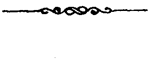|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
 Die Freiämtler sind von jeher gewesen, wofür sie mit Recht heute noch gelten, nämlich ein spekulatives, kluges Völklein, das sich in günstigen Zeitumständen auf seinen Vortheil versteht, in schlimmen aber den Schaden zu wenden weiß. Wie dieses Völklein heutzutage aus leerem Stroh blanke Dukaten prägt und seine unansehnlichen Bauernhäuser in wahre Paläste umwandelt, ist weltbekannt – sind ja die Wohlener Strohbänder und Schnürchen eine theure und gesuchte Waare selbst jenseits der Meere. Weniger bekannt ist, welche Bewandtniß es mit dem Schadenwenden und Salviren in schlimmen Zeiten hat. Oder wer weiß z. B., wie sich die Freiämtler im Kriege zwischen den katholischen Orten und Bern von 1712 durchhalfen? – Damals kalkulirten die Katholischen: die Freiämtler sind, als unsere Glaubensgenossen, auch unsere natürlichen Vorposten gegen das reformirte Bernbiet; wir müssen uns daher ihrer Treue und Wachsamkeit versichern. Zu diesem Zwecke schickten sie eine ansehnliche Deputatschaft in's Freiamt, welche die Leute über ihre wichtige Aufgabe aufklären und sie in Eid und Pflicht nehmen sollte. Die Ausgeschossenen des Ländchens hörten die Botschaft der gnädigen Herren und Obern von Luzern mit geziemendem Ernste an und zogen sich dann zurück zu gemeinsamer
Berathung. Nachdem sie das Für und Gegen geprüft und abgewogen, traten sie wieder vor die hohe Gesandtschaft der fünf Orte und ihr Obmann erklärte im Namen Aller laut und feierlich: »Wenn die Berner chömmit, so schüßit mer nit; wenn sie aber nit chömmit, so wend mer Standare halte.« Die gnädigen Herren von Luzern hatten gut auf eine andere Antwort dringen; die Freiämtler behaupteten, daß sie ihres Landes Wohl und Weh richtig in's Auge gefaßt, und dabei blieb es. –
Die Freiämtler sind von jeher gewesen, wofür sie mit Recht heute noch gelten, nämlich ein spekulatives, kluges Völklein, das sich in günstigen Zeitumständen auf seinen Vortheil versteht, in schlimmen aber den Schaden zu wenden weiß. Wie dieses Völklein heutzutage aus leerem Stroh blanke Dukaten prägt und seine unansehnlichen Bauernhäuser in wahre Paläste umwandelt, ist weltbekannt – sind ja die Wohlener Strohbänder und Schnürchen eine theure und gesuchte Waare selbst jenseits der Meere. Weniger bekannt ist, welche Bewandtniß es mit dem Schadenwenden und Salviren in schlimmen Zeiten hat. Oder wer weiß z. B., wie sich die Freiämtler im Kriege zwischen den katholischen Orten und Bern von 1712 durchhalfen? – Damals kalkulirten die Katholischen: die Freiämtler sind, als unsere Glaubensgenossen, auch unsere natürlichen Vorposten gegen das reformirte Bernbiet; wir müssen uns daher ihrer Treue und Wachsamkeit versichern. Zu diesem Zwecke schickten sie eine ansehnliche Deputatschaft in's Freiamt, welche die Leute über ihre wichtige Aufgabe aufklären und sie in Eid und Pflicht nehmen sollte. Die Ausgeschossenen des Ländchens hörten die Botschaft der gnädigen Herren und Obern von Luzern mit geziemendem Ernste an und zogen sich dann zurück zu gemeinsamer
Berathung. Nachdem sie das Für und Gegen geprüft und abgewogen, traten sie wieder vor die hohe Gesandtschaft der fünf Orte und ihr Obmann erklärte im Namen Aller laut und feierlich: »Wenn die Berner chömmit, so schüßit mer nit; wenn sie aber nit chömmit, so wend mer Standare halte.« Die gnädigen Herren von Luzern hatten gut auf eine andere Antwort dringen; die Freiämtler behaupteten, daß sie ihres Landes Wohl und Weh richtig in's Auge gefaßt, und dabei blieb es. –
Die diplomatische Klugheit, die diesen Beschluß diktirt, ist keineswegs mit dem Geschlechte von 1712 ausgestorben, sondern hat sich unverkümmert auf Söhne und Enkel fortgeerbt. Das zeigte sich beinahe ein Jahrhundert später, im Jahre 1799.
Damals sah es betrübt und bedenklich aus im Vaterlande und es war wohl nöthig, daß der gemeine Mann oft mehr Klugheit zeigte, als Diejenigen, die ihm zu Regenten gesetzt waren. Die eigentlichen Regenten indessen waren die Franzosen oder ihre im Lande kommandirenden Generale, und die einheimischen Herren, welche blos dem Namen nach regierten, konnten selbst zusehen, daß sie nicht irgendwo am unrechten Orte ein mißbeliebiges Wörtlein sprachen, oder am rechten einen Bückling vergaßen. Schlimmer wurde es noch, als der Franzos selbst nicht mehr alleiniger Regent blieb und vom Bodensee her Oesterreicher und Russen heranrückten, die an der Regierung des unglücklichen Landes ebenfalls ihr Theil haben wollten. Die Franzosen mußten sich vor dem mächtigen Anpralle des Gegners zurückziehen, und so standen bald auf dem rechten Ufer des Wallensee's, die Linth, den Zürichsee, die Limmat und Aare herab die Oesterreicher und Russen, die Söhne der großen Nation auf dem andern Ufer. In der Stadt Zürich eilten die Kosaken auf ihren flinken Rößlein die steile Münstertreppe auf und nieder und streckten Kalmüken ihre Lanzenspitzen nach den Fenstern empor, in der Meinung, man solle ihnen ein Stück Brod daran stecken, während die französischen Grenadiere auf der Höhe des Uetliberges singend und kauderwelschend um das Wachtfeuer saßen, an dem sie ein »requirirtes« Schaf brieten.
Dem französischen Obergeneral Massena, der damals im Städtchen Bremgarten sein Hauptquartier hatte, gefiel indessen das Schweizerländchen viel zu gut, als daß er Willens gewesen wäre, dasselbe mit dem Oesterreicher und Russen zu theilen; auch war er nicht der Mann, der einen empfangenen Schlag lange unerwidert gelassen hätte. Man konnte daher diesseits des Uetliberges bald merken, daß es sich um die Vorbereitungen zu einer großen Entscheidungsschlacht handle. Von Genf und andern französischen Grenzorten zogen auf allen Straßen zahlreiche Hülfsschaaren zu dem an der untern Aare und zwischen Reuß und Limmat liegenden fränkischen Heere heran, freilich meistens blutjunge, bartlose Leute, die noch nie Pulver gerochen und nun marschirend auf den Straßen und den großen Dorfplätzen einexerzirt wurden; aber trotz Unerfahrenheit und Jugend waren sie voller Zuversicht, da Massena, der Liebling der Siegesgöttin, wie ihn Bonaparte genannt, an der Spitze des Heeres stand. Nach der Mitte des Septembers sah man auch große Wagenzüge, mit Schiffen beladen, gegen das Freiamt zuführen, die an der Aare aufwärts bis an den Bieler- und Neuenburgersee zusammengesucht worden waren. Ueber dem ganzen Lande lagen Angst und bange Erwartung.
Einer dieser mit Schiffen beladenen Wagenzüge machte Halt in dem kleinen Freiämtler Dorfe Bünzen, das etwa zwei Stunden von Bremgarten, dem damaligen französischen Hauptquartiere, entfernt, an der Bünz liegt, einem ziemlich großen Bache, der zur Regenzeit oft mächtig anzuschwellen vermag. Die Pontons wurden abgeladen, in den Bach gebracht und da an großen Pflöcken festgebunden. Die Bünzener betrachteten das Schauspiel mit erschrockener Verwunderung. So lange die Bünz das Thal herabfloß, hatte ihr Wasser noch nie ein Schifflein gesehen, außer etwa, es hätte sich ein erfinderischer Junge ein solches aus Dachschindeln zum Spielzeuge erbaut; was sollten nun plötzlich die zahlreichen und großen Fahrzeuge zu bedeuten haben? – Diese Frage beantwortete den geängstigten Dorfbewohnern der alte Nachtwächter, der Holländer-Steffen, der mehr als zwanzig Jahre in holländischen Diensten verlebt hatte und daher seinen Namen trug. »Was das heißen soll,« sagte er ernst, » mille tonnerre – die Franzosen wollen eine Schiffbrücke über die Bünz schlagen, weil sie daherum eine Schlacht zu liefern gedenken. Parbleu – da bin ich schon mehr dabei gewesen. Die Schiffbrücken schlägt man zum Avanciren und Retiriren; aber drum herum geht's immer am blutigsten her. Mille tonnerre, das muß ich am besten wissen.«
Diese Auskunft des alten Kriegsmannes verbreitete im Dörfchen Jammer und unsägliche Bestürzung. Wußten doch die Alten, wenn auch nur vom Hörensagen, noch genug zu erzählen, wie es damals hergegangen, als die Ländler und Berner vor neunzig Jahren drüben auf der Langelen sich geschlagen hatten. Die flüchtigen Katholischen konnten sich nicht über die angeschwollene Bünz retten und mußten ihren Rückweg durch das Dörfchen nehmen; aber die welschen Berner Dragoner folgten ihnen auf dem Fuße und hieben nieder, was sie mit den langen Pallaschen erreichen konnten. Als einige der Flüchtigen, hinter Häusern versteckt, hervorschossen, stand in wenigen Augenblicken das halbe Dörfchen in Flammen, und als der Kampf vorbeigetobt war, lag neben den rauchenden Feuerstätten mancher Bünzener in dem festen Schlafe, von dem Keiner wieder aufwacht. Barmherziger Himmel – wie sollt' es nun erst werden, wenn sich da Franzosen und wilde Russen herumschlugen? – Der junge Kaplan suchte zwar den Wehklagenden nach Kräften Trost einzureden. Eine Schlacht werde hier sicherlich nicht geschlagen, sondern da, wo sich die Feinde gegenüberstünden, also drüben im Limmatthale, etwa bei Zürich, oder vielleicht auch drunten an der Aare bei Windisch, und die Schiffe würden schon wieder aus der Bünz verschwinden, wenn es an der Zeit sei. Aber der gute Mann kam übel an mit seiner Weisheit. Was der Bücherwurm von solchen Dingen verstehen sollte, brummte der Holländer-Steffen, in seinem militärischen Ehrgefühl verletzt, und die heulenden Weiber sekundirten ihm nach Kräften. Der Kaplan habe gut reden, schrien sie, er müsse weder für Vieh noch Kind Kummer tragen und könne den Staub von den Füßen schütteln, wenn es zum Fehlen gehe. – Die Männer waren gleichfalls dieser Meinung, und selbst der alte Schulmeister, das herkömmliche Orakel des Dorfes, gab seine Ansicht dahin ab: die Langelen habe es in sich. Es sei nun schon zweimal auf derselben geschlagen worden, und was sich gezweiet, werde sich dritten müssen. Gott möge sich der armen Unschuldigen erbarmen. –
Es ist immer ein großes Glück, wenn der Hirte unerschrockener Klugheit bleibt, wo der Wolf mit schreckenvoller Verwirrung in die Heerde fährt. Das konnten jetzt auch die Bünzener erfahren, die einen klugen und umsichtigen Gemeindevorsteher hatten. War dieser der reichste Mann im Dorfe, so war er auch der Gescheiteste, wie sich das von selbst versteht, und hieß nicht umsonst Peterli Wohlrath. Er ließ daher noch am selben Abend die Bürgerversammlung einberufen, um die ernste Lage des Vaterlandes in gemeinsame Berathung zu ziehen. Die bloße Einladung zu dieser Versammlung, die der Holländer-Steffen kraft seines Amtes im Dorfe herumtrug, war hinreichend, in manchem bekümmerten Herzen ein Lichtlein des Trostes aufzustecken. Es ging wie eine Ahnung durch die bangen Gemüther, der würdige Ortsvorsteher möchte einen Weg entdeckt haben, der aus der drohenden Noth zur Rettung führe.
Und diese Ahnung sollte auch nicht getäuscht werden. Peterli Wohlrath sprach zu den versammelten Bürgern, zwischen die sich ängstliche Weiber und Kinder hereingedrängt hatten, mit beweglichen Worten von der Gefahr, die dem Dorfe drohe. Mit allen Sachverständigen sei er selbst der Meinung, daß eine große Schlacht bevorstehe und dieselbe hier in Bünzen geschlagen würde, wie leider die in der Bünz befindlichen Schiffe zur Genüge ersehen ließen. In diesem traurigen Falle sei nur zu gewiß zu erwarten, daß kein Stein des Dorfes auf dem andern bleiben werde.
Diese aus so klugem und offiziellem Munde kommende Bestätigung der schon herrschenden Befürchtungen konnte natürlich ihren Eindruck nicht verfehlen; aber als wohlberechnender Redner machte Peterli Wohlrath eine lange Pause, um seine Worte in ihrer ganzen Wirkung austönen zu lassen. Die Versammlung erscholl von Jammer und Wehklage, bis endlich eine Stimme rief: »Jesus Maria, Herr Ammann, Ihr werdet doch das Unglück nicht geschehen lassen.«
Der also Angerufene erhob langsam das Haupt und begann wieder in bedächtigem Tone: »Ja, das allerdings ist auch meine Meinung, wir dürfen das Unglück nicht geschehen lassen; aber wie es verhindern, ist eine andere inhaltsschwere Frage.« – Der Redner machte abermals eine Pause. Alle Köpfe streckten sich neugierig und erwartungsvoll empor und durch die ganze Versammlung summte es: »Ja – wie ist das zu machen!« – »Ich glaube ein Mittel gefunden zu haben,« fuhr der würdige Vorsteher nach einer Pause fort – »wir schicken eine Deputatz an den Obergeneral und ersuchen ihn, seine Schlacht an einem andern Orte zu schlagen. Das ist meine Meinung.« – Die hoch emporgereckten Köpfe sanken wieder zurück, um sich gegenseitig mit staunender Verwunderung anzuschauen.
Ja, das war es; – mit einem einzigen Worte war das Errettungsmittel genannt, so klar und einfach, und doch war's vorher Keinem eingefallen. Nach dem ersten Schweigen der Verwunderung über die eigene Einfalt und der Bewunderung der ortsvorsteherischen Weisheit machte sich das dankbare Gefühl in einem lauten und allgemeinen Beifallrufen Luft und nach wenigen Minuten waren der Ammann und der alte Schulmeister mit der Ehre beauftragt, dem General Massena den nöthigen Staatsbesuch zu machen. –
In der ersten Dämmerung des folgenden Morgens war vor dem Hause Peterli Wohlraths schon das ganze Dorf versammelt, um den beiden Ehrengesandten noch die letzten Glückwünsche mit auf den Weg zu geben, und diese schritten denn auch bald im vollen Bewußtsein ihrer Würde und hohen Aufgabe auf der Straße nach Bremgarten hin. Der Ammann trug in einem Quersacke zwei sehr respektable Schinken, die bisher vor den Luchsaugen der Requisition gerettet worden waren, über die Schulter, während der Schulmeister in einem saubern Wattsäcklein ein Quantum der auserlesensten gedörrten Birnenschnitze nachbündelte. Das waren, wie man sich noch allzuwohl aus den kaum vergangenen Landvogtszeiten erinnerte, sehr probate Mittel zur Erreichung hoher Staatszwecke. Die weitern Mittel jedoch zu dem diesmal beabsichtigten Ziele machten den beiden Männern mit jedem Schritte vorwärts größeres Kopfzerbrechen, und kaum eine Viertelstunde außerhalb des Dorfes war der sonst ehrgeizige Ammann schon halbwegs bereit, dem Schulmeister die Ehre des Sprechers vor dem Obergeneral mit allen Folgen abzutreten. Der Schulmeister sträubte sich mit der seiner Stellung angemessenen Bescheidenheit dagegen, und die beiden Gesandten werweiseten immer lauter darüber hin und her, bis sie durch rasche hinter ihnen herkommende Schritte unterbrochen wurden. Ihr anfängliches Erschrecken war jedoch überflüssig gewesen. Es war nur der Holländer-Stöffele, des Holländer-Steffen zwölf- bis vierzehnjähriger Sprößling, der aus dem dämmernden Nebel heraustrat. »Was thust du schon da draußen?« fragte der Schulmeister, seinen Dreiröhrenhut fester andrückend, den Knaben.
»Nichts für ungut,« antwortete dieser mit einem hellen Aufleuchten der klugen braunen Augen, »ich möchte mit euch nach Bremgarten – ich möcht' den Obergeneral einmal sehen.«
»Was, du Hudelbub?« rief der erste Ehrengesandte ärgerlich, »pack' dich auf der Stell' wieder heim, wenn du nicht da von dieser Kirschensuppe zum Imbiß willst.« Dabei hob er auf eine eben nicht einladende Weise seinen knotigen Marktstecken empor. Der Knabe wich rasch einige Schritte zurück und besann sich einen Augenblick. »Hört,« sagte er dann unterwürfig, »laßt mich nur mitgehen, Herr Ammann; ich will Euch bis Bremgarten den schweren Sack tragen und dann kann ich ja etwa auf der Brücke warten, bis der General einmal vorbeireitet.«
Dieser allerdings annehmbare Antrag stimmte den Stolz des Dorffürsten schon etwas gnädiger und der zweite Ehrengesandte kam dieser Gefühlsänderung rasch zu Hülfe. Derselbe hatte nämlich alsbald überlegt, daß ihn die Anwesenheit des Knaben von dem bereits unbequemen Gespräche über die Sprecherwürde befreien könnte, und er sagte deshalb: »Wer weiß, Herr Ammann, der Bube hat ein flinkes Maul und von den Soldaten schon allerlei welsche Brocken aufgeschnappt; vielleicht könnt' er uns bei den Posten oder sonst dienlich sein. Auf der Straße kann er ja immer mitgehen.«
Der erste Ehrengesandte fand gegen dieses Argument keine stichhaltige Einwendung. Nachdem er seinen Quersack von der Schulter genommen und denselben dem Knaben aufgehalst hatte, setzte sich der Zug wieder in Bewegung, voran mit bedächtigen Schritten und noch bedenklichern Gesichtern die beiden Männer, die Dreiröhrenhüte trotz des kühlen Herbstmorgens oft von der Stirne nehmend; hintendrein leichtfüßig der Junge, der trotz des schweren Quersackes nicht unterlassen konnte, seinem frohen Muthe dann und wann durch einen Seitensprung Luft zu machen.
Der Tag war kaum vollständig angebrochen, als die wunderliche Gesandtschaft aus dem Walde hervor gegen Bremgarten herabzog. Der Morgennebel lag noch fest auf den Krümmungen der Reuß zusammengegürtet, kaum von den ersten Sonnenstrahlen übergossen, oder spielte in leichtern Wölklein um die Thürme und Spitzgiebel des alten Klosterstädtchens; aber in den engen Straßen desselben rauschte und toste schon ein Leben, als ob da nie an eine Nachtruhe gedacht worden wäre. Ueber die hölzerne Reußbrücke sprengten zu und ab rothbuschige Reiter, daß das alte Fugenwerk bis in den Grund des Wassers hinab erdröhnte; weiterhin in der Straße wimmelte bärenmütziges Fußvolk durch einander, und vor dem Gasthofe zum Hirschen gar, wo der Obergeneral wohnte, summte es wie ein Bienenschwarm. Heransprengende Reiter ließen ihre dampfenden Rosse einfach auf der Straße stehen und eilten, unbekümmert um die Thiere, die steinernen Stufen hinan, die zur Hauptthüre führten; aus dieser hingegen kamen ebenso eilfertig andere bärtige Gesichter in prächtigen Uniformen, die sich auf das nächste beste Rößlein warfen und davongaloppirten. Unsere Gesandten, die sich mühsam bis hieher durchgearbeitet, standen mit ihren Hüten in der Hand angstvoll in dem Gewirre, jeden Augenblick in Gefahr, von einem Hufe getreten oder überritten zu werden, ohne zu wissen, an wen sie sich in diesem welschenden Haufen um Rath und Beistand wenden sollten. Kein Mensch mochte sie nur eines Blickes würdigen, mit wie bangfragendem Gesichte sie auch an Diesem oder Jenem emporschauten. »Ihr werdet sehen,« sagte der Schulmeister leise zu seinem Mitgesandten, »die Schlacht geht schon diesen Morgen an und wenn wir heimkommen, ist Alles vorüber – daß Gott erbarm'.« – »Das könnt' wohl sein,« erwiderte der Ammann, den Schweiß mit dem Rockärmel von der Stirne wischend; »wenn wir nur bei'm General wären – die Red' wollt' ich am Ende selbst halten.« – »Ja, aber der Kerl da droben an der Thür läßt uns sicherlich nicht hinein,« seufzte der Schulmeister, »mir ist's, ich seh' noch Blut an seinem langen Säbel.« – »Das mein' ich auch,« gab der Ammann kläglich zurück – »aber wie es immer geh', Ihr seid mir vor der Gemeinde Zeuge, daß ich meine Pflicht gethan habe – Schulmeister.«
In diesem Augenblick ließ Stöffele, der bisher ruhig hinter den beiden Gesandten gestanden, seinen Zwerchsack auf den Boden fallen und drängte sich mit einem lauten »Der Kapitän, der Kapitän, der so lange im Dorfe gewesen ist« – der Treppe zu. Die beiden Männer schauten ihrem bisher ganz vergessenen Begleiter verwundert nach, der in flinkem Sprunge droben an der Thüre neben einem jungen, hochgewachsenen Offiziere stand. Ihr Erstaunen wurde nicht vermindert, als sie sahen, wie Stöffele den Militär frisch anredete und nach wenigen Worten von diesem lächelnd an dem grimmig aussehenden Posten vorüber in's Haus geführt wurde.
»Das ist ein Teufelsbub,« brachte endlich der erste Gesandte stoßweise hervor, »am Ende macht der die ganze Gesandtschaft allein ab.«
»Wenn's nur hilft,« meinte der Schulmeister zaghaft, »mir wär's einerlei.«
Der Ammann, dessen Ehrgeiz sich bei dem Gedanken, so schmählich um den Erfolg seiner Rathschläge betrogen zu werden, wieder zu regen anfing, würde sich wahrscheinlich mit der Demuth seines Kollegen nicht einverstanden erklärt haben; aber während er in rathloser Verwirrung noch hin und her dachte, erschien auch Stöffele in Begleit des Offiziers schon wieder unter der Hausthüre. Mit leuchtenden Augen kam er die steinerne Treppe herabgesprungen und rief seinen Begleitern zu: »Kommt, kommt schnell, der Obergeneral hat jetzt einen Augenblick Zeit und will euch anhören.« Der unter der Thüre stehen gebliebene Offizier machte ebenfalls eine rasch heranwinkende Handbewegung. Der erste Gesandte faßte seinen Zwerchsack in beide Hände, der zweite stieß einige unverständliche Worte hervor, die wie ein klagender Anlauf zu einem Gebete klangen, und dann ging's wie im Traume die Stufen hinan, an dem wildaussehenden Posten vorüber den Gang entlang, bis der Offizier eine Thüre öffnete und seine Begleiter halb hineinschiebend mit tiefer Stimme sagte: »Der Obergeneral.«
Das Wort klang wie ein dröhnender Glockenschlag an die von innerer Aufregung und dem eben durchlebten Waffengetöse betäubten Ohren; aber den Abgesandten wurde doch alsbald leichter zu Muthe, als sie die Augen aufschlugen und sich in einer von frühern Markt- und Kirchweihtagen her wohlbekannten Stube befanden. Wie oft hatten sie in jener Ecke mit fröhlichen Bekannten einen Schoppen getrunken oder waren in jüngern Jahren durch diese Thüre mit schäkernden Mädchen nach der Tanzstube hinübergegangen! Freilich sah der Raum jetzt etwas verändert aus; statt der schönen Heiligenbilder, die ehemals an den Wänden hingen, waren da nun große Papiere festgenagelt, auf denen sich allerlei schwarze oder buntbemalte Striche wunderlich genug durch einander kreuzten, auf dem Tische lagen ebenfalls große Papierhaufen, und auf dem kleinen Tische, der unter dem Spiegel stand, blinkten neben einigen Pistolen sogar Säbelklingen hervor. Aber gleichwohl war's den beiden Männern wie auf einen Schlag leichter um's Herz geworden, sie befanden sich auf wohlbekanntem Boden, der fest unter ihren Füßen stand. Und der Obergeneral selbst – anderswo hätten sie's keinem Menschen geglaubt, daß das der gefürchtete Massena wäre, bei dessen bloßem Namen die trotzigsten Soldaten mit unwillkürlichem Respekte an die Mütze langten. Sie hatten ihn die letzte Zeit über wohl schon etwa gesehen; aber immer nur von einer Schaar hoher Offiziere oder den gefürchteten rothen Husaren umgeben, deren wallende Roßhaarschweife noch lange sichtbar durch die Staubwolke flatterten, die sich in ihrem wilden Begleite über die Straße dahinwälzte. Jetzt stand hinter dem papierbedeckten Tische ein mittelgroßer, dunkelhaariger Mann, ohne Bart noch Kopfbedeckung, in einen weiten Schlafrock gehüllt. Unser Kaplan hat einen schönern, mußten Ammann und Schulmeister beim ersten Anblick denken. Als er auf die tiefen Bücklinge der Eingetretenen mit einem leichten Kopfnicken gegrüßt, warf er seine dunkeln Augen nach Stöffele. Er griff nach einem Teller, auf dem die prächtigsten Aepfel und Birnen lagen, hob ein Stück in der rechten Hand empor und rief: »Nun, kleiner Schelm, kannst du das fangen?« Damit warf er eine Birne in hohem Bogen über den Tisch herüber und richtig – Stöffele hatte sie wie eine flinke Katze mit den Händen aufgefangen. Der General lachte, nahm eine andere Birne, that einen herzhaften Biß darein und nickte dem Jungen zu: »Sie sind gut, probier's nur.«
Diese unerwartete Aufnahme half dem Muthe der Abgeordneten vollends auf die Füße und der Ammann machte dem Schulmeister bereits durch einen wohlgemuthen Rippenstoß bemerklich, daß er auch seine Rede wieder vollständig im Reinen habe, als der General, eine zweite Birne ergreifend, sagte: »Nun, ihr guten Leute, was wollt ihr von mir?«
Diese Ansprache brachte den gesandtschaftlichen Redner in einige Verwirrung; sie paßte so ganz und gar nicht zu dem Kunstwerke, das er sich in Gedanken zusammengesetzt, und er nahte sich daher seinem Nebenmanne mit einem etwas höflichern Ellbogengruße als vorhin. Es war nur die dringende Bitte um das Zuflüstern einiger passender Anfangsworte. Aber der Schulmeister, dem der Muth ebenfalls gewachsen, und der sich durch die Frage des Generals in keinem Concepte gestört fand, mißverstand diese Bitte; er begann sich deshalb unter leisem Räuspern die Hände zu reiben und hob alsdann selbsten an: »Herr Oberster und General, Herr Obergeneral vielmehr – es handelt sich von wegen der vorhabenden Schlacht und der Schiffbruck –«
Bei diesem gelungenen Anfange blieb die Rede plötzlich stecken und der Redner stolperte entsetzt über sein Schnitzsäcklein zurück, das er in anfänglichem Eifer zwischen die Füße gestellt hatte. Es war sich just auch nicht zu wundern; und der Ammann und selbst der kecke Stöffele sahen erschreckt nach dem General hinüber. Denn kaum hatte der Schulmeister mit nachdrücklicher Betonung das Wort »Schiffbruck« ausgesprochen, als des Feldherrn bisher so freundliches Gesicht wie eine vom Blitze durchfurchte, dunkle Wetterwolke aufleuchtete und er mit einem lauten Sacredieu einen weiten Sprung in die Stube that.
»Was weißt du von einer Schiffbrücke,« rief er, hart an den Schulmeister herantretend, »wo soll es eine solche geben? wer hat dir davon gesagt – Mann?«
Aber der so barsch Gefragte war nicht im Stande, eine Antwort zu geben; er deutete, einen kleinen Schritt nach dem andern zurückweichend, nur mit dem Finger auf seinen Amtsgenossen.
»Nun?« – fragte der General, sein Gesicht hastig dem Ammann zuwendend.
Dieser mochte empfinden, daß der entscheidende Augenblick gekommen war; aber da ihm seine Rede nun vollends verloren gegangen, erhob er ebenfalls die Hand und brachte, auf Stöffele deutend, mühsam die Worte hervor: »Der Vater des Jungen hat's gesagt – der weiß es am Besten.« Ueber das Gesicht des Feldherrn glitt wieder ein Lächeln, als er einen Augenblick die erschrockenen Männer betrachtet. Dann kehrte er sich zu Stöffele und fragte: »Nun, Kleiner, was hat dein Vater gesagt – was weißt du von einer Schiffbrücke?«
Der Kleine erhob den schwarzen Krauskopf, dem Feldherrn frisch in's Gesicht schauend. »Ja, seht, Herr General, die Sache ist so. Gestern haben Eure Soldaten mächtig große Schiffe zu uns nach Bünzen gebracht und sie dann in der Bünz festgebunden; da sagte mein Vater, Ihr wolltet da über den Bach eine Schiffbrücke schlagen und dabei dem Russen eine Schlacht liefern, wobei unser ganzes Dorf verbrannt und zusammengeschossen werde.«
»Und deshalb sollen wir den gnädigen Herrn General im Namen unserer Gemeinde um Gottes und der Heiligen Barmherzigkeit willen bitten, die Schlacht an einem andern Orte zu schlagen,« fiel der erste Gesandte mit kläglicher Stimme ein.
Der General warf einen raschen Blick auf die an der Wand hängende Karte und brach dann in ein schallendes Gelächter aus; dabei fuhr er mit beiden Händen dem Knaben nach dem Kopfe und krabbelte mit den Fingern kosend in den krausen Haaren herum. Aber plötzlich hielt er wieder inne und schien einen Augenblick in ernstes Nachdenken verloren.
»Was ist dein Vater, Kleiner?« fragte er alsdann Stöffele in das Gesicht schauend.
»Er ist Nachtwächter daheim,« erwiderte der Knabe.
»So, so; hast du noch mehr Geschwister?«
»Noch sechs, Herr General.«
»Sieben also; aber wie viel Kühe habt ihr im Stalle?«
»Oh,« fiel der erste Gesandte, der über der Heiterkeit des Feldherrn sein Fahrwasser wiedergefunden hatte, räuspernd ein, »das sind die ärmsten Leute in unserm Dorfe; sie haben nur zwei Ziegen und müssen wohl manchmal von der Gemeinde unterstützt werden.«
»Wie viel Stück Vieh besitzt denn Ihr?« fragte der General nach dem Sprecher blickend.
»Je nachdem,« erwiderte Peterli Wohlrath, indem er sich ein wenig höher hob, »fünfzehn bis zwanzig – unterschiedlich.«
»Warum ist denn der Vater des Kleinen da so arm? Taugt er nichts?«
Der zweite Gesandte hielt diese Gelegenheit passend, sich in der Gunst des Feldherrn wieder rehabilitiren zu können. Er sagte daher, mit einem Bückling beginnend: »Das just nicht, gnädiger Herr Obergeneral; er war über zwanzig Jahre Soldat in Holland, und die alten Soldaten sind immer arme Schlucker.«
Der Feldherr wendete sich mit einem scharfen Blinzeln seiner dunkeln Augen wieder dem Knaben zu. »So, Kleiner,« sagte er, ihm mit der Hand über die braune Wange streichelnd, »du bist ein Soldatenkind – hab' ich mir's doch gleich gedacht. Aber sag', möchtest du nicht auch ein Soldat werden?«
Stöffele schüttelte mit dem Kopfe. »Nein, Herr General, ich möchte ein Doktor werden.«
»So, ein Doktor – und warum denn das?«
»Ja, seht, Herr General,« erwiderte der Knabe, seine braunen Augen aufschlagend, »als im Sommer so viele verwundete Soldaten die Straße nach Lenzburg hinabgeführt wurden und sie manchmal so elend nach einem Doktor schrien, da hab' ich mir gedacht, das wär' doch das Schönste, ein Doktor zu sein, um den armen Leuten helfen zu können.«
Der General legte die Hand an die Stirn und begann in langen Schritten die Stube auf und nieder zu gehen. Plötzlich blieb er vor den erwartungsvollen Abgeordneten stehen und sagte mit ernstem Gesichte: »Was euer Anliegen betrifft, da ist schwer zu helfen. Allerdings sind die Vorbereitungen mitten in euerm Dorfe zu einer Schiffbrücke getroffen, um daselbst eine Schlacht zu schlagen. Am Besten, ihr zieht sogleich mit Weib und Kind weg; ist die Schlacht vorbei und das Dorf zusammengeschossen, so könnt ihr dann ein neues aufbauen.«
Diese mit eiskaltem Ernst gesprochenen Worte fielen wie ein Donnerschlag auf die bereits erstarkenden Hoffnungen der Abgeordneten. Der Schulmeister stieß einen tiefen Seufzer aus, während der Ammann sich mechanisch niederbückte, um seinen Zwerchsack zu öffnen. Der General, der die Absicht dieser Bewegung errathen mochte, machte eine abwehrende Handbewegung und fuhr nach einem dumpfen Schweigen wieder fort: »Ihr dauert mich, aber meine Pflicht ist streng. Es gäbe vielleicht ein einziges Hülfsmittel. Eure Gemeinde bezahlt mir 3000 Kronen an die Kosten, die ich bereits zur Herschaffung der Schiffe nach Bünzen gehabt; aber wohlverstanden, freiwillig und nicht als Kontribution. Dann will ich sehen, wie ich's vor der Regierung verantworte und ein anderes Schlachtfeld aufsuchen. Bis heute Abend muß ich jedoch Geld oder gute Gülten in Händen haben.«
Die Abgeordneten hatten diesen Vorschlag mit athemloser Angst angehört. Mit demselben war ihnen die schwerste Last vom Herzen genommen; aber Peterli Wohlrath begriff sogleich, daß es sich nun darum handle, die minderschwere noch möglichst zu erleichtern. Seinen Zwerchsack wagte er nicht mehr aufzuheben; dagegen fing er mit etwas kläglicher Stimme an: »Dreitausend Kronen für eine arme Gemeinde –«
Der General zog eine große goldene Uhr hervor und ließ sie durch einen Fingerdruck anschlagen. »Es ist jetzt 9 Uhr,« sagte er streng. »Bis Abends 6 Uhr habt ihr Zeit. Nachher ist's zu spät.«
Er zog an einer Klingel und sogleich trat ein Offizier herein. »Zwei Grenadiere begleiten diese Leute nach Bünzen, um bald möglichst Rapport zu erstatten.« Der Offizier öffnete die Thüre und die Gesandten standen wieder ebenso rasch draußen auf der Straße, als sie hineingetreten waren. Stöffele kam erst einige Augenblicke hintendrein gesprungen. »Seht, das hat mir der brave General für meinen Vater gegeben,« rief er, seinen Begleitern die nur leise geöffnete Hand entgegenstreckend, zwischen deren kleinen Fingern ein glänzendes Goldstück hervorblinkte. Alsbald traten zwei Grenadiere heran, und marsch ging's über die Brücke hinaus die Straße nach Bünzen zu. –
Die daheimgebliebenen Bünzener, die den Vormittag in banger Erwartung durchlebt hatten, saßen noch nicht beim Mittagessen, als der Holländer-Steffen den sofortigen Zusammentritt der Gemeinde durch einen Hornruf im Dorfe herum verkündigte, wie dies in dringendsten Fällen bisweilen zu geschehen pflegte. Die Männer liefen spornstreichs dem Gemeindehause zu, und noch war in manchem Topfe nicht fertig gekocht, als sie den bangen Frauen die Nachricht heimbrachten: »Gottlob, nun wird hier nicht geschlagen – wir haben uns um 3000 Kronen von dem Unglücke losgekauft. Ja, der Peterli Wohlrath ist doch ein Mann – wenn wir den nicht hätten!« –
Waren die Bünzener prompt, so war's General Massena nicht minder. Kaum hatte sich die Sonne auf den Wald geneigt, zog von einer Husarenabtheilung begleitet ein langer Wagenzug in's Dorf. Die Schiffe wurden wieder aus der Bünz gehoben, aufgeladen, und fort ging es auf der Straße nach Bremgarten.
Die Dorfbewohner schickten sich zu einem ruhigern Schlafe an, als die vergangene Nacht; aber noch lagen sie in tiefen Träumen, als sie von einem tosenden Donner aufgeschreckt wurden, der über den Bremgartner Berg herüberscholl. Er dauerte in ununterbrochener Heftigkeit den ganzen Morgen fort, und am Nachmittage hieß es, die Franzosen hätten in der Nacht drüben bei Dietikon eine Schiffbrücke über die Limmat geschlagen und die Russen dort und bei Zürich angegriffen. Das ganze Dorf war freudig und bewundernd einverstanden, als Peterli Wohlrath mit nachdenklichem Gesichte sagte: »Was der Massena für ein Mann ist! handkehrum verlegt er die Schlacht von der Bünz mehr als vier Stunden weit über den Berg weg an die Limmat hinüber. Aber wer ist schuld daran?«
Nachdem diese Schlacht den ganzen Tag gedauert und noch am folgenden Morgen ferner Kanonendonner über den Berg her grollte, kam gegen Abend der Bericht, die Russen seien total auf's Haupt geschlagen, die Franzosen verfolgen sie auf der Straße nach Eglisau und Schaffhausen hin und der General Massena habe sein Quartier bereits wieder in Zürich aufgeschlagen.
Jetzt hintendrein, da alle Gefahr vorüber war, stellten sich allmälig mehrere Bünzener auf die Seite des Kaplans, der fortwährend behauptete: Massena habe nie daran gedacht, weder über die Bünz eine Schiffbrücke zu bauen, noch hier eine Schlacht zu schlagen, aus dem einfachen Grunde, weil hier keine Feinde gewesen wären, sondern blos drüben an der Limmat. Die Schiffe seien auch nur in die Bünz gebracht worden, damit sie nach dem langen Landtransport wieder wasserdicht und für den Gebrauch tauglich werden. Diese Ansicht gewann sogar die Oberhand, als man vernahm, daß schon mehrere Tage vor dem Bünzener Schrecken der ganzen Reuß entlang, von Dietwyl bis nach Mellingen hinunter solche Schiffstransporte angelangt und in's Wasser gestoßen, aber fast zu gleicher Zeit wie in Bünzen wieder abgeholt worden waren.
Das Alles jedoch focht am wenigsten den Holländer-Steffen an, obwohl ihm auch mancher Seitenhieb über seine militärische Prophezeiung zugemünzt wurde. Wenige Tage nach der Schlacht war er mit Stöffele vor das Statthalteramt nach Bremgarten zitirt und ihm dort unter einem mit Freudenthränen und sattsamen milletonnerres gewürzten Erstaunen tausend blanke Kronen eingehändigt worden, »als ein Geschenk des Obergenerals Massena.« Eine weitere Eröffnung ging dahin, von demselben General seien dem bekannten und hochgeschätzten Doktor Weißenbach in Bremgarten zweitausend Kronen übergeben worden, der sich dagegen verpflichtet und versprochen, für Stöffele's Heranbildung zum Arzte zu sorgen. Was der Doktor nun vor der Hand beabsichtige, das könnten Vater und Söhnchen bei ihm selbst in Erfahrung bringen.
Das geschah denn auch. Stöffele zog gleich am folgenden Tage nach Bremgarten, um dort zunächst die Lateinschule zu besuchen. –
Der zum tüchtigen Arzte ausgebildete junge Mann fand später im russischen und sächsischen Feldzuge noch übervolle Gelegenheit, dem Wunsche nachzuleben, der einst die Seele des Knaben beim Anblicke um Hülfe flehender Verwundeter erfüllt und erschüttert hatte, da er nach kaum beendigten Studien als Feldarzt bei den schweizerisch-französischen Auxiliartruppen eingetreten war. Nach der Auflösung oder Umwandlung dieser Truppen beim Sturze Napoleons in bourbonische Regimenter begab er sich auf Reisen, pflegte aber, nach mehr als zwanzigjähriger Abwesenheit in die Heimath zurückgekehrt, die hier mitgetheilte Begebenheit seiner Jugendgeschichte vor den reichen Erfahrungen seiner Männerjahre am liebsten zu erzählen. Dem General Massena hat er ein dankbares Andenken fortbewahrt, doch schloß er gewöhnlich: »Ja, der verstand das Geldmachen, gab sich aber dabei selten so feine Mühe, wie bei den Bünzener Ehrengesandten, davon könnte noch Mancher erzählen im Schweizerlande und anderwärts.«