
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
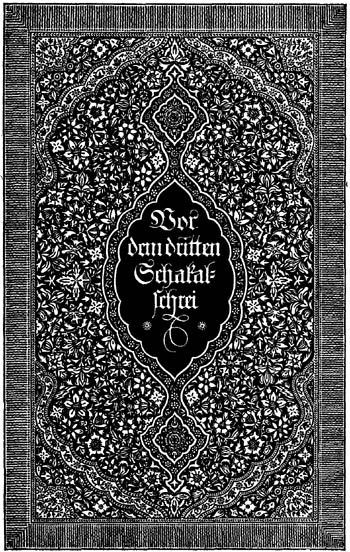
He hath awakened from the dream of life
Shelley
Edmunds Boot, mit einigen seiner Leute bemannt, wartete auf Amanda an dem östlichen Rand des Gartens, wo durch den Vorsprung eines kleinen Felsenhügels sich ein natürlicher Hafen gebildet hatte.
Eine Ruderfahrt von wenigen Minuten genügte, um die gegenüber sich erhebende Felsenmauer zu erreichen. Der Palastberg bildete hier eine hervorspringende Ecke, wodurch die schmale südliche Bucht, an deren Ende die Hindustadt lag, von dem großen Seebecken getrennt wurde.
Ziemlich an der Ecke, auf der jetzt in violetten Schatten gehüllten Südseite, gähnte in dem rostroten Felsen ein wenig einladendes grottenartiges Tor über dem Wasser. An der Stelle, die jetzt der Bungalow einnahm, hatte sich in alten Tagen ein befestigtes Vorwerk befunden, das in jenen wehrhaften Zeiten einen vorgeschobenen Posten und ein Ausfallstor nach der Wüste bedeutete. Damals mochte der Verkehr zwischen dem Wassertor und dem Hafen, der heute ausnahmsweise wiedereröffnet war, täglich stattgefunden haben.
Amandas einzige Begleiterin war ein Dienstmädchen, das schon zu Lebzeiten ihrer Mutter bei ihnen gewesen war und sich keinen Augenblick bedacht hatte, seinem guten Herrn und dem lieben Fräulein nach dem heißen Indien zu folgen, obwohl das für seine Begriffe ziemlich dasselbe war, wie für einen anderen, eine Höllenfahrt zu unternehmen. Aber wenn es der Herrschaft einfällt zur Hölle zu fahren, was soll dann eine getreue Dienerseele tun? Barbara Schwitzgäbele befahl ihre Seele den Heiligen, schnürte ihr Bündel und begab sich unter die Heiden – ein Wagnis, das ihr um so höher anzurechnen ist, als sie sehr wohl entdeckt hatte, daß nicht nur der gelehrte Professor, sondern auch das Fräulein gar arge Ketzer wären; und zwar nicht etwa nur Protestanten – was schon schlimm genug gewesen wäre – sondern überhaupt fast selber Heiden, wodurch die Gefahren ungemein gesteigert wurden. Solche Bedenklichkeiten waren da; das half aber alles nichts: sie mußte mit.
Und so saß sie denn hier im Boot neben Amanda – eine derbe Schwäbin, von etwas unbestimmbarem Alter, mit blankroten harten Apfelwangen und runden Beerenaugen, die alles sahen und sich über nichts wunderten – denn seitdem sie die heimatliche Scholle aus dem Gesichtskreis verloren hatten, waren sie auf alle Ungeheuerlichkeiten gefaßt; – geschweige denn, daß sie etwas hätten bewundern sollen. Daß Bärbele im Begriff stand, in das Allerheiligste einer Cenana hineinzudringen und Gesicht zu Gesicht mit einer indischen Fürstin zu stehen, ein Vorzug, den viele Damen, die höher in der Welt als selbst ihr Fräulein gestellt waren, gern mit teurem Geld bezahlt hätten – das imponierte ihr nicht im geringsten und interessierte sie nicht halb so viel, wie wenn sie unterwegs gewesen wäre, um einen Kuhstall zu besichtigen.
Schweigend saß sie neben ihrer jungen Herrin, die vor einer nicht ganz zu bezwingenden Erregung und Neugierde ebenfalls verstummt war. Man sah es ihrem Gesicht wohl an, daß sie diese Fahrt höchlichst mißbilligte, sich aber bewußt war, daß, wenn es dem Fräulein beliebe, ihren niedlichen Kopf, den Bärbele ihr heute so sorgfältig frisiert hatte, in den Rachen eines Tigers zu stecken, sie, Barbara Schwitzgäbele, nicht deshalb mit ihr nach Indien gegangen wäre, um den ihrigen zu salvieren. Für den Rest möchten die gesegnete Mutter Gottes und die Heiligen sorgen!
Im Wassertor war das schwere eiserne Gitter, das sonst den Eingang versperrte, in die Höhe gezogen. Man erwartete sie. Ein Cenanawärter, der aussah, als ob er eilig aus dem Bett gesprungen wäre, den Überzug seines Kissens auf den Kopf gesetzt, seine großblumige Steppdecke um sich gebunden und die Füße in die Pantoffeln seiner Frau gesteckt hätte, machte einen rechtwinkligen Salam. Am Fuße einer steilen Treppe, deren hohe Stufen sich bald ins Dunkel verstiegen, harrten acht Träger mit zwei Tragsesseln, deren eigentümliche Form sie geeignet machte, ohne Gefahr für den Insassen, von zwei Männern eine Felsentreppe hinaufgetragen zu werden.
Das Arrangement fand keine Gnade vor Bärbeles Augen. Als Amanda sich anstandslos in den einen Sessel setzen wollte, hielt das Mädchen sie am Ärmel zurück und fing an, in ganz waschechtem Schwäbisch die etwas verdutzten Inder zu benachrichtigen, daß ihr Fräulein und sie selbst im Schwarzwald viel steilere Felsentreppen mit viel schlechteren Stufen hinauf und hinunter gestiegen wären, und daß es ihnen nimmer einfallen würde, sich in so eine Schachtel zu setzen, damit sie, die ungetauften Affen, mit ihnen hinunterkollerten, daß sie Fratzen schneiden könnten, soviel sie wollten – –
Hier wurde aber ihre substantielle Person von zwei Paar brauner Arme umfangen und in die eine »Schachtel« gesetzt. Amanda sprang lachend ln die zweite, und aufwärts ging es, so schnell, daß den Insassen Sehen und Hören verging. Denn die halbnackten Inder, deren »Ungetauftheit« ihren Bewegungen nicht hinderlich zu sein schien, sprangen die Stufen hinauf gleich den Affen, die sie nach Bärbeles Anschauung waren, und die sie nach ihrer eigenen Anschauung vielleicht noch im vorhergehenden Leben gewesen waren, und schrieen dabei ebenso ohrenzerreißend wie so eine Bande Affen, die von einem gelungenen Raubzug nach ihrem Felsennest zurückkehrt. Die Beförderung der Beute schien ihnen wenig Mühe zu verursachen – die Träger wechselten alle Minuten, ohne daß dadurch eine merkliche Unterbrechung der Fahrt entstanden wäre. Gewöhnlich befand man sich in ziemlich tiefem Dunkel; ab und zu fand aber das Licht Eingang durch einen engen Schlitz in der rauh behauenen Wand; und zwar war es bald eine kolossale Goldbarre, bald ein blauer Stahlbalken, der sich hereinbohrte – woraus Amanda schloß, daß diese in den Felsen ausgehauenen Treppengänge zwischen der dem See zugekehrten Westseite und der südlichen, die Bucht begrenzenden Seite des Berges hin- und hergingen.
Plötzlich befand man sich im offenen Tageslicht – in einem inneren Palasthof. Links nur der Himmel über kolossalen Mauerzinnen; rechts das Tor zu einem anderen Hof, glitzernd von Bronze und von glasierten Steinen, aber nur mit einem flüchtigen Blick zu genießen: denn beim Aussteigen stand Amanda an der Schwelle einer offenen Tür, vor welcher der Cenanawärter in Kissen, Steppdecke und Frauenpantoffeln rechtwinklig salamte, zum Eintreten auffordernd.
Amanda begriff nicht, wie er in diesem Anzug den halbnackten Trägern vorausgeeilt sein könne. Es war in der Tat ein anderer – ähnelte ihm aber wie ein Zwillingsbruder.
Der ziemlich lange, halbdunkle Korridor brachte die Palastbesucher zu einer Tür, die von selber aufging, und vor welcher ein Drillingsbruder salamte.
Sie traten in ein leeres Zimmer. Ihnen gegenüber war eine spitzbogige Türöffnung, durch eine Bambusportiere verhängt. Schwarze Finger teilten ihre rasselnden Stränge, ein runzeliges Affengesicht grinste ihnen entgegen, und ein jetzt ganz zum Vorschein kommendes, altes hageres und gebücktes Weibsbild, das in gelben Seidenstoff eingewickelt war, winkte ihnen näher zu treten.
Das Allerheiligste der Cenana war durchaus keine von orientalischem Prunk strotzende Märchenhalle aus »Tausend und eine Nacht«. Es war ein nackter Raum, weiß getüncht – nur daß dies Weiß nirgends weiß war, sondern mystischer heller Schein, in dem gleichsam Visionen von Farben hin und her zu fluten schienen, als ob das Weiße im Begriff wäre, alle Farben des Regenbogens aus sich zu gebären. In diesem Land des reflektierten Lichtes hatte Amanda schon seltsame Lichtwirkungen im Inneren von Hindutempeln oder mohamedanischen Moscheen gesehen, wunderbare Phänomene eines leuchtenden Helldunkels, aber nichts, das diesem ähnlich käme. Das Licht sickerte herein, durch ein paar doppelte, von Schnitzwerk durchbrochene Marmorplatten, aus einer Galerie, die durch ähnliche Öffnungen nach einem kleinen Hof blickte. Solchermaßen filtriert hatte es gleichsam seine Wirklichkeit eingebüßt und teilte allem, worauf es fiel, etwas Unwirkliches mit. Ein Dutzend bunt gekleideter Mädchen, die in einer Ecke kauerten, sahen aus wie große Stiefmutterblumen, die verzauberte Mädchen waren, und die alte Gelbgekleidete, die Amanda hereingewinkt hatte und jetzt neben diesem Beet stand, war gewiß die Hindu-Circe, die sie verzaubert hatte.
Am unwirklichsten aber kam ihr die Rani selbst vor, wie sie dort auf einem fußhohen, mit Gurtgeflecht bespannten Holzgestell vor ihr lag.
So also sah sie aus, »die Zierde des Palastes«! Ein Augenpaar vor allem: groß, mandelförmig geschlitzt, tiefschwarz, fast lauter Pupille, zu wenig voneinander durch die hohe Nasenbrücke getrennt, unter einer einzigen gewölbten Brauenlinie, die nicht weit von dem massigen groben Rabenhaar entfernt war, – nur Raum da für eine Traube schwerfälliger Rubinen; im linken Flügel der langen, leichtgebogenen Nase ein blitzender Brillant; kurze, vollgeschweifte, sehr rote Lippen – alles in ein mattbraunes Oval gesetzt: das war das Gesicht, das sich aus einem Haufen regenbogenfarbiger Schleier heraus neugierig Amanda entgegenstreckte. Und als nun aus dieser duftigen Hülle ein spangenglitzernder Arm hervorglitt und ihr eine kleine Hand mit spitzen, hennagefärbten Nägeln zum Kuß hinreichte – als die Bewegung des unter den Musselinfalten hingestreckten Körpers sie mit einer Welle von Widerwillen übergoß – – –
War dies Wesen wirklich ein Weib oder eine von jener gelben Fee in Frauengestalt verzauberte Schlange? ... eine Lamia?
Die farbenschillernden Verse Keats' in »Lamia« – einem Lieblingsgedicht Edmunds, welche die Weibschlange schildern, flogen ihr durch den Kopf. Sie mußte sich Gewalt antun, um diese Fingerspitzen mit den Lippen zu berühren und auf einem Schemel Platz zu nehmen, anstatt mit einem Aufschrei davonzulaufen.
Dann stärkte sie sich durch einen Blick auf die getreue Bärbele, die nur wenige Schritt von ihr entfernt stand und offenbar von Lichtzauber und anderer Magie des Ortes so wenig beeinflußt war, als ob sie im Obstgarten ihres Vaterhauses stände.
Sie hielt einen flachen, in ein seidenes Tuch gewickelten Gegenstand krampfhaft in den Händen. Daß sie den nicht verlöre, war, was man von ihr verlangen konnte! –
Dies erinnerte Amanda an das, was zuerst zu tun war.
Sie winkte das Mädchen heran, ließ sich den Gegenstand geben und enthüllte ihn. Es war ein schön geschliffener Handspiegel. Mit einigen wohleinstudierten Hindustani-Worten überreichte sie das Geschenk der Rani. Die Zierde des Palastes spiegelte sich sofort und drückte ihre Zufriedenheit aus.
– Ayah! rief sie.
Die alte böse Fee verließ ihre Wache am Blumenbeet, nahm von einem kleinen Tisch einen goldigen Musselinschleier, so fein, als ob er von den Spinnen für eine Elfenkönigin gewebt wäre, und reichte ihn der Rani, die ihn ihrem Gast übergab.
Nachdem Amanda das Geschenk hinlänglich bewundert hatte, händigte sie es dem Mädchen ein.
Die wichtige Zeremonie des Geschenkaustauschens war glücklich überstanden. Die Dinge fingen an, mehr Realität zu gewinnen.
Aber welch Zwitterlicht von seltsamster Mischung des Wirklichen und des Unwirklichen begann jetzt zu spielen, als durch die Vermittelung einer Dolmetscherin, die notdürftig das Englische beherrschte, ein Gespräch zustande kam, während die »Zierde des Palastes« Süßigkeiten naschte und sie ihrem Gaste aufnötigte! Welch sonderbarer Abgrund von Unwissenheit und Aberglauben, von erhitzter Phantasie und langweiligster Nüchternheit offenbarte sich dem immer mehr erstaunenden Blick Amandas! Immer unvorbehaltener entschleierte sich ihr die ganze bunte Gemütsöde einer Orientalin, deren einzige geistige Unterhaltung darin besteht, stundenlang sich Feenmärchen vorerzählen zu lassen oder alte Heldenlieder zum einförmigen Klingklang einer Laute rezitieren zu hören, während sie, auf der niedrigen Ruhebank liegend, den aromatischen Tabak der Wasserpfeife einatmet, Betelblätter kaut oder Opiumkügelchen zwischen den Handflächen rollt, um sie zu verschlingen und schlaffer zurückzusinken, den wohligen Traumbildern des »Erregers« sich hingebend.
»Bin ich denn eine Bajadere?« fragte sie beleidigt, als Amanda, um nicht bloß der antwortende Teil zu sein, sondern auch ihrerseits etwas an den Tag zu legen, eine unglücklich gewählte Frage stellte, die voraussetzte, daß diese Zierde des Palastes schreiben und lesen könne.
»Wenn du eine wärst, würde dich kein Gott besuchen«, dachte Amanda. Bei dieser Gelegenheit ließ sich vom Blumenmädchen-Beet in der Ecke ein halbunterdrücktes Kichern hören – wie denn überhaupt ein solches, vom Knittern seidener Stoffe begleitet, zeitweilig von dort kam; wobei der dem Beet ausströmende Duft nach Moschus und Camphor etwas lebhafter wehte. Vom Hofe her vernahm man das monotone Plätschern eines Springbrunnens und das Girren der Tauben, dessen ruckendes Rollen bisweilen so stark wurde, daß die schwüle Luft davon zu zittern schien.
Das Fragestellen hatte sich als schwierig erwiesen, war aber auch überflüssig. Schier unerschöpflich war die Neugierde der Rani, und diese war vor allem auf die Person »des großen Sahib« gerichtet, von dem Amanda ihr nicht genug berichten konnte: wann er aufstehe, was er am liebsten esse, ob er Betel kaue, ob er rauche und was er rauche, ob es wahr sei, daß er auf fünfundzwanzig Schritt seinem Diener eine Münze aus der Hand schieße; besonders wollte sie aber wissen, ob er blinzele. Diese Frage verstand Amanda durchaus nicht; aber es stellte sich heraus, daß die Götter es nicht tun, was sie aus »Nal und Damajanti« schon wußte, und daß, was sie nicht ahnte, der große Sahib eigentlich einer sei, nämlich der wiederverkörperte Râm, was ein Priester der Rani unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut habe. Freilich gingen ihre theologischen Kenntnisse nicht so weit, daß sie sagen konnte, ob die Eigenschaft des Nicht-Blinzelns den Göttern auch in ihrer Verkörperung anhaftete. Wenn er auch blinzelte, sei das doch kein Beweis dafür, daß er nicht Râm sei. Er müsse es übrigens sein, wie hätte er sonst solche Heldentaten vollbringen können? Habe er doch den Sultan der Türken aus dem Lande der Javaner vertrieben. Dort sei er eigentlich König, habe aber einen Statthalter eingesetzt und sei nun hierher gekommen, um die Franken aus Indien zu vertreiben, denn er sei selbst ein Inder, der Enkel einer Begum. Er sei aber nicht nur der größte Held, sondern auch der größte Dichter der Welt seit Valmiki. Habe er doch ein Gedicht geschrieben so groß wie Ramayana. Es hieße: Seyd-ha-roldon-schu-hang, und alle Franken könnten es auswendig.
Amanda begriff mit Verwunderung, daß in dieser dumpfen Cenana-Atmosphäre die Gestalt Sir Edmunds mit sagenhaften Zügen seines großen Freundes zusammengeschmolzen war; fand sich aber nicht bewogen, ihre Wirtin über diesen Punkt aufzuklären.
Die Zierde des Palastes verließ übrigens auch sofort das ermüdende literarische Gebiet und zwar mit der überraschenden Frage, zu welcher Männerklasse der große Sahib, nach Memsahibs Meinung, wohl gehören mochte. Als Amanda, etwas unangenehm durch diese jedenfalls ziemlich indiskrete Frage berührt, nicht ohne Erröten gestand, deren Sinn nicht klar zu fassen, erklärte die Rani, sie meine nicht die Einteilung nach dem Grade ihrer Vorzüglichkeit in beste, mäßige und geringe; aber gehöre er wohl zu den Hasen, den Gazellen, den Stieren oder den Hengsten?
Ein leises Flüstern und Kichern vom Mädchenbeet in der Ecke begleitete diese Frage und wollte nicht enden, als Amanda kopfschüttelnd auch die so spezifizierte Frage als unverständlich ablehnte.
– So teilt man doch die Männer ein nach ihrem Temperament – wie sie sind, wenn sie lieben ... »Sanft sprechend, von guter Sinnesart, zartgliedrig, schönhaarig, ein Schatzhaus aller Vorzüge und wahrheitsliebend«, so ist der Hase – und man hat auch andere Kennzeichen. Wie teilt denn ihr sie ein im Frankenland?
Das Kichern in der Ecke wurde zum halberstickten Glucksen, das Knittern der Seidenstoffe zum lebhaften Rascheln.
Eine Glutwelle überflutete Amanda. Ihr war, als ob sie in dieser dumpfen, von Moschusdunst, Sandelgeruch und Jasminduft übersättigten Cenanaluft ersticken müßte. Ihre ganze europäische Natur wandte sich im krampfhaften Widerwillen um gegenüber der vor ihr gähnenden bodenlosen Schamlosigkeit des Orients, von der ihr eine Ahnung aufdämmerte, auf einmal so vag und so konkret, wie die eines jungen Mungos, wenn er zum erstenmal im Grase den schleimigen Pfad einer Schlange mit glühenden Augen erblickt und mit zitternden Nüstern wittert. Es kostete sie das Aufgebot ihrer ganzen Willenskraft, sich so weit zu sammeln, daß sie mit verächtlichem Lächeln zu verstehen geben konnte, im Frankenlande ließe man die Männer uneingeteilt.
Die Rani zuckte die Achsel.
– Was lernt Ihr Frankenmädchen denn von Euren Ayahs, oder in Euren Schulen, von denen Ihr doch genug habt?
Amanda fühlte die gebieterische Notwendigkeit, sich zu behaupten, um so mehr, als der blumenhafte Mädchenchor sie offenbar auslachte.
– Was wir lernen?
Und ohne sich lange zu bedenken, schleuderte sie den einzigen Sanskritsatz aus, auf den sie sich augenblicklich besann, einen Vers, den sie einmal in einem Buch ihres Vaters zitiert gefunden und der sowohl durch seinen Wohlklang wie durch seinen Sinn so großen Eindruck auf sie gemacht hatte, daß sie ihn auswendig gelernt hatte:
Yatra vatra bhavet trishna samsaram viddhi tatra vai.
Die Wirkung war so stark wie unerwartet.
Die Rani warf sich auf das Lager zurück, streckte die rechte Hand gegen sie aus und zog mit der linken an den Fingern, daß sie knackten – ein altbewährtes Mittel gegen den bösen Blick und gegen ähnlichen Zauber. Dabei rief sie ihre Ayah wie ein erschrockenes Kind. Die Blumen des Mädchenbeetes wurden wie von einem Windstoß in die Ecke hinein- und zusammengefegt, als ob sie davonfliegen möchten und durch eine hohe Gartenmauer daran verhindert würden.
Die Ayah aber sprang auf, stellte sich zwischen die entsetzte Rani und Amanda, und mit drohenden Gebärden ihrer mumienartigen Arme und Hände, deren krallenförmige Finger ihre langen, spitzen Nägel in den Hals des Mädchens hineinhauen zu wollen schienen, überflutete sie Amanda mit einem geiferartigen Wortschwall, dessen Sinn deutlich genug der war, daß es der Memsahib sehr schlimm ergehen, daß sie wenigstens gepfählt werden würde, wenn sie »der Zierde des Palastes« eine Krankheit angezaubert hätte. Barbara Schwitzgäbele ließ die Herausforderung nicht unbeantwortet. Mit einem Sprung war sie neben Amanda und schüttelte eine ländliche Faust vor dem runzeligen Affengesicht der Alten, offenbar bereit, einen echten Schwabenstreich für ihre Herrin zu schlagen. Solchermaßen geschützt konnte Amanda ihrer Rache genießen. Ohne den drohenden Krallen des alten geierartigen Wesens die geringste Beachtung zu schenken, lachte sie laut auf und fragte auf Hindustani zurück:
– Was lernt Ihr Mädchen denn hier, wenn Ihr nicht einmal so viel Sanskrit versteht?
– Wir lernen, wofür wir Gebrauch haben, murmelte die Rani mürrisch, mit einem mißtrauischen Blick.
Das Gebaren Amandas, das allerdings nichts sehr Furchtbares an sich hatte, schien die erregten Gemüter ein wenig zu beruhigen. Ein schnelles Hin und Her zwischen der Rani und ihrer Ayah erfolgte. Die Erklärung, daß Amanda Sanskrit gesprochen habe, war zweifelhafter Natur: – Sanskrit, jene längst ausgestorbene heilige Mumie von einer Sprache, welcher nur gelehrte Brahmanenlippen ein vorübergehendes, spukhaftes Leben einhauchten, – hinlänglichen Lebenshauch zum fledermausartigen Umherschweben im Halbdunkel der Tempelhallen – – die Priestersprache, die Zaubersprache!
Die Rani verlangte, sofort eine Übersetzung Wort für Wort zu hören.
Sie ließ nicht lange auf sich warten:
Allüberall wo sich Begierde reget,
Dort wahrlich, wisset, ist die Wandelwelt.
– Solche Weisheit lernen die Mädchen bei uns, fügte Amanda mit dreister Stirn hinzu.
Der Vers schien der Rani nicht weniger zu gefallen als ihr selber. Es leuchtete auf in den mandelförmigen, trübschwarzen Augen der schwerfälligen Doppelbraue:
– Noch einmal! sag's noch einmal, Memsahib!
Amanda wiederholte den Vers, erst auf Sanskrit, dann auf Englisch, das die Dolmetscherin in Hindustani übersetzte.
– Prächtig! rief die Rani. Hört Ihr's, Mädchen! Das will ich in den Gartenkiosk setzen lassen, oben über die Säulen mit großen schönen Sanskritbuchstaben, gleich jenem Mogul-Kaiser, der die berühmte Inschrift in seine Halle setzte – man liest sie noch heute in Delhi – mit Edelsteinen steht's in Marmor geschrieben an der Wand des Diwan-i-khaß: »Wenn es ein Paradies auf Erden gibt, ist es hier, ist es hier, ist es hier.« Ja, so soll es in meinem Kiosk stehen: »Wenn der Samsara dort ist, wo sich Begierde regt, dann ist er hier, ist er hier, ist er hier!«
Die Rani sprach oder sang diese Worte mit einer fast erschreckenden Leidenschaft, indem sie bei jedem »hier« die Hände an die Brust preßte, wie um zu verhindern, daß die darin sich regende Begierde ihre wogende Wohnung zersprenge. Der Atem kam stoßweise zwischen die offenen, karminroten Lippen, die Augen brannten wie im Fieber, zwischen den Juwelen der Stirn perlten die Schweißtropfen.
Mit einer Mischung von regem Interesse und lebhaftem Widerwillen starrte Amanda sie an: sah sie doch vor sich den leibhaftigen inkarnierten trishna selber, den Willen zum Leben, zur Wollust, zur Macht, zum Ergreifen, Verschlingen und Aussaugen, in seiner prachtvollsten Gestalt, jenen unersättlichen Durst nach allem, was den Durst reizen und nicht löschen kann ...
Die Rani murmelte einige Worte und machte eine Handbewegung. Als ob sie durch diese abgepflückt wären, lösten sich zwei Blumen vom Eckbeete ab, flatterten heraus und entzauberten sich in zwei Hindumädchen, die sich in einer anderen Ecke des Raumes mit ein paar musikalischen Instrumenten bewaffneten – einer langhalsigen Laute und einer Handtrommel – worauf sie zu Füßen ihrer Herrscherin niederkauerten.
– Memsahib! wandte die Ayah sich an Amanda, – du hast der Zierde des Palastes einen schönen Spruch gegeben, der ihr wohlgefällt. Damit du nicht ohne entsprechendes Gegengeschenk davongehst, sollst du ein rajputanisches Lied zu hören bekommen. Memsahib! die Zierde des Palastes will dir vorsingen.
Amanda, die jetzt ihren Triumph gehabt und sich nunmehr gern recht höflich zeigen wollte, erklärte, daß ihre Leber, bei der Ankündigung einer solchen Ehre, aufschwölle wie ein Schwamm, der Wasser saugt.
In der Tat erwartete sie sich mehr Ehre als Vergnügen von der Sache, zumal ihr mit Schubert und Beethoven erzogenes Ohr sich entschieden weigerte, das Geklimper und Trommeln, das die beiden Mädchen schon angestimmt hatten, als Musik anzuerkennen. Und doch schlich sich nach und nach – denn das Präludieren dauerte ein paar Minuten – eine eigentümliche Wirkung über ihre Sinne und ihr Gemüt. Festgebannt hing ihr Blick an dieser kleinen Trommel. Sie war geformt wie ein Stundenglas; das Mädchen hatte sie in der Mitte gefaßt und bearbeitete die beiden verschiedentlich gestimmten Felle bald mit den Fingerspitzen, bald mit den Knöcheln der anderen Hand. Bisweilen aber schüttelte sie nur das Instrument, wobei dann die seidenen, teils mit Bleikugeln, teils mit Knoten versehenen Franzen auf die Felle schlugen und seltsame geisterhafte Laute hervorbrachten, wie die Hufschläge wild dahinrasender Gespensterpferde oder spukhaftes Widerhallen längst geborstener Heerpauken – Klänge, die in Verbindung mit dem monotonen Summen einer tiefen Metallsaite der Laute unwiderstehlich die Stimmung, ja die Vorstellung nächtlicher Stille und öder Weite erweckten.
Und die Rani hub an zu singen.
Rauh war ihre Stimme und alles andere denn ausgebildet, aber die Töne waren nicht unangenehm und der Ausdruck war lebhaft und ward um so ergreifender, je leidenschaftlicher die wenig bewegte Melodie sich steigerte, besonders gegen den Schluß der Zeilen, nach welchen sie immer noch in wortloser Modulation nachsummte – ein wildes und träumerisches, zwischen Lachen und Schluchzen, zwischen Schreien und Seufzen sich wiegendes Vokal-Zwischenspiel, das der Dolmetscherin reichliche Zeit ließ, ihre Übersetzung zu murmeln.
Und dies etwa war, was sie sang:
Der Räuber Juggurt – wie sprengt er durchs Feld!
Ein Schrei der Verfolger hinter ihm gellt.
Die Rajabraut er im Sattel hält –
In die Wüste hinaus – in die Wüste!
Sein Renner stürzt am verfallenen Schrein;
Die Schwerter blitzen im Mondenschein;
Erschlagen liegt Juggurt an Shiwas Stein,
In der Wüste – tief, tief in der Wüste.
Das Schwert entringt seiner Faust die Braut.
Ihre linke Hand wohl ab sie haut:
»Die bringt meinem Vater!« sie ruft es laut
In der Wüste – laut, laut in der Wüste.
Noch einmal schneiden die Klinge muß,
Sie trennt vom Knöchel den zarten Fuß: –
»Den bringt eurem Raja als Scheidegruß –
Einen Gruß von mir – aus der Wüste.«
Sie fällt auf den Leichnam, umarmt ihn mit Macht.
Die Hufschläge schwinden fern, fern in der Nacht.
Es heult der Schakal, die Hyäne lacht
In der Wüste – lacht, lacht in der Wüste.
Die Stimme der Rani war in einem letzten röchelnden Nachsummen hingestorben, das geisterhafte Trommeln des Nachspieles schwieg gänzlich, und Amanda saß noch schweigend da. Sie fühlte sich, als ob sie von einem Wirbelsturm fortgetragen und irgendwo verloren worden wäre. Von Sekunde zu Sekunde wurde ihr das Schweigen peinlicher, und immer schwieriger wurde es ihr, es zu brechen. Schließlich wußte sie zu ihrer eigenen Beschämung nichts Besseres, als ein geschichtliches Interesse für Rajputaner-Chronik an den Tag zu legen.
– Wer war wohl jener Juggurt? – Zu welcher Zeit hat er gelebt?
Die Rani zuckte die Achsel.
– Weiß ich's? – Ein Räuber war er, der die Rajabraut raubte ... das ist er wohl noch, fügte sie hinzu mit dem unerschütterlichen Glauben des Hindu an die Fortdauer des Lebens und des Charakters.
Die explosive Energie, worüber die Rani offenbar im höchsten Grad verfügte, hatte ausgerast und sie in einem vertieften Stadium orientalischer Trägheit zurückgelassen. Doch war gerade noch so viel übrig geblieben, daß sie mit eigentümlich schnellen Bewegungen ihrer winzigen Hand – etwa wie wenn eine Kobra nach Fliegen schnappt – aus einer Jaspisschale Kardamomenkörner pickte, die sie mit Behagen kaute. Plötzlich neigte sie sich vor und schob ihrem lieben Gast höchst eigenhändig einige von diesen Leckereien in den Mund – eine hohe Gunstbezeugung. Dabei reckte und streckte ihr Körper sich unter der duftigen Hülle, und diese geschmeidige Wellenbewegung gab selbst der Unerfahrenheit Amandas eine Ahnung von der unvergleichlichen Formenschönheit und elastischen Anmut der indischen Frauengestalt, durchschauerte sie aber gleichzeitig so intensiv mit jener kriechenden Angst vor allen Schlangenwesen, daß sie sich schleunigst empfahl, ohne sich viel darum zu kümmern, wie schwer sie wohl durch ein solches Aufbrechen gegen die Rajputaner Palastetikette verstoßen möge. –