
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Keine einzige Gruppe der ganzen Ordnung läßt sich leichter kennzeichnen als die Familie der Hirsche ( Cervina ). Sie sind geweihtragende Wiederkäuer. Mit diesen Worten hat man sie hinlänglich beschrieben; denn alles übrige erscheint dieser Eigenthümlichkeit gegenüber als nebensächlich. Von den Moschusthieren unterscheiden sich die Hirsche durch bedeutendere Größe, durch den Besitz von Thränengruben, durch die nur sehr kurzen Eckzähne bei den Männchen mancher Arten und durch eine Haarbürste an den Hinterfüßen. Ihr Bau ist schlank und zierlich, der Leib wohlgeformt und gestreckt, der Hals stark und kräftig, der Kopf nach der Schnauzenspitze zu stark verschmälert; die Beine sind hoch und fein gebaut; die Füße haben sehr entwickelte Afterklauen und schmale, spitzige Hufen. Große, lebhafte Augen, aufrechtstehende, schmale, mittellange und bewegliche Ohren, die glatte, ungefurchte Oberlippe und sechs Backenzähne in jedem Kiefer sind anderweitige Merkmale der Gruppe.
Die Geweihe kommen meist nur den Männchen zu. Sie sind, wie oben angegeben, paarige, knöcherne, verästelte Fortsetzungen der Stirnbeine und werden alljährlich abgeworfen und aufs neue erzeugt. Ihre Bildung und die Absterbung steht im innigen Zusammenhang mit der Geschlechtsthätigkeit. Verschnittene Hirsche bleiben sich hinsichtlich des Geweihes immer gleich, d. h. sie behalten es, wenn die Verschneidung während der Zeit erfolgte, wo sie das Geweih trugen, oder sie bekommen es niemals wieder, wenn sie verschnitten wurden, als sie das Geweih eben abgeworfen hatten; ja einseitig Verschnittene setzen bloß an der unversehrten Seite noch auf. Schon vor der Geburt des Hirsches ist die Stelle, welche das Geweih tragen soll, durch eine starke Verknöcherung des Schädels angedeutet. Mit dem sechsten oder achten Monate des Alters bildet sich durch Erhebung der äußern Decke am Stirnbeine ein Knochenzapfen, welcher während des ganzen Lebens hindurch stehen bleibt: der sogenannte Rosenstock, auf welchem die Geweihe sich aufsetzen. Anfänglich sind die Stangen nur einfach spitzig, später verästeln sie sich mehr und mehr, indem von der Hauptstange Sprossen auslaufen, deren Anzahl bis zwölf an jeder Stange ansteigen kann. »Mit dem Alter der Hirsche«, sagt Blasius, »geht eine gewaltige Umänderung der Geweihe vor sich. Die erste und allgemein auffallende Veränderung ist die der Rosenstöcke, welche mit der zunehmenden Größe der Stirnzapfen sich mit jedem Jahr mehr erweitern und nach der Mitte der Stirn einander näher rücken; ebenso verringert sich auch mit dem Aufrücken der Stirnkante die Rose und der Schädel in jedem Jahre. Noch auffallender aber sind die Veränderungen in der Gestalt der Geweihe und der Anzahl der Enden.
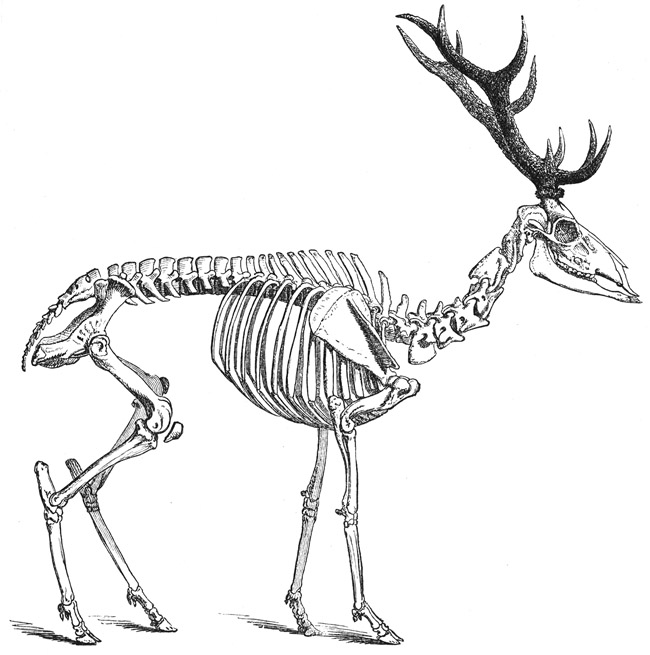
Geripp des Edelhirsches. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
»Die jungen Geweihe, in deren ersten Bildungsanfängen der Grund zum Abwerfen der alten liegt, sind anfangs von einer gefäßreichen, behaarten Haut umgeben, kolbig, weich und biegsam. Erst lösen sich die tieferen, dann die höher stehenden Enden von der Hauptstange los, und nachdem alle in bleibende Verhältnisse ausgebildet und die Enden vereckt sind, stockt der Blutumlauf, und der Hirsch hat das Bedürfnis, die Haut oder den Bast abzuschlagen, welcher nun auch anfängt, sich von selbst abzulösen.« Die Veränderung des Geweihes, gewissermaßen seine Weiterausbildung, geht nun in folgender Weise vor sich: Schon ehe der Hirsch das erste Lebensjahr erreicht, bilden sich als unmittelbare Fortsetzungen der Rosenstöcke Stangen, welche bei manchen Arten der Familie wohl abgeworfen, aber immer in gleicher Weise wieder ersetzt werden, wogegen bei den meisten Hirschen die auf die ersten Stangen, die sogenannten Spieße, folgenden Geweihe, also der Kopfschmuck des zweiten Jahres, einen, bisweilen wohl auch zwei Zacken, Sprossen oder Zinken erhalten. Im Frühjahre des dritten Jahres wiederholt sich derselbe Vorgang; aber die neu aufgesetzte Stange enthält einen Sprossen mehr als im vorigen Jahre, und so geht es fort, bis die größtmöglichste Ausbildung des Thieres erreicht worden ist. Krankheiten oder schlechte Nahrung bringen bisweilen einen Rückgang hervor, indem dann die neu aufgesetzten Stangen je einen oder zwei Sprossen weniger zählen als vorher, und ebenso kann die Geweihbildung durch reichliche Nahrung und ruhige, sorgenlose Lebensweise beschleunigt werden.
Max Schmidt hat über die Bildung und Entwickelung der Geweihe so übersichtlich und wahrheitsgetreu berichtet, daß ich nichts besseres zu thun weiß, als mich im nachfolgenden auf seine Ausführungen zu stützen. Bei dem neugebornen Hirsche sind die Stellen, an denen später die Geweihe sich entwickeln, in der Regel durch Haarwirbel angedeutet und erscheinen häufig eher etwas vertieft als erhöht. Gegen Ende des ersten oder zu Anfang des zweiten Jahres treten die Rosenstöcke allmählich hervor, und sobald sie ihre völlige Länge erreicht haben, werden die ersten Spuren eigentlicher Geweihbildung bemerklich. Der stets mit Haut bekleidete Rosenstock hat, je nach der Art, eine sehr verschiedene Höhe, indem er bald kaum über die Fläche der Stirnbeine sich erhebt, bald eine Länge von zwei bis fünf, in einzelnen Fällen sogar bis fünfzehn Centimeter erreicht. Die im zweiten Lebensjahre zum Vorscheine kommenden Geweihanfänge sind entweder niedere, höckerige Gebilde oder aber mehr gestreckte, kegelförmige Hervorragungen von ebenfalls sehr verschiedener Länge, je nach Art des Thieres; bei der ersteren Form tritt immer, bei der zweiten zuweilen eine Theilung ein. Hierauf folgt in späteren Jahren die weitere Ausbildung der Geweihe in der angegebenen Weise.
Die Befestigung des Geweihes auf dem Rosenstocke findet derartig statt, daß kleinere oder größere Hervorragungen der Geweihwurzel in entsprechende Vertiefungen der obern Fläche des Rosenstockes eingreifen und umgekehrt. Diese Verbindung ist eine so innige, daß sie auf einem senkrechten Durchschnitte eines frischen ausgebildeten Geweihes und des Rosenstockes nicht sichtbar wird, sondern erst nach dem Austrocknen als eine feingezackte Linie auf der Schnittfläche sich darstellt. Daher kommt es auch, daß bei Anwendung von Gewalt ein Geweih, welches nicht dem Abwerfen nahe ist, nicht leicht an dieser Stelle bricht, sondern weit eher der Rosenstock von der Stirnbeinfläche abgesprengt wird.
Bei den meisten Hirschen bemerkt man einige Tage vor dem Abwerfen eine Auftreibung des Hautrandes, welcher Rosenstock und Geweihwurzel umgibt; der Hirsch schont das Geweih, vermeidet damit anzustoßen und beweist dadurch, daß er ein ungewohntes Gefühl an dieser Stelle verspürt.
Das Abwerfen selbst geschieht infolge des eigenen Gewichtes der Stangen oder eines geringen äußern Anstoßes. Höchst selten werden beide Stangen zugleich abgeworfen; es bleibt vielmehr ein Zwischenraum von verschiedener Dauer, welche bald wenige Minuten, bald mehrere Tage umfaßt, zwischen dem Abwerfen der ersten und der zweiten Stange. Durch sein ganzes Benehmen, besonders aber durch die Haltung des Kopfes und Hängenlassen der Ohren bekundet der Hirsch, daß das Abwerfen, wenn nicht schmerzhaft, so doch jedenfalls mit einem unbehaglichen Gefühle verbunden ist. Schon mehrere Tage vorher stößt er nicht mehr, sondern wehrt sich wie das Thier, durch Schlagen mit den Vorderläufen. Nach dem Abwerfen einer Stange veranlaßt ihn das ungleiche Gewicht, den Kopf schief nach einer Seite geneigt zu tragen, und er schüttelt oft, als wolle er dadurch die andere Stange ebenfalls entfernen. Anwendung von Gewalt findet zwar auch, jedoch seltener statt, insbesondere dann, wenn der Hirsch verstümmelte Geweihe trug.
Unmittelbar nach dem Abwerfen beginnt die Neubildung des Kopfschmuckes. Hofrath Dr. Sömmering hat sich der Mühe unterzogen, den Aufbau des Geweihes eines gefangen gehaltenen Edelhirsches genau zu beobachten und zu beschreiben, und seine Schilderung gibt ein sehr getreues Bild dieses Vorganges. »Gleich nach dem Abfallen der einen Stange«, sagt er, »war die untere Fläche derselben trocken, wenigstens nicht blutig; die Blutgefäße in ihr waren also völlig abgestorben und leer. Man bemerkte namentlich nach hinten und außen, aber nur dicht am Rande der Rose, zwischen den Perlen, Oeffnungen zahlreicher Kanäle, durch welche die ernährenden Gefäße zum Baste verliefen. Die kleineren enthielten die Schlagadern, welche fast alle aus der äußern Halsschlagader ( Carotis externa) entspringen. Zur Zeit der Geweihbildung erweitern und verlängern sich deren Zweige außerordentlich und sind von noch stärkeren Hohladern umgeben, deren Knochenkanäle man neben denen der Schlagadern sieht, und deren Wege man noch deutlicher als jene in den breiteren Furchen des Geweihes angedeutet findet. Durch das Fegen sind sie an den Spitzen der plattgeschliffenen Enden verwischt worden und völlig verschwunden. Die Mitte der untern Fläche des Geweihes ist weniger hart und fest als der Rand, mehr porös und rauh, mit dem Stirnbeinfortsatze daher loser verbunden, nicht durch wirkliche Naht daran befestigt.
»Nach dem Abwerfen beider Stangen sucht der Hirsch im Freien die Ruhe, thut sich an einsamen Plätzen nieder und scheint ermattet, wenigstens muthlos zu sein, im Gefühle des Verlustes seiner Waffen. Er trägt den Kopf gern gesenkt und meidet jeden Anstoß, jede Berührung desselben.
»Die runde Fläche, auf welcher die Stange saß, hat 50 Millimeter Durchmesser, ist mit einem Gerinsel von Blut und Lymphe bedeckt, aber schon jetzt mit einem acht Millimeter breiten, wulstigen, schwärzlich violetten Ringe umgeben: eine offenbar bereits vor dem Abwerfen bestehende Neubildung von Gefäßen, welche, aus dem Hautrande des Rosenstockes sich hervordrängend, die Auflockerung und Loslösung bewirkt haben. Der Andrang des Blutes nach den Rosenstöcken wird von dem alten abgestorbenen Geweih aufgehalten; die Gefäße häufen sich vor demselben an, krümmen und verschlingen sich und bilden einen wulstigen Gefäßring, welcher das Geweih gleichsam von der Stirnhaut abschnürt und untergräbt und so die leichte Abstoßung desselben bewirkt. Aus diesem Gefäßwulste entsteht später durch Ausscheidung von kalkiger Knochenmasse die Rose mit ihrem Perlenkranze. Sie fehlt noch bei dem Erstlingsgeweih des Spießers, dessen dünne Stange auf einem hohen Fortsatze des Stirnbeins aufsitzt. Mit jedem Jahre nimmt dieser an Breite zu, aber an Höhe ab, denn mit dem Abwerfen des Geweihes geht immer eine obere Schicht desselben verloren.
» Schon am zweiten Tage nach dem Abwerfen ist die Mitte der Wundfläche mit schwärzlich rothbraunem Schorfe bedeckt, welcher sich immer mehr nach der Mitte zusammenzieht, während der Ringwulst breiter und höher wird. Am vierten Tage ist die eigentliche Wundfläche schon sehr verkleinert, im Durchmesser 28 Millimeter, der Ringwulst dagegen 12 Millimeter breit, letzterer erhabener gewölbt und gefurcht, seine dünne Oberhaut so empfindlich, daß sie leicht blutet. Dasselbe beobachtet man auch noch am achten Tage; nur ist inzwischen der Ringwulst wieder merklich breiter und höher geworden, jedoch noch völlig rund geblieben, ohne den behaarten Hautrand seitlich zu überragen. Am vierzehnten Tage hat die mittlere Wundstelle sich wiederum bedeutend verkleinert. Der Wulst ist im Umfange allenthalben, am meisten aber nach vorn, über den Rand des behaarten Rosenstockes ausgedehnt, so daß man sehr deutlich den Anfang zu dem zuerst sich bildenden untersten Ende des Geweihes, des Augensprosses, wahrnimmt. Von dessen Spitze aus gemessen hat der Wulst oder Kolben nur einen Durchmesser von 72 Millimeter, während jener der mittlern Vertiefung nur noch 16 Millimeter beträgt. Am zwanzigsten Tage beginnt der nun nach allen Seiten stark hervortretende grauschwarze Kolben mit weißlichen Haaren sich zu bedecken; seine Oberhaut ist fester geworden und nicht allein der Ansatz zu den Augensprossen stärker hervorgetreten, sondern namentlich der hintere Theil des Kolbens, aus welchem die Stange sich erheben soll, breiter, höher, massenhafter ausgebildet. Von nun an verschwindet die kleine vertiefte Mittelfläche bald gänzlich, und der Kolben wächst rascher in die Breite und Höhe. Außer dem, am dreiundzwanzigsten Tage bereits 60 Millimeter langen Augensproß theilt er sich in eine kleinere vordere und eine stärkere hintere Halbkugel, aus welcher das zweite Ende, der Eissproß, und die Stange selbst sich bilden. Er ist nur dicht mit weißlichen Haaren bedeckt und hat daher eine graue Färbung bekommen. Im Verlaufe der nächsten zehn Tage hat sich das Ansehen der Kolben bedeutend verändert. Das ganze Geweih ist gleichsam in der Anlage schon vorhanden; alle Enden sind durch mehr oder minder hervorragende Abtheilungen und Einschnitte des Kolbens angedeutet. Letzterer gleicht einer Pflanze, welche im Frühlinge nach der Winterruhe schon ihren Stengel gebildet hat, aus dem Blätter und Blüten hervortreiben, nachdem das Wachsthum der Wurzel vollendet ist. Nun erst sieht man deutlich einen über den Rand des behaarten Rosenstockes hervorragenden bläulichen, gefäßreichen Ring, den Anfang der sich bildenden Rose und ihrer Perlen, am Grunde des Geweihes. Darüber ragt der Augensproß hervor. Die Spitze ist sehr breit geworden und beginnt durch Furchung sich zu gabeln. Zwölf Tage später, am fünfundvierzigsten des Wachsthums, ist die letzte Gabelung oder Theilung der Kolben noch nicht vollständig; am neunundfünfzigsten Tage sind alle vorhandenen Enden bereits ziemlich lang geworden, und der Augensproß hat sich bereits zugespitzt. Der obere Theil des Geweihes theilt sich jedoch erst am zweiundsechzigsten Tage und ist am neunundsiebenzigsten Tage fertig, aber noch mit stark behaartem und gefäßreichem Bast überzogen, welcher sehr empfindlich sein muß, weil der Hirsch noch immer das Geweih schont. Noch am hundertundzwanzigsten Tage, um welche Zeit das Geweih vollständig ausgewachsen ist und seine Enden bis zu den Spitzen knochenhart sind, blutet der Augensproß bei der geringsten Verletzung. Erst zwanzig Tage später fegte der in Rede stehende Hirsch.«
Der hier beschriebene Hergang der Neubildung des Geweihes gilt für alle Hirsche, nur mit der Maßgabe, daß das Wachsthum bei dem einen längere, bei dem andern kürzere Zeit beansprucht. Nachdem der Bast oder häutige Ueberzug des Geweihes seine Dienste gethan hat, trocknet er ein, und der Hirsch reibt nunmehr die sich loslösenden Fetzen desselben an Bäumen und Gesträuchen ab, wodurch gleichzeitig die Geweihe, hauptsächlich wohl von dem Safte der dabei beschädigten Pflanzen dunkler gefärbt werden.
Im allgemeinen ist die Gestalt des Geweihes eine sehr regelmäßige, obgleich Oertlichkeit und Nahrung Veränderungen zur Folge haben können. Für die Artbestimmung bleibt das Geweih immer noch eines der Hauptmerkmale, mögen auch einzelne Naturforscher solcher Bestimmung nur einen sehr zweifelhaften Werth zusprechen wollen.
Die inneren Leibestheile der Hirsche stimmen im wesentlichen mit denen anderer Wiederkäuer überein und bedürfen hier keiner besondern Beschreibung. Daß allen Hirschen die Gallenblase fehlt, wurde bereits erwähnt.
Schon in der Vorzeit waren die Hirsche über einen großen Theil der Erdoberfläche verbreitet. Gegenwärtig bewohnen sie mit Ausnahme des größten Theiles von Afrika und von ganz Australien alle Erdtheile und so ziemlich alle Klimate, die Ebenen wie die Gebirge, die Blößen wie die Wälder. Manche leben gemsenartig, andere so versteckt als möglich in dichten Waldungen, diese in trockenen Steppen, jene in Sümpfen und Morästen. Nach der Jahreszeit wechseln viele ihren Aufenthalt, indem sie, der Nahrung nachgehend, von der Höhe zur Tiefe herab- und wieder zurückziehen; einige wandern auch und legen dabei unter Umständen sehr bedeutende Strecken zurück. Alle sind gesellige Thiere; manche rudeln sich oft in bedeutende Herden zusammen. Die alten Männchen trennen sich gewöhnlich während des Sommers von den Rudeln und leben einsam für sich oder vereinigen sich mit ihren Geschlechtsgenossen; zur Brunstzeit aber gesellen sie sich zu den Rudeln der Weibchen, rufen andere Gesinnungstüchtige zum Zweikampfe heraus, streiten wacker mit einander und zeigen sich überhaupt dann außerordentlich erregt und in ihrem ganzen Wesen wie umgestaltet. Die meisten sind Nachtthiere, obwohl viele, namentlich die, welche die hohen Gebirge und die unbewohnten Orte bevölkern, auch während des Tages auf Aesung ausziehen. Alle Hirsche sind lebhafte, furchtsame und flüchtige Geschöpfe, rasch und behend in ihren Bewegungen, feinsinnig, geistig jedoch ziemlich gering begabt. Die Stimme besteht in kurz ausgestoßenen, dumpfen Lauten bei den Männchen und in blökenden bei den Weibchen.
Nur Pflanzenstoffe bilden die Nahrung der Hirsche; wenigstens ist es noch keineswegs erwiesen, ob die Renthiere, wie man behauptet hat, Lemminge fressen oder nicht. Gräser, Kräuter, Blüten, Blätter und Nadeln, Knospen, junge Triebe und Zweige, Getreide, Obst, Beeren, Rinde, Mose, Flechten und Pilze bilden die hauptsächlichsten Bestandtheile ihrer Aesung. Salz erscheint ihnen als Leckerei, und Wasser ist ihnen Bedürfnis.
Die Hirschkuh wirft ein oder zwei, in seltenen Fällen drei Junge, welche vollständig ausgebildet zur Welt kommen und schon nach wenigen Tagen der Mutter folgen. Bei einigen Arten nimmt sich auch der Vater seiner Nachkommenschaft freundlich an. Die Kälber lassen sich Liebkosungen seitens ihrer Mutter mit vielem Vergnügen gefallen, und diese pflegt jene aufs sorgfältigste, schützt sie auch bei Gefahr.
In Gegenden, wo Ackerbau und Forstwirtschaft den Anforderungen der Neuzeit gemäß betrieben werden, sind die Hirsche nicht mehr zu dulden. Der Schaden, welchen die schönen Thiere anrichten, übertrifft den geringen Nutzen, den sie bringen. Sie vertragen sich leider nicht mit der Land- und Forstwirtschaft. Wäre die Jagd nicht, welche mit Recht als eine der edelsten und männlichsten Vergnügungen gilt, man würde sämmtliche Hirsche bei uns längst vollständig ausgerottet haben. Noch ist es nicht bis dahin gekommen; aber alle Mitglieder dieser so vielfach ausgezeichneten Familie, welche bei uns wohnen, gehen ihrem sichern Untergange entgegen und werden wahrscheinlich schon in kurzer Zeit bloß noch in einem Zustande der Halbwildheit, in Thierparks und Thiergärten nämlich, zu sehen sein.
Die Zähmung der Hirsche ist nicht so leicht, als man gewöhnlich annimmt. In der Jugend betragen sich freilich alle, welche frühzeitig in die Gewalt des Menschen kamen und an diesen gewöhnt wurden, sehr liebenswürdig, zutraulich und anhänglich; mit dem Alter aber schwinden diese Eigenschaften mehr und mehr, und fast alle alten Hirsche werden zornige, boshafte und rauflustige Geschöpfe. Hiervon macht auch die eine, schon seit längerer Zeit in Gefangenschaft lebende Art, das Ren, keine Ausnahme. Seine Zähmung ist keineswegs eine vollständige, wie wir sie bei anderen Wiederkäuern bemerken, sondern nur eine halbgelungene.
Wir stellen die Riesen der Familie oben an, obgleich sie nicht die vollendetsten, sondern eher die am mindesten entwickelten Hirsche sind. Die Elenthiere ( Alces), welche gegenwärtig noch einen einzigen oder, wenn man das amerikanische Mosthier als besondere Art erklärt, zwei Vertreter haben, sind gewaltige, plump gebaute, kurz- und dickhalsige, hoch- und kurzleibige, hochbeinige Geschöpfe, mit schaufelartig ausgebreiteten, fingerförmig eingeschnittenen, vielfach gezackten Geweihen, an denen die Augen- und die Mittelsprossen fehlen; sie besitzen kleine Thränengruben, Haarbüschel an der Innenseite der Fußwurzel und Klauendrüsen, aber keine Eckzähne. Der Kopf ist häßlich, die obere Lippe hängt über; die Augen sind klein, die Ohren lang und breit; der Schwanz ist sehr kurz.
Schon seit alten Zeiten ist das Elch oder Elen ( Alces palmatus, A. jubatus und antiquorum, Cervus alces) hoch berühmt. Ueber den Ursprung des Namens ist man noch nicht im klaren: Einige behaupten, daß er aus dem alten Worte »elend« oder »elent« gebildet sei und soviel wie stark bedeute, Andere nehmen an, daß er von dem slawischen Worte »Jelen« – Hirsch – herstammen soll. So viel ist sicher, daß der lateinische Name nach dem deutschen gebildet wurde. Bereits die alten römischen Schriftsteller kennen das Elch als deutsches Thier. »Es gibt im Hercynischen Walde«, sagt Julius Cäsar, » Alces, den Ziegen in Gestalt und Verschiedenheit der Färbung ähnliche Thiere, aber größer und ohne Hörner, die Füße ohne Gelenke. Sie legen sich auch nicht, um zu ruhen und können nicht aufstehen, wenn sie gefallen sind. Um zu schlafen, lehnen sie sich an Bäume; daher graben diese die Jäger aus und hauen sie so ab, daß sie leicht umfallen, sammt dem Thiere, wenn es sich daran lehnt.« Plinius gibt noch an, daß das Elen eine große Oberlippe hat und deshalb rückwärts weiden müsse. Pausanias weiß, daß bloß das Männchen Hörner trägt, nicht auch das Weibchen. Unter Gordon III., zwischen den Jahren 238 bis 244 nach Christus, wurden zehn Stück Elenthiere nach Rom gebracht; Aurelian ließ sich mehrere bei seinem Triumphzuge voranführen. Im Mittelalter wird das Thier oft erwähnt, namentlich auch im Nibelungenliede, wo es unter dem Namen »Elk« vorkommt. Wenn die Sage recht berichtet, wäre zu dieser Zeit das Elenthier durch ganz Deutschland bis zum äußersten Westen hin vorgekommen; denn gerade bei der Beschreibung der Jagd Sigfrieds im Wasgau heißt es:
»Darnach schlug er wieder ein Wisent und einen Elk,
Starker Auer viere und einen grimmen Schelk.«
In den Urkunden des Kaisers Otto des Großen vom Jahre 943 wird geboten, daß niemand ohne Erlaubnis des Bischofs Balderich in den Forsten von Drenthe am Niederrhein Hirsche, Bären, Rehe, Eber und diejenigen wilden Thiere jagen dürfe, welche in der deutschen Sprache Elo oder Schelo heißen. Dasselbe Verbot findet sich noch in einer Urkunde Heinrichs II. vom Jahre 1006 und in einer andern von Konrad II. vom Jahre 1025. In den norddeutschen Torfmooren, bei Braunschweig, in Hannover, Pommern, in alten Hünengräbern etc., findet man jetzt noch Elengeweihe, gewöhnlich in versteinertem Zustande. Der oftgenannte Bischof von Upsala, Olaus Magnus, ist der erste, welcher das Elch näher kennzeichnet. »Wie die Hirsche«, sagt er, »schwärmen diese Thiere herdenweise in den großen Wildnissen umher und werden häufig von den Jägern in ausgespannten Netzen oder in Klüften gefangen, wohinein man sie durch große Hunde treibt und mit Spießen und Pfeilen erlegt; auch das Hermelin springt ihnen manchmal, wenn sie auf dem Boden weiden oder auch aufrecht stehen, an die Kehle und beißt sie dermaßen, daß sie verbluten. Die Elenthiere kämpfen mit den Wölfen und schlagen sie oft mit den Hufen todt, besonders auf dem Eise, wo sie fester stehen als die Wölfe.« »In Pommern«, sagt Kantzow in seiner Pomerania (1530), »hat's auch große Heiden, daselbst pflegt man elende. Das thier hat von seiner vnmacht den namen bekhomen, den es hat nichts, damit es sich veren khan; es hat wol breite hörner, aber es weiß sich nicht mit zu behelffen, sondern es verbirgt sich in die vnwegsamsten sümpfe und walde, da es sicher sey. Es khan aber einen minschen oder hundt weit erwittern; dasselbige ist ihme offt zu heyl, sobald aber die Hunde zu jme khomen, ist's gefangen. Die klawen helt man für die fallende sucht gut, darumb macht man ringe daraus und traget sie über den Fingern. Etzliche haben gemeint, es habe keine knie oder gelenke, aber das ist falsch« etc. Auch der alte Geßner, welcher die Fabeln der Alten wiedergibt, ist der Meinung, daß der Name Elen dem Thiere gebührt: »Ist sunst ein wol geplaget thier, vnd mit dem rechten namen genannt ein Ellend, das täglichs vor dem fallenden siechtiger ernider geworffen wirt, vnd daruon nit er erledigt ee es sein klawen des rechten hindern lauffs in das linck or stoßt«.
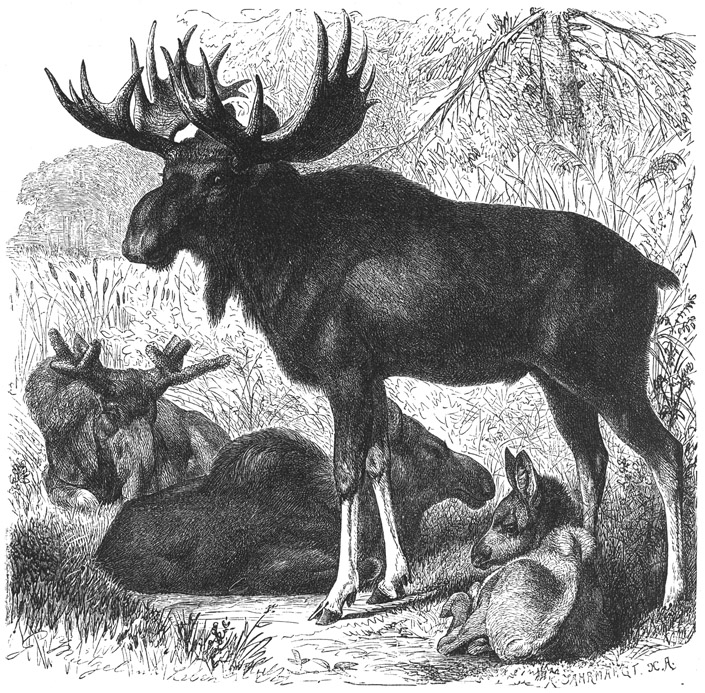
Elch ( Alces palmatus). 1/24 natürl. Größe.
In den letzten Jahrhunderten hat sich der Elchwildstand in Europa überall in rasch zunehmender Steigerung vermindert. Noch im siebenzehnten, möglicherweise sogar im achtzehnten Jahrhundert ist das Elch hier und da in Sachsen und Schlesien vorgekommen. In Sachsen wurde das letzte Elen im Jahre 1746, in Schlesien, laut Haugwitz, das letzte im Jahre 1776 erlegt. In Pommern scheint es sich ebenso lange erhalten zu haben; in Ostpreußen war es um diese Zeit noch ziemlich verbreitet; doch mußte auch hier schon nach dem Siebenjährigen Kriege ein Gebot zur Schonung des Elchwildstandes erlassen werden. Zu Anfänge dieses Jahrhunderts gab es in den Forsten Schorell, Tzulkien und Skallisen noch viel Elenwild. Im Forste Ibenhorst bei Tilsit hat es sich, geschützt durch königliche Bestimmung, bis auf unsere Tage erhalten. Zwar waren die Thiere im Jahre der Jagdfreiheit 1848 auch hier bis auf sechszehn Stück vermindert worden und im darauf folgenden Jahre sogar bis auf elf Stück zurückgegangen; strengste Schonung aber hob nach und nach den Wildstand wieder, so daß derselbe gegenwärtig (1874), laut Angabe des königlichen Oberförsters Axt, in den Ibenhorster Forsten sechsundsiebenzig Stück beträgt. Außerdem stehen in den Waldungen der Oberförstereien Gauteden, Tapiau, Fritzen, Sternberg, Greiben und Bludau, sämmtlich im Regierungsbezirke Königsberg belegen, zusammen noch sechzig Stück Elchwild. Somit zählen wir noch heute diese Hirschart zu den deutschen Thieren.
Abgesehen von diesen unter strengster Aufsicht stehenden Gehegen findet man das Elch in den höheren Breiten aller waldreichen Länder Europas und Asiens. In unserem Erdtheile ist es auf die baltischen Niederungen, außer Ostpreußen also auf Litauen, Kur- und Livland, sowie auf Schweden und Norwegen und einige Strecken Großrußlands beschränkt. In Norwegen bewohnt es die östlichen Provinzen des Südens, in Schweden die daran stoßenden westlichen oder mit, anderen Worten, die ungeheueren Waldungen, welche das sogenannte Kjölengebirge bedecken, namentlich also Wermeland, Dalekarlien, Herjedalen, Oesterdalen, Hedemarken, Gulbrandsdalen und Valdersdalen. Weit häufiger als in Europa lebt das Elch in Asien. Es breitet sich hier über den ganzen Norden bis an den Amur aus und kommt überall vor, wo es große ausgedehnte Wälder gibt, nach Norden hin, soweit der Baumwuchs reicht. Im Stromthale der Lena, am Beikalsee, am Amur, in der Mongolei und Tungusien hält es sich noch immer in ziemlicher Anzahl.
Das Elen ist ein gewaltiges Thier. Die Leibeslänge eines erwachsenen Elchhirsches beträgt 2,6 bis 2,9 Meter, die Länge des Schwanzes ungefähr 10 Centim., die Höhe am Widerrist 1,9 Meter, am Kreuze einige Centimeter weniger. Sehr alte Thiere können ein Gewicht von fünfhundert Kilogramm erreichen; als Durchschnittsgewicht müssen jedoch drei- bis vierhundert Kilogramm betrachtet werden. Der Leib des Elch ist verhältnismäßig kurz und dick, breit an der Brust, hoch, fast höckerig am Widerrist, gerade am Rücken, niedrig am Kreuze. Er ruht auf sehr hohen und starken Beinen von gleicher Länge, welche mit schmalen, geraden, tiefgespaltenen und durch eine ausdehnbare Bindehaut vereinigten Hufen beschuht sind; die Afterklauen berühren leicht den Boden. Auf dem kurzen, starken und kräftigen Halse sitzt der große, langgestreckte Kopf, welcher vor den Augen verschmälert ist und in eine lange, dicke, aufgetriebene, sehr breit nach vorn abgestutzte Schnauze endet. Diese ist durch die knorpelige Nase und die den Unterkiefer weit überragende, dicke, sehr stark verlängerte, höchst bewegliche, gefurchte Oberlippe fast verunstaltet. Die kleinen und matten Augen liegen tief in den stark vortretenden Augenhöhlen; die Thränengruben sind unbedeutend. Große, lange, breite, aber zugespitzte Ohren stehen nach seitwärts gerichtet am Hinterkopfe, neigen sich aber oft schlotternd gegen einander. Das Geweih des erwachsenen Männchens besteht aus einer großen, einfachen, sehr ausgebreiteten, dreieckigen, platten, schaufelförmigen, gefurchten Krone, welche an ihrem äußern Rande mit zahlreichen Zacken besetzt ist, und wird von kurzen, dicken, gerundeten, mit wenigen Perlen besetzten Stangen getragen, welche auf kurzen Rosenstöcken sitzen und sich sogleich seitlich biegen. Im ersten Herbste bemerkt man beim jungen Bocke da, wo das Geweih aufsitzt, einen dichten Haarwulst, im nächsten Frühjahre erhält er die Rosenstöcke, im zweiten einen etwa 30 Centim. langen Spieß, welcher erst im folgenden Winter abgeworfen wird. Allmählich zertheilt sich das Geweih mannigfaltiger. Im fünften Jahre entsteht eine flache Schaufel, verbreitert sich fortan und theilt sich an den Rändern in immer mehr Zacken, deren Anzahl bis in die zwanzig steigen kann. Das Geweih erreicht ein Gewicht von etwa zwanzig Kilogramm.
Die Behaarung des Elen ist lang, dicht und straff. Sie besteht aus gekerbten, dünnen und brüchigen Grannen, unter denen kurze, feine Wollhaare sitzen; über die Firste des Nackens zieht eine starke, sehr dichte, der Länge nach getheilte Mähne, welche sich gewissermaßen am Halse und an der Vorderbrust fortsetzt und bis zwanzig Centimeter lang wird. Sonderbarer Weise sind die Bauchhaare von rückwärts nach vorn gerichtet. Die Färbung ist ein ziemlich gleichmäßiges Röthlichbraun, welches an der Mähne und den Kopfseiten in glänzendes Dunkelschwarzbraun, an der Stirne ins Röthlichbraune und am Schnauzenende ins Graue zieht; die Beine sind weißlichaschgrau, die Augenringe grau. Vom Oktober bis zum März ist die Färbung etwas heller, mehr mit Grau gemischt. – Das Thier ist kaum kleiner, trägt aber kein Geweih und hat längere und schmälere Hufe sowie kürzere und wenig nach auswärts gerichtete Afterklauen. Sein Kopf erinnert an den eines Esels oder Maulthiers. Im Winterkleide unterscheidet sich das weibliche Elenthier vom Hirsche durch einen senkrecht gestellten, schmalen Streifen unter dem Feigenblatte.
In der Weidmannssprache wendet man alle für Edel- und beziehentlich Damhirsch gültigen Ausdrücke auch für das Elchwild an. Das Schmalthier wird mit dem dritten Jahre fertig und in den folgenden Jahren als Altthier angesprochen. Der Elchhirsch heißt im ersten Jahre Kalb, im zweiten und dritten Spießer oder Gabler, im vierten geringer Elchhirsch, im fünften geringer Schaufler, im sechsten guter Schaufler und in höheren Jahren Haupt- oder Kapitalschaufler. In Ibenhorst zählt man die Enden des Geweihes und spricht demgemäß den Elchhirsch genau wie den Rothhirsch an.
Wilde, einsame, an Brüchen und unzugänglichen Mooren reiche Wälder, namentlich solche, in denen Weiden, Birken, Espen und andere Laubbäume stehen, bilden den Stand des Elchwildes. Der Forst von Ibenhorst besteht aus zweitausend Morgen mit Kiefern, Fichten und Birken bestandenem Höhenboden, sechstausend Morgen Torfmooren und einigen vierzigtausend Morgen Erlenbruch, in welchem einzelne Birken und Eschen eingesprengt sind. Zwischen den Erlenstöcken und an den Rändern der Gräben wachsen in großer Ausdehnung Weidenwerft, Rohr, Schilf, Gräser, Brennnesseln von gewaltiger Höhe und dergleichen mehr, wodurch die wildesten Dickungen hergestellt werden. Ein so beschaffenes und bestandenes Gebiet gewährt diesem Hirsche alle Bedingungen zu einem ihm behaglichen Leben; nicht minder zusagend sind ihm übrigens auch ausgedehnte, nasse Schwarzholzwaldungen, vorausgesetzt, daß in ihnen Weidenarten nicht gänzlich fehlen. Sümpfe und Moore scheinen zu seinem Gedeihen und Wohlbefinden unumgänglich nothwendig zu sein. Das plumpe Geschöpf durchmißt Moräste, welche weder Mensch noch Thier gefahrlos betreten könnten, mit Leichtigkeit. Vom April bis zum Oktober hält es sich in den tiefer gelegenen, nassen Gegenden auf, später sucht es sich erhöhte, welche den Ueberschwemmnngen nicht ausgesetzt und im Winter nicht mit Eis bedeckt sind. Bei stillen, heiterem Wetter bevorzugt es Laubhölzer, bei Regen, Schnee und Nebel Nadelholzdickungen. Aus Mangel an Ruhe oder hinlänglicher Aesung verändert es leicht seinen Standort. Im Ibenhorster Forste begibt es sich im Winter, den Erlenbruch verlassend, nach den Torfmooren und in die hochgelegenen Kieferwaldungen; in Livland, Rußland und Skandinavien streift es weit umher; in Ostsibirien tritt es, wenn auf den Höhen viel Schnee fällt, in die Ebenen herab, zieht in sehr schneereichen Wintern sogar bis in die außerdem streng gemiedenen kahlen Hochsteppen hinaus. Die Thiere mit ihren Kälbern suchen hier, laut Radde, zum Winterstande besonders gern die Nordabhänge gut bewaldeter, namentlich bestrauchter Gebirge auf, wohin der alte Hirsch nicht folgt, weil ihm diese Hölzer, seines weit seitwärts ausgelegten Geweihes halber, hinderlich werden. Ein Bett bereitet sich das Elch in keinem Falle, legt sich vielmehr stets ohne weiteres nieder, gleichviel, ob es Sumpf oder Moor oder ob es trocknen oder schneebedeckten Waldboden zum Orte seiner Ruhe erwählt.
Um die Lebensgeschichte des Elen möglichst vollständig und wahrheitsgemäß schildern zu können, habe ich in Ibenhorst selbst Erkundigungen eingezogen und durch die Güte der Herren Forstmeister Wiese, Oberförster Axt und Förster Ramonaht ebenso ausführliche, wie unsere Kenntnis des Thier es bereichernde Mittheilungen erhalten. Infolge der ihm seit Jahrzehnten gewährten Schonung lebt das Elch in den Ibenhorster Forsten allerdings unter anderen Verhältnissen als in den übrigen Theilen seines Verbreitungsgebietes und hat insbesondere die Scheu vor dem Menschen fast gänzlich verloren, benimmt und beträgt sich jedoch nicht wie ein gefangenes, sondern wie ein freies Thier, bekundet alle Eigenarten eines solchen und darf deshalb immerhin für eine Lebensschilderung als maßgebend erachtet werden.
In seiner Lebensweise weicht das Elenthier vielfach von der des Hirsches ab. Wie dieser schlägt es sich zu Rudeln von sehr verschiedener Stärke zusammen, und nur gegen die Satzzeit hin sondern sich von diesen Rudeln die alten Hirsche ab, gewöhnlich eigene Gesellschaften für sich bildend. In Gegenden, wo es zwar allgemein verbreitet ist, aber doch nicht häufig auftritt, wie beispielsweise in Ostsibirien, rudelt es sich im Winter zu kleinen Trupps, geht dagegen im Sommer stets einzeln oder höchstens das Thier mit seinem Kalbe; in den Ibenhorster Forsten vereinigt es sich im Spätherbste, wenn die Ueberschwemmung der Bruchwaldungen es zwingt, auf den Mooren und im Hochwalde Stand zu nehmen, zu Rudeln von fünfundzwanzig bis vierzig Stücken. Diese Gesellschaften bestehen regelmäßig aus Hirschen und noch nicht fertigen Thieren, weil das Mutterwild, aus übergroßer Sorge um seine Kälber, nicht allein die Hirsche höchst unfreundlich behandelt, sondern ebenso andere Thiere und deren Kälber meist abschlägt. Von einem friedfertigen Zusammenleben der Elche bemerkt man überhaupt wenig. Jedes einzelne Stück hat oft mit dem andern etwas auszumachen, eins vertreibt das andere von der warmgelegenen Stelle, und dem Mutterwilde muß alles übrige weichen: dieses bekundet nicht einmal gegen verwaiste Kälber freundliche Gesinnung, sondern vertreibt sie ebenso rücksichtslos wie jedes sonstige Stück des Rudels aus seiner Nähe. So lange die Brunst sie nicht beeinflußt, zeigen sich die Hirsche weit geselliger als die Thiere, nehmen beispielsweise mutterlose Kälber ohne weiteres in ihre Rudel auf; während der Brunst dagegen bethätigen auch sie die Unfriedsamkeit ihres Geschlechtes, suchen, jeder für sich, so viele Thiere als möglich zusammen zu treiben und zusammen zu halten und schlagen alle anderen Hirsche von sich ab. Im Frühjahre zerstreuen sich die Rudel vollständig und leben, abgesehen von den Thieren mit ihren Kälbern, einzeln oder zu zweien und dreien vereinigt.
Mehr noch als den übrigen Hirschen sind dem Elche Störungen aller Art aufs tiefste verhaßt. Es verlangt unbedingte Ruhe und verläßt eine Gegend, in welcher es wiederholt behelligt wurde. In den Ibenhorster Forsten, wo es sich an den Menschen und sein Treiben nach und nach gewöhnt hat, gibt sich dieses Bedürfnis als überraschende oder ergötzende Trägheit kund. Hier ist unser Wild so sorglos und faul geworden, daß es sich kaum rührt, wenn es etwas durch das Gehör vernimmt, und nur dann von seiner Lagerstätte sich erhebt, wenn man ihm bis auf vierzig und selbst dreißig Schritte nahe gekommen ist. Aber auch dann noch trollt es nicht immer weg, bethätigt vielmehr oft eigenwillige Widerspenstigkeit oder Störrigkeit, gepaart mit plumper Neugierde, welche auf seine geistigen Befähigungen ein nicht eben günstiges Licht wirft.
Wo es sich ungestört weiß, bettet es, abgesehen vielleicht von kurzer Ruhe, nur in den Vor- und Nachmittagsstunden und streift schon von vier Uhr des Nachmittags an in den Abend-, den ersten Nacht-, den Früh- und Morgenstunden umher; im entgegengesetzten Falle wählt es die Nachtzeit, um nach Aesung auszuziehen. Nach Wangenheim besteht diese in Blättern und Schößlingen der Moorweide, Birke, Esche, Espe, Eberesche, des Spitzahorn, der Linde, Eiche, Kiefer, Fichte, in Haide, Moorrosmarin, jungem Röhricht und Schilfe, in schossendem Getreide und Lein. In den Ibenhorster Forsten geht das Elch alle Baum- und Straucharten an, welche daselbst wachsen, außer den genannten beispielsweise noch Faulbaum, Hasel und Erle. Von letzterer nimmt es, namentlich seitdem die Weidenarten seltener geworden sind, besonders gern die jährigen Ausschläge, zweijährige Schößlinge ab und zu, jedoch schon seltener, ältere Zweige und Schossen dagegen niemals. Im Moore äst es sich vorzugsweise von Haidekraut, Wollgras und Schachtelhalmen, mit denen es zuweilen seinen Wanst vollständig anfüllt. In den Monaten Mai und Juni bilden letztere und Kuhblumen seine hauptsächlichste Aesung. Neuere Beobachter geben übereinstimmend an, daß der Elch sich nicht von Getreide äst. »So oft ich mich darnach erkundigt habe«, schreibt mir O. von Löwis, »hörte ich in Livland niemals davon, daß Elenthiere ins Getreide oder in ein Flachsfeld gehen und hier durch Aesung Schaden verursachen sollten. Im Gegentheile bemerkte ich oft, daß sie unmittelbar neben Getreide wachsendes Röhricht und Gezweige angenommen, also jenem vorgezogen hatten.« Auch Oberjägermeister von Meyerinck bemerkt ausdrücklich, daß die Elche der Ibenhorster Forsten nicht vom Getreide sich äsen. »Getreidefelder«, sagte er, »besuchen sie gar nicht, auch Kartoffeln und andere Feld- und Baumfrüchte nehmen sie nicht. Sie nähren sich von Weidenwerft, den kleinen Torfweiden, Haide- und Heidelbeerkraut, Kiefernadeln und sogar von Kienpost ( Ledum palustre), welches Gewächs bekanntlich eine Giftpflanze ist und sonst von keiner Wildart angerührt wird. Den Feldern schaden sie höchstens einmal dadurch, daß sie zufällig durch das Getreide wechseln und mit ihren großen Fährten dasselbe niedertreten.« Nach den Mittheilungen meiner Ibenhorster Gewährsmänner behält Wangenheim Recht. Junge Saat nimmt das Elch allerdings ebensowenig wie in den Aehren stehendes Getreide, wohl aber letzteres, während es schoßt, den Hafer, während er in Milch steht. Dementsprechend besucht es Getreidefelder im Mai und Juni sehr regelmäßig, wogegen es dieselben früher oder später nicht betritt. Von Meyerincks Angabe, daß unser Thier auch von Kienpost sich äse, scheint nach Ansicht der Ibenhorster Forstleute irrig zu sein, da keiner von diesen eine dieselbe bestätigende Wahrnehmung gemacht zu haben versichert. Falls das Elch Weidenschößlinge in genügender Menge und Auswahl haben kann, äst es sich oft ausschließlich von diesen: den Wanst der vom Prinzen Friedrich Karl von Preußen und von Meyerinck erlegten Elchhirsche fand man einzig und allein mit zermalmten Blättern und Holzfasern des Weidenwerfts angefüllt. In Ostsibirien äst sich das Elch hauptsächlich von den niedrigen Gebüschen der Zwerg- und Buschbirke, mit besonderer Leckerhaftigkeit aber auch von den fleischigen Wurzeln einiger Wasserpflanzen, denen zu Liebe es im Sommer zu den Thalseen herabsteigt, und welche es tauchend gewinnen muß. Aehnlich verfährt es auch in Ibenhorst, um sich einzelner im Wasser stehenden Pflanzen zu bemächtigen. Grasend sich zu äsen, wie andere Hirsche thun, vermag es nicht, weil es die lange, schlotternde Oberlippe daran hindert, wohl aber ist es im Stande, ebenso wie schossendes Getreide, höhere Grashalmen abzupflücken. Hierzu wie zum Abbrechen von Gezweigen weiß es seine rüsselförmige Hängelippe sehr geschickt zu gebrauchen. Beim Abrinden setzt es seine Schneidezähne wie einen Meißel ein, schält ein Stückchen Rinde los, packt dieses mit den Zähnen und Lippen und reißt dann nach oben zu lange Streifen der Rinde ab. Höhere Stangen biegt es mit dem Kopfe nieder, bricht dann die Kronen ab und äst sich von dem Gezweige und von der Rinde. Hierbei bevorzugt es, wie leicht erklärlich, alle saftrindigen Bäume und Gesträuche, als da sind Espe, Esche, Weide und Pappel, derart, daß es nicht selten selbst sehr starke Espen noch vollständig entrindet. Unter den Nadelbäumen zieht es die Kiefer allen übrigen vor, wogegen es die Fichte nur im höchsten Nothfalle angeht. In Ibenhorst kümmert es sich so wenig um die Waldarbeiter, daß es während deren Gegenwart auf frischen Kieferschlägen sich einfindet, um die Nadeln der gefällten Bäume zu verzehren. Wie man beobachtet hat, liebt es, wohl schon der Bequemlichkeit halber, das Gezweige der Fällbäume mehr als das vom Winde abgebrochener Aeste, weshalb man, ihm zu Gefallen, im Winter in regelmäßigen Zeiträumen größere Kiefern zu werfen pflegt. Selbst mehr als fingerdicke Zweige vermag es auszunutzen; es zermalmt dieselben so vollständig, daß man in der Losung stets nur sehr fein zerschrotene Holzfasern findet. Wasser zum Trinken ist ihm jederzeit Bedürfnis, und es bedarf davon viel, um sich zu sättigen.
Die Bewegungen des Elenthieres sind weit weniger ebenmäßig und leicht als die des Edelwildes. Es vermag nicht anhaltend flüchtig zu sein, trollt aber sehr schnell und mit unglaublicher Ausdauer manche Schriftsteller behaupten, daß es in einem Tage dreißig Meilen zurücklegen könne. Beim Sichtbarwerden eines Menschen oder vor dem Nehmen eines Hindernisses pflegt es einen Augenblick Halt zu machen und dann erst weiter zu gehen, bei Gefahr sich selten zurückzuwenden, vielmehr mit derselben Gemächlichkeit wie früher fortzutrollen.
Eine höchst sonderbare Bewegungsart in wasserreichen Mooren schildert Wangenheim. Das Elch läßt sich da, wo der Boden es nicht mehr tragen kann, wenn es läuft, auf die Hessen nieder, streckt die Vorderläufe gerade vorwärts aus, greift mit den Schalen ein, stemmt mit den Hessen nach, und gleitet so über die schlammige Fläche; da, wo diese ganz schlotterig ist, legt es sich sogar auf die Seite und hilft sich durch Schlagen und Schnellen mit den Läufen fort. Förster Ramonaht versichert, dasselbe wiederholt gesehen zu haben und bestätigt Wangenheims Mittheilungen in jeder Beziehung. »In gar zu grundlosen Sümpfen«, bemerkt O. von Löwis hierzu, »bleibt das Elen übrigens zuweilen doch jämmerlich stecken. So versank im April des Jahres 1866 auf dem Gute Ohlershof in Livland ein starker Hirsch derartig in dem Schlamme eines abgelassenen Sees, daß herzukommende Leute ihn mit Stricken anbinden konnten, hierauf mit vieler Mühe herauszogen und auf das Gehöft brachten, woselbst er sodann drei Wochen lang in einem Pferdestalle gehalten wurde.« Gefährlich werden ihm insbesondere schlammige Stellen mit steilen Ufern, deren Höhe es mit den Vorderläufen nicht erreichen kann, wogegen es auch solche Hindernisse leicht überwindet, wenn es die Vorderläufe zusammengeknickt auf nicht nachgebendes Erdreich legen kann, worauf es dann den Leib ohne sonderliche Anstrengung nachzieht und damit wieder festen Boden gewinnt. Im Schwimmen ist das Elch Meister. Es geht nicht bloß aus Noth in das Wasser, sondern, wie manche Rinderarten, zu eigener Lust und Freude, um sich zu baden und zu kühlen, sucht auch in Ostsibirien die tieferen Gebirgsschluchten auf, in denen der Schnee lange liegen bleibt, und liebt es, auf ihm sich herumzuwälzen. Auf glattem, schneefreiem Eise kann es, trotz der Behauptung des Bischofs von Upsala, nicht lange gehen, und wenn es auf den glatten Spiegel einmal gefallen ist, kommt es nur sehr schwer wieder auf die Läufe. Anfänglich, so versichern meine Ibenhorster Freunde, läuft unser Hirsch auch auf glattem Eise recht gut, bald aber »erwärmen sich« oder, was wohl richtiger sein dürfte, erweichen die Schalen seiner Hufe, und dann stürzt er sehr leicht und öfters nach einander. Während des Trollens vernimmt man ein hörbares Anschlagen der Afterklauen an die Ballen; dieses Geräusch nennt der Weidmann »Schellen«. Bei eiligem Laufe legt der Elchhirsch das Geweih fast wagerecht zurück und hebt die Nase hoch in die Höhe; deshalb strauchelt er öfters und fällt auch leicht nieder; dann zuckt er, um sich wieder aufzuhelfen, in eigenthümlicher Weise mit den Läufen und greift namentlich mit den Hinterläufen weit nach vorwärts. Hierauf gründet sich die Fabel, daß das Thier an der Fallsucht leide. Ein Elenthier, welches einmal im Laufe ist, läßt sich durch nichts beirren, weder durch das Dickicht des Waldes, noch durch Seen oder Flüsse, noch durch Sümpfe, welche vor ihm liegen. Die Fährte macht den Eindruck, »als wenn sie ein großer schwerer Mastochse hinterlassen hätte« und hat auch insofern etwas eigenthümliches, als es keine sicheren Merkmale gibt, um die Fährten der Hirsche von denen der Thiere zu unterscheiden. Nach Axt kennzeichnet sich allerdings auch die Fährte des Elchhirsches durch ihre rundere, mehr zusammengedrückte Form, wogegen die des Thieres länglicher und mehr eigestaltig ist; es gehört jedoch ein ungemein geübtes Auge dazu, um diese wenig bemerklichen Unterschiede herauszufinden, umsomehr, als die Schalen selten gänzlich unverletzt, vielmehr in der Regel vorn und seitlich abgestoßen oder sonstwie verunstaltet sind.
Das Elch vernimmt ausgezeichnet, äugt und wittert oder windet aber weniger gut. Hinsichtlich seiner geistigen Fähigkeiten scheint es sein plumpes und dummes Aussehen nicht Lügen zu strafen. Seine Handlungen deuten auf geringen Verstand. Es ist wenig scheu und noch viel weniger vorsichtig, lernt kaum, wirkliche Gefahr von bloß eingebildeter zu unterscheiden, betrachtet seine Umgebung im ganzen theilnahmlos, fügt sich nur schwer in veränderte Verhältnisse und bekundet überhaupt ein wenig bildsames Wesen. Seine geselligen Eigenschaften sind in keiner Weise entwickelt; von einem festen Zusammenhalte des Rudels bemerkt man nichts: jedes einzelne Stück desselben handelt vielmehr nach eigenem Ermessen, und nur das Kalb folgt seiner Mutter, nicht aber das gesammte Rudel einem Leitthiere, wie dies bei anderen Hirschen der Fall zu sein pflegt. Fressen und Ruhen scheinen dem Elche als die höchsten Lebensaufgaben zu gelten; nur die Brunst verändert das gleichmäßige Einerlei seines Wesens.
Alte Elchhirsche werfen im November, frühestens im Oktober, jüngere um mehr als einen Monat später ab; erstere fegen im Juli, letztere erst im August, zuweilen noch später. Die Neubildung des Geweihes geschieht insofern in eigenthümlicher Weise, als dasselbe anfänglich ungemein langsam und erst vom Mai an schneller wächst. Sichtbar werden die Kolben nicht vor Ende des genannten Monats oder vor dem Anfange des Juni, weshalb auch das Verecken kaum eher als zwei oder drei Monate vor Beginn der Brunstzeit stattfindet. Diese tritt in den Ostseeländern Ende Augusts, im asiatischen Rußland im September oder Oktober ein. Um diese Zeit sind die Hirsche auf das höchste erregt. Während man sonst nur in seltenen Fällen einen dem Schrecken des Rothwildes ähnelnden, jedoch bedeutend stärkern und tiefern, hell nachklingenden Laut und auch diesen vielleicht bloß vom alten Thiere vernimmt, orgeln die Elchhirsche jetzt nach Art des Edelhirsches, jedoch in kurzen Absätzen und mehr plärrend als schreiend, fast wie der Damhirsch, nur in viel tieferem Tone, fordern damit alle gleichstrebenden Hirsche zum Zweikampfe heraus und fechten diesen mit Wuth und Ingrimm durch, nehmen leicht auch selbst den Menschen an, laufen, die Nase zum Boden herabgesenkt, als wollten sie eine Fährte aufnehmen, unstet und rastlos bei Tage und Nacht umher, tagtäglich viele Meilen durchmessend, treiben die Thiere tagelang ununterbrochen, verfolgen sie weit und schwimmen ihnen selbst durch die breitesten Ströme nach. Junge Hirsche werden von den älteren abgeschlagen und finden selten Gelegenheit, ihren Trieb zu befriedigen; dann trollen sie wie unsinnig in gerader Richtung fort, besuchen selbst bebaute Gegenden, welche sie sonst ängstlich meiden und kommen endlich ebenso sehr vom Leibe wie die Alten durch das wirkliche Brunsten. Der Beschlag selbst dauert kurze Zeit, wird aber oft wiederholt. Nach dessen Vollendung steigt der Hirsch niemals ab, sondern das Thier rückt unter ihm weg. Sechs- bis achtunddreißig Wochen geht das Elchthier hoch beschlagen; Ende Aprils oder anfangs Mai setzt es, zum erstenmal nur ein Kalb, bei jedem folgenden Satze aber deren zwei, meist ein Pärchen, seltener zwei desselben Geschlechtes. Drei Kälber bei einem Satze sind ein seltenes Vorkommnis, gehen auch als Schwächlinge meist zu Grunde. Die Geburt scheint schwieriger von Statten zu gehen als bei anderen Hirscharten; denn das setzende Thier bekundet, nach den Beobachtungen des Försters Ramonaht, durch sein Gebaren, daß die Wehen sehr heftig und schmerzhaft sein müssen, beißt sich an Zweigen oder in der Moosdecke fest, streckt und windet sich abwechselnd beim Treiben der Frucht und verendet in nicht allzu seltenen Fällen während der Wehen. Sofort nach glücklicher Geburt der Kälber verzehrt es, wie viele andere Säugethiere, Wiederkäuer insbesondere, ebenfalls zu thun pflegen, den Mutterkuchen und wendet sich sodann liebevoll seinen Kälbern zu, um sie zunächst zu reinigen. Gleich nach dem Ablecken springen diese auf, taumeln aber noch wie berauscht mit dem Kopfe hin und her und müssen anfangs von der Mutter fortgeschoben werden, wenn sie sich bewegen sollen; doch schon am dritten oder vierten Tage folgen sie dem Elchthiere, welches sie fast bis zur nächsten Brunstzeit besaugen, selbst dann noch, wenn sie bereits so groß geworden sind, daß sie sich unter die Mutter hinlegen müssen. In den ersten Tagen ihres Lebens sind sie so ungestaltet, daß sie in mehr als einer Hinsicht an einen Esel erinnern, und mit diesem Aussehen steht ihre Unbeholfenheit vollständig im Einklange. O. von Löwis schreibt mir, daß sie sich während der ersten Jugendzeit, wenn sie überrascht wurden, sofort niederlegen und widerstandslos aufnehmen und forttragen lassen. Sehr groß ist die Anhänglichkeit und Liebe der Mutter zu ihren Kälbern. Sie vertheidigt selbst die getödteten Jungen, und irrt, wenn diese ihr geraubt wurden, oft noch tagelang suchend auf der Unglücksstelle umher.
Außer dem Menschen werden dem Elch, trotz seiner Stärke, mehrere andere Feinde gefährlich: vor allen Wolf, Luchs, Bär und Vielfraß. Der Wolf reißt die Elche gewöhnlich im Winter bei hohem Schnee nieder; der Bär pflegt meistens nur einzelne Thiere zu beschleichen und steht vom Angriffe eines Rudels ab; der Luchs und unter Umständen der Vielfraß springen auf ein unter ihnen weggehendes Elen, krallen sich am Halse fest und beißen ihm die Schlagadern durch. Sie sind als die gefährlichsten Feinde des wehrhaften Wildes anzusehen; Wölfe und Bären dagegen haben sich vorzusehen: denn das Elch versteht sich, auch wenn es das kräftige Geweih nicht besitzt, erfolgsam zu vertheidigen, indem es die harten und scharfen Schalen seiner Vorderläufe mit ebenso viel Geschick als Nachdruck gebraucht. Ein einziger, richtig angebrachter Schlag mit diesen, durchaus nicht zu unterschätzenden Waffen genügt, um einen Wolf für immer niederzustrecken oder ihn doch lendenlahm zu machen. Für diese Annahme liefern selbst die Ibenhorster Elche dann und wann überzeugende Belege. So wurde vor mehreren Jahren der Hund eines dortigen Forstbeamten, angesichts seines Herrn, von einem alten Elchthiere, welches aus der benachbarten Feldmark eines Aasjägers zurückgetrieben werden sollte, angenommen, verfolgt und, da derselbe in dem tiefen Schnee nicht rasch genug flüchten konnte, bald eingeholt, zu Boden geschlagen und auch nunmehr noch mit den Schalen der Vorderläufe so heftig bearbeitet, daß er binnen wenigen Minuten zu einer unförmlichen Masse geworden war. Der Hund fiel als Opfer der seinem Herrn bewiesenen Treue; denn dieser konnte sich einzig und allein dadurch vor dem in Wuth gerathenen Thiere retten, daß er jenen auf dasselbe hetzte. Alte Thiere mit Kälbern sind regelmäßig angrifflustiger als die Hirsche; aber auch diese nehmen, namentlich in der Brunstzeit, den Menschen an. Dies erfuhr unter anderen der Ibenhorster Forstwart Müller, als er im September 1873 mit seinem Hunde über die Wiesen der tieferen Stellen des Forstrevieres ging. Ohne von dem Manne und seinem Hunde gereizt worden zu sein, näherte sich ihm ein starker Elchhirsch, nahm ihn in der nicht zu verkennenden Absicht, ihm den Garaus zu machen, ohne weiteres an, zwang ihn, unter einem auf erhöhten Rosten stehenden Heuhaufen Schutz zu suchen, belagerte ihn hier, verfolgte ihn, als er sich, von einem Heuhaufen zum anderen flüchtend, zu retten suchte, bis vor die Thüre eines Hauses, welches er schließlich glücklich erreicht hatte, und wollte sich selbst von hier nicht verjagen lassen. Wahrscheinlich erregte auch in diesem Falle der unseren Forstwart begleitende Hund den Zorn des Elchhirsches; es sind jedoch Fälle bekannt, daß auch nicht von Hunden begleitete Männer von ergrimmten Elchen angenommen wurden. Nach Versicherung des Försters Ramonaht soll man dem verfolgenden Elchhirsche übrigens verhältnismäßig leicht und zwar dadurch entgehen können, daß man bei jedem von ihm unternommenen Angriffe rasch zur Seite springt. Kurze Wendungen soll der Elchhirsch nicht gern ausführen und in der Regel von dem Verfolgten ablassen, wenn dieser ihm in der angegebenen Weise auszuweichen sucht.
Abgesehen von Raubthieren und lästigen Schmarotzern bekümmert sich das Elch um andere Thiere sehr wenig. Gleichwohl geschieht es zuweilen, daß es sich bei Rinderherden einfindet. So kamen, wie Radde mittheilt, im Spätherbste des Jahres 1851 sechs Elenthiere zum Tarainor und gesellten sich zu den Rindviehherden, mit denen sie einige Tage friedlich ästen. Beunruhigt durch die Bewohner der Steppen, welche solche Thiere niemals gesehen hatten, kehrten sie auf demselben Wege, den sie beim Kommen eingeschlagen, wieder zurück, hielten sich noch einige Zeit bei der Grenzwacht Duruluginsk auf und wanderten sodann von hieraus in die Wälder. Vierzehn Tage, bevor Oberjägermeister von Meyerinck zur Elchjagd im Ibenhorster Forste eintraf, anfangs September 1867, trug sich dort eine ähnliche Geschichte zu. Eines Nachmittags sieht der das Vieh beaufsichtigende Hirt aus dem benachbarten, etwa achthundert Schritte entfernten Walde einen starken Elchhirsch hervortreten und schnurstracks auf seine Kuhherde lostrollen. Als derselbe sich genähert hat, bemerkt ihn der Herdenstier, stürmt auf den Fremdling los und greift ihn an. Ein gewaltiger Kampf entspinnt sich; denn der durch die gerade stattfindende Brunst aufs höchste erregte Elchhirsch nimmt die Herausforderung an. Bald hat er den Sieg errungen und den Bullen zu Boden geworfen. Und nunmehr forkelt er den geschlagenen Feind unter lautem Gebrüll, das Geschrei des Hirten nicht beachtend, so unbarmherzig in die Rippen, daß dieser nicht im Stande ist, wieder auf die Beine zu kommen. Der Hirt läuft nach dem benachbarten Gehöfte, um Hülfe zu holen; aber auch noch, als mehrere Menschen hinzukommen und gemeinschaftlich schreien und lärmen, läßt sich der Elchhirsch nicht abhalten, den Bullen mit seinem Geweih weiter zu bearbeiten, und erst, als er wahrnimmt, daß der unvorsichtige Angreifer gedemüthigt, erschöpft und wehrlos am Boden liegt, entfernt er sich siegesstolz und ruhig, um nach demselben Walde, aus welchem er erschienen, zurückzukehren. Der Bulle war arg zerstoßen und hatte mehrere schwere Verletzungen davongetragen.
Jung eingefangene Elenthiere werden zahm und können selbst zum Aus- und Eingehen gebracht werden; bei uns halten sie jedoch die Gefangenschaft selten längere Zeit aus. In Schweden sollen früher gefangene Elche so weit abgerichtet worden sein, daß man sie zum Ziehen der Schlitten verwenden konnte; ein Gesetz verbot aber derartige Zugthiere, »weil deren Schnelligkeit und Ausdauer die Verfolgung von Verbrechern unmöglich gemacht haben könnte«. Spätere Versuche, Elche zu Hausthieren zu gewinnen, sind gescheitert. Die Jungen schienen zwar anfangs zu gedeihen, magerten aber später mehr und mehr ab und starben regelmäßig bald dahin. Wangenheim erzählt, daß auf den königlichen Gestüten sechs Jahre lang derartige Versuche angestellt wurden. Die jung eingefangenen Kälber ließ man von Kühen, welche sich willfährig zeigten, säugen und bemuttern; sie gingen mit auf die Weide und wuchsen heran. Wenn die Sonne zu heiß schien, und wenn die Bremsen flogen, eilten sie immer nach ihren Ställen zurück, um Schutz vor beiden Plagen zu suchen. In den Ställen band man sie, wie Kühe, mit Halftern fest. Im Sommer ließ man sie ihre Aesung sich selbst suchen, im Winter fütterte man sie mit Heu und Hafer. Aller Sorgfalt ungeachtet starben die meisten Kälber bereits im zweiten, die überlebenden sicher im dritten Jahre an »einem zu dünnen Leibe«, d. h. allgemeiner Abmagerung und Entkräftung, welche sie im Hochsommer befiel.
Ein junges Elch, welches ich im Berliner Thiergarten sah, war von dem Oberförster Ulrich in den Ibenhorster Waldungen verlassen aufgefunden und aufgezogen worden. »Der Pfleger«, so berichtete mir Freund Bolle, »ernährte es während des ersten Vierteljahres ausschließlich mit frischer Milch einer eigens dazu bestimmten Kuh, wovon es täglich fünfzehn Stof oder achtzehn Liter erhielt. Doch blieb es hierbei matt, schwächlich und gleichwohl scheu. Demnächst wurde die Menge der Milch auf sechs Stof täglich herabgesetzt. Es wurden dafür gleichzeitig Weidenblätter gefüttert, wieder einige Monate lang. Zuletzt erhielt es jeden Tag Roggenmehl mit drei Stof Milch. Außerdem äste es sich frei im Garten mit allerlei Kräutern, mit Beeren, Runkelrübenblättern etc., verschmähte auch den reifenden Roggen auf dem Felde nicht und fraß mit Begierde Knospen, Rinde und junge Zweige von Weiden, Espen, Birken, Faulbäumen, Ebereschen etc., dabei vielen Schaden anrichtend. Im Laufe des Jahres wurde es ziemlich zahm. Bei großer Hitze hielt es sich am liebsten in einem kühl gelegen, leeren Anbau des Hauses auf. Erst gegen Abend ging es auf Aesung aus.«
»Das Thier«, sagt August Müller, welcher von Ulrich selbst berichtet wurde, »wuchs heran, lief den Menschen nach wie ein zahmer Hammel, und leckte seinem Herrn beim Wiedersehen zärtlichst Hand und Gesicht. Für den Garten, in welchen es anfangs nur zur Gesellschaft ging, entwickelte das junge Elch bald eine besondere Theilnahme, da ihm, nachdem es der Amme entwachsen war, auch die Nützlichkeit solcher Anlagen einleuchtend wurde. Da sich bald der Garten vor ihm schloß, sprang es gewandt über den Zaun. Dieser wurde bis gegen zwei Meter erhöht; aber auch diese Probe bestanden seine wohlgerathenen Glieder. Wenn sein Herr in den Forst ging, mochte es ihn gern begleiten und mußte oft gewaltsam zurückgetrieben werden. Einst wurde ihm gestattet, mitzugehen. Es folgte kreuz und quer und fand im Walde auch Seinesgleichen. Die sah es aufmerksam an, und sie schienen es auch lebhaft anzuregen; jedoch gefiel es ihm beim Herrn Oberförster besser, und es kehrte getreulich mit ihm aus dem Walde zurück.«
»Anfangs Februar 1861«, fährt Bolle fort, »kam es wohlbehalten in Berlin an und wurde in einem Gehege untergebracht, welches ihm Bewegung gestattete. Man hielt es möglichst nach den gegebenen Vorschriften, und es befand sich dabei bis gegen den Sommer hin anscheinend wohl. Als die erste Hitze kam, schien ihm dies unbehaglich, obwohl es nicht förmlich erkrankte. Ueberhaupt ist das Thier, seinem Benehmen nach zu schließen, bis ganz kurz vor seinem Tode nicht krank gewesen. Es erlag der ersten Krankheit, welche es befiel.«
Aehnliches habe ich später bei mehreren von mir in Gefangenschaft gehaltenen Elenthieren ebenfalls erfahren. Das erste, welches unter meine Pflege kam, stammte aus Schweden und berechtigte bei seiner Ankunft durchaus nicht zu erfreulichen Hoffnungen für die Zukunft. Der ausgesuchtesten Pflege ungeachtet kränkelte es fortwährend, und wenn ich wirklich einmal glaubte, es herausgefüttert zu haben, fiel es immer bald wieder ab. Seine Nahrung war anfangs sehr gemischter Art, weil es nie längere Zeit dasselbe Futter annehmen wollte. Alle übrigen Hirsche, welche ich hielt, befanden sich bei gleichmäßigem Futter vortrefflich und verursachten keine besondere Mühe; das Elch hingegen schien der vorsorglichsten Pflege zu spotten. Ich fütterte es mit Laub, jungen Zweigen, auch solchen von Nadelholz, eingemaischtem Körnerfutter, Brod und dergleichen, und es nahm auch das ihm gebotene Futter anscheinend mit Behagen an, immer aber nur eine Zeitlang; dann verschmähete es plötzlich dieselben Stoffe, welche ihm früher als Leckerei erschienen waren. Daß das Thier unter solchen Umständen seinem Ende mit Riesenschritten entgegeneilte, konnte kaum zweifelhaft sein. Lange Zeit zersann ich mir den Kopf, wie dem armen Geschöpfe wohl zu helfen: endlich kam mir der Gedanke, daß die Gefangenkost, welche wir bisher gereicht, durch einen Zusatz von Gerbstoff nur verbessert werden könnte. Der Gedanke wurde ausgeführt und – unser Elch fraß von Stunde an ohne Widerstreben, ja ohne Auswahl das ihm vorgeworfene Futter, besserte sich fortan in jeder Hinsicht und befand sich bald so wohl, als ein derartiges Thier überhaupt in der Gefangenschaft sich befinden kann.
Ein großer Uebelstand für das Halten in der Gefangenschaft ist, wie ich mich sattsam überzeugte, die Unfähigkeit des Elch, von Pflanzen sich zu äsen, welche auf dem Boden wachsen. Seine lange, schlotterige Oberlippe verwehrt ihm, kurzhalmige Gräser aufzunehmen, und weist es auf niedere Baumzweige an. Niemals habe ich gesehen, daß es auch nur ein Hälmchen Gras abgebissen hätte; es wird ihm schon schwer, das auf den Boden geworfene, abgeschnittene Futter zu sich zu nehmen, weshalb ihm auch feine Nahrung in einer ziemlich hoch an der Wand angenagelten Krippe vorgeworfen werden muß.
Von anderen Hirschen unterscheidet sich das Elch in seinem Betragen ebensosehr wie in seinem Aussehen. Man darf es niemand verdenken, wenn er das Thier als sehr häßlich erklärt; wir wollen nicht einmal den Berlinern zürnen, welche es als einen Esel ansahen: denn wirklich hat der über alles Maß verlängerte, plump gebaute, langohrige Kopf manche Ähnlichkeit mit dem des gedachten Thieres, nur daß er noch häßlicher ist. Das Elch macht ganz den Eindruck eines vorweltlichen Wesens, und dieser Eindruck wird verstärkt durch das Betragen. Im Vergleiche zu seinen Verwandten ist es träge und schwerfällig, geistig wie leiblich. Es bekundet wenige von den liebenswürdigen Eigenschaften der Hirsche, dagegen alle Unarten derselben. Mit seinem Wärter befreundet es sich; doch ist ihm niemals gänzlich zu trauen. Es hört auf einen ihm beigelegten Namen, kommt auf den Ruf herbei, läßt sich streicheln, putzen, mit einem Halfter belegen und in den Stall ziehen, aber nur so lange, als es ihm eben behagt. Gegen denselben Mann, welchem es ruhig nachfolgte und aus dessen Hand es Futter nahm, zeigt es sich plötzlich störrisch, legt, wie der stutzige Esel oder das Lama, das Gehör nach hinten, beugt den Kopf hernieder, schielt mit den Lichtern nach oben und schlägt dann plötzlich mit dem einen Vorderlaufe in gefährlicher Weise, weil es sehr hoch reicht und den Kopf eines Menschen noch bequem treffen kann. Der erste Wärter meiner Gefangenen kam mehrmals in augenscheinliche Gefahr, weil er nicht so gut, wie der zweite, den verschiedenen Launen des Thieres zu begegnen verstand.
Gegen andere Thiere zeigt sich das gefangene Elch sehr gleichgültig, beachtet Hunde, welche die übrigen Hirsche in große Aufregung versetzen, nicht im geringsten, bekümmert sich aber auch um Verwandte, welche in oder neben seinem Raume eingestellt sind, nur wenig. Mit Renthieren verträgt es sich vortrefflich, vielleicht weil ihm deren ruhiges Wesen zusagt. Die flinken und lebendigen Hirscharten scheinen ihm verhaßt zu sein; es versucht, auch sie zu schlagen, und duldet sie, ohne feindliche Versuche zu machen, erst dann, wenn es sich von der Nutzlosigkeit seiner Anstrengungen überzeugt hat.
Die Umhegung, in welcher man ein Elch hält, muß hoch sein; denn ungeachtet der Plumpheit aller seiner Bewegungen setzt es ohne Beschwerde über eine Wand von zwei Meter Höhe hinweg, nimmt dazu nicht einmal einen Anlauf. Es geht ruhig bis an die betreffende Umzäunung, stellt sich plötzlich auf die Hinterläufe, hebt die vorderen zusammengebogen über das Gitter weg und wirft sich nun gemächlich nach vorn, die langen Hinterläufe nach sich ziehend. Mein Gefangener verließ wiederholt seinen Pferch, um im benachbarten Gebüsch des Gartens zu weiden. Es würde ihm leicht gewesen sein, auch die Umhegung des Gartens selbst zu überspringen; daran dachte er jedoch nie. Gewöhnlich legte er sich ruhig außerhalb seines Gitters nieder und duldete ohne Widerstreben, daß ihm der Wärter einen Halfter umlegte, um ihn wieder zurückzuführen.
Man erlegt das Elch entweder auf dem Anstande oder auf großen Treibjagden und in Lappen und Netzen. Im hohen Norden versuchen die Jäger im Winter, ihr Wild auf Schneeschuhen zu jagen, und bemühen sich, es auf das Eis zu treiben, wo sie ihm dann bald den Garaus machen. Der Gewinn, welchen der Mensch von dem erlegten Thiere zieht, ist beträchtlich. Wildpret, Fell und Geweihe werden ebenso wie beim Hirsche verwendet. Das Fleisch ist zäher, das Fell aber fester und besser als das des Edelwildes. Elenhaut wurde, namentlich im Mittelalter, hochgeachtet und theuer bezahlt. »Sein Haut«, sagt der alte Geßner, »gibt gar gute Leybgöller, das regen, auch stich, vnd schwärtschläg aufhebt, vnd etwan annstatt eins harneschs zu vnsern zeyten angelegt wirt. Ein Ellendshaut gilt etwann drey biß in vier Ducaten, vnd wirt als vnderschidlich von einer Hirtzenhaut erkennt, daß sy lufftlöcher hat, vnd der so sy aufblaßt des athens in der übergehebten Hand empfindet.« Auch noch in späterer Zeit schätzte man dieses Wildleder viel höher als anderes und verfolgte deshalb das Elch mehr als billig. So ließ Kaiser Paul der Erste in Rußland einen förmlichen Vernichtungskrieg gegen die Elche führen, um die zur Beinbekleidung seiner Reiter nach seiner Ansicht unbedingt erforderlichen Elenhäute zu erhalten. Bei mehreren nördlichen Völkern gelten die knorpeligen Stangen, die Ohren und die Zunge als Leckerbissen. Lappländer und Sibirier spalten die Sehnen und verwenden sie wie die der Renthiere. Besonders die harten und blendend weißen Knochen werden ungemein gerühmt. In früheren Zeiten wußte man noch weit mehr aus dem Elenthiere zu machen. Es wurden allerlei Heilmittel von ihm gewonnen, und der Aberglaube fand reichliche Nahrung durch die wunderbaren Kuren, welche man damit bewirkte; galt ja doch das Thier den alten Preußen als eine Gottheit! Insbesondere Elenthierklauen standen, weil man sie als eine treffliche Arznei gegen fallende Sucht und andere Gebresten ansah, hoch in Ehren wie im Preise und wurden zerfeilt eingenommen, in Ringform getragen, als Amulete verwendet und sonstwie benutzt, auch oft verfälscht, d. h. durch Kuhklauen ersetzt. Gescheidte Leute gaben freilich schon zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts nicht viel auf den mit solchen Klauen getriebenen Heilschwindel. »Herr Geßner«, bemerkt sein Uebersetzer, »sagt, Er habe etwann erfahren, das söllichs geholffen, etwann habe es nit helfen wollen, vnd vermeinet, was also der arzney gebraucht werde, da etwas aberglauben bey sein müß, daß dieselb ye dem glauben nach, dessen der sy nimpt, vil oder wenig helffe. So seye diese verwänung, daß Ellendsklaw für söllichen siechtagen (fallende Sucht) gut sey, dahär entstanden, diweyl es täglich auch dise kranckheit hat. – Anstatt der Ellendsklawen, da sich dann wol zu verwarnen, verkauffen die landfarer etwan kuklawen; doch so man es feylet vnd auff kolen wirfft, hat es ein guten geruch, da kuhorn stinckt.« Man ersieht aus letzterer Angabe, daß die Leichtgläubigkeit gerechterweise schon damals bestraft wurde.
Aller Nutzen, welchen das Elenthier bringen kann, wiegt bei weitem den Schaden nicht auf, welchen es verursacht. Das Thier ist ein wahrer Holzverwüster und wird geregelten Forsten so gefährlich, daß Hegung nirgends, Schonung kaum stattfinden darf, wenn es sich darum handelt, Forstbau den Erfordernissen unserer Zeit gemäß zu betreiben. In jenen Wäldern, welche seine Heimat bilden, fällt der Schaden nicht so ins Gewicht, als man von vornherein annehmen möchte; denn jene sind ohnehin halbe Urwälder. Aber auch in den Ibenhorster Forsten richtet das Elchwild nicht soviel Unfug an, daß man deshalb auf seine Ausrottung dringen müßte; ich bin vielmehr, nachdem ich mich an Ort und Stelle unterrichtet habe, übereinstimmend nicht allein mit dem Thierkundigen August Müller, sondern auch mit den Ibenhorster Forstleuten zu der Ueberzeugung gekommen, daß »ein dem Elchwilde etwa gebrachtes Opfer mit dem Werthe des schönen und lebendigen Denkmals, welches diesem berühmten Ureinwohner Preußens in den Ibenhorster Forsten errichtet ist, in keinem Verhältnisse steht«. Und deshalb habe ich es freudig begrüßt, daß unser wald- und wildliebender Kaiser neuerdings die Hegung und Pflege dieses halb vorweltlichen Wildes durch strenge Befehle wesentlich verschärft hat.
Demungeachtet wird man das Aussterben des Elchwildes in unserem Vaterlande nur dann aufhalten, ihm vielleicht sogar begegnen können, wenn man dem gegenwärtigen Stande frisches Blut zuführt. Trotz der zweckmäßigsten Maßregeln zum Schutze des Elchwildes vermindert sich der Ibenhorster Stand desselben alljährlich mehr und mehr, schwerlich allein deshalb, weil die Werftweide neuerdings durch Trockenlegung einzelner Theile des Forstes empfindlich gelitten und das Elchwild dadurch einen Hauptbestandtheil seiner Nahrung verloren hat, noch weniger durch Verschuldung der umwohnenden Aasjäger, welche dem Elchwilde allerdings erheblichen Schaden zufügen, vielmehr wegen der geringen Fruchtbarkeit, um nicht zu sagen Unfruchtbarkeit, der in den Ibenhorster Forsten stehenden Elchthiere. In den letzten Jahren sind von durchschnittlich vierzig Stück Mutterwild alljährlich höchstens zwölf Kälber gebracht worden, hauptsächlich wohl infolge der Inzucht, welche hier thatsächlich besteht. Für mich unterliegt es kaum einem Zweifel, daß diesem Uebelstande abgeholfen werden könnte, wenn man aus Rußland oder Schweden zwölf bis zwanzig Elchhirsche einführen wollte, um dadurch die jetzt kaum stattfindende Zuchtwahl zu ermöglichen.
Je mehr wir gezwungen sind, den Wildstand in unseren eine regelrechte Bewirtschaftung zulassenden Forsten zu verringern, umsomehr sollen wir bestrebt sein, das Wild da zu hegen und zu pflegen, wo der von ihm verursachte Schaden unerheblich genannt werden darf. Selbst wenn man von Seiten der Regierung die Ibenhorster Forsten nur als Elchpark betrachten und sie einzig und allein zu Gunsten der Elenthiere bewirtschaften und beaufsichtigen lassen wollte, würde sich solches verantworten lassen; denn ein so mächtiger Staat wie Preußen kann alljährlich wohl einige tausend Mark aufwenden, um die Tage eines seinem Untergange raschen Schrittes entgegengehenden, der allgemeinen Theilnahme würdigen Thieres zu verlängern.
Das Moosthier, »Moosdeer« der Amerikaner, oder das Orignal der Franzosen (Alces americanus, A. machlis, malchis und muswa, Cervus Orignal und lobotus), unterscheidet sich hauptsächlich durch tief eingeschnittene Geweihschaufeln mit gesonderten Augensprossen, durch die schwach behaarte Kehlwamme und die dunklere Färbung von seinem altweltlichen Verwandten. Noch heutigen Tages ist man über das Thier keineswegs im reinen, obgleich einige Forscher nicht bloß an den Fellen, sondern sogar an den geräucherten Keulen Unterschiede auffinden wollten. Ich habe es lebend neben unserem europäischen Elche gesehen, bin jedoch nicht im Stande gewesen, erhebliche Unterschiede zwischen beiden Thieren herauszufinden, und glaube kaum, daß es sich als besondere Art aufstellen läßt. Die Geweihe des Moosthieres sind stärker und schwerer als die unserer Elche und erreichen selbst ein Gewicht von 30 bis 40 Kilogramm. Pennant fand einzelne, welche 75 Pfund wogen und dabei 32 Zoll Länge und 31½ Zoll Breite hatten. Hamilton Smith gibt folgende Beschreibung: »Das Moosthier ist die größte Hirschart, denn es ist am Widerrist höher als ein Pferd. Wollte man den großartigen Eindruck, welchen dieses Thier auf seine Beschauer macht, leugnen, so müßte man nur ausgestopfte Weibchen oder Junge gesehen haben. Wir hatten Gelegenheit, Moosthierhirsche in der Pracht ihrer Entwickelung, mit vollendetem Geweih und in ihrer Wildheit zu sehen, und wir müssen gestehen, daß kein Thier einen ergreifendern Eindruck hervorzurufen vermag. Der Kopf mißt über zwei Fuß, hat aber ein plumpes Ansehen; das Auge ist verhältnismäßig klein und tiefliegend, die Ohren ähneln dem eines Esels und sind lang und behaart; die Geweihzacken vermehren sich bis zu achtundzwanzig«.
Gegenwärtig findet sich das Moosthier noch im Norden Amerikas, namentlich in Kanada, Neu-Braunschweig und an der Fundy-Bai. Kapitän Franklin fand es am Ausflusse des Mackenzie und östlich noch am Kupferminenflusse unter 65 Grad Nordbreite. Mackenzie traf es auch auf den Höhen des Felsgebirges und an den Quellen des Elkflusses. Das Moosthier wirft das Geweih später ab als das europäische Elch, gewöhnlich im Januar und Februar, in strengen Wintern aber erst im März. Die Aesung ist wahrscheinlich dieselbe wie die des Elches.
Die Wilden stellen dem Moosthiere eifrig nach und betreiben seine Jagd auf mannigfaltige Weise. Einer ihrer Hauptkniffe ist, das Wild ins Wasser zu treiben, wo sie ihm dann mit ihren Booten auf den Leib rücken und es ohne große Mühe todtschlagen können. Diese Leute behaupten, daß sie nach dem Genusse des Elchwildprets dreimal so weit reisen könnten, als wenn sie eine Mahlzeit von anderem Fleische genossen hätten. Aus den Geweihen fertigen sie große Löffel; die Haut benutzen sie zur Dichtung der Boote, in denen sie sich nach beendigter Jagd zurückschiffen. Einer ihrer Jagdplätze, die »Hirschhornwiese« am Missouri, hat Berühmtheit erlangt. Sie haben dort aus Moosthier- und Wapitigeweihen eine hohe Pyramide aufgethürmt oder wenigstens aufgethürmt gehabt; denn die Yankees werden die Geweihe inzwischen wohl besser benutzt haben. Junge Moosthiere können leicht gezähmt werden, lernen in wenigen Tagen ihren Wärter kennen und folgen ihm dann mit viel Vertrauen. Mit zunehmendem Alter aber werden sie auch wild, zornig und gefährlich. »Um Mitternacht«, erzählt Audubon, »wurden wir durch einen argen Lärm im Schuppen erweckt und fanden, daß sich unser frisch gefangenes Moosthier von seinem Schrecken erholt hatte und daran dachte, nun nach Hause zu gehen, zu seinem großen Aerger aber sich als Gefangener erkannte. Wir waren unfähig, etwas für das Thier zu thun; denn sobald wir nur eine unserer Hände bewegten oder durch eine Oeffnung in sein Gefängnis steckten, sprang es nach uns, mit der größten Wuth brüllend und dabei seine Mähne erhebend, in einer Weise, welche uns vollkommen überzeugte, daß es wohl schwer halten würde, es am Leben zu erhalten. Wir warfen ihm ein Hirschfell zu; aber dieses zerriß es in einem Augenblick in Stücke: kurz, es geberdete sich wie rasend. Dieses Thier war ein Jährling von ungefähr sechs Fuß Höhe.«
Bei den Renthieren (Rangifer) tragen beide Geschlechter Geweihe, welche von dem kurzen Rosenstocke an bogenförmig von rück- nach vorwärts gekrümmt, an ihren Enden wie an dem Augensproß schaufelförmig ausgebreitet, fingerförmig eingeschnitten und schwach gefurcht sind. Sehr breite Hufe und längliche, aber stumpf zugespitzte Afterklauen zeichnen diese Hirsche aus. Ihre Gestalt ist im allgemeinen ziemlich plump, namentlich der Kopf unschön; die Beine sind verhältnismäßig niedrig; der Schwanz ist sehr kurz. Nur die alten Männchen haben im Oberkiefer kleine Eckzähne.
Man darf das Renthier als den wichtigsten aller Hirsche bezeichnen. Ganze Völker danken ihm Leben und Bestehen; denn sie würden ohne dieses sonderbar genug gewählte Hausthier aufhören, zu sein. Dem Lappen und Finnen ist das Ren weit nothwendiger als uns das Rind oder das Pferd, als dem Araber das Kamel oder seine Ziegenherden; denn es muß die Dienste fast aller übrigen Herdenthiere leisten. Das zahme Renthier gibt Fleisch und Fell, Knochen und Sehnen her, um seinen Zwingherrn zu kleiden und zu ernähren; es liefert Milch, läßt sich als Lastthier benutzen und schleppt auf dem leichten Schlitten die Familie und ihre Geräthschaften von einem Ort zum anderen; mit einem Worte: das Renthier ermöglicht das Wanderleben der nördlichen Völkerschaften.
Ich kenne kein zweites Thier, in welchem sich die Last der Knechtschaft, der Fluch der Sklaverei so scharf ausspricht wie in dem Renthiere. Es kann kein Zweifel obwalten, daß das heute noch wildvorkommende » Ren« der Skandinavier der Stammvater jenes Hausthieres ist. Zahme, welche ohne Obhut des Menschen leben können, verwildern in sehr kurzer Zeit und werden schon nach einigen Geschlechtern den wilden wieder vollständig gleich. In Gestalt und Wesen gibt es aber schwerlich zwei Geschöpfe, welche, bei so inniger Verwandtschaft, so außerordentlich sich unterscheiden wie das zahme und das wilde Renthier. Jenes ist ein trauriger Sklave seines armen, traurigen Herrn, dieses ein stolzer Beherrscher des Hochgebirges, ein gemsenartig lebender Hirsch, mit allem Adel, welcher diesem schönen Wilde zukommt. Wer freilebendes Renwild in Rudeln und zahme Renthiere in Herden gesehen hat und beide vergleichend betrachtet, will kaum glauben, daß das eine wie das andere ein Kind desselben Urahnen ist.
Das Ren ( Rangifer tarandus, Cervus tarandus, Tarandus rangifer, arcticus und groenlandicus) ist ein stattliches Geschöpf von Hirschgröße, nicht aber Hirschhöhe. Seine Länge beträgt 1,7 bis 2 Meter, die Schwanzlänge 13 Centim., die Höhe am Widerrist 1,08 Meter. Das Geweih steht zwar an Größe und noch mehr an Schönheit dem des Hirsches nach, ist aber immerhin ein sehr stattlicher Kopfschmuck. Der Leib des Ren unterscheidet sich von dem des Hirsches vielleicht nur durch größere Breite des Hintertheils; Hals und Kopf sind aber viel plumper und weniger schön und die Läufe bedeutend niederer, die Hufe viel häßlicher als bei dem Edelwilde; auch fehlt dem Renthiere unter allen Umständen die stolze Haltung des Hirsches: es trägt sich weit weniger schön als dieses edle Geschöpf. Der Hals hat etwa Kopflänge, ist stark und zusammengedrückt und kaum nach aufwärts gebogen, der Kopf vorn nur wenig verschmälert, plumpschnauzig, längs des Nasenrückens gerade; die Ohren sind kürzer als beim Edelhirsche, jedoch von ähnlicher Bildung, die Augen groß und schön, die Thränengruben klein und von Haarbüscheln überdeckt; die Nasenkuppe ist vollständig behaart, die Nasenlöcher stehen schräg gegeneinander; die Oberlippe hängt über, der Mund ist tief gespalten. Das Geweih der Renkuh ist regelmäßig kleiner und weniger gezackt als das des Renhirsches, bei beiden Geschlechtern aber dadurch besonders ausgezeichnet, daß die Stangen sehr dünn und nur am Grunde rundlich, nach oben dagegen abgeplattet sind, und daß die Augensprossen, welche vorn in eine breite Schaufel enden, so dicht auf der Nasenhaut aufliegen, daß man kaum einen Finger dazwischen durchbringen kann. In der Mitte der Stange tritt außer dem Eissproß, welcher sich ebenfalls schaufelt und auszackt, nur ein Sproß und zwar nach hinten hervor; das Ende des Geweihes ist eine langausgezogene Schaufel mit verschiedenen Zacken. Aeußerst selten findet man ein regelmäßig gebautes Geweih, wie beim Hirsche; es kommt oft vor, daß selbst Hauptsprossen, wie z. B. die Augensprossen, gänzlich verkümmern. Die Schenkel sind dick, die Beine immer noch stark und dabei niedrig, die Hufe sehr groß, breit, flach gedrückt und tief gespalten; die Afterklauen reichen bis auf den Boden herab. Bei zahmen Renthieren nehmen die Schalen so an Breite zu, daß man wildes und zahmes Renwild unbedingt als Arten trennen müßte, wenn man den Bau der Hufe allein in Betracht ziehen wollte. Ueberhaupt sind die wilden Renthiere bei weitem zierlicher und ansprechender gebaut als die zahmen, welche unter der Obhut und Pflege des Menschen durchaus nicht veredelt wurden, vielmehr verkrüppelt und verhäßlicht worden zu sein scheinen.

Ren ( Rangifer tarandus). 1/15 natürl. Größe.
Die Decke ist so dicht wie bei keinem andern Hirsche. Das Haar ist sehr lang, dick, gewunden, gewellt, zellig, spröde und brüchig, nur am Kopfe und Vorderhalse sowie an den Beinen, wo es sich noch mehr verlängert, biegsamer und haltbarer. An der Vorderseite des Halses befindet sich eine Mähne, welche zuweilen bis zur Brust herabreicht, und auch an den Backen verlängern sich die Haare. Im Winter werden sie überall bis sechs Centimeter lang, und weil sie sehr dicht über einander liegen, bildet sich dann eine Decke von mindestens vier Centimeter Dicke, welche es sehr erklärlich macht, daß das Renthier mit Leichtigkeit eine bedeutende Kälte ertragen kann. Nach dem Vorkommen und noch mehr nach der Jahreszeit ist die allgemeine Färbung verschieden. Die wilden Renthiere ändern mit ziemlicher Regelmäßigkeit zweimal im Jahre ihr Haarkleid und dessen Färbung. Mit Beginn des Frühlings fällt das reiche Winterhaar aus, und ein kurzes, einfarbig graues Haar tritt an dessen Stelle; es wachsen nun mehr und mehr andere Haare dazwischen hervor, deren weiße Spitzen das graue Haar immer vollständiger verdrängen, bis endlich das ganze Thier weißgrau, fast fahl, der Färbung schmelzenden, schmutzigen Schnees täuschend ähnlich erscheint. Diese Umfärbung beginnt immer zuerst am Kopfe, zunächst in der Augengegend, und verbreitet sich dann weiter und weiter. Die Innenseite der Ohren ist stets mit weißen Haaren besetzt; dieselbe Färbung hat auch ein Haarbüschel an der Innenseite der Ferse; die Wimpern sind schwarz. Beim zahmen Renthiere ist die Färbung im Sommer am Kopfe, Rücken, Bauche und an den Füßen dunkelbraun, am dunkelsten, fast schwärzlich, auf dem Rückgrate, heller an den Seiten des Leibes, über welche aber gewöhnlich zwei lichtere Längsstreifen laufen. Der Hals ist viel lichter als der Rücken, die Unterseite weiß, die Stirne gewöhnlich schwarzbraun, ein Kreis um die Augen schwarz, die Kopfseite weiß. Im Winter verschwindet die braune Färbung, und das weiße Haar tritt ebenfalls mehr hervor; doch gibt es auch viele Renthiere, welche sich im Winter nur durch verlängerte Haare auszeichnen, in der Färbung aber sich gleichbleiben.
Einige Naturforscher nehmen an, daß die in Amerika vorkommenden Renthiere einer besondern Art angehören, und unterstützen ihre Meinung dadurch, daß auch das europäische Ren auf der Westhälfte zu finden und sich durch Größe, Färbung und Lebensweise unterscheide. Der Karibu ( Tarandus Caribu ) soll größer sein als das Ren, ein kleineres Geweih und dunklere Färbung haben, einsamer, vorzugsweise in Wäldern leben und nicht wandern.
Schon die Alten kannten das Ren. Julius Cäsar beschrieb es ziemlich richtig. »Im Hercynischen Walde«, sagt er, »gibt es einen Ochsen von der Gestalt des Hirsches, dem mitten auf der Stirn ein viel größeres Horn steht, als es die übrigen haben; die Krone desselben breitet sich handförmig in viele Zacken aus. Das Weibchen hat eben solche Hörner.« Plinius mengt die Beschreibung des Ren- und Elenthieres unter einander. Aelian erzählt, daß die wilden Scythen auf gezähmten Hirschen wie auf Pferden reiten. Olaus Magnus (1530) gibt dem Ren drei Hörner: »Zwei größere Hörner«, sagt er, »stehen wie bei den Hirschen, sind aber ästiger; denn sie haben manchmal fünfzehn Aeste. Ein anderes Horn steht in der Mitte des Kopfes und dient zur Vertheidigung gegen die Wölfe.« Dieser Schriftsteller weiß, daß die Nahrung des Renthieres aus Bergmoos besteht, welches es unter dem Schnee hervorscharrt, daß man es in Herden hält und hütet, daß es in einem anderen Klima bald zu Grunde geht; er erzählt, daß der König von Schweden im Jahre 1533 einigen Herren aus Preußen zehn Stück geschenkt hat, welche von diesen freigelassen wurden; er berichtet, daß die Hirten mit ihren ziehenden Hirschen in den Thälern an jedem Tage fünfzigtausend Schritte zurücklegen, und daß die Thiere zu weiten Reisen benutzt werden, gibt auch schon deren Nutzen und Verwendung an: denn er sagt, daß das Fell zu Kleidern, Betten, Sätteln und Blasebälgen, die Sehnen zu Schnüren und als Zwirn, die Knochen und Hörner zu Bogen und Pfeilen, die Klauen als Krampfmittel benutzt werden etc. Die auf ihn folgenden Naturforscher mischen Wahres und Falsches durch einander, bis auf Scheffer aus Straßburg, welcher im Jahre 1675 in seinem Werke über Lappland das Ren ziemlich richtig schildert. Doch erst der große Linné ist es, welcher es selbst und zwar genau beobachtet hat. Nach ihm haben viele andere dieses und jenes berichtet, und somit darf die Naturgeschichte des Renthieres als ziemlich abgeschlossen betrachtet werden. Ich selbst habe die wilden Rudel und die zahmen Herden beobachten können und bin dadurch in den Stand gesetzt worden, aus eigener Anschauung zu sprechen. Sehr vieles habe ich auch von meinem alten Jäger Erik Swensen und von anderen glaubwürdigen Norwegern erfahren.
Der hohe Norden der Alten und, wenn man den amerikanischen Karibu zu unserer Art zählt, auch die nördlichsten Gegenden der Neuen Welt, sind die Heimat des Ren. Es findet sich in allen Ländern nördlich des 60. Grades, steigt in manchen Gegenden bis zum 52. Grade nördlicher Breite herab und kommt nach Norden hin noch jenseit des 80. Grades regelmäßig vor. Wild trifft man es auf den Alpengebirgen Skandinaviens und Lapplands, in Finnland, im ganzen nördlichen Sibirien, in Grönland und auf den nördlichsten Gebirgen des festländischen Amerika. Auch auf Spitzbergen lebt es; auf Island ist es, nachdem es vor mehr als hundert Jahren dort eingeführt wurde, vollständig verwildert und hat sich bereits in namhafter Anzahl über alle Gebirge der Insel verbreitet. In Norwegen fand ich es auf dem Dovre-Fjeld noch in ziemlicher Anzahl vor; nach der Versicherung meines alten Erik sollen mindestens viertausend Stück allein auf diesem Gebirgsstocke leben. Aber es kommt auch auf den Hochgebirgen des Bergener Stifts vor und reicht dort sicherlich bis zum 60. Grade nördlicher Breite herab. Im nördlichen Asien verbreitet es sich zwar erheblich weiter nach Süden hin, tritt hier jedoch nirgends zahlreich auf und ist in stetiger Abnahme begriffen. Schon gegenwärtig bewohnt es nur noch in kleinen Trupps das östliche Sajan, das Quellland des Irkut und Kitoi, die Baikalgegenden, das Quellgebirge der Dschida und das Apfelgebirge, wird aber auch hier von Jahr zu Jahr seltener. Dagegen fehlt es wohl kaum einem Gebirge des nördlichen Asien jenseit des 50. Grades der nördlichen Breite und findet sich innerhalb dieses Gebietes, ebensowohl wild wie gezähmt, hier und da in sehr bedeutender Anzahl.
Das Renthier ist ein echtes Alpenkind, wie die Gemse, und findet sich nur auf den baumlosen, mit Moos und wenigen Alpenpflanzen bestandenen, breiten Rücken der nordischen Gebirge, welche die Eingebornen so bezeichnend » Fjelds« nennen. In Norwegen bildet der Gürtel zwischen ein- bis zweitausend Meter unbedingter Höhe seinen gewöhnlichen Aufenthalt. Niemals steigt es hier bis in den Waldgürtel herab, wie es überhaupt ängstlich die Waldungen meidet. Die kahlen Bergebenen und Halden, zwischen deren Gestein einzelne Pflanzen wachsen, oder jene weiten Ebenen, welche dünn mit Rentierflechten übersponnen sind, müssen als Standorte dieses Wildes angesehen werden, und nur dann, wenn es von einem Höhenzuge nach dem andern streift, trollt es über eine der sumpfigen, morastähnlichen, niederen Flächen hinweg; aber auch bei solchen Ortsveränderungen vermeidet es noch ängstlich den Wald. Pallas gibt an, daß es im nördlichen Sibirien zuweilen in Waldungen vorkomme, und auch von Wrangel bestätigt dies. Von beiden Schriftstellern erfahren wir, daß es in Sibirien weite und regelmäßige Wanderungen ausführt. Um den Dasselfliegen zu entgehen, steigt es, laut Pallas, im Sommer aus den offenen Gegenden auf die waldigen Berge und kehrt von hier aus erst gegen den Winter hin in die Ebenen zurück. Ebensowohl bei der Reise zu Berge wie bei der Wanderung zu Thale vereinigt es sich zu zahlreichen Herden, welche in langgestreckten Zügen, einem wandelnden Walde vergleichbar, dahinziehen, auf weithin zu verfolgende Pfade austreten und breite Ströme, namentlich den Ob, Jenisei, Anadir und die Lena, mehr oder weniger an denselben Stellen alljährlich überschwimmen. Die Kühe mit den Kälbern eröffnen, die Hirsche beschließen diese Züge. »Gegen Ende des Mai«, ergänzt Wrangel, »verläßt das wilde Ren in großen Herden die Wälder, wo es den Winter über einigen Schutz gegen die grimmige Kälte sucht, und zieht nach den nördlichen Flächen, theils, weil es dort bessere Nahrung auf der Moosfläche findet, theils aber auch, um den Fliegen und Mücken zu entgehen, welche mit Eintritt des Frühlings in ungeheuren Schwärmen die Luft verfinstern. Der Frühlingszug ist für die dortigen Völkerschaften nicht vortheilhaft; denn in dieser Jahreszeit sind die Thiere mager und durch die Stiche der Kerbthiere ganz mit Beulen und Wunden bedeckt; im August und September aber, wann die Renthiere wieder aus der Ebene in die Wälder zurückkehren, sind sie gesund und wohlgenährt und geben eine schmackhafte, kräftige Speise. In guten Jahren besteht der Renthierzug aus mehreren tausenden, welche, obgleich sie in Herden von zwei- bis dreihundert Stücken gehen, sich doch immer einander ziemlich nahe bleiben, so daß das Ganze eine ungeheure Masse ausmacht. Ihr Weg ist stets unabänderlich derselbe. Zum Uebergange über den Fluß wählen sie eine Stelle, wo ein trockener Thalweg zum Ufer hinabführt und an dem gegenüberstehenden eine flache Sandbank ihnen das Hinaufkommen erleichtert. Hier drängt sich jede einzelne Herde dicht zusammen, und die ganze Oberfläche bedeckt sich mit schwimmenden Thieren.« An dem Baranicha in Sibirien sah Wrangel zwei unabsehbare Herden wandernder Renthiere, deren Züge zwei Stunden brauchten, um vorüberzukommen. Mindestens ebenso großartig sind die Wanderungen, welche unsere Hirsche im Westen der Erde alljährlich ausführen. Sie erscheinen, vom Festlande Amerikas kommend und die Eisdecke des Meeres als Brücke benutzend, im Frühjahre in Grönland und verweilen hier bis Ende Oktober, worauf sie die Rückreise antreten. Auch bei diesen Zügen gehen die Kühe den Hirschen voraus. Die Gesellschaften bestehen aus zehn bis hundert Stücken, welche sich in kleineren oder größeren Zwischenräumen folgen. Auf dem Festlande Amerikas selbst wandern die Thiere, wie in Sibirien, von den Gebirgen nach der Küste und umgekehrt. Nach einer Angabe John Franklins verlassen sie letztere mit ihren hier gebornen Jungen im Juli und August, sind im Oktober auf der Grenze der kahlen Landstriche angelangt und suchen im Winter in den Waldungen Schutz und Nahrung. Sobald der Schnee auf den Bergen zu schmelzen beginnt, treten sie wieder aus den Wäldern heraus und steigen allmählich in die Ebenen herab. Meuten von Wölfen, denen viele zum Opfer fallen, folgen ihren Zügen, und Indianerhorden lauern ihnen an allen bekannten, von den Thieren mit größter Regelmäßigkeit eingehaltenen Pässen auf.
In Norwegen wandern die Thiere nicht, sondern wechseln höchstens von einem Gebirgsrücken auf den andern: wie weit, ist nicht ermittelt. Jene Gebirge sind aber auch so beschaffen, daß sie ihnen alle Vortheile, welche den sibirischen die Wanderungen bieten, gewähren können. Zur Zeit der Mücken ziehen die wilden Renthiere einfach nach den Gletschern und Schneefeldern hinauf, welche sie ohnehin so lieben, daß sie mindestens ein paar Stunden des Tages auf ihnen ruhend verweilen; im Herbste, im Winter und im Frühlinge kommen sie weiter an den Bergen herab.
Alle wilden Renthiere lieben die Geselligkeit in hohem Grade. Ihre Rudel sind viel stärker als die von anderem Hirschwild und erinnern in mancher Hinsicht an die ungeheuren Herden, welche manche Antilopen in Südafrika bilden. Ich sah freilich nur Rudel von vier bis fünfzig Stücken auf dem Dovre; im Winter kommen aber, wie mich mein erfahrener Jäger versicherte, solche von drei- bis vierhundert vor. Einzelne Renthiere trifft man nur höchst selten an; es sind dies stets alte Hirsche, welche von dem übrigen Rudel abgeschlagen worden sind.
Die Renthiere eignen sich ganz vortrefflich, jene nördlichen Länder zu bewohnen, welche im Sommer eigentlich nur ein Morast und im Winter nur ein einziges Schneefeld sind. Ihre breiten Hufe erlauben ihnen, ebensogut über die sumpfigen Stellen und die Schneedecke hinwegzugehen wie an den Halden umherzuklettern. Der Gang des Renthieres ist ein ziemlich schneller Schritt oder ein rascher Trott. So flüchtig wie unser Edelhirsch wird es selbst dann nicht, wenn eines aus der Herde zusammengeschossen worden ist und alle übrigen in die höchste Angst gerathen. Dabei hört man fast bei jedem Tritte ein eigenthümliches Knistern, dem Geräusche vergleichbar, welches ein elektrischer Funke hervorbringt. Ich habe mir viele Mühe gegeben, die Ursache dieses Geräusches kennen zu lernen, und bin zahmen Renthieren stundenlang nachgegangen, habe auch einige niederwerfen lassen und alle möglichen Beugungen ihrer Fußgelenke durchgeprobt, um meiner Sache sicher zu werden, bin aber noch heute so unklar, als ich es früher war. Nachdem ich das Thier so genau als möglich längere Zeit beobachtet hatte, glaubte ich annehmen zu dürfen, daß das fragliche Geräusch von einem Zusammenschlagen des Geäfters herrühre, und wirklich konnte ich durch Aneinanderreiben der Füße ein ähnliches Knistern hervorbringen; allein die Renthiere, welche ich in den Thiergärten beobachtete, belehrten mich, daß meine Ansicht falsch sei; denn sie bringen auch dasselbe Knistern hervor, ohne daß sie einen Fuß von der Erde erheben; sie knistern, sobald sie sich, auf allen vier Füßen feststehend, ein wenig nach vorn oder zur Seite beugen. Daß bei solchen Beugungen das Geäfter nicht an die Hufe schlägt, glaube ich verbürgen zu können. Und so bleibt bloß die Annahme übrig, daß das Geräusch im Innern des Gelenkes entsteht, ähnlich wie wenn wir einen Finger anziehen, bis er knackt. Mit dieser Ansicht erklärt sich auch Dr. Weinland einverstanden; diese Ansicht verfochten die Lappen, welche ich von Norwegen befragen ließ, und endlich die norwegischen Forscher. Ein Versuch, welchen man gemacht hat, spricht freilich dagegen. Man wickelte nämlich einem Ren Leinwand um Hufe und Afterklauen und vernahm dann nicht das geringste Geräusch mehr. Dieser Versuch würde freilich noch nicht beweisen, daß, wie der betreffende Naturforscher annahm, das Knacken nur ein Zusammenschlagen des Geäfters mit den Hufen sei; denn solches Zusammenschlagen müßte man wahrnehmen können, und dies ist nicht der Fall. Junge Renthiere knistern übrigens nicht, und bei alten endet das sonderbare Geräusch, sobald sie im tiefen und weichen Schnee waten.
Bei langsamem Gange über morastige Flächen breitet das Renthier seine Hufe so weit aus, daß eine Fährte entsteht, welche weit mehr an die einer Kuh als an die eines Hirsches erinnert, und in gleicher Weise schreitet es auch über den Schnee, auf welchem es, sobald derselbe nur einigermaßen sich gesetzt hat, nicht mehr einsinkt.
Das Schwimmen wird dem Ren sehr leicht; es setzt ohne weiteres über ziemlich breite Ströme, und die Lappen treiben ganze Herden durch die Fjords von einer Insel zur andern. Die zahmen Renthiere entschließen sich allerdings nur nach einigem Widerstreben, in das Wasser zu gehen; die wilden dagegen scheuen dieses nicht und gehen, wenn sie flüchtig sind, durch Dick und Dünn.
Alle höheren Sinne des Renthieres sind vortrefflich. Es wittert ganz ausgezeichnet: wie ich mich wirklich überzeugt habe, bis auf fünf- oder sechshundert Schritte hin; es vernimmt mindestens ebenso scharf wie der Hirsch und äugt so gut, daß der Jäger alle Ursache hat, auch wenn er gegen den Wind herankommt, sich aufs sorgfältigste zu verbergen. Dabei ist das Thier lecker, denn es sucht sich nur die besten Alpenpflanzen heraus, und sein Gefühl beweist es sehr deutlich, wenn es die Mücken plagen: das zahme Renthier zuckt bei der leisesten Berührung zusammen. Alle Jäger, welche wilde Renthiere beobachteten, schreiben ihnen Klugheit, ja selbst eine gewisse List zu: scheu und vorsichtig im höchsten Grade sind sie unzweifelhaft. Gegen andere Thiere beweisen sie nicht die geringste Scheu. Sie kommen vertrauensvoll an die Kühe und Pferde heran, welche in ihren Höhen weiden, und vereinigen sich da, wo es Zahme ihrer Art gibt, sehr gern mit diesen, obgleich sie recht wohl wissen, daß sie es nicht mit ihres Gleichen zu thun haben. Hieraus geht hervor, daß ihre Scheu und Furcht vor den Menschen ein Ergebnis ihrer Erfahrung ist, und somit muß man ihnen einigermaßen entwickelten Verstand zugestehen.
Das wilde Ren äst sich im Sommer mit den saftigen Alpenkräutern, namentlich mit den Blättern und Blüten der Schneeranunkel, des Renthierampfers, der Saponarien, des Hahnenfußes, Schwingels etc. Während des Winters gräbt es mit seinen Hufen Renthierflechten aus und frißt von den Steinen die Schnee- und Osterflechten ab. In Norwegen meidet es auch im Winter den nahrungsreichen Wald, geht aber dann öfters in den Sumpf, um sich dort von allerlei Kräutern zu äsen. Sehr gern frißt es die Knospen und jungen Schößlinge der Zwergbirke, nicht aber die anderer Birkenarten. Die Auswahl unter der Nahrung ist immer eine höchst sorgfältige, auf sehr wenige Pflanzen beschränkte. Niemals gräbt das Ren mit dem Geweih, wie oft behauptet worden ist, sondern immer mit seinen Vorderläufen. Am eifrigsten geht es in den Morgen- und Abendstunden der Nahrung nach; während der Mittagszeit ruht es wiederkäuend, am liebsten auf Schneefeldern und Gletschern oder wenigstens ganz in der Nähe derselben. Ob es auch des Nachts schläft, ist nicht bekannt.
In Norwegen tritt der Hirsch Ende Septembers auf die Brunst. Sein Geweih, welches Ende Decembers oder im Januar abgeworfen wurde, ist jetzt wieder vollständig geworden, und er weiß es zu gebrauchen. Mit lautem Schrei ruft er Mitbewerber heran, orgelt wiederholt in der ausdrucksvollsten Weise, angesichts der jetzt sehr verstärkten Rudel häufige Kämpfe mit den betreffenden Mitbewerbern bestehend. Die wackeren Streiter verschlingen sich oft mit ihren Geweihen und bleiben manchmal stundenlang an einander gefesselt; dabei kommt es dann auch vor, wie bei den Hirschen, daß die schwächeren Renthierböcke, welche von den älteren während der Fortpflanzungszeit übermüthig behandelt werden, sich die Gelegenheit zu Nutze machen und die brünstigen Thiere beschlagen. Gegen das Altthier benimmt sich der Hirsch sehr ungestüm, treibt auch das erkorene Stück oft lange umher, bevor es zur Paarung kommt. Dann wird er zärtlicher. Hat er nach längerem Laufe endlich Halt gemacht, so beleckt er die auserkorene Gattin, hebt den Kopf in die Höhe und stößt hierbei rasch und hinter einander dumpfe, grunzende Laute aus, bläht seine Lippen auf, schlägt sie wieder zusammen, beugt den hintern Theil des Leibes nieder und geberdet sich überhaupt höchst etgenthümlich. Der Beschag selbst geht sehr rasch vor sich und währt nur kurze Zeit; dabei faucht der Hirsch niesend mit der Nase. Mitte April ist die Satzzeit; das alte Thier geht also etwa dreißig Wochen hochbeschlagen. Niemals setzen wilde Renthiere mehr als ein Kalb. Dieses ist ein kleines schmuckes Geschöpf, welche von seiner Mutter zärtlich geliebt und lange gesäugt wird. In Norwegen nennt man das junge Renthier entweder Bockkalb oder Semlekalb, je nachdem es männlich oder weiblich ist; die erwachsenen Renthiere werden ebenfalls als Bock und Semle unterschieden. Schon gegen das Frühjahr hin trennt sich das hochbeschlagene Thier mit einem Bocke von seinem Rudel und schweift nun mit diesem bis zur Satzzeit und auch nach ihr noch umher. Solche Familien, welche aus dem Bocke, der Semle und dem Kalbe bestehen, trifft man häufig; die Schmalthiere und die jungen Böcke bilden ihrerseits stärkere Rudel, bei denen ein geltes Altthier die Leitung übernimmt. Erst wenn die Kälber groß geworden sind, vereinigen sich die Familien wieder zu Rudeln; dann theilen sich die Altthiere in die Leitung. Die Renthiere sind so besorgt um ihre Sicherheit, daß das Leitthier, auch wenn alle übrigen Mitglieder des Rudels wiederkäuend ruhen, immer stehend das Amt des Wächters ausübt; will es sich selbst niederlassen, so steht augenblicklich ein anderes Altthier auf und übernimmt die Wache. Niemals wird ein Rudel Renthiere an Halden weiden, wo es gegen den Wind beschlichen werden kann; es sucht sich stets Stellen aus, auf denen es die Ankunft eines Feindes schon aus weiter Entfernung wahrnehmen kann, und dann trollt es eilig davon, oft meilenweit. Es kehrt aber nach guten Plätzen zurück, wenn auch nicht in den nächsten Tagen. Gewisse Halden des Dovre-Fjeld, welche reich an saftigen Pflanzen sind, haben als gute Jagdplätze Berühmtheit erlangt.
Die Jagd des wilden Ren erfordert einen leidenschaftlichen Jäger oder einen echten Naturforscher, dem es auf Beschwerden und Entbehrungen nicht ankommt; für gewöhnliche Sonntagsschützen ist sie durchaus kein Vergnügen. Es gibt in jenen Höhen, wo das vorsichtige Wild sich aufhält, keine Sennhütten oder Sennhäuschen mit allerliebsten Sennerinnen oder zitherschlagenden Sennbuben, sondern nur Beschwerden und Mühsale. Eine Wanderung über die norwegischen Gebirge verlangt tüchtige Wasserstiefeln und abgehärtete Füße für dieselben, einen breiten Rücken, welcher sich etwas aufpacken läßt, und vor allem eine gesunde Brust, welche stundenlang beim Auf- und Niedersteigen ohne Beschwerde ihre Dienste thut. Wie bei der Gemsenjagd muß man für mehrere Tage mit Lebensmitteln sich versehen, wie der Steinbockjäger in Felsklüften oder, wenn es gut geht, in verlassenen Steinhütten, welche man vorher gegen den Luftzugang zu schließen hat, während der Nachtzeit Unterkommen suchen; denn wenn man in einer der Sennhütten, welche sich auch nicht überall finden, übernachten will, muß man im günstigen Fall um drei- bis fünfhundert Meter hinab- und am andern Morgen natürlich wieder hinaufsteigen. Auf der Jagd heißt es aufpassen! Alles muß beobachtet werden, der Wind und das Wetter, der Stand der Sonne etc. Man muß die Lieblingsplätze des Renthieres kennen, mit seinen Sitten vertraut sein und zu schleichen verstehen wie eine Katze. Ganz besonders nothwendig ist es auch, daß man die Fährten wohl zu deuten weiß, um zu erfahren, ob sie von heute oder gestern oder von noch früherer Zeit herrühren. Jedes abgerissene Blatt auf den Halden, jeder weggetragene Stein gibt Fingerzeige. In Norwegen ist bei der Renthierjagd allerdings nicht an Gefahr zu denken, aber Beschwerden gibt es genug. Die Halden bestehen nur aus wirr durch- und übereinander geworfenen Schieferplatten, welche, wenn man über sie weggeht, in Bewegung gerathen oder so scharfkantige Ecken und Spitzen hervorstrecken, daß jeder Schritt durch die Stiefeln hindurch fühlbar wird; die außerordentliche Glätte der Platten, über welche das Wasser herabläuft, vermehrt noch die Schwierigkeit des Weges, und das jede Viertelstunde nothwendig werdende Ueberschreiten der schlüpfrigen Rinnsale erfordert viele und nicht eben belustigende Springübungen, falls man es vermeiden will, im kalten Gebirgswasser ein unfreiwilliges Bad zu nehmen und sich dabei Arme und Beine blutig zu schlagen. Und selbst, wenn man alle diese Unannehmlichkeiten nicht achten wollte, würde die Jagd noch immerhin ihre eigenen Schwierigkeiten haben. Die Färbung des Wildes stimmt stets so genau mit dem jeweiligen Aufenthaltsort überein, daß es überaus schwer hält, ein einzelnes Renthier, welches sich gelagert hat, wahrzunehmen; an eine weidende Herde aber kommt man so leicht nicht heran. Die Geröllhalden spiegeln dem Jäger oft tückisch das Bild des gesuchten Wildes vor, er glaubt sogar alle Sprossen der Geweihe zu erkennen, und selbst das Fernrohr hilft solche Lügen bestärken; man geht eine volle Stunde lang, kommt zur Stelle und sieht, daß man sich getäuscht und anstatt der Thiere nur Felsblöcke ins Auge gefaßt hatte. Oder, was noch schlimmer, man hat die Renthiere für Steine angesehen, ist guten Muthes auf sie losgegangen und sieht nun plötzlich, daß sich das Rudel in einer Entfernung von ungefähr zwei- bis dreihundert Schritten erhebt und das Weite sucht. Die größte Vorsicht wird nöthig, wenn man endlich nahe an das Wild kommt. Jede rasche Bewegung ist jetzt aufs strengste verpönt. Die norwegischen Jäger haben eine eigene Art, niederzuknieen und aufzustehen; sie sinken Centimeter um Centimeter mit gleichmäßiger Langsamkeit förmlich in sich zusammen und verschwinden so allgemach, daß ein weidendes Renthier, selbst wenn es die sich mehr und mehr verkleinernde Gestalt sähe, doch sicherlich in ihr keinen Menschen erkennen würde. Sobald der Jäger auf dem Boden liegt, probt er nochmals durch kleine Stücken Moos, welche er losreißt und in die Höhe wirft, den Wind, und dann beginnt er auf dem Bauche fortzukriechen, um sich soviel als möglich dem Rudel zu nähern. Mein alter Erik verstand diese Art, sich zu bewegen, so meisterhaft, daß ich, der ich mir einbildete, auch schleichen und kriechen zu können, wie ein beschämter Schulbube vor ihm stand oder vielmehr lag; denn mit Ausnahme der Fersengelenke bewegte sich an dem ganzen Manne kein Glied, und dennoch glitt er, wenn auch höchst langsam, immer und immer vorwärts. Wenn ein Wässerchen dem Jäger in den Weg kommt, kann er natürlich nicht ausweichen; aber da das Rinnsal etwas vertieft ist, kommt er auch darüber hinweg. Das Gewehr wird über den Nacken gelegt, so daß Schloß und Zündung vor dem Wasser gesichert sind, Pulverhorn oder Geschosse zwischen Hemd und Brust gelegt[?]; ob das übrige naß wird, kümmert den Mann natürlich nicht, und so läuft er auf allen Vieren durch den Wildbach: – wir haben es auch gethan. Kleinere Gräben werden ohne weitere Umstände durchkrochen; denn schon die Renthierflechten sind so feucht, daß der kriechende Jäger auf der ganzen Vorderseite ebenso naß wird, als ob er sich im Wasser gebadet hätte. Derart nähert man sich mehr und mehr dem Rudel und ist sehr froh, wenn man näher als zweihundert Schritte an dasselbe herankommt. Die meisten norwegischen Jäger schießen nicht aus bedeutender Entfernung und können dies, der geringen Güte ihrer Waffen halber, auch nicht thun; vermöchten sie aber aus einer Entfernung von dreihundert Schritten mit Sicherheit zu schießen, so würde gewiß jede Jagd ihnen eine Beute bieten; denn bis zu dieser Entfernung lassen die Renthiere einen geschickten Jäger regelmäßig an sich herankriechen. Sind nun Steine in der Nähe, so setzt der Kriechende seinen Weg fort, selbstverständlich so, daß er immer einen größern Stein zwischen sich und dem Leitthiere hat, also gedeckt wird. So kann es kommen, daß er bis auf hundert und zwanzig Schritte an das Rudel heranschleicht und dann seine alte, erprobte Büchse mit Sicherheit zu brauchen vermag. Er legt bedächtig auf einem Steine auf, zielt lange und sorgfältig und feuert dann nach dem besten Bocke des Rudels hin, falls dieser günstig sich gestellt hat. Auf laufende Renthiere geben alle nordischen Gebirgsjäger nur sehr ausnahmsweise einen Schuß ab.
Nach meiner Erfahrung ist das Rudel nach dem ersten Schusse so verblüfft, daß es noch eine geraume Zeit verwundert stehen bleibt; erst nachdem es sich von der Gefahr vollständig überzeugt hat, wird es flüchtig. Diese Beobachtungen haben auch die norwegischen Jäger gemacht, und deshalb gehen sie gern selbander oder zu dreien und Vieren auf die Jagd, schleichen zugleich nach einem Rudel hin, zielen verabredetermaßen auf bestimmte Thiere und lassen einen zuerst feuern; dann schießen auch sie. Ich bin fest überzeugt, daß Jäger, welche mit guten, sicheren Doppelbüchsen bewaffnet sind, aus einem und demselben Rudel fünf bis sechs Renthiere wegschießen können, wenn sie sonst geschickt sich angeschlichen haben und regungslos hinter den Steinen liegen bleiben. Die geringste Bewegung freilich scheucht das Rudel augenblicklich in die wildeste Flucht.
Für viele sibirische Völkerschaften hat die Jagd des Rens die höchste Bedeutung. Im Südosten Sibiriens verarmen die braven Tungusen, infolge der Abnahme der wilden Renthiere, mehr und mehr und gehen, wie Radde voraussagt, ihrem gänzlichen Untergange bestimmt entgegen; denn trotz der ungeheuren Waldungen ist der Wildstand, auf welchen die Tungusen angewiesen sind, bereits so geschwächt, daß sie sich nicht mehr ernähren können. Im Norden Asiens ist es noch besser; aber auch hier übt das Ren den größten Einfluß aus auf das Leben der Menschen. »Die Jukahiren und die übrigen Bewohner der Gegend längs dem Aniujflusse in Sibirien«, sagt von Wrangel, »hängen ganz von dem Renthiere ab, welches hier, wie in Lappland, fast ausschließlich Nahrung, Kleidung, Fuhrwerk, Wohnung liefert. Die Renthierjagd entscheidet, ob Hungersnoth oder Wohlleben herrschen wird, und die Zeit der Renthierzüge ist hier der wichtigste Abschnitt des Jahres. Wenn die Thiere auf ihren regelmäßigen Wanderungen zu den Flüssen kommen und sich anschicken, über dieselben weg zu schwimmen, stürzen die Jäger in ihren kleinen Kähnen pfeilschnell hinter Büschen, Gesteinen etc., wo sie sich bis dahin verborgen gehalten, hervor, umringen den Zug und suchen ihn aufzuhalten, während zwei oder drei der gewandtesten unter ihnen, mit einem kurzen Spieße bewaffnet, in den schwimmenden Haufen hineinfahren und in unglaublich kurzer Zeit eine große Menge tödten oder doch so schwer verwunden, daß sie höchstens das Ufer erreichen wo sie den dort wartenden Weibern, Mädchen und Kindern in die Hände fallen. Die Jagd ist übrigens mit großer Gefahr verbunden. In dem ungeheuren Gewühle der dicht unter einander schwimmenden Thiere ist der kleine, leichte Kahn ohnehin jeden Augenblick dem Umwerfen nahe; außerdem aber wehren sich die verfolgten Thiere auf alle mögliche Art: die Männchen mit ihren Geweihen und Zähnen, die Weibchen aber mit den Vorderläufen, mit denen sie an den Rand des Kahnes zu springen pflegen und ihn auf diese Weise leicht umwerfen. Gelingt dies, so ist gewöhnlich der Jäger verloren, weil es ihm beinahe unmöglich wird, sich aus dem dichten Haufen herauszuarbeiten.«
Ganz ähnlich jagen, wie King berichtet, die Indianer Nordamerikas, namentlich die Chipewyane, die Kupfer-, Hundsrippen- und Hasenindianer das Ren. Auch diese Leute leben fast ausschließlich von letzterem. Große Herden von zehn- bis hunderttausend Stück wandern im Frühjahr nordwärts zum Eismeere und im Herbste wieder südwärts. Wenn im Sommer die Flechten vertrocknen welche den Thieren während der kalten Jahreszeit zur Nahrung gedient haben, suchen sie sich nahe der Seeküste mancherlei saftige Kräuter zur Aesung; im September treten sie den Rückzug an und erreichen im Oktober das Ziel. Sie haben alsdann eine sieben bis zwölf Centimeter dicke Lage von Feist unter der Haut des Rückens und der Schenkel und bilden deshalb jetzt den Hauptgegenstand der Jagd. Man erlegt das Wild mit der Flinte, fängt es in Schlingen, tödtet es beim Durchschwimmen der Flüsse mit Spießen, gräbt tiefe Falllöcher oder bildet von Zweigen und Buschwerk zwei Zäune, läßt in beiden schmale Lücken, legt in jede Lücke eine Schlinge, treibt die Rudel zwischen die Zäune und fängt die Stücke, welche durchbrechen wollen, oder sticht sie beim Herauskommen todt. Die Hundsrippenindianer gehen, wie Trenzel erzählt, paarweise auf die Jagd. Der vorderste trägt in der einen Hand ein Renthiergeweih, der andere, dicht hinter ihm hergehende, ein Büschel Zweige, gegen welche er das Geweih reibt, um die Stirne aber eine Binde von weißem Pelze; bemerken die Renthiere diese merkwürdige Erscheinung, so stehen sie still und äugen verwundert. Nun feuern beide Jäger zugleich, eilen der Herde nach, laden im Laufen wieder und schießen noch ein oder mehrere Male. An anderen Orten treiben die Indianer, wenn sie es können, die Renthiere ins Wasser und stechen sie dann nieder.
Die Indianer wissen das wilde Ren in ähnlicher Weise zu benutzen, wie die Lappen ihr zahmes Herdenthier. Aus den Geweihen und den Knochen verfertigen sie sich ihre Fischspeere und Angeln; mit den gespaltenen Schienbeinknochen schaben sie Fleisch, Fett und Haar von den Häuten ab; mit Renthiergehirn schmieren sie des Fell ein, um es geschmeidig zu machen. Das durch Räuchern mit faulem Holze gegerbte Leder hängen sie um ihre Zeltstangen; die ungegerbten Häute geben ihnen Bogensehnen und Netze; die Sehnen des Rückens werden zu feinem Zwirn gespalten; die weichen, pelzartigen Felle der Kälber müssen ihnen die Kleidung liefern. Vom Kopfe bis zu den Zehen hüllen sie sich in Renthierfelle, werfen ein anderes, weichgegerbtes Fell auf den Schnee, decken sich mit dem dritten zu und sind so im Stande, der grimmigsten Kälte Trotz zu bieten. Kein Theil des Renthieres bleibt unbenutzt, nicht einmal der Speisebrei im Magen. Wenn dieser einige Zeit gelegen und eine gewisse Gährung gelitten hat, gilt er als höchst schmackhaftes Gericht. Das Blut wird gekocht und zur Suppe bereitet, die Knochen werden gestoßen und gekocht; das daraus gewonnene Mark mischt man mit Fett und getrocknetem Fleische oder benutzt es zum Salben des Haares und des Gesichts.
Das wilde Ren hat außer dem Menschen noch viele Feinde. Der gefährlichste von ihnen ist der Wolf. Er umlagert die Rudel stets, am schlimmsten aber doch im Winter. Wenn der Schnee so fest geworden ist, daß er die Renthiere trägt, gelingt es dem bösen Räuber bei der Wachsamkeit seiner Beute nur äußerst selten, an eine Herde heranzukommen, und im ungünstigsten Falle sind dann auch die Renthierböcke noch so kräftig, daß sie ihm mit den Vorderläufen genügend zusetzen können; die Umstände ändern sich aber bei frischem Schneefalle. Dann sinkt das Ren tief ein in die flaumige Decke, ermüdet leicht und wird von dem irgendwo hinter einem Felsblocke oder dichten Busche lauernden Räuber viel leichter gefangen als sonst. Auf den Hochgebirgen rotten sich Meuten von Wölfen gerade um die Zeit zusammen, in welcher sich die Renthiere in starke Rudel schlagen, und nun beginnt ein nicht endender Kampf um das Leben. Durch Hunderte von Meilen ziehen die Wölfe den wandernden Renthierherden nach, und es kommt dahin, daß selbst die Menschen, eben der Wölfe wegen, solche Renthierzusammenrottungen verwünschen. In Norwegen mußten die Renthierzuchten, welche man auf den südlichen Gebirgen anlegen wollte, der Wölfe wegen aufgegeben werden. Man hatte sich aus Finnmarken oder dem norwegischen Lappland dreißig Renthiere nebst lappländischen Hirten kommen lassen, deren Zucht auf den Hochgebirgen des Bergener Stifts vortrefflich gedieh. Schon nach fünf Jahren hatten die dreißig Renthiere Hunderte von Nachkommen erzeugt, und die Besitzer der Herden begannen, sich Reichthum zu erträumen: da brachen die Wölfe, welche von allem Anfange an sich als die schlimmsten Feinde der neuen Herde gezeigt hatten, mit Macht herein. Es schien, als ob sich die Wölfe ganz Norwegens auf einem Punkte zusammengezogen hätten, so häufig waren sie geworden. Weil man nun die Wachsamkeit verdoppelte, blieben diese nicht bei der Renthierjagd allein, sondern kamen auch in Unmassen in das Thal herab, raubten gierig in der Nähe der Gehöfte Rinder und Schafe, bedrohten die Menschen und wurden schließlich so lästig, daß man jene Herden theils abschlachten, theils niederschießen, theils verwildern lassen, mit einem Worte, die Zucht aufgeben mußte. Daß der Wolf auch den zahmen Renthierherden großen Schaden zufügt, habe ich schon gesagt. Und dieser gierige Räuber ist noch nicht der einzige Feind. Der Vielfraß stellt den Renthieren, wie ich selbst gesehen, eifrig nach, der Luchs wird ihnen sehr gefährlich, und der Bär raubt, wenn auch nicht gerade in derselben Weise wie der Wolf, immer noch viele der bedrohten Thiere. Nächst diesen großen Räubern sind es kleine, scheinbar erbärmliche Kerbthiere, welche mit zu den schlimmsten Feinden der Renthiere gezählt werden müssen. Namentlich drei Arten dieser Klasse bestimmen deren ganzes Leben. Es sind dies eine Stechmücke und zwei Dasselfliegen oder Bremsen. Die Mücken[?] veranlassen und bestimmen die Wanderungen der Renthiere: vor ihnen flüchten sie zum Meere hinab und in die Gebirge hinauf; von ihnen werden sie Tag und Nacht oder vielmehr während des monatelangen Sommertages unablässig in der fürchterlichsten Weise gequält. Nur wer selbst von jenen kleinen Ungeheuern tage- und wochenlang stündlich gestochen und geschröpft worden ist, kann die Qual begreifen, welche die armen Geschöpfe zu leiden haben. Und diese Plage ist nicht die schlimmste; denn die Dasselfliegen bereiten den Renthieren vielleicht noch ärgere Pein. Eine Art legt ihre Eier in die Rückenhaut, eine zweite in die Nasenlöcher des Ren; die Larven entwickeln sich und die der ersten Art bohren sich durch die Haut in das Zellgewebe ein, leben hier von dem Eiter, welchen sie erregen, verursachen im höchsten Grade schmerzhafte Beulen, wühlen sich weiter und weiter und bohren sich endlich, wenn sie der Reife nahe kommen, wieder heraus. Die Larven der zweiten Art gehen durch die Nasenhöhle weiter, dringen bis in das Hirn und verursachen die unheilbare Drehkrankheit, oder sie schlüpfen in den Gaumen und verhindern das Ren wegen des Schmerzes, welcher beim Kauen entsteht, am Aesen, bis endlich das gequälte Thier sie durch heftiges Niesen oft klumpenweise heraustreibt, aber erst, nachdem sie sich dick und voll gemästet haben. Im Juli oder anfangs August werden die Eier gelegt, im April oder Mai sind die Larven ausgebildet. Gleich im Anfange geben sich die Leiden des bedauernswerthen Geschöpfes durch schweres Athmen zu erkennen, und oft genug ist der Tod, namentlich bei jüngeren Thieren, das wohlthätige Ende aller Qual. Solchen von den Dasselfliegen gepeinigten Renthieren erscheinen Nebelkrähen und Schafstelzen als wohlthätige Freunde. Sie vertreten die Stelle der Kuhvögel, Madenhacker und Kuhreiher, welche wir später kennen lernen werden, fliegen auf den Rücken der armen Thiere und bohren aus den Geschwüren die Maden hervor, und die Renthiere verstehen ganz genau, wie viel gutes die Vögel ihnen anthun, denn sie lassen sie ruhig gewähren.
Jung eingefangene Renthiere werden sehr bald zahm; man würde sich aber einen falschen Begriff machen, wenn man die Renthiere, was die Zähmung anlangt, den in den Hausstand übergegangenen Thieren gleichstellen wollte. Nicht einmal die Nachkommen derjenigen, welche schon seit undenklichen Zeiten in der Gefangenschaft leben, sind so zahm wie unsere Hausthiere, sondern befinden sich immer noch in einem Zustande von Halbwildheit. Nur Lappen und deren Hunde sind im Stande, solche Herden zu leiten und zu beherrschen.
Uebrigens geben sich nicht bloß die Lappen mit der Renthierzucht ab, sondern auch die Finnen und in Sibirien Wogulen, Ostjaken, Samojeden, Tungusen, Koräken und Tschuktschen, welche, wie Pallas sagt, die größten Renherden halten. Nach den Erfahrungen dieses Naturforschers pflegt kein Volk die Renthiere besser als die Koräken. Sie besitzen Herden von vierzig- bis fünfzigtausend Stück und kennen unter dieser Unmasse die ihnen gehörigen genau. Solchen Herden gegenüber erscheinen die im Westen Europas gehaltenen kaum erwähnenswerth. Die norwegischen Lappen pflegen nach amtlichen Angaben, welche mir von dem Vogd oder Richter zu Tana gemacht wurden, im ganzen nur noch 79,000 Stück Renthiere, und zwar kommen auf die Kreise Tana und Polemak 31,000, auf den Kreis Karasjok 23,000 und auf den Kreis Kautokeino 25,000 Stück, welche ungefähr zwölfhundert Besitzern zugehören.
Das zahme Renthier ist die Stütze und der Stolz, die Lust und der Reichthum, die Qual und die Last des Lappen; nach seinen Begriffen steht derjenige, welcher seine Renthiere nach Hunderten zählt, auf dem Gipfel menschlicher Glückseligkeit. Einzelne Lappen besitzen zwei- bis dreitausend Stück, die meisten aber höchstens deren fünfhundert; niemals jedoch erfährt ein Normann die eigentliche Anzahl der Herde eines dieser Biedermänner: denn alle Lappen glauben, daß Wolf und Unwetter sofort einige Renthiere vernichten würden, wenn sie, die Herren, unnöthigerweise über ihre Renthiere, zumal über deren Anzahl, sprechen sollten. Mit Stolz schaut der Fjeldlappe, der eigentliche Renthierzüchter, auf alle anderen seines Volkes herab, welche das Nomadenleben aufgegeben und sich entweder als Fischer an Flüssen, Seen und Meeresarmen niedergelassen, oder gar als Diener an Skandinavier verdingt haben; er allein dünkt sich ein echter, freier Mann zu sein; er kennt nichts höheres, als sein »Meer«, wie er eine größere Renthierherde zu nennen pflegt. Sein Leben erscheint ihm köstlich; er meint, daß ihm das beste Loos auf Erden zugefallen wäre.
Und was für ein Leben führen diese Leute! Nicht sie bestimmen es, sondern ihre Herde: die Renthiere gehen, wohin sie wollen, und die Lappen müssen ihnen folgen. Der Fjeldlappe führt ein wahres Hundeleben. Monatelang verbringt er den größten Theil des Tages im Freien, im Sommer gequält und gepeinigt von den Mücken, im Winter von der Kälte, gegen welche er sich nicht wehren kann. Oft kann er sich nicht einmal Feuer schüren, weil er in den Höhen, welche seine Herde gerade abweidet, kein Holz findet; oft muß er hungern, weil er sich weiter entfernt, als er will. Dürftig geschützt durch die Kleidung, ist er allen Unbilden der Witterung preisgegeben; seine Lebensweise macht ihn zu einem halben Thiere. Er wäscht sich nicht; er nährt sich von geradezu abscheulichen Stoffen, welche ihm der Hunger eintreibt; er hat oft keinen andern Gefährten als seinen treuen Hund, und theilt mit diesem ehrlich und redlich die geringe Nahrung, welche ihm wird. Und alles dies erträgt er mit Lust und Liebe, seiner Herde wegen.
Das Leben der zahmen Renthiere unterscheidet sich fast in jeder Hinsicht von dem geschilderten des wilden Ren. Jene sind, wie ich oben angab, kleiner und häßlicher gestaltet, werfen später ab, pflanzen sich auch zu einer andern Zeit im Jahre fort als die wilden und wandern beständig. Manchmal unmittelbar unter der Herrschaft des Menschen lebend, genießen sie zu gewissen Zeiten ihre Freiheit im vollsten Maße. Bald wächst ihnen die Nahrung so reichlich zu, daß sie kräftig und feist werden, bald müssen sie Hunger und Kummer erdulden wie ihr Herr. Im Sommer leiden sie entsetzlich von den Mücken und Renthierbremsen, im Winter von dem Schnee, welcher die Weide verdeckt und ihnen durch seine harte Kruste oft die Füße verwundet.
In Norwegen und Lappland wandern die Lappen gewöhnlich längs der Flüsse nach dem Gebirge oder dem Meere zu, getrieben durch die Mücken, und von den Gebirgen wieder zur Tiefe herab oder von dem Meere nach dem Innern des Landes, genöthigt durch das Herannahen des Winters. In den Monaten Juli und August leben die Renthiere auf den Gebirgen und am Meeresstrande, vom September an findet die Rückwanderung statt, und um diese Zeit läßt der Lappe, wenn er bei seinen Herbststellen, kleinen Blockhäusern, in denen er die notdürftigsten Lebensbedürfnisse verwahrt, angelangt ist, seine Renthiere ihre Freiheit genießen, falls »Friede im Lande« ist, d. h. falls keine Wölfe in der Nähe umherstreifen. In diese Zeit fällt die Brunst, und dabei geschieht es, daß die zahmen mit den wilden sich vermischen, zur lebhaften Freude der Herdenbesitzer, welche hierdurch eine bessere Zucht erzielen. Mit dem ersten Schneefalle werden die Renthiere wieder eingefangen und gehütet, denn um diese Zeit gilt es, sie mehr als je vor den Wölfen zu bewahren. Nun kommt der Frühling heran und mit ihm eine neue Zeit der Freiheit; dann werden die Thiere nochmals zur Herde gesammelt: denn jetzt setzen die Kühe ihre Kälber und liefern die köstliche Milch, welche nicht verloren gehen darf; sie werden also wieder nach den Orten getrieben, wo es wenig Mücken gibt. So geht es fort, von einem Jahre zum andern.
Renthierzucht und Renthierhut sind schwieriger, als es scheint. Ohne die munteren, wachsamen Hunde würde es dem Lappen geradezu unmöglich sein, seine Herde zu weiden; jener Hülfe dankt er alles. Aeußerst wachsam, behend, klug und durchaus verläßlich sind diese Hunde; ihre ganze Gestalt gibt Zeugnis von der Freiheit, in welcher sie leben: sie ähneln wilden Verwandten ihrer Familie. Die Lauscher stehen aufrecht und verleihen dem Kopfe den Ausdruck bewußter Selbständigkeit und natürlicher Schlauheit. Das Fell am Körper, mit Ausnahme des Kopfes, ist sehr dicht, pudelähnlich behaart, die Beine sind haarig, die Gestalt ist schlank; aber die Thiere selbst sind klein und schmächtig, kaum so groß wie unsere Spitze. Dunkle Haarfärbung ist vorherrschend. Die Lappen halten sie mit Recht außerordentlich hoch, denn sie gehorchen aufs Wort und wissen jeden Wink des Hirten zu deuten, ja, sie hüten ohne sein Zuthun tagelang auf eigene Faust. Durch sie treibt der Lappe die ganze Herde zusammen, mit ihrer Hülfe vereinigt er sein Vieh an einer in das Meer vorspringenden Felsenkante und jagt es dann in das Wasser, um es zum Schwimmen über fünfzig bis hundert Schritte breite Meeresarme zu nöthigen; sie sind es, welche im Frühjahre die Schwächlinge einfangen müssen, weil diese während des Schwimmens ertrinken würden, und welche im Herbste, wenn die Weide alle Thiere gekräftigt hat, die Herde wieder über den Meeresarm zurückjagen.
Eine Renthierherde gewährt ein höchst eigenthümliches Schauspiel. Sie gleicht allerdings einem wandelnden Walde, wohlverstanden, wenn man annimmt, daß der Wald gerade blätterlos ist. Die Renthiere gehen geschlossen wie die Schafe, aber mit behenden, federnden Schritten und so rasch, wie keines unserer Hausthiere. Auf der einen Seite wandelt der Hirt mit seinen Hunden, welch letztere ihrerseits eifrig bemüht sind, die Herde zusammenzuhalten. Ohne Aufhören umkreisen sie die Thiere, jedes, welches heraustritt, augenblicklich wieder zur Herde treibend: so bringen sie es dahin, daß der Trupp immer geschlossen bleibt. Durch sie wird es dem Lappen sehr leicht, jedes beliebige Renthier mit seiner Wurfschlinge, welche er geschickt zu handhaben versteht, aus dem Haufen herauszufangen.
Wenn es gute Weide in der Nähe gibt, bauen sich die Lappen zur Erleichterung des Melkens eine Hürde, in welche sie allabendlich ihre Thiere treiben. Diese Hürden bestehen aus dicht an einander gelehnten Birkenstämmen von etwa zwei Meter Höhe, welche oben durch Querhölzer zusammengehalten werden, die ihrerseits wieder auf stärkeren Pfählen und Pfeilern befestigt sind. Zwei breite Thore, welche dann durch ein Gatter geschlossen werden, führen in das Innere. Die Hunde treiben die Herde ein, und das Melken beginnt. Auf die jungen Renthiere gibt man weniger Acht, läßt sie vielmehr unbekümmert außerhalb der Hürde weiden und sich ihres Lebens und der goldenen Freiheit freuen, soweit dies die Aufmerksamkeit der Hunde, welche schon die gehörigen Schranken zu ziehen wissen, ihnen gestattet. Innerhalb der Hürde ist das Getümmel groß. Die Renthiere erinnern durch ihr Hin- und Herlaufen und durch ihr ewiges Blöken an die Schafe, obgleich ihr Lautgeben mehr ein schweinähnliches Grunzen genannt werden muß als ein Blöken. Bei weitem die meisten, welche in Herden gehalten werden, sind sehr klein; man sieht unter Hunderten nur höchst wenig starke Thiere. Dabei fällt die Unregelmäßigkeit der Geweihe unangenehm auf. Wenn man sich der Hürde nähert, vernimmt man zuerst das beständige Blöken und dann, bei der ununterbrochenen Bewegung, ein Knistern, als ob Hunderte von elektrischen Batterien in Thätigkeit gesetzt würden. In der Mitte der Hürde liegen mehrere große Baumstämme, an welche die Renthiere beim Melken angefesselt werden. Ohne Wurfschlinge läßt sich kein Renthier seiner Milch berauben; deshalb trügt jeder Lappe und jede Lappin eine solche beständig bei sich. Sie besteht entweder aus einem langen Riemen oder einem Stricke, wird leicht in Ringe zusammengelegt, an beiden Enden festgehalten und so geworfen, daß sie um den Hals oder das Geweih des Thieres zu fallen kommt; dann faßt man sie kürzer und kürzer, bis man letzteres ganz nahe an sich herangezogen hat, bildet eine Schifferschlinge und legt sie ihm um das Maul, hierdurch es fest und sicher zäumend und zu unbedingtem Gehorsam nöthigend. Hierauf bindet man es an dem Klotze fest und beginnt das Melkgeschäft. Während desselben macht das Renthier allerlei Anstrengungen, um durchzugehen; allein die Lappen verstehen dem zu begegnen und ziehen besonders widerspenstigen Thieren die Schlinge so fest über der Nase zusammen, daß sie wohl ruhig bleiben müssen. Dann naht sich der Melkende dem Ren von hinten, schlägt mehrere Male flach auf das Euter und entleert es. Man melkt sehr ungeschickt und vergeudet viele Milch, welche namentlich die Schenkel des Thieres bespritzt, daher wischt man auch wohl nach dem Melken Schenkel und Beine sauber ab. Das unreinliche Melkgefäß hat die Gestalt eines oben verlängerten Napfes mit geradeaus gehendem Stiele, besteht aus Holz und ist aus einem Stücke geschnitzt. Beim Melken kommen so viele Haare in die Milch, daß man sie durchseihen muß, allein das grobe Tuch, welches man dabei verwendet, läßt noch immer genug von den kürzeren Haaren durchschlüpfen, und so sieht die Milch nicht eben einladend aus. Ich habe sie dennoch und trotz der überaus schmutzigen Finger, zwischen denen sie hervorgegangen war, versucht: sie schmeckt angenehm süßlich und ist so fett wie Rahm. Sofort nach dem Melken öffnet man die Hürden und zieht wieder auf die Weide hinaus, gleichviel, ob man am frühen Morgen oder am späten Abende die Thiere versammelt; denn man weidet Tag und Nacht.
Unter den zahmen Renthierkühen scheint Gemeinschaftlichkeit der Güter zu herrschen. So störrisch sich diese Thiere beim Melken bezeigen, so liebenswürdig benehmen sie sich gegen die Kälber. Sie erlauben ebensowohl fremden wie ihren eigenen Kindern, sie zu besaugen.
Während der Sommermonate bereiten die Lappen kleine, sehr wohlschmeckende, wenn auch etwas scharfe Käse aus der wenigen Milch, welche ihre Herdenthiere ihnen geben. Diese Käse dienen später als eines ihrer vorzüglichsten Nahrungsmittel. Sie wissen daraus unter anderem auch eine Art Suppe zu bereiten, welche sie als höchst schmackhaft schildern. Im September ist die eigentliche Schmaus- und Schlachtzeit; denn das Renthierfleisch, namentlich das von Böcken herrührende, nimmt einen schlechten Geschmack an, wenn die Hirsche gebrunstet haben. Das Ren wird, um es zu Boden zu werfen, genickfangt; dann stößt der Schlächter sein Messer in das Herz des Opfers, sorgfältig darauf achtend, daß sich alles Blut in der Brusthöhle sammle. Während des Abhäutens wird die Stichwunde durch ein eingeschobenes Holzstückchen verschlossen. Nachdem die Haut abgezogen worden ist, nimmt man die Eingeweide heraus und schöpft das übrige Blut in den geleerten und etwas gereinigten Wanst, welchen der Lappe nunmehr eine »Renthierbrust« nennt. Aus dem Blute wird Suppe bereitet, und erst wenn diese fertig ist, geht es an ein Zertheilen des Schlachtopfers. Kopf, Hals, Rücken, Seiten und Brust werden von einander abgetrennt und dann außer dem Bereiche der Hunde an ein Gerüst gehängt. Etwa noch ausfließendes Blut sammelt man in Gefäßen. Bei fernerem Zertheilen schneidet man die Sehnen sorgfältig heraus, weil sie später Zwirn und Rockschnüre geben sollen. Das Mark dient als besonderer Leckerbissen. Der Hausvater besorgt ebensowohl das Schlachten wie die Zubereitung der Speise, kostet dabei von Zeit zu Zeit und zwar so ernstlich, daß er bereits vor dem Mahle gesättigt sein könnte, ißt hierauf noch soviel, als sein Magen aufnehmen kann, und gedenkt nun erst der Kinder und schließlich der Hunde. Zu solchen Renthierschmäusen werden auch die umwohnenden Lappen eingeladen; während des September gibt es daher eine Völlerei nach der andern.
Mancherlei Seuchen richten oft arge Verheerungen unter den Renthieren an, und außerdem trägt das rauhe Klima dazu bei, daß sich die Herden nicht so vermehren, als es, der Fruchtbarkeit des Ren angemessen, sein könnte. Junge und zarte Kälber erliegen der Kälte oder leiden von den heftigen Schneestürmen, so daß sie, vollkommen ermattet, der Herde nicht weiter folgen können; ältere Thiere können bei besonders tiefem Schnee nicht mehr hinlänglich Nahrung finden, und wenn der Lappe unter solchen Umständen sich auch bemüht, ihnen in den Wäldern einige Aesung zu verschaffen, indem er die mit Flechten reich behangenen Bäume niederschlägt: er kann der Herde doch nicht das erforderliche Futter bieten. Sehr schlimm ist es, wenn zwischen den Schneefällen einmal Regen eintritt und der Schnee dadurch eine harte Kruste erhält. Eine solche verwehrt dem Ren, durch Wegschlagen der Schneedecke zu seiner Aesung zu gelangen. Dann entsteht oft bittere Noth unter den Lappen, und Leute, welche nach dortigen Volksbegriffen als reich gelten, werden unter solchen Umständen manchmal in einem einzigen Winter arm. Sie legen sich sodann auf Renthierdiebstahl und kommen dadurch in Fehde mit anderen Renthierbesitzern, von denen sie, bei der That ertappt, ohne Umstände todtgeschlagen werden.
Der Renthierdiebstahl ist unter den Lappen sehr verbreitet. Man darf diesen rohen Gebirgskindern Schätze von Gold zur Aufbewahrung übergeben und sicher sein, daß auch nicht das geringste davon verschwindet; man braucht nirgends Thüre und Thor zu verschließen vor den in der Nähe der Gehöfte weidenden Lappen, denn Golddiebe gibt es unter ihnen ebensowenig als unter dem größten Theile der Norweger: den Renthierdiebstahl aber können sie nicht lassen. Der Vogt von Tana, welchem ich viele und werthvolle Nachrichten über das merkwürdige Volk und sein Treiben verdanke, war oft genöthigt, Lappen wegen Diebstahls, und zwar wiederholt zu bestrafen. Wenn er den Leuten vorstellte, wie unrecht es wäre, sich an fremdem Eigenthum zu vergreifen und wie thöricht sie an sich selbst handelten, indem sie sich der goldenen Freiheit beraubten, hörte er stets nur die eine Antwort: »Ja, Herr, das wissen wir wohl, daß es unrecht ist, Renthiere zu stehlen: aber sie schmecken gar zu gut! Wir können das Stehlen nicht lassen; es ist uns unmöglich, ein fremdes Renthier zu sehen, ohne es uns anzueignen.« Dieses Sichaneignen geschieht übrigens auch zuweilen in der besten Absicht. Wenn die Lappen ihre Renthiere sammeln, kommt es ihnen zunächst gar nicht darauf an, ob sie Thiere zusammentreiben, welche zu ihrer Herde gehören, oder ob sie fremde zur Herde vereinigen. Die nächstwohnenden Renthierbesitzer kommen verabredetermaßen an einer gewissen Oertlichkeit zusammen; jeder tauscht sich dann die ihm gehörigen und von ihm gezeichneten Thiere aus und gelangt so wieder zu seinem Eigenthume.
Der gesammte Nutzen, welchen die zahmen Renthiere ihrem Besitzer bringen, würde, auf unsere Verhältnisse übertragen, gar nicht zu berechnen sein. Alles, was das Thier erzeugt, wird verwendet, nicht bloß das Fleisch und die Milch, sondern auch jeder einzelne Theil des Leibes. Die noch knorpeligen Hörner werden ebenso gern gegessen wie die des Elenthieres in gleichem Zustande; aus den weichen Fellen der Renthierkälber verfertigt man sich die Kleider; das Wollhaar wird gesponnen und verwebt; aus den Knochen macht man sich allerlei Werkzeuge; die Sehnen benutzt man zu Zwirn und dergleichen. Außerdem muß das Thier auch noch, namentlich während des Winters, die ganze Familie und ihr Hab und Gut von einem Orte zum andern schaffen. In Lappland benutzt man das Ren hauptsächlich zum Fahren, weniger zum Lasttragen, weil ihm letzteres, des schwachen Kreuzes wegen, sehr beschwerlich fällt. Die Tungusen und Koräken aber reiten auch auf den stärksten Renhirschen, indem sie einen kleinen Sattel gerade über die Schulterblätter legen und sich mit abstehenden Beinen auf das sonderbare Reitthier setzen. In Lappland reitet niemand auf Renthieren, und bloß die stärksten Böcke oder »Renochsen«, wie die Norweger sagen, werden zum Fahren benutzt. Man bezahlt tüchtige Zugthiere gern mit acht bis zwölf Species oder dreißig bis fünfzig Mark unseres Geldes, während die gewöhnlichen Renthiere höchstens zwölf bis achtzehn Mark kosten. Kein Ren wird vorher zum Zuge abgerichtet; man nimmt ohne viel Umstände ein beliebiges, starkes Thier aus der Herde und spannt es vor den höchst passenden, der Natur des Landes und des Renthieres durchaus entsprechenden Schlitten. Dieser ist von dem bei uns gebräuchlichen freilich ganz verschieden und ähnelt vielmehr einem Boote. Er besteht aus sehr dünnen Birkenbretern, welche von einem breiten Kiele an bootartig gekrümmt an einander genagelt werden und so eine Mulde bilden, deren Vordertheil bedeckt ist. Ein senkrecht stehendes Bret am Hintertheile dient zur Rückenlehne, eine starkes Oes am Vordertheile als Deichsel. Selbstverständlich kann bloß ein einziger Mann in einem solchen Bootschlitten sitzen, und nothwendigerweise muß er die Beine gerade vor sich hin ausstrecken: da nun aber der Schlitten mit Renthierfellen ausgefüttert ist, ruht man sehr bequem und warm in dieser sonderbaren Stellung. Für das Gepäck oder für zu befördernde Waare hat man Schlitten, welche oben mit Schiebedeckeln verschlossen werden können, den anderen aber sonst ganz ähnlich sind. Gewöhnlich fährt ein Lappe mit dem Leitren dem Reisenden voraus, um den Weg zu prüfen; denn selbstverständlich geht es in gerader Richtung über die weiße Decke hinweg, ohne genau zu wissen, welchen Grund sie verhüllt. Auf Flüssen und Seen werden Birkenreiser längs beider Seiten der Bahn gesteckt, um alle aufzufordern, denselben Weg zu benutzen und ihn glatt und fest zu fahren. Drei bis vier Schlitten hinterdrein enthalten Gepäck und Lebensmittel für den Reisenden, unter Umständen auch Renthierflechten für die Thiere, und so besteht der volle Reisezug gewöhnlich aus mindestens sechs Schlitten.
Das sehr einfache Geschirr besteht eigentlich nur aus einem breiten Stück Fell, welches zusammengenäht ist, damit es allseitig weich wird. Dieses rundliche Band endigt in zwei dicke Knöpfe, welche beim Anschirren durch eine Schlinge, das Ende des Zugseiles, gesteckt werden. Letzteres läuft zwischen den Vorderbeinen durch und sollte auch längs des Bauches fortlaufen, wird aber von dem Ren gewöhnlich übersprungen und kommt dann hinten bald auf die rechte, bald auf die linke Seite des Thieres zu liegen. Am Schlitten wird eine Schleife durch das Oes am Vorderende gesteckt und an ihr das Zugseil befestigt. Der einfache Zügel endigt in eine Schlinge, welche dem Ren um das Maul gelegt und durch ein zweites Band, das hinter dem Geweih verläuft, befestigt wird. Man lenkt ein Zugthier, indem man den Zügel mit einiger Kraft bald auf die linke, bald auf die rechte Seite seines Rückens wirft. Ein gutes Renthier legt mit dem Schlitten in einer Stunde eine norwegische oder anderthalb geographische Meilen zurück und zieht bis 9 Wog oder 288 Pfund, wird aber gewöhnlich nur mit 4 bis 5 Wog belastet. Im Sommer verwendet man es in Norwegen nicht zum Zuge.
Diesen eigenen Erfahrungen will ich noch die Bemerkungen anderer Reisenden hinzufügen, um das Bild zu vervollständigen. Die Koräken spannen anstatt eines Ren deren zwei an und fahren zuweilen in einem Zuge zehn bis zwölf Meilen weit, ermüden ihre Zugthiere dann aber derart, daß diese oft genug liegen bleiben. Sind die Thiere sehr erschöpft, so werfen sie sich auf den Boden nieder und verharren eine Zeitlang regungslos; dann pflegen die Samojeden ihnen eine Ader zu öffnen. Wenn man starke, gut ausgefütterte Renthiere schont, d. h. sie nur morgens und abends einige Stunden ziehen, mittags und nachts aber weiden läßt, kann man erstaunlich große Strecken mit ihnen durchreisen, ohne sie zu übernehmen.
Enge Gefangenschaft behagt dem Ren sehr wenig; gleichwohl hält es sich in unseren Thiergärten, falls es entsprechend behandelt wird, recht gut, pflanzt sich auch regelmäßig hier fort. Ohne Renthierflechten kann man es übrigens auf die Dauer nicht erhalten; es verschmäht, wenn es diese ihm am meisten zusagende Nahrung haben kann, selbst das beste Heu und nimmt solches, wie alle übrigen Pflanzenstoffe, mit Ausnahme von Brod, scheinbar nur mit Widerstreben zu sich. Unser Klima, d. h. die im Tieflande herrschende Sommerwärme, sagt ihm nicht zu, während es gegen die Winterkälte, auch die strengste, vollkommen gleichgültig ist. Dem entsprechend eignet es sich mehr als jeder andere nichtdeutsche Hirsch zur Einbürgerung auf waldlosen Hochflächen aller Gebirge, auf denen die Renthierflechte wächst. Hier würde es sich sehr wohl befinden, in kurzer Frist eingewöhnen, fortpflanzen und als Jagdwild verwerthen lassen. Allerdings hat man wiederholt Versuche gemacht, es in Deutschland einzubürgern, bei keinem einzigen derselben aber, so weit mir bekannt, das nöthige Verständnis des Thieres und seiner Lebensweise sowie der Grundbedingungen des erhofften Erfolges bekundet. Entweder ließ man ein Rudel im Tieflande frei und wunderte sich, daß die Thiere hier nicht leben bleiben wollten, oder man setzte ein ungeeignetes Pärchen auf den Alpen aus, und – verkaufte dasselbe, trotzdem es vorzüglich gedieh, weil es sich, infolge der Unfruchtbarkeit des einen Thieres, nicht fortpflanzte. Hätte man vom Anfange an eine Renthierherde von mindestens zwanzig bis dreißig Stücken auf einen geeigneten Hochgebirgsboden, wie die Alpen solche in Menge aufweisen, gebracht und hier sich selbst überlassen, so würde man unbedingt zum Ziele gekommen sein. Dafür sprechen alle Erfahrungen, welche bis jetzt gesammelt wurden. Das Ren, welches man in beliebiger Menge und ohne besondere Schwierigkeiten aus norwegisch Lappland beziehen kann, verwildert ungemein leicht, schüttelt die Sklaverei in kürzester Zeit ab, beansprucht keinerlei Pflege, befindet sich, erwiesenermaßen auch unter unseren Breiten in einem Höhengürtel von zweitausend Meter unbedingter Höhe und darüber ebenso wohl wie in seinem Vaterlande, nährt sich von Pflanzen, welche unsere Herdenthiere entweder nicht fressen oder nicht erlangen können und verursacht keinen Schaden: dies alles sind Verhältnisse, wie sie günstiger nicht gedacht werden können. Gerade weil Forst- und Ackerbau uns zwingen, das ursprünglich einheimische Hochwild mehr und mehr auszurotten, sollten wir auf einen wenigstens einigermaßen zufriedenstellenden Ersatz dieses so manches brave Jägerherz beglückenden edlen Thieres Bedacht nehmen, und gerade, weil wir unser Hochwild seiner Schädlichkeit halber befehden müssen, sollten wir uns nach Thieren umsehen, welche den Jäger mit dem Forst- und Landwirt nicht in Zwiespalt bringen. Ein solches Ersatzwild ist das Ren. Ich habe schon vor Jahren auf dasselbe hingewiesen und mich bemüht zu überzeugen, daß es auf unseren Hochgebirgen gedeihen müsse: die inzwischen angestellten Versuche haben zwar nicht meinen Wünschen, wohl aber meinen Voraussetzungen entsprochen. Fortan handelt es sich darum, mit dem erforderlichen Ernste und der nöthigen Kenntnis weitere Versuche anzustellen: der Erfolg wird ihnen nicht fehlen.
An das Ren reihen sich naturgemäß die Damhirsche ( Dama) an. Die Kennzeichen der Sippe liegen in den unten runden, zweisprossigen Geweihstangen, welche sich oben zu einer verlängerten Schaufel mit Randsprossen erweitern.
Einige Naturforscher nahmen an, daß das Damwild ursprünglich blos dem Süden und namentlich den Mittelmeerländern angehörte, nach und nach aber mehr nach Norden hin verbreitet wurde. Dieser Ansicht steht entgegen, daß man, wie Wagner angibt, in altdeutschen Gräbern zwischen Schlieben und Wittenberg viele Reste des Damwildes gefunden hat. Jedenfalls also müßte die Einführung in unsere Gegenden in frühester, vorgeschichtlicher Zeit geschehen sein. Ekkehard, ein Mönch zu St. Gallen, führt in einem um das Jahr 1000 geschriebenen Werke den Damhirsch als jagdbares Wild auf; andere Schriftsteller des Mittelalters gedenken schon weißer Damhirsche als Jagdthiere, »welche in Thüringen und Hessen nicht selten sind.« Allerdings liebt das Damwild mehr gemäßigte als kalte Gegenden und ist aus diesem Grunde in den Mittelmeerländern von jeher häufig gewesen. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich nach Süden hin bis an den Nordrand der Sahara, nach Norden hin bis ins südliche Schweden und Norwegen. Cuvier erhielt einen wilden Damhirsch aus den Wäldern südlich von Tunis, Belon fand ihn auf den griechischen Inseln; auf Sardinien und in Spanien scheint er von jeher häufig gewesen zu sein. Schon die alten Schriftsteller erwähnen ihn als einen ständigen Bewohner ihrer Heimat, Aristoteles unter dem Namen Prox, Plinius unter dem Namen Platyceros. Gegenwärtig ist gerade dieses Wild in unseren Thiergärten vielleicht noch häufiger als in Spanien, Frankreich und Italien; am gemeinsten aber dürfte es wohl in England sein, wo es in den Parks der großen Grundbesitzer in Menge gezogen wird. Hügeliges Land, in welchem sanfte Thäler mit niederen Anhöhen abwechseln, Haine, Feldhölzchen und Laubwaldungen, wo der Boden mit kurzem Grase bewachsen ist, sagen dem Damhirsche besonders zu; es ist für die Parks wie geschaffen, und man kann sich auch nicht leicht eine höhere Zierde solcher großen Anlagen beschaffen als eben das Damwild, welches seinen Namen davon tragen soll, daß es das Wild der Damen ist.
Der Damhirsch, Dähel, Dämling und Dandl ( Dama vulgaris, D. platyceros und maura, Dactyloceros und Cervus dama etc.) steht seinem edlen Verwandten an Größe bedeutend nach. Seine Gesammtlänge, einschließlich des 19 Centimeter langen Wedels beträgt 1,7 Meter, die Höhe 90 Centimeter; Haupthirsche sind 1,8 Meter und darüber lang und gegen 1 Meter hoch, hinten noch 5 bis 7 Centimeter mehr. Von dem Edelwilde unterscheidet sich das Damwild durch die kürzeren und minder starken Läufe, den verhältnismäßig stärkern Körper, den kürzern Hals, das kürzere Gehör und durch den längern Wedel sowie auch durch die Färbung. Keine unserer heimischen Wildarten zeigt so viele Abänderungen in der Färbung wie der Damhirsch, ebensowohl nach der Jahreszeit als nach dem Alter. Im Sommer sind Oberseite, Schenkel und Schwanzspitze braunröthlich, Unterseite und Innenseite der Beine dagegen weiß; schwärzliche Ringe umranden Mund und Augen; die Rückenhaare sind weißlich am Grunde, rothbraun in der Mitte und schwarz an der Spitze. Im Winter wird die Oberseite an Kopf, Hals und Ohren braungrau, auf dem Rücken und an den Seiten schwärzlich, die Unterseite aschgrau, manchmal ins Röthliche ziehend. Eben nicht selten sind ganz weiße, welche ihre Farbe zu keiner Jahreszeit wechseln und im Winter nur durch das längere Haar sich auszeichnen. Manche Hirsche tragen in der Jugend auch ein gelbliches Kleid; seltener endlich kommen schwarz gefärbte vor.
Hinsichtlich seiner Lebensweise und Bewegung ähnelt das Damwild dem Edelhirsch in vieler Beziehung. Die Sinne beider Thiere stehen auf gleicher Stufe und auch die geistigen Eigenschaften sind ungefähr dieselben. Doch ist das Damwild minder scheu und vorsichtig als der Edelhirsch, treibt sich oft bei hellem Tage auf lichten Stellen des Waldes umher und wechselt weder so regelmäßig noch so weit wie sein Verwandter. An Schnelligkeit, Sprungkraft und Gewandtheit gibt das Damwild dem Edelhirsch kaum etwas nach; in der Art der Bewegung aber unterscheiden sich beide: denn das Damwild hebt im Trollen die Läufe höher, springt in nicht ganz voller Flucht nach Art der Ziegen satzweise mit allen vier Läufen zugleich und trägt den Wedel dabei erhoben. Sein Gang hat etwas anmuthiges; es trollt mit großer Leichtigkeit und springt über eine zwei Meter hohe Wand. Unter Umständen schwimmt es auch gut. Immer thut es sich auf seine vier Läufe nieder, niemals auf die Seite. Beim Niederknien fällt es zuerst auf die Vorderläufe, beim Aufstehen hebt es sich zuerst mit den Hinterläufen. Die Aesung beider Hirscharten ist ganz dieselbe; doch schält das Damwild mehr als das Rothwild, und gerade hierdurch wird es schädlich. Sehr auffallend ist es, daß unser Wild sich zuweilen mit giftigen Pflanzen äst, deren Genuß ihm den Tod bringt. So gingen in einem Thiergarten in Preußen einmal ganze Trupps von Damwild ein, wie sich herausstellte, nur infolge der Aesung giftiger Schwämme.

Damhirsch ( Dama vulgaris), 1/18 natürl. Größe.
An seinem Stande hält das Damwild sehr fest. Es bildet größere oder kleinere Trupps, welche sich vor der Brunstzeit verstärken, dann aber wieder vertheilen, weil die starken Hirsche während des Sommers einzeln, die Schaufler aber mit den Thieren und Kälbern vereinigt gehen. Um die Mitte des Oktober suchen die Damhirsche ihre Rudel auf und treiben die Spießer und geringen Hirsche vom Rudel ab, sie hierdurch zwingend, wenig zählende Trupps unter sich zu bilden; sobald aber die stärkeren Hirsche gebrunstet haben, erscheinen die schwächeren wieder beim Rudel. Die Damhirsche sind um die Brunstzeit sehr erregt. Sie rufen des Nachts laut, und Gleichstarke kämpfen heftig mit einander um die Thiere. In Thiergärten duldet man bloß drei- oder vierjährige Schaufler, weil die älteren so kampflustig sind, daß dadurch die Vermehrung des Standes wesentlich beeinträchtigt wird. Ein Hirsch genügt ungefähr acht Thieren; aber auch schon Spießer sind im Stande, fruchtbar zu beschlagen. Nach ungefähr vierzehn Tagen ist die Brunst vorüber.
Das Damthier geht acht Monate hochbeschlagen, und setzt gewöhnlich im Juni, ein Kalb, seltener deren zwei. Das Junge ist in den ersten Tagen seines Lebens sehr unbehülflich und muß deshalb von den Alten sorgfältig beschützt und gehütet werden. Kleinere Raubthiere, welche ein Gelüst nach dem bunten Kälbchen zeigen, treibt die Mutter durch Schlagen mit den Vorderläufen ab; vor größeren Raubthieren geht sie langsam dahin, um sie von dem Platze abzulocken, wo ihr Kind verborgen ruht, entflieht eiligst und kehrt unter unzähligen Haken und Widergängen nach dem alten Platze zurück. Wenn das Damhirschkalb sechs Monate ist, zeigen sich bei dem männlichen Erhebungen auf dem Rosenstocke, aus denen zu Ende des nächsten Februar die Spieße hervortreten und bis zum Fegen im August sich ausbilden. Nun heißt das Kalb ein Spießer; im zweiten Jahr wird ein Gabler daraus; im dritten Jahr treten kurze Augensprossen, bei recht guter Aesung auch wohl an jeder Stange eine oder zwei kurz abgestumpfte Enden hervor, welche im folgenden Jahr sich noch mehr zu vermehren pflegen. Erst im fünften Jahre beginnt die Bildung der Schaufeln, welche mit der Zeit ebensowohl an Größe zunehmen als auch mehr und mehr Randsprossen erhalten. Geweihe recht alter Damhirsche sind oft sehr schön und 7 bis 9 Kilogramm schwer. Solche alte Hirsche heißen Schaufler, gute und Hauptschaufler, je nach der Größe ihres Geweihes; jüngere nennt man Hirsche vom zweiten und dritten Kopfe. Aus dem Kalbe weiblichen Geschlechts wird, wenn es ein Jahr alt ist, ein Schmalthier und, wenn es zum erstenmal gebrunstet hat, ein Altthier. Die alten Hirsche werfen im Mai, die Spießer erst im Juni ab, gewöhnlich jedoch nicht beide Stangen zu gleicher Zeit, sondern im Verlaufe von zwei bis drei Tagen. Bis zum August sind die Stangen ausgebildet.
Der Tritt des Damwildes ist vorn mehr zugespitzt und verhältnismäßig länger als der des Rothwildes; er ähnelt am meisten der Fährte einer Ziege, ist aber selbstverständlich um vieles stärker.
Man jagt das Damwild entweder in großen Treiben oder auf Pirschgängen; auch ist, weil es sehr genau Wechsel hält, der Anstand lohnend. Am leichtesten ist ihm pirschend anzukommen, wenn man in Gesellschaft eines Gefährten seinen Weg trällernd oder pfeifend dahin wandelt, sich aber dabei auf einer oder der andern Seite unmerklich heranzieht. In gehöriger Büchsenschußweite bleibt dann der Schütze, welcher sich durch einen Baumstrauch oder auf andere Weise gedeckt hat, stehen, während der Begleiter immer trällernd oder pfeifend seinen Weg fortsetzt, bis der erste geschossen hat. »Mir ist es manchmal gelungen«, sagt Dietrich aus dem Winckell, »einige starke Damwildstücke, welche auf einem großen freien Platze standen, auf folgende Art zu täuschen. An einem Orte, wo das Wild mich nicht gewahr werden konnte, zog ich Rock und Weste aus und ließ das Untertheil des Hemdes so über die Beinkleider herabhängen, daß es einer Fuhrmannskutte glich. Die Büchse in der Hand ging ich meinen Weg fort. Das Wild faßte mich sogleich ins Auge und bewies durch mancherlei Bewegungen, daß es nicht ganz ruhig sei. Ich machte einen neuen Versuch, mich ihm, während ich fortsang, tanzend und springend zu nähern; auch das Wild machte allerhand muntere Bewegungen, ohne aber flüchtig zu werden, bis mein Schuß aus Spaß Ernst machte und nach demselben ein Stück zusammenbrach.« An ein einzeln äsendes Stück kann man sich ziemlich leicht heranschleichen, falls man den Wind gut wahrnimmt. Vor Pferden und Fuhrwerken hält es eben fast immer aus; wenn es aber einmal scheu geworden ist, flüchtet es bei der geringsten Gefahr auf weite Entfernungen.
Die Haut des Damwildes wird ihrer Dehnbarkeit und Weiche halber mehr geschätzt als die des Edelwildes. Das Wildpret ist sehr lecker, am besten vom Juli bis zur Mitte des September, wo der Hirsch viel Feist auflegt. Nur wenn die Brunstzeit herannaht, nimmt das Wildpret des Hirsches einen Bockgeruch an, weshalb auch in dieser Zeit kein Damwild erlegt werden darf.
Für Thierparks eignet sich ein Stand dieses Wildes vortrefflich. Auf fünfzig Morgen Land kann man sechzig Stücke halten und davon jährlich acht Stück abschießen. Das Damwild ist munter und zum Scherzen aufgelegt und nur bei stürmischer Witterung unstät und unruhig. Dieselben Eigenschaften behält es in der engern Gefangenschaft, an welche es sich leicht gewöhnt. Jung eingefangene, mit Kuh- oder Ziegenmilch aufgezogene Kälber werden ungemein zahm und können dahin gebracht werden, daß sie ihrem Herrn wie ein Hund auf dem Fuße nachlaufen. Für Musik scheint das Damwild eine ganz besondere Liebhaberei an den Tag zu legen; selbst das freilebende kommt, wenn es die Töne des Hornes vernimmt, näher und näher, um zuzuhören. Männliche Damhirsche werden in der Gefangenschaft, wenn die Brunstzeit herannaht, böse und kampflustig, wie alle im engen Gewahrsam gehaltene Hirsche, gehen dreist auf den Menschen los und können diesen trotz ihres nicht eben tüchtigen Geweihes empfindlich verletzen. Nach eigenen Erfahrungen suchen sie im tollen Uebermuthe sogar mit anderen, stärkeren Hirschen anzubinden und lassen sich selbst durch derbe Abfertigungen nicht belehren. Angenehme, d. h. ihres Wesens halber ansprechende Gefangene sind sie ebensowenig als andere Hirsche.
Bei den Hirschen im engsten Sinne ( Cervus) tragen ebenfalls bloß die männlichen Glieder Geweihe mit runden Aesten oder Stangen. Von den mehr oder weniger zahlreichen Sprossen sind mindestens drei nach vorwärts gerichtet, Augen- und Mittelsprossen immer, die Eissprossen weniger regelmäßig vorhanden. An der Außenseite des Mittelfußes befinden sich Haarbüschel. Die Thränengruben sind deutlich. Bei alten Männchen (seltener auch bei sehr alten Weibchen) treten die Eckzähne im Oberkiefer über die anderen weit hervor.
Eine der stattlichsten und edelsten Gestalten dieser Gruppe, für uns die wichtigste aller Arten, ist der Edel- oder Rothhirsch ( Cervus Elaphus). Ungeachtet seiner Schlankheit ist er doch kräftig und schön gebaut und seine Haltung eine so edle und stolze, daß er seinen Namen mit vollstem Rechte führt. Seine Leibeslänge beträgt etwa 2,3 Meter, die des Schwanzes 15 Centimeter, die Höhe am Widerrist 1,5 Meter und die am Kreuz einige Centimeter weniger. Das Thier ist bedeutend kleiner und gewöhnlich auch anders gefärbt. Hinsichtlich der Größe bleibt unser Edelhirsch nur hinter dem Wapiti und dem persischen Hirsche zurück, wogegen er die übrigen bekannten Arten seiner Sippe übertrifft. Er hat gestreckten, in den Weichen eingezogenen Leib mit breiter Brust und stark hervortretenden Schultern, geraden und flachen Rücken, welcher am Widerrist etwas erhaben und am Kreuze vorstehend gerundet ist, langen, schlanken, seitlich zusammengedrückten Hals, und langen, am Hinterhaupte hohen und breiten, nach vorn zu stark verschmälerten Kopf, mit flacher, zwischen den Augen ausgehöhlter Stirne und geradem Nasenrücken. Die Augen sind mittelgroß und lebhaft, ihre Sterne länglichrund. Die Thränengruben stehen schräg abwärts gegen den Mundwinkel zu, sind ziemlich groß und bilden eine schmale, längliche Einbuchtung, an deren inneren Wänden eine fettige, breiartige Masse abgesondert wird, welche das Thier später durch Reiben an den Bäumen auspreßt. Das Geweih des Hirsches sitzt auf einem kurzen Rosenstocke auf und ist einfach verästelt, vielsprossig und aufrechtstehend. Von der Wurzel an biegen sich die Stangen in einem ziemlich starken Bogen, der Stirne gleichgerichtet, nach rückwärts und auswärts, oben krümmen sie sich wieder in sanften Bogen nach einwärts und kehren dann ihre Spitzen etwas gegen einander. Unmittelbar über der Nase entspringt aus der Vorderseite der Stange der Augensproß, welcher sich nach vor- und auswärts richtet; dicht über derselben tritt der kaum minder lange und dicke Eissproß hervor; in der Mitte der Stange wächst der Mittelsproß heraus und am äußern Ende bildet sich die Krone, welche ihre Zacken ebenfalls nach vorn ausdehnt, aber je nach dem Alter oder der Eigenthümlichkeit des Hirsches mannigfaltig abändert. Die Stange ist überall rund und mit zahlreichen, theils geraden, theils geschlängelten Längsfurchen durchzogen, zwischen denen sich in der Nähe der Wurzel längliche oder rundliche, unregelmäßige Knoten oder Perlen bilden. Die Spitzen der Enden sind glatt. Mittelhohe, schlanke aber doch kräftige Beine tragen den Rumpf und gerade, spitzige, schmale und schlanke Hufe umschließen die Zehen; die Afterklauen sind länglichrund, an der Spitze flach abgestutzt und gerade herabhängend, berühren aber den Boden nicht. Der Schwanz ist kegelförmig gebildet und nach der Spitze zu verschmälert. Ein feines Woll- und ein grobes Grannenhaar deckt den Leib und liegt ziemlich glatt und dicht an, nur am Vorderhalse verlängert es sich bedeutend. Meiner Ansicht nach besteht die Winterdecke nicht aus Grannen, sondern ausschließlich aus überwuchernden, eigenthümlich veränderten Wollhaaren, zwischen denen sich noch einige wenige wie gewöhnlich gebildete befinden. Die richtige Deutung der Haare des Winterkleides unserer Wildarten ist übrigens schwer und eine irrige Ansicht in dieser Beziehung leicht möglich. Die straffe, nicht überhängende Oberlippe des Edelhirsches trägt drei Reihen dünner, langer Borsten; ähnliche Haargebilde stehen auch über den Augen. Nach Jahreszeit, Geschlecht und Alter ändert die Färbung des Rothwildes. Im Winter sind die Grannen mehr graubraun, im Sommer mehr röthlichbraun; das Wollhaar ist aschgrau mit bräunlicher Spitze. Am Maule fällt das Haar ins Schwärzliche, um den After herum ins Gelbliche. Nur die Kälber zeigen in den ersten Monaten weiße Flecken auf der rothbraunen Grundfarbe. Mancherlei Farbenänderungen kommen vor, indem die Grundfärbung manchmal ins Schwarzbraune, manchmal ins Fahlgelbe übergeht. Hirsche, welche auf farbigem Grunde weiß gefleckt oder vollkommen weiß sind, gelten als seltene Erscheinung.
In der Weidmannssprache gebraucht man folgende Ausdrücke. Der männliche Hirsch heißt Hirsch, Edelhirsch oder Rothhirsch, der weibliche Thier, Roththier und Stück Wild, das Junge Kalb, mit Rücksicht des Geschlechtes aber Hirsch- oder Wildkalb. Das Hirschkalb wird, nachdem es das erste Jahr vollendet hat, Spießer genannt; im zweiten Jahre erhält es den Namen Gabelhirsch oder Gabler; im dritten Jahre heißt es Sechsender u. s. f., je nach der Anzahl der Enden oder Sprossen des Geweihes. Wenn dieses ganz regelmäßig gebildet erscheint, ist der Hirsch ein gerader Ender, wenn eine Stange nicht genau wie die andere ist, ein ungerader. Erst wenn der Hirsch zwölf Enden hat und 300 Pfund wiegt, wird er ein jagdbarer oder guter Hirsch genannt; mit zehn Enden ist er noch ein schlecht jagdbarer. Ein sehr alter und starker, guter Hirsch heißt Kapitalhirsch; er trägt ein gutes, braves, prächtiges Gewicht oder Geweih. Ein starker und großer Hirsch sieht gut, ein magerer, schlecht aus am Leibe; einen irgendwie unvollkommenen Hirsch nennt man Kümmerer. Der Hirsch hat kein Fleisch, sondern Wildpret, kein Blut, sondern Schweiß, kein Fett, sondern Feist; seine Beine heißen Läufe, die Schultern Blätter, die Schenkel Keulen, der Unterrücken Ziemer, die Dünnungen Flanken, die Luftröhre Drossel, der Kehlkopf Drosselknopf, der Schwanz Wedel, die Augen Lichter, die Ohren Gehör, die Hörner Geweih, das Fell Haut, die Gedärme Gescheide, die inneren Theile Lunge, Geräusch oder Gelünge, der After Weideloch, die Hufe Schalen, die Afterklauen Oberrücken oder Geäfter, das Euter Gesäuge. Eine Gesellschaft Edelwild wird ein Trupp oder ein Rudel genannt, und auch hierbei unterscheidet man einen Trupp Hirsche von einen Trupp Wild. Das Edelwild steht in einem Reviere, steckt in einem Theile desselben, wechselt auf einem bestimmten Wege hin und her, zieht auf Aesung oder zu Holze, tritt aus dem Holze auf die Felder oder Gehaue; es geht vertraut, wenn es im Schritt läuft, trollt oder trabt, ist flüchtig, wenn es rennt, fällt über Jagdzeuge oder ins Garn; es thut sich nieder, wenn es ruht, und löset sich, wenn es ein natürliches Bedürfnis befriedigt. Der Hirsch orgelt oder schreit, das Thier mahnt (beide klagen, wenn sie bei Verwundungen aufschreien); es verendet, wenn der Tod infolge von Verwundung ensteht, oder fällt und geht ein, wenn es einer Krankheit unterliegt; es brunstet oder brunftet; das Thier geht hochbeschlagen und setzt ein Kalb. Bei guter Aesung wird das Hochwild feist, bei magerer schlecht; der Hirsch setzt sein Geweih auf und vereckt es oder bildet es vollkommen aus; den Bast, welcher an ihm sitzt, fegt er ab; die abfallenden Stücke sind das Gefege. Das Urtheil eines Weidmanns über den Hirsch heißt der Anspruch etc.
Noch gegenwärtig bewohnt das Edelwild fast ganz Europa, mit Ausnahme des höchsten Nordens, und einen großen Theil Asiens. In Europa reicht seine Nordgrenze etwa bis zum 65., in Asien bis zum 55. Grad nördlicher Breite; nach Süden hin bilden der Kaukasus und die Gebirge der Mandschurei die Grenzen. In allen bevölkerten Ländern hat es sehr abgenommen oder ist gänzlich ausgerottet worden, so in der Schweiz und einem großen Theile von Deutschland. Am häufigsten ist es noch in Polen, Galizien, Böhmen, Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Kärnten, Steiermark und Tirol; viel häufiger aber als in allen diesen Ländern, findet es sich in Asien, namentlich im Kaukasus und in dem bewaldeten südlichen Sibirien. Es liebt mehr gebirgige als ebene Gegenden und vor allem große, zusammenhängende Waldstrecken, namentlich Laubhölzer. Hier schlägt es sich zu größeren oder kleineren Trupps zusammen, welche nach dem Alter und Geschlecht gesondert sind: alte Thiere, Kälber, Spießer, Gabler und Schmalthiere bleiben gewöhnlich vereinigt; die älteren Hirsche bilden kleine Trupps für sich, und die starken oder Kapitalhirsche leben einzeln bis zur Brunstzeit, wann sie sich mit den übrigen Trupps vereinigen. Die stärksten Rudel werden demgemäß von den Thieren und den jungen Hirschen, die schwachen von Hirschen mittlern Alters gebildet. Die Kälber bleiben bis zur nächsten Satzzeit bei der Mutter und gesellen sich sodann als Spießer oder Schmalthiere zu den aus älteren Hirschen und Schmalthieren gebildeten Trupps, wogegen die Altthiere, sobald die Kälber ihnen folgen können, neue Rudel bilden und erst im Spätsommer, jedoch nicht immer, mit jenen Rudeln wieder sich zusammenschlagen. An der Spitze des Rudels steht stets ein weibliches Thier, nach welchem alle übrigen sich richten. Dies geschieht selbst während der Brunstzeit, so lange der Hirsch die Thiere nicht treibt. Jener erscheint im Rudel stets zuletzt und zwar um so gewisser, je stärker er ist. »Sieht man«, sagt Blasius, »in der Brunstzeit mehrere starke Hirsche beim Rudel, so kann man immer mit Sicherheit auf einen noch stärkern rechnen, welcher oft fünfhundert Schritte hinterdrein trollt.« Im Winter ziehen sich die Trupps von den Bergen zur Tiefe zurück, im Sommer steigen sie bis zu den höchsten Spitzen der Mittelgebirge empor; im allgemeinen aber hält das Edelwild, so lang es ungestört leben kann, an seinem Stande treulich fest und nur in der Brunstzeit oder beim Aufsetzen der neuen Geweihe und endlich bei Mangel an Aesung verändert es freiwillig seinen alten Wohnort. Der Schnee treibt es im Winter aus den höheren Gebirgen in die Vorberge herab, und das weiche Geweih nöthigt es, in sehr niederem Gebüsch oder im Holze, wo es an den Zweigen nicht anstreicht, sich aufzuhalten. Wird der Wald sehr unruhig, so thut es sich zuweilen in Getreidefeldern nieder. Den Tag über liegt es in seinem Bette verborgen, gegen Abend zieht es auf Aesung aus, im Sommer früher als im Winter. Nur in Gegenden, wo es sich völlig sicher weiß, äst es sich zuweilen auch bei Tage. Beim Ausgehen nach Aesung pflegt es in raschem Trabe sich zu bewegen oder zu trollen; der Rückzug am Morgen dagegen erfolgt langsam, weshalb ihn die Jäger den Kirchgang nennen. Auch wenn die Sonne bereits aufgegangen ist, verweilt es noch in den Vorhölzern; denn der Morgenthau, welcher auf den Blättern liegt, ist ihm unangenehm.
Alle Bewegungen des Edelwildes sind leicht, zierlich und anstandsvoll; namentlich der Hirsch zeichnet sich durch seine edle Haltung aus. Der gewöhnliche Gang fördert hinlänglich; im Trollen bewegt sich das Wild sehr schnell und im Laufe mit fast unglaublicher Geschwindigkeit. Beim Trollen streckt es den Hals weit nach vorn, im Galopp legt es ihn mehr nach rückwärts. Ungeheuere Sätze werden mit spielender Leichtigkeit ausgeführt, Hindernisse aller Art ohne Aufenthalt überwunden, im Nothfall breite Ströme, ja selbst – in Norwegen oft genug – Meeresarme ohne Besinnen überschwommen. Den Jäger fesselt jede Bewegung des Thieres, jedes Zeichen, welches es bei der Spur zurückläßt, oder welches überhaupt von seinem Vorhandensein Kunde gibt. Schon seit alten Zeiten sind alle Merkmale, welche den Hirsch bekunden, genau beobachtet worden. Der geübte Jäger lernt nach kurzer Prüfung mit unfehlbarer Sicherheit aus der Fährte, ob sie von einem Hirsche oder von einem Thiere herrührt, schätzt nach ihr sogar ziemlich richtig das Alter des Hirsches. Die Anzeichen werden gerechte genannt, wenn sie untrüglich sind, und der Jäger spricht nach ihnen den Hirsch an. Unsere Vorfahren kannten zweiundsiebzig solcher Zeichen; Dietrich aus dem Winckell aber glaubt, daß man diese auf siebenundzwanzig herabsetzen kann. Ich will nur einige von ihnen anführen. Der Schrank oder das Schränken besteht darin, daß, wenn der Hirsch feist ist, die Tritte des rechten und linken Laufes nicht gerade hinter, sondern neben einander kommen; an der Weite des Schrittes erkennt man die Schwere des Hirsches. Der Schritt kennzeichnet den Hirsch, weil die Eindrücke der Füße weiter von einander stehen als bei dem Thiere; schreitet er weiter als 75 Centim. aus, so kann er schon ein Geweih von zehn Enden tragen. Der Burgstall oder das Grimmen ist eine kleine, gewölbte Erhebung in der Mitte des Trittes, der Beitritt, welcher den feisten Hirsch anzeigt, der Eindruck des Hinterlaufes neben dem Tritte des Vorderlaufes. Der Kreuztritt entsteht, wenn der Hirsch soweit ausschreitet, daß der Tritt des Hinterlaufes in den zu stehen kommt, welchen der Vorderlauf zurückließ; das Thier geht niemals in dieser Weise. Das Ballenzeichen bildet sich, wenn die Ballen an allen vier Tritten ausgedrückt sind, das Blenden, wenn der Hirsch mit der Hinterschale fast genau in die Vorderfährte tritt. Die Stümpfe deuten auf die stumpfere Form der Schale des Hirsches, während die eines alten Thieres spitziger sind. Das Fädlein ist ein kleiner, schmaler, erhabener Längsstrich zwischen den beiden Schalen, das Insigel, ein von der Schale abgeworfener Ballen Erde, welchen der Hirsch bei feuchtem Wetter aufgenommen hat, der Abtritt ein Eindruck auf Rasen, welcher die Halme abgeschnitten hat (das Thier zerquetscht sie bloß), der Einschlag wird bezeichnet durch Pflanzenblätter und Halme, welche der Hirsch zwischen den Schalen aufnahm und auf harten Boden fallen ließ, der Schloßtritt durch den ersten Eindruck, welchen der Hirsch macht, wenn er sich aus dem Bette erhebt etc. Zu diesen gerechten Zeichen kommen nun noch die Himmelsspur, d.+h. die Merkmale, welche der Hirsch beim Fegen an Bäumen zurückgelassen hat, und andere mehr. Für den Ungeübten dürfte es schwer sein, die Fährten des Hirsches und des alten Thieres, selbst wenn er sie soeben neben einander gesehen hat, ein paar Schritte davon wieder zu unterscheiden.
Unter den Sinnen des Edelwildes sind Gehör, Geruch und Gesicht vorzüglich ausgebildet. Es wird allgemein behauptet, daß das Wild in Entfernungen von vier- bis sechshundert Schritt einen Menschen wittern kann, und nach dem, was ich an dem wilden Renthier beobachten konnte, wage ich nicht mehr, an jener Behauptung zu zweifeln. Auch das Gehör ist außerordentlich scharf; ihm entgeht nicht das geringste Geräusch, welches im Walde laut wird. Manche Töne scheinen einen höchst angenehmen Eindruck auf das Rothwild zu machen: so hat man beobachtet, daß es sich durch die Klänge des Waldhorns, der Schalmei und der Flöte oft herbeilocken oder wenigstens zum Stillstehen bringen läßt.
Ueber Wesen und geistige Eigenschaften des Edelhirsches gehen die Ansichten ziemlich weit auseinander. Der Jäger ist geneigt, in seinem Lieblingswilde den Inbegriff aller Vollkommenheit zu erblicken, der minder eingenommene Beobachter, welcher den Hirsch mit anderen Thieren vergleicht, urtheilt minder günstig. Nach neuerem Dafürhalten ist dieser weder gescheiter noch liebenswürdiger als andere wildlebende Wiederkäuer. Er ist sehr ängstlich und scheu, nicht aber klug und verständig. Sein Gedächtnis scheint schwach, seine Fassungsgabe gering zu sein. Nach und nach sammelt auch er sich Erfahrungen und verwerthet sie nicht ungeschickt; von einem ernstem Nachdenken über seine Handlungen aber dürfte bei ihm kaum gesprochen werden können. Er handelt unvorsichtig, nicht überlegt, ist scheu, jedoch nicht klug. Wenn seine Leidenschaften erregt wurden, vergißt er häufig seine Sicherheit, auf welche er sonst stets zuerst Bedacht zu nehmen pflegt. Liebenswürdig ist er in keiner Weise. Selbstsüchtig denkt der männliche Hirsch ausschließlich an seinen eigenen Vortheil und ordnet diesem alles übrige unter. Das Thier behandelt er stets grob und roh, während der Brunstzeit am schlechtesten. Anhänglichkeit bekundet nur das Thier seinem Kälbchen gegenüber, der Hirsch kennt dieses Gefühl nicht. So lange er anderer Hilfe bedarf, ist er schmiegsam und für Freundlichkeit empfänglich, sobald er seiner Kraft sich bewußt geworden, erinnert er sich früher empfangener Wohlthaten nicht mehr. Andere Thiere fürchtet er, oder sie sind ihm gleichgültig, wenn nicht geradezu unangenehm; schwächere mißhandelt er. Sobald er sich beleidigt wähnt oder gereizt wird, verzerrt er rümpfend die Oberlippe, knirscht mit den Zähnen, verdreht ingrimmig die Lichter, beugt den Kopf nach unten und macht sich zum Stoßen bereit. Während der Brunstzeit ist er förmlich von Sinnen, vergißt alles, vernachlässigt selbst eine regelmäßige Aesung und scheint einzig und allein an das von ihm sonst sehr wenig beachtete Mutterwild und andere gleichstrebende Hirsche zu denken. Ein Brunsthirsch im freien Walde ist eine herrliche, ein Brunsthirsch im engen Gitter eine abscheuliche Erscheinung. Der beschränkte Raum drückt die großen Leidenschaften des Hirsches zum Zerrbilde herab und macht deshalb diesen selbst widerlich. Das Thier erscheint sanfter, hingebender, anhänglicher, kurz liebenswürdiger, ist aber im wesentlichen ebenso geartet wie der Hirsch. Im Freien tritt es, weil ihm die Waffen fehlen, noch furchtsamer auf als dieser, übernimmt deshalb auch regelmäßig die Leitung eines Rudels; wirklich verständig aber zeigt es sich ebensowenig wie jener. Die außerordentlich feinen Sinne, welche jede Gefahr gewöhnlich rechtzeitig zum Bewußtsein bringen, lassen Hirsch und Thier klüger erscheinen, als sie wahrscheinlich sind.
Unzweifelhaft zeigt sich das Edelwild deshalb so furchtsam, weil es erfahrungsmäßig den Menschen als seinen schlimmsten Feind kennt und dessen Furchtbarkeit würdigen gelernt hat. An Orten, wo es sich des Schutzes vollkommen bewußt ist, wird es sehr zutraulich. Im Prater bei Wien standen früher starke Trupps der stattlichen Geschöpfe, welche sich an das Heer der Lustwandelnden vollkommen gewöhnt hatten und, wie ich aus eigener Erfahrung versichern kann, ohne Scheu einen Mann bis auf dreißig Schritte an sich herankommen ließen. Einer dieser Hirsche war nach und nach so kühn geworden, daß er dreist zu den Wirtschaften kam, zwischen den Tischen umherging und die schönen Hände der Frauen beleckte, sie hierdurch bittend, ihm, wie es gewöhnlich geworden war, Zucker oder Kuchen zu verabreichen. Dieses prächtige Thier, welches niemandem etwas zu Leide that, der es gut mit ihm meinte, aber jedem Necklustigen oder Böswilligen sofort das kräftige Geweih zeigte, verendete auf eine klägliche Weise. Bei einer ungeschickten Bewegung verwickelte es sich mit den Sprossen seines Geweihes in eine durchlöcherte Stuhllehne, warf beim Ausrichten den darauf Sitzenden unsanft zu Boden, erschrak hierüber, bohrte die Sprossen noch fester in den Stuhl ein, wurde durch diese unfreiwillige Bürde aufs äußerste entsetzt, und raste nun mit höchster Wuth in den Parkanlagen umher, machte alle übrigen Hirsche scheu und stürzte wie unsinnig auf die Vorübergehenden los, so daß man es endlich erschießen mußte. Bei den Futterplätzen wird das Edelwild oft überraschend zahm. »In Dessau«, sagt Dietrich aus dem Winckell, »stehen an jeder der beiden Fütterungen siebzig, achtzig und mehr Hirsche. Haben sie sich, um besondere Aesung zu suchen, davon entfernt, so kann sie der Jäger mit dem Pferde gemächlich näher treiben. Hat er dann Heu auf die Raufen gesteckt und Hafer oder Eicheln in kleinen Häufchen auf dem Erdboden herumgestreut, so kommen sie, dem wiederholten Rufe: »Komm Hirsch!« zufolge, heran und sind so ruhig bei der Aesung, daß der ihnen bekannte Jäger unter ihnen umherreiten, auch zuweilen einige mit den Händen berühren kann. Dies Schauspiel, an welchem mehrere Zuschauer ganz in der Nähe theilnehmen dürfen, gewährt gewiß jedem Jagdliebhaber ein hohes Vergnügen.«
Anders verhält es sich, wenn der Hirsch in einen engen Raum gesperrt wird, oder wenn die Brunstzeit eingetreten ist. In beiden Fällen wird er oft durch die geringste Kleinigkeit gereizt und nimmt auch den Menschen an. Vor dem von ihn beabsichtigten Angriffe biegt er den Kopf herab, richtet die Spitzen der Augensprossen gerade auf seinen Feind und fährt mit so viel Schnelligkeit auf denselben los, daß schwer zu entkommen ist. Aeltere und neuere Jagdbücher wissen von vielen Hirschen zu erzählen, welche Menschen, oft ohne Veranlassung, angriffen und verwundeten oder umbrachten. » Anno 1637«, erzählt von Flemming in seinem » Teutschen Jäger«, »wurden auf dem Schlosse Hartenstein täglich ein junger Hirsch und eine arme Magd aus der Hofküche gespeiset. Im Herbste trifft der Hirsch das arme Mensch im Walde an und stößt es todt. Er wurde aber, ehe sie begraben worden, erschossen und vor die Hunde geworfen.« In Wildgärten, wo die Hirsche ihre angeborene Scheu vor dem Menschen nach und nach verlieren, werden sie viel gefährlicher als im freien Walde. Lenz sah einen Hirsch auf dem Kallenberge bei Koburg, welcher schon zwei Kinder getödtet hatte und selbst auf den Fütterer lebensgefährlich losstieß, wenn dieser ihm kein Futter mehr geben wollte. »Da der vierbeinige Wütherich«, so erzählt unser Gewährsmann, »gerade kein Geweih, und statt dessen nur weiche Kolben hatte, also an sich schon weniger gefährlich war, so bat ich den Wärter, Futter zu holen, dies in kleinen Gaben meiner linken Hand zu überliefern, die rechte aber mit einem guten Knüppel zu bewaffnen. Ich fütterte nun den Hirsch. So oft eine Gabe alle war, trat er zurück, um Anlauf zu nehmen, zuckte boshaft mit der Nase, sah mich schief und wüthend an, wich aber jedesmal, wenn ich die Waffe drohend schwang, und kam dann ganz getrost wieder, wenn die neue Futtergabe sich zeigte.« In Gotha stieß ein zahmer Hirsch seinen sonst sehr von ihm geliebten Wärter in einem Anfalle von Bosheit durchs Auge ins Gehirn, daß der Verletzte augenblicklich todt zur Erde sank; in Potsdam mordete ein ganz zahmer weißer Hirsch seinen Versorger, mit welchem er im besten Einverständnisse lebte, auf gräßliche Weise. Aehnliche Fälle ließen sich noch viele aufführen. In den Thiergärten fürchtet man die eingehegten Edelhirsche mehr als Tiger und Löwen; denn diesen sieht man auf den ersten Blick an, ob sie gute oder schlechte Laune haben, jene dagegen sind unberechenbar und während der Brunstzeit förmlich von Sinnen. Nur in der Jugend beweisen sie ihrem Wärter eine gewisse Anhänglichkeit; je älter sie werden, um so mehr zeigen sie sich geneigt, gerade ihre besten Bekannten zu mißhandeln. Wirklich vertrauen darf man ihnen nie, weil sie kein Vertrauen verdienen. Das Thier ist nicht im geringsten liebenswürdiger und ansprechender als der Hirsch, nur minder wehrhaft und gefährlich. Aber auch sein Zorn flammt wie Strohfeuer auf, und es gebraucht seine Schalen mit ebensoviel Kraft wie Geschick, sobald es sich darum handelt, seine Abneigung oder schlechte Laune kundzugeben. Gleichwohl lassen sich Hirsch und Thier bis zu einem gewissen Grade zähmen, auch zu mancherlei sogenannten Kunststückchen abrichten; jede Ziege aber leistet in dieser Beziehung mehr als sie. August II. von Polen fuhr im Jahre 1739 mit acht Hirschen; die Herzöge von Zweibrücken und Meiningen hatten Gespanne, welche aus weißen Hirschen bestanden. Heutzutage sieht man höchstens bei Bereitern und Seiltänzern noch eine derartige Verwendung der edeln Thiere. An Futter und Pflege stellen gefangene Edelhirsche wenig Ansprüche, halten sich deshalb auch im engen Gewahrsam sehr gut, pflanzen sich ohne Umstände fort und erzeugen mit ihren nächsten Verwandten fruchtbare Blendlinge. Dies benutzend, hat man in neuerer Zeit mehrfach und nicht gänzlich ohne Erfolg Versuche gemacht, den Edelhirsch mit dem Wapiti zu kreuzen, um in geschützten Gegenden stärkeres Wild zu erzielen.
Je nach der Jahreszeit ist die Aesung des Edelwildes eine verschiedene. Im Winter besteht sie in grüner Saat und vielen Pflanzen, welche in der Nähe von Quellen hervorsprießen, in Knospen, Holzrinde, Heidekraut, Brombeerblättern, Misteln und dergleichen, im Frühlinge in Knospen und frischen Trieben mit oder ohne Laub, allerlei Grasarten und Kräutern, später aus Getreidekörnern, Rüben, Kraut, verschiedenen Früchten, Kartoffeln, Bücheln und Eicheln. Nach Blasius soll das Edelwild in Norddeutschland erst seit etwa fünfzig Jahren den Kartoffeln nachgehen, auch Fichtenrinde früher nicht abgeschält haben, überhaupt seine Neigungen im Verlaufe verschiedener Geschlechter mehrfach geändert haben. Während der Brunstzeit nehmen die alten Hirsche nur das Nothdürftigste zu sich und fressen dann meist Pilze, und zwar auch solche, welche für den Menschen giftig sind. Salz liebt das Rothwild ebenso sehr wie die meisten übrigen Wiederkäuer.
Starke Hirsche werfen ihre Geweihe bereits im Februar, spätestens im März ab und ersetzen sie bis zu Ende Juli vollständig wieder; junge Hirsche, zumal Spießer, tragen die Stangen oft noch im Mai, haben jedoch ebenfalls im August bereits vereckt und gefegt.
Mit dem Geweihwechsel steht die Härung in gewisser Beziehung, mit beiden die Geschlechtsthätigkeit im Einklange. Nachdem das Geweih abgeworfen worden ist, bildet sich mit ihm das Sommerhaar aus, und sobald letzteres vollendet ist, setzt das Thier sein Kalb. Der Hirsch brunstet im vollen Sommerhaare und verliert die Grannen bald nach der Brunst, worauf die Entwickelung des Winterhaares vor sich geht.
»Die Brunstzeit des Edelwilds«, sagt Dietrich aus dem Winckell, »fängt mit Eintritt des Monats September an und dauert bis zur Mitte des Oktober. Schon gegen Ende des August, wenn die Hirsche am feistesten sind, erwachen in den stärksten die Triebe zur Brunst. Sie äußern dies durch ihr Schreien – einen Laut, welcher dem Jäger angenehm, dem musikalischen Ohr aber nichts weniger als schmeichelnd ist – infolge dessen ihnen gleich anfangs der Hals anschwillt. Denselben Ort, wo der Hirsch einmal gebrunstet hat, wählt er, solange das Holz nicht abgetrieben wird, und falls er Ruhe hat, in den folgenden Jahren immer wieder. Solche Stellen nennt man Brunstplätze. In der Nachbarschaft derselben zieht sich dann auch das Wild in kleine Trupps zu sechs, acht, zehn bis zwölf Stück zusammen, verbirgt sich aber, vielleicht aus Gefallsucht, vor dem Brunsthirsche. Dieser trollt unaufhörlich mit zu Boden gesenkter Nase umher, um zu wittern, wo es gezogen ist und steht. Findet er noch schwache Hirsche oder Spießer dabei, so vertreibt er sie und bringt sich in den Besitz der Alleinherrschaft, welche er von nun an mit der größten Strenge ausübt. Keine der erwählten Geliebten darf sich nur auf dreißig Schritte weit entfernen; er treibt sie sämmtlich auf den gewählten Brunstplatz. Hier, von soviel Reizen umgeben, vermehrt sich der Begattungstrieb stündlich; aber noch immer weigern sich wenigstens die jüngeren Spröden, die Schmalthiere, welche er unausgesetzt umherjagt, so daß der Platz ganz kahl getreten wird.
»Abends und morgens ertönt der Wald vom Geschrei der Brunsthirsche, welche sich jetzt kaum den Genuß des nöthigen Geäses und nur zuweilen Abkühlung in einer benachbarten Suhle oder Quelle, wohin die Thiere sie begleiten müssen, gestatten. Andere, weniger glückliche Nebenbuhler beantworten neidisch das Geschrei. Mit dem Vorsatze, alles zu wagen, um durch Tapferkeit oder List sich an die Stelle jener zu setzen, nahen sie sich. Kaum erblickt der beim Wilde stehende Hirsch einen andern, so stellt er sich, glühend vor Eifersucht, ihm entgegen. Jetzt beginnt ein Kampf, welcher oft einem der Streitenden, nicht selten beiden, das Leben kostet. Wüthend gehen sie mit gesenktem Gehörn auf einander los, und suchen sich mit bewundernswürdiger Gewandtheit wechselweise anzugreifen oder zu vertheidigen. Weit erschallt im Walde das Zusammenschlagen der Geweihe, und wehe dem Theile, welcher aus Altersschwäche oder sonst zufällig eine Blöße gibt! Sicher benutzt diese der Gegner, um ihm mit den scharfen Ecken der Augensprossen eine Wunde beizubringen. Man kennt Beispiele, daß die Geweihe beim Kampfe sich so fest in einander verschlungen hatten, daß der Tod beider Hirsche die Folge dieses Zufalls war, und auch dann vermochte keine menschliche Kraft, sie ohne Verletzung der Enden zu trennen. Oft bleibt der Streit stundenlang unentschieden. Nur bei völliger Ermattung zieht sich der Besiegte zurück; der Sieger aber findet seinen Lohn im unersättlichen, immer wechselnden Genuß von Gunstbezeugungen der Thiere, welche – wer kann es bestimmen, ob nicht mit getheilter Theilnahme – dem Kampfe zusahen. Während desselben gelingt es zuweilen ganz jungen Hirschen, sich auf kurze Zeit in den Besitz der Rechte zu stellen, um welche jene sich mit so großer Hartnäckigkeit streiten, indem sie sich an das Wild heranschleichen und das genießen, was ihnen sonst erst drei Wochen später, wenn die starken, ganz entkräftet, die Brunstplätze verlassen, zu Theil wird. Zum Beschlage selbst bedient der Hirsch sich nur eines sehr kurzen Zeitraums.
»Das Thier gehört nicht zu den Geschöpfen, welche nicht gleiches mit gleichem vergelten, wenn der Gatte sich steten Wechsel erlaubt! Es sucht sich so oft als möglich für den Zwang schadlos zu halten, welchen ihm die eifersüchtigen Grillen desselben auflegen. Sonst schrieb man ihm soviel Enthaltsamkeit zu, daß man behauptete, es trenne sich unvermerkt vom Hirsche, sobald es sich hochbeschlagen fühle; neuere Beobachtungen haben das Gegentheil bewiesen.
»Vierzig bis einundvierzig Wochen geht das Thier tragend. Es setzt, je nachdem es während der Brunst zeitig oder spät beschlagen wurde, zu Ende des Mai oder im Monat Juni ein Kalb, selten zwei. Wenn die Setzzeit herannaht, sucht es Einsamkeit und Ruhe im dichtesten Holze. Die Kälber sind in den ersten drei Tagen ihres Lebens so unbeholfen, daß sie sich nicht von der Stelle bewegen. Man kann sie sogar mit der Hand aufnehmen. Nur selten und auf kurze Zeit verläßt sie in dieser Zeit die Mutter, und selbst wenn sie verscheucht wird, entfernt sie sich bloß so weit als nöthig ist, um durch vorgegebene Flucht die wirkliche oder eingebildete Gefahr abzuwenden. Und diesen Zweck sucht sie, vorzüglich wenn ein Hund oder Raubthier sich naht, mit vieler Schlauheit zu erreichen. Trotz ihrer sonstigen Furchtsamkeit flieht sie nicht eher und nicht schneller, als sie muß, um zu entkommen, weil sie weis, daß dies das beste Mittel ist, die Aufmerksamkeit des Feindes vom Kalbe ab und auf sich zu ziehen, und jenen, indem er ihr mit Eifer folgt, irre zu führen. Kaum ist er gänzlich entfernt, so eilt sie an den Ort zurück, wo sie ihren Liebling verließ. Nachdem das Kalb nur eine Woche überlebt hat, würde die Mühe vergeblich sein, es ohne Netze fangen zu wollen. Ueberall folgt es nun der Mutter und drückt sich sogleich im hohen Grase, wenn diese sich meldet, d. h. einen Laut des Schreckens von sich gibt, oder mit dem Vorderlaufe schnell und stark auf den Boden stampft. Es besaugt das Thier bis zur nächsten Brunstzeit, und wird von diesem über die Wahl der ihm dienlichen Aesung von Jugend auf belehrt.«
Von nun an beginnt das wechselreiche Leben des Edelwildes. Das Wildkalb ist bereits im dritten Jahre erwachsen, das Hirschkalb braucht eine Reihe von Jahren, ehe es sich alle Rechte der Alleinherrschaft erworben hat. Im siebenten Monate seines Alters setzt es zum erstenmale auf, und von nun an wechselt es seinen Hauptschmuck in jedem Jahre. Ich halte es für sehr belehrend, einen kurzen Ueberblick der Veränderungen, welche das Hirschkalb durchmacht, hier zu geben, und will mich dabei auf Blasius stützen, welcher diesen Gegenstand im naturwissenschaftlichen Sinne behandelt hat. Es reicht beim Hirsche noch weniger aus als beim Rehbocke, die Anzahl der Enden jagdmäßig zu bestimmen, um die Reihe der allmählichen Entwickelung zu bezeichnen. Wenn auch in der Anzahl der Enden oft eine Unregelmäßigkeit des Fortschritts bemerkt wird und sogar die Hirsche nicht selten wieder zurücksetzen, findet doch eine strenge Gesetzmäßigkeit in der Reihenfolge der Entwickelung statt, und die Bestimmung einer solchen Entwickelungsreihe bringt die Anzahl der Enden nicht so oft in Widerspruch mit der Stärke des Geweihes der Hirsche als die jagdmäßige Zählung. Für eine naturgeschichtliche Betrachtung erscheint die Gestalt der Geweihe von viel größerer Wichtigkeit als die Anzahl der Enden. Bei der Zählung der Enden kommt ihre Stellung wieder vielmehr in Betracht als die Anzahl selber. Nur diejenigen Enden sind von Bedeutung, welche mit der Hauptstange in Berührung kommen, alle Verzweigungen, entfernt von der Hauptstange, können nur als zufällige, keine wesentlichen Veränderungen des Bildungsgesetzes bedingende Abweichungen angesehen werden. Die Hauptstange hat anfangs nur eine einzige, gleichmäßige und schwache Krümmung; dann erhält sie eine plötzliche, knieförmige Biegung an der Stelle, wo der Mittelsproß entsteht, nach rückwärts, während die Spitze immer nach innen gerichtet bleibt. Eine zweite knieförmige Biegung erhält sie in der Krone des Zwölfenders: sie biegt sich wieder rückwärts und macht am Fuße der Krone einen Winkel; eine dritte tritt beim Vierzehnender, eine vierte beim Zwanzigender immer höher hinauf in der Krone ein, während die Spitze oder Außenseite sich nach innen kehrt. Jede dieser Biegungen bleibt für alle folgenden Entwickelungsstufen als Grundlage. Ebenso auffallend ist die Veränderung des Augensprosses im Verlaufe der Entwickelung. Zuerst steht er ziemlich hoch, später tritt er der Rose immer näher. Anfangs macht er mit der Hauptstange einen spitzen Winkel, später vergrößert sich dieser immer mehr. Aehnliche Veränderungen gehen der Mittelsproß, der Eissproß und die Krone ein. Der Spießhirsch trägt schlanke und zertheilte Hauptstangen mit gleichmäßiger Krümmung nach außen, ohne alle knieförmige Biegung; die Spitzen sind wieder nach innen gerichtet. Der Gabelhirsch hat an einer entsprechenden Hauptstange schwache, aufwärtsstrebende, von der Rose sehr entfernte Augensprossen. Beim Sechsender hat die im ganzen noch ähnlich gebogene Hauptstange gegen die Mitte eine plötzliche, knieförmige Biegung; ihre beiden Hälften verlaufen in untergeordneten, nach hinten gekrümmten Bögen; an dem nach vorn gekehrten Knie steht der aufstrebende, schwache Mittelsproß; der Augensproß hat sich mehr gesenkt. Sowie an einer Stange, kann auch an beiden der Mittelsproß fehlen: dann hätte man der Form nach einen Sechsender, welcher jagdmäßig als Gabelhirsch zählen würde; fehlt auch der Augensproß, so hätte man einen Spießer, den man der Form nach als Sechsender ansprechen müßte. Beim Achtender tritt eine Endgabel zum Augen- und Mittelsproß, welche stärker und mehr senkrecht gestellt sind. Auch hier sind die Nebensprossen oft nur durch die Winkelbildung der Hauptstange angedeutet: man kann der Form nach Achtender haben, welche jagdmäßig nur als Sechsender angesprochen werden dürften. Beim Zehnender tritt zum erstenmal der Eissproß oder zweite Augensproß auf; er kann aber auch durch eine bloße scharfe Kante an der Hauptstange angedeutet sein: dann hat man Achtender, welche als Zehnender angesprochen werden müssen. Nun kann auch der äußere Gabelsproß verkümmern: dann hat man Sechsender, anstatt der Zehnender; ja es kann vorkommen, daß auch der Mittelsproß verkümmert und man hat Gabelhirsche, welche thierkundlich als Zehnender angesprochen werden müssen. Beim Zwölfender zeigt sich zum erstenmal die Krone. Die Hauptstange tritt rückwärts knieförmig heraus, mit der Spitze nach innen gekehrt. Hier liegen zuerst nicht mehr alle Enden in einer und derselben gleichmäßig gekrümmten Fläche; das Ende der Hauptstange macht durch die zweite knieförmige Biegung eine Ausnahme. Es tritt mit den beiden Enden der Gabel des Horns von der unzertheilten Oberhälfte der Hauptstange in einem und demselben Punkt hervor, und dies bedingt das Gepräge der Krone. Hier treten oft Verkümmerungen auf. Am häufigsten fehlen die Eissprossen: dadurch entstehen die sogenannten Kronzehnender, welche mit vollem Rechte thierkundlich als Zwölfender angesprochen werden; es fehlt auch der äußere Nebensproß der Gabel, der Gipfel des Geweihes ist dann wieder eine Gabel; allein die Enden liegen noch in einer und derselben gleichmäßig gekrümmten Fläche: auch solche Zehnender müssen als Zwölfender gelten. Die Verkümmerung kann so weit gehen, daß Hirsche jagdmäßig als Sechsender angesprochen werden, welche, thierkundlich betrachtet, Zwölfender sind; solche Geweihe sind aber selten. Am Vierzehnender bildet die nach hinten gerichtete Spitze des Zwölfenders wieder eine regelmäßige Gabel, d. h. es tritt nach außen ein Nebensproß an ihr hervor; hierdurch bildet sich eine zweite Gabel hinter der ersten, deren Theilung etwas höher als die der vordern Gabel stattfindet. Diese Doppelgabel kennzeichnet die Krone des Vierzehnenders; fehlt solchem Geweihe der Eissproß, so wird der Hirsch jagdmäßig als Zwölfender angesprochen u. s. f. In der Krone des Sechzehnenders biegt sich die Hauptstange hinter der Doppelgabel des Vierzehnenders aufs neue zurück, wendet aber die Spitze wieder nach innen; die fünffache Krone des Achtzehnenders entwickelt die Spitze der Hauptstange des Sechzehnenders und wieder einen Nebensproß nach außen: hierdurch entsteht eine dreifache Gabel über und hinter einander, von vorn nach hinten allmählich höher ansteigend; sie, mit der doppelten Biegung der Hauptstange, kennzeichnet den Achtzehnender. Beim Zwanzigender biegt sich hinter der dreifachen Kronengabel des Achtzehnenders die Hauptstange aufs neue knieförmig nach rückwärts, die Krone zählt also sieben Enden und drei knieförmige Biegungen. Die Krone des Zweiundzwanzigenders würde vier Kronengabeln hinter einander und eine dreifache knieförmige Biegung in der Hauptstange einer Krone haben etc. In diesen Zügen liegt die regelrechte Entwickelungsreihe angedeutet, und der Zusammenhang der Gestalt und Anzahl ist unverkennbar; die Form der Geweihe erscheint als Hauptsache, als das bedingende, die Anzahl der Enden schließt sich der Form als das unwesentliche, bedingte, an. Alle Abweichungen sind für den Thierkundigen nebensächlich, auch solche, wo die Nebensprossen sich ungewöhnlich zertheilen; denn solche Zertheilung kann jede Verzweigung der Hauptstange treffen und ins unbegrenzte fortgehen. Sie zeigen sich nicht selten in den Enden der Kronen von sehr alten Hirschen und kommen auch häufig an dem Mittelsproß vor. So kommt es, daß in den Augen des Naturforschers die hohe Endenzahl vieler berühmten Geweihe, z. B. des Sechsundsechzigenders auf der Moritzburg, welcher vom Kurfürsten Friedrich III. 1696 bei Fürstenwalde geschossen wurde, sehr gewaltig zusammenbricht. Mehr als zwanzig regelrechte Enden sind wohl sehr selten vorgekommen; Achtzehnender sieht man schon in jeder mäßig großen Sammlung, und unter den lebenden Hirschen kommen Sechzehnender noch immer nicht selten vor. Bei reichlicher Aesung geschieht es, daß die Hirsche bei neuen Aufsätzen Geweihe von sechs und zehn Enden überspringen; noch häufiger aber kommt das Wiederholen der Endenanzahl und ebenso oft das Zurücksetzen auf eine geringere Endenanzahl vor. In dieser Beziehung bildet der Zehnender eine auffallende Grenze. Ein Hirsch, welcher einmal eine Krone getragen hat, setzt nie weiter als auf einen regelmäßigen Zehnender zurück.«
In gewisser Hinsicht auffallend ist es, daß jeder gesunde Hirsch sein Geweih in eben der Form und Stellung wieder aufsetzt, wie er es im vorigen Jahre hatte. Wenn es weit oder eng, vorwärts oder rückwärts stand, bekommt es auch in der Folge wieder eben dieselbe Gestalt, und wenn der Augen- oder Eissproß oder andere Enden eine besondere Biegung machen, erscheint diese in gleicher Weise beim nächsten Aufsetzen. Einige Jäger, welche Gelegenheit zu vielen Beobachtungen hatten, behaupten sogar, daß gewisse Eigentümlichkeiten der Geweihe sich der Nachkommenschaft durch viele Geschlechter hindurch vererben. Sie versichern, daß sie gewisse Familien sofort am Geweih zu erkennen vermöchten. Daß auch die Oertlichkeit auf Bildung des Geweihes Einfluß hat, dürfte kaum zu bezweifeln sein. Die Hirsche der Donauinseln z. B. tragen, so schwach von Wildpret sie auch sind, auffallend vielendige Geweihe: Vierundzwanzigender unter ihnen gehören nicht zu besonderen Seltenheiten, obschon die Geweihe nicht so schwer als bei Berghirschen sind.
Das Gewicht, welches das Geweih erreichen kann, ist sehr verschieden; bei schwachen Hirschen wiegt es 9 bis 10, bei sehr starken 16 bis 18 Kilogramm.
Die Feinde des Edelwildes sind der Wolf, der Luchs und der Vielfraß, seltener der Bär. Wolf und Luchs dürften wohl die schlimmsten genannt werden. Der erstere verfolgt bei tiefem Schnee das Wild in Meuten und hetzt und mattet es ab; der letztere springt ihm von oben herab auf den Hals, wenn es, nichts ahnend, vorüberzieht. Der schlimmste Feind aber ist und bleibt unter allen Umständen der Mensch, obgleich er das Edelwild gegenwärtig nicht mehr in der greulichen Weise verfolgt und tödtet als früher. Ich glaube hier von der Jagd absehen zu dürfen, weil eine genaue Beschreibung derselben uns zu weit führen dürfte und man darüber, wenn man sonst will, in anderen Büchern nachschlagen kann. Gegenwärtig ist dieses edle Vergnügen schon außerordentlich geschmälert worden, und die meisten der jetzt lebenden Jäger von Beruf haben keinen Hirsch geschossen: solches Wild bleibt für vornehmere Herren aufgespart. Es mag wohl eine recht lustige Zeit gewesen sein, in welcher die Grünröcke noch die liebe deutsche Büchse fast ausschließlich handhabten und in den glatten Schrotgewehren nur ein nothwendiges Uebel erblickten! Mit großartigem Schaugepränge zog man zu den Jagden hinaus, und fröhlich und heiter ging es zu, zumal dann, wenn einer oder der andere von den Sonntagsschützen oder noch nicht ganz weidgerechten Jägern sich irgend ein Versehen zu Schulden hatte kommen lassen.
Die Zeit ist vorüber, für immer. Es hat nur einmal eine deutsche Jägerei gegeben. Und wenn auch da, wo es gegenwärtig noch Hirsche gibt, die reichen Grundbesitzer sich vielfach bemüht haben, solch ein frisch fröhliches, männliches Treiben bei sich einzuführen: sie haben nicht auch gleich die Heiterkeit und Gemächlichkeit, den derben Witz unserer Altvorderen ihren Gehülfen anlernen können, und so ist all ihr Thun nur Stückwerk geblieben. Daß die großartigen »Parforcejagden« und andere ähnliche Anstalten zur Erlegung des Edelwildes ursprünglich fremde Einrichtungen waren, erkennt jeder leicht an ihrem, dem deutschen Wesen so widersprechenden Gepräge. Unsere Vorfahren gebrauchten nur die Büchse zur Erlegung des Hirsches.
Auch das Edelwild wird von einigen Bremsenarten arg geplagt. Diese widerlichen Kerfe legen ihre Zuchten, ganz in der Weise wie bei dem Ren, auf dem Wilde an, und die Schmeißbrut durchlöchert den armen Geschöpfen fast das ganze Fell. Auch eine Laus, welche sich in den Haaren einnistet, Fliegen und Mücken quälen das Wild in hohem Grade. Um diesen, ihm äußerst verhaßten Geschöpfen zu entgehen, suhlt es sich oft stundenlang im Wasser. Außerdem ist das Wild manchen Krankheiten unterworfen. Der Milzbrand tritt oft seuchenartig auf, die Leberfäule, die Ruhr, der Zahnkrebs und die Auszehrung richten zuweilen große Verheerungen an, und in schlechten Jahren gehen auch viele Hirsche aus noch unerklärten Ursachen ein.
Leider ist der Schaden, welchen das Rothwild anrichtet, viel größer als der Nutzen, den es bringt. Nur aus diesem Grunde ist es in den meisten Gegenden unseres Vaterlandes ausgerottet worden. Obschon Wildpret, Decke und Geweih hoch bezahlt werden, und man die Jagdfreude sehr hoch anschlagen darf: der vom Wild verursachte Schaden wird hierdurch nicht aufgehoben. Ein starker Hochwildstand verträgt sich mit unseren forstwirtschaftlichen Grundsätzen durchaus nicht mehr.
In früheren Zeiten beschäftigte sich der Aberglaube lebhaft mit allen Theilen des Hirsches; heutzutage scheinen bloß die Chinesen, welche die noch weichen Hirschgeweihe als Arzneimittel verwenden und mit außerordentlich hohen Preisen bezahlen, an ähnlichen Anschauungen festzuhalten. Bei uns zu Lande wurden vormals die sogenannten Haarbeine, die Thränendrüsen, die Eingeweide, das Blut, die Geschlechtsteile, die im Magen nicht selten vorkommenden Bezoare, ja selbst die Losung als viel versprechendes Heilmittel in hohen Ehren gehalten. Aus Hirschklauen verfertigte man sich Ringe als Schutzmittel gegen den Krampf; Hirschzähne wurden in Gold und Silber gefaßt und von den Jägern als Amulete getragen. Von dem Leben des Thieres erzählt man sich allerlei Fabeln, und selbst die Jäger hielten lange daran fest, bis erst die genauere Beobachtung den Hirsch uns kennen lehrte.
Das Edelwild hat wenige, ihm wirklich nahestehende Verwandte. In Nordwestafrika lebt ein Hirsch, welchen man unter dem Namen Cervus barbarus getrennt, aber keineswegs allseitig als besondere Art anerkannt hat, sondern eher als Abart betrachten will, weil er dem Edelhirsche in jeder Hinsicht am ähnlichsten ist. Sodann kennt man einen stattlichen Hirsch aus Persien, welcher mit dem unserigen viel übereinstimmendes zeigt, durch bedeutendere Größe und viel stärkere Nackenmähne aber sich hinlänglich unterscheidet ( Cervus Wallichii), und endlich ist der größte aller eigentlichen Hirsche, der Wapiti Nordamerikas ( Cervus canadensis), hierher zu rechnen. Alle übrigen Hirsche stimmen wenig mit dem unserigen überein, welcher auch ihnen gegenüber immerhin den Namen Edelhirsch verdient. Doch gibt es einzelne Arten, welche sich durch Schönheit des Baues wesentlich auszeichnen.
Unter ihnen steht meiner Ansicht nach der Barasinga ( Cervus Duvaucelii, C. Bahrainja und elaphoides, Rucervus Duvaucelii) oben an. Er wird als Vertreter einer besondern Untersippe, der Zackenhirsche ( Rucervus) betrachtet, ist schlank gebaut und hoch gestellt, der Kopf verhältnismäßig kurz, nach der Muffel zu pyramidenförmig zugespitzt, das Gehör groß, namentlich auffallend breit, das Auge sehr groß und schön; die Läufe sind hoch, aber kräftig; der Wedel ist kurz, beträchtlich länger als bei unserem Edelwilde, aber nur etwa halb so lang als bei dem Damwilde. Das Geweih zeichnet sich durch Breite und wiederholte Verästelungen aus. Im ganzen betrachtet, hat es mit dem Schaufelgeweih des Elch einige Aehnlichkeit, obwohl von Schaufeln nicht gesprochen werden kann. Die Stangen biegen sich gleich von der Rose an zur Seite und oben, aber nur wenig nach hinten, senden hart über der Rose den sehr langen, kräftigen, nach vorn, oben und außen gerichteten Augensproß ab und zertheilen sich im letzten Drittheil ihrer Länge in zwei fast gleichwerthige Aeste, welche sich wiederum zersprossen. Der hintere dieser Aeste, welcher als das Ende der Stange betrachtet werden darf, wird zur Krone; er zerfällt in den starken Endzacken, welcher fast gerade nach oben und hinten sich richtet, und in zwei unverhältnismäßig kurze Nebensprossen, welche nach rückwärts gekehrt sind. Der vordere Ast wendet sich nach außen, oben und vorn und verzweigt sich ebenfalls in ein einfach und doppelt getheiltes, d.+h. wiederum sprossiges Ende, welches sich nach vorn, unten und innen kehrt. Der im vierten Jahre stehende Hirsch, nach welchem ich vorstehende Beschreibung entworfen habe, ist, weidmännisch bezeichnet, ein Vierzehnender. Die Behaarung ist reich und dicht, das einzelne Haar lang und ziemlich fein; die Decke erscheint aber struppig, weil die Haare nicht gleich lang sind. Das Gehör ist außen kurz und gleichmäßig, innen sehr lang und ungleichmäßig, fast zottig behaart. An der Wurzel ist das einzelne Leibeshaar dunkelgraubraun, hierauf goldigbraun, an der Spitze endlich etwa zwei Millimeter lang wieder dunkler. Die Gesammtfärbung erscheint im Sommer goldigrothbraun, geht aber nach unten hin durch Grau in Lichtgelb über, weil die Spitzen der Haare hier grau und bezüglich lichtgelb gefärbt sind. Ueber den Rücken verläuft ein breiter Streifen von dunkelbrauner Färbung, welcher auch den größten Theil des an der Spitze lichtgelben Wedels einnimmt und jederseits durch eine Reihe von kleinen goldgelben Flecken besonders gehoben wird. Der Kopf ist auf Stirn und Schnauzenrücken rothbraun, goldig gesprenkelt; Kopf und Schnauzenseiten sind grau, die Unterseite der Schnauze, Kehle und Kinn grauweiß. Hinter der nackten Muffel verläuft ein ziemlich breites, dunkelbraunes Band, welches auf der fast weißen Unterlippe noch angedeutet ist. Ein zweites, wenig bemerkbares Band, gewissermaßen die Fortsetzung der dunkeln Braue, verläuft, nach der Muffel zu ausgeschweift, von einem Auge zum andern. Eigenthümlich sind lange borstenartige Haare, welche, einzeln stehend, die Muffel und das Auge umgeben. Das Gehör ist bräunlich, auf der Außenseite dunkel gerandet, an der Wurzel hingegen gelblichweiß; dieselbe Färbung zeigen die Haare der Innenmuschel. Bauch und Innenschenkel sind gelblich, die Schienbeine der Vorderläufe braungrau, die Fußwurzeln lichtfahlgrau; an den Hinterläufen sind die Fesseln dunkler als die Schenkel. Die Schalen sind groß und können sehr breit gestellt werden.
Soviel bis jetzt bekannt, bewohnt dieses zierliche Thier ganz Hinderindien. Ob es vorzugsweise im Gebirge oder aber in der Ebene gefunden wird, ist mir nicht bekannt. Cuvier, der Entdecker, bestimmte es nach den Geweihstangen, welche ihm eingesandt wurden; viel später bekam man den Hirsch selbst im Balge und erst in der Neuzeit lebend zu Gesicht. Der Earl von Derby, welcher einen der am reichsten besetzten Thiergärten hielt, scheint zuerst lebende Barasingas besessen zu haben; später kamen solche Hirsche nach London, und gegenwärtig sieht man sie in mehreren Thiergärten, obgleich überall noch selten. Der vorstehend beschriebene Barasinga kam als Schmalspießer in Europa an, trug aber bereits ein Geweih, welches dem eines Edelgablers entsprach, da die Spieße schon einen Ansatz zur Theilung zeigten. Anfang Februar warf er ab und setzte hierauf ein Geweih von vierzehn Enden, jede Stange mit Augensproß und zwei ziemlich gleichmäßig entwickelten Gabeln an der Spitze. Das nächstfolgende Geweih unterschied sich nur durch größere Stärke, nicht durch die Endenzahl.
Ueber die Zeit der Brunst und die Geburt des Jungen ist mir bis jetzt noch nichts bekannt geworden; doch läßt sich nach dem Aufsetzen des Geweihes schließen, daß gerade dieser Hirsch mit unserem Edelwilde so ziemlich die gleiche Zeit halten mag. Nach meinen Beobachtungen an dem von mir gepflegten Gefangenen glaube ich, daß der Barasinga zur Einbürgerung bei uns sich eignen würde. Er scheint unser Klima vortrefflich zu vertragen und ist ein so anmuthiges Geschöpf, daß er jedem Parke oder Walde zur größten Zierde gereichen müßte. Seine Haltung ist stolz und etwas herausfordernd, sein Gang zierlich, jedoch gemessen, sein Betragen anscheinend lebendiger, ich möchte sagen muthwilliger, als das anderer Hirsche. Mein Gefangener war ein übermüthiger Gesell, welcher sich mit allem möglichen versuchte. Er stand mit seinem Wärter auf dem besten Fuße, hörte auf seinen Namen und kam gern herbei, wenn er gerufen wurde, nahm aber jede Gelegenheit wahr, dem Manne, mehr aus Spiellust als im Ernste, einen Stoß beizubringen. Den neben ihm stehenden Hirschen trat er oft herausfordernd entgegen und begann dann selbst mit den stärksten durch das Gitter hindurch einen Zweikampf. Ein weißer Edelhirsch, ihm gegenüber ein Riese, wurde ohne Unterlaß von ihm geneckt, gefoppt und zum Kampfe herausgefordert, so daß ich ihn schließlich versetzen mußte, um den Barasinga nicht zu gefährden. Die Stimme des letztem ist ein ziemlich hoher, kurzer, blökender Ton, welcher dem Schrei einer geängstigten jungen Ziege sehr ähnelt, jedoch viel kürzer hervorgestoßen wird. Abweichend von anderen Hirschen schreit der Barasinga zu jeder Jahreszeit, gewissermaßen zu seiner Unterhaltung; er pflegt auch einen Anruf mit Regelmäßigkeit zu beantworten.
Unter anderen indischen Hirschen verdient zunächst der Axis unsere Beachtung. Man hat auch ihn, wohl wegen seines unter den Hirschen allerdings vereinzelt dastehenden Fleckenkleides, in der Neuzeit zum Vertreter einer besondern Untersippe ( Axis) erhoben; doch zeigt er im allgemeinen das Gepräge anderer Hirsche, welche das gleiche Vaterland mit ihm bewohnen. Dabei ist allerdings zu bemerken, daß sein Geweih mehr dem unseres sechsendigen Edelhirsches ähnelt als dem der übrigen indischen Hirsche, mit denen wir uns bald beschäftigen werden.
Der Axis ( Cervus Axis, Axis maculata) ist, soweit die Färbung in Betracht kommt, einer der schönsten, wo nicht der schönste aller Hirsche. Der Leib ist gestreckt, aber niedrig gestellt und deshalb gedrungen erscheinend, der Hals verhältnismäßig dick, der Kopf kurz, regelmäßig gebaut, nach der schmalen und kurzen Schnauze hin gleichmäßig sich verschmächtigend, das Gehör mittellang, lanzettförmig, schmal, innen kaum, außen leicht behaart, der Wedel ziemlich lang, gerundet, kaum breiter als dick. Das schön leierförmige Geweih biegt sich von der Wurzel ab nach hinten, außen und oben. Der Augensproß entspringt unmittelbar an der Rose und wendet sich von hier aus nach vorn, außen und oben, der Gabelsproß zweigt sich etwa in der Mitte der Stange ab und wendet sich nach oben und ein wenig nach hinten. Ein angenehmes Grauröthlichbraun ist die Grundfärbung; der Rückenstreifen erscheint sehr dunkel, auf dem Widerriste fast schwarz; Kehle, Gurgel, Bauch und Innenseite der Läufe sind gelblichweiß, die Außenseiten der Läufe gelblichbraun. Sieben Reihen weißer, ziemlich unregelmäßig gestellter Flecken auf jeder Seite, bilden die Zeichnung. In der untersten Reihe stehen die Flecken so dicht zusammen, daß sie sich längs der Weichen und auf den Hinterschenkeln zu einem fast ununterbrochenen Bande vereinigen. Der Kopf und die Seiten des Unterhalses sind ungefleckt. Ueber den Stirntheil der Schnauze von einem Auge zum andern verläuft, hufförmig nach vorn sich biegend, eine dunkle Binde; auch die Mitte des sonst lichten Scheitels pflegt dunkler zu sein. Die braune Binde hinter der Muffel ist schmal und wird von dieser durch einen dreieckigen Flecken von gelblicher Farbe getrennt. Das Gehör ist außen graubraun, an der Wurzel unbedeutend lichter als in der Mitte. Der Wedel ist auf der Außenseite lichtbraun, auf der untern weiß, welche Färbung zum Vorscheine kommt, sobald er erhoben wird. Die Innenseite der Keule ist ziemlich reinweiß.

Axishirsch ( Cervus Axis). 1/15 natürl. Größe.
Auf allen Ebenen Ostindiens und den benachbarten Inseln lebt der Axis in großer Anzahl, bei Tage wohl versteckt in den Rohrwaldungen und im Grase der steppenartigen Gegenden, nachts in starken Rudeln umherschweifend und sich äsend. Er bildet einen Gegenstand der eifrigsten Jagd der Eingebornen, und seinetwegen hauptsächlich werden von den indischen Fürsten oft tausende aufgeboten. Außerdem erlegt man ihn bei den Tigerjagden in namhafter Menge. Diese vielfachen Nachstellungen mögen die Ursache sein, daß das Thier da, wo es sich verfolgt weiß, mindestens ebenso scheu ist als unser Hochwild. Demungeachtet wird der gefangene Axis bald und vollständig zahm. Man hat ihn schon vor Jahren nach England eingeführt und in Erfahrung gebracht, daß er sich in dem milden Klima vortrefflich hält; von England aus ist er später weiter versandt worden und unter anderem auch nach Deutschland gekommen. In einem Parke bei Ludwigsburg soll er bereits vor fünfzig Jahren eingeführt worden sein. Nach den bisherigen Erfahrungen steht seiner Weiterverbreitung ein Hindernis im Wege: die Unregelmäßigkeit der Zeit seiner Fortpflanzung. Die meisten Hirsche dieser Art haben sich, wenn man so sagen darf, allerdings an unser Klima gewöhnt; sie werfen ihr Geweih rechtzeitig ab und treten zur günstigsten Jahreszeit auf die Brunft, die hochbeschlagenen Thiere setzen auch im Frühjahre, und ihre Kälber gedeihen dann vortrefflich: aber einzelne Axishirsche bringen noch immer ihr Kalb mitten im Winter und machen ein erwünschtes Gedeihen des eingebürgerten Stammes sehr fraglich, wo nicht unmöglich; denn selbstverständlich gehen die meisten von den im Winter geborenen Kälbern, infolge der Witterungseinflüsse sowohl als auch wegen Mangel an geeigneter Nahrung für die Mutter, erbärmlich zu Grunde. Wäre dies nicht der Fall, so würden wir wahrscheinlich jetzt schon alle größeren Parks mit diesem schmucken Wilde bevölkert sehen, da es im übrigen nur wenige Hirsche gibt, welche so geeignet sind wie der Axis, ein umschlossenes Gehege zu beleben. Die Bewegungen des Thieres sind allerdings weder so zierlich noch so schnell und ausdauernd wie die anderer Hirsche von der gleichen Größe, aber immerhin anmuthig genug, um ein Jägerauge zu erfreuen. Ueber das Betragen des Axis wüßte ich nichts zu sagen, was als ihm eigenthümlich bezeichnet werden könnte; nach meinem Dafürhalten kommt er hierin am meisten mit dem Damwilde überein.

Sambur oder Saumer ( Cervus Aristotelis). 1/18 natürl. Größe.
Die meisten übrigen Hirsche Indiens werden gegenwärtig ebenfalls einer besonderen Untersippe zugezählt, welcher man den malaiischen Namen Russa gegeben hat, einfach deshalb, weil dieses Wort Hirsch bedeutet. Man kann nicht verkennen, daß alle indischen Hirsche ein gewisses, ihnen eigenthümliches Gepräge bekunden, welches sie sehr von ihren in Europa oder in Amerika lebenden Verwandten unterscheidet, sich jedoch besser herausfühlen als beschreiben läßt. Im allgemeinen mag gesagt werden, daß die betreffenden Thiere mehr oder weniger untersetzt gebaut, starkgliederig, kurzhälsig und kurzköpfig, aber verhältnismäßig langschwänzig und mit groben, brüchigen, dünnstehenden Haaren bekleidet sind, und daß die Geweihe, welche nur die männlichen Hirsche zieren, niemals mehr als sechs Enden zeigen. Die Geweihstangen biegen sich wenig nach außen und hinten und senden außer dem Augensproß nur noch ein Gabelende ab. Der Kopf ist gewöhnlich hinten viel breiter als vorn, gleichwohl am Geäse abgestutzt und immer noch breit; die Lichter sind groß, die Thränengruben oft außerordentlich entwickelt; das Gehör ist verhältnismäßig klein. Bei manchen Arten kommen Mähnen am Halse vor, welche jedoch mit den Haarwucherungen unserer Hirsche an der gedachten Leibesstelle nicht verglichen werden können. Bezeichnend ist der lange und stets reichlich mit grobem Haare bekleidete Schwanz oder Wedel.
Nach meinem Dafürhalten ist der Sambur oder Saumer ( Cervus Aristotelis, Russa und Hippelaphus Aristotelis), welcher von Aristoteles unter dem Namen Roßhirsch ( Hippelaphus) kenntlich beschrieben worden ist, als der stattlichste und edelste Hirsch dieser Gruppe zu bezeichnen. Geßner, Cajus und andere Forscher glaubten in dem »Hippelaphus« das Elen oder wenigstens ein elchartiges Thier erkennen, Erxleben und Linné ihn mit dem europäischen Hirsche vereinigen zu müssen; Buffon hielt ihn für eine Spielart des letztern, obgleich Aristoteles ausdrücklich sagt, daß das Geweih nur drei Sprossen trägt und nie mehr erhält; Cuvier endlich klärte den Irrthum auf, indem er, wahrscheinlich ganz richtig, annahm, daß der alte Grieche einen von ihm in Indien beobachteten Hirsch gemeint haben müsse. Aristoteles kann nun zwar auch den Mähnenhirsch im Auge gehabt haben; jedenfalls aber war es richtig, den von diesem verschiedenen Sambur zu Ehren des alten Forschers zu benennen. Der Sambur erreicht mindestens die Größe des Edelhirsches; Duvaucel behauptet sogar, auf Sumatra einzelne Stücke gesehen zu haben, welche dem größten Pferde gleich waren. Von dem verwandten Mähnenhirsche unterscheidet er sich außer durch seine Größe namentlich durch die dunkle Färbung. Letztere ist auf der Oberseite tief dunkel- oder schwärzlichbraun, das einzelne Haar am Grunde weißlich, hierauf schwärzlichbraun und vor der Spitze mit einem mehr oder minder breiten Farbenringe gezeichnet, welcher unter gewissem Lichte dem dunkeln Braun einen röthlichen Schimmer verleiht. Am Vorderhalse geht die herrschende Färbung in Braungrau, auf der Brust und dem Bauche in Schwärzlich, zwischen den Hinterschenkeln in Weißlich über. Das Kinn ist röthlichweiß, mit braunem Fleck, die Oberlippe schmutzigweiß, ein Büschel am innern Ohrrande weißlich. Das Thier gleicht in der Färbung ganz dem Hirsche, und auch das Kalb unterscheidet sich nur wenig von den Alten.
Indien, die Küste von Malabar und Koromandel, Sylhet, Nepal, Malakka und Sumatra, vielleicht noch Borneo, bilden die Heimat dieses in Indien häufigen, gegenwärtig auch in unseren Thiergärten keineswegs seltenen Hirsches. Ueber seine Lebenweise sind wir wenig unterrichtet, wissen zum mindesten nicht, inwiefern er sich von dem verwandten Mähnenhirsche unterscheidet. Ich halte es deshalb für angemessen, auch diesen kurz zu beschreiben und alsdann zusammenzustellen, was mir von dem Freileben der dreisprossigen indischen Hirsche überhaupt bekannt geworden ist.
Der Mähnenhirsch ( Cervus Hippelaphus, C. Russa, bengalensis, maximus, unicolor, Russa Hippelaphus etc.) steht dem Edelhirsche kaum an Größe nach und wird in seiner Heimat wohl nur von dem Samburhirsche oder von dem auf den südwestasiatischen Gebirgen lebenden Wallichshirsche übertroffen. Die Leibeslänge des erwachsenen Hirsches beträgt reichlich 2 Meter, wovon 30 Centim. auf den Schwanz zu rechnen sind, die Höhe am Widerrist 1 Meter. Das Thier ist beträchtlich kleiner. Im allgemeinen besitzt der Mähnenhirsch die angegebenen Kennzeichen der Gruppe. Sein Leib ist gedrungen, kräftig und niedrig gestellt, weshalb die Läufe stämmiger erscheinen als bei dem Edelhirsche, der Hals stark und der Kopf verhältnismäßig sehr kurz, aber breit, das Gehör klein, außen dicht, innen nur spärlich mit Haaren bekleidet, das Auge groß, die Thränengrube unter ihm auffallend entwickelt. Das Geweih zeichnet sich durch seine sehr starken und deshalb kurz erscheinenden Stangen aus, sitzt dicht auf dem niedern Rosenstocke, biegt sich von der Wurzel an in einem sanften Bogen nach rückwärts und auswärts, steigt von der Mitte an gerade in die Höhe und wendet sich dann wieder etwas nach einwärts. Der Augensproß, welcher unmittelbar über dem Rosenstocke entspringt, ist stark und lang, vor-, auf- und mit der Spitze nach einwärts gekrümmt, der Gabelsproß zweigt sich ungefähr 30 Centim. über der Wurzel des Geweihes ab und richtet sich etwas nach vor-, auf- und auswärts. Stangen und Enden sind auf der Oberfläche gefurcht und geperlt. Die Behaarung ist verschieden, je nach der Jahreszeit. Bei ausgebildetem Geweih trägt der Hirsch ein Kleid aus groben, brüchigen und ziemlich dünn stehenden Haaren von einer schwer zu beschreibenden graulichbraunfahlen Färbung. Ueber den Rücken verläuft ein bald deutlich, bald undeutlich begrenzter dunklerer, d.+h. bräunlicherer Streifen. Die Läufe sind an ihrer Vorderseite ungefähr von der Farbe des Rückens, seitlich und innen jedoch nicht unbedeutend lichter. Bezeichnend scheint mir nach meinen Beobachtungen ein schmales lichtgraues oder weißes Band zu sein, welches sich hart an der Muffel zu beiden Seiten des Obergeäses herabzieht. Beide Geschlechter sind vollkommen gleich gefärbt und auch das Junge, welches geboren wird, während seine Eltern das beschriebene Kleid tragen, unterscheidet sich nicht durch die Färbung. Dies glaube ich umsomehr hervorheben zu müssen, als alle übrigen mir bekannten, nicht zu der in Rede stehenden Gruppe gehörigen echten Hirsche im Jugendkleide gefleckt sind, wogegen die gedachten Indier in einem Kleide zur Welt kommen, welches dem ihrer Eltern genau entspricht. Sehr bezeichnend für den Hirsch ist die ziemlich starke Mähne, welche am Unterhalse und Kinne sich entwickelt und deren Haare sich durch ihre Beschaffenheit kaum von den übrigen unterscheiden. Bald nach Abwerfen des Geweihes färbt sich der Hirsch und zu gleicher Zeit das Thier. Beide erscheinen dann dunkelgrau mit einem mehr oder weniger hervortretenden Anfluge ins Fahlbräunliche.
Soviel bis jetzt bekannt, findet sich der Mähnenhirsch vorzugsweise auf Java, Sumatra, Borneo und dem indischen Festlande. Diese Angabe soll jedoch keineswegs etwaige Irrthümer der Reisenden ausschließen, da es durchaus nicht unmöglich ist, daß der auf dem Festlande lebende Mähnenhirsch sich von dem die Inseln bewohnenden unterscheidet. Einige Forscher haben den Mähnenhirsch der Inseln, welcher kleiner als der vom Festlande sein soll, unter dem Namen Russa moluccensis getrennt; ihre Angaben sind aber so ungenügend, daß ich mit Bestimmtheit nicht zu sagen vermag, ob ich soeben die eine oder die andere Art beschrieb. Es wird gesagt, daß Borneo durch Vermittelung des Menschen mit dem Mähnenhirsche bevölkert worden sein soll: ein Sultan Soërianse habe ein Paar in den Graswildnissen bei Bulu Lampej freigelassen, und diese seien als Stammeltern aller jetzt vorkommenden anzusehen. Die Reisenden erwähnen, daß sich dieses Wild in sehr starke Trupps zusammenschlägt, welche mehr als Waldungen die offenen steppenartigen Ebenen bevorzugen. Auf Java bewohnt der Mähnenhirsch, hier Mendjangan oder Minjángan genannt, vornehmlich die Allangalang-Bestände, welche meilenweite ebene Flächen oder sanft geneigte Berggehänge überziehen, steigt jedoch immerhin bis zu 2000 Meter unbedingter Höhe im Gebirge empor und wählt dann die Vorwälder zu seinem Aufenthalte. Das Allangallanggras ( Saccharum Koenigii) bildet, laut Junghuhn, auf allen Eilanden des indischen Inselmeeres trockene, einförmige Wildnisse, welche sich, ohne jede Abwechselung, trostlos nach allen Seiten ausbreiten. Von fern gesehen erscheinen sie als ein silberweißes, im Winde wogendes Grasmeer, in der Nähe betrachtet, als ein Dickicht, welches dem Wanderer bis an die Schultern oder bis an das Kinn reicht. Die scharfen Ränder und Spitzen der Grasblätter wehren dem Eindringlinge den Durchgang und überwölben selbst die schmalen Pfade, welche Thiere und Menschen getreten haben; das helle Licht blendet das Auge, die drückende Hitze macht die Luft über den Spitzen erzittern und flimmern und belästigt das Gefühl. Nur spärlich eingestreute Inseln anderer Pflanzen und kleine, hainartige Wäldchen gewähren Abwechselung. Dies ist das Reich der Streifenschweine ( Sus vittatus) und unserer Hirsche sowie des Tigers, welcher beiden Thierarten als schlimmster Feind entgegentritt, nicht immer zum Schaden, meist sogar zum Nutzen des Menschen, in dessen Besitzthum sie von hier aus verwüstend einfallen; dies auch ist das ergiebigste Jagdgebiet der Großen des Landes. Die Schweine trifft man hier in unschätzbarer Menge, die Mähnenhirsche meist zwar nur in kleinen Rudeln, aber ebenfalls ungemein zahlreich an.
Ueber Lebensweise und Betragen der letztgenannten sind die Nachrichten überaus dürftig. Die alten Hirsche trennen sich nach der Brunst von den Trupps der Thiere und schweifen bis zur nächsten Brunstzeit einsiedlerisch umher, halten jedoch gewisse Beziehungen zu den Trupps fest, wandern mit diesen bei Beginn der trockenen Jahreszeit den stehenden Gewässern zu und ziehen, wenn die Regenzeit oder der Frühling eintritt, mit ihnen wieder in höher gelegene Gegenden. Während der größten Hitze des Tages liegen Hirsche und Thiere zwischen dem Grase und Schilfe oder im Dickichte der Gebüsche verborgen, vor Sonnenuntergang ziehen sie zur Suhle, und mit Einbruch des Abends auf Aesung aus. Das Wasser lieben sie ganz ungemein: dies kann man auch an den Gefangenen beobachten, welche nach einem Schlammbade wahrhaft begierig sind. Ueber die Aesung mangeln mir bestimmte Angaben, wir dürfen aber von den Gefangenen schließen, daß die Nahrung im wesentlichen der Aesung unseres Edelwildes entspricht.
Die Bewegungen des Mähnenhirsches verdienen eine kurze Besprechung. Ueber den flüchtigen Hirsch vermag ich leider nicht zu urtheilen und muß also den Reisenden glauben, welche sagen, daß der Lauf sehr schnell und ausdauernd sei, und daß der gestreckte Galopp, welchen der flüchtige Hirsch annimmt, häufig durch kurze Sätze unterbrochen werde; dagegen kann ich über den ruhigen Schritt des Mähnenhirsches aus eigener Erfahrung sprechen. Die Gefangenen unserer Thiergärten zeichnen sich durch ihre Bewegungen vor sämmtlichen übrigen Hirschen aus. Kein mir bekannter Hirsch schreitet so würdevoll, so stolz dahin wie der Mähnenhirsch. Sein Gang gleicht durchaus dem angelernten Schritte, dem sogenannten spanischen Tritte, eines wohlunterrichteten Schulpferdes. Jede Bewegung von ihm ist dieselbe, welche ein Pferd unter gedachten Umständen ausführt. Man meint, der Hirsch wäre durchdrungen von dem Gefühle des Stolzes, welches er an den Tag zu legen scheint. Er hebt den Lauf bedächtig auf, streckt ihn ganz in der Weise des Schulpferdes vor und setzt ihn zierlich wieder auf den Boden, begleitet auch jeden Schritt mit einer entsprechenden Kopfbewegung. Demungeachtet bleibt man im Zweifel, ob dieses Gebaren Stolz oder Zorn ausdrücken soll; denn der würdevolle Gang wird regelmäßig mit einem verdächtigen Aufwerfen der Oberlippe begleitet, welches bei allen Hirschen ein Zeichen ihrer Wuth oder mindestens großer Erregtheit ist. Bemerken will ich noch, daß man namentlich bei dieser Art des Gehens auch von den Mähnenhirschen ein starkes Knistern vernimmt, ganz wie von dem Renthiere. Der Hirsch bewegt sich viel in der beschriebenen Weise und trabt nur selten schneller in seinem Gehege umher, das Thier hingegen führt scherzend oft Sprünge aus und zeigt sich dabei äußerst behend und gewandt. Ihm eigenthümlich ist, daß es bei dem Ansatze zu schnellerem Laufe den Kopf tief nach unten biegt und den Hals lang vorstreckt, auch wohl sonderbar schlängelnde Bewegungen mit dem Kopfe ausführt, bevor es flüchtig wird.
Im übrigen stimmen meine Beobachtungen an den gefangenen Thieren mit den Angaben der Reisenden überein. Die Sinne des Mähnenhirsches sind sehr ausgebildet, namentlich Gehör und Witterung vorzüglich scharf und das Geäuge ebenfalls wohl entwickelt. Zudem ist dieses Wild wachsam und vorsichtig. Es lernt seinen Pfleger bald kennen, ohne sich jedoch eigentlich mit ihm zu befreunden. Möglich ist, daß Mähnenhirsche, welche sehr früh in die Gefangenschaft geriethen, ebenso zahm werden als andere Hirsche; von denen, welche ich pflegte, kann ich dies jedoch nicht sagen, obgleich ich mir viele Mühe mit ihrer Zähmung gegeben habe.
Wenn wir von den gefangenen auf die freilebenden Mähnenhirsche schließen dürfen, haben wir unsere Wintermonate als die Brunstzeit zu bezeichnen. Die Mähnenhirsche in den Thiergärten werfen im Mai ihr Geweih ab und fegen im September. Am 20. November ließ einer meiner Gefangenen zum erstenmal seine Stimme vernehmen: ein sehr kurzes, dumpfes und leises Blöken. Von dieser Zeit an zeigte er sich sehr erregt, kampf- und zerstörungslustig wie die übrigen brünstigen Hirsche, namentlich aber erzürnt gegen den Wärter, mit dem er sonst auf bestem Fuße stand. Während der ganzen Zeit verbreitete er einen unausstehlichen bockartigen Geruch, welcher zuweilen so heftig wurde, daß er den Stall förmlich verpestete. Ausgang December bekundete auch das Thier durch ein leises Mahnen Sehnsucht nach dem Hirsche, und am 7. Januar erfolgte der Beschlag. Dasselbe Thier hatte am 18. Oktober ein Kalb geboren, und somit darf die Zeit, welche es hoch beschlagen geht, zu 8½ Monaten angenommen werden. Das Kalb war vom ersten Tage an sehr munter und gedieh zu meiner besondern Freude zusehends. Seine Mutter bewachte und beschützte es mit ebensoviel Sorgfalt als Muth, bedrohte selbst den ihr wohlbekannten Wärter, dem sie sonst scheu aus dem Wege ging. Mit gesenktem Kopfe, erhobenem Wedel und weit auseinander klaffenden Thränengruben, ging sie jedem Eindringlinge kühn zu Leibe und versuchte, ihn durch kräftige Schläge mit den Vorderläufen abzutreiben, wobei sie sich bemühte, das Kalb durch ihren eigenen Leib zu decken. Dieses hatte nach etwa vier Monaten ungefähr die Hälfte der Größe seiner Mutter erreicht, besäugte sie aber bis in den sechsten Monat seines Lebens. An das Futter, welches dem Thiere gereicht wurde, ging es bereits in der dritten Woche.
Auf den großartigen Treibjagden der indischen Fürsten erlegt man oft viele Hunderte von Mähnenhirschen, obgleich man nicht das Feuergewehr, sondern bloß Schwert und Speer anwendet, um sie zu fällen, oder die Schlinge gebraucht, um sie lebendig zu erbeuten. »Die Hirschjagden«, so schreibt mir Haßkarl, »werden auf Java zu Pferde betrieben. Reitertruppen stehen auf verschiedenen Stellen des Allangallangfeldes bereit, die im Waldesdunkel aufgejagten und durch eine geschlossene Reihe von oft mehr als hundert Büffeln nebst dazu gehöriger inländischer Mannschaft ins Freie getriebenen Hirsche und sonstiges Gewild zu empfangen, d. h. ihnen den Weg zu verlegen, sie, nachjagend, einzuholen und ihnen dann mittels des Seitengewehres das Rückgrat zu durchschlagen. In neuerer Zeit hat man anstatt dieser Metzelei das Fangen mit Hülfe einer an der Spitze der Lanze befindlichen Schlinge eingeführt. Rührend ist es anzusehen, wenn ein Altthier mit seinem Kalbe verfolgt wird. Fort und fort sucht es dieses zu decken und zu schützen und führt deshalb die wunderlichsten Kreuz- und Quersprünge aus, bis es endlich von ihm durch die Reiter abgeschnitten worden ist und nunmehr, allerdings oft zu spät, sein Heil in der Flucht suchen muß. Das Junge wird dann leichter gefangen«. Laut Junghuhn jagt man unsern Hirsch ausschließlich seines Wildprets halber, welches in dünnen Scheiben geschnitten, mit Salz eingerieben, an der Sonne getrocknet, dann Djendeng genannt und als die am meisten beliebte Zuspeise zu den auf der Tafel alter javanischen Häuptlinge niemals fehlenden Reisgerichten angesehen wird, aber auch auf der Tafel der Europäer als eine vorzügliche Speise gilt. Decke und Haut werden nicht benutzt.
Der Schweinshirsch ( Cervus porcinus, Hyelaphus porcinus), Vertreter der Untersippe Hyelaphus, eine der gemeinsten indischen Arten, reiht sich der vorigen Gruppe an. Er gehört zu den plumpesten Gestalten der ganzen Familie, ist fast schwerfällig gebaut, dickleibig, kurzläufig, kurzhalsig und kurzköpfig und zeichnet sich außerdem auch noch durch sein Geweih aus. Die kurzen, dünnen und dreiendigen Stangen stehen auf ziemlich hohen Rosenstöcken, welche weit von einander entfernt sind. Hierdurch erscheint das Geweih größer als es in Wahrheit ist. Die Verzweigung desselben ist so einfach wie bei den vorhergehenden, nur daß alle Theile weit zierlicher und kleiner sind. Der Augensproß wendet sich anfangs nach vorn und außen, mit der Spitze aber wieder nach innen; das obere kurze Ende bildet einen nach innen und hinten gekrümmten Haken. Das Haar ist noch immer grob, rauh und brüchig, jedoch weit feiner, auch weniger gewellt als bei dem Mähnenhirsch und seinen nächsten Verwandten. Die Färbung scheint mannigfach abzuändern, und darauf gründet sich der Mangel an Uebereinstimmung, welcher sich in den verschiedenen Beschreibungen des Schweinshirsches kundgibt. Gewöhnlich ist die allgemeine Färbung ein schönes Kaffeebraun, welches beim Hirsche bis zum Schwarzbraun dunkeln, beim Thiere bis zum Lederbraun sich lichten kann, die des einzelnen Haares an der Wurzel aschgrau, in der Mitte schwarzbraun, vor der dunkeln Spitze hellzimmetbraun geringelt. Die lichten Ringe kommen jedoch in der allgemeinen Färbung verhältnismäßig wenig zur Geltung, wie es scheint bei dem Thiere mehr als bei dem Hirsche. Dunkler gefärbt, fast schwarz, sind ein Rückenstreifen, eine Binde hinter der Muffel, welche sich ringsum zieht, eine zweite, nach der Muffel zu hufeisenförmig eingebogene Binde zwischen den Augen und ein Längsstreifen auf der Stirnmitte, graulicher, dunkelaschfarben etwa, die Unterseite des Leibes und die Läufe, lichter, nämlich hellfahlgrau, der Kopf und die Halsseiten, die Kehle, das Gehör und unregelmäßig gestellte Flecken auf beiden Seiten des Leibes, weiß endlich die Spitzen des Unterkiefers, der Wedel auf seiner Unterseite und an der Spitze sowie der schmale, vom Wedel bedeckte Spiegel. Lichtere Flecken habe ich bei allen Schweinshirschen bemerkt, welche ich lebend sah; aber sie treten bei den heller gefärbten Thieren immer mehr hervor als bei den dunkelfarbigen, bei denen sie zuweilen fast zu verschwinden scheinen und nur dann sich zeigen, wenn das Haar gesträubt wird. Das Jugendkleid unterscheidet sich bloß dadurch von dem des alten Thieres, daß die Flecken anscheinend größer und heller sind.
Wie weit das Vaterland des Schweinshirsches sich erstreckt, ist zur Zeit noch nicht ermittelt; soviel aber wissen wir, daß er weit verbreitet und, wo er vorkommt, häufig ist. Sehr gemein scheint er in Bengalen zu sein: von hier aus erhalten wir die meisten, welche unsere Thiergärten bevölkern. Man sagt, daß er in Indien als halbes Hausthier gehalten werde. Unser Klima erträgt er ohne Beschwerde, verlangt nur bei strenger Witterung einen geschützten Ort zum Rückzuge, pflanzt sich auch in engem Raume leicht fort und vermehrt sich sehr stark.
In seinem Betragen hat er manches eigenthümliche. Er gehört nicht zu den begabten unter seinen Verwandten, sondern muß eher als geistesarmes Geschöpf betrachtet werden. Das Thier ist furchtsam, scheu und unklug, der Hirsch muthig, auch dem Menschen gegenüber rauflustig, herrschsüchtig und zu Gewaltthätigkeiten geneigt. So vortrefflich er sich zeitweilig mit seinen Thieren verträgt, so sehr quält er sie zu anderen Zeiten. Ohne alle Veranlassung stürmt er auf sie los und mißhandelt sie, oft in gefährlicher Weise. Nach der Brunstzeit muß man ihn stets von jenen entfernen. Vor der Brunst übt er seine Kraft an allen denkbaren Dingen, rennt gegen die Bäume und Gitter, wühlt mit seinem kurzen Geweih den Rasen auf und wirft die losgerissenen Stücke hin und her, bedroht jeden, welcher sich nähert, indem er den Kopf zur Seite biegt und mit boshafter Miene in schiefer Richtung heranschreitet, geht auch ohne Bedenken auf den Mann und macht dann von seinen Waffen in empfindlicher Weise Gebrauch. Der Geweihwechsel beginnt mit den ersten Monaten des Jahres; gewöhnlich wirft er im Februar, oft schon im Januar ab und fegt im Mai oder bereits April. Ein von mir gepflegter Schweinshirsch trat im Juli auf die Brunst, der Beschlag erfolgte am 16. August, der Satz des Kalbes am 1. April; somit ergibt sich eine Trächtigkeitszeit von 228 Tagen. Die Kälber sind sehr niedliche, auf lichtbraunem Grunde gelblich gefleckte Thiere, welche vom ersten Tage ihres Lebens an die untersetzte Gestalt ihrer Eltern zeigen.
Soweit bekannt, hat der Schweinshirsch in seiner Heimat dieselben Feinde wie seine Verwandten. In Bengalen wird er oft zu Pferde gejagt und vom Sattel aus mit einem Schwertstreiche erlegt. Einzelne Jäger sind Meister in der Kunst, dem flüchtigen Wilde auf allen Wegen zu folgen und in kurzer Frist mit ihrer so ungeeignet scheinenden Waffe ihm beizukommen. Das Wildpret gilt als wohlschmeckend.
In Nordamerika wohnen die Mazamahirsche ( Reduncina oder Mazama), zierliche, anmuthige Thiere, welche sich ebenso durch ihren Bau wie durch die Geweihe der Hirsche auszeichnen. Ihre Gestalt ist sehr schlank, Hals und Kopf sind lang, die Läufe mittelhoch, aber schwach, der Wedel ist ziemlich lang. Die Geweihe krümmen sich bogenförmig von rückwärts nach außen und vorwärts und sind in drei bis sieben Sprossen verästelt, welche sämmtlich nach einwärts gehen; der Augensproß ist vorhanden, Eis- und Mittelsproß fehlen. Die Lichter sind groß und ausdrucksvoll, das Gehör ist ziemlich groß, lanzettförmig gestaltet, auf der Außenseite mit sehr kurzen Haaren bekleidet, so daß es fast nackt erscheint, innen dagegen, namentlich an den Seiten, reichlicher bedeckt. Dichte, weiche Haare von lebhafter Färbung bilden die Decke; sie verlängern sich mähnenartig bei dem Hirsche und außerdem zu einer Quaste am Wedel beider Geschlechter.
Die bekannteste Art der Gruppe, der Virginiahirsch ( Cervus virginianus, C. strongyloceros, Mazama virginiana), hat in mancher Hinsicht Ähnlichkeit mit unserem Damhirsche, welchem er auch in der Größe ungefähr gleichkommt, unterscheidet sich aber sofort durch den zierlichen Bau und namentlich durch den langgestreckten, feinen Kopf, welcher vielleicht der schönste aller Hirsche genannt werden darf. Nach Versicherung des Prinzen von Wied wird der virginische Hirsch übrigens oft bedeutend größer als unser Damhirsch und gibt dem Edelhirsche nicht viel nach. Die Färbung ändert sich den Jahreszeiten entsprechend. Im Sommerkleide ist ein schönes, gleichmäßiges Gelbroth, welches auf dem Rücken dunkelt und nach den Seiten in Gelbroth übergeht, die vorherrschende Färbung; Bauch und Innenseite der Glieder sind blässer; der Wedel ist oben dunkelbraun, unten und auf den Seiten blendend weiß. Bezeichnend erscheint die Färbung des Kopfes, welcher immer dunkler als der übrige Körper, und zwar bräunlichgrau, gefärbt ist. Der Nasenrücken pflegt gewöhnlich sehr dunkel zu sein, zu beiden Seiten der Unterlippe aber und an der Spitze des Oberkiefers ziehen sich weiße Flecken herab, welche sich fast zu einem Ringe vereinigen. Im Winter ist die Oberseite graubraun, etwa der Winterfärbung unseres Rehes entsprechend, die Unterseite röthlich, die der Läufe gelbröthlichbraun, das Gehör an der Außenseite dunkelgraubraun, an Rand und Spitze schwärzlich, inwendig weiß. Ein Fleck außen am untern Ohrwinkel, die Unterseite des Kopfes, die Hinterseite des Vorderschenkels, der Bauch, die innere und die Vorderseite des Hinterschenkels, die untere Fläche des dünnen, sehr lang und dicht behaarten Schwanzes sind ebenfalls reinweiß; die Zeichnung am Geäse bleibt in beiden Kleidern dieselbe. Nach den vom Prinzen von Wied gegebenen Maßen beträgt die Lange eines Hirsches von mittlerer Stärke 1,8 Meter, die Länge des Wedels 30 Centim., die Länge des Kopfes ungefähr ebensoviel, die Höhe des Ohres 15 Centim., die Höhe des Geweihes 30 Centim. und die Länge jeder Stange, der Krümmung nach gemessen, etwa 50 Centim. Am Widerrist ist ein solcher Hirsch 1 Meter hoch. Das beträchtlich kleinere Thier wird nur 1,3 Meter lang und nicht über 80 Centimeter hoch. Das Kalb ist auf dunkelbraunem Grunde sehr zierlich weiß oder gelblichweiß gefleckt, im übrigen seinen Eltern ähnlich.
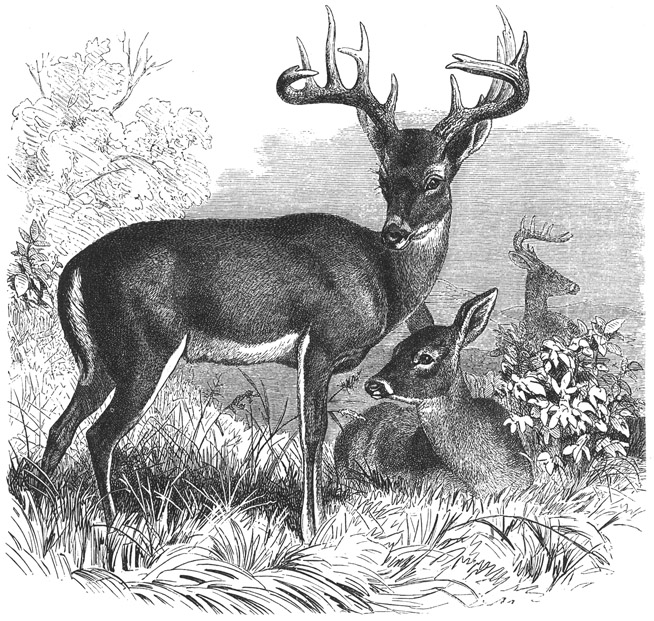
Virginiahirsch ( Cervus virginianus). 1/15 natürl. Größe.
Nach den Angaben der amerikanischen Forscher verbreitet sich dieser schöne Hirsch, mit Ausnahme der nördlichst gelegenen, über alle Waldungen von Nordamerika. In den Pelzgegenden soll er sich nicht finden; wohl aber kommt er in Kanada vor. Von der Ostküste Nordamerikas reicht er bis zu den Felsgebirgen und südlich bis nach Mejiko. Früher soll er aller Orten in zahlreicher Menge gefunden worden sein; gegenwärtig ist er aus den stark bevölkerten Theilen schon fast ganz verdrängt oder hat sich wenigstens in die größeren Gebirgswaldungen zurückziehen müssen.
Dank Audubon und anderen Forschern kennen wir gegenwärtig Lebensweise und Betragen des virginischen Hirsches ziemlich genau. Im allgemeinen ähnelt sein Leben dem unseres Edelwildes. Der virginische Hirsch bildet, wie dieses, Trupps und Rudel, zu denen sich die starken Hirsche während der Brunstzeit einfinden, tritt ungefähr zu derselben Zeit wie unser Hirsch auf die Brunst und setzt auch das Kalb oder die beiden Kälber ungefähr in den gleichen Monaten, in denen unser Edelwild geboren wird. Der Hirsch wirft im März ab und fegt Ende Juli oder im August, verfärbt sich dann im Oktober und tritt um diese Zeit auf die Brunst.
Diesen übersichtlichen Worten, welche dem Prinzen von Wied entlehnt sind, will ich einiges aus der Schilderung Audubons hinzufügen. »Das Wild«, sagt er, »hängt fest an dem einmal gewählten Platze, und kehrt nach Verfolgung immer wieder zu ihm zurück. Allerdings thut es sich während der verschiedenen Tage gewöhnlich nicht auf demselben Bette nieder, wird aber doch in derselben Gegend gefunden, oft keine fünfzig Schritte von der Stelle, von welcher es früher aufgestört worden war. Seine Lieblingsplätze sind alte Felder, welche theilweise von Buschwald wieder in Besitz genommen worden sind und deswegen ihm Schutz gewähren. In den südlichen Staaten sucht es sich, und zwar namentlich im Sommer, wenn es weniger verfolgt wird, oft die äußeren Hage der Pflanzungen auf und steht hier während des Tages in einem düstern Dickichte zwischen Rohr, wildem Wein und Dornengestrüpp, jedenfalls in möglichster Nähe seines Weidegrundes. Doch ist diese Vorliebe für derartige Oertlichkeiten nicht allgemein: oft findet man auch zahlreiche Spuren des Wildes in Feldern, welche nur von fern her besucht werden. In den Gebirgsgegenden bemerkt man zuweilen ein Stück auf einem hervorragenden Felspunkte niedergethan, dem Steinbock oder der Alpengemse vergleichbar; gewöhnlich aber verbirgt sich das Wild zwischen Myrten- und Lorbeergebüsch, neben umgefallenen Bäumen und an ähnlichen Orten. In der kalten Jahreszeit bevorzugt es die geschützten und trockenen Plätze, steht dann gern unter dem Winde und läßt sich von den Sonnenstrahlen wärmen; im Sommer zieht es sich während des Tages in die schattigen Theile des Waldes zurück und hält sich in der Nähe kleiner Flüsse oder kühler Ströme auf. Um der Verfolgung der Mücken und Stechfliegen zu entgehen, flüchtet es sich oft in einen Fluß oder Teich und liegt hier bis zur Nase im Wasser.
»Die Aesung des Wildes ist nach der Jahreszeit verschieden. Im Winter geht es die Zweige und Blätter des Gebüsches an, im Frühling und Sommer wählt es sich, und zwar mit größter Leckerhaftigkeit, das zarteste Gras aus, und kommt oft, dem jungen Mais und anderem Getreide nachgehend, in die Felder herein. Beeren verschiedener Art, Nüsse und ähnliche Früchte, namentlich auch Bücheln, liebt es ungemein. Bei so reichlicher Auswahl an Aesung sollte man meinen, daß es beständig gut von Wildpret sei; dies ist jedoch nicht der Fall, denn mit Ausnahme gewisser Jahreszeiten ist dieser Hirsch sehr schlecht vom Leibe. Die Hirsche sind vom August bis zum November feist. Wir selbst haben solche erlegt, welche 175 Pfund wogen, und sind berichtet worden, daß einzelne ein Gewicht von mehr als 200 Pfund erreichen. Die Brunst beginnt, in Karolina wenigstens, im November, manchmal auch etwas eher. Der Hirsch ist jetzt fortwährend auf den Beinen, fast beständig im Rennen, um seine Gegner aufzusuchen. Wenn er mit anderen Hirschen zusammentrifft, beginnt ein heftiger Zweikampf, in welchem nicht selten einer getödtet wird, obgleich der schwächere gewöhnlich die Flucht ergreift und dem stärkern höchstens in einiger Entfernung folgt, achtungsvoll immer bereit, dem siegreichen Nebenbuhler das Feld zu räumen. Nicht selten verfangen sich zwei gleich starke Hirsche so vollständig mit den Geweihen, daß sie nicht wieder von einander loskommen können und in kläglicher Weise zu Grunde gehen. Wir haben uns bemüht, derartig verschlungene Geweihe zu trennen, aber gefunden, daß weder unsere Geschicklichkeit noch unsere Kraft dies auszuführen vermochte. Verschiedene Male haben wir zwei und einmal drei Paare von Geweihen so verfangen gesehen. Die Brunstzeit währt ungefähr zwei Monate und beginnt bei den älteren Hirschen eher als bei den jüngeren. Gegen den Monat Januar werfen die Hirsche ab, und von dieser Zeit an leben sie friedlich mit einander vereinigt.
»Die Thiere sind am feistesten vom November bis zum Januar, fallen hierauf ab, umsomehr, je näher die Satzzeit heranrückt, und nehmen wieder zu, während ihre Kälber sie besaugen. Diese werden in Karolina im April geboren; Schmalthiere hingegen setzen gewöhnlich erst im Mai oder Juni. In den nördlichen Staaten tritt die Satzzeit etwas später ein als in Florida und Tejas. Auffallend, aber vollkommen begründet ist, daß in Alabama und Florida die Mehrzahl der Kälber im November geboren werden. Das Thier verbirgt sein frisch gesetztes Kalb unter einem dichten Busche oder im dicken Grase und besucht es mehrmals des Tages, namentlich morgens, abends und während der Nacht. Erst später nimmt es das Junge mit sich fort. Wenn die Kälber bloß einige Tage alt sind, liegen sie manchmal so tief im Schlafe, daß sie gefangen werden können, ehe sie die Ankunft eines Menschen wahrnehmen. Sie lassen sich sehr schnell zähmen und schließen sich ihren Fängern schon nach wenigen Stunden innig an. Ein Freund von uns besaß ein Thierkalb, welches nach seiner Gefangennahme zu einer Ziege gebracht und von dieser angenommen wurde, und wir haben andere gesehen, welche von Kühen groß gesäugt worden waren. Sie halten sich gut in der Gefangenschaft; aber wir haben gefunden, daß sie lästige Schoßthierchen sind. Ein Paar, welches wir verschiedene Jahre hielten, hatte sich gewöhnt, unser Studirzimmer durch das offene Fenster zu besuchen, und führte dies auch aus, wenn die Fenster geschlossen waren, unbekümmert um das Glas in denselben. Die Thiere schienen überhaupt einen zerstörungslustigen Sinn zu besitzen, leckten und nagten an unseren Buchdeckeln und verursachten uns oft große Verwirrung unter unseren Papieren. Kein Busch in dem Garten, so werthvoll er uns auch sein mochte, war ihnen heilig; sie benagten selbst unser Kutschengeschirr und machten sich schließlich über unsere jungen Enten und Hühner her, bissen ihnen den Kopf und die Füße ab und ließen dann den verstümmelten Leib liegen.
»Das Thier setzt erst, wenn es wenigstens zwei Jahre alt ist, und dann regelmäßig ein Kalb, während es später deren zwei zur Welt bringt. Ein starkes und gesundes Thier gebiert oft drei Kälber, und in dem Leibe eines von uns erlegten Thieres fanden wir sogar vier wohlausgebildete Junge. Die regelmäßige Zahl der Kälber ist zwei. Das Thier liebt sein Kalb ungemein und kommt auf dessen Ruf augenblicklich herbei. Die Indianer brauchen die List, auf einem Rohrstücke das Mahnen des Kalbes nachzuahmen, um die Mutter herbeizulocken, welche dann regelmäßig ihrem Pfeile zum Opfer fällt. Wir selbst haben zweimal Thiere durch Nachahmen der Stimme des Kalbes herbeigerufen. Dem Menschen gegenüber wagt die Mutter ihr Kind nicht zu verteidigen, sondern denkt nur an die Flucht.
»Unser Wild ist sehr gesellig und wird in den westlichen Prairien oft in ungemein zahlreichen Rudeln von vielen hundert Stücken zusammen gesehen. Nach der Brunst schlagen sich, wie wir schon erwähnt haben, auch die Hirsche in Rudel zusammen oder vereinigen sich mit den Thieren, welche den größten Theil des Jahres hindurch zusammenleben.
»Das Wild ist eins der schweigsamsten aller Geschöpfe. Es läßt selten einen Laut vernehmen. Das Kalb stößt ein leises Blöken aus, welches von dem feinen Gehör seiner Mutter vielleicht auf eine Entfernung von hundert Schritten wahrgenommen wird; diese ruft ihr Kalb durch ein leises Murmeln herbei. Ein lautes Schreien haben wir nur gehört, wenn das Wild verwundet wurde. Der Bock stößt, wenn er aufgestöbert wird, ein kurzes Schnauben aus; wir haben aber auch nachts ein schrillendes Pfeifen, ähnlich dem der Gemse, von ihm vernommen, und zwar bis auf eine Entfernung von ungefähr einer halben Meile. Die Witterung ist so ausgezeichnet, daß ein Stück dem andern durch Spüren zu folgen im Stande ist. An einem Herbstmorgen sahen wir ein Thier an uns vorüberlaufen; zehn Minuten später beobachteten wir einen Hirsch, welcher es mit der Nase auf dem Boden verfolgte, und zwar auf allen Widergängen seines Laufes; eine halbe Stunde später erschien ein zweiter Hirsch und geraume Zeit nachher ein Spießer als dritter, und alle folgten derselben Fährte. Das Gesicht scheint wenig entwickelt zu sein; wenigstens haben wir beobachtet, daß das Wild, wenn wir still standen, oft wenige Schritte vor uns vorbeiging, ohne uns zu bemerken, während es augenblicklich flüchtig wurde, wenn wir uns bewegten oder wenn wir ihm in den Wind kamen. Das Gehör ist ebenso fein als der Geruch.
»Unser Wild kann ohne Wasser nicht bestehen und ist gezwungen, die Flüsse oder Quellen allnächtlich aufzusuchen. Im Jahr 1850 herrschte eine allgemeine Dürre in unseren südlichen Ländern, und die Folge davon war, daß das Wild massenweise seine Stände verließ und sich wasserreicheren Gegenden zuzog. Sehr begierig sind die Hirsche auf Salz: Jäger, welche dies wissen und Salzlecken kennen, machen in der Nähe derselben regelmäßig gute Jagd.
»Wenn man das Wild ein nächtliches Thier nennt, muß man hinzufügen, daß es in Prairien oder in Oertlichkeiten, wo es selten gestört wird, auch in den Morgen- und Nachmittagsstunden seiner Aesung nachgeht. Unter solchen Umständen ruht es gewöhnlich nur in den Mittagsstunden. In den Atlantischen Staaten freilich, wo es von den Jägern fortwährend belästigt wird, erhebt es sich selten vor Sonnenuntergang von seinem Bette. Uebrigens sieht man es während des Frühlings und Sommers öfter, als im Winter bei Tage sich äsen.
»In Gegenden, wo das Wild fortwährend beunruhigt wird, läßt es den Jäger weit näher an sein Bett herankommen als in Gauen, wo es selten gestört wird. Es bleibt ruhig liegen, aber keineswegs weil es schläft oder nicht wachsam ist, sondern weil es fürchtet, sich laufend dem Blicke auszusetzen, und hofft, im Liegen übersehen zu werden. Wir haben es liegen sehen, die Hinterläufe sprungfertig, das Gehör platt auf die Seiten des Nackens gepreßt, die Lichter scharf jede Bewegung des Störenfrieds bewachend. Unter solchen Umständen darf der Jäger nur dann auf Erfolg hoffen, wenn er langsam rund um das Thier reitet und thut, als ob er es nicht bemerkt habe, dann aber plötzlich feuert, bevor es sich von seinem Bette erhebt. Ehe es Nachstellungen erfahren hat, versucht es, sich bei der Ankunft des Jägers in gedrückter Stellung davon zu schleichen.
»Der Gang des Wildes ist verschieden. Im Laufe trägt es sein Haupt niedrig und verfolgt seinen Weg vorsichtig und still, gelegentlich das Gehör und den Wedel bewegend. Das größte Thier ist regelmäßig der Führer des Trupps, welcher in der sogenannten indischen Reihe fortzieht; selten gehen ihrer zwei neben einander. Ein ruhiger Schritt ist die Bewegung des nicht in Furcht gesetzten Wildes. Wenn es aufgestört wird, ohne jedoch erschreckt zu sein, springt es zwei oder dreimal in die Höhe und fällt mit scheinbarem Ungeschick auf drei Läufe nieder, kehrt sich einen Augenblick später der entgegengesetzten Seite zu, erhebt seinen weißen Wedel und dreht ihn von einer Seite zur andern. Darauf folgen dann einige hohe Sprünge, worauf das Haupt nach jeder Richtung hin gedreht wird, um womöglich die Ursache der Störung zu erspähen. Die Sprünge und Sätze sind so anmuthig, daß man sie nur mit Erstaunen und Bewunderung betrachten kann. Sieht dagegen das Wild den Gegenstand seines Schreckens, bevor es sich von seinem Bette erhebt, dann schießt es rasch niedrig auf dem Boden dahin, Haupt und Wedel in einer Linie mit dem Körper gehalten, und so läuft es mehrere hundert Schritte fort, als wolle es mit einem edlen Rosse wetteifern. Diese Art der Bewegung kann es jedoch nicht lange fortsetzen; wir haben mehrmals gesehen, daß es durch einen gewandten Reiter überholt und zurückgetrieben wurde, und wissen, daß eine Meute guter Hunde Wild ungefähr nach stündiger Jagd einholt, falls es diesem nicht gelingt, einen Sumpf oder einen Strom zu erreichen, in welchen es sich unter solchen Umständen augenblicklich wirft. Es geht übrigens auch unbedrängt ins Wasser und schwimmt mit großer Schnelligkeit, den Leib tief eingesenkt und nur das Haupt über der Oberfläche erhoben. Nach unseren Erfahrungen kreuzt es zuweilen sehr breite Ströme und durchschwimmt Entfernungen von zwei (englischen) Meilen so rasch, daß ein Boot es kaum überholen kann. An den südlichen Küsten wirft sich das von Hunden verfolgte und ermüdete Wild in die Brandung, schwimmt auf ein oder zwei Meilen in das Meer hinaus und kehrt gewöhnlich zu demselben Platze zurück, von welchem es ausgegangen war.
»Wenn wir nachts durch den Wald ritten und an Wild vorüberkamen, hörten wir oft, daß es mit dem Fuße aufstampfte, oder vernahmen von den Hirschen ein lautes Schnaufen. Hierauf stürmte das Rudel eine kurze Strecke dahin und stampfte und schnaufte wieder. Dieses Betragen scheint übrigens nur bei Nacht stattzufinden.
»Das Wildpret ist das wohlschmeckendste von dem aller Thierarten, deren Fleisch wir versucht haben. Es ist feiner als das Wildpret des Wapiti oder der europäischen Hirscharten; den höchsten Wohlgeschmack hat es jedoch nur während der Feistzeit in den Monaten August bis December.
»Die Erbeutung des Wildes forderte alle List und Geduld der Indianer heraus, bevor das Weißgesicht mit seiner Büchse, seinem Rosse und seinen Hunden in die Jagdgründe eintrat. Der Wilde stritt mit dem Wolfe und dem Puma um solche Beute, und die verschiedensten Jagdarten wurden in Anwendung gebracht. Am häufigsten erlegte man das Wild, indem man das Mahnen des Kalbes oder das Schreien des Bockes nachahmte. Zuweilen auch kleidete sich der Wilde in die Decke des erlegten Hirsches, dessen Geweih er am Kopfe festgebunden hatte, und ahmte getreulich den Gang und alle übrigen Bewegungen des Hirsches nach, wodurch es ihm gelang, sich bis mitten in das Rudel zu schleichen und dann oft mehrere nach einander mit dem Bogen zu erlegen, ehe das Rudel flüchtig wurde. Nach unserem Dafürhalten haben die nordamerikanischen Indianer zur Erlegung ihrer Jagdbeute niemals vergiftete Pfeile gebraucht wie die Indianer Südamerikas. Seit der Einführung der Feuerwaffen haben jedoch die meisten Stämme Bogen und Pfeil bei Seite gelegt und das Gewehr angenommen. Aber auch mit dieser Waffe schleichen sie sich gewöhnlich möglichst nahe an das sich äsende Rudel an und schießen selten auf weiter als auf dreißig Schritte, dann freilich mit dem größten Erfolge.
»Der Weiße Mann jagt je nach des Landes Beschaffenheit. In Gebirgsgegenden bevorzugt er die Pirsche, in dicht bewachsenen Wäldern nimmt er die Hunde zu Hülfe und gebraucht dann anstatt der Büchse ein mit starken Posten geladenes Doppelgewehr. Bei tiefem Schneefalle benutzt man in einigen Gegenden auch Schneeschuhe und verfolgt mit ihrer Hülfe das Wild, welches sich unter solchen Umständen nur langsam fortbewegen kann. Weniger waidmännisch verfährt man in Virginien, indem man entweder starke Stahlfallen in die Nähe des Wassers stellt oder längs der Innenseite der Feldgehege spitzige Pfähle einrammt, auf denen sich das überspringende Wild spießt. Hier und da betreibt man die Jagd vom Bote aus: man kennt die Stellen, an denen das Wild über die Ströme oder Seebusen zu setzen pflegt, jagt es mit Hunden auf, verfolgt es mit dem Bote und schießt es im Wasser zusammen. Ganz eigenthümlich ist die Feuerjagd. Zu ihr sind zwei Jäger erforderlich. Der eine trägt eine Eisenpfanne, auf welcher er mit harzigem Holze ein kleines Feuer unterhält; der andere, welcher dicht neben ihm geht, führt das Gewehr. Durch den Anblick des ungewohnten Lichtes mitten im Wald wird das Wild so überrascht, daß es ruhig stehen bleibt; seine Augen spielen dann den Schein der Flamme wieder und geben dem Jäger Gelegenheit zum Zielen. Oft kommt es vor, daß nach dem Schusse einige Glieder des Trupps sich von neuem nach der Flamme kehren. Das einzige unangenehme bei dieser Jagd ist, daß der Jäger, welcher die beiden feurigen Augen wahrnimmt, nicht unterscheiden kann, ob er Wild oder ein Thier seiner Herde vor sich hat; es kommt auch gar nicht selten vor, daß gelegentlich solcher Jagden die im Walde weidenden Herdenthiere erlegt werden. Ein Herr erzählte uns, daß er nur einmal in seinem Leben die Feuerjagd betrieben habe. Auch er glaubte die Augen eines Hirsches zu sehen, feuerte und verwundete sein Wild tödtlich, erlegte sogar wenige Minuten darauf ein zweites Thier in derselben Weise. Als er am nächsten Morgen ausging, um nach seiner Beute zu suchen, fand er freilich, daß er anstatt der Hirsche zwei seiner besten Füllen erschossen hatte! Nach einer andern Erzählung feuerte ein Jäger auf zwei glänzende Punkte und erlegte dabei einen Hund, verwundete zugleich aber auch einen Neger, zwischen dessen Beinen der Hund gestanden hatte.
»Wir sind versichert worden, daß unser Wild von einem guten Windhunde regelmäßig gefangen wird. Ein Paar dieser trefflichen Thiere, welche in Karolina eingeführt worden, fing gewöhnlich den Hirsch nach einem Laufe von wenigen hundert Schritten. Stöberhunde wurden benutzt, um die Hirsche aufzusuchen und aufzutreiben, dann übernahmen die Windhunde die Verfolgung.
»Mit lebhaftem Bedauern müssen wir die Befürchtung der Jäger bestätigen, daß unser Wild im schnellen Abnehmen begriffen ist und möglicherweise bald ausgerottet sein wird. Schon gegenwärtig gibt es in Karolina kaum den fünfzigsten Theil des Wildes mehr, welches vor zwanzig Jahren dort lebte. In den nördlichen und mittleren Staaten ist es bereits ausgerottet, und nur in den südlichen Ländern, wo die ausgedehnten Wälder, Brüche und Sümpfe den Anbau des Bodens verwehren, treibt es sich noch in großer Anzahl umher, obgleich auch hier schon viele Pflanzer ihre Hunde verschenkt haben, weil für sie keine Arbeit mehr sich findet.«
Ich will dieser Schilderung Audubons, welche ich übrigens nicht streng übersetzt und nur im Auszuge gegeben habe, bloß das eine noch hinzufügen, daß, nach meinen Erfahrungen, die gefangenen virginischen Hirsche, wenn sie entsprechend gehalten werden, zu den anmuthigsten Geschöpfen gehören, welche der Mensch an sich fesseln kann. Darin mag Audubon Recht haben: für das Zimmer eignen sie sich wie alle Hirsche nicht, – einem Parke oder überhaupt einen Raume aber, welcher ihretwegen umhegt worden ist, gereichen sie zur größten Zierde. Sie gewöhnen sich in kurzer Zeit an ihren Pfleger und beweisen ihm eine besondere Zärtlichkeit. Mazamahirsche, welche ich pflegte, näherten sich vertrauensvoll ihren Bekannten und nahmen die ihnen dargereichten Leckerbissen nicht nur freundlich entgegen, sondern leckten dem Geber auch dankbar die Hand. Leider tritt ein Uebelstand der Hegung dieser Hirsche in engeren Räumen hindernd entgegen: sie brechen sich oft ihre zarten Läufe und gewöhnlich so unglücklich, daß die Heilung schwer oder unmöglich ist. Ein ungeschickter Sprung im Stalle kann solche Verluste bewirken, und noch häufiger als im Stalle selbst verunglückten sie in der angegebenen Weise, wenn sie scherzend in der Nähe der Gitter sich vergnügen oder während der Brunst sich gegenseitig treiben, ohne auf jeden Schritt zu achten. Mit mehr Erfolg pflegt man Virginiahirsche in größeren Thierparks. Sie gedeihen hier, da ihre ursprüngliche Heimat annähernd dasselbe Klima hat wie Mitteleuropa, über Erwarten gut, vermehren sich stark und bilden bald ansehnliche Trupps, eignen sich daher besser als jeder andere Hirsch zur Einbürgerung in unseren Gegenden. Freilich richten sie hier mindestens ebenso viel Schaden an wie Roth- oder Damwild, werden also immer nur in Gehegen, welche man ihnen preisgibt, geduldet werden können. Graf Bräuner unterhält gegenwärtig auf seinen Besitzungen in Oesterreich stattliche Rudel und ist mit dem Erfolge der von ihm angestellten Einbürgerungsversuche in jeder Beziehung zufrieden gestellt worden.
Bei den Sprossenhirschen ( Blastoceros), deren Heimat Südamerika ist, verästeln sich die aufrechtstehenden Geweihe in drei bis fünf Sprossen, von denen einer nach auswärts sich richtet; Eis- und Mittelsprossen fehlen.
Die bekannteste Art dieser Untersippe, der Pampashirsch ( Cervus campestris, C. leucogaster, Mazama und Blastoceros campestris) ein für unsere Familie mittelgroßes Thier von 1,1 bis 1,3 Meter Leibeslänge und 10 Centimeter Schwanzlänge, am Widerrist 70 Centim., am Kreuz 75 Centim. hoch, hat Hirschgestalt und Färbung. Sein Geweih erinnert an das unseres Rehes, ist aber schlanker, feiner und durch die längeren Sprossen unterschieden. Es krümmt sich nur wenig nach rückwärts, in der unteren Hälfte etwas nach außen, in der oberen wieder nach innen. Der Augensproß entspringt etwa 5 Centim. über der Rose und ist etwa 10 Centim. lang; oben bildet sich aus der Stange eine zweizackige Gabel, deren Sproß gerade nach aufwärts gerichtet ist, während sich das Ende der Gabel nach rückwärts kehrt. Zuweilen finden sich Geweihe, von deren Stange an der Vorderseite noch ein zweiter nach vorwärts gekehrter Sproß sich abzweigt.
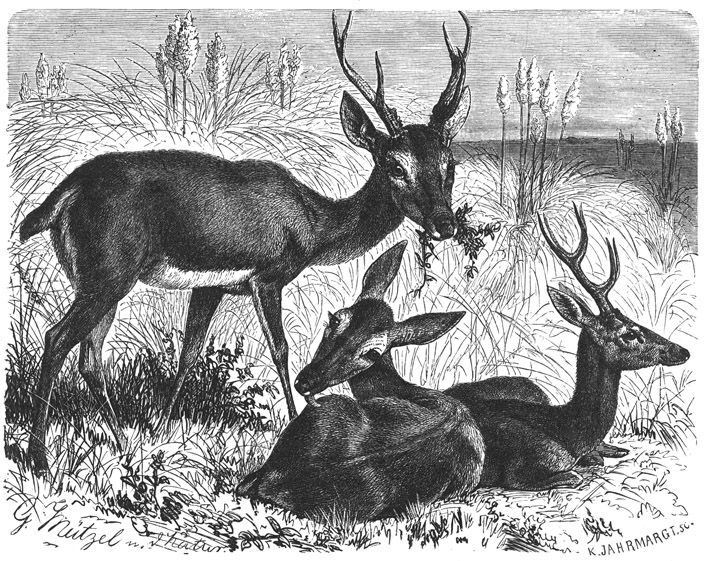
Pampashirsch ( Cervus campestris). 1/12natürl. Größe.
Die Länge des Geweihes beträgt selten mehr als 25 Centim. Stangen von 30 Centim. Länge gehören zu den Ausnahmen. Das Haar ist dick, rauh, brüchig und glänzend, auf der Ober- und Außenseite licht-röthlichbraun oder fahl-gelbbraun, an den Seiten, am Vorderhalse und auf der Innenseite der Gliedmaßen am lichtesten. Die Untertheile, also Kinn, Kehle, Brust und die Längsstreifen an der Innenseite der Schenkel sind schmutzig-, der Bauch, die Hinterseite der Schenkel, die Unterseite des Schwanzes und die Schwanzspitze reinweiß, die Ohren außen licht-röthlichbraun, innen weißlich. Ein weißer Ring umgibt das Auge, und weiße Flecken stehen an der Spitze der Oberlippe.
Der größte Theil Südamerikas ist die Heimat dieses überall häufigen Hirsches. Nach Rengger kommt er hauptsächlich auf offenen und trockenen Feldern in den wenig bevölkerten Gegenden vor, während er, selbst wenn er heftig verfolgt wird, die Nähe von Sümpfen und die Wälder meidet. Er lebt paarweise und in kleinen Rudeln; alte Böcke einsiedeln. Bei Tage ruht er im hohen Grase und hält sich so still in seinem Bette, daß man dicht neben ihm vorbeireiten kann, ohne daß er sich bewegt. Dies thut er, weil er sich dadurch zu verbergen sucht; denn seine Sinne sind schärfer und seine Bewegungen schneller und gewandter als bei vielen anderen Hirschen. Nur sehr gute Pferde können ihn einholen; wenn er aber einigen Vorsprung hat, vermag ihn auch der beste Renner nicht zu erreichen. Nach Sonnenuntergang zieht er auf Aesung aus und streift dann während der ganzen Nacht umher. Das Thier setzt nur ein Kalb, entweder im Frühlinge oder im Herbste. Nach wenigen Tagen führt es dasselbe dem Hirsche zu, und beide Eltern bekunden große Sorgfalt und Liebe für das Kleine. Sobald Gefahr droht, verstecken sie es im hohen Grase, zeigen sich selbst dem Jäger, führen ihn von der Spur des Kalbes ab und kehren dann auf Umwegen wieder zu diesem zurück. Wird das Junge gefangen, so entfernen sie sich, falls sie nicht von den Hunden verfolgt werden, niemals weit von dem Jäger, sondern gehen unruhig in großen Kreisen um ihn herum und nähern sich, wenn sie die meckernde Stimme des Kalbes vernehmen, sogar auf Schußweite. Ein Paar dieser Hirsche verfolgte Rengger, welcher ein Junges mit sich wegführte, einmal eine halbe Stunde lang.
Jung eingefangen wird der Pampashirsch außerordentlich zahm. Er lernt alle Mitglieder des Hauses kennen, folgt ihnen überall hin, gehorcht ihrem Rufe, spielt mit ihnen und beleckt ihnen Hände und Gesicht; mit Haushunden und Pferden lebt er nicht nur friedlich, sondern neckt sie zuweilen mit Stößen; fremde Personen und fremde Hunde meidet er. Rohe und gekochte Pflanzen der verschiedensten Art ernähren ihn; auf Salz ist er, wie seine Verwandten, besonders erpicht. Bei schöner Witterung vergnügt er sich im Freien; in den Mittagsstunden kaut er wieder; bei Regenwetter begibt er sich unter Dach.
Der erwachsene Hirsch gibt einen sehr unangenehmen, den Ausdünstungen des Negers ähnelnden Geruch von sich, namentlich in der Brunstzeit. Dann ist er so stark, daß man ihn sogar an Stellen wahrnimmt, wo eine Viertelstunde vorher ein Männchen vorbeigekommen ist. »Ich warf einst mit Kugeln«, sagt Rengger, »in die Geweihe des Gua-zu-y, und ließ dieselben nur so lange daran, bis ich das Thier getödtet hatte; dennoch hatten sie schon einen so stinkenden Geruch angenommen, daß ich mich ihrer während vierzehn Tagen nicht mehr bedienen konnte. Auch besitze ich ein paar Geweihe, an denen die noch vorhandene Hautbedeckung des Rosenstockes, jetzt nach Verlauf von acht Jahren, noch jenen Negergeruch wahrnehmen lassen. Der Geruch stellt sich nicht vor dem ersten Altersjahre ein und soll, wie mir ein Jäger versichert, ganz wegbleiben, wenn man das Thier in der Jugend verschneidet.«
Um den Gua-zu-y zu erlegen, muß man Treibjagden anstellen. Einige Jäger zu Pferde bilden auf dem Felde einen Halbkreis und erwarten das Wild, welches ihnen andere mit Hülfe der Hunde zutreiben. So wie sich einer dem Hirsch genugsam genähert hat, sprengt er plötzlich auf ihn zu und wirft ihm die Kugeln in die Geweihe oder zwischen die Läufe. Eine Hauptregel ist, daß sich der Jäger nicht zu früh gegen das nahende Thier in Bewegung setzt, sonst wird er schon aus der Ferne von diesem bemerkt und ist dann nicht mehr im Stande, das flüchtige Geschöpf einzuholen. Wird der Hirsch lange gejagt, so macht er, wie unser Reh, häufig Seitensprünge, um die Hunde von der Spur abzubringen, und versetzt sich endlich an einer Stelle, wo er hohes Gras findet. Im Falle der Noth zeigt er Muth und vertheidigt sich gegen Hunde und Menschen entweder mit dem Geweih oder durch Schlagen mit den Vorderläufen. Zuweilen gelingt es auch, wenn man mit Vorsicht die Felder durchreitet, vom Pferde herab einen Gua-zu-y im Aufspringen zu schießen. Außer dem Menschen hat dieses Wild bloß den Cuguar zu fürchten.
Das Wildpret der jungen Thiere ist angenehm, das der alten Ricken etwas zäh, das der Hirsche, wegen der Ausdünstung, gänzlich ungenießbar. Die Haut benutzt man gegerbt zu Reitdecken und Bettunterlagen.
Auch das Reh vertritt eine besondere Untersippe ( Capreolus), deren Merkmale in dem drehrunden, wenig verzweigten, gabelig verästelten, rauhen Geweih ohne Augensprossen zu suchen sind. Das Gebiß besteht aus 32 Zähnen, da die Eckzähne fehlen oder doch nur sehr selten vorkommen.
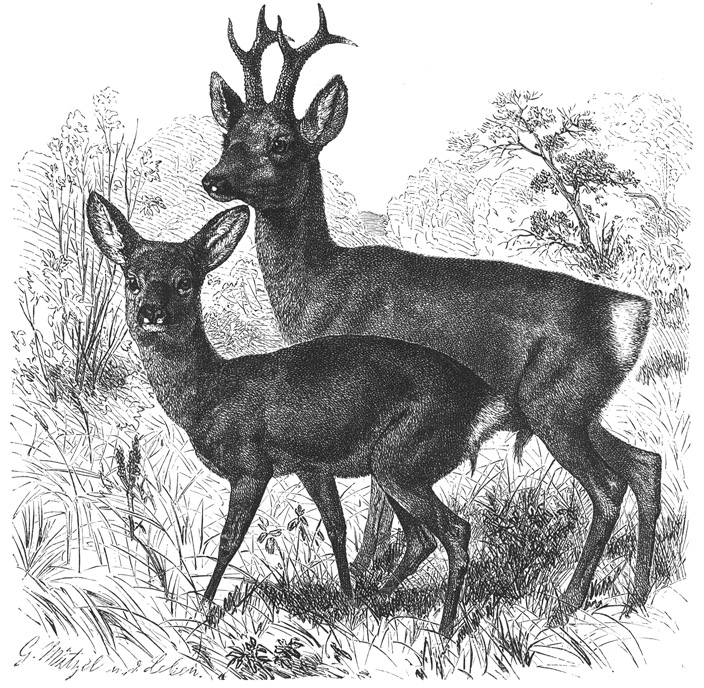
Reh ( Cervus Capreolus). 1/12 natürl. Größe
Das Reh ( Cervus Capreolus, C. Pygargus, Capreolus vulgaris) wird 1,3 Meter lang und am Kreuze bis 75 Centimeter hoch; das Stumpfschwänzchen erreicht kaum eine Länge von 2 Centim. Sein Gewicht beträgt 20 bis 25, in seltenen Fällen sogar bis 30 Kilogramm. Im Vergleiche zum Edelhirsche ist das Reh gedrungen gebaut, der Kopf kurz und abgestumpft, der Hals schlank und länger als der Kopf, der Leib verhältnismäßig wenig schlank, vorn etwas stärker als hinten, auf dem Rücken fast gerade, am Widerriste niederer als am Kreuze; die Läufe sind hoch und schlank, die Hufe klein, schmal und spitzig, die Lichter sind groß und lebhaft, am obern Lide lang gewimpert, ihre Thränengruben sehr klein, eigentlich nur schwach angedeutet, da sie bloß bis 6 Millim. lange, seichte, kahle Vertiefungen von abgerundeter, dreieckiger Gestalt bilden; das Gehörn ist mittellang und steht weit auseinander. Das Gehörn zeichnet sich durch breite Rosen und durch verhältnismäßig starke, mit weit hervortretenden Perlen besetzte Stangen aus. Gewöhnlich setzt die Hauptstange nur zwei Sprossen an; allein die Entwickelung, welche das Rehgehörn erreichen kann, ist damit noch nicht beendet. »Die jagdmäßige Zählung der Rehbocksenden«, sagt Blasius, »beabsichtigt nicht, einen Ausdruck für das Naturgesetz der Gehörnbildung zu geben. Will man das thierkundliche Bildungsgesetz aussprechen, so kommt es weniger auf die Anzahl der Enden als auf die Gesammtform des Gehörns an, mit deren Verbindung die Endenzahl eine Bedeutung gewinnt. Im ersten Winter erhält der Schmalbock unzertheilte, schlanke Spieße mit schwacher Rose an der Wurzel der Stange; beim Gabelbocke ist die Stange ungefähr in der Mitte getheilt. Die Hauptstange richtet sich von der Theilung an in einem Winkel nach hinten, der Nebensproß nach vorn. Diese knieförmige Biegung der Hauptstange ist weit wichtiger als der vordere Nebensproß, und man kann den Bock dem Alter nach für einen Gabler ansprechen, wenn die Biegung vorhanden ist und der Nebensproß fehlt. Beim Sechsender theilt sich die nach hinten gebogene Hauptstange zum zweitenmale und biegt sich nach der Theilung wieder nach vorn vor, während sich der zweite hohe Nebensproß nach hinten wendet. Die zweite knieförmige Biegung kennzeichnet den Sechsender, und man kann den Bock dem Alter und Gehörn nach als Sechser ansprechen, wenn er beide knieförmige Biegungen der Hauptstange zeigt, auch wenn die Nebensprossen beliebig fehlen. Mit dem Sechsender schließt gewöhnlich die Gesammtentwickelung ab, indem der Rehbock bei ferneren Aufsätzen in der Regel dieselbe Anzahl von Enden wieder erhält. Die regelrechte Entwickelung kann jedoch weiter fortschreiten. Beim Achter theilt sich die über der zweiten Gabel oder Kniebiegung und die nach oben oder nach hinten gerichtete Spitze aufs neue und setzt einen Nebensproß ab. Der Zehnender ist die höchste regelmäßige Entwickelung des Rehgehörns, welche ich kenne. Er entsteht, wenn die beiden oberen Spitzen des Sechsenders sich gabelig zertheilen; das Gehörn besteht dann aus einem vorderen Mittelsproß, einer oberen Endgabel und einer hinteren Nebengabel. Gehörne dieser Form kenne ich nur aus Syrmien und Kroatien. Häufig zeigen die Rehgehörne eine Neigung, inwendig an der Hauptstange, unterhalb des nach vorn gerichteten Mittelsprosses und gleichmäßig an jeder Seite eine auffallend lange Perle zu entwickeln. Diese Perle wird zuweilen bis 25 Millimeter lang und kann dann jagdmäßig als Ende gezählt werden.«
Mißbildungen aller Art sind bei dem Rehgehörn außerordentlich häufig. In Sammlungen sieht man Stangen von der sonderbarsten Gestaltung: manche mit einer ganzen Reihe von jagdgerechten Enden, andere schaufelartig verbreitert und mit Randsprossen besetzt. Es kommen Rehböcke mit drei Stangen und drei Rosenstöcken oder solche mit einer einzigen Rose und einem einfachen Stocke vor etc. Auch sehr alte Ricken erhalten einen kurzen Stirnzapfen und setzen schwache Gehörne auf. Radde erhielt im Sajan ein solches, welches die Ricke mitten auf der Stirne trug. Es zeigt vier längere, aus einem Grunde entspringende Sprossen, welche in abweichender Richtung zu einander ausgewachsen sind. Von einem anderen derartigen Gehörn theilt mir Block mit, daß es aus zwei, gegen fünf Centimeter langen Stangen bestand, und selbst einen alten Weidmann täuschen konnte, welcher die Ricke als Bock ansprach und erlegte.
Die dichte Behaarung des Rehes ändert sich je nach der Jahreszeit, indem, meiner Auffassung nach, wie beim Hirsche, im Sommer nur das Grannenhaar, im Winter ausschließlich das Wollhaar zur Entwickelung gelangt. Ersteres ist kurz, straff, hart und rund, letzteres lang, gewellt, weich und zerbrechlich, auch durchaus anders gefärbt als jenes. Ober- und Außenseite des Körpers sind im Sommer dunkel-rostroth, im Winter braungrau, Unterseite und Innenseite der Gliedmaßen immer heller gefärbt. Auf der Stirne und dem Nasenrücken mischt sich Schwarzbraun, an den Seiten des Kopfes und rückwärts über den Augen rothgelb ein; Kinn, Unterkiefer und ein kleiner Fleck jederseits der Oberlippe sind weiß; hinter der Mitte der Unterlippe tritt ein kleiner brauner Fleck hervor. Das Gehör ist auf der Außenseite etwas dunkler als der übrige Leib, innen mit gelblichweißen Haaren besetzt. Steiß und der Hintertheil der Keulen sind, scharf abgegrenzt, lichtfarbig, im Sommer gelblich im Winter weiß. Bei den Kälbern treten auf der röthlichen Grundfarbe kleine, rundliche, weiße oder gelbliche Flecken in Reihen hervor. Verschiedenartige Spielarten sind bekannt worden; manche von ihnen erhalten sich sogar durch mehrere Geschlechter hindurch. In der Grafschaft Denneberg soll es tusch-, in der Grafschaft Schaumburg rabenschwarze Rehe geben, welche gleichgefärbte Kälber erzielen; in dem Erbach'schen hat man bleifarbige Böcke erlegt. Häufiger sind ganz weiße, seltener gefleckte alte Rehe, höchst selten silberfarbene.
In der Weidmannssprache heißt das männliche Reh nach seiner Geburt Bockkalb oder Kitzbock, nach zurückgelegtem ersten Jahre Spießbock oder Schmalrücken, nach vollendetem zweiten Jahre Gabelbock, vom dritten Jahre ab endlich Bock, guter und braver Bock, das weibliche Reh dagegen in denselben Altersstufen Reh- oder Kitzkalb und Kitzchen, sodann Schmalreh, endlich Rike, Ricke, Hille, Rehgeis, Rehziege und zuletzt alte, beziehentlich gelte Rike. Der lange Haarbüschel, welcher am vordem Ende der Brunstruthe des Bockes herabhängt, heißt Pinsel, der Haarbüschel, welcher aus dem Feigenblatte oder Geburtsgliede der Rike hervortritt, Schürze oder Wasserzeichen, die lichte Stelle am Steiße der Spiegel. Das Reh bildet einen Sprung oder ein Rudel, wenn es sich gesellschaftsweise vereinigt; es schreckt, schmält oder meldet sich, wenn es seinen kurzen Schrei von sich gibt, oder klagt, wenn es von Hunden oder Raubthieren ergriffen wird und laut aufschreit. Im übrigen gebraucht man von ihm dieselben Ausdrücke wie vom Hochwilde.
Das Reh verbreitet sich mit Ausnahme der nördlichsten Länder über ganz Europa und den größten Theil von Asien. Es lebt noch gegenwärtig in Deutschland, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, Holland, England und Schottland, Ungarn, Galizien, Siebenbürgen, den Donautiefländern, im südlichen Schweden, Polen, Lithauen und den Ostseeprovinzen, ist selten in der Türkei und Griechenland, fehlt im nördlichen und mittlern Rußland, tritt jedoch in der Ukräne und der Krimm wieder auf, bewohnt Kaukasien, Armenien, Kleinasien, Palästina und Persien, ebenso das mittlere und südliche Sibirien, soweit es bewaldet ist, östlich bis zum Mündungslande des Amur, nach Süden hin bis zu den indisch-mandschurischen Hochgebirgen, kommt jedoch in den kahlen, waldlosen Hochsteppen nur noch selten und sehr einzeln vor. In der Schweiz ist es bis auf einzelne Trupps ausgerottet, geht da, wo es vorkommt, auch nicht hoch im Gebirge empor, wogegen es im Kaukasus bis zu 2000 Meter, in den Gebirgen des südlichen Sibirien selbst bis zu 3000 Meter unbedingter Höhe aufsteigt. Im allgemeinen kann man sagen, daß es sich innerhalb seines Verbreitungsgebietes in allen größeren Waldungen findet, gleichviel, ob solche in Gebirgen oder ebenen Gegenden liegen, ob sie aus Schwarz- oder Laubholz bestehen. Gerade das letztere scheint dem Reh besonders zu behagen, während es anderseits wieder trockene Gegenden vorzieht. Waldungen mit viel Unterholz, junge Baumschläge, Vor- und Feldhölzer, welche Dunkel und Schatten bieten, sagen ihm zu. Im Winter zieht es sich von den Höhen zur Tiefe herab, im Sommer steigt es höher empor. In Sibirien wandert es mit einer gewissen Regelmäßigkeit überall, wo es ihm beschwerlich oder unmöglich wird, auf seinen Sommerständen zu überwintern. Schon in unseren Hoch- und Mittelgebirgen findet etwas ähnliches statt, nur daß hier die Wanderungen nicht über so weite Strecken sich ausdehnen; in Sibirien aber verläßt es mit Eintritt der kalten Jahreszeit bestimmt seine sommerlichen Aufenthaltsorte, schart sich in zahlreiche Rudel und meidet nun das Gebirge gänzlich, um in den Wäldern der Ebene den Winter zu verbringen. Bei dieser Gelegenheit kommt es zuweilen mit der Kropfantilope zusammen, welche doch eine von der seinigen gänzlich abweichende Lebensweise führt. Die Wanderungen beginnen unmittelbar nach der Brunst und dauern, streng genommen, während des ganzen Winters fort, wogegen mit Beginn der Schneeschmelze ein allmähliches Aufrücken in den Gebirgen stattfindet. Sowohl im Sommer wie im Winter meidet das Reh in Sibirien die reinen Schwarzwälder, bevorzugt dagegen die Thalmündungen, die flachen Vorländer, die sanfthügeligen, nicht sehr dicht bewaldeten Vorberge oder hält sich in den dichten Unterhölzern des alpinen Gürtels auf, hier mit Vorliebe die Dickichte der Eiche, Kiefer und sibirischen Tanne zu seinem Standorte wählend. Bei uns zu Lande lebt es gern in Vorhölzern, auch in solchen, welche mit geschlossenen Waldungen nur lose zusammenhängen, nicht selten inmitten größerer Feldfluren, zieht sich auch im Vorsommer gänzlich in die Felder zurück und thut sich über Tages im hohen Getreide nieder. Standwild im strengsten Sinne des Wortes ist es nur da, wo es sich vollkommen sicher fühlt; aber auch hier unternimmt es gern weitere Streifzüge, sei es um eine gewisse Aesung, sei es, um andere seiner Art aufzusuchen. Mehr als der Hirsch, ungleich mehr als der Damhirsch, liebt es Freiheit in jeder Beziehung, insbesondere Veränderung des Standes, der Aesung, selbst der Gesellschaft. Es ist nicht allein wählerisch, sondern förmlich launenhaft, gefällt sich heute hier, morgen dort, läßt sich unter Umständen allerlei Störungen gefallen und nimmt sie wiederum so übel, daß es gelegentlich gänzlich auswechselt.
Die Bewegungen des Rehes sind behend und anmuthig. Das Reh kann erstaunlich weite, bogenförmige Sätze ausführen und über breite Gräben, hohe Hecken und Sträuche ohne irgend welche bemerkbare Anstrengungen fallen, schwimmt sehr gut und klettert recht leidlich. Es vernimmt, wittert und äugt vortrefflich, ist listig, vorsichtig und sehr scheu. »Freundlichkeit, Zuthunlichkeit«, sagt Dietrich aus dem Winckell, »spricht aus jedem seiner Blicke, und doch läßt es nur, von der zartesten Jugend an von dem Menschen künstlich erzogen, sich zähmen; im entgegengesetzten Falle behält es selbst bei der besten Pflege die im wilden Zustande eigene Schüchternheit und Furcht vor Menschen und Thieren bei. Diese geht so weit, daß es, wenn es überrascht wird, nicht nur zuweilen einen kurzen Laut des Schreckens von sich gibt, sondern auch den Versuch, sich durch die Flucht zu retten, oft aufgeben muß, indem es leicht völlig aus dem Sprunge kommt und dann, auf einem engen Raume sich ängstlich gleichsam herumtummelnd, nicht selten ein Opfer gemeiner, gar nicht rascher Bauernhunde, vorzüglich aber der Raubthiere wird. Nur in Gehegen, wo die Rehe sehr wenig beschossen werden und immer Ruhe haben, legen sie ihre Scheu vor dem Menschen insoweit ab, daß sie, wenn er in einer Entfernung von zwanzig bis dreißig Schritten an ihnen vorübergeht, sich im Aesen nicht stören lassen. Im Bette wird keine andere Wildart häufiger überrascht als das Reh; wahrscheinlich muß es schlafen oder, wenn es sich wachend niedergethan hat, um das Geschäft des Wiederkäuens zu verrichten, unter einem dicken Strauche oder in hohem Grase vor den spähenden Blicken seiner Verfolger sich hinlänglich gesichert glauben.« Im übrigen ähnelt das Wesen des Rehes dem unseres Edelwildes sehr. Es ist ebensowenig ein kluges und ebensowenig ein liebenswürdiges Thier wie der Hirsch, vielmehr ebenfalls heftig, reizbar und jähzornig, auch rauf- und kampflustig. Von der »Freundlichkeit und Zuthunlichkeit«, welche Winckell rühmend hervorhebt, nimmt man bei innigerem Umgange mit dem Rehe herzlich wenig wahr. So lange es jung ist, zeigt es sich allerdings höchst liebenswürdig, im Alter aber sehr eigenwillig, trotzig und bösartig. Schon die alte Rike hat ihre Mucken, jedoch zu wenig Kraft, um ihren Absichten den erwünschten Aus- und Nachdruck zu geben; der Bock aber ist ein unverträglicher, boshafter, selbst- und herrschsüchtiger Gesell, behandelt schwächere seiner Art stets, die Rike nicht selten ganz abscheulich, mißhandelt ohne Erbarmen seine Sprößlinge, sobald er meint, daß sie seinen Gelüsten im Wege stehen könnten, zeigt allen Geschöpfen, welche er nicht fürchten muß oder aus Gewohnheit nicht mehr fürchtet, das Gehörn und gebraucht es in höchst gefährlicher Weise. Zu trauen ist ihm nie; denn sein Sinn ist im höchsten Grade unbeständig und wetterwendisch, seine Reizbarkeit unglaublich groß und seine störrische Beharrlichkeit nicht zu unterschätzen. Wirkliche Anhänglichkeit, hingebende Aufopferung kennt er nicht: bei Gefahr ist er der erste, welcher sich, nicht ohne bemerkenswerthe List und Verschlagenheit, davon zu machen sucht; Vertheidigung der Rike und seines Sprößlings kommt ihm nicht in den Sinn. Er hält sich nicht immer, aber oft zu beiden, jedoch kaum aus warmer Zuneigung, sondern wohl hauptsächlich aus Liebe zur Geselligkeit und Bequemlichkeit, da er weiß, daß die vorsichtige Rike unablässig um die Sicherheit ihres Kälbchens besorgt ist, und er sich dies zu Nutze zu machen sucht. Selbst während der Brunstzeit bekundet er der Rike gegenüber eigentlich weder Liebe noch Zärtlichkeit, sondern nur Sinnlichkeit und Begierde. Vollendete Selbstsucht ist der Grundzug seines Wesens.
Niemals bildet das Reh so starke Trupps wie das Edelwild. Während des größten Theiles des Jahres lebt es familienweise zusammen, ein Bock mit einem, seltener mit zwei bis drei Riken und deren Jungen; nur da, wo es an Böcken fehlt, gewahrt man Trupps von zwölf bis fünfzehn Stücken. Der Bock trennt sich wahrscheinlich bloß dann von der Familie, wenn jüngere seine Stelle vertreten, und er es für gut befindet, grollend in die Einsamkeit sich zurückzuziehen. Dies geschieht hauptsächlich im Frühsommer, währt aber nie länger als bis zur Brunstzeit; dann trollt er unruhig umher, um Schmalrehe auszusuchen. Nach der Blattzeit bleibt er meistens beim Schmalreh; wenn die nunmehrige Rike aber hochbeschlagen ist, sucht er sich eine andere, und diese bleibt bis zum nächsten Frühlinge seine bevorzugte Gefährtin. Im Winter vereinigen sich zuweilen mehrere Familien und leben längere Zeit mit einander. Die Kälber halten sich bis zur nächsten Brunstzeit zu den Rehen, werden dann von diesen abgeschlagen und bilden oft eigene Trupps für sich.
Ueber Tages hält sich das Reh in einem ruhigen und Deckung bietenden Theile des zeitweiligen Wohngebietes auf, gegen Abend, in geschützten Gehegen bereits in den späteren Nachmittagsstunden, tritt es auf junge Schläge, Wald- und Flurwiesen oder Felder heraus, um sich zu äsen; gegen Morgen begibt es sich wieder nach der Dickung oder ins hohe Getreide zurück, schlägt mit den Vorderläufen die Moos- oder Rasendecke weg und bereitet sich so sein Bett oder Lager, um hier zu ruhen. Einen bestimmten Wechsel hält es gern, obschon nicht ganz regelmäßig ein, und auf ihm pflegt der Bock vorauszuschreiten, während bei der Flucht regelmäßig die Rike die Spitze nimmt. Während der Brunstzeit ändert das Reh wie alle Hirsche seine gewohnte Lebensweise sehr wesentlich.
Die Aesung ist fast dieselbe, welche das Edelwild genießt; nur wählt das leckere Reh mehr die zarteren Pflanzen aus. Blätter und junge Schößlinge der verschiedensten Laubbäume, Nadelholzknospen, grünes Getreide, Kraut und dergleichen bilden wohl die Hauptbestandtheile der Aesung. Bei uns zu Lande ernährt es sich von den Blättern und jungen Trieben der Eiche, Ulme, Birke, Aspe, des Hornbaumes, Spitzahorns sowie der Nadelhölzer, insbesondere der Fichte, von jung aufschießendem Raps, Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Erbsen, Kraut und Klee, allerlei Gräsern, auch Eicheln und anderen Baumfrüchten, in Sibirien außer diesen und ähnlichen Pflanzenarten auch von den Trieben der Wermutarten, Potentillen etc. Salz leckt es sehr gern, und reines Wasser ist ihm Bedürfnis; es begnügt sich aber bei Regen oder starkem Thaufalle mit den Tropfen, welche auf den Blättern liegen. Hier und da kommt es zuweilen auch wohl in die Gärten herein, deren leckere Gemüse ihm behagen, und setzt dabei kühn und geschickt über ziemlich hohe Zäune weg. Vom Hirsche unterscheidet es sich dadurch, daß es die Kartoffeln nicht ausscharrt und in den Feldern nicht soviel Getreide durch Niederthun umlegt; dagegen verbeißt es in Forsten und Gärten die jungen Bäume oft in schlimmer Weise und wird dann empfindlich schädlich.
Merkwürdigerweise ist erst in neuerer Zeit die Fortpflanzungsgeschichte des Rehes festgestellt worden. Lange Jahre hat man sich hin und her gestritten, wann eigentlich die Brunstzeit des Rehes eintrete. Man wollte eine wahre und eine falsche Brunst unterscheiden, erstere als in den August, letztere als in den November fallend. Dietrich aus dem Winckell hat den Beschlag der Rehe im August beobachtet und ist gleichwohl geneigt zu glauben, daß er sich im November wiederhole, trotzdem er weiß, daß um diese Zeit die Rehböcke längst abgeworfen haben. »Alles mögliche«, sagt Blasius, »ist gegen die Novemberbrunst geltend gemacht worden: die wirklich bekannte Begattung im August, die Feistzeit vor dem regelmäßigen Zustande der Böcke, das Abwerfen der Geweihe im Oktober und die Neubildung derselben während der angeblichen Novemberbrunst, das Beschlagen im August und das später sich Vereinzeln der Rike, wobei sie im Mai gesetzt – aber alles vergebens! Ein harmloses Necken und Jagen in diesen Wintermonaten sollte alle Gegengründe aufwiegen! Man muß wenig Sinn für die Deutung von Thatsachen verrathen, wenn man nach der Haltung der Rehe in der sogenannten Blattzeit noch an der wirklichen Brunst zweifeln will. Die Böcke führen zuweilen in dieser Zeit Kämpfe mit einander auf Tod und Leben und verflechten durch heftiges Schlagen hin und wieder ihre Gehörne unentwirrbar in einander. In heftigem Kampfe stellen sie sich auf die Hinterbeine und rennen mit den Köpfen gegen einander, wie die Ziegen, oder nehmen Anlauf, um einander zu durchbohren, während sie zu jeder andern Zeit sich friedlich unter einander vertragen.
»Bei allen hirschartigen Thieren steht die geschlechtliche Erregung mit der Hautthätigkeit in einer zeitlichen Wechselfolge. Nach der Befruchtung geht der Wechsel des Haares und des Geweihes vor sich: das Haar bildet sich aus, und das Geweih wird abgeworfen. Das neue Geweih entwickelt sich während der Sommermonate und hat seine Ausbildung erreicht, wenn das Sommerhaar auftritt. Die Kälber werden gesetzt, wenn das Sommerkleid ausgebildet ist.«
Die Fortpflanzungsgeschichte des Rehes ist kurz folgende. Nachdem das im Oktober oder November abgeworfene Geweih des ältern Bockes sich neu gebildet und vereckt, der Bock auch gefegt hat, was zu Ende März, spätestens im April zu geschehen pflegt, zeigt sich der Bock zwar nicht mehr so harmlos als während der Zeit seiner Waffenlosigkeit, aber doch auch noch nicht erregt, sondern benimmt sich eher als erträglicher Genosse der Rike und zuweilen selbst als theilnehmender Vater seiner oder anderer Böcke Sprößlinge. Um die Mitte des Juli endet dieses schöne Verhältnis. Unruhe, Rauf- und Kampflust machen sich geltend; der starke Bock trennt sich unter allen Umständen von den bisherigen Genossen, beziehentlich der Familie, schweift weit umher, tritt anderen Böcken herausfordernd entgegen, läßt öfters seine Stimme, ein dumpfes, kurz ausgestoßenes »bäö, bäö« oder »bö, bö, bö«, vernehmen und beginnt junge, zwar sehr verliebte, aber züchtige Riken zu treiben, d.+h. hitzig hin und her zu jagen. Seine Erregung steigert sich von Tag zu Tage; er bekämpft mit oft sinnloser Wuth seine Nebenbuhler, bindet selbst mit anderen Geschöpfen, in seltenen Fällen sogar mit dem Menschen an, mißhandelt, ja tödtet die Kitzen, falls deren Vorhandensein ihm hinderlich zu sein scheint, und behandelt auch die Riken, welche sich seinen Wünschen nicht sofort fügen wollen, mit ebensoviel Ungestüm als Rücksichtslosigkeit. Seine Eifersucht und Raufsucht geht so weit, daß er die begehrte Schöne meist ob des Nebenbuhlers hintansetzt, indem er auf Böcke, welche gleich ihm eine Rike treiben, wüthend und kampfeifrig losstürzt, ohne sich um die Geis weiter zu bekümmern. Diese ist fast ebenso erregt als er, gibt ihren Gefühlen auch entsprechenden Ausdruck, indem sie den Bock durch einen »fippenden« Laut, welcher wie »ī, ī, īĕ, īĕ, ī, īĕ« klingt, auf sich aufmerksam macht und zu sich einladet. Auf dieses Zeichen hin eilt der junge Bock hitzig und unbedacht, der ältere vorsichtiger, der alte, erfahrene schleichend wie ein Fuchs herbei, um der Minne Sold zu fordern. Die alte Rike gewährt letzterem meist ohne Umstände, das Schmalreh dagegen widerstrebt dem ungestümen Bewerber, läßt sich längere Zeit treiben, geräth auch meist in große Angst und gibt diese durch die Laute »ī, īă, īăīă« zu erkennen, fügt sich jedoch endlich ebenfalls dem Willen des Bockes. Da dieser, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat, regelmäßig Schmalrehe treibt und die alten Riken mehr oder weniger vernachlässigt, finden gemeiniglich die jungen Böcke bei letzteren williges Entgegenkommen. Ueberwiegt in einem Reviere das eine Geschlecht, so wandert der nicht zur Paarung gelangende Theil aus, um anderswo sein Glück zu suchen.
Das befruchtete Ei geht, wie die Untersuchungen des Jägermeisters von Veltheim, Pockels, Zieglers und zumal Bischoffs mit nicht mehr anzufechtender Bestimmtheit dargethan haben, in kurzer Zeit durch den Eileiter, furcht sich hier und gelangt in seiner ursprünglichen Größe in die Gebärmutter, in welcher es gewöhnlich übersehen wird, da es nur die allersorgfältigste Beobachtung zu entdecken vermag. In dieser verweilt es, ohne sich irgendwie zu verändern, etwa vier Monate, bis nach Mitte December, in demselben gänzlich unentwickelten Zustande, beginnt aber sodann mit ungewöhnlicher Schnelligkeit in regelrechter Weise sich auszubilden, bis der Keimling im Mai oder Juni seine vollständige Reife erlangt hat. Somit geht das Reh ebenfalls ungefähr vierzig Wochen hochbeschlagen, und die Entwickelung seiner Frucht unterscheidet sich, soviel bekannt, einzig und allein dadurch von der anderer Hirsche, daß der Keimling eine allerdings ungewöhnlich lange Zeit in einem sich gleichbleibenden Zustande verharrt.
Dies ist die Regel, Ausnahmen hat aber auch sie. Es kann nämlich vorkommen, daß eine Rike erst mehrere Wochen später beschlagen wird und dennoch rechtzeitig setzt. Gefangene Riken z.+B., welche während der Brunstzeit mit dem Bocke nicht zusammenkommen konnten und erst im Spätherbste einen solchen zum Gesellen erhielten, werden unter besonders günstigen Umständen ausnahmsweise um diese Zeit noch brünstig, empfangen ebenfalls und bringen kaum später als andere ihr Kälbchen zur Welt. Es sind mir über diese verspätete Rehbrunst von den verschiedensten Seiten her so übereinstimmende Mittheilungen zugegangen, daß ich an der Richtigkeit der Beobachtungen nicht wohl zweifeln darf. Gerade das lange Verharren des befruchteten Eies in einem Zustande scheinbarer Nichtentwickelung dürfte es ermöglichen, daß die zwischen der Befruchtung und der ersichtlichen Weiterbildung liegende Zeit abgekürzt werden kann. Ich unterlasse es, die an gefangenen Rehen gesammelten Erfahrungen auch auf frei lebende zu beziehen, bemerke jedoch noch, daß auch unter diesen ein Beschlagen im Oktober und November thatsächlich beobachtet worden ist.
Etwa vier oder fünf Tage vor dem Setzen sucht die Rike in einem einsamen, möglichst abgelegenen Theile des Waldes einen stillen Platz und bringt dort ihre Kälber zur Welt. Jüngere Riken setzen gewöhnlich nur ein einziges Kalb, ältere deren zwei, in seltenen Fällen selbst drei. Die Mutter verbirgt ihre Sprößlinge vor jedem sich nahenden Feind mit Sorgfalt und gibt ihnen bei der leisesten Ahnung einer Gefahr warnende Zeichen durch Aufstampfen mit dem einen Laufe oder durch einen kurzen zirpenden Laut. In der zartesten Jugend drücken sich die Kälber, sobald sie diesen vernehmen, auf der Stelle nieder; späterhin entfliehen sie mit der Mutter. Während der ersten Tage des Lebens, wann die Kälber noch zu unbehülflich sind, nimmt die Rike zur Verstellungskunst ihre Zuflucht und sucht den Feind von sich abzulenken. Wird ihr ein Junges geraubt, ohne daß sie es hindern kann, so folgt sie dem Räuber, auch dem Menschen, lange nach und gibt ihre Sorgen durch beständiges, ängstliches Hin- und Herlaufen und durch Rufen zu erkennen. »Mich hat diese Mutterzärtlichkeit«, sagt Dietrich aus dem Winckell, »mehr als einmal dahin vermocht, das Kalb, welches ich schon mitgenommen hatte, wieder in Freiheit zu setzen, und die Mutter belohnte mich reichlich dafür durch die sorgsamen Untersuchungen, ob dem Kinde ein Unfall zugestoßen sei oder nicht. Freudig sprang sie um das unbeschädigt gefundene Kleine herum und schien es mit Liebkosungen zu überhäufen, indem sie ihm zugleich das Gesäuge zur Nahrung darbot.« Etwa acht Tage nach der Geburt nimmt die Rike ihre Kälber mit auf die Weide, und nach zehn bis zwölf Tagen sind sie vollkommen stark genug, ihr nachzueilen. Nun kehrt sie mit ihnen auf den alten Stand zurück, gleichsam in der Absicht, dem Vater seine Sprößlinge jetzt vorzuführen. Diese besaugen ihre Mutter bis zum August, nehmen aber schon im zweiten Monate ihres Lebens feineres, grünes Geäse mit an; die Mutter lehrt sie die Auswahl treffen. Mit dem Alter von vierzehn Monaten sind sie fortpflanzungsfähig geworden und bilden nunmehr eine Familie für sich.
Schon zu Ende des vierten Monats wölbt sich das Stirnbein des jungen Bockes, in den folgenden vier Wochen bilden sich kleine, immer höher werdende Kolben, und in den Wintermonaten brechen dann die ersten, acht bis zehn Centimeter langen Spieße hervor. Im März fegt der junge Bock »mit Wollust und wahrem Uebermuthe«, im nächsten December wirft er die Spieße ab. Binnen drei Monaten hat sich das zweite Gehörn gebildet. Es wird seiner Zeit etwas früher als im vorigen Herbste abgeworfen und durch das dritte ersetzt. Alte Böcke werfen, wie bemerkt, schon im November ab.
Man jagt das Reh fast in derselben Weise wie anderes Hochwild, obwohl man gegenwärtig mehr das glattläufige Schrotgewehr als die Kugelbüchse zu seiner Erlegung anwendet. Von geübten Jägern wird der Bock in der Brunstzeit durch Nachahmung des zirpenden Liebeslautes seines Weibchens herbeigelockt und dann erlegt. In Sibirien errichtet man auf den Wechseln der Rehe Fallgruben, hetzt sie, wenn der Schnee beim Schmelzen sich mit einer dünnen Eisdecke belegt, mit Hunden und Pferden, fährt sie mit dem Schlitten an und erlegt sie, nachdem sie sich an das Gefährt gewöhnt haben, sticht sie nieder, wenn sie bei ihren Wanderungen die Flüsse übersetzen, treibt jedoch im ganzen nicht ärgere Aasjägerei als unsere Wildschützen und Bauern. Außer dem Menschen stellen Luchs und Wolf, Wildkatze und Fuchs den Rehen nach, erstere großen und kleinen ohne Unterschied, letztere namentlich den Rehkälbern, welche zuweilen auch dem zwerghaften blutgierigen Wiesel zum Opfer fallen sollen.
Der Nutzen, welchen das Reh dem Menschen gewährt, ist beziehentlich derselbe wie der des übrigen Hochwildes, der Schaden, welchen es anrichtet, verhältnismäßig gering, jedoch immer noch viel bedeutender als der Nutzen. Namentlich in jungen Schlägen haust es oft schlimm und vereitelt in wenigen Tagen jahrelange sorgsame Arbeiten des Forstmannes. Bei uns zu Lande nützt man das köstliche Wildpret, das Gehörn und die Decke wie das Fell; in Sibirien verarbeitet man die Decke zu Pelzen, welche allgemein getragen werden, weil sie sehr leicht und billig sind.
Im Wildgarten wie im Thierzwinger oder im engern Gewahrsam überhaupt hält sich das Reh minder leicht als andere Hirsche, weil seinem ungebundenen Wesen aller Zwang zuwider ist. Ist der Wildgarten zu klein, so kümmert es, geht immer mehr zurück und schließlich ein, auch wenn es reichliche und ihm zusagende Aesung hat, beziehentlich gefüttert wird. Nach den Erfahrungen des Grafen von Mengersen, welcher einen gut bestandenen Rehpark unterhält, muß man mindestens sieben Morgen Landes auf ein Reh rechnen, aber auch dann noch im Winter Kleeheu, Kartoffeln, Rüben und Eicheln füttern, falls man auf Erfolg zählen will. In den Thiergärten rechnet man das Reh unter diejenigen Thiere, deren Erhaltung schwierig ist. Einzelne von ihnen gedeihen allerdings nicht allein unter einer durchaus sachgemäßen Pflege, sondern auch unter Umständen, welche den erfahrenen Thierpfleger in Erstaunen versetzen müssen, da sie eigentlich gar keine Pflege genießen; sie aber bilden Ausnahmen von der Regel. Das Reh erweist sich als ein sehr wählerisches, heikliges und schwer zu befriedigendes Geschöpf, ist weichlich und hinfällig, pflanzt sich daher auch keineswegs regelmäßig im Zwinger fort und geht oft infolge einer sehr unbedeutenden Veranlassung ein. Jung aufgezogen, wird es leicht und in hohem Grade zahm, befreundet sich mit Menschen und Thieren, benimmt sich wie ein wirkliches Hausthier und gewährt dann viel Vergnügen. Doch erlebt man auf die Dauer nur an der Rike, nicht aber auch an dem Bocke Freude; denn letzterer bekundet mit der Zeit sein eigentliches Wesen, wird dreist, zudringlich und unverschämt, während die Rike in der Regel sanftmüthig bleibt.
»Einer meiner Brüder«, sagt Dietrich aus dem Winckell, »besaß eine gezähmte Rike, welche sich in der menschlichen Gesellschaft fast am besten zu gefallen schien. Oft lag sie zu unseren Füßen, und gern machte sie sich die Erlaubnis zu Nutze, auf dem Sofa an der Seite meiner Schwägerin zu ruhen. Hund und Katze waren ihre Gespielen. Fand sie sich von ihnen beleidigt, so wurden sie durch tüchtige Schläge mit den Läufen hart bestraft. Die liebe Rike ging mit uns oder auch für sich allein im Freien spazieren. Zur Brunstzeit blieb sie gewöhnlich, kurze Besuche abgerechnet, welche sie ihrem Wohlthäter abzustatten nicht vergaß, einige Tage und Nächte hindurch im Walde, kam dann, wenn sie sich hochbeschlagen fühlte, nach Hause und setzte zur gehörigen Zeit. Die Kälber aber, mit der Muttermilch dieses zahmen Rehes genährt, blieben wild und wurden deshalb im folgenden Oktober ausgesetzt. Sogar während der Brunstzeit verließ unsere Rike, wenn sie von ihrem Herrn beim Namen gerufen war, den Bock und folgte dem Gebieter bis ans Ende des Waldes; hier aber trennte sie sich von ihm und gab dem Gatten den gewöhnlichen Ruf, ein Zeichen zur Annäherung.«
Das Benehmen gezähmter Böcke ist regelmäßig ein anderes als der Riken. Die ihnen angeborne Furchtsamkeit wird durch Gewohnheit abgestumpft; sie kennen den Menschen und wissen, daß weder er noch die Hunde ihnen etwas thun dürfen, und zeigen sich dann nicht bloß anmaßend, sondern werden sogar gefährlich. Ein junger Rehbock, welchen der meinem Vater befreundete Oberförster Heerwart hielt, hatte sich in den Kopf gesetzt, daß die Hundehütte für ihn ein ganz bequemes Lager wäre, und ging, so oft es ihm einfiel, da hinein. Wenn nun der bereits erwähnte Hund Basko gerade in der Hütte lag, schlug er mit seinen Vorderläufen kühn auf den gewaltigen Feind seines Geschlechtes los, bis dieser mit eingeklemmtem Schwanze die Hütte verließ und dem übermüthigen Gesellen Platz machte. Der vortreffliche Hund wußte recht wohl, daß er dem Liebling seines Herrn nichts abschlagen durfte, und ließ sich von ihm in wirklich lächerlicher Weise beherrschen. Aeltere Böcke dürfen unter keiner Bedingung als Spielgenossen von Kindern angesehen werden. Sie fürchten sich nicht einmal vor erwachsenen Männern, geschweige denn vor Frauen und Kindern, nehmen bei der unbedeutendsten Veranlassung eine drohende Miene an, gehen auf denjenigen, welcher sie beleidigte oder auch nicht beleidigte, mit niedergebogenem Gehörn los und wissen dieses so kräftig zu gebrauchen, daß selbst starke Männer ihrer kaum sich erwehren, Frauen und Kinder aber durch sie ernstlich gefährdet, schwer verletzt und selbst getödtet werden können.
In Südamerika leben mehrere kleine Hirsche, welche ebenfalls eine besondere Untersippe bilden, weil das Geweih der Böcke nur aus zwei einfachen Stangen besteht, und sie auch durch anderweitige Merkmale von den übrigen Hirschen sich unterscheiden. Sie heißen Spießhirsche ( Subulo) und kennzeichnen sich durch geringe Größe, schlanken Bau, das aus zwei kurzen, oft bis auf kleine Spitzen verkümmerten, an der Wurzel ziemlich dicken, allmählich sich verschmächtigenden und in eine scharfe Spitze auslaufenden, eine mit runzeligen Furchen durchzogene Oberfläche zeigenden, schief nach oben und rückwärts, auch fast gleichlaufend neben einander stehenden Spießen bestehende Geweih, durch ziemlich langen, stark behaarten Schwanz, kleine Thränengruben, einen Haarschopf auf der Stirne und einen Haarpinsel an der innern Seite der Ferse. Eckzähne sind bei beiden Geschlechtern in der Jugend vorhanden, verschwinden jedoch später vollständig.
Der Rothspießhirsch oder Guasupita ( Cervus rufus, Subulo rufus, C. simplicicornis und dolichurus), die größte Art der Gruppe, übertrifft unser Reh an Schwere und erreicht fast die Größe eines Schmalthieres des Damwildes; seine Länge beträgt 1,1 Meter, die Schwanzlänge 10-11 Centimeter, die Höhe des Spießes 7 Centim., die Höhe am Widerrist 60 Centim. Der Leib ist gestreckt, der Hals kurz und schlank, der Kopf kurz, vorn sehr schmal, die Ohren sind ziemlich groß, aber nicht besonders lang, die Augen klein und lebhaft, die Thränengruben kaum bemerkbar, die Läufe hoch, schlank und äußerst zierlich gebaut. Die glatt und dicht anliegende Behaarung erinnert hinsichtlich ihrer Beschaffenheit an die unseres Rehes. An dem Kopfe und an den Läufen ist sie sehr kurz, sonst ziemlich reichlich; längs der Mitte des Vorderkopfes erhebt sie sich mähnenartig. Ihre Gesammtfärbung ist ein gelbliches Braungrau, welches auf der Gegend zwischen den Augen, Stirne und Scheitel in Dunkelbraungrau, auf der Unterseite des Halses, der Brust und dem Bauche in Grau übergeht. Die Innenseite der Läufe ist weiß, der Schwanz auf der Oberseite bräunlich gelbroth, unterseits weiß.
Die Spießhirsche bewohnen in ziemlicher Anzahl Guayana, Brasilien, Peru und Paraguay. Sie leben in Ebenen wie im Gebirge, unsere Art steigt sogar bis zu 5000 Meter über den Meeresspiegel empor. Möglicherweise findet sich dieser Hirsch auch in Mejiko. Wälder aller Art und niedere Gebüsche bilden seinen Aufenthalt. In niederen Gegenden bevorzugt er die schattigen, dichten Urwaldungen, in den Hochländern die einzeln stehenden Gebüsche; das Feld meidet er. Bei Tage liegt er ruhend im dichten Gebüsch; mit Sonnenuntergang begibt er sich an den Saum der Wälder, um dort sich zu äsen. Pflanzungen in der Nähe werden besucht und gebrandschatzt; sonst begnügt er sich mit der Aesung, welche im Walde wächst. Auf den angebauten Stellen geht er hauptsächlich die jungen Schößlinge der Melonen, den aufkeimenden Mais, den jungen Kohl und vor allem die Bohnen an. So zieht er hin und her bis zur Morgendämmerung, mit welcher er wieder in den Wald zurückkehrt.
Man trifft ihn immer einzeln und paarweise, nie aber in Rudeln an. Beide Geschlechter halten treu zusammen und leiten und führen dann auch die Jungen gemeinschaftlich. Die Rike wirft gewöhnlich nur ein Junges, meistens im December oder Januar. Das Kalb folgt der Mutter schon in den ersten drei bis fünf Tagen seines Lebens auf allen ihren Wegen nach, anfangs neben ihr hertrollend, später aber ihr vorausgehend. Droht Gefahr, so versteckt es sich im Gebüsche, und die Mutter entflieht.
Alle Spießhirscharten sollen furchtsam sein. Wenn sie zur Aesung ziehen, treten sie zuerst immer nur mit halbem Leibe aus dem Walde hervor, sehen sich nach allen Seiten um, thun einige Schritte vorwärts und bleiben wieder stehen, um die Gegend auszukundschaften. Bemerken sie einen Feind in der Nähe, so fliehen sie in den Wald; ist der Gegenstand ihrer Furcht entfernter, so betrachten sie ihn erst neugierig eine Zeitlang, ehe sie die Flucht ergreifen. Ihre Bewegungen sind schnell, aber nicht ausdauernd; man kann sie daher leicht mit guten Pferden müde machen, einholen und vermittels der Wurfkugeln in seine Gewalt bekommen. Gute Hunde kommen auch dem kräftigsten Hirsche in nicht zu dichtem Walde binnen einer halben Stunde nach.
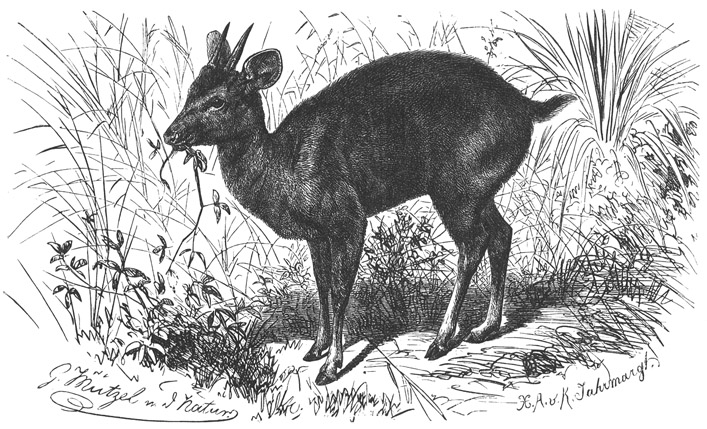
Rothspießhirsch ( Cervus rufus). 1/10 natürl. Größe.
Die Landleute fangen nicht selten die Kälber, um sie zu zähmen. Man muß sie aber angebunden oder im Hofe eingeschlossen halten, weil sie sonst häufig Schaden in den Pflanzungen anrichten. So lange sie jung sind, betragen sie sich zutraulich und zahm, älter geworden, werden sie bösartig wie alle ihre Verwandten; denn nicht bloß die Hirsche, sondern auch die Thiere gehen auf den Mann. Jung eingefangene Spießhirsche halten sich anfänglich gern an ihr Haus, entfernen sich aber späterhin immer mehr von der Wohnung, und bleiben schließlich gänzlich weg, wenn sie auch ihren alten Aufenthaltsort nicht völlig vergessen. Rengger sah einen, welcher zehn Monate früher entflohen war, in seiner heimatlichen Wohnung Schutz suchen, als er von einigen Hunden verfolgt wurde. Ein Thier, welches ich geraume Zeit pflegte, war ein überaus anmuthiges, liebenswürdiges Geschöpf. Wahrscheinlich hatte es von Jugend auf in Gesellschaft des Menschen gelebt, bewies diesem wenigstens Vertrauen und Anhänglichkeit. Ich durfte es berühren, streicheln, vom Boden aufheben, wegtragen, ohne daß es auch nur einen Versuch zur Flucht, zum Widerstande machte. Ihm gespendete Liebkosungen erwiderte es durch Belecken der ihm schmeichelnden Hand oder des Gesichtes seiner Freunde. Mit anderen Hirschen vertrug es sich ausgezeichnet; ich habe es überhaupt nur als ein friedfertiges, sanftes, ja zärtliches Wesen kennen gelernt. Das rauhe Klima Norddeutschlands behagte ihm wenig, doch zeigte es sich minder frostig, als ich erwartet hatte. Regen fürchtete es nicht, ließ sich vielmehr öfters tüchtig einnässen. Dagegen suhlte es sich nie; schmutzige Feuchtigkeit schien ihm verhaßt zu sein. Scharfe Winde mied es ängstlich, und vor ihnen suchte es stets im Innern seines Stalles Schutz. Von den in seinem Gehege wachsenden Gräsern nahm es nur selten ein Hälmchen an; es bevorzugte trockene Aesung und, wohl infolge der Angewöhnung, vor allem Brod und Zwieback.
Die Jagd der Spießhirsche ist sehr einfach. Man hetzt sie mit Hunden oder schießt sie auf dem Anstande, welcher dem Jäger den meisten Erfolg verspricht. Außer dem Menschen stellen die großen Katzenarten den erwachsenen und kleinen, sowie die wilden Hunde den jungen Spießhirschen eifrig nach. Das Fell wird höchstens zu Satteldecken benutzt, das Wildpret gern gegessen.
Zum Schluß werfen wir noch einen Blick auf die Gruppe der Muntjakhirsche ( Cervulus, Stylocercus und Prox), welche sich durch ihre geringe Größe, das sehr kurze, unvollkommene Geweih, die auffallend großen Eckzähne, die tieferen und breiten Thränengruben und den Mangel der Haarbürste an den Hinterfüßen kennzeichnen. Die hierher gehörigen Arten bewohnen Indien und die Sundainseln.
Der Muntjak oder Kidang ( Cervulus Muntjac, Cervus Muntjac, moschatus und subcornutus, Prox und Stylocercus Muntjac), die bekannteste Art dieser Gruppe, erreicht etwa die Größe unseres Rehbocks; seine Länge beträgt 1,2 Meter, seine Höhe am Widerrist 65 Centim. Die Geweihstangen des Männchens sitzen auf sehr langen Rosenstöcken, sind schräg nach rückwärts gerichtet, biegen sich anfangs etwas nach außen und vorwärts und krümmen sich dann plötzlich gegen die Spitze hakenförmig nach rück- und einwärts. Zuerst sind sie nur einfach, später erhalten sie einen kurzen, starken, spitzigen, nach vor- und aufwärts gerichteten Augensproß. Sehr eigenthümlich sind die Rosenstöcke, welche ziemlich nahe aneinander stehen, sich aber bald von einander entfernen, etwa 8 Centim. hoch aufsteigen, bis zur Rose von einer dicht behaarten Haut, welche längs der Rosenkante einen büschelförmigen Haarwuchs trägt, überdeckt werden und mit einer sehr niederen, aus einer einfachen Reihe großer Perlen gebildeten Rose endigen. Mit zunehmendem Alter wird der Rosenstock stärker, wie sich auch die Anzahl der Perlen an ihm vermehrt. An den Stangen selbst sieht man wohl tiefe Längsfurchen, aber keine Perlen. Im übrigen ist der Muntjak ein ziemlich schlank gebauter, kräftiger Hirsch von gedrungenem Leibe, mit mittellangem Halse, kurzem Kopfe, hohen und schlanken Läufen und einem kurzen, flockig behaarten Wedel. Die Behaarung ist kurz, glatt und dicht, das Haar dünn, glänzend und spröde, die Färbung auf der Oberseite gesättigt gelbbraun, nach der Mitte des Rückens dunkler, bis ins Kastanienbraune, am Hinterhalse mehr zimmetbraun, an der Schnauze gelbbraun, längs der Vorderseite der Rosenstöcke dunkelbraun gestreift, auf der Außenseite der Ohren dunkelgelbbraun; auf der Innenseite derselben wie am Kinne, der Kehle, am Hinterbauche und den Innenseiten der Beine, den Hinterbacken und dem unteren Theil des Schwanzes weiß; Vorderbauch und Brust sind gelblicher, zu beiden Seiten weiß gefleckt, die Vorderläufe dunkelbraun, am Rande der Schienbeine weiß, hinten schwarz gestreift; über den schwarzen Hufen liegt ein kleiner weißer Fleck. Das Geweih ist weißlich, etwas ins Gelbliche ziehend. Abänderungen kommen häufig vor.
Sumatra, Java, Borneo und Banka sowie die Malaiische Halbinsel bilden die Heimat des Muntjak. Laut Horsfield erwählt er sich zu seinem Aufenthalte gewisse Gegenden, an welche er dann so große Anhänglichkeit zeigt, daß er sie freiwillig niemals verläßt. Mancher Ort ist als bevorzugter Stand unseres Hirsches seit Menschengedenken bekannt. Nicht allzu hoch gelegene Gegenden, in denen Hügel und Thäler abwechseln, und noch mehr solche, welche sich an den Fuß der höheren Gebirge anlehnen oder größeren Wäldern nähern, scheinen alle diesem Wilde zusagende Bedingungen in sich zu vereinigen. Auf Java sind so beschaffene Standorte sehr gewöhnlich; dort deckt sie ein langes Gras und Sträucher und Bäume von mittlerer Höhe, welche in Gruppen zusammentreten oder kleine Dickichte bilden und nur durch schmale Streifen angebauten Bodens unterbrochen werden oder in die tieferen Wälder übergehen. Hier trifft man den Muntjak zu zweien, außer der Brunstzeit aber auch in kleinen Familien an. An solchen Stellen, welche außerdem reich an Wasser, aber arm an Menschen sind, findet unser Hirsch alles ihm nöthige im Ueberflusse vor und lebt hier in höchst angenehmer Weise, fast unbehelligt von seinem Erzfeinde. Im übrigen ist noch wenig über seine Lebensweise bekannt. Man weiß bloß, daß seine Brunstzeit in die Monate März und April fällt, und daß dann die während des übrigen Jahres einzeln umherstreifenden Böcke die Riken in den Dickichten aufsuchen, beschlagen, eine Zeit mit ihnen vereinigt leben und sie dann wieder verlassen. Ueber die Dauer der Trächtigkeit und die Zeit des Satzes mangeln Beobachtungen; man kennt auch noch nicht die Zeit, in welcher der junge Bock zum erstenmale aufsetzt.

Muntjak ( Cervulus Muntjac). 1/12 natürl. Größe.
Mehr haben wir, dank den genauen Berichten des genannten gelehrten Reisenden, über die Jagd erfahren. Die Eingeborenen, welche die in jener Gegend zerstreuten Weiler und Dörfer bewohnen, geben sich nicht viel mit der Jagd des Kidang ab, umsomehr aber finden die Vornehmen des Landes ein Vergnügen an derselben. Der Kidang hinterläßt eine sehr spürbare Fährte und wird deshalb von den Hunden leicht und sicher ausgenommen. Wenn er sich verfolgt sieht, geht er nicht, wie der Hirsch, in die Weite, sondern läuft anfangs so schnell als möglich, bald aber langsamer und vorsichtiger in einem großen Bogen fort, sobald als möglich wieder nach seinen ursprünglichen Standorte sich wendend. Die Eingeborenen, welche alle Sitten des Thieres gut kennen, behaupten, daß der Muutjak ein kraftloses und faules Geschöpf ist. Wenn man ihn einige Male im Kreise umhergetrieben hat und die Verfolgung fortführt, soll er seinen Kopf in einem dicken Busche verbergen und in dieser Stellung fest und bewegungslos verweilen, ohne der Annäherung des Jägers Beachtung zu schenken, gleichsam als fühle er sich hier in vollständiger Sicherheit. Gelingt es dem Jäger nicht, ihn am ersten Tage zu erbeuten, so braucht er nur am nächstfolgenden dahin zurückzukehren, wo er ihn zuerst auftrieb; er findet ihn dann sicher an derselben Stelle.
Viele der reichen Gewalthaber halten bloß zum Zwecke dieser Jagd starke Meuten von Hunden, welche regelrecht abgerichtet werden. Diese, gemeiniglich mit dem Namen Pariahunde belegt, stammen von der eingeborenen Art her, welche die Insel bewohnt, und leben eigentlich in einem Zustande unvollkommener Zähmung. Ihr Leib ist mager und ihr Gehör aufgerichtet; sie sind wild und heftig, ihrem Herrn selten besonders zugethan, werden auch von den Eingebornen wie von den übrigen Muhammedanern wenig geachtet und oft nicht gut behandelt. Meistens schlecht gezogen, ekeln sie die Europäer an; aber sie sind sehr feurig, muthig und zum Zwecke der Jagd unübertrefflich. Sobald sie die Spur des Wildes gefunden haben, nehmen sie hitzig die Verfolgung auf, und der Jäger kann ihnen dann langsam folgen; denn gewöhnlich kommt er noch rechtzeitig zur Stelle, wo Hunde und Hirsch mit einander im Kampfe liegen. Der Muntjak ist ein sehr muthiger Gesell und versteht sein kleines Geweih mit Kraft und Geschicklichkeit zu gebrauchen. Viele Hunde werden verwundet, wenn sie ihn angreifen, und manche tragen auf Nacken und Brust oder am Unterleibe Verletzungen davon, welche ihnen das Leben kosten. Aber der Hirsch, welcher kein zähes Leben hat, unterliegt zuletzt doch den vereinigten Angriffen der Hunde, oder wenn nicht, sicher einem Schusse des Meutenführers.
In Banka hängt man zwischen zwei nahe stehende Bäume Schlingen und zäunt von den Bäumen aus in schiefer Richtung zwei Wände, welche mehr und mehr sich verbreitern. Mit Hilfe der Hunde treibt man den Kidang da hinein und regelmäßig auch in die tückisch gelegten Schlingen zwischen den Bäumen, welche ihm Ausweg und Rettung zu gewähren scheinen. Außer dem Menschen stellen unserem Hirsche Tiger und Panther eifrig nach. Doch das milde Klima mit seinem Reichthum an Nahrung sagt ihm so außerordentlich zu, daß alle Verluste, welche Mensch und Raubthier seinem Bestande bringen, schnell gedeckt werden.
Die Gefangenschaft hält der Kidang in seinem Vaterlande sehr gut und auch in Europa recht leidlich aus. Man findet ihn oft im Besitze der Europäer und Eingebornen; doch verlangt er, wenn er sich wohl befinden soll, einen weiten Raum und ausgewähltes Futter. Im allgemeinen zuthunlich und anhänglich an seinen Pfleger, ist er doch ein echter Hirsch, jähzornig, leicht reizbar und dann boshaft wie seine Verwandten. Bei der Vertheidigung wie beim Angriffe gebraucht er nicht allein das Geweih, sondern auch seine Zähne, fährt, laut Schmidt, wie ein bissiger Hund aus den Gegner los und bringt diesem unter Umständen wenn auch nicht gefährliche, so doch schmerzhafte Wunden bei. Wahrscheinlich verfährt er bei Kämpfen mit Nebenbuhlern ebenso.
Das Wildpret des Kidang wird gern von den Europäern gegessen; die Eingebornen aber genießen es nur dann, wenn es vom Bocke herrührt, weil gewisse Eigenheiten in den Sitten der Weibchen ihnen Abscheu vor diesen beigebracht haben; auch glauben sie wohl, daß der Genuß ihnen Krankheiten erzeuge und dergleichen mehr. Die Decke findet keine Verwendung.