
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die zweite Hauptabtheilung der Wiederkäuer wird gebildet durch die Hornthiere ( Cavicornia), welche nach ziemlich übereinstimmender Ansicht der Forscher eine einzige, jedoch in drei, wie andere wollen, in vier Unterfamilien getrennte, nach außen wohl abgegrenzte Familie bilden. So nahe verwandt die Hirsche den horn- oder scheidenhörnigen Thieren auch zu sein scheinen, so bestimmt unterscheiden sie sich, wie bereits in der Einleitung bemerkt, durch die Gestalt und Beschaffenheit sowie den Bildungshergang ihrer Gehörne, weil deren Entwickelung und Weiterbildung eine stetig fortschreitende ist. »Die Hornthiere«, sagt Blasius klar und verständlich, »haben keilförmig sich verschmälernde Stirnzapfen, welche von der Hornscheide dauernd umschlossen bleiben; der Knochenzapfen wächst vom Grunde aus ununterbrochen nach und dehnt sich dadurch in die Länge, an der Wurzel auch in die Dicke aus. Beim Fortwachsen entwickelt sich auf diesem Knochenzapfen der ganzen Länge nach ununterbrochen neue Hornmasse, für welche die alte vorhandene fortwährend eine fest umschließende Scheide bildet. Auch bei den Scheidenhörnern wird durch die neugebildete Hornmasse die vorhandene ältere vom knöchernen Stirnzapfen getrennt, aber nicht wie bei den Hirschen mechanisch abgeworfen, indem die kegelförmige Gestalt der Berührungsfläche und die feste Umhüllung der alten Hornscheide das Abfallen verhindern. Eine Wiederkehr nach gewissen Zeiträumen, wie bei den Hirschen, scheint auf den ersten Blick nicht zu bestehen; doch zeigt jeder Jahreszuwachs eine schärfere Abschnürung auch äußerlich am Horne durch wellenförmige Verengung und sogar durch mechanische, oft tief in die Hornmasse eindringende Ablösung der Schichten verschiedenen Alters. Auch ist nicht zu verkennen, daß der Grad des Wachsthums der Hornmasse nicht im Verlaufe des ganzen Jahres ein gleichmäßiger ist. Der Jahreszuwachs nach dem Alter ist ebenfalls abwechselnd; die Länge der neu hinzutretenden Jahresringe wird mit dem Alter immer kleiner.« Zur anderweitigen Kennzeichnung der Familie mag dienen, daß alle zu ihr gehörigen Thiere nur im Unterkiefer Schneidezähne haben, acht an der Zahl, oder, wie andere wollen, sechs Schneide- und zwei Eckzähne, und außerdem in jedem Kiefer oben und unten sechs Mahl- oder Backenzähne besitzen, daß ferner die Schädelknochen an den Kopfseiten vor dem Auge dicht und undurchbrochen sind, der Huf ziemlich plump und breiter als die Dicke der Zehen ist, die Behaarung gleichmäßiger als bei den Hirschen zu sein pflegt und Haarwülste an den Hinterläufen nicht oder doch nur ausnahmsweise vorhanden sind.
Abgesehen von dem Gebiß und dem Gehörn läßt sich übrigens etwas allgemein gültiges von den Hornthieren nicht sagen. Ihr Leibesbau ist außerordentlich verschieden, da die Familie ebensowohl plumpe und massige wie überaus leichte und zierliche Gestalten aufweist. Die Gestalt der Hörner und der Hufe, die Länge des Schwanzes, Haarkleid und Färbung schwanken in weiten Grenzen; Thränengruben sind vorhanden oder fehlen; die Nasenspitze ist behaart oder nackt: kurz es ergeben sich bei genauer Betrachtung der hierher zu zählenden Thiere die verschiedensten und durchgreifendsten Unterschiede.
Wie die äußere Gestalt, ändert auch die Lebensweise der Hornthiere mannigfaltig ab. Fast über die ganze Erde sich verbreitend, bewohnen sie in vielen Arten alle Gürtel der Breite und Höhe und alle Gebiete oder Gefilde, von der öden Wüste an bis zu dem in tropischer Fülle prangenden Walde, von der sumpfigen Ebene an bis zu den gletscherbedeckten Gebirgen hinauf. Weitaus die meisten leben gesellig, nicht wenige in starken Herden, einige wenigstens zeitweilig in Scharen, welche höchstens noch von den durch Nager gebildeten übertroffen werden können. Entsprechend ihrer verschiedenen Gestalt bewegen sich die einen plump und schwerfällig, die anderen im höchsten Grade behend und gewandt, und im Einklange mit ihren Aufenthaltsorten schwimmen einzelne ebenso gut, als andere klettern. Fast ausnahmslos sind auch die höheren Begabungen wohl entwickelt: die Hornthiere zeichnen sich durch scharfe Sinne, nicht wenige durch Verstand aus, obwohl gerade unter diesen Thieren auch geistig sehr wenig befähigte Mitglieder gefunden werden. Ihre Vermehrung ist eine erhebliche, obschon sie meistens nur ein einziges, seltener zwei, in Ausnahmsfällen drei und höchstens vier Junge gleichzeitig zur Welt bringen. Letztere unterscheiden sich in ihrer Entwickelung wie in ihrem Wachsthume nicht von denen anderer Wiederkäuer. Sie kommen in sehr ausgebildetem Zustande zur Welt und sind bereits nach wenigen Stunden, spätestens nach einigen Tagen im Stande, ihren Eltern auf allen, oft den gefährlichsten und halsbrechendsten Wegen zu folgen. Bei vielen Arten währt das Wachsthum mehrere Jahre, bei den meisten sind die Jungen bereits nach Ablauf des ersten Lebensjahres wieder fortpflanzungsfähig, und gerade hierdurch erklärt sich das verhältnismäßig außerordentlich rasche Anwachsen eines Trupps oder einer Herde dieser Thiere.
Für den Menschen haben die Hornthiere eine viel höhere und wichtigere Bedeutung als alle übrigen Wiederkäuer, mit alleiniger Ausnahme der Kamele. Ihnen entnahmen unsere Vorfahren die für die Menschheit wichtigsten Nähr- und Nutzthiere; ihnen danken wir einen wesentlichen Theil unserer regelmäßigen Nahrung wie unserer Kleiderstoffe; ohne sie würden wir gegenwärtig nicht mehr im Stande sein, zu leben. Auch die noch ungebändigten, unbeschränkter Freiheit sich erfreuenden Arten der Familie sind durchgehends mehr nützlich als schädlich, da ihre Eingriffe in das, was wir unser Besitzthum nennen, uns nicht so empfindlich treffen wie das Gebaren anderer großer Thiere, und sie durch ihr fast ausnahmslos schmackhaftes Wildpret, durch Fell, Haare und Horn den von ihnen dann und wann angerichteten Schaden wenigstens so ziemlich wieder aufwiegen, im großen ganzen sogar überbieten. Fast sämmtliche wildlebende Hornthiere zählen zum Wilde, nicht wenige von ihnen zu Jagdthieren, welche der Weidmann den Hirschen als vollkommen ebenbürtig an die Seite stellt. Außer dem Menschen hängen sich viele andere Feinde an die Fährte der Scheidenhörner; mehr noch aber als alle Gegner zusammengenommen beschränken Mangel, Hunger und infolge dessen sich einstellende Seuchen ihre Vermehrung.
Unter den Hornthieren stellen wir die Antilopen, welche eine besondere Unterfamilie ( Antilopina ) bilden, obenan. Die Abtheilung enthält die meisten Arten der Gesammtheit und begreift in sich die zierlichsten und anmuthigsten Hornthiere überhaupt. Jedoch läßt sich dies nur im allgemeinen sagen; denn gerade unter den Antilopen gibt es einige, welche dem von uns gemeiniglich mit dem Namen verbundenen Begriffe wenig entsprechen. Die Abtheilung wiederholt im großen und ganzen das Gepräge der Gesammtheit; es finden sich in ihr die schlankesten und zierlichsten aller hohlhörnigen Thiere und ebenso plumpe, schwerfällige Geschöpfe, welche man auf den ersten Blick hin eher zu den Rindern als zu ihnen zählen möchte. Aus diesem Grunde verursacht ihre allgemeine Kennzeichnung ebenso erhebliche Schwierigkeiten wie die der ganzen Familie, und auch die Abgrenzung der Gruppe ist keineswegs leicht, da einzelne Antilopen anscheinend weit mehr mit den Rindern und Ziegen übereinstimmen als mit dem Urbilde, als welches wir die schon seit den ältesten Zeiten hochberühmte Gazelle anzusehen haben.
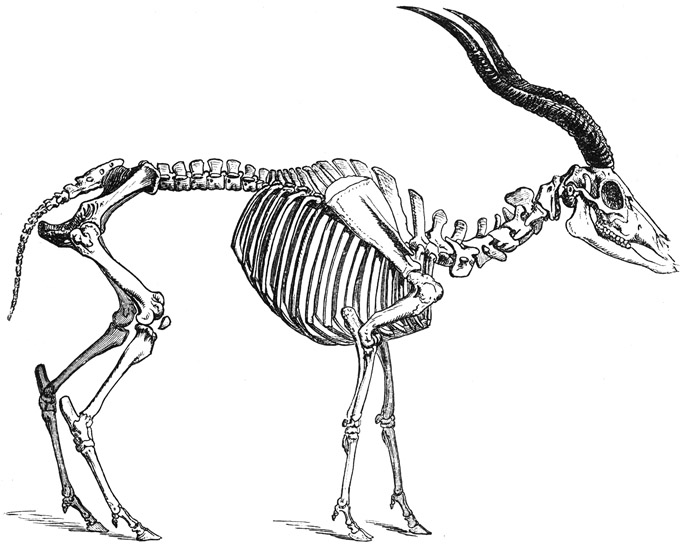
Geripp der Mendesantilope. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
Im allgemeinen kann man die Antilopen als schlankgebaute, hirschähnliche Thiere mit kurzem, fast immer eng anliegendem Haarkleide und mehr oder minder gewundenem Gehörn bezeichnen, welches zumeist beiden Geschlechtern zukommt. Die verschiedenen Arten ähneln sich im ganzen außerordentlich, und nur die Bildung der Hörner, der Hufe und des Schwanzes sowie einzelne Abänderungen des Haarkleides geben sichere Unterscheidungsmerkmale. Aber die Anzahl der Antilopen ist so groß, daß die Grenzglieder der Reihe kaum noch Aehnlichkeit mit einander zu haben scheinen; denn mit der großen Artenzahl geht natürlich die Verschiedenheit der Gestaltung Hand in Hand, und deshalb übertrifft die Familie an Mannigfaltigkeit alle übrigen der Ordnung. Es finden sich Anklänge an die plumpen Rinder wie an die zierlichen Rehe, an die kleinen zarten Moschusthiere wie an die Pferde. Der gewöhnlich kurze Schwanz verlängert sich wie bei den Rindern oder ähnelt dem mancher Hirsche. Am Halse bildet sich eine kleine Mähne; um den Mund herum verlängern sich eigenthümlich die Haare, so daß sie fast einen Bart bilden, wie bei den Ziegen. Die Hörner biegen sich gleichmäßig oder winden und drehen sich in dreifachen Bögen; ihre Spitze krümmt sich nach hinten oder nach vorn, nach innen oder nach außen; das ganze Gehörn erscheint leierartig oder die einzelne Stange wie eine gewundene Schraube oder auch wieder ganz gerade, wenigstens nur unbedeutend gekrümmt. Bald ist es rund, bald gekantet, bald gekielt, bald zusammengepreßt; die Querrunzeln, welche das Wachsthum bezeichnen, sind im allgemeinen deutlich, aber auch nur angedeutet etc. Bei einer Sippe besteht das Gehörn sogar aus vier Stangen.
Der innere Leibesbau der Antilopen, über welchen wenig eingehende Beobachtungen gemacht worden sind, entspricht ziemlich dem der Hirsche. Die Weibchen haben regelmäßig zwei oder vier Zitzen am Euter. Sie werfen gewöhnlich nur ein Junges, selten zwei, und tragen dasselbe in durchschnittlich neun Monaten aus. Das Kalb ist nach vierzehn bis achtzehn Monaten erwachsen, wenn auch nicht immer zeugungsfähig.
Ganz Afrika, Süd-, West- und Mittelasien, Süd- und Mitteleuropa sind die Heimat der Antilopen. Jede Art scheint ein bestimmtes Lieblingsfutter zu haben, und dieses ihren Aufenthalt zu bedingen, so lange der Mensch nicht eingreift und die scheuen und flüchtigen Thiere in andere Gegenden treibt. Die meisten lieben die Ebene, einige aber ziehen das Hochgebirge entschieden der Tiefe vor und steigen bis zur Grenze des ewigen Schnees empor; diese bewohnen offene, spärlich mit Pflanzen bewachsene Gegenden, jene finden sich in dünn bestandenen Buschwäldern, einzelne auch in den dichtesten Waldungen, einige sogar in Sümpfen und Brüchen. Die größeren Arten schlagen sich in Trupps oder Rudel, oft in solche von außerordentlicher Stärke; die kleineren leben mehr paarweise oder wenigstens in minder zahlreicheren Gesellschaften. Sie sind Tag- und Nachtthiere, unterscheiden sich also auch hierdurch von den Hirschen, welche sich, wie bekannt, zur Nachtzeit äsen und umhertummeln, bei Tage aber sich lagern und schlafen. Ihre Bewegungen sind meist lebhaft und behend, auch ungemein zierlich. Die Schnelligkeit mancher Arten wird von keinem andern Säugethiere übertroffen, die Anmuth ihres Wesens von keinem erreicht. Luft, Licht und ungemessene Freiheit lieben sie über alles; deshalb bevölkern gerade sie die arme Wüste, deshalb beleben sie die todte Einöde. Nur wenige Arten trollen plump und schwerfällig dahin und ermüden schon nach kurzer Verfolgung; die übrigen vergeistigen sich gleichsam während ihrer Bewegung. Sie besitzen sehr scharfe Sinne, äugen, vernehmen und wittern ausgezeichnet, sind lecker und empfindlich für äußere Einflüsse. Ihr Verstand ist nicht besonders, aber doch mehr als bei anderen Familien der Ordnung entwickelt. Neugierig, munter, heiter und neckisch wie die Ziegen, benutzen sie gemachte Erfahrungen, stellen Wachen aus, wenn sie Verfolgungen erlitten haben, und werden dann in hohem Grade scheu. Viele zeichnen sich durch Friedfertigkeit aus, andere können recht bösartig sein. Ihre blökende, stöhnende oder pfeifende Stimme hört man selten, gewöhnlich bloß zur Brunstzeit, wenn die Böcke und Ziegen mit einander sich streiten.
Die Nahrung besteht nur in Pflanzenstoffen, hauptsächlich in Gräsern und Kräutern, in Blättern, Knospen und jungen Trieben. Einigen muß die dürftigste Aesung genügen, andere zeigen sich ungemein wählerisch und genießen nur die saftigsten und leckersten Pflanzen. Bei frischem grünem Futter können die meisten lange dürsten, die in der dürren Wüste lebenden sogar tage- und wochenlang Wasser vollständig entbehren.
Man darf die Antilopen nützliche Thiere nennen und braucht kaum eine Ausnahme zu machen. An den Orten, wo sie leben, bringen sie selten erheblichen Schaden; Wohl aber nützen sie durch ihr Fleisch, durch ihr Gehörn und durch ihr vortreffliches Fell. Sie sind deshalb ein Gegenstand der eifrigsten Jagd bei allen Völkern, welche mit ihnen die gleiche Heimat theilen. Noch größer aber dürfte der Nutzen sein, den sie dem Menschen gewähren durch die Freude an ihrer Schönheit, Anmuth und Liebenswürdigkeit und durch das außerordentliche Vergnügen, welches ihre Jagd bereitet. Manche seit uralter Zeit hochberühmte Antilopen sind von Dichtern und Reisenden laut gepriesen worden, wegen anderer setzt der Alpenjäger hundertmal sein Leben ein. In derselben Weise fühlt sich der Mensch zu allen übrigen Antilopen hingezogen. Dazu kommt noch, daß die meisten, wenigstens in ihrem Vaterlande, die Gefangenschaft leicht und dauernd aushalten, sich in derselben fortpflanzen und ihren Pfleger durch Zahmheit und Zutraulichkeit erfreuen. Manche werden förmlich zu Hausthieren und sind in früherer Zeit buchstäblich als solche betrachtet und behandelt worden.
So weit Geschichte und Sage zurückreichen, thun beide einzelner Antilopen Erwähnung. »Eine nicht unerhebliche Anzahl von Arten«, schreibt mir mein gelehrter Freund Dümichen, »begegnen uns in den Abbildungen auf den altegyptischen Denkmälern und zwar vorzugsweise an den Wänden von Giseh, Sakhara, Theben, Beni-Hassan und El-Kab. Am häufigsten und in einer wahrhaft entzückenden Anmuth ist das Bild der zierlichen Gazelle, zumal des jungen, an seinem noch wenig entwickelten Gehörn kenntlichen Thieres von den Altegyptern wiedergegeben worden. Ein paar Mal kommen auch die beiden Nebenarten gedachter, im Texte » Kahes« genannten Antilope, die aus Kleinasien und der arabischen Wüste stammende Isabellgazelle ( Antilope isabellina) und die Schwarznasengazelle ( Antilope arabica) unter den Bildern vor. Nicht minder häufig sieht man die Säbelantilope oder Steppenkuh ( Oryx leucoryx), hieroglyphisch » Mahet«, und die Mendesantilope ( Addax nasomaculata), hieroglyphisch » Nutu« genannt, bildlich dargestellt. Von anderen Gazellenarten kommen vor: der Tedal ( Antilope Soemmeringii), die Ledragazelle ( AntilopeDama), von anderen Oryxböcken die Beisa ( Oryx Beisa), von Wasserböcken die Defasaantilope ( Kobus Defasa) aus Habesch, der Wasserbock ( Kobus ellipsiprymnus), der Adjel ( Adenota leucotis) und der Abok ( Adenota megaceros) aus dem Gebiete des obern Weißen Nil, die Schimmelantilope ( Hippotragus leucophoeus) von ebendaher, von Kuhantilopen endlich der Korrigum ( Damalis senegalensis) und der Tetel ( Bosephalus bubalis), hieroglyphisch » Schesau« genannt, jene aus Sennâr, diese aus dem Steppengebiete unter dem Westabfalle des Abessinischen Hochlandes stammend.« Unter diesen Antilopen finden sich, wie ich hinzufügen will, mehrere Arten, über deren Vorkommen im Norden Afrikas uns erst die in die neueste Zeit fallenden Forschungen Heuglins und Schweinfurths unterrichtet haben, weil sie nur im eigentlichen Herzen Afrikas gefunden werden. Bis dahin also drangen, forschend und sammelnd, die Altegypter vor, um ihrer Neigung, allerhand auffallendes Gethier sich zu eigen zu machen, gerecht zu werden. »Die Antilopen«, fährt Dümichen fort, »wurden von den Altegyptern durch Pfeilschüsse erlegt. Auf den betreffenden Darstellungen erblicken wir den Jäger zumeist begleitet von dem in den Hieroglyphen » Tesem« genannten Windspiele der Wüste oder Steppe, dem Slugui der heutigen Araber, nicht selten aber auch gefolgt von dem Steppen- oder Hiänenhunde, welchen die alten Bewohner des Pharaonenlandes ebenso gut wie den Gepard zu zähmen und abzurichten verstanden. Zur Jagd der Wasserböcke bediente man sich der Wurfschlinge. Besondere Beachtung verdient, daß Gazellen, Säbel- und Mendesantilopen von den Altegyptern als Hausthiere gehalten wurden und zwar nicht bloß in einzelnen Stücken, sondern in großen Herden neben Rindern und Ziegen. In einem Grabe von Sakhara z. B. wird der Viehreichthum eines vornehmen Egypters angegeben auf 405 Rinder einer selten vorkommenden Rasse, 1225 Rinder und 1220 Kälber des Langhornschlages und 1138 Kälber des Kurzhornschlages, 1135 Gazellen, 1308 Säbel- und 1244 Mendesantilopen.
Es ist sehr schwer, die große Anzahl der Glieder unserer Familie in natürliche Gruppen zu ordnen. Gewöhnlich gründet man die Eintheilung auf ihre Ähnlichkeit mit Hirschen, Ziegen, Stieren etc.; doch genügt dies nicht, und so hat man bis jetzt immer noch das Gehörn als bestes Merkmal für eine übersichtliche Eintheilung und Einordnung beibehalten.
Wir heben bloß die wichtigsten Gestalten dieser reichsten Gruppe der Wiederkäuer hervor.
Die Reihe der von mir zur Besprechung erwählten Arten mag durch die Antilopen im engsten Sinne ( Antilope) eröffnet werden. Die unter diesem Namen aufgestellte, jedoch wiederum in mehrere Unterabtheilungen zerfällte Sippe kennzeichnet sich durch mittlere, unserem Rehe annähernd gleiche Größe, verlängerte, leierförmige oder schraubenartig gedrehte, in der Regel beiden Geschlechtern zukommende Hörner, große oder doch nur ausnahmsweise kleine Thränengruben, vorhandene Leistendrüsen und wenig ausgedehnte, vielmehr auf einen kleinen nackten Fleck an der Oberlippe beschränkte Muffel.
Hirschziegenantilopen ( Cervicapra) nennt man die Arten mit runden, auf- und rückwärts gerichteten, schraubenförmig gedrehten und geringelten, fast geraden Hörnern, welche aber bloß dem Männchen zukommen, kurzem und buschig behaartem Schwanze, großen, beweglichere Thränengruben und Drüsensäcken zwischen den Zehen und in den Weichen sowie Klauendrüsen. Das Weibchen besitzt zwei Zitzen.
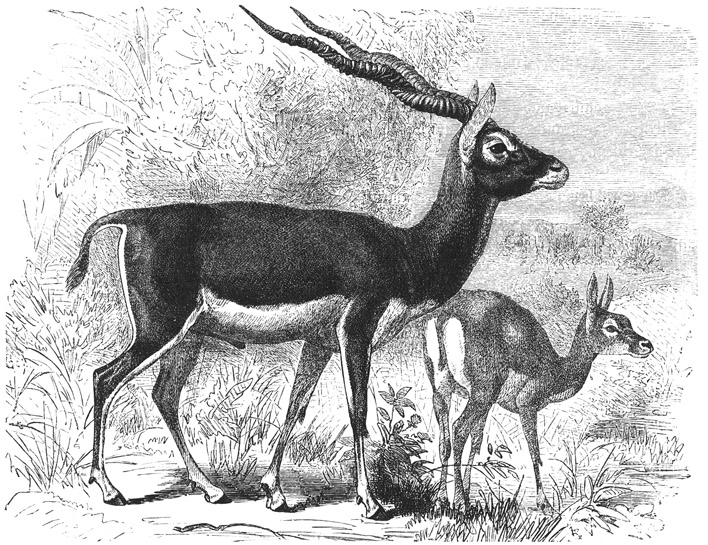
Hirschziegenantilope ( Antilope cervicapra). 1/10 natürl. Größe.
Die Hirschziegenantilope, Sassi und Sasin der Indier ( Antilope cervicapra, Capra cervicapra und bezoartica, Strepsiceros cervicapra, Cervicapra bezoartica, etc.), spielt in der indischen Götterlehre eine wichtige Rolle. Sie findet sich auf der Himmelskarte, gespannt vor den Wagen des Mondes, dargestellt als ein Pfeil der Götter, nimmt in dem Thierkreise der Hindus die Stelle des Steinbocks ein und ist neben vielen anderen Arten der Göttin Tschandra oder dem Monde geheiligt. Sie ist etwas kleiner, schlanker und weit zierlicher als unser Damhirsch; ihre Leibeslänge beträgt 1,3 Meter, die Länge des Schwanzes 15 Centim., die Höhe am Widerriste 80 Centim. Der Leib ist schwach gestreckt und untersetzt, der Rücken ziemlich gerade und hinten etwas höher als am Widerriste, der Hals schmächtig und seitlich zusammengedrückt, der Kopf ziemlich rund, hinten hoch, nach vorn zu verschmälert, an der Stirne breit, längs der Nase gerade und an der Schnauze gerundet. Die Beine sind hoch, schlank und dünn, die hinteren etwas länger als die vorderen. Unter den verhältnismäßig großen und außerordentlich lebhaften Augen befinden sich Thränengruben, eine Art von Tasche bildend, welche willkürlich geöffnet und geschlossen werden kann. Die Ohren sind groß und lang, unten geschlossen, in der Mitte ausgebreitet, gegen das Ende verschmälert und zugespitzt. Das Gehörn wird bis 40 Centim. lang, ist nach vorn und rückwärts gerichtet, fast gerade, jedoch mehrere Male schwach ausgebeugt und schraubenförmig gedreht. An der Wurzel stehen beide Stangen nahe zusammen, an der Spitze ungefähr 35 Centim. von einander entfernt. Je nach dem verschiedenen Alter sind die Hörner stärker oder schwächer und nahe der Wurzel mit mehr oder weniger ringförmigen Erhabenheiten versehen. Bei alten Thieren zählt man mehr als dreißig solcher Wachsthumsringe, bei dreijährigen ungefähr zehn, bei fünfjährigen bereits gegen fünfundzwanzig; ihre Anzahl steht aber nicht in einem geraden Verhältnisse zu dem Wachsthume. Die Behaarung ist kurz, dicht und glatt, das einzelne Haar ziemlich steif und, wie bei den meisten hirschähnlichen Thieren, etwas gedreht. Auf der Brust, an der Schulter und zwischen den Schenkeln bildet es deutliche Nähte, in der Horn- und Nabelgegend Wirbel, auf der Innenseite der Ohren vertheilt es sich in drei Längsreihen, am Handgelenke und an der Spitze des Schwanzes verlängert es sich zu kleinen Haarbüscheln, auf der Unterseite des letztern fehlt es gänzlich. Nach Alter und Geschlecht ist die Färbung eine verschiedene. Beim alten Bocke sind Vordergesicht, Hals, Rücken, Außenseite und ein bis auf die Fesselgelenke herabreichender, nach unten sich verschmälernder Streifen auf den Beinen dunkel braungrau, Stirn, Scheitel, Ohren, Nacken, Hinterhals und Hinterschenkel nebst Oberschwanz fahlgrau, der Vordertheil der Schnauze, ein Ring ums Auge, Kinn, der schmal rostrothbraun eingefaßte Spiegel und die ganze Unterseite von der Brust an sowie die Innenseite weiß, die bis auf eine schmale Stelle zwischen den Nasenlöchern behaarte Muffel, die Hörner, die zierlichen, mittelgroßen, zusammengedrückten und spitzigen Hufe und die mittelgroßen, abgeplatteten und abgestumpften Afterklauen schwarz, die Iris bräunlichgelb, der quergestellte Stern dunkelschwarz. Die Ziege ist viel lichter als der Bock, dunkel isabellbraun, ein verwaschener Streifen längs der Seiten dunkel isabellgelb, die Stirn schwarzbraun, ein Ring um das Auge und die Ohrwurzel weiß, das übrige wie bei dem Bocke gefärbt und gezeichnet. Junge Thiere sollen sich durch vorherrschend röthliche Färbung von den alten Weibchen unterscheiden.
Der Sasi bewohnt Vorderindien, namentlich Bengalen, und lebt in Herden von fünfzig bis sechzig Stücken, welche von einem alten dunkelfarbigen Bocke angeführt werden. Unter allen Umständen ziehen die Thiere offene Gegenden den bedeckten vor; denn sie sind stets im hohen Grade für ihre Sicherheit besorgt. Kapitän Williamson erzählt, daß immer einige junge Männchen und auch alte Weibchen zum Vorpostendienste beordert werden, wenn sich die Herde an einem Lieblingsplatze zum Weiden anschickt. Namentlich Büsche, hinter denen sich Jäger heranschleichen und verstecken können, werden von diesen Wachen aufs sorgfältigste beobachtet. Es würde Narrheit sein, versichert dieser Beobachter, Windhunde nach ihnen zu hetzen; denn nur, wenn man sie überrascht, ist einiger Erfolg zu erwarten; sonst ergreifen sie augenblicklich die Flucht und jagen in wahrhaft wundervollem Laufe dahin. »Die Höhe und Weite ihrer Sprünge versetzt jedermann in Erstaunen: sie erheben sich mehr als drei Meter (?) über den Boden und springen sechs bis zehn Meter weit, gleichsam als ob sie den nachsetzenden Hund verspotten wollten.« Deshalb denken die indischen Fürsten auch nicht daran, sie mit Hunden zu jagen, beizen sie vielmehr mit Falken oder lassen sie vom schlauen Tschita oder Jagdleoparden fangen, wie dies in Persien gewöhnlich ist.
Die Aesung der zierlichen Thiere besteht in Gräsern und saftigen Kräutern. Wasser können sie auf lange Zeit entbehren.
Ueber die Fortpflanzung fehlen noch sichere Nachrichten. Es scheint, daß die Paarung nicht an eine bestimmte Zeit gebunden ist, sondern, je nach der Gegend, während des ganzen Jahres stattfindet. Neun Monate nach der Begattung wirft das Weibchen ein einziges, vollkommen ausgebildetes Junge, verbirgt es einige Tage lang im Gebüsch, säugt es mit Sorgfalt und bringt es dann zur Herde, bei welcher es verweilt, bis es die Eifersucht des Leitbockes vertreibt. Dann muß es in der Ferne sein Heil suchen und sehen, ob es sich anderen Rudeln anschließen kann. Die Weibchen sind bereits im zweiten Jahre, die Männchen wenigstens im dritten fortpflanzungsfähig. Es scheint, daß mit der Begattung ein eigenthümliches Erregtsein des Thränensackes in Verbindung steht. An Gefangenen hat man beobachtet, daß der ganze Hautbeutel unter dem Auge, die Thränengrube, welche sonst nur als ein schmaler Schlitz erscheint, wenn das Thier gereizt wird, weit hervortritt und sich förmlich nach außen umstülpt. Die glatten Innenwände des Sackes sondern einen stark riechenden Stoff ab, welcher durch Reiben an Bäumen oder Steinen entleert wird und wahrscheinlich dazu dient, das andere Geschlecht auf die Spur zu leiten. Während der Brunstzeit vernimmt man auch die Stimme des Männchens, welches sonst schweigt, eine Art von Meckern; das Weibchen gibt, so oft es erzürnt wird, blökende Laute von sich.
In Indien sind Tiger und Panther schlimme Feinde der Hirschziegenantilope. Die Indier stellen ihr ebenfalls eifrig nach und fangen sie auf sonderbare Weise lebendig. Hierzu bedient man sich eines zahmen Männchens, welches man, nachdem man ihm einen mit mehreren Schlingen versehenen Strick um die Hörner gebunden hat, unter die wilde Herde laufen läßt. Sobald der fremde Bock dort anlangt, entspinnt sich zwischen ihm und dem Leitbocke des Rudels ein Kampf, an dem bald auch Riken theilnehmen, und hierbei verwickeln sich gewöhnlich mehrere Stücke in den Schlingen des Strickes, reißen und zerren nach allen Richtungen hin und stürzen endlich vollständig wehrlos zu Boden.
Jung eingefangene Sassis werden außerordentlich zahm. Sie dauern leicht in Gefangenschaft aus, vertragen sich bis gegen die Paarzeit hin mit ihres Gleichen und erfreuen durch ihre Zuthunlichkeit und Anhänglichkeit. Doch muß man sich hüten, sie zu necken oder zu foppen. Sind sie z.+B. gewöhnt, Brod aus der Hand zu fressen, so richten sie sich, wenn man ihnen diese Lieblingsspeise hoch hält, wie die zahmen Hirsche auf die Hinterbeine auf, um dieselbe zu erlangen; täuscht man sie auch dann noch, so werden sie böse, beginnen zu zittern und suchen ihren Unmuth durch Stoßen mit den Hörnern an den Tag zu legen. Am besten halten sie sich, wenn man ihnen freien Spielraum gibt. In größeren Parks gewähren sie wegen ihrer außerordentlichen Anmuth und Zierlichkeit ein prächtiges Schauspiel, werden hier auch viel zahmer als in den Käfigen, wo namentlich die Männchen manchmal ihren Wärter anfallen und nach ihm stoßen. In Indien wird der Sassi als ein heiliges Thier oft zahm gehalten. Frauen sind mit der Pflege des Halbgottes betraut und tränken ihn mit Milch; Musiker spielen ihm Tonstücke vor. Nur die Braminen dürfen sein Fleisch genießen. Aus seinen Hörnern bereiten sich die Geistlichen und Heiligen der Hindu eigenthümliche Waffen, indem sie dieselben unten durch eiserne oder silberne Querzapfen so befestigen, daß die Spitzen nach beiden Seiten von einander abstehen. Diese Waffe trägt man wie einen Stock und gebraucht sie wie einen Wurfspieß.
Bezoarkugeln, welche man im Magen dieser Antilope und in dem vieler anderen Wiederkäuer findet, gelten als besonders heilkräftige Arzneimittel und finden vielfache Anwendung.
Von dem Sassi unterscheidet sich die Kropfantilope, Dseren der Mongolen, Hoangjang der Chinesen ( Antilopa gutturosa, A. orientalis, Capra flava, Procapra gutturosa), durch ihre sehr kleinen Thränengruben sowie das Fehlen der Kniebüschel und gilt deshalb ebenfalls als Vertreter einer besondern Untersippe ( Procapra). Sie ist merklich kleiner als der Damhirsch; der Bock, bei den Mongolen Onê genannt, 1,4 Meter lang, wovon der Kopf 42 Centim., der Schwanz 17 Centim. wegnimmt, an der Schulter 80, und am Kreuze 83 Centim. hoch, das Weibchen, Sergaktschin der mongolischen Steppenbewohner, dagegen nur 1,2 Meter lang und an der Schulter 74 Centim. hoch. Der Leib ist schlank, der Kopf kurz und dick, der Hals beim Männchen ausgezeichnet durch den sehr großen Kehlkopf, welcher in der Halsmitte wie ein Höcker hervortritt, und von dem aus eine schlaff behaarte Naht nach der Wamme verläuft, der Schwanz kurz, oben mit zottigen Haaren bedeckt, unten kahl; die Läufe sind schlank und sehr zierlich, die hinteren etwas höher als die vorderen, die Hufe dreieckig gewölbt, die Vorderknie glatt. Große, S-artig gebogene Nasenlöcher, die in der Mitte gefurchte Lippe, zerstreute Haare an dieser und an dem Kinne, nacktrandige Augenlieder und die auf dem Scheitel dicht beisammenstehenden, unten zusammengedrückten, langsam auseinander laufenden, in einem Bogen zurückgelegten, nach innen gebogen aufsteigenden, am Ende ausgespreizten, unten gestreiften, an der Spitze glatten, mit etwa zwanzig sehr vorragenden Ringrunzeln versehenen Hörner, welche nur der Bock trägt, die sehr kleinen, fast von Haaren verdeckten Thränengruben und die mäßig großen, spitzigen Ohren, welche innen drei undeutliche Rinnen haben, kennzeichnen das Thier noch anderweitig. Die Färbung unterscheidet sich je nach der Jahreszeit. Im Sommer sind Unterlippe, Kehle und Vordertheil der Oberlippe sowie die Gegend um den After, hier einen Spiegel bildend, reinweiß, die Kopfseiten hellisabell, Nasen- und Stirngegend blaß bräunlichgrau, Oberkopf, Nacken und obere Halsseiten ins Rothgelbe ziehend, der ganze Oberkörper und die Seiten lebhaft isabellgelb, die unteren Halstheile bis zur Brust gelblichweiß, die Unterseite, gegen die gelben Seiten scharf abgesetzt, wie die inneren Schenkel bis zum Laufe weiß, die Füße vorn hellgelblich, hinten mehr weiß als gelb, die Hufe schwärzlich hornfarben. Das Haar ist auch im Sommer lang, meistens einfarbig, hier und da weiß zugespitzt. Der Winterpelz zeichnet sich, laut Radde, durch vorwaltende Helle auf der obern wie auf der untern Körperseite aus; das matte Braungrau des Nasenrückens erstreckt sich auch auf die vordere obere Wangengegend und unter den innern Augenwinkel. Das Haar des Rückens nimmt von vorn nach hinten an Länge zu, so daß es zwischen 3 bis 5 Centim. mißt, und steht so außerordentlich dicht, daß man keine Spur des Wollhaares bemerken kann. Die äußere Ohrfläche ist dicht bedeckt von blaßgelben Haaren, auf der Vorderseite der Vorderfüße verläuft von der Kniebeuge an ein nach unten hin dunkler und breiter werdender bräunlichgrauer Längsstreifen bis zu den Klauen.
Die Kropfantilope, über deren Lebensweise wir namentlich Pallas und Radde ausführliche Mittheilungen verdanken, bewohnt die mongolische Tatarei, die Steppen zwischen China und Tibet sowie Ostsibirien, hier vorzugsweise die hohe Gobi, hält sich also immer in offenen Gegenden auf. Laut Radde läßt sich auch bei ihr wie bei dem Dschiggetai und dem Argali ein allmähliches Zurückweichen nach Süden und Osten bemerken. Gegenwärtig gibt es nur noch zwei Oertlichkeiten in Daurien, wo das Thier auch während des Sommers bleibt und die Weibchen alljährlich noch Junge bringen. Die eine liegt östlich vom Dsün-Tarei, wohin nur selten die Hirten größere Schafherden treiben, und ist ein menschenleeres, ziemlich gebirgiges Land mit Salz- und einigen Süßwasserseen, ohne Wald- und Strauchbestände, auf weithin nur mit gelblichen Gräsern bedeckt, die andere von gleichem Gepräge findet sich nordwärts vom linken Argunjufer, da wo dieser Fluß in die russischen Besitzungen eintritt. Pallas beobachtete Kropfantilopen viel weiter westlich am obern Ononlaufe, wo sie gegenwärtig nicht mehr leben, und hier einzeln oder in kleinen Trupps zerstreut innerhalb ihres weiten, öden Gebietes, von den dürftigen Gräsern sich äsend und namentlich in der Nähe von Gewässern sich sammelnd. Sie sind überaus behend und im Springen so geschickt wie irgend eine andere Antilope, scheuen aber das Wasser und schwimmen nur im äußersten Nothfalle. Die Brunstzeit tritt anfangs December ein, und die Männchen kämpfen dann hitzig um die Weibchen. Die Jungen, in der Regel zwei, werden um die Mitte des Juni geboren, sollen nach Angabe der Mongolen drei Tage nach der Geburt noch ruhen, dann aber bereits so stark und kräftig sein, daß sie bei der Verfolgung nicht mehr hinter der Mutter zurückbleiben. Gegen den Spätherbst hin tritt die Kropfantilope weite Wanderungen an, welche ihren Grund wahrscheinlich darin haben, daß an einzelnen Orten ihres Verbreitungsgebietes, beispielsweise in der südlichen Gobi, fast gar kein Schnee mehr fällt, die wenigen Wasserbecken sich mit einer für die schwachen Hufe viel zu starken Eisdecke überlegen, und sie nun, vom heftigsten Durste gepeinigt, sich aufmachen müssen, um Wasser oder wenigstens Schnee zu suchen. Somit drängen sie sich in nördlicher Richtung nach den tieferen Ebenen hinab, wachsen zu immer größeren Herden an und erinnern schließlich durch ihre Menge an die wandernden südafrikanischen Springböcke und andere dortige Verwandte. »In wie großer Menge sie bisweilen erscheinen«, sagt Radde, »davon konnte ich mich im Oktober 1856 jenseit des Argunj auf mongolischer Seite überzeugen; denn hier waren ihre Spuren und ihr Mist so zahlreich, als ob tausende von Schafen gegangen seien. Wir konnten diese Antilopen damals nicht mehr einholen; sie waren, wie sich die Grenzkosaken auszudrücken pflegen, windige, d.+h. unbeständige oder schnelle, und wanderten, getrieben vom Durste, rastlos ihres Weges fort.«
Im Sommer jagt man nach Angabe desselben Forschers die Kropfantilopen nur selten, weil ihrer dann immer nur wenige anzutreffen sind; desto eifriger aber verfolgt man sie auf ihren Wanderungen. Um zum Schusse zu kommen, werden verschiedene Jagdarten in Anwendung gebracht. So lange noch kein Schnee gefallen ist, kommen die Antilopen zur Mittagszeit in einzelnen Rudeln an die bereits zugefrorenen Süßwasserseen, deren dünne Eisdecke sie mit den Hufen durchstoßen, um zu trinken. Hierbei halten sie alltäglich dieselbe Stelle ein, so daß der Jäger in der Nähe derselben sich auf den Anstand legen kann. Ueberrascht man sie auf dem Eise, so fallen sie leicht und können dann erschlagen werden. Die gewöhnliche Art, Kropfantilopen zu jagen, erfordert zwei Menschen, von denen der eine sie dem andern zutreibt. Der Jäger legt sich, sobald er das Wild in weiter Ferne oder an einem Abhange, wo es spielt, bemerkt hat, hinter einen Murmelthierhaufen platt auf den Leib, macht seine Büchse schußfertig, indem er sie zwischen den Gräsern auf eine kurze Gabel stellt, und faßt den berittenen Treiber, welcher unterdessen in weiten Bögen den Antilopen sich näherte, scharf ins Auge. Dieser Treiber nimmt alle bei Jagden ohnehin zu beobachtenden Umstände, als Oertlichkeit, Windrichtung etc. wahr und versucht, die Antilopen dem Jäger zuzutreiben. Während der Flucht reihen sich letztere in Linien, welche ebenso oft unter Führung eines Bockes wie unter Leitung eines alten Weibchens dahinziehen, bald im Schritte vorwärts schreitend, bald hastig eilend, bei heftigem Laufen zuweilen auch einen hellen, gellenden Schrei ausstoßend. Je nachdem die Entfernung zwischen Treiber und Jäger groß oder gering ist, hält jener sich näher oder ferner von den scheuen Thieren, bis diese endlich in Schußnähe an den Jäger herangekommen sind. Nunmehr macht der Treiber sie durch den nachgeahmten Ruf eines Raben oder das Heulen eines Wolfes stutzig, damit der Schütze sich bequemer sein Ziel wählen kann. Die Steppentungusen sind im Auffinden und Erlegen der Kropfantilopen besonders geschickt, und bei ihnen treiben selbst junge Mädchen die Thiere zum Schusse. Einzelne Jäger erlegen in günstigen Wintern gegen zweihundert dieser Antilopen, da die Thiere, wie schon bemerkt, zuweilen in so dichten Scharen gehen, daß der Schütze nur auf die Beine zu zielen braucht, um mit einer Kugel ihrer drei bis vier zum Sturze zu bringen. Zu Pallas Zeiten wurden große Treibjagden auf sie angestellt, bei denen eine erhebliche Anzahl von Reitern eine Herde einzuschließen und gleichzeitig nach einem Gewässer zuzutreiben suchte. Vor letzterem scheuen sie so, daß sie, anstatt schwimmend sich zu retten, lieber zwischen den Reitern durchrennen, denen sie dabei regelmäßig znr Beute werden.
Jung eingefangene Kropfantilopen werden ebenso zahm wie andere Verwandte. Pallas sah mehrere, welche ungescheut in das Zimmer kamen, und Radde vernahm von solchen, welche mit Schafen und Ziegen zusammen lebten und weideten, also frei umhergingen, ohne weiterer Aufsicht zu bedürfen.
Eine der lieblichsten Erscheinungen unter den Antilopen des Innern Afrika ist der Pala oder Pallah, welcher nach dem Vorschlage Sundevalls ebenfalls als Vertreter einer besondern Untersippe, der Hochhornantilopen ( Aepyceros) gelten darf. Die Kennzeichen der Gruppe liegen in dem über 50 Centim. langen, schlanken, winklig leierförmigen, von der Wurzel an schief nach außen und oben, über der Mitte durch einen Winkel wieder nach einwärts und hinten gebogenen, grobgeringelten, rauhen, an der Spitze glatten Gehörne des Bockes und einem am Sprunggelenke der Hinterfüße nach hinten sich richtenden langen, wolligen Haarbüschel, den langen, spitzigen Ohren und dem etwa 25 Centim. langen zugespitzten Schwanze; auch sind keine Afterklauen vorhanden.
Der Pala ( Antilope melampus, Aepyceros melampus) übertrifft unsern Damhirsch etwas an Größe, ist jedoch viel zierlicher gebaut. Seine Länge beträgt gegen 2 Meter, wovon auf die Schwanzlänge 30 Centim. zu rechnen sind, die Höhe am Widerriste etwa 95 Centim. Die Färbung des Kopfes, Halses und der Oberseite ist ein zartes, hellgelbliches, nach hinten sich lichtendes Rostbraun, die der Unterseite und des kleinen Spiegels ein reines Weiß; den Spiegel begrenzend, zieht sich eine braunschwarze Bogenlinie von oben nach unten über die Keulen herab; vor den Augen befindet sich ein länglicher, weißer, zwischen den Hörnern ein schwarzer Fleck; über den Rücken verläuft ein schwarzer Streifen. Das hornlose Weibchen ist ganz ähnlich gefärbt und besitzt zwei Zitzen.
Lichtenstein entdeckte den Pala im Süden Afrikas; spätere Reisende fanden ihn auch in Ost-, West- und Mittelafrika auf: sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich also vom 12. Grade nördl. Br. an durch ganz Mittel- und den größten Theil von Südafrika. In früheren Zeiten wurde er in den Bechuanenländern zu tausenden gefunden; das mörderische Blei hat jedoch, laut Fritsch, so unter seinen Herden aufgeräumt, daß er gegenwärtig im südlichen Afrika recht selten geworden ist. Abweichend von den nächsten Verwandten bevölkert das anmuthige Thier lichte Gehölze und tritt selten auf freie Ebenen heraus. Gewöhnlich findet man es in kleinen Trupps von sechs bis acht, ausnahmsweise wohl auch in Gesellschaften von zwölf bis zwanzig Stück, und zwar befinden sich dann etwa drei bis vier Böcke unter dem Rudel. Es sind friedfertige, mehr zutrauliche als schüchterne Geschöpfe, welche aber, sobald sie öfter Nachstellungen oder Beunruhigung erfahren müssen, sehr vorsichtig und scheu werden und dann ungemein flüchtig durch ihr Gebiet ziehen. Das Auftreten der Pala ist in hohem Grade gefällig, und ein Trupp der zierlichen Thiere, welcher mit tanzenden Sprüngen durch den Buschwald zieht, gewährt ein überaus malerisches Bild. »Stolz und hoch«, sagt Heuglin, »trägt der Bock den edlen Kopf mit den schönen dunklen Augen, und kühn und rasch sind die Bewegungen seiner hohen, zarten, wie gedrechselten Läufe.« Mit der äußern Zierlichkeit der Gestalt und der Behendigkeit der Bewegungen paart sich eine selbst unter Antilopen auffallende Schärfe der Sinne. Den weitsichtigen Augen entgeht so leicht kein sich nähernder Gegner, die scharfen Ohren vernehmen jedes, auch das leiseste Geräusch: die schlanken Hälse heben sich, das Leitthier stampft auf den Boden und dahin jagt die ganze Gesellschaft. Unbehelligt gefällt sich der Trupp in den verschiedensten Stellungen oder aber in den mannigfaltigsten Spielen. Während einige sich äsen und dabei die Wache halten, liegen andere wiederkäuend im Schatten der Bäume; die Kälber umtanzen trippelnd ihre Mütter, deren wachsames Auge ihnen ununterbrochen zugewendet bleibt, die Böcke unterhalten sich währenddem durch einen kaum ernsthaft gemeinten Kampf, einige Thiere durch lustige Sprünge, wobei sie sich mit allen vier Läufen gleichzeitig heben und oft über den Rücken des andern wegspringen. Unwillkürlich erinnert dies denjenigen, welcher die behenden und anmuthigen Geschöpfe sich so bewegen sieht, an den geflügelten Fuß Merkurs, welchen jene durch ihren Haarbüschel an den Hinterfüßen zu wiederholen scheinen.
Von den südafrikanischen Jägern wird auch der Pala mit Leidenschaft gejagt. Sein Wildpret ist, wie das der meisten Antilopen, zwar etwas trocken, aber doch zart und schmackhaft, und die Haut, welche von den Eingebornen zur Kleidung benutzt wird, findet auch bei den Europäern vielfache Verwendung.
Die Gazellen ( Gazella) sind schlanke, höchst anmuthige Antilopen mit geringelten leierförmigen Hörnern, Thränengruben, Leistenbälgen, langen, spitzigen Ohren, kleinen Afterklauen und zwei Zitzen. Ihr Schwanz ist kurz und an der Spitze bequastet; anderweitige Haarbüschel stehen nur an der Handwurzel. Beide Geschlechter sind gehörnt.
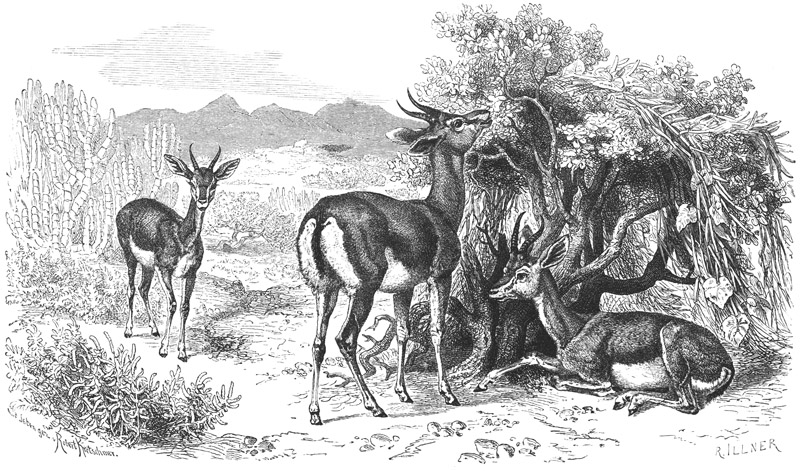
Gazelle.
Eine Gazelle in der Wüste ist ein so ansprechendes Bild, daß schon seit alten Zeiten die morgenländischen Dichter mit aller Glut ihrer Seele sie besungen haben. Selbst der Fremdling aus den Ländern des Abends, welcher sie in ihrer Freiheit sieht, muß es verstehen, warum sie gerade den Morgenländern als ein so innig befreundetes Wesen erscheint; denn auch über ihn kommt ein Hauch jener Glut, welche zu den feurigsten Lobliedern dieses Thieres die Worte läuterte und die Reime flüssig werden ließ. Das Auge, dessen Tiefe das Herz des Wüstensohnes erglühen und erblühen macht, vergleicht er mit jenem der Gazelle; den schlanken weißen Hals, um den sich seine Arme ketten in trauter Liebesstunde, weiß er nicht schmückender zu bezeichnen, als wenn er ihn dem Halse jenes Thieres gleichstellt. Der Fromme findet in der zierlichen Tochter der Wüste ein sinnlich wahrnehmbares Bild, um des Herzens Sehnsucht nach dem Erhabenen verständlich zu machen. Die Gazelle übt einen Zauber aus auf jedermann. Ihrer Amnuth halber weihten sie die alten Egypter der erhabenen Gottheit Isis und opferten die Kälber der Götterkönigin; ihre Schönheit muß dem Dichter des Hohen Liedes zum Bilde dienen: denn sie ist »das Reh« und »der junge Hirsch«, mit denen der Freund verglichen wird, das Reh oder die Hindin des Feldes, bei denen die Töchter Jerusalems beschworen werden. Für die schönsten Reize des Weibes nach morgenländischen Begriffen hat jener Dichter nur den einen Vergleich: sie sind ihm »wie zwei junge Rehzwillinge, die unter den Rosen weiden.« Die arabischen Dichter aller Zeiten finden nicht Worte, sie zu schildern; die ältesten Werke dieses Volkes preisen sie, und die Minnesänger auf den Straßen rühmen sie noch heutigen Tages.
Die Gazelle ( Antilope dorcas, Capra Gazella, Gazella africana und dorcas) erreicht nicht ganz die Größe unseres Rehes, ist aber viel zarter und schlanker gebaut, auch schöner gezeichnet als dieses. Alte Böcke messen 1,1 Meter, mit dem Schwanze 1,3 Meter in der Länge und sind am Widerriste 60 Centim. hoch. Der Körper ist gedrungen, obwohl er der hohen Läufe wegen schmächtig erscheint; der Rücken schwach gewölbt, am Kreuze höher gestellt als am Widerriste, der Schwanz ziemlich lang, an der Spitze stark behaart. Die Beine sind außerordentlich zart, schlank und höchst zierlich behuft. Auf dem gestreckten Halse sitzt der mittellange Kopf, welcher hinten breit und hoch, nach vorn verschmälert, und an der Schnauze schwach gerundet ist; die Ohren haben etwa Dreiviertel der Kopfeslänge; die großen feurigen und lebhaften Augen zeigen einen fast runden Stern; die Thränengruben sind von mittlerer Größe. Das Gehörn ist nach dem Geschlechte ziemlich verschieden. Der Bock trägt immer stärkere Hörner als die Rike, und die Wachsthumsringe sind dort stets mehr ausgeprägt als hier. Bei beiden richten sich die Hörner nach auf- und rückwärts, wenden sich aber mit den Spitzen wieder nach vorn und etwas gegen einander, so daß sie, von vorn betrachtet, an die Leier der Alten erinnern. Mit zunehmendem Alter rücken die sogenannten Wachsthumsringe immer weiter nach der Spitze zu; bei recht alten Böcken erreichen sie dieselbe, wahrscheinlich, weil sie durch Abnutzung kürzer wird, bis auf zwei Centimeter. Uebrigens stehen die Wachsthumsringe nur bedingt in einem geraden Verhältnisse mit dem Alter des Thieres: ein im Hause erzogener, fünfvierteljähriger Bock, welchen ich untersuchte, zeigte bereits fünf Ringe auf seinen noch sehr kurzen Hörnchen. Die vorherrschende Färbung ist ein sandfarbiges Gelb, welches aber gegen den Rücken hin und auf den Läufen in ein mehr oder weniger dunkles Rothbraun übergeht. Ein noch dunklerer Streifen verläuft längs der beiden Leibesseiten und trennt die blendend weißgefärbte untere Seite von der dunklern obern. Der Kopf ist lichter als der Rücken, ein von den Augenwinkeln bis zur Oberlippe verlaufender Streifen braun, Nasenrücken, Kehle, Lippen, ein Ring um die Augen und ein Streifen zu beiden Seiten des Nasenrückens sind gelblichweiß, die Ohren gelblichgrau, schwarz gesäumt und mit drei Längsreihen ziemlich dicht aneinanderstehender Haare besetzt. Der Schwanz ist an seiner Wurzel dunkelbraun, wie der Rücken, in seiner letzten Hälfte aber schwarz. Bei manchen Stücken zieht die Färbung mehr ins Graue und ähnelt dann sehr dem Kleide der persischen Gazelle, welche, wie mehrere andere Ab- oder Spielarten, von einigen Forschern als besondere Art betrachtet wird.
Nordostafrika ist die Heimat der Gazelle. Sie reicht von der Berberei an bis nach dem steinigen Arabien und Syrien und von der Küste des Mittelmeeres bis in die Berge Abessiniens und in die Steppen des innern Afrika. Der ganze Wüstenzug und das ihn begrenzende Steppengebiet kann als ihre Heimat betrachtet werden; in den Gebirgen von Habesch steigt sie, laut Heuglin, höchstens bis zu 1500 Meter empor. Je pflanzenreicher die Einöde, umso häufiger findet man das Thier; jedoch muß hierbei festgehalten werden, daß eine pflanzenreiche Gegend nach afrikanischen Begriffen von einer gleichbezeichneten in unserem Klima sehr verschieden ist. Man würde sich irren, wenn man die Gazelle in wirklich fruchtbaren Thalniederungen als ständigen Bewohner vermuthen wollte; solche Strecken berührt sie nur flüchtig, ungezwungen wohl kaum. Sie zieht Niederungen den durchglühten Hochebenen vor, aber nur Niederungen der Wüste: in Flußthälern findet man sie ebenso selten wie auf dem Hochgebirge. Mimosenhaine und noch mehr jene sandigen Gegenden, in denen Hügelreihen mit Thälern abwechseln und die Mimosen überall sich finden, ohne eigentlich einen Hain oder Buschwald zu bilden, sind ihre Lieblingsplätze, weil die Mimose als ihre eigentliche Nährpflanze angesehen werden muß. In den Steppen kommt sie ebenfalls und zwar an manchen Orten sehr häufig vor; allein auch hier bevorzugt sie dünnbestandene Buschgegenden dem wogenden Halmenwalde. In den Steppen Kordofâns sieht man Rudel von vierzig bis fünfzig Stücken, welche, vielleicht nicht das ganze Jahr hindurch, ziemlich weit umherstreifen; an ihren Lieblingsplätzen gewahrt man sie jedoch nur in kleinen Trupps von zwei, drei bis acht Stücken, sehr oft auch einzeln. Nahe der Mittelmeerküste ist sie selten. Je weiter man nach Nubien hin vordringt, um so häufiger wird sie; am gemeinsten dürfte sie in den zwischen dem Rothen Meere und dem Nil gelegenen Wüsten und Steppen zu finden sein. Die schwachen Rudel sind gewöhnlich Familien, bestehend aus einem Bocke mit seinem Thiere und dem jungen Nachkommen, welcher bis zur nächsten Brunftzeit bei den Eltern verweilen darf. Ebenso häufig aber findet man auch Trupps, welche nur aus Böcken und zwar wohl aus solchen bestehen, die von den stärkeren abgetrieben wurden. Diese Junggesellen halten bis gegen die Brunftzeit hin treu zusammen.
Jeder Reisende, welcher auch nur auf einige Meilen hin die Wüste durchzieht, kann eine Gazelle zu sehen bekommen, und wer erst ihre Lebensweise kennt, findet sie mit Sicherheit in allen Theilen ihres Heimatskreises auf. Als Tagthier zeigt sie sich gerade zur günstigsten Zeit dem Auge. Nur während der größten Hitze des Tages, in den Mittagsstunden bis etwa vier Uhr abends, ruht sie gern wiederkäuend im Schatten einer Mimose; sonst ist sie fast immer in Bewegung. Aber man sieht sie nicht so leicht, als man glauben möchte: die Gleichförmigkeit ihres Kleides mit der herrschenden Bodenfärbung erschwert ihr Auffinden. Schon auf eine Achtelmeile hin entschwindet sie unserem schwächlichen Gesichte, während die Falkenaugen der Afrikaner sie oft in mehr als meilenweiter Entfernung noch wahrnehmen. Gewöhnlich steht der Trupp unmittelbar neben oder unter den niederen Mimosenbüschen, deren Kronen sich von unten aus schirmförmig nach oben ausbreiten und somit den Thieren unter ihnen ein schützendes Dach gewähren. Die wachhaltende Gazelle äst sich, die anderen liegen wiederkäuend oder sonst sich ausruhend unweit von ihr. Nur die stehende fällt ins Auge, die liegende gleicht einem Steine der Wüste so außerordentlich, daß selbst der Jäger oft sich täuschen kann. So lange nicht etwas ungewöhnliches geschieht, bleibt das Rudel auf der einmal gewählten Stelle und wechselt höchstens von einem Orte zu dem andern, hin und herziehend; sowie es aber Verfolgungen erfährt, vertauscht es augenblicklich seinen Stand. Auch der Wind schon ist hinreichend, um die Gazelle zu solchem Wechsel zu bewegen. Sie steht stets unter dem Winde, am liebsten so, daß sie von dem Berghange aus die vor ihr liegende Ebene überschauen und durch den Luftzug von einer Gefahr im Rücken Kunde erhalten kann. Aufgestört flüchtet sie zunächst auf die Höhe des Hügels oder Berges, stellt sich auf dem Kamme auf und prüft nun sorgfältig die Gegend, um den geeignetsten Ort zur Sicherung zu erspähen.
Es läßt sich nicht verkennen, daß man in der Gazelle ein hoch begabtes Thier vor sich hat. Sie ist so bewegungsfähig wie irgend eine andere Antilope, dabei lebhaft, behend und überaus anmuthig. Ihr Lauf ist außerordentlich leicht; sie scheint kaum den Boden zu berühren. Ein flüchtiges Rudel gewährt einen wahrhaft prachtvollen Anblick; selbst wenn die Gefahr ihm nahe kommt, scheint es noch mit seiner Befähigung zu spielen. Oft springt mit zierlichen Sätzen von ein bis zwei Meter Höhe eine Gazelle, gleichsam aus reinem Uebermuthe, über die andere hinweg, und ebenso oft sieht man sie über Steine und Büsche setzen, welche ihr gerade im Wege liegen, aber sehr leicht umgangen werden könnten. Alle Sinne sind vortrefflich ausgebildet. Sie wittert ausgezeichnet, äugt scharf und vernimmt weit. Dabei ist sie klug, schlau und selbst listig, besitzt ein vortreffliches Gedächtnis und wird, wenn sie Erfahrung gesammelt hat, immer verständiger. Ihr Betragen hat viel ansprechendes. Sie ist ein harmloses und etwas furchtsames Geschöpf, keineswegs aber so muthlos, als man gewöhnlich glaubt. Unter dem Rudel gibt es oft Streit und Kampf, wenn auch bloß unter den gleichgeschlechtigen Gliedern desselben, zumal unter Böcken, welche gern zu Ehren der Schönheit einen Strauß ausfechten, während sie die Riken bis gegen die Brutzeit hin mit Liebenswürdigkeit, ja mit Zärtlichkeit behandeln und gleiches von diesen empfangen. Mit allen übrigen Thieren lebt die Gazelle in Frieden; deshalb sieht man sie auch gar nicht selten in Gesellschaft anderer, ihr nahestehender Antilopen.
Man kann nicht eben sagen, daß die Gazelle scheu wäre; aber sie ist vorsichtig und meidet jeden ihr auffallenden Gegenstand oder jedes ihr gefährlich scheinende Thier mit Sorgfalt. In Kordofân ritt ich einmal durch eine von der gewöhnlichen Straße abgelegene Gegend, welche nur wenig bevölkert ist und ausgedehnte Graswälder besitzt. Hier sah ich während des einen Tages wohl zwanzig verschiedene, und zwar ausnahmslos sehr starke Rudel. Wahrscheinlich hatten diese Thiere das Feuergewehr noch nicht kennen gelernt. Sie ließen mich bis auf etwa vierzig Schritte herankommen, ungefähr soweit, als ein Sudâner seine Lanze zu schleudern vermag. Dann zogen sie vertraut weiter, ohne mich groß zu beachten. Im Anfange fesselten mich die schönen Thiere so, daß ich nicht daran dachte, mein Gewehr auf sie zu richten. Aber die Jagdbegierde beseitigte bald jedes Bedenken. Ich feuerte auf den ersten besten Bock, welcher sich mir zur Zielscheibe bot, und schoß ihn zusammen. Die anderen flüchteten, blieben aber schon nach hundert Schritten Entfernung stehen und trollten gemächlich weiter. Ich konnte mich von neuem bis auf achtzig Schritte nähern und erlegte den zweiten Bock, und schließlich schoß ich noch einen dritten aus demselben Rudel, bevor es eigentlich flüchtig wurde.
Die Verschiedenheit der klimatischen Verhältnisse Nordostafrikas bedingt auch eine sehr verschiedene Brunftzeit der Gazellen. Im Norden fällt sie etwa in die Monate August bis Oktober, in den Gleicherländern beginnt sie erst Ende Oktober und währt dann bis Ende December. Die Böcke fordern einander mit laut blökendem Schrei zum Kampfe auf und streiten sich so heftig, daß sie sich gegenseitig die Hörner abstoßen: ich habe viele von ihnen erlegt, bei denen die eine Stange an der Wurzel abgebrochen worden war. Von dem Thiere vernimmt man nur ein sanftes, helles Mahnen. Der stärkste Bock wird natürlich von ihm bevorzugt, duldet auch keinen Nebenbuhler. Traulich zieht das Thier mit ihm hin und her, und gern nimmt es Liebkosungen von Seiten des Herrn Gemahls entgegen. Dieser folgt seiner Schönen auf Schritt und Tritt nach, beriecht sie von allen Seiten, reibt den Kopf zart an ihrem Halse, beleckt ihr das Gesicht und sucht ihr überhaupt seine Liebe auf alle Weise zu erkennen zu geben. Beim Beschlage hebt er sich plötzlich auf die Hinterläufe und geht auf diesen dem Thiere nach, welches vorwärts rückt und, spröde thuend, mit einer raschen Bewegung sich seitwärts wendet. Jener läßt sich aber nicht sogleich abweisen, folgt vielmehr der Erkorenen immer wieder, treibt sie hin und her und kommt endlich zum Ziele. Im Norden setzt die Rike Ende Februar oder Anfang März, im Süden zwischen den Monaten März und Mai, also nach etwa fünf- oder sechsmonatlicher Tragzeit, ein einziges Kalb. Zu Ende des März und im Anfange des April waren die meisten weiblichen Gazellen, welche ich erlegte, hoch beschlagen, und manche trugen bereits ein sehr ausgebildetes Junge. Das zur Welt gekommene Kälbchen ist in den ersten Tagen seines Lebens ein verhältnismäßig unbehülfliches Geschöpf, und daher kommt es auch, daß viele junge Gazellen von den flinken Arabern und Abessiniern mit den Händen gefangen werden. Je hülfsbedürftiger das Thierchen ist, umsomehr wird es von der Mutter geliebt. Nicht allzumächtigen Feinden geht sie muthig entgegen: so weiß sie einen etwa heranschleichenden Fuchs, welcher schlimme Absichten verrathen sollte, mit den scharfen Hufen abzutreiben. Doch hat das junge Thier viele Gefahren auszustehen, ehe es so flüchtig wird, daß es mit den Eltern gleichen Schritt halten kann. Man dürfte schwerlich übertreiben, wenn man sagt, daß die Hälfte der Nachkommenschaft unserer Gazellen und anderer Schwächlinge ihrer Verwandtschaft den zahllosen Räubern, welche sie beständig umlauern, zum Opfer fällt. Freilich würden sich die Gazellen ohne diese, das Gleichgewicht herstellenden Glieder der Thierwelt, auch so vermehren, daß sie, wie im Süden Afrikas die Springböcke und andere in Herden lebende Antilopen, die niedere Pflanzenwelt so gut als vernichten könnten.
Jung ins Haus gebrachte Gazellen werden nach wenigen Tagen zahm, ertragen auch, zumal in ihrer Heimat, leicht und dauernd die Gefangenschaft. Die Schönheit der Augen dieser Thiere ist unter allen morgenländischen Völkern so vollständig anerkannt, daß schwangere Frauen Gazellen nur aus dem Grunde zu halten pflegen, um ihrer Frucht die Schönheit des Thieres einzuprägen. Oft setzen sie sich längere Zeit vor das Thier hin und sehen ihm in die schönen Augen, streichen ihm mit den Fingern über die weißen Zähne, berühren dann die ihrigen und sagen dabei verschiedene Sprüche her, denen sie noch besondere Kraft zutrauen. In den europäischen Häusern der größeren Städte Nord- und Ostafrikas sieht man regelmäßig gezähmte Gazellen, und unter ihnen findet man viele, welche sich so an den Menschen gewöhnt haben, daß sie als echte Hausthiere angesehen werden können. Sie folgen ihrem Herrn wie Hunde nach, kommen in die Zimmer herein, betteln bei Tische um Nahrung, unternehmen Ausflüge in die benachbarten Felder oder in die Wüste und kehren, wenn der Abend kommt, oder wenn sie die Stimme ihres geliebten Pflegers vernehmen, gern und freudig wieder nach Hause zurück. Auch bei uns zu Lande kann man Gazellen jahrelang am Leben erhalten, falls man ihnen die nöthige Pflege angedeihen läßt. Wie zu erwarten, müssen die höchst empfindlichen Kinder des Südens vor allen Einflüssen der rauhen Witterung sorgfältig behütet werden; ein warmer Stall für den Winter und eine größere Parkanlage für den Sommer sind deshalb zu ihrem Wohlbefinden unentbehrlich. Ein Rudel Gazellen verleiht jedem größern Garten oder Parke eine Zierde, welche schwerlich von einer andern übertroffen werden kann. Das schmucke Reh erscheint der Gazelle gegenüber plump und schwerfällig; steht ihr ja doch fast jeder andere Wiederkäuer an Anmuth und Lieblichkeit nach! Zahme Gazellen zeigen sich auch gegen fremde Leute sanft und zutraulich; nur die Böcke gebrauchen bisweilen ihr Gehörn, doch immer mehr um zu spielen, als in der Absicht zu verletzen. Heu, Brod und Gerste, im Sommer Klee und anderes Grünzeug genügen zur Ernährung der Gefangenen; sehr gut bekommt ihnen auch ein Kleientrank, wie ihn Ziegen erhalten. Wasser bedürfen sie nur sehr wenig: täglich ein mittelgroßes Glas voll befriedigt ihren Durst vollständig. Dagegen verlangen sie Salz, welches sie begierig auflecken.
Ueberall, wo man solche gefangene Gazellen gut hält, schreiten sie zur Fortpflanzung, im Süden natürlich leichter als in unserem rauhen Norden. In Kairo hat eine Gazelle fünf Jahre nach einander je ein wohlgebildetes Junge zur Welt gebracht und glücklich aufgezogen; in unseren Thiergärten gehören derartige Vorkommnisse eben auch nicht zu den Seltenheiten.
Die Gazelle bildet in ihrer Heimat einen Gegenstand der eifrigsten, ja der leidenschaftlichsten Jagd. Alle Völkerschaften, welche mit ihr denselben Wohnkreis theilen, wetteifern mit einander in Ausübung dieses herrlichen Vergnügens. Der edle Perser und der vornehme Türke jagen die Gazelle mit derselben Lust wie der Beduinenhäuptling und der Sudâner. Im Norden Afrikas bildet das Feuergewehr die Hauptwaffe; in Persien und im Herzen der Wüste, auch schon in Egypten, beizt man das Wild mit Falken oder hetzt es mit den Windhunden zu Tode. Ich habe in Egypten oft genug die hohen Herren mit dem Falken auf der Faust zur Gazellenbeize hinausreiten sehen, zufällig aber niemals Gelegenheit gehabt, derselben beizuwohnen, und muß mich daher, nur solche Jagd zu schildern, auf die Mittheilungen Heuglins und Sponys stützen. Die Edelfalken, welche man im Norden abzutragen versucht, sind der Wander-, Würg- und Rothnackenfalke. Um sie auf Gazellen abzurichten, wirft man sie, nachdem sie einigermaßen gezähmt worden sind, gefesselt auf eine ausgestopfte Gazelle, deren Augenhöhlen mit Fleisch gefüllt wurden. Die Entfernung, in welcher sich der Wärter von der Gazelle stellt, wird täglich etwas vergrößert, bis der Jagdfalke sich gewöhnt hat, diese auf weithin zu suchen. Nachdem er sich von dem in den Augenhöhlen aufgespeicherten Fleische geäst hat, wird er wieder zurückgenommen und jedesmal auf der Hand gekröpft. Nach und nach befreit man ihn von allen Fesseln und sucht ihn dahin zu bringen, daß er auf den Ruf zu dem Falkner zurückkehrt. Das schwierigste der Lehre besteht darin, daß er auch auf lebende Gazellen stößt. Zu diesem Zwecke versucht man ihn zuerst an eingefangenen Jungen; hat man solche nicht, so werden sie in der Wüste ausgesucht, womöglich von der alten Rike getrennt und durch eine längere Jagd ermüdet; alsdann häubelt man den Falken ab und wirft ihn auf das junge Thier. So lernt er nach und nach auch auf ältere Gazellen stoßen, und wenn er erst einmal Kämpfe mit solchen bestanden hat, ist er zur Jagd geeignet.
Die Gazellenbeize erfordert eine große Anzahl von Menschen, Pferden, Hunden und Falken, ist also sehr kostspielig und wird daher nur von den Großen des Reiches betrieben. Halim Pascha richtete, laut Spony, in der letzten Zeit jährlich wenigstens fünfzehn Pferde und dreißig Hunde dabei zu Grunde. Vor der Jagd wird die erwählte Oertlichkeit, welche erfahrungsmäßig Gazellen beherbergt, durch mehrere Tage genau untersucht und der zeitweilige Wechsel des Lagerplatzes des Wildes sorgfältig erkundet. Am Vorabende der Jagd erhalten die Stallknechte die nöthigen Befehle; denn der Jagdzug setzt sich am andern Morgen noch im Dunkel der Nacht in Bewegung, da man vor Sonnenaufgang zur Stelle sein muß. Im tiefsten Schweigen zieht man zur Wüste hinaus und dem Jagdplatze zu, welcher bereits in der Nacht von den Jägern umstellt worden ist. Hier gewahrt man einen Falkner zu Pferde mit dem Stoßvogel auf der Faust und dem Hunde an der Leine, dort einen andern zu Fuße mit einem Falken auf der Faust, einem zweiten auf der Schulter, einem dritten vielleicht noch auf dem Kopfe; hinter ihm schreiten die Hundejungen mit einer Meute gefesselter Windspiele. Außerdem befinden sich mit Wasser und Lebensmitteln beladene Kamele zur Stelle. Den Vortrupp bilden die Jäger, vollkommen fährtegerechte, mit allen zur Jagd erforderlichen Kenntnissen ausgerüstete Leute, denen das Amt obliegt, von den sich findenden Erhöhungen aus das Wild zu erkunden, durch Zeichen die Richtung, wo solches steht, anzugeben und unter Berücksichtigung der Windrichtung die Jäger anzuweisen, wie sie reiten sollen. Langsam und still, soviel wie möglich gegen den Wind, nähert man sich nun einem Rudel Gazellen, indem man alle vorhandenen Bodenverhältnisse weidmännisch benutzt. In geeigneter Entfernung läßt man einen erprobten Falken abhäubeln und wirft ihn, sobald er die Gazelle eräugt hat. Der Falke erhebt sich hoch in die Luft und eilt in pfeilschnellem Fluge auf die Gazelle zu, stürzt sich von oben herab auf sie und versucht, in der Augengegend die Fänge einzuschlagen. Das überraschte Wild ist bemüht, durch Rütteln und Ueberschlagen des Raubvogels sich zu entledigen, während dieser nöthigenfalls den Kopf des Opfers verläßt, um ihn sofort wieder von neuem zu packen. Obgleich die Hunde bis dahin von den Gazellen noch nichts gesehen haben, wissen sie doch erfahrungsmäßig, daß die Jagd mit dem Enthauben des Falken beginnt, werden hitzig, zerren an den Leinen und lassen sich nicht mehr halten. Abgekoppelt folgen sie sogleich dem Falken, welchen sie fest im Auge behalten, und hinter ihnen drein jagen nun im vollsten Laufe die Jäger. Wenn der Falke gut ist, hält er jede nicht allzu große Antilope auf, bis die Hunde herangekommen sind und sie niederreißen. Für die Betheiligten ist die Jagd entzückend. Jedesmal wenn der Falke die flüchtige Gazelle überholt, sie stößt und die Fänge in Hals und Kopf zu schlagen versucht, ertönt ein Freudenschrei aus allen Kehlen; wenn ein guter Falke sich von der Gazelle, in deren Hals er seine Fänge eingeschlagen hat, eine längere Strecke mit fortschleppen läßt, vernimmt man von allen betheiligten Jägern die lautesten Beifallszeichen. Wird das Wild von den Windspielen ereilt und niedergerissen, so bilden Hunde und Gazelle dann nur eine für das Auge unentwirrbare Masse, und nunmehr ist es Zeit, daß wenigstens einer der Jäger auf der Walstatt anlangt. Er bemächtigt sich des Falken, gibt dem lebenden Wilde den Gnadenstoß, treibt die Hunde weg und kröpft den Falken. Zuweilen geschieht es bei solchem Durcheinander, daß ein Falke einen Hund auf Ohr und Nase schlägt und dadurch zwar den Hund arg belästigt, aber selbst den ernsthaftesten Jäger heiter stimmt, weil fast stets zur Lösung derartiger Mißverständnisse die Beihülfe eines Menschen nöthig wird. Manchmal schlägt der Falke anstatt der Gazelle einen Hasen, und dann ist selbstverständlich die Jagd verdorben; im allgemeinen aber halten sich die vortrefflichen Vögel an das richtige Wild.
In einigen Gegenden Nordafrikas verfolgen gut berittene Jäger die Gazelle und suchen sie von ihren ausdauernden Pferden herab zu erlegen. Dies ist kein leichtes Stück; denn so schnellfüßig auch die Rosse der Wüste, so schwer wird es ihnen, dem flüchtigen Wilde nachzukommen. Nach langer Hatze, welche abwechselnd von mehreren geführt wird, nähern sich die Reiter diesem aber doch, und wenn sie einmal bis zu einer gewissen Entfernung an das abgemattete Thier herangekommen sind, ist es verloren. Mit der größten Sicherheit schleudern die Jäger ihm starke Knüppel zwischen die Läufe und brechen fast regelmäßig einen der Knochen entzwei. Dann ist es kein Kunststück weiter, das arme, verwundete Geschöpf mit den Händen zu greifen.
Ich habe die Gazellenjagd nur mit der Büchse betrieben und mehr als einmal an einem Tage sechs Stück erlegt, auch wenn ich es mit schon gewitzigten zu thun hatte. Der Pirschgang führt unbedingt am sichersten zum Ziele. Auf meiner letzten Reise in Habesch hatte ich Gelegenheit genug, Gazellen zu jagen, obgleich ich eigentlich niemals vom Wege abging. Wenn wir, mein Begleiter van Arkel und ich, einen Trupp stehen sahen, ritten wir, höchstens mit einer geringen Abweichung, ruhig unseres Weges weiter und so nahe, als es uns passend erschien, an die Gazellen heran. Dann sprang einer von uns hinter einem Busche vom Maulthiere, übergab dieses dem begleitenden Diener und schlich nun, oft kriechend, mit sorgfältigster Beobachtung des Windes an das Wild heran. Der andere zog seines Weges fort, weil wir sehr bald erfahren hatten, daß die Gazelle auf Reiter weit weniger achtet als auf Fußgänger, und ebenso auch, daß sie augenblicklich davon geht, wenn ein Reiterzug plötzlich Halt macht. Gewöhnlich schaute das Leitthier des betreffenden Rudels neugierig den Dahinziehenden nach und vergaß dabei, die übrige Umgebung prüfend zu beobachten. Der Jagende benutzte seine Zeit so gut als möglich und konnte auch in den meisten Fällen von einem der dichteren Büsche aus einen glücklichen Schuß thun, in der Regel nicht weiter als aus neunzig bis hundertfünfzig Schritte. Die überlebenden Gazellen eilten nach dem Schusse so schnell als möglich davon, am liebsten dem nächsten Hügel zu, an welchem sie bis zu dem Gipfel eilfertig hinaufkletterten. Dort aber blieben sie stehen, gerade als wollten sie sich genau von dem Vorgegangenen überzeugen, und mehr als einmal ist es uns gelungen, uns selbst bis an diese, dort wie Schildwachen aufgestellten Thiere mit Erfolg heranzuschleichen. Doch kam es auch vor, daß das Wild rührende Beweise seiner Anhänglichkeit an den Gefährten gab. Zweimal in wenigen Jagdtagen habe ich zwei Gazellen von einem Busche aus erlegt. Auf den ersten Schuß blieb eine Gazelle, gleichsam starr vor Schrecken, neben dem verendenden Genossen stehen, ließ von Zeit zu Zeit ein ängstliches Blöken vernehmen und ging höchstens im Kreise um den Gefallenen herum, ihn mit sichtlicher Angst betrachtend. Da wurde rasch die Büchse wieder geladen und noch eine zweite tödtliche Kugel entsandt. Ich bemerke ausdrücklich, daß ich nur das eine Mal ein Paar auf diese Weise erlegte: die zweiten, welche ich nach einander zusammenschoß, waren Böcke; aber sie zeigten nicht geringere Anhänglichkeit an einander als jene, bei denen die Gattenliebe ins Spiel kam. An einigen Orten belebten sich nach und nach die höheren Hügel mit Gazellen, welche, durch unsere Schüsse erschreckt, von allen Seiten herbeikamen, um von ihrer Warte aus die Gegend zu überschauen. Ich darf wohl behaupten, daß die meist unbewachsenen Berge hierdurch einen wunderbaren Schmuck erhielten. Die schönen Gestalten zeichneten sich so klar gegen den tiefblauen Himmel ab, daß man auch auf große Entfernung hin jedes Glied deutlich wahrnehmen konnte. Oft kam es auch vor, daß die erschreckten Gazellen über einen der unzähligen niederen Hügel, an denen die Samhara so reich ist, weggingen und gleich hinter denselben, d. h. sobald sie den Jäger aus dem Auge verloren hatten, stehen blieben. Im Anfange foppten sie mich einige Male durch dieses sonderbare Betragen. Ich kletterte höchst behutsam an dem Hügel empor und suchte mein Wild in der Entfernung, während es doch dicht unter mir stand. Das Herabrollen eines Steines oder ein anderes Geräusch, welches ich verursachte, schreckte dann die Gazellen auf, und sie eilten jetzt in solch rasender Flucht dahin, daß die Fehlschüsse, welche ich mir zu schulden kommen ließ, wohl verzeihlich erscheinen dürften. Niemals aber sah ich von Menschen verfolgte Gazellen in ihrer wahren Schnelligkeit; denn diese nehmen sie bloß an, wenn ihnen ein Hund auf den Fersen ist. Ich vermag es nicht, das Schauspiel zu beschreiben, welches die beiden Thiere gewähren; ich könnte höchstens sagen, daß eine so dahineilende Gazelle nicht mehr zu laufen, sondern zu fliegen scheint: aber damit hätte ich ihre Flüchtigkeit noch immer nicht geschildert!
In Kordofân und anderen innerafrikanischen Ländern, wo das Feuergewehr nicht in jedermanns Händen ist, sondern noch heutigen Tages als bevorzugte Waffe des Weißen betrachtet und mit einer gewissen Scheu angestaunt wird, legt man sich mehr auf den Fang als auf die Jagd der Gazelle. Man stellt in geringen Abständen auf dem oft begangenen Wechsel sogenannte Teller auf und umgibt jeden einzelnen mit einer Schlinge, welche an einem starken Knüppel befestigt ist. Die Teller bestehen aus einem vielfach durchbohrten Reifen, durch welchen dicht neben einander Stäbchen gesteckt werden. Letztere laufen nach dem Mittelpunkte des Reifes zu, sind etwas nach unten gerichtet und da, wo sie inmitten des Reifes zusammenstoßen, scharf zugespitzt. Jeder Teller wird über eine kleine Grube gelegt, welche man im Sande ausgescharrt und durch ein reifenartig zusammengebogenes breites Rindenstück ausgekleidet hat, damit sich die Grube nicht wieder mit Sand ausfüllt. Die Gazelle, welche ruhig ihres Weges wandelt, tritt auf den Teller, ihr glatter Huf rutscht auf den biegsamen Stäbchen nach der tiefern Mitte herab, dringt dort durch, sinkt tief in die Grube hinein, und sie hat nun einen höchst unangenehmen Kranz am Laufe, dessen Spitzen ein unerträgliches Jucken verursachen. Hiervon belästigt, sucht sie durch Schnellen mit den Läufen von dem Anhängsel sich zu befreien und zieht gerade hierdurch die Schlinge zu, aus welcher sie sonst den Fuß ungefährdet entfernt haben würde. Geängstigt, wie sie ist, beginnt sie rascher zu laufen, aber der Knüppel, welcher hinten nachfolgt, flößt ihr bald das höchste Entsetzen ein; sie eilt so schnell als möglich davon, der Knüppel kommt in raschere Bewegung und schlägt ihr schließlich einen der Läufe entzwei. Das nun fluchtunfähige Wild gelangt leicht in die Gewalt des Menschen. Der Jäger, welcher seine Fallen untersucht, bemerkt sehr bald, daß eine ihren Zweck erfüllt hat und setzt jetzt seine leichten, schnellen Windhunde auf die Spur oder folgt dieser selbst, weil ja der nachschleifende Knüppel sie deutlich genug bezeichnet. So fängt man viele Gazellen und Antilopen überhaupt, jedoch nicht die meisten, welche erbeutet werden; denn ergiebiger noch ist die Jagd mit den Windspielen der Steppe, welche oft an einem einzigen Tag dreißig bis vierzig Stück des leckern Wildes fangen.
Großartige Treibjagden werden zeitweilig von den Beduinenstämmen angestellt und dabei unter günstigen Umständen Hunderte von Gazellen mit einem Male getödtet. In den an Antilopen reichen Wüstenstrecken sieht man hier und da aus Steinen aufgeschichtete Mauern von Mannshöhe und darüber, welche in auseinandergehender Richtung auf weithin durch die Wüste geführt wurden, derartig, daß sie an dem einen Ende mindestens auf eine halbe Meile von einander entfernt sind, während sie an dem andern in einen ringsumschlossenen hofartigen Raum übergehen. Zur Zeit nun, wenn viele Antilopen in der Nähe dieser Mauern stehen, macht sich der Beduinenstamm zur Jagd aus, umreitet in weitem Bogen das Wild und sucht es der Einhegung zuzutreiben. Nicht immer, wohl aber in den meisten Fällen, gelingt die Absicht vollkommen, und wenn die Gazellen erst einmal zwischen die Mauern gerathen sind, bleibt ihnen kein Ausweg mehr übrig; denn in der Angst versuchen sie kaum, über die Mauern wegzuspringen. Endlich erfüllen sie den geschlossenen Raum, und nunmehr beginnt ein abscheuliches, durchaus unweidmännisches Abschlachten des edlen Wildes unter Triumphgeschrei der Betheiligten.
Außer den Menschen stellen der erwachsenen Gazelle wenige Feinde nach, vor allen Leopard und Jagdpanther, Hiänenhunde, Schakalwölfe und andere Windhunde und vielleicht noch ein und der andere Adler.
Mit den Gazellen haben die Springantilopen ( Antidorcas ) große Aehnlichkeit, unterscheiden sich jedoch durch ein wesentliches, einzig und allein ihnen zukommendes Merkmal von den genannten und allen übrigen Verwandten. Längs des Rückens nämlich, etwa von der Mitte desselben beginnend, verläuft eine durch Verdoppelung der Oberhaut gebildete, mit sehr langen Haaren ausgekleidete Falte, welche bei ruhigem Gange der Thiere geschlossen ist, bei heftiger Bewegung, insbesondere beim Springen, aber entfaltet wird. Die Hörner, welche von beiden Geschlechtern getragen werden, erheben sich steil an der Stirn, biegen sich sodann gleichzeitig nach außen und hinten, hierauf wieder etwas nach vorn und wenden sich mit den Spitzen nach einwärts, sind also verdreht leierförmig. Der Leib ist ebenso kräftig wie zierlich gebaut, der Kopf mäßig groß, der Hals schlank, der Schwanz mittellang, die Füße sind ziemlich hoch, die Ohren lang und zugespitzt, die Augen sehr groß, glänzend und lang bewimpert, die Thränengruben klein und undeutlich.
Der einzige Vertreter dieser Gruppe ist der Springbock, Prunk- oder Zugbock ( Antilope Euchore, Gazella und Antidorcas Euchore, Intilope dorsata und saliens), eine wundervolle Antilope von anderthalb Meter Länge, wovon 20 Centimeter auf den Schwanz gerechnet werden müssen, und 85 Centim. Schulterhöhe. Die Färbung ist ein lebhaftes, dunkles Zimmetgelb; ein Streifen, welcher von der Wurzel der Hörner durch die Augen und gegen die Nase verläuft, und ein breiter anderer, welcher sich längs der Seite zwischen den Oberarm und Oberschenkel erstreckt, sind nußbraun, alle übrigen Theile weiß, und deshalb hat Lichtenstein so unrecht nicht, wenn er die Hauptfärbung des Thieres schneeweiß nennt und bemerkt, daß sich von den Schultern bis zu den Keulen zu beiden Seiten des Rückens ein breiter, isabellfarbiger, unten kastanienbraun gesäumter Streifen hinzieht. Die schwarzen Hörner erreichen, der Krümmung nach gemessen, eine Länge von 30 bis 40 Centim. und zeigen ungefähr zwanzig vollständige Ringe, sind jedoch an der Spitze glatt. Die schneeweißen Haare, welche die Rückenfalte auskleiden, haben eine Länge von 20 bis 25 Centim. Das Weibchen gleicht in der Färbung dem Männchen vollständig, ist jedoch kleiner und sein Gehörn weit schwächer, demgemäß auch minder stark gebogen; sein Euter hat zwei Zitzen.
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von der Ansiedelung am Vorgebirge der guten Hoffnung bis jenseit des Gleichers, möglicherweise noch weiter nach Norden hin, da einzelne Reisende das Thier sogar in den Steppen von Westkordofân beobachtet haben wollen. Im Kaplande, insbesondere in der Karu, überhaupt in den nördlichen Theilen der Ansiedelung, kommt der Springbock noch regelmäßig, in einzelnen Jahren in ungeheueren Scharen vor, obgleich sein eigentliches Wohngebiet mehr im Innern Südafrikas zu suchen ist. Im Norden des Kaplandes liegen ausgedehnte, quellenlose Ebenen, in denen der Mensch nur während der Regenzeit wohnen kann. Am Ende der letzteren bleiben noch Tümpel schlechten Wassers übrig, welche dem Wilde genügen. Diese Einöden, wahre Wüsten, sind die eigentliche Heimat der Springböcke. Hier leben sie unter regelrechten Verhältnissen in kleinen oder größeren Trupps; hier ernähren sie sich von den wenigen, aber saftigen und würzigen Pflanzen, welche der arme Boden hervorbringt; hier pflanzen sie sich fort; hier vermehren sie sich zu hunderttausenden und aberhunderttausenden, das unendlich weite Gebiet förmlich erfüllend. Wenn nun, wie es etwa alle vier oder fünf Jahre geschieht, anhaltende Dürre eintritt und die Tümpel austrocknen, treibt der Mangel die Millionen von Thieren südwärts nach dem Kaplande, und hier brechen sie ein, alles verheerend und vernichtend, was grün ist. Erst wenn es wieder regnet und das verbrannte Land von neuem mit Pflanzen sich bedeckt, ziehen sie in ihre friedlichen Ebenen zurück. Tausende und abertausende vereinigen sich zu diesen sonderbaren Pilgerschaften oder »Treckbocken«, wie die holländischen Boers sie nennen, und die Schwärme wachsen an wie die der Heuschrecken.
»Jeder Reisende«, sagt Kapitän Gordon Cumming, »welcher die ungeheueren Massen, in denen der Springbock bei seinen Wanderungen erscheint, gesehen hat, wie ich, und von dem, was er gesehen, eine wahrhafte und getreue Beschreibung gibt, muß fürchten, Unglauben zu ernten: so wunderbar ist der Anblick der wandernden Herde. Treffend und richtig hat man sie mit den verheerenden Heuschreckenschwärmen verglichen, welche dem Wanderer in diesem Lande der Wunder so gut bekannt sind: ebenso wie diese verzehren sie in wenigen Stunden alles Grün auf ihrem Wege und vernichten in einer einzigen Nacht die Frucht langjährigen Fleißes eines Landwirtes.
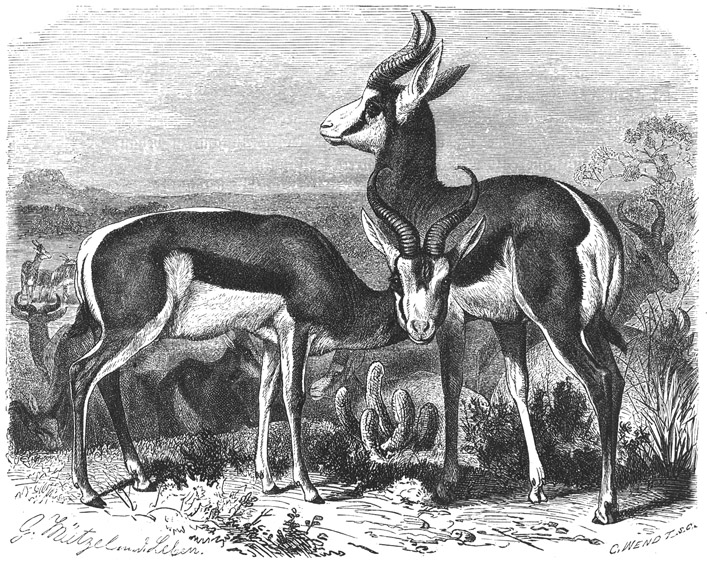
Springbock ( Antilope Euchore). 1/14 natürl. Größe.
»Am 28. December hatte ich die Freude, zum erstenmal einen Treckbocken zu sehen. Es war dieses, glaube ich, in Bezug auf Jagdthiere das großartigste, gewaltigste Schauspiel, welches ich jemals gehabt habe. Seit ungefähr zwei Stunden vor Tagesanbruch hatte ich wach in meinem Wagen gelegen und auf das Grunzen der Böcke gehört, welches ich in einer Entfernung von ungefähr zweihundert Schritten wahrnahm. Ich glaubte, daß irgend eine große Herde von Springböcken neben meinem Lager grase; als es aber hell geworden und ich aufwachte, sah ich die ganze Ebene buchstäblich mit einer ungeheueren Menge dieser Thiere bedeckt. Sie zogen langsam hin und her. Von einer Oeffnung in der langen Hügelreihe gegen Westen, durch welche sie wie das Wasser eines großen Flusses zu strömen schienen, erstreckten sie sich bis an eine Anhöhe, ungefähr eine Meile nordöstlich, hinter welcher sie verschwanden. Ich stand beinahe zwei Stunden auf dem Vorderkasten meines Wagens, verloren in Erstaunen über den wundervollen Anblick, und es kostete mir einige Mühe, mich zu überzeugen, daß es Wirklichkeit war, was ich hier sah und nicht etwa das abenteuerliche Traumbild eines Jägers. Während dieser Zeit strömten die unzählbaren Massen ohne Ende durch jene Hügelöffnung hindurch. Endlich sattelte ich mein Pferd, nahm meine Büchse, ritt mit den Nachreitern mitten unter die Thiere hinein und feuerte, bis vierzehn Stück gefallen waren. Dann rief ich: Halt! Genug! Wir kehrten nun um, um das Wildpret vor den gefräßigen Geiern zu sichern, und nachdem wir die geschossenen Springböcke in das Gebüsch getragen und mit Reisern zugedeckt hatten, wandten wir uns nach unserem Lager zurück.
»Wem daran gelegen hätte, der würde an diesem Morgen Gelegenheit gehabt haben, dreißig bis vierzig zu erbeuten. Niemals während meines spätern Jägerlebens stieß ich auf eine so dichte Herde wie an diesem Tage; auch gestatteten sie mir nie wieder, so weit in sie hineinzureiten.
»Nachdem wir angespannt hatten, fuhren wir mit dem Wagen hinaus, um das geschossene Wild zu holen. So ungeheuer und überraschend die Herde von Springböcken war, welche ich an diesem Morgen sah, so wurde sie doch noch bei weitem von der übertroffen, welche ich abends erblicken sollte. Denn als wir die niedere Hügelkette, durch deren Paß die Springböcke geströmt waren, überstiegen hatten, sah ich die Ebene und sogar die Hügelabhänge, welche sich ringsum hinzogen, dicht, nicht mit Herden, sondern mit einer einzigen Masse von Springböcken bedeckt. So weit das Auge reichte, wimmelte die Landschaft von ihnen, bis sie endlich in ein undeutliches Wirrsal lebendiger Geschöpfe verschwommen.
»Es wäre vergebliche Mühe gewesen, die Anzahl der Antilopen, welche ich an diesem Tage sah, zu schätzen; doch nehme ich nichtsdestoweniger keinen Anstand zu behaupten, daß einige hunderttausende sich innerhalb meines Gesichtskreises befanden.«
Wir könnten versucht sein, diese lebendige Schilderung des bekannten afrikanischen Jägers für eine echte Jagdgeschichte zu halten, wenn nicht alle Reisenden die Wahrheit jener Angaben bestätigten. Auch Le Vaillant spricht von Herden von zehn- bis fünfzigtaufend Stück, welche von Löwen, Leoparden, Luchsen und Hiänen verfolgt werden, und Eduard Kretschmar erzählt von Massen, welche er nach Millionen schätzt. Kretschmar ritt während einer Dürrung, welche schon über Jahresfrist angehalten und zahlreiches Vieh getödtet hatte, mit den holländischen Boers vor Tagesanbruch nach einem Passe, durch welchen muthmaßlich Scharen von Springböcken ins Land hereinbrechen wollten. Bald kamen die Vorposten der Böcke, zu zwei und drei, zu zehn und zwanzig, dann zweihundert und vierhundert; endlich drängte sich der ganze Paß dicht voll, und über ihnen wirbelten Staubwolken und schwärmten Geier. Die Hunde wurden losgelassen und verschwanden unter der Masse; die Schüsse krachten. In kurzer Zeit waren mehr als zweihundert Böcke erlegt. Schnell wurden Anstalten gemacht, sie wegzuschaffen. Da drängte sich eine neue Herde von etwa zwanzigtausend heran. Einer von den Leuten wurde über den Haufen gerissen, und so zusammengetreten, daß man ihn nachher bewußtlos und ganz mit Erde bedeckt fand, erholte sich jedoch allmählich, da er glücklicherweise mit dem Gesicht auf der Erde gelegen hatte. Bei diesem zweiten Durchzuge wurden wiederum hundert Stück geschossen. Man schnitt allen den Kopf ab; das übrige wurde auf Wagen und Pferden nach Hause geschafft. Währenddem waren auch durch andere Pässe Massen von Springböcken durchgedrungen, und man sah auf der sechs deutsche Meilen sich hinstreckenden Fläche Millionen von diesen Thieren weiden. Man brachte auch Nachricht, daß beim Uebergang über den Karre, in geringer Entfernung vom Krahl, mehrere Hunderte vom Felsen gestürzt und leicht zu holen wären. So wurde denn auch dorthin ein neuer Zug veranstaltet und eine Anzahl von etwa zweihundert Stück auf Wagen geladen. Zu Hause war dann alles damit beschäftigt, das Fleisch in dünne Streifen zu schneiden und überall im Hause und um das Haus auf dünne Stöcke, auf Bettpfosten, auf jeden brauchbaren Gegenstand zu legen, wo es bald von Fliegenwolken umschwärmt wurde. Die Keulen wurden eingesalzen, die Felle auf dem Erdboden ausgebreitet und mit Pflöcken befestigt. Getrocknet dienen diese vorzüglich, um den Fußboden der Zimmer zu belegen. Das Fleisch, welches vortrefflich schmeckt, wird im getrockneten Zustande vielfach benutzt.
Die Richtung, welche die wandernden Antilopen einschlagen, ist nicht immer dieselbe. Gewöhnlich kehren sie auch auf einem andern Wege zurück, als auf dem, welchen sie gezogen waren. Ihre Weglinie bildet deshalb gewöhnlich ein ungeheures langgezogenes Eirund oder ein großes Viereck, dessen Durchmesser vielleicht einige hundert Meilen beträgt. Diese Bahn wird von den Thieren in einer Zeit von sechs Monaten bis zu einem Jahre durchzogen. Wunderbar ist der Zusammenhalt einer so sich bewegenden Herde. Harris erzählt, daß eine Schafherde, welche einmal zufällig unter die wandernden Springböcke gekommen war, gezwungen wurde, mit diesen zu laufen, wohin sie gingen, ohne daß der Hirt vermochte, seine Schutzbefohlenen wieder zu befreien. Selbst der mächtige Löwe, welcher diesen Antilopen eifrig nachstellt, soll manchmal von den Herden geradezu gefangen werden. So groß auch der Schrecken sein mag, welchen das Raubthier den wehrlosen Wiederkäuern bereitet: diejenigen, welche den Schrecken empfinden, sind nicht im Stande, dem Andrängen der anderen, welche von dem fürchterlichen Räuber nichts wissen, zu widerstehen, und der Löwe seinerseits muß wohl oder übel mit der Masse fortwandern, weil er sich durch die lebenden Haufen, welche jeden Augenblick wechseln und sich neu ersetzen, unmöglich einen Ausgang bahnen kann. Die Angabe klingt sehr sonderbar, scheint jedoch nicht gänzlich unwahrscheinlich zu sein. Die Nachzügler des Heeres freilich können den zahllosen hungrigen Feinden, welche diesen Zügen folgen, nicht widerstehen; aber alle die Löwen, Leoparden, die Hunderte von Hiänen und Schakalen, welche die Herde umschwärmen, die tausende von Geiern, welche in den Lüften über ihr kreisen, brauchen sich auch nicht eben anzustrengen; denn von den Hunderttausenden der wandernden Antilopen gehen täglich so viele an Nahrungsmangel zu Grunde, daß alle Räuber genug zu fressen haben.
Noch wird erwähnt, daß beständig der Vor- und Nachtrab wechselt. Diejenigen, welche den Haufen anführen, finden selbstverständlich mehr Nahrung als die, welche da weiden wollen, wo schon tausende vor ihnen sich gesättigt haben; jene erwerben sich also ihr tägliches Brod mit leichter Mühe und werden feist und faul. Damit aber ist ihre gute Zeit auch vorbei; denn jetzt drängen sich die hungrigen mit Macht hervor, und mehr und mehr bleiben die gemästeten zurück, bis sie an das Ende des Zuges gelangen. Einige Tage der Reise und des Mangels spornen dann wieder sie an, ihre Stelle im Vortrab von neuem sich zu erobern, und so findet ewig ein Hin- und Herwogen in der gesammten Herde statt.
Der Springbock hat von den Ansiedlern seinen Namen mit Recht erhalten. Verfolgt flüchtet die von ihm gebildete Herde und macht eine Reihe seltsamer, senkrechter Sprünge, indem sich einer nach dem andern mit gekrümmten Läufen hoch in die Lüfte erhebt und gleichzeitig das schneeweiße und lange Haarkleid längs des Rückens flattern läßt, hierdurch ein wahrhaft feenhaftes Aussehen erlangend, welches diese Antilope von jeder andern unterscheidet. »Der Anblick einer solchen fliehenden Herde von einigen hundert Springböcken«, sagt Lichtenstein, »ist auch für jemand, welcher nicht Jäger ist, äußerst unterhaltend. Sie laufen eine Strecke sehr rasch; sowie ihnen aber ein Busch oder ein Felsen im Wege steht, schnellen sie sich behende über ihn weg, stehen dann wieder still, sehen sich um, und plötzlich setzt sich dann wieder die ganze Herde in die eiligste Bewegung mit abwechselnden Laufen und Springen. Sind ihrer viele beisammen, so sieht man sich nicht müde daran, wie hier und dort einer sich in die Luft schnellt.« Sie springen zuweilen über zwei Meter hoch und mit jedem Sprunge über vier bis fünf Meter weit, ohne daß es ihnen die geringste Anstrengung zu kosten scheint. Vor dem Sprunge beugen sie den Kopf nieder und gegen die Vorderläufe, schnellen sodann mit allen vier Läufen zugleich auf, erheben sich mit stark gebogenem Rücken bis zu der angegebenen Höhe, gewöhnlich jedoch minder hoch, und breiten, während sie emporsteigen, fächerförmig ihre Hautfalte aus. Einen Augenblick lang scheinen sie gleichsam in der Luft zu schweben, kommen sodann mit allen vier Füßen zugleich herunter, fallen auf den Boden und steigen wieder in die Höhe, als ob sie davonfliegen wollten. So bewegen sie sich nur einige hundert Schritte weit, nehmen dann einen leichten federnden Trab an und neigen ihren schön geformten Hals und die Nase auf den Boden. Wenn sie einen Feind erblicken, machen sie plötzlich Halt, drehen sich herum und fassen den Gegenstand ihres Schreckens ins Auge. Kommen sie an einen Weg oder an eine Fahrstraße, welche vor kurzem von Menschen betreten wurde, oder kreuzen sie einen Pfad, auf welchem ein ihnen furchtbares Raubthier wandelte, so springen sie mit einem einzigen Satze darüber hinweg, und wenn eine Herde von vielleicht vielen tausenden einen derartigen Weg verfolgt, gewährt sie einen überaus schönen Anblick, weil jeder einzelne Bock denselben kühnen Sprung thut.
Obwohl der Springbock häufig eigene Herden bildet, trifft man ihn doch gewöhnlich in Gesellschaft von Gnus, Bläßböcken, Quaggas und Straußen an. Flüchtig wie der Wind und seiner Schnelligkeit sich vollkommen bewußt, schlendert er, laut Harris, in jenen bunten Herden anscheinend äußerst sorglos umher, nähert sich gelegentlich mit empor gehobenem Halse einer gefallsüchtigen Rike seiner Art und öffnet dann und wann seine Rückenfalte, so daß das hervortretende weiße Haar mit einem Male eine vollständige Umwandlung seines Aeußern hervorbringt, da hierbei die braune Färbung fast gänzlich verschwindet. Niemals aber setzt er bei derartigen Spielen seine Sicherheit aus dem Auge. Wachsamer als irgend eine andere Antilope, gibt er stets zuerst das Zeichen zur Flucht und leitet dann die sich zurückziehende Herde. Beim Erscheinen eines fremden Gegenstandes spitzt er das Gehör, erhebt sein Haupt, trottet ungeduldig ein wenig vor, um sich zu überzeugen, ob das Gesehene wohl feindlich sein möge, biegt im bejahenden Falle den Kopf zum Boden und beginnt nun, wie die Ansiedler sagen, zu prunken, d. h. in der eben beschriebenen Weise emporzuspringen und dabei seine volle Schönheit zu entfalten. Auch Harris versichert, daß das Thier, einmal flüchtig geworden, sich bis zu drei Meter über den Boden erhebe und bis fünf Meter weite Sätze ausführen kann.
Die Bakalaharikaffern, denen diese wandernden Herden Nahrung in Hülle und Fülle bringen und eine Reihe von Festtagen gewähren, zünden der Springböcke wegen vor der Regenzeit weite Strecken der Steppe an, damit hier um so leichter ein frisch grüner Teppich von saftigem Grase, den Böcken zum höchst willkommenen Weideplatze, über den verbrannten Boden sich legen möge. Selten gewahrt man diese in dem hohen, schilfartigen Grase, welches so große Strecken ihrer Heimat überzieht. Sie sind entschiedene Liebhaber der zartesten Pflanzen und kommen zu solchen frischgrünen Orten von weither herbeigezogen, dem Menschen reiche Beute versprechend.
Jung aufgezogene Springböcke werden bald zahm. Diejenigen, welche ich sah und pflegte, waren scheu und vorsichtig Fremden gegenüber, zeigten sich aber muthwillig, wenn sie es mit Bekannten zu thun hatten. Mehrere zusammen in einem Raume vertragen sich nicht immer; zumal die Böcke zeigen sich als zänkische Gesellen, welche selbst die Riken quälen oder mindestens plagen. Abgesehen von dieser Unfriedfertigkeit sind die gefangenen Springböcke reizende Erscheinungen. Ihr weiches, farbenprächtiges Kleid, ihre anmuthige Gestalt und die Zierlichkeit ihrer Bewegungen fesseln auch dann noch jedermann, wenn die Thiere im engen Raume des Geheges eigentlich gar nicht zur Geltung kommen. Leider gelangen wenige von ihnen lebend zu uns. Die lange Seereise raubt mehr als die Hälfte von denen, welche am Kap eingeschifft werden; das Klima und mehr noch die so vielen Antilopen entsetzliche Enge des Aufenthaltsortes, welchen man ihnen anweisen kann, wird den übrig gebliebenen oft verderblich. Bei weitem die meisten von allen, welche in Thiergärten zu Grunde gehen, verlieren ihr Leben durch eigene Schuld. Ohne erklärliche Ursache stürmen sie manchmal gegen die Gitter an und brechen sich die Läufe oder verletzen sich anderweitig, so daß sie plötzlich todt zusammenbrechen.
Ueber die Fortpflanzung finde ich auffallenderweise noch gar keine sichere Nachricht.
Auf die Gazellen mögen die Kuhantilopen ( Bubalis) folgen, da sie gewissermaßen Uebergangsglieder von jenen zu den schweren Formen der Familie bilden. Die von einzelnen Thierkundigen wiederum in Unterabtheilungen zerfällte Gruppe umfaßt große, kräftige, fast plump gebaute Antilopen mit hohem Widerrist und abschüssigem Rücken, ungestaltetem, langgestrecktem, breitschnauzigem Kopfe, kurzem Halse, kräftigen Gliedmaßen, auf der Stirnleiste stehenden, verschieden, immer aber doppelt gebogenen, beiden Geschlechtern zukommenden Hörnern, kleinen Thränen-, deutlichen Weichengruben und kleiner oder fehlender Muffel.
Verhältnismäßig zierlich gebaute Arten der Gruppe, und deshalb als Vertreter einer besondern Untersippe ( Damalis) angesehen, sind der Buntbock und der Bläßbock, wie die Ansiedler des Vorgebirges sie nennen.
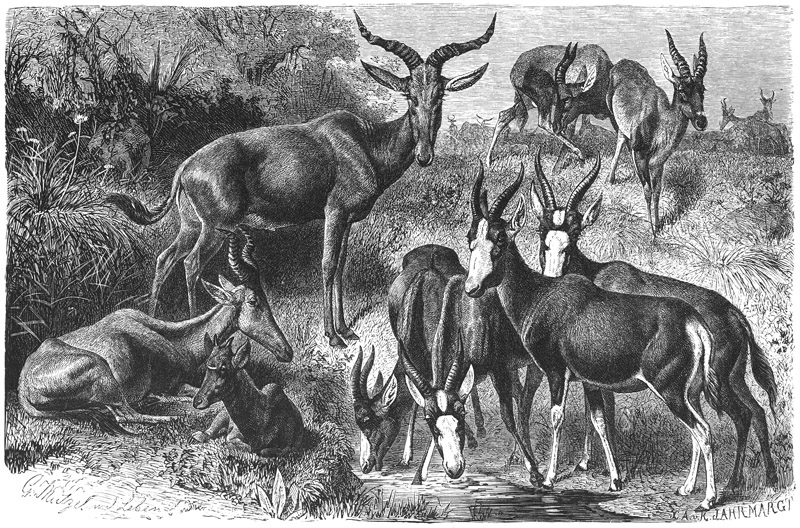
Tora. Buntbock. Bläßbock. Senegalantilope.
Kuhantilopen.
Ersterer ( Bubalis pygarga, Antilope, Damalis und Gazella pygarga) erreicht bei 1,2 Meter Schulterhöhe eine Gesammtlänge von 2 Meter, wovon auf den Schwanz 45 Centimeter zu rechnen, und trägt Hörner von 40 Centimeter Länge, welche auf der Stirnleiste aufgesetzt sind, unten auf- und auswärts, in der Mitte rück- und seitwärts, am Ende wiederum aufwärts gebogen, bis zu zwei Drittheilen ihrer Länge mit zehn bis fünfzehn starkwulstigen Querringen besetzt, dazwischen gestreift, an der Spitze aber glatt und schwarz von Farbe sind. Die Färbung der Kopfseiten, des Halses, Oberrückens und der Seiten ist ein tiefes Purpurbraun mit röthlichem Schimmer; eine zwischen den Hörnen beginnende, die ganze Vorder- und Oberseite des Kopfes einnehmende Blässe, die Ohren, ein dreieckiger Spiegel auf den Hinterbacken, die Unterseite des Leibes, die Innenseite der Läufe und diese vom Unterschenkel an abwärts sowie die Wurzelhälfte des Schwanzes sind weiß, beide Oberschenkel, verbunden durch einen oben und unten blaß-zimmetbraun gesäumten Längsstreifen über die Weichen sowie zwei gürtelartige Flecken an den vorderen Unterschenkeln, und die Schwanzspitze endlich schwarz. Das Weibchen unterscheidet sich nur durch geringere Größe und das dünnere und schlankere Gehörn.
Der Bläßbock ( Bubalis albifrons, Antilope albifrons und und nasomaculata?) ist etwas kleiner und kurzhörniger, im allgemeinen aber dem Buntbock sehr ähnlich gezeichnet. Auch bei ihm sind die in gleicher Ausdehnung den Vorderkopf bedeckende Blässe, die Ohren, ein schmaler dreieckiger Spiegel, die Unterseite und die Innenseite der Läufe weiß, Kopf und Hals braunroth, eine sattelförmige Stelle auf Rücken und Schultern bläulichweiß, ein breites Band von den Vorder- zu den Hinterschenkeln wie diese selbst und ein Gürtelband an den Unterschenkeln braun, die Haare der Schwanzquaste schwarz.
Im Innern Afrikas, von hier aus nach Westen hin sich verbreitend, gesellt sich zu den genannten die gleich große Senegalantilope oder der Korrigum ( Bubalis senegalensis, Antilope und Boselaphus senegalensis), gekennzeichnet durch die kurzen, knotigen, wenig gebogenen, an der Wurzel einander sehr nahe stehenden, gleichlaufend aufsteigenden, sodann auseinandergehenden, mit der Spitze wieder genäherten Hörner, erdgraue Färbung, einen dunkelgrauen Fleck am Auge und einen ebenso gefärbten breiten Fleck auf Ober- und Unterschenkel.
Eine zweite Untersippe bilden die Kuhantilopen in engstem Sinne ( Alcelaphus), von denen eine Art den Norden, eine andere den Süden bewohnt.
Erstere, die schon den Alten unter dem Namen Bubalus bekannte, auf den egyptischen Denkmälern vielfach dargestellte Steppenkuhantilope, Tetel der Araber, Tori und Tora der Abessinier ( Bubalis bubalis, Antilope, Alcelaphus, Boselaphus, Damalis und Acronotus bubalis, Bubalis mauretanica), erreicht fast Hirschgröße, nämlich eine Länge von 2,8 Meter, wovon der Schwanz beinahe einen halben Meter wegnimmt, und reichlich 1,5 Meter Höhe am Widerrist. Die starken, hoch oben am Scheitel aufgesetzten, in den unteren zwei Drittheilen mit schraubenförmigen Wülsten versehenen Hörner entspringen dicht bei einander, beugen sich anfangs in einem sanften, aufrechten Bogen etwas aufwärts, sodann mit einer stärkern Schwingung nach hinten, um endlich mit aufwärts gerichteten, stumpfen Spitzen zu enden; die rundlichen Thränengruben werden von Haarwülsten umgeben, die Ohren sind groß, lang und spitzig. Das glatte Haar ist gleichmäßig lichtrothbraun, die dicke Schwanzquaste schwarzbraun gefärbt.
Von der Steppenkuhantilope unterscheidet sich die südafrikanische Kama, das Hartebeest, zu deutsch Hirschkuhantilope, der Ansiedler ( Bubalis Caama, Antilope Alcelaphus, Boselaphus und Acronotus Caama) durch ihren noch mehr verlängerten und schmäleren Kopf und die stärkeren, in schärferen Winkeln gebogenen Hörner, die verhältnismäßig kleineren Ohren und die Färbung. Das an der Wurzel sehr starke, kurze Gehörn, welches ungefähr sechszehn Knoten zeigt, steigt anfangs neben einander gehend aufwärts, zieht sich sodann in gleichlaufender Richtung etwas nach vorn und biegt sich im letzten Drittheil mit der scharfen Spitze wieder auswärts und fast rechtwinklig nach rückwärts. Auch bei dieser Antilope ist die vorherrschende Färbung ein schönes, lichtes Zimmetbraun; die Stirn und die Vorderseite des Kopfes sind dunkelbraun, zwei Längsstreifen, welche auf den Unterschenkeln der Vorder- und Hinterläufe beginnen und sich verschmälert auf der Vorderseite der Fußwurzel herabziehen, sowie die Schwanzquaste schwarz, ein brillenartiger Fleck um das Auge, Unterbrust, Bauch, Innenseite der Hinterschenkel und ein breiter, halbmondförmig in den Schenkel eingreifender Spiegel endlich weiß.
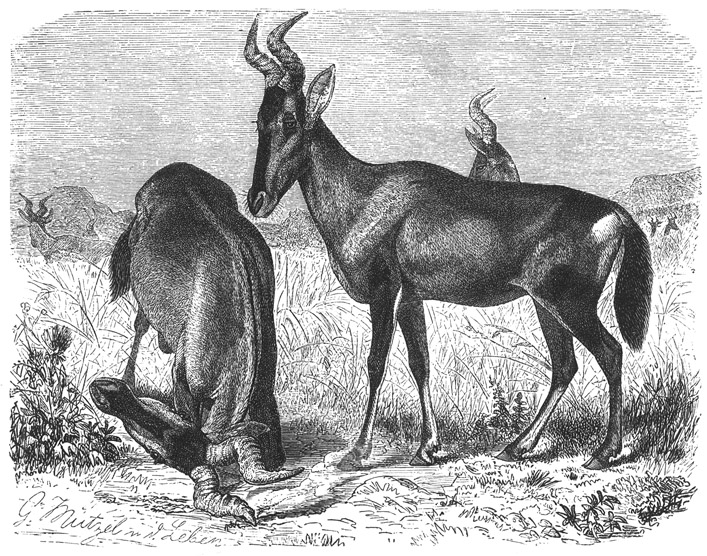
Hartebeest ( Bubalis Caama). 1/20 natürl. Größe
Alle diese Antilopen geben sich auch in Bezug auf Lebensweise, Wesen und Betragen als nahe Verwandte zu erkennen. Der Buntbock, wohl die schönste Art der Gruppe, bevölkert mit seinem nächsten Verwandten, dem Bläßbock, in sehr zahlreichen Herden die Hochebenen des inneren Südafrika, von hier aus bis zum Gleicher und vielleicht noch weiter nördlich sich verbreitend und Steppengelände mit stehenden Gewässern allen übrigen Oertlichkeiten vorziehend. Da, wo der weiße Mann mit seinen vernichtenden Geschossen sich nur selten zeigt, sieht man, laut Harris, hunderte und aberhunderte dieser Antilopen, zu mehr oder minder zahlreichen Herden geschart, in der Nachbarschaft solcher Lachen sich umhertreiben, das ausblühende Salz begierig lecken, zu bestimmten Zeiten zur Tränke kommen und dann wiederum auf der weiten Steppe sich vertheilen, um hier sich zu äsen. Oft mischen sich auch Bläßböcke, fast regelmäßig Gnus oder Kokuns und Springböcke, ebenso wie Straußen unter die bunte Herde, welche dadurch in noch höherem Grade als sonst die Aufmerksamkeit des Reisenden auf sich lenkt und die Jagdlust des Wildschützen anregt. In früheren Zeiten bewohnte die schöne Antilope auch das Kapland und zwar in kaum geringerer Anzahl als der Springbock; die Schlächtereien aber, in welche die ungezügelte Jagd- oder richtiger Mordlust der Bauern ausartete, haben sie ausgerottet, und es bedurfte des Eingreifens der Regierung, welche eine Strafe von fünfhundert Reichsdollars auf das Tödten eines Buntbockes setzte, um sie in dem einzigen Gebiete von Zwellendam zu erhalten. Dem Bläßbocke würde unzweifelhaft bereits dasselbe Schicksal beschieden sein, läge der Mittelpunkt seines Verbreitungsgebietes nicht weiter im Norden als der seines Verwandten. Ueber die Senegalantilope haben wir erst durch Heuglin nähere Nachrichten erhalten. Lange Zeit kannte man nichts weiter als Schädel und Gehörn dieses schönen Thieres, welches neuerdings dann und wann auch lebend nach Europa gelangt. Im Innern Afrikas bewohnt diese Antilope besonders häufig die Ebenen zwischen dem Kir- und Djurflusse. Während der nassen Jahreszeit lebt sie auf den trockneren, offenen Triften in Rudeln von zehn bis dreißig Stück; wenn die Teiche und Regenbetten vertrocknen, sammelt sie sich in den Sumpfgebieten um die größeren Flüsse. Besonders gern hält sie sich auf lichten Weideplätzen und namentlich in Gegenden auf, wo sich viele Termitenhügel und Bauhiniengebüsche finden. Ihre etwas schwerfälligen Bewegungen erinnern an die der Steppenkuhantilope, mit welcher sie auch die geringe Scheu vor dem Menschen theilt. Letztere, der Tetel, kommt nur im Herzen Afrikas, dann und wann mit den bisher genannten zusammen, da ihr Verbreitungsgebiet weiter im Norden und namentlich im Nordosten des Erdtheils liegt. In den Steppen an den Westabfällen des abessinischen Hochlandes wie in den weiten Gebieten um den Barka und Atbara ist sie häufig, in den Steppen und Wüsten westlich vom Nile wenigstens nicht selten; einzelne sollen sogar in der Nähe der Oasen im Westen von Egypten noch gefunden werden: daß sie im Westen der Wüste, südlich vom Atlas überall häufig vorkommt, unterliegt keinem Zweifel. Soweit sich jedoch auch ihr Verbreitungsgebiet ausdehnt, es steht an Umfang noch bedeutend zurück hinter dem der verwandten Kama; denn diese bewohnt nicht allein die ganze südliche Hälfte Afrikas, sondern in großer Anzahl auch die Mitte und den Westen des Erdtheils, da sie von Heuglin und Schweinfurth in den oberen Nielgebieten überall in namhafter Menge angetroffen wurde. Dank den Beobachtungen der letztgenannten Forscher und namentlich Schweinfurths kennen wir gegenwärtig die Kama genauer als ihre Verwandten und dürfen deshalb vorzugsweise sie ins Auge fassen, wenn es sich darum handelt, ein Gesammtbild ihrer Gruppe zu entwerfen.
In früheren Zeiten überall häufig im Gebiete der Ansiedlungen am Vorgebirge der Guten Hoffnung, ist das Hartebeest infolge unablässiger Verfolgungen gegenwärtig hier sehr zusammengeschmolzen, und kein Verbot hindert seine gänzliche Vernichtung. Erst im Norden der Ansiedelungen oder der durch Jäger besuchten Gegenden findet es sich in größerer Anzahl, und im Herzen Afrikas gehört es auf geeigneten Oertlichkeiten zu den häufigsten Antilopen. Heuglin beobachtete es paarweise und in Familien in dem lichteren Waldgürtel am Bahar el Djebel nicht selten, Schweinfurth lernte es als einen der gemeinsten Bewohner der Bongo- und Niam-Niam-Länder kennen. »Am häufigsten«, sagt er, »stößt man auf Rudel von fünf bis zehn Stück in den unbewohnten Grenzwildnissen; in den bebauten Gegenden bevorzugt das Thier den lichten Buschwald in der Nachbarschaft die Flußniederungen, ohne diese selbst zu betreten. Es hat die Gewohnheit, um die Mittagszeit an Baumstämmen oder an hell von der Sonne beschienenen Termitenhügeln stehenden Fußes zu rasten und entzieht sich alsdann durch seine beharrliche Ruhe und die bevorzugte Wahl eines völlig gleichfarbenen Hintergrundes oft lange den Blicken des Spähenden.« Laut Harris steht jedem Rudel ein alter Bock vor, welcher, wie so viele andere Antilopen auch, bei dem von ihm beherrschten, sich unterthan gemachten Trupp keinen zweiten seinesgleichen duldet. Trotz der unschönen Gestalt und des häßlichen und ungeschlachten Kopfes, welcher der Kama, wenn sie ausschreitet, ein ebenso auffallendes als plumpes Ansehen verleiht, macht sie doch einen majestätischen Eindruck auf den Beschauer, und zwar den besten, wenn sie sich in Galopp setzt. Im Anfange des Laufes sieht es freilich aus, als wäre sie auf den Hinterbeinen gelähmt; sobald sie jedoch einmal ordentlich in Bewegung gekommen ist, verschwindet dieser Eindruck vollständig. Sie fördert sich dann mittels eines wiegenden und gefügigen Trottes, trägt den Kopf mit dem schweren Gehörn erhaben wie ein edles Roß, hebt die Füße wie ein Schulpferd, peitscht den weißen Spiegel mit dem glänzend schwarzen Schwanze und stürmt so ziemlich eilfertig dahin. Bewegungslustig wie irgend eine andere Antilope, gefällt sie sich oft in wundersamen Sprüngen und Wendungen, gar nicht selten auch in eigenthümlichen Spielen. »In einem Abstande von kaum fünfhundert Schritten vom Wege«, erzählt Schweinfurth, »fesselte ein Trupp tändelnder Hartebeests unsere Aufmerksamkeit. Sie spielten mit einander in einer Weise, daß man glauben konnte, sie machten ihre Schwenkungen, gelenkt von unsichtbaren Reitern. Und dies alles geschah angesichts einer Karavane von einer halben Wegstunde Länge. Paarweise umjagten sie ein großes Baumwäldchen, wie in einer Arena im Kreise um dasselbe laufend; dabei standen andere Trupps von drei bis vier Hartebeesten als aufmerksame Beschauer still bei Seite und lösten nach einer Weile die kreisenden ab. So ging es fort, bis endlich meine Hunde auf sie losstürzten und sie nach allen Richtungen zerstreuten. Diesen Vorgang habe ich genau so beobachtet, wie ich denselben mit obigen Worten zu schildern versuchte. Ich glaube, die Thiere befanden sich in der Brunstzeit und waren in diesem Zustande blind gegen äußere Gefahr.« Inwiefern die Auffassung Schweinfurths berechtigt ist, geht am besten daraus hervor, daß solche Spiele beim Hartebeest und allen seinen Verwandten in ernste Zweikämpfe ausarten, sobald ein zweiter starker Bock bei dem Rudel sich einfindet. Wie schon die Alten von ihrem Bubalus erzählten, stürzen sie sich bei solchen Kämpfen auf den Boden, den Kopf zwischen die Vorderläufe gebeugt, nähern sich Stirn an Stirn und schlagen nun mit größter Wuth die Gehörne gegen einander, so daß ein auf weit hin hörbares, geräuschvolles Rasseln entsteht. Nicht selten verfangen auch sie sich wie kämpfende Hirsche und vermögen dann entweder gar nicht oder nur unter Verlust eines Hornes sich zu trennen. Die Wunden, welche kämpfende Böcke einander beibringen, sind tief und zerrissen, deshalb auch in hohem Grade gefährlich. In derselben Weise sollen sie sich gegen ihre Feinde vertheidigen und die meisten derselben erfolgreich sich vom Leibe halten.
Ueber die Zeit der Trächtigkeit fehlen noch bestimmte Beobachtungen. Die Satzzeit des einzigen Kalbes soll, laut Harris, am Vorgebirge der Guten Hoffnung in die Monate April und September fallen, woraus also hervorgehen würde, daß diese Antilope zweimal im Laufe des Jahres brünstig wäre. Gefangene haben sich auch in unseren deutschen Thiergärten wiederholt fortgepflanzt und Junge erzielt, welche man ohne Schwierigkeiten aufziehen konnte. Ein im Thiergarten zu Frankfurt geborenes Kalb der Steppenkuhantilope war größer als ein Hirschkalb, glich noch vielmehr, als die Alten den Rindern, einem Kuhkalbe, hatte sehr hohe Beine, zeigte schon einigermaßen den langen Kopf, aber eine sehr gewölbte Stirn und war röthlichgelb gefärbt wie die Alten. Sofort nach seiner Geburt lief es mit der Mutter durch sein Gehege, obwohl seine Bewegungen noch überaus ungelenk waren, und sein Galopp an den der Girafen erinnerte. Nach anderweitigen Beobachtungen brechen ungefähr im dritten Monate des Lebens die Hörner durch; es bedarf jedoch mehrerer Jahre, bevor sie ihre eigenthümliche Krümmung erhalten, und sie sind demgemäß in verschiedenen Zeitabschnitten von denen der alten Thiere gänzlich verschieden, ändern auch ihre Gestalt und Biegung bis zum vollendeten Wachsthume fast ununterbrochen.
Von Jugend an unter menschlicher Pflege stehende Kuhantilopen werden ungemein zahm, folgen ihrem Pfleger auf dem Fuße, nehmen ihm Brod und andere Leckereien aus der Hand und geben ihm ihre Zuneigung auf mancherlei Weise zu erkennen. Leider aber hält dieses schöne Verhältnis niemals längere Zeit an; denn sobald sie sich ihrer Stärke bewußt werden, bekunden sie, insbesondere die Böcke, die Rauflust ihres Geschlechtes und zeigen sich gewöhnlich am allerbösartigsten gegen dieselben Personen, denen sie früher Anhänglichkeit bewiesen. Alten Thieren ist ebensowenig zu trauen wie anderen großen Antilopen: sie sind launenhaft, leicht reizbar und lassen es dann keineswegs bei bloßer Abwehr genügen, sondern werden meist selbst zum angreifenden Theile.
Außer den großen Katzenarten, namentlich Löwen und Leoparden, welche den Kuhantilopen eifrig nachstellen sollen, werden diese von Schmarotzern überaus gequält. Eine Biesfliegenart legt ihre Eier unter der Haut, eine andere in der Nasenschleimhaut der Antilopen ab, und es entwickeln sich Maden, welche zwar durch Niesen und Schnauben oft bündelweise entfernt werden, dem Nährthiere aber entsetzliche Qualen bereiten.
Gejagt werden Kuhantilopen überall, wo sie vorkommen, und zwar von den Eingeborenen wie von den Weißen. Sie haben die Gewohnheit, wenn sie sich verfolgt sehen, immer einen bestimmten Abstand zwischen sich und dem Jäger einzuhalten, diesen somit gewissermaßen zu foppen und zu verspotten, da sie nur für die weittragendsten Büchsen schußgerecht aushalten. Berittene Jäger kommen ihnen eher nahe; niederhetzen aber, wie andere schwere Antilopen, lassen sie sich nicht. Das Wildpret wird überall hochgeschätzt, da es zu dem schmackhaftesten zählt, welches die Antilopenfamilie liefert. Am Kap pflegt man es in Streifen zu schneiden, an der Luft zu dörren und später zur Herstellung kräftiger Suppen zu verwenden. Das Fell benutzt man zu Decken, aus der gegerbten Haut bereitet man Riemen und Geschirre, die Hörner werden ihrer Härte und des Glanzes halber zu allerlei Geräthschaften und Schmuckgegenständen verarbeitet.
Die wenig bekannte Gruppe der Rückendrüsenantilopen ( Adenota), welche hauptsächlich West- und Innerafrika bewohnt, kennzeichnet sich durch anmuthige, gazellenartige Gestalt, ziemlich kräftige, und an der Wurzel fast aufrecht, sodann aus- und rückwärts, mit den Spitzen sanft vorwärts gekehrte, unten zusammengedrückte, in der Mitte gestreifte, an den Spitzen glatte, von der Wurzel an mit starken Halbringen versehene Hörner, große Ohren, kurzen Schwanz und mäßig hohe Läufe. Thränengruben sind vorhanden, bei einzelnen Arten findet sich auch ein Drüsenhöcker. Die Weibchen sind ungehörnt.
Wir verdanken Heuglin die Schilderung einer am obern Weißen Nile lebenden, von den Negern Abok genannten Art ( Adenota megaceros, Antilope und Redunca megaceros), welche die Größe eines starken Damhirsches, gedrungene Glieder, einen stark behaarten Hals, ziemlich langen, an der Spitze flockigen Schweif, auf dem Widerriste einen Fettbuckel und ein bis 60 Centimeter langes, in der Mitte stark nach hinten und auswärts gebogenes Gehörn hat. Die lange, straffe Behaarung ist dunkel-umberbraun, Auge und Schläfegegend, Ohren, Nasenspitze, ein Nackenfleck und der Höcker sind gelblichweiß, die Untertheile gelblichbraun.
»Der Abok«, sagt Heuglin, »scheint nicht gerade ständig die Uferländer und die Steppen um den eigentlichen Abiad oder Weißen Fluß und den in ihm mündenden Sobât zu bewohnen, sondern in der nassen Jahreszeit sich in das Innere zurückzuziehen. Ueber Tags hält er sich im Winter und im Frühjahre viel in der baumlosen Steppe auf, und gegen Abend sieht man dort, soweit der Gesichtskreis reicht, dichte, schwere Staubwolken sich erheben, welche mit dumpfem Geräusche näher rücken, und aus denen sich nach und nach nicht etwa einzelne Hunderte, sondern geschlossene Herden und wieder Herden des Abok zur Tränke stürzen. Aber wie das Festland ist auch Sumpf und Wasser ihr Element; sie treiben sich im tiefsten Schlamme und Moore mit Leichtigkeit umher und schwimmen gern über den Strom. Scheu kann man sie nicht nennen, denn namentlich auf dem Anstande sind sie leicht, und ebenso vom Boote aus zu erlegen, wenn sie herdenweise einen Fluß durchschwimmen.
Ebenso wie die Kuhantilopen ähneln auch die Riedantilopen (Redunca) den Gazellen. Sie sind große oder mittelgroße Arten von untersetzter Gestalt, mit ziemlich langem Schwanze, bei denen nur das Männchen gehörnt ist. Die in der Nähe des Augenrandes eingefügten Hörner sind rund, am Grunde geringelt und mit der Spitze nach vorwärts gebogen. Das Weibchen hat vier Zitzen. Die Thränengruben sind unvollkommen.
Unter den zu dieser Gruppe gehörenden Antilopen ist der Riedbock (Redunca eleotragus Antilope eleotragus und arundinacea, Eleotragus reduncus und arundinaceus) die bekannteste. Das schöne Thier wird mit dem Schwanze 1,4 bis 1,5 Meter lang, am Widerriste etwa 95 Centimeter und am Kreuze 80 Centim. hoch; die Hörner erreichen eine Länge von 30 Centim. und sind unten ungefähr 3 Centim. dick. Im allgemeinen ähnelt der Riedbock unserem Reh, ist jedoch etwas schlanker gebaut. Der Leib ist schwach gestreckt, am Hinterheile ein wenig stärker als vorn, der Hals lang und dünn, seitlich zusammengedrückt und hirschähnlich gebogen, der Kopf verhältnismäßig groß, nach vorn verschmälert, mit breiter Stirn, geradem Nasenrücken und stumpf zugespitzter Schnauze; die Ohren, auf beiden Seiten mit dichtem Haar bedeckt, sind groß, lang, schmal und zugespitzt, an der Wurzel geschlossen, gegen das Ende geöffnet, an der Spitze verengt, die Augen groß und lebhaft, die Hufe mittelgroß, etwas gewölbt, die Afterklauen abgeplattet und quergestellt. Der Schwanz reicht mit dem zottigen Haarbusche fast bis an die Knie und erscheint wegen seiner reichlichen Behaarung viel dicker und breiter als er wirklich ist. Die verhältnismäßig starken und kräftigen Hörner stehen ziemlich entfernt von einander, steigen von der Wurzel rückwärts in die Höhe, krümmen sich dann in einem sanften Bogen nach vorwärts und weichen dabei ziemlich weit auseinander, nähern sich aber wieder mit den Spitzen um ein wenig. Ihre untere Hälfte ist von tiefen und regelmäßigen Längsfurchen durchzogen, die obere glatt, die Wurzel zehn- bis zwölfmal quergerunzelt. Die ziemlich kurze und dichte Behaarung liegt nicht so glatt an dem Leibe an als bei den übrigen, bis jetzt genannten Antilopen, verlängert sich am Unterleibe und den Hinterseiten der Oberarme sowie am Vorderhalse bis zur Brust und bildet auf der Mitte des Rückens, am unteren Ende des Vorderhalses und auf dem Scheitel Haarwirbel. Unterhalb der Ohren, in der Schläfegegend, liegt ein runder, kahler Flecken. Die Ober- und Außenseite des Leibes ist gewöhnlich rothgraubraun, die Unterseite und Innenseite der Vorderbeine weiß. An der Außenseite der Beine zieht die Färbung mehr ins Gelbliche, am Kopfe und Halse sowie der Außenseite der Ohren ins Fahle. Die Augen werden von einem weißlichen Kreise umgeben. Die Hinterbeine sind einfarbig rothgrau. Auf der Vorderseite der Füße verläuft ein undeutlicher, dunkelbrauner Streifen. Der Schwanz ist oben fahlbraun, unten weiß. Hufe und Afterklauen sind schwarz. Zuweilen kommen Abweichungen vor, indem das Haar bald mehr ins Gelblichgraue, bald mehr ins Röthliche zieht. Das Weibchen unterscheidet sich durch den Mangel des Gehörns, auch durch geringere Größe vom Männchen.
Sumpfige, mit Schilf und Riedgras bedeckte Gegenden Süd- und Mittelafrikas sind die Heimat des Riedbockes, welcher eben seinen Namen von seinem Aufenthaltsorte erhielt. In den Ansiedelungen des Vorgebirges der Guten Hoffnung, im Lande der Namaquas und in der Kafferei ist er an manchen Orten sehr häufig; im Innern Afrikas tritt er, nach Schweinfurths Beobachtungen, erst jenseit der großen Sümpfe des obern Nilgebietes auf. Hier belebt er paarweise die Buschwaldungen in der Nähe von Gewässern oder Sümpfen, beziehentlich auch Binsicht und Röhricht und das höhere Seggengras zeitweilig fließender Ströme. Infolge seiner zurückgezogenen Lebensweise sieht man ihn viel seltener, als sein häufiges Vorkommen glauben läßt.
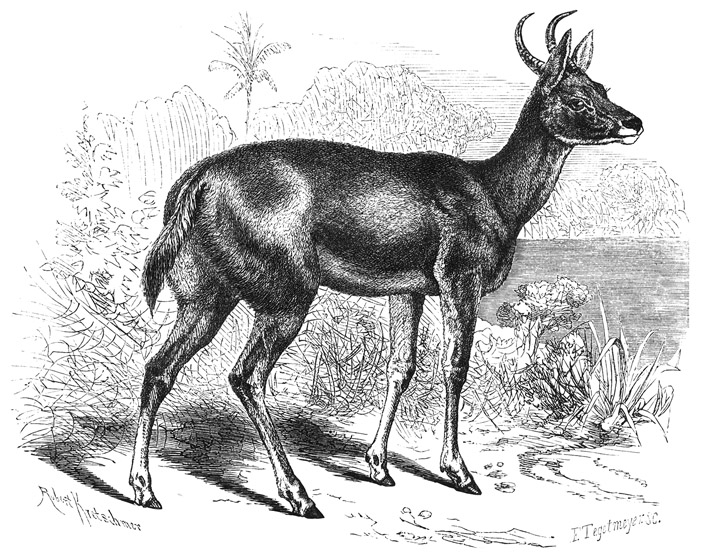
Riedbock ( Redunca eleotragus). 1/10 natürl. Größe
Ueber die Lebensweise berichtet Drayson in seinen vortrefflichen »Jagdbildern aus Südafrika«. Wenig Thiere sind für den Jäger so vielversprechend wie der Riedbock. »Gewöhnlich liegt er versteckt in dem Riedgrase, bis man fast an ihn herangekommen ist, und wenn er aufgeschreckt wird, flieht er nur auf kurze Strecken hin, bleibt dann stehen und schaut nach seinen Verfolgern zurück. Dabei hört man ihn ein eigenthümliches Niesen ausstoßen, welches augenscheinlich der Warnungsruf ist. Das dadurch bewirkte Geräusch wird ihm aber öfters zum Verderben, denn es macht den Jäger erst aufmerksam auf ihn. Er ist ein großer Freund von jungem Getreide und deshalb den Kaffern sehr verhaßt. Sie geben sich alle Mühe, ihn zu vertreiben, und betrachten schon die Vernichtung eines Riedbockes, als ein höchst günstiges Ergebnis ihrer Jagden, weil es ihnen hauptsächlich darauf ankommt, die Brandschatzer ihrer Pflanzungen zu vernichten. Bei verschiedenen Gelegenheiten habe ich mir die ewige Freundschaft eines ganzen Dorfes dadurch gewonnen, daß ich einige › Umsekes‹ wegschoß, welche die Leute mehrere Wochen lang geärgert hatten.
»Wirklich wunderbar ist die Lebenszähigkeit dieser Antilope. Es kommt oft vor, daß sie noch lustig dahinläuft, nachdem ihr eine Kugel durch den ganzen Leib gegangen ist, und wenn ihr auch in vielen Fällen die Flucht nichts hilft, geht sie doch dem Jäger verloren. Wenn sie in einer abgelegenen Waldschlucht sich zu verbergen sucht, um ihren Verfolgern zu entgehen, finden sie doch andere Feinde auf, und wenn es nur ein Haufen hungriger Hiänen wäre, welche der blutigen Fährte durch Meilen hin folgen, nachts in ihren Schlupfwinkel eindringen und sie zerreißen.«
Ueber die Fortpflanzung ist mir keine Angabe bekannt, und ebensowenig weiß ich über das Leben dieser Antilopen in der Gefangenschaft zu berichten; denn obgleich man sie schon seit ungefähr achtzig Jahren kennt, und ihre Bälge oft nach Europa gebracht hat, ist doch, meines Wissens wenigstens, bis jetzt noch kein lebender Riedbock zu uns gelangt.
Als nahe Verwandte der Riedantilopen sieht man die Wasserböcke ( Kobus) an, große, ziemlich langbehaarte, oft gemähnte Antilopen von regelmäßiger Gestalt mit langen, spitzigen, in sanften Bogen erst rück- und vorwärts, dann auf- und abwärts sich krümmenden, geringelten Hörnern, welche jedoch nur dem Männchen zukommen, mäßig entwickelter Muffel, Klauendrüsen und langer Schwanzquaste, wogegen Thränengruben und Thränendrüsen fehlen.
Der Wasserbock ( Kobus ellipsiprymnus, Antilope ellipsiprymna, Aegoceros, ellipsiprymnus), ein stattliches, fast hirschgroßes Thier von 2 Meter Gesammt- und 50 Centimeter Schwanzlänge, bei 1,3 Meter Kreuzhöhe, trägt, der Krümmung nach gemessen, 80 Centim. lange, stark geringelte Hörner und ein reiches, auffallend fettiges und grobes, nur auf dem Oberkopfe, den Lippen, der Außenfläche der Ohren und den Läufen kurzes und dichtes, sonst langes und zottiges, vorherrschend grau gefärbtes Kleid, da nur die Spitzen der Haare braun sind. Am Kopfe, Rumpfe, Schwanze und den Schenkeln zieht diese Färbung in das Gelbrothe oder Rothbraune; die Augenbrauen, ein schmaler Streifen unter dem Liede, Oberlippe, Muffel, die Halsseiten und eine schmale Binde an der Kehle sowie eine andere, welche über den hintern Theil der Schenkel vom Kreuze an nach vorn und unten verläuft und eiförmig gebogen ist, sind weiß. Das Weibchen ist blasser und zarter gebaut.
A. Smith fand den Wasserbock nördlich von Kurrichano in Südafrika in kleinen Herden auf, welche acht bis zehn Stücke stark waren und sich an den Ufern der Ströme aufhielten; Heuglin und nach ihm Schweinfurth lernten ihn auch als Bewohner des innern Afrika kennen. Unter jedem Rudel sieht man zwei oder drei Böcke, jedoch nur einen einzigen starken, da dieser die schwächeren abzutreiben scheint; doch behaupten die Eingeborenen, daß es überhaupt mehr Geisen als Böcke gäbe, weil viel mehr Thier- als Bockkälber gesetzt würden. Ungeachtet seiner fast plumpen Gestalt macht der Wasserbock einen guten Eindruck auf den Beschauer. Seine Augen sind lebhaft, ausdrucksvoll, Selbständigkeit des Wesens, ja fast Wildheit wiederspiegelnd, seine Bewegungen verhältnismäßig zierlich. So lange er weidet, sieht er etwas unbehülflich aus; erregt aber nimmt er etwas stattliches und würdevolles an, und besonders wenn er den Kopf hebt, gewinnt er ein lebhaftes, geistvolles Ansehen. Nach Heuglin ist er kein eigentlicher Sumpfbewohner, sondern liebt Stellen, welche mit mehr als mannshohem Schilfe bewachsen sind. Wie die Pferdeantilopen hat er die Gewohnheit, Termitenbaue zu besteigen und von ihnen aus in majestätischer Haltung sein nasses Gebiet zu überschauen. Aus diesem Grunde wird man seiner leicht ansichtig; aber auch wenn er durch das Gebüsch geht, leuchten die weißen Spiegelstreifen auf weithin durch das Dunkel des Gelaubes. Besonders scheu ist er nicht, läßt vielmehr den Schützen gewöhnlich ziemlich nahe an sich herankommen. Wittert der Leitbock wirklich Gefahr, so eilt er in sausendem Galopp dahin und das ganze Rudel hinter ihm drein. Die Flucht geht regelmäßig dem Wasser zu, und hier stürzt sich die geängstigte Herde mit einem Male plumpend in die Wellen. Wahrscheinlich sind die Wasserböcke gewöhnt, vor ihrem schlimmsten Feinde, dem Löwen, in dieser Weise die Flucht zu ergreifen. Die Aesung besteht in Sumpf- und Wasserpflanzen sowie in dem saftigen Grase, welches in allen Niederungen Südafrikas sich findet.
Die Eingeborenen der Länder des Vorgebirges der guten Hoffnung lassen die Wasserböcke unbehelligt, die Neger des innern Afrika erlegen sie auf Treibjagden so gut wie jedes andere Wild. Das Thier bedarf, um zum Falle gebracht zu werden, eines gut angebrachten Schusses, und wenn es nicht im Feuer zusammenstürzt, ist es für den Jäger regelmäßig verloren, weil es auf den meisten Stellen seines Wohngebietes fast unmöglich ist, ihm durch Röhricht, Sumpf und Wasser zu folgen. Das Wildpret alter Böcke soll so gut als ungenießbar, weil zähe, faserig und mit einem unangenehmen, starken, bockartigen Geruche behaftet sein, aus letzterem Grunde auch selbst dem hungernden Kaffer widerstehen. Harris fand es vollkommen ungenießbar und versichert, daß er durch den heftigen Gestank manchmal geradezu von seiner Beute verjagt worden und nicht einmal im Stande gewesen wäre, das erlegte Wild abzuhäuten; Schweinfurth dagegen bemerkt, daß ihm das zarte, wenn auch fettarme Fleisch der erlegten Kälber vortrefflich geschmeckt habe.

Wasserbock ( Kobus ellipsiprymnus). 1/18 natürl. Größe.
Zu den stattlichsten Erscheinungen der ganzen Familie zählen die Pferdeböcke oder Roßantilopen ( Hippotragus oder Aegocerus), so genannt wegen der starken Nacken- und beziehentlich Halsmähne, welche die hierher gehörigen Arten besitzen. Die Hörner, welche bei einer Art von beiden Geschlechtern, bei der anderen nur von den Böcken getragen werden, entspringen auf der Stirnleiste, biegen sich in einem einfachen, scharfen Bogen nach hinten und tragen fast bis zu der glatten Spitze scharf hervortretende Ringe. Der Kopf erinnert in Form und Aussehen an den unserer Gemse, die Ohren aber haben, wie Harris sehr richtig sagt, beziehentlich ihrer Länge und Gestalt mit denen des Esels entschiedene Aehnlichkeit; der Hals ist kurz und dick, der auf verhältnismäßig schlanken Läufen ruhende, vorn höher als hinten gestellte Leib gedrungen, der Schwanz sehr lang und dick bequastet; Thränengruben fehlen, werden jedoch durch einen Haarbüschel gewissermaßen ersetzt; Klauendrüsen und Weichengruben sind nicht vorhanden. Das Weibchen hat zwei Zitzen.

Rappen- und Schimmelantilope ( Hippotragus niger und H. leucophoeus). 1/20 natürl. Größe.
In älteren Reisebeschreibungen Südafrikas geschieht mehrmals einer hierher gehörigen Antilope Erwähnung, welche von den Ansiedlern des Vorgebirges der Guten Hoffnung Blaubock genannt wurde, im Gebiete der Ansiedelungen aber schon seit etwa siebzig Jahren vollständig ausgerottet sein soll. Wahrscheinlich war dieser Blaubock nichts anderes als ein lebhaft gefärbtes Männchen der Schimmelantilope, des Bastardgemsbocks der Ansiedler des Vorgebirges der Guten Hoffnung ( Hippotragus leucophoeus, Antilope leucopheaa, equina und glauca, Aegocerus leucophoeus und equinus, Ozanna leucophoea), eines ebenso gewaltigen als schönen Thieres von fast 3 Meter Gesammt- oder 2,2 Meter Leibes- und 75 Centimeter Schwanzlänge, 1,6 Meter Schulterhöhe und rostfarbig gelblich-milchweißer Hauptfärbung. Der Bock, welcher merklich größer als das Weibchen ist, trägt ein starkes, der Krümmung nach etwa 65 Centim. messendes, einfach nach rückwärts und außen gebogenes Gehörn, welches an der Wurzel bald rund, bald eiförmig ist und entweder bis zur Spitze oder nur bis zu drei Vierteln seiner Länge starke Ringe trägt, auch hinsichtlich der schärferen und schwächeren Biegung abändert. Die Ohren, deren Länge 35 Centim. beträgt, sind scharf zugespitzt und mit den Spitzen nach rückwärts und unten gebogen; der Schwanz ist gegen die Spitze hin mit kurzen Haaren bekleidet, an der Spitze aber ziemlich stark bequastet; die Nackenmähne besteht aus hohen und steifen Haaren ähnelt also der eines Esels oder noch besser eines Zebras mehr als der eines Pferdes; die Haare des Vorderhalses verlängern sich ebenfalls, ohne jedoch eine Mähne zu bilden. Der Vorderkopf ist schwärzlich, ein Streifen jenseits vor und hinter dem Auge und eine Blässe zwischen den Hörnern weiß, der übrige Leib röthlich schimmelfarben, das Mähnenhaar an der Spitze braun, ein Fleck an der Brust grauschwärzlich gefärbt; die Läufe spielen mehr in das Rehbraune. Einzelne Stücke haben, laut Hartmann, isabellgelbe, ins Roströthliche oder Graufahle ziehende, andere entschieden eselsgraue Färbung. Das hornlose Weibchen ist ähnlich gefärbt.
Eine von Harris entdeckte zweite Art der Gruppe, die Rappenantilope ( Hippotragus niger, Antilope und Ozanna nigra), steht an Größe hinter der Verwandten kaum zurück, da auch sie fast 3 Meter an Gesammtlänge und 1,5 Meter an Schulterhöhe erreicht, trägt mächtige, 80 Centimeter lange, leicht nach außen und hinten gebogene, bis zu drei Vierteln der Länge mit dreißig stark hervortretenden, unvollständigen Ringen gezierte Hörner, hat merklich kürzere und schmälere, nur 25 Centim. lange, gerade zugespitzte Ohren, eine aus lockeren Haaren bestehende Nacken- und Rückenmähne, eine deutliche Halsmähne, einen lang zugespitzten Kopf und einen stark bequasteten Schwanz. Die vorherrschende Färbung ist ein tiefes, glänzendes Schwarz, welches hier und da einen Schimmer in das Tiefnußbraune zeigt; ein breiter Streifen, welcher über jedem Auge beginnt und zur Seite der Schnauze gegen die Muffel verläuft, der Vordertheil und die Unterseite der Schnauze sowie die Brust, der Bauch und die obere Hälfte der Innenseite der Hinterschenkel, endlich noch die Innenseite der Ohren sind weiß, die Ohren an ihrer Wurzel und ein Fleck am Hinterkopfe, die Unterschenkel außen und innen aber hellnußbraun. Das Weibchen ist merklich kleiner als das Männchen, trägt kleinere, ähnlich gebogene Hörner und hat tiefnußbraune, hier und da ins Schwärzliche spielende Färbung.
Während man früher annahm, daß diese beiden Roßantilopen dem Süden Afrikas eigenthümlich seien, wissen wir jetzt, daß das Innere Afrikas ihre eigentliche Heimat ist, und die Nachbarländer der Ansiedelungen am Vorgebirge die südliche Grenze ihres Verbreitungsgebietes darstellen. Nach Norden hin reicht dieses im Osten bis zum Atbara, im Westen bis zum Senegal und Gambia. Die Rappenantilope scheint mehr dem Osten anzugehören, kommt aber ebenfalls diesseits des Gleichers vor. Beide Arten bewohnen Gebirgsgegenden, namentlich felsige, dürftig mit niederem Buschwerk bewachsene Bergzüge, bilden kleine Trupps von sechs bis höchstens zwölf Stücken, von denen jeder einzelne ein ziemlich großes Gebiet zu behaupten scheint, bewegen sich mit Kraft, stehen aber an Ausdauer hinter vielen ihrer Verwandten zurück.
Zu ihren Eigenthümlichkeiten gehört, daß die Böcke immer die Leitung übernehmen, niemals die Altthiere. Der wachsame Anführer benachrichtigt bei Gefahr seine Herden durch ein Schneuzen, darauf hin sammelt sich augenblicklich alles um ihn, und dahin gehts in wilder Flucht. Die Brunst beginnt gegen das Ende der Regenzeit. Sie würde dem Jäger die beste Gelegenheit geben, gute Beute zu machen, falls er diese brauchen könnte; denn gerade zur Brunstzeit verbreiten die Männchen einen so durchdringenden Bockgeruch, daß nicht einmal eine Hottentottenzunge sich mit dem Fleische befreunden mag. Mit Beginn der nächstjährigen Regen, also zur Zeit des dortigen Frühjahres, setzt das alte Thier ein Junges, welches von beiden Eltern geführt und nötigenfalls beschützt wird. Die Eingeborenen Westafrikas versichern ganz ernsthaft, daß diese Antilopen nur einmal während ihrer Lebenszeit der Mutterfreuden genießen könnten, weil sofort nach der Geburt die Säbelhörner des Weibchens unglaublich schnell wüchsen, schließlich hinten in den Rücken eindrängen und mehr und mehr sich verlängerten, bis sie endlich das arme Thier erdolchten.
Die Jagd der Roßantilopen soll wegen ihrer Vorsicht und Schnelligkeit äußerst schwierig sein. Bei Gefahr gehen die Böcke, wie die Buschmänner behaupten, dreist auf ihren Gegner los und wissen ihre Hörner dann in gefährlicher Weise zu gebrauchen. Die Eingeborenen fangen die Pferdeantilopen wie alle anderen Wiederkäuer in Fallgruben. Gordon Cumming spricht von der Rappenantilope mit Begeisterung. »Während ich durch den Wald galoppirte«, sagt er, »erblickte ich eins der schönsten Thiere, welches die Schöpfung hat: einen alten Bock der schwarzen Antilope. Es ist das stattlichste und schönste Thier in Afrika. Sie war die erste, welche ich erblickte, und nie werde ich die Empfindung vergessen, welche sich meiner bei diesem, für einen Jäger so ergreifenden Anblicke bemächtigte. Der Bock stand mitten unter einer Herde Palas, uns gerade im Wege, hatte uns aber unglücklicherweise entdeckt, ehe wir ihn sahen. Ich rief meine Meute und lief ihm nach; der Tag war aber schwül und heiß, und die Hunde hatten keinen Muth mehr. Da mein Pferd keines von den besten war, blieb ich bald zurück, und das schöne Thier war schnell aus meinem Bereiche und entschwand meinen Augen für immer. Vergebens versuchte ich die Nacht zu schlafen: das Bild dieser Antilope schwebte mir noch immer vor.«
Eine allerliebste Jagdgeschichte erzählt Schweinfurth. »Einer meiner tagtäglichen Streifzüge durch Busch und Wald gestaltete sich mir spielend zu einem Jagdabenteuer unerhörter Art. So etwas kann man nur im Innern Afrikas erleben. Im tiefen Schatten eines Butterbaumes und versteckt von dem in seinem Schutze hoch aufgeschossenen Grase hatte ich wohl eine halbe Stunde lautlos zusammengekauert dagesessen, ganz versunken in die Zergliederung meiner Pflanzen. Meine drei Begleiter schliefen wie gewöhnlich den Schlaf der Gerechten; weit im Umkreise herrschte die feierliche Stille der Waldeinsamkeit, daß man den Tritt einer jeden Ameise am Boden zu hören vermochte; ab und zu drang ein feines Knistern von dem rastlosen Arbeiten in den Werkstätten der Termiten zu dem Ohre des Zeichnenden. Da schwankte ein riesiger Schatten an seinem Auge vorbei, und wie er den Blick erhob, stand ihm auf kaum Pistolenschußweite ein mächtiger Antilopenbock gerade gegenüber. Die Schönheit eines noch nie gesehenen Thieres erhöhte meine Ueberraschung, und mit pochendem Herzen starrte ich auf das räthselhafte Bild, welches gleichsam dem Erdboden entwachsen zu sein schien. Es war ein Bastardgemsbock von hellgrau-brauner Färbung, an der Brust mit langem Haar und weiß am Bauche. Von dem stolz gehobenen Kopfe mit seinem langen, spitzen und massiven Gehörn bis hinab zu den schwarzen Läufen mit den weißen Knöchelbinden stand der Bock frei da vor meinen Blicken, in solcher Majestät, wie ein gewaltiger Büffel, der drohend nach allen Seiten äugt und sichert, bevor er sich zur Fortsetzung seines Weideganges anschickt. Die rothbraune, steife Mähne, welche vom gebogenen Nacken her über den ganzen Widerrist sich erstreckte, gab seiner Erscheinung etwas unbeschreiblich Keckes und Herausforderndes. Rauschend legte sich das Gras vor seinen wuchtigen Tritten. Jetzt schwenkte er auf die Seite, mir die ganze Spiegelgegend zukehrend; man konnte die Fliegen erkennen, welche den hin- und herfuchtelnden Girafenschweif umkreisten, durch welchen diese Antilopenart ausgezeichnet ist, einer Quaste von dreiviertel Fuß langen schwarzbraunen Haaren vergleichbar, die auf schlankem Stiele befestigt ist. Von meinen Leuten regte sich keiner; behutsam streckte ich daher die Hand aus nach der neben mir liegenden Büchse, schob die Sicherheit zurück, und bei der nächsten Körperwendung des Thieres fiel meine Kugel mitten aufs Blatt, ein Ziel von kaum dreißig Schritte Entfernung. Mit mächtigem Satze fuhr der Bock in die Höhe; dann stand er einen Augenblick still, die Läufe gespreizt und wie betäubt mit etwas gesenktem Haupte. Eben wollte ich zur zweiten Büchse greifen, da gab es einen gewaltigen Krach, und das Jagdglück hatte mir die stolzeste Beute in den Schoß geworfen, in den Schoß – dann hätte es wohl noch gefehlt, daß ein Bastardgemsbock mir auf die offene Zeichenmappe fiele?
»Der Schuß hatte meine Leute kaum wach gemacht: hier zu Lande war ein einziger Schuß des Blickes nicht werth, es bedurfte erst meines Triumphgeschreies, um sie auf die Beine zu bringen. Nun wurden wie gewöhnlich einige Neger aus den nächsten Hütten herbeigeholt, welche sich geschäftig an die Arbeit des Abhäutens und Zerwirkens machten. Der Kopf allein wog fünfunddreißig Pfund. Ich erfuhr von den Eingeborenen, daß der Manja, so nennen die Bongo diese Antilopenart, zu den selteneren Thieren der Gegend gehört, obgleich er sich in allen Theilen des Gebietes wieder findet, und daß derselbe für gewöhnlich einzeln oder weit abgesondert von seinesgleichen der Aesung nachgeht. Er soll die einzige von den größeren Arten sein, welche den Jäger annimmt und Wuthanfälle hat wie ein wilder Büffel.«
Schon seit alter Zeit bekannte und berühmte Antilopen sind die Spießböcke ( Oryx), von denen wenigstens eine Art häufig auf den Denkmälern Egyptens und Nubiens abgebildet wurde. Man sieht hier den Oryx in den mannigfaltigsten Stellungen, gewöhnlich mit einem Stricke um den Hals, zum Zeichen, daß man ihn gejagt und gefangen hat. In den Gemächern der großen Pyramide Cheops sieht man dasselbe Thier, zuweilen nur mit einem Horne dargestellt, und hieraus wollen einige Naturforscher die Behauptung gründen, daß der Oryx zur Sage von dem Einhorne Veranlassung gegeben habe, während unter dem Reem der Bibel oder dem Einhorne doch entschieden nur das Nashorn gemeint sein kann. Von diesem Oryx erzählen sich die Alten wunderbare Dinge. Sie behaupten, daß er ebenso wie die Ziegenherden den Aufgang des Sirius erkenne, sich diesem Gestirn entgegenstelle und es gleichsam anbete, daß er Wasser trübe und verunreinige und deshalb den egyptischen Priestern verhaßt wäre, daß er sein Gehörn beliebig wechseln könne und bald vier, bald nur zwei, bald gar nur eine Stange trage und dergleichen mehr.
Noch bis in das späte Mittelalter, ja selbst bis in die neuere Zeit, wurde die von den Alten gegebene Beschreibung des Oryx für maßgebend erachtet. »Under den wilden Geyssen«, sagt der alte Geßner, »wirdt auch gezelt ein geschlächt der thieren Oryx genannt: yetz bey vnseren zeyten vnbekannt. Wirt von Oppiano also beschriben: ganz weyß, außgenommen das maul vnd wangen, mit einem starcken, feißten vnd dicken genick, mit hohen aufrechten schwartzen vnd gantz scharpffen hörneren gezieret, sölcher herte vnd veste, daß sy eysen, vnd andere metal, auch die stein überträffend, wonet in wälden, gantz aufsetzig anderen wilden thieren: sein gmüt vnd art ist gantz wild vnd grausam, dann er entsitzt nit das bällen der Hunden, nit das kirschen deß Ebers, weder das lüyen deß Stiers, noch das brüle deß Löuwens, auch nit die traurig stimm deß Pantherthiers: wirt auch nit bewegt von gewalt vnd stercke der menschen: sonder zü dem offteren mal bringt es auch den allersterckesten Jeger vmb sein läben. Sy bringend auch zun zeyten selber einanderen um ir läben. Es schreybend etlich daß sölche thier allein mit einem horn söllend gezieret seyn, so söllend auch an etlichen orten einhörnige wilde Geyssen gefunden werden.«
Die Alten haben, laut Hartmann, Oryxantilopen sowohl mit gerade gewachsenen wie auch mit mehr gebogenen Hörnern abgebildet und zwar nicht selten in höchst gelungener Weise. Man hat diese Art im Alterthume häufig gezähmt gehalten und zur Opferung benutzt; niemals aber sieht man dieselbe auf Denkmälern anders als in Gemeinschaft mit Altegyptern. Dies sowohl wie der Umstand, daß dergleichen Antilopen niemals unter den Tributgegenständen der südlich von Egypten gelegenen Länder dargestellt erscheinen, gestattet den Schluß, daß die egyptisch-nubische Art dieser Gruppe in den Wüstenthälern des Pharaonenlandes in genügender Anzahl vorhanden, und man nicht erst genöthigt gewesen, sie noch südlicher aufzusuchen. Oryxantilopen scheinen durch Israeliten, Perser und andere auch nach Asien gebracht und dort gezüchtet worden zu sein; jedoch erscheint die Ansicht einiger Schriftsteller, daß solche Thiere in Persien und Indien wild vorkommen sollen, durch nichts bewahrheitet.
Die Spießböcke gehören zu den größten und schwersten aller Antilopen, machen jedoch trotz ihres etwas plumpen Baues einen majestätischen Eindruck auf den Beschauer. Der Kopf ist gestreckt, aber nicht ungestaltet, die Gesichtslinie fast gerade oder nur wenig gebogen, der Hals mittellang, der auf mäßig hohen, starken Läufen ruhende Leib sehr kräftig, der Schwanz ziemlich lang, am Ende stark bequastet; die Augen sind groß und ausdrucksvoll, die Ohren verhältnismäßig kurz, breit und abgerundet, die Hörner, welche von beiden Geschlechtern getragen werden, sehr lang und dünn, von der Wurzel an geringelt und entweder gerade oder in flachem Bogen nach rück- und auswärts gebogen. Thränengruben fehlen, Leistengruben sind ebensowenig vorhanden. Alle bekannten Arten ähneln sich und haben zu der Ansicht verleitet, daß man es nur mit verschiedenen Ausprägungen eines und desselben Thieres zu thun habe; wenn man jedoch die verschiedenen Spießböcke neben einander sieht, erscheint diese Ansicht als eine hinfällige.
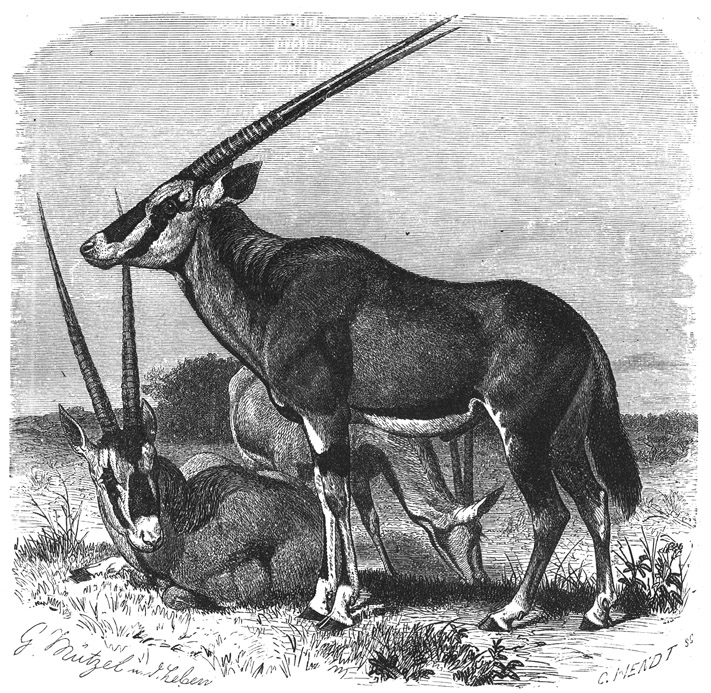
Beisa ( Oryx Beisa). 1/16 natürl. Größe.
Als das Urbild der Gruppe betrachtet man gewöhnlich den Passan, von den Ansiedlern des Vorgebirges der Guten Hoffnung Gemsbock, von den Bedschuanen Kukame genannt ( Oryx capensis, Antilope Oryx und recticornis, Oryx gazella), ein stolzes Thier von 2,8 Meter Gesammt-, beziehentlich 2,4 Meter Leibes- und 40 Centim. Schwanzlänge und 1,2 Meter Schulterhöhe. Das Gehörn, welches bei der Geis zwar dünner, auffallenderweise aber noch länger zu sein pflegt als beim Bocke, wird über 1 Meter lang, ist nur äußerst wenig gebogen oder selbst schnurgerade, steigt schief nach hinten und außen auf und ist in der unteren Hälfte dreißig- bis vierzigmal stark geringelt, an der Spitze aber glatt und scharf. Die Decke liegt dicht und glatt an und besteht aus kurzen, straffen Haaren, welche mit Ausnahme des aufrechtstehenden, mähnenartigen Haarkammes auf Oberhals und Vorderrücken sowie eines Büschels langer, borstiger Haare am Unterhalse überall ziemlich gleich lang sind. Hals, Nacken, Rücken und Seiten haben gelblichweiße, der Kopf, die Ohren, der obere Theil der Hinterschenkel, die Brust, der Bauch und die Läufe vom Fesselgelenk an blendend weiße Färbung; ein Streifen auf der Stirn, ein breiter Fleck auf der Vordernase, eine von dem Gehörn an durch das Auge nach der Unterkinnlade verlaufende, und eine zweite längs der letztern sich herabziehende, das Weiß des Kopfes von dem Isabell des Halses trennende Binde und der äußere Rand der Ohren sind schwarz, weshalb der Kopf halfterartig gezeichnet erscheint; ebensolche Färbung zeigen auch ein auf dem Rücken beginnender, auf dem Kreuze sich ausbreitender und rautenförmige Gestalt annehmender Flecken, die vorderen und hinteren Unterschenkel, ein Streifen auf der Vorderseite der Fesseln, ein bandartig von der Mittelbrust nach vorn und oben in die Weichengegend verlaufender Streifen sowie endlich die starke Quaste, wogegen Nacken-, Mähnen- und Halsbusch mehr ins Schwarzbraune spielen.
Der Passan findet sich, soviel bis jetzt bekannt, nur im südlichen Afrika, wird aber im Nordosten durch eine ihm sehr nahe stehende Art vertreten.
Diese, die Beisa ( Oryx Beisa, Antilope Beisa), wahrscheinlich der eigentliche Oryx der Alten, dessen Färbung sein soll gleich »der Milch des Frühlings«, steht dem Passan an Größe nicht nach, hat ebenfalls mehr oder weniger gerade, meterlange Hörner und ist jenem sehr ähnlich gefärbt und gezeichnet. Die Grundfärbung ihres Felles erscheint lichter als beim Passan, isabellfahlgrau oder gelblichweiß; reinweiß sind Mund und Nasenspitze, der vordere und hintere Augenwinkel, Wurzel der Ohren, Bauchmitte und Vorderläufe, schwarz dagegen ein dreieckiger Fleck gerade auf der Stirn, welcher an der Wurzel der Hörner beginnt und sich durch einen schmalen Streifen mit einem länglichen, glockenförmigen Flecke auf dem Vordergesicht verbindet, ein schräg nach unten durch das Auge über die Wange verlaufender, nach der Gegend des Mundwinkels ziehender Streifen, ein von der Wurzel des Ohres nach der Kehle sich wendendes, oben sich ausspitzendes, unten längs der Mitte des Unterkiefers einen doppelten Streifen bildendes Halsband, ein Streifen längs der Mitte des Vorderhalses bis zur Brust herab, welcher hier sich spaltet, hinter dem Buge hinzieht und als schmales Band längs der Seiten der Brust und des Bauches bis zu den Weichen hin verläuft, ein breites, schräg gestelltes Armband um die Schiene der Vorderläufe, sowie endlich ein Fleck vorn am Laufe, die Schwanzquaste und die Hörner; die Mähne längs des Nackens sowie der Haarkamm auf dem Vorderrücken haben rostrothe Färbung; die Schwanzruthe ist fahlgrau, die äußere Seite der Ohren ebenso, nach der Spitze zu mit schwärzlichem Saume. Beide Geschlechter sind gleich gefärbt.
Die Beisa bewohnt das Küstenland von Habesch, nach Norden hin bis zum Wendekreise, nach Süden hin bis zum Gebiete der Somalen sich verbreitend.
Die dritte Art der Gruppe, von uns gewöhnlich Säbelantilope, von den Arabern Wild- oder Steppenkuh genannt ( Oryx leucoryx, Antilope leucoryx und ensicornis), ist etwas plumper als die Verwandten und trägt ebenso lange, dreißig- bis vierzigmal geringelte, aber sanft gebogene, nach außen und hinten gerichtete, mit der Spitze nach unten geneigte Hörner. Das kurze, grobe, nur längs des Rückgrats und der Nackenfirste verlängerte, übrigens glatt anliegende Haarkleid ist ziemlich gleichmäßig gefärbt. Ein mehr oder weniger reines Gelblichweiß, welches aus der Unter- und Innenseite der Läufe heller, am Halse dagegen durch Rostfarben ersetzt wird, bildet die Grundfärbung; sechs Flecken von mattbrauner Farbe stehen am Kopfe, und zwar einer zwischen den Hörnern, zwei zwischen den Ohren, zwei andere zwischen den Hörnern und Augen und der sechste endlich als Streifen auf dem Nasenrücken. Alte Böcke erreichen eine Länge von reichlich 2 Meter, bei einer Schulterhöhe von 1,3 Meter.
Das Verbreitungsgebiet der Säbelantilope erstreckt sich über den nördlichen Theil von Innerafrika, von der Regengrenze an südlich. Sie ist nicht selten in Sennâr und Kordofân, in Mittel- und Westsudân, kommt aber auch nach Norden hin in der Bahiudasteppe und in einzelnen Wüstenthälern Nubiens bis zur egyptischen Grenze vor.
Hinsichtlich ihrer Lebensweise dürften die Oryxantilopen im wesentlichen mit einander übereinstimmen; doch fehlen zur Zeit noch genügende Beobachtungen über ihr Freileben, und die Naturgeschichte dieser altberühmten Thiere ist noch immer lückenhaft und dürftig.
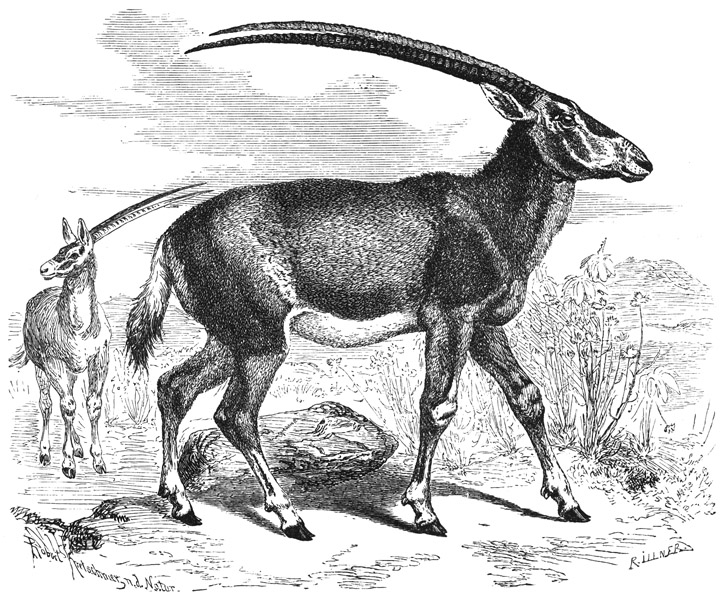
Säbelantilope ( Oryx leucoryx). 1/16 natürl. Größe.
»Der Gemsbock«, sagt Gordon Cumming, »scheint von der Natur dazu bestimmt, die trockenen Karus des heißen Südafrika zu bevölkern, für welche er seiner Natur nach vortrefflich sich eignet. Er gedeiht in unfruchtbaren Gegenden, wo man glauben sollte, daß darin kaum eine Heuschrecke Nahrung finde, und ist, trotz der Glut seiner Heimat, doch völlig unabhängig vom Wasser. Dieses trinkt er, wie ich nach meiner Beobachtung und der wiederholten Behauptung der Bauern überzeugt bin, niemals, auch wenn er es haben würde.« Unter ganz ähnlichen Umständen leben die nördlichen Arten, obwohl sie durchaus nicht Wasserverächter sind wie der Passan. Allerdings trifft man die stattlichen Thiere, welche sich schon von weitem durch ihre gewaltige Größe auszeichnen, in den heißen, wasserlosen Steppen Südnubiens und Kordofâns an, ohne daß man begreift, wo sie ihren Durst löschen könnten; allein an denselben Orten leben auch noch eine Menge andere Thiere, welche Wasser trinken. Auch verschmähen die Oryxböcke letzteres wenigstens in der Gefangenschaft nicht.
Man sieht die Oryxantilopen gewöhnlich paarweise oder in sehr kleinen Trupps, häufig auch nur eine Mutter mit ihren Jungen. Höchst selten rudeln sich zahlreiche Gesellschaften, und solche von zweiundzwanzig Stück, wie sie Gordon Cumming sah, mögen wohl nur ausnahmsweise sich vereinigen. In den unbevölkerten Gegenden sind die herrlichen Thiere nirgends selten, aber auch nirgends häufig und dabei immer so scheu und furchtsam, daß man die wenigsten von denen, welche in einer bestimmten Gegend leben, überhaupt zu sehen bekommt. Sie fliehen, ehe der Reiter ihnen sich nähert. Nach meinen Beobachtungen meiden sie den Wald; in Kordofân halten sie sich nur in der Steppe auf. Dort gibt ihnen die so reiche Pflanzenwelt hinlängliche Nahrung, und wenn dann die Zeit der Dürre und Armut, der Winter kommt, haben sie sich so viel Feist zugelegt, daß sie eine Zeitlang auch mit magerer Kost, mit ausgedörrten Halmen und blätterlosen Zweigen, vorlieb nehmen können. Nur einzelne Mimosenbüsche bieten ihnen dann noch frischere Aesung. Beim Weiden recken sie ihren Hals hoch empor, stemmen sich auch wohl mit den Vorderhufen gegen den Stamm an, um höher hinauflangen zu können. Die südafrikanischen sollen, wie englische Jäger berichtet haben, zur Zeit der Dürre nach der sogenannten Wasserwurzel graben, einer in jenen Gegenden häufigen und werthvollen lilienähnlichen Pflanze, welche die Feuchtigkeit unter ihrer festen Hülle lange erhält.
Die Oryxböcke sind schnell. Ihr Schritt ist leicht, ihr Trab hart, ihr Galopp sehr schwer, aber ausdauernd und gleichmäßig fördernd. Nur die besten Pferde sind im Stande, ihnen zuweilen nachzukommen. Die Araber der Bahiuda wie die Bakhara, welche ausgezeichnete Rosse besitzen, machen sich ein besonderes Vergnügen daraus, die Schnelligkeit ihrer Pferde an dem Laufe des Oryx zu erproben und stechen diesem, sowie er sich im letzten Augenblicke der Gefahr gegenüberstellt, die Lanze an den Hörnern vorüber von oben in die Brust. Mit anderen Antilopen scheint sich wenigstens der sogenannte Gemsbock des Kaplandes zu vertragen, da man ihn oft mit der Kanna oder Elandantilope in vollster Eintracht werden sieht. Der Säbelbock ist, wie ich selbst beobachtet habe, ein im höchsten Grade unverträgliches Geschöpf, welches andere Thiere im Anfalle schlechter Laune oft arg mißhandelt. Man muß den Spießböcken überhaupt nachrühmen, daß sie, so scheu sie auch sein mögen, doch keineswegs die Furchtsamkeit anderer Antilopen zeigen, sondern eher etwas vom Wesen des Stieres haben. Gereizt gehen sie in heller Wuth auf den Angreifer los und suchen ihn in boshafter Weise zu verletzen. Gegen den anlaufenden Hund wissen sie sich erfolgreich zu vertheidigen, indem sie den Kopf vorbiegen und in schnellen Wendungen nach rechts und links mit solcher Kraft ausschlagen, daß sie einem Hunde ihre Hörner durch den ganzen Leib rennen, wenn jener nicht geschickt ausweicht. Lichtenstein erzählt, daß einer seiner Begleiter in der großen Karu das Geripp eines Panthers und eines Oryx neben einander liegen fand. Der Bock hatte seinen gefährlichen Feind mit einem Hornstoße getödtet, war aber selbst den vorher empfangenen Wunden erlegen. Harris hält es nicht für unmöglich, daß unter Umständen dem Löwen ein gleiches Schicksal werde. Im Augenblicke großer Gefahr stellt sich der Oryx nicht nur den Hunden, sondern auch dem Menschen gegenüber, und es heißt dann vorsichtig zu Werke gehen, wenn man nicht durch und durch gerannt sein will. Gordon Cumming entkam, wie er erzählt, nur dadurch dem Tode, daß der auf ihn anrennende Oryx wenige Schritte vor ihm, von Blutverluste erschöpft, zusammenbrach.
Ueber die Fortpflanzung im Freien fehlen noch ausführliche Berichte; an gefangenen Säbelantilopen hat Weinland beobachtet, daß die Tragzeit 248 Tage in Anspruch nimmt.
Die Jagd auf alle Oryxantilopen wird mit Vorliebe zu Pferde betrieben. Cumming beschreibt eine solche in lebhafter Weise und erzählt dabei, daß er den ganzen Tag einem bereits verwundeten Passan nachgeritten sei, bis endlich das Thier nicht mehr weiter konnte. Die Hottentotten wagen nicht, einzeln Gemsböcke anzugreifen oder zu verfolgen, weil diese sich augenblicklich gegen sie wenden. Keine andere Antilope soll einen prachtvollern Anblick gewähren als der fliehende Oryxbock. Man trifft ihn nicht selten unter anderen Antilopenherden, wo er sich die Führerschaft erkämpft hat. Sobald er merkt, daß er verfolgt wird, stößt er, wie man erzählt, ein heftiges, durchdringendes Geschrei aus, hebt den Kopf empor, so daß die Hörner auf den Rücken zu liegen kommen, streckt den Schwanz gerade von sich und eilt nun in wilder Jagd über die Ebene dahin, alles, was ihm in den Weg kommt, vor sich niederwerfend oder durchbohrend. Ueber Büsche, welche ihn hindern wollen, schnellt er mit einem einzigen gewaltigen Satze hinweg; durch die Herden der Zebras bricht er hindurch, Straußenherden jagt er in die tollste Flucht. Erst nach vielstündiger Verfolgung ist es möglich, in schußgerechte Entfernung von ihm zu kommen; denn er hält auch dann noch die Verfolgung aus, wenn er vom Schweiße trieft.
Auf Beisaantilopen habe ich selbst Jagd gemacht. Ich sah dieses schöne Thier zweimal im März 1862 und zwar in der bereits mehrfach genannten Samhara, das erstemal einen einzigen Bock, das zweitemal einen Trupp von sechs Stück. Der Bock wie der Trupp entflohen schon aus großer Entfernung vor uns. An den Trupp versuchten wir uns anzuschleichen; allein eine Biegung des Wassergrabens, welcher uns vollständig barg, brachte uns in den Wind, und augenblicklich setzten die Thiere sich in Bewegung. Die Beisa bewies mir dadurch, daß sie ebenso scharf windet wie das Renthier: denn wir waren noch immer fünfhundert Schritte von ihr entfernt gewesen. Durch Zufall kam derselbe Trupp eine halbe Stunde später auf siebzig Schritte mir zum Schuß, und nur ein ganz besonderes Jagdunglück hinderte, daß ich den erwählten Prachtbock nicht zusammenschoß: ich hatte vergessen, daß der Schrotlauf meines Wenders gerade oben lag, feuerte dem stolzen Gewilde eine Ladung Schrot aufs Blatt, und wurde durch den Nichterfolg meines Schusses so verdutzt, daß ich gar nicht ans Wenden dachte. Obgleich der Bock verwundet war, wandte er sich doch nicht gegen mich, wie nach Rüppells Angabe zu vermuthen gewesen wäre, sondern trollte mit den anderen ziemlich langsam und stumm davon.
Die Nomaden der Steppe fangen ab und zu einen der bei ihnen lebenden Spießböcke und bringen ihn in die Stadt, um ihn den Vornehmen des Landes oder den Europäern zum Kaufe anzubieten. Auf diese Weise habe ich während meines Aufenthaltes in Afrika mehrere erhalten. Ich kann die Gefangenen nicht rühmen. Sie sind träge, langweilig und unverträglich. Die Gefangenschaft halten sie leicht aus, lernen auch ihren Pfleger kennen und gewöhnen sich an ihn; niemals aber darf dieser ihnen trauen, weil sie ihre Hörner zuweilen, gleichsam des Spaßes wegen, in höchst gefährlicher Weise zu gebrauchen pflegen. Mit anderen Thieren darf man sie nicht zusammenhalten, da sie sich in kurzer Zeit der Herrschaft bemächtigen und ihre Genossen in abscheulicher Weise mißhandeln. Auch unter sich fangen sie ab und zu einmal Streit an und stoßen sich dann tüchtig. Dabei sind sie störrig und lassen sich nur mit größter Mühe fortschaffen. Noch heute gedenke ich einiger Tage meines Reiselebens mit wahrem Unmuthe. Wir hatten eine junge weibliche Steppenkuh erhalten und wollten dieselbe gern mit uns nehmen. Das einfachste würde natürlich gewesen sein, sie an den Hörnern zu binden und neben dem Kamele laufen zu lassen; allein das gute Thier wollte nicht mit uns spazieren, und die Araber versicherten einstimmig, daß das ›junge Rind der Steppe‹ noch gar nicht marschfähig wäre. Deshalb erhielt einer unserer Diener den Auftrag, das große unbehülfliche Geschöpf mit sich auf das Kamel zu nehmen. Ein Teppich wurde zu diesem Zwecke der Antilope um den Leib geschnürt und dann am Sattel befestigt. Der Oryx schien über diese Art der Fortschaffung äußerst entrüstet zu sein und stieß den Diener und das Kamel mit seinen spitzigen Hörnern. Das Reitthier, welches anfänglich bloß murrte, bekam endlich eine so ungewohnte Behandlung satt und ging durch. Nun versuchte ich, die Antilope weiter zu schaffen, und empfing anstatt unseres Aali die Hornstöße. Es wurde ein erneuter Versuch gemacht, das Steppenrind zum Gehen zu bringen, doch er scheiterte an dessen Störrigkeit. Nochmals wurde das Thier aufs Kamel gebracht, und schon glaubte ich, daß jetzt alles gut gehen würde, als der Oryx plötzlich aus seiner Umhüllung heraussprang und mit raschen Schritten davon eilte. Wir setzten ihm nach, waren aber nicht im Stande, ihn wieder zu erlangen. Jetzt zeigte er, daß er marschfähig war, fühlte auch seine Freiheit viel zu sehr, als daß er sich von neuem in unsere Gewalt begeben hätte.
In der Neuzeit ist die ›Steppenkuh‹ oft nach Europa gekommen und hat sich in den Thiergärten recht wohl erhalten, auch ohne besondere Schwierigkeit hier sich fortgepflanzt. Weit seltener sieht man den Passan und noch viel weniger die Beisa, welche gegenwärtig noch den meisten Museen fehlt.
Man benutzt Fleisch und Fell der Oryxantilope in der gewöhnlichen Weise. Die geraden Hörner des Passan und der Beisa werden oft als Lanzenspitzen verwendet. Man wartet, bis die Hornschalen bei beginnender Fäulnis von dem starken Zapfen sich lösen, zieht sie dann ab, setzt sie auf gewöhnliche Lanzenstäbe, und die Waffe ist fertig. Die Europäer am Kap lassen die Hörner auch wohl poliren, mit silbernen Knöpfen versehen und gebrauchen sie sodann als Spazierstöcke.
Die Mendesantilopen ( Addax) schließen sich den Oryxböcken am nächsten an, da ihre leichten, schrauben- oder leierförmig gewundenen, der Länge nach geringelten, schlanken und langen Hörner das einzige gewichtige Unterscheidungsmerkmal bilden. Auf den egyptischen Denkmälern findet sich die Mendesantilope mehrfach dargestellt. Die Mendeshörner, welche den Kopf der Götterbilder, der Priester und Könige des alten Egyptenlandes schmücken, sind dem Gehörn dieser Antilope nachgebildet. Von Egypten aus hat sich der Ruhm des Thieres weiter verbreitet. Schon die alten Griechen und Römer kannten es recht gut; Plinius erwähnt es unter dem griechischen Namen » Strepsiceros« und unter dem lateinischen Addax, welcher letztere seit uralten Zeiten der Landesname dieser Antilope sein muß, weil sie heute noch von den Arabern Abu-Addas genannt wird.
Die Mendesantilope ( Addax nasomaculatus, Antilope und Strepsiceros Addax, Oryx nasomaculata) ist ziemlich plump gebaut, der Leib untersetzt, am Widerriste merklich erhaben, am Kreuze sehr gerundet, der Kopf gestreckt, aber breit am Hinterhaupte; die Läufe sind stark und verhältnismäßig kräftig. Die nach auf- und rückwärts gerichteten, in doppelter Windung gebogenen, gegen die Spitze zu allmählich von einander abweichenden Hörner werden von der Wurzel an von dreißig bis fünfundvierzig schiefen, nicht regelmäßigen Ringen umgeben, sind aber im letzten Drittel gerade und vollkommen glatt. Die Behaarung ist dicht und mit Ausnahme einiger Körperstellen kurz und grob. Vor der Wurzel der Hörner steht ein Schopf, welcher über die Stirn herabhängt; vom Ohre nach dem Hinterhaupte zieht sich ein Streifen verlängerter Haare hinab; den Vorderhals schmückt eine lange Mähne. Von der gelblich weißen Grundfärbung sticht das Braun des Kopfes, des Halses und der Mähne ziemlich lebhaft ab. Unterhalb der Augen verläuft eine breite Binde, hinter den Augen sowie auf der Oberlippe stehen weiße Flecken; die Quaste des ziemlich langen Schwanzes besteht aus weißen und braunen Haaren. Während der kühlen Jahreszeit geht die gelblich weiße Färbung allmählich ins Graue über. Beim Männchen ist das Haar dunkler und die Mähne größer als beim Weibchen. Junge Thiere sind rein weiß gefärbt.
Das Verbreitungsgebiet der Mendesantilope beschränkt sich auf Ostafrika. In den Ländern Südnubiens, zumal in der Bahiuda, sieht man sie zuweilen in zahlreichen Herden und häufig in kleinen Familien. Sie bewohnt auch die dürrsten Stellen, wo, nach der Versicherung der Nomaden, weit und breit kein Tropfen Wasser sich findet. Wenn man diesen Leuten Glauben schenken darf, ist sie im Stande, monatelang das letztere gänzlich zu entbehren. Sie ist scheu und furchtsam, wie die übrigen Antilopen, behend und ausdauernd im Laufe, dennoch aber vieler Verfolgung ausgesetzt. Unter den Thieren stellen ihr wohl nur der Hiänenhund oder Simir und der Karakal nach: um so eifriger aber verfolgen sie die Edlen des Landes, unter denen sie lebt. Die Machthaber der Nomaden und Beduinen sehen in ihr eines der edelsten Jagdthiere, und hetzen sie, theils um ihr Fleisch zu nützen, theils um die Schnelligkeit ihrer Pferde und Windhunde zu erproben, theils auch um Junge zu erbeuten, welche sie dann aufziehen.

Mendesantilope ( Addax nasomasculata). 1/12 natürl. Größe.
An heißen Tagen rücken die Jäger mit Kamelen und Pferden auf die Jagd aus. Eine Anzahl von Kamelen trägt das der Jagdgesellschaft nöthige Brodgetreide, Wasser und Futter für die Pferde, Zelte und Lagerbedürfnisse, die Frauen und die weniger bei der Jagd Betheiligten. Die Männer reiten auf stolzen Pferden. Sobald sich Antilopen zeigen, werden die Pferde zunächst getränkt; dann jagt man den schnellfüßigen Thieren nach, bis sie vor Mattigkeit nicht weiter können. Am eifrigsten betreiben die Beduinen diese Jagd. Sie ist ihnen eine männliche Uebung, ein Spiel, eine Unterhaltung. Der Werth der Antilope kommt hier nicht in Betracht; es gilt vielmehr die Gewandtheit des Mannes und die Schnelligkeit des Pferdes oder Windhundes zu zeigen. Nur die Edlen des Landes üben diese Jagd zu Pferde aus. Ihrer zwölf oder fünfzehn vereinigen sich und nehmen ihre Diener, ihre Zelte, ihre vortrefflichen Windhunde und ihre abgerichteten Falken mit sich hinaus. Sobald man eines Haufens dieser oder anderer dieselben Ländereien bewohnenden Antilopen ansichtig wird, sucht man sich so weit als möglich ungesehen dem Trupp zu nähern. Wenn man in ihre Nähe gekommen ist, springen die Diener von den Kamelen oder Pferden und halten den Windhunden, welche sie bisher an langen Stricken führten, die Schnauzen zu, um sie am Bellen zu verhindern. Dann machen sie die klugen Thiere auf das noch fernstehende Wild aufmerksam und lassen sie endlich gleichzeitig los. So wie dies geschehen, fliegen die edlen Geschöpfe wie Pfeile über die Ebene dahin, und der ganze Reiterzug saust hinter ihnen drein, mit allerlei Liebkosungen und Befehlen die Hunde anfeuernd und aufstachelnd. »O! mein Bruder, mein Freund, mein Herr, eile, du Schnellfüßiger, du von einem Vogel Geborner, du Falkengleicher, eile! Dort sind sie, eile, mein Liebling, laufe, du Unübertrefflicher!« Schmeichelei folgt auf Drohung, Lob wechselt mit Tadel, je nachdem der Hund die Antilope oder diese ihn überbietet. Die besten Windhunde erreichen das Wild nach einer Jagd von einer bis zwei Meilen, die schlechteren müssen vier und zuweilen sechs Meilen weit den flüchtigen Antilopen nachstürmen, ehe diese, erschöpft, sich ihnen entgegenstellen.
In dem Augenblicke, wenn der erste Hund das Rudel erreicht, wird die Jagd überaus spannend und anziehend. Der edle Windhund stürzt sich immer auf das stärkste Thier des Rudels, aber nicht blind, sondern mit größter Vorsicht, mit unübertrefflicher Gewandtheit und wahrhaft bewunderungswürdiger Leichtigkeit. Die Antilope versucht dem Feinde zu entfliehen, schlägt Haken nach der Rechten, nach der Linken, wirft sich über den Hund weg und springt rückwärts. Dieser schneidet ihr jeden Weg ab und kommt ihr immer näher. Endlich stellt sie sich und weist das spitze Gehörn; in demselben Augenblicke aber, in welchem sie den Kopf zur Erde beugt, um ihrem Angreifer einen gefährlichen Stoß zu versetzen, springt dieser auf ihren Nacken und reißt sie mit wenigen Bissen zu Boden, entweder das Genick oder die Schlagadern durchbeißend. Wenn das Wild gefallen ist, eilen die Araber mit Freudengeschrei herbei, springen von den Pferden herab und schneiden ihrer Beute unter dem Ausrufe: »Be ism lillahi el rachmân, el rachím, Allahu akbar!« – im Namen Gottes des Allbarmherzigen, Gott ist größer! – die Kehle durch, damit sie sich verblute, wie das Gesetz des Propheten es befiehlt. Fürchten sie aber, nicht zur rechten Zeit auf dem Walplatze einzutreffen, so rufen sie von weitem dem Hunde die obigen Worte zu, in dem festen Glauben, daß nun er seinerseits das gesetzmäßige Schlachten besorgen werde. Dasselbe thun sie auch, wenn sie ein Thier mit der Kugel erlegen: sie sagen, daß ihr Geschoß durch jene Worte das Gesetz vollständig erfülle.
Gegen Abend endet die Jagd. Einer der Reiter sprengt zu den Kamelen zurück oder gibt deren Führern den Sammelplatz an, auf welchem man übernachten will. Dann zieht alles dorthin, und ein eigentümliches, frisches, fröhliches Weidmannsleben erwacht in den Zelten.
Solche Jagden währen oft mehrere Wochen. Die Jäger nähren sich von ihrer Beute; aber gewöhnlich ist diese so reich, daß sie einen Tag um den andern immer noch ein mit Wild befrachtetes Kamel nach den Zelten schicken können, um auch ihren Frauen und Kindern einen Antheil zukommen zu lassen. Die Zeit der Regen ist die geeignetste zur Jagd aller Antilopen; denn wenn der Boden benetzt ist, kann das Wild nicht so schnell laufen als sonst, weil sich Klumpen von feuchter Erde oder Schlamm an seine Hufe hängen.
Neuerdings sind lebende Mendesantilopen wiederholt nach Europa gelangt und hier in verschiedenen Thiergärten erhalten und beobachtet worden. Sie zeigen durch ihr Betragen, wie nahe sie mit den Oryxböcken verwandt sind; denn sie sind ebenso launisch und unverträglich wie diese. Doch kennt man auch Ausnahmsfälle. Eine, welche der Großherzog von Toscana aus Egypten erhielt, scheute sich nicht im geringsten vor dem Menschen, ließ sich streicheln und liebkosen und leckte ihrem Wärter die Hand. Zuweilen wollte sie spielen und wurde dabei unangenehm; denn oft zeigte sie unversehens die Hörner und versuchte den zu stoßen und zu schlagen, welchen sie eben geliebkost hatte. Beim geringsten Verdachte spitzte sie die Ohren und setzte sich in Vertheidigungszustand. Auf Hunde und andere Feinde lief sie mit zurückgeschlagenen Hörnern los, stemmte sich mit den Vorderfüßen auf den Boden, wendete das Horn nach vorn und stieß rasch von unten nach oben; auch mit den Füßen schlug sie sowohl vor- als rückwärts. Ihre Stimme war bald ein Grunzen, bald ein schwaches Plärren. Mit letzterem drückte sie Verlangen nach Nahrung aus. Bei einfachem Futter halten sich diese Antilopen gut und lange in Gefangenschaft, pflanzen sich hier auch ohne besondere Schwierigkeiten fort.
Drehhorn- oder Schraubenantilopen ( Strepsiceros) nennt man einige große Antilopen mit schraubenförmig gewundenen, zusammengedrückten und gekielten Hörnern, welche nur von dem Bocke getragen werden, und buntem, gestreiftem oder sonstwie durch lichte Farben gezeichnetem Fell. Thränengruben sind nicht vorhanden; die Muffel ist entweder behaart oder nackt.
Als Vertreter dieser Gruppe gilt der stattliche Kudu ( Strepsiceros Kudu, Antilope strepsiceros und Zebra, Damalis capensis, Strepsiceros excelsus), eine Antilope, welche unseren Edelhirsch an Größe übertrifft und kaum hinter dem Elch zurücksteht, obgleich sie dessen Gewicht nicht erreicht. Alte Böcke messen von der Nase bis zur Spitze des etwa 50 Centimeter langen Schwanzes 3 Meter, bei 1,7 Meter Höhe am Widerrist, und erlangen ein Gewicht von 300 Kilogramm und darüber. Das Weibchen ist bedeutend kleiner; doch maß ein von mir untersuchtes Altthier immer noch 2,5 Meter in der Länge, und 1,5 Meter Höhe am Widerrist. Hinsichtlich des Leibesbaues erinnert der Kudu in vieler Hinsicht an den Hirsch. Der Leib ist untersetzt, der Hals mittellang, der Kopf ziemlich kurz, an der Stirne breit, vorn zugespitzt, die Oberlippe behaart bis auf die Furche; die Augen sind groß, die Ohren länger als der halbe Kopf. Diesem verleiht das Gehörn einen herrlichen Schmuck. Es gehört zu den größten, welche irgend eine Antilope trägt. Schon bei mittelalten Böcken messen die einzelnen Stangen in gerader Linie von der Spitze zur Wurzel gegen 60 Centim., bei sehr alten aber erreichen sie beinahe das doppelte dieser Länge. Man begreift wirklich kaum, wie das Thier im Stande ist, die Last des Kopfschmuckes zu schleppen, oder wie es ihm möglich wird, mit solchen Hörnern durch das Dickicht eines Buschwaldes zu flüchten. Von der Wurzel aus richtet sich das Gehörn schief nach hinten und mehr oder weniger weit nach auswärts. Bei einigen Gehörnen stehen die Spitzen fast einen Meter weit von einander. Die Schraubenwindungen der Stange finden sich immer an derselben Stelle, die erste etwa im ersten, die zweite ungefähr im zweiten Drittel der Länge. Auch die Spitzen sind etwas schraubenartig nach außen gewendet, bei alten Thieren mehr als bei jungen. An der Wurzel der Hörner beginnt ein scharfkantiger Kiel, welcher in seinem Verlaufe dem Schraubengange folgt und erst gegen die vollkommen runde Spitze hin sich verliert. Die kurze, glatt anliegende, etwas rauhe Behaarung verlängert sich auf der Firste des Halses und Rückens, beim Bocke auch vom Kinn bis unter die Brust herab zur Mähne. Ein schwer zu beschreibendes röthliches Braungrau, welches auf den hinteren Theilen des Bauches und den inneren Seiten der Läufe in Weißlichgrau übergeht, bildet die Grundfärbung; die Nackenmähne ist dunkelbraun oder schwarz, bei sehr alten Thieren aber wenigstens längs des ganzen Vorderhalses weißgrau, der Schwanz oben dunkelbraun, unten weiß und an der Quaste schwarz. Röthliche Kreise umgeben die Augen. Von jener Grundfärbung heben sich scharf ab weiße Streifen, meist sieben oder neun an der Zahl, von denen einige sich gabeln. Sie verlaufen in gleichen Abständen längs der Seite von dem Rücken nach unten. Zwischen beiden Augen liegt ein nach der Schnauzspitze zugekehrter, ähnlich gefärbter Halbmond. Bei dem Weibchen sind alle Streifen schwächer und blässer; junge Thiere sollen eine größere Anzahl derselben zeigen als alte.

Kudu ( Strepsiceros Kudu). 1/20 natürl. Größe.
Unsere Kunde des Kudu reicht nicht über die letzte Hälfte des vorigen Jahrhunderts zurück. Zwar geben bereits die Alten von dem » Strepsiceros« eine ziemlich richtige Beschreibung, allein sie kannten denselben nur von Hörensagen, und auch unsere Vorfahren wußten von den Trägern der ihnen auffallenden Schraubenhörner, welche oft nach Europa gesandt worden waren, nichts zu sagen. Erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gelangte ein lebender Kudu nach Holland, und damit beginnt die Geschichte des stattlichen Thieres; eine erschöpfende Beschreibung seiner Lebensweise konnte jedoch bis jetzt noch immer nicht geliefert werden.
Der Kudu, von den Arabern Tedal oder Nelet, am Habesch Agasén und Tigrisch Garua genannt, ist weit über Afrika verbreitet, da er von den Ländern des Vorgebirges der Guten Hoffnung an nach Norden hin vorkommt, so weit bewaldete Berg- oder wenigstens Hügelzüge einen ihm zusagenden Aufenthalt gewähren. In früheren Zeiten fand er sich in der Ansiedelung am Vorgebirge der Guten Hoffnung so ziemlich überall; gegenwärtig ist er hier sehr verringert und dem Innern zugedrängt, doch bewahrt ihn auch hier seine Lebensweise wahrscheinlich noch auf längere Zeit vor dem Schicksale seiner Familienverwandten, und außerdem tritt er in allen übrigen, innerhalb seines Verbreitungsgebietes liegenden Ländern noch in so namhafter Anzahl auf, daß seine Ausrottung zunächst nicht befürchtet zu werden braucht.
Wie es scheint, bewohnt der Kudu ausschließlich den Wald, am liebsten jene in Afrika so häufigen, dornigen Buschwälder. Wir fanden ihn in den Bogosländern erst in einer Höhe von sechshundert Meter über dem Meere und bis zu zweitausend Meter hinauf, immer an den Bergwänden, wo er zwischen den grünen Mimosen majestätisch dahin schritt. Die starken Böcke leben einzeln; die Thiere dagegen vereinigen sich gern in schwache Trupps von vier bis sechs Stück. Südafrikanische Jäger wollen beobachtet haben, daß jüngere Böcke, welche durch die alten von dem Trupp abgeschlagen wurden, sich zusammenrudeln und mit einander ein mürrisches Junggesellenleben führen.
Nach den Beobachtungen, welche wir anstellen und nach den Erkundigungen, welche wir einziehen konnten, ähnelt der Kudu in seiner Lebensweise und seinem Wesen unserem Hochwilde. Er durchstreift ein ziemlich großes Gebiet und wechselt regelmäßig hin und her. Haltung und Gang erinnern an den Hirsch. Erstere ist ebenso stolz, letzterer ebenso zierlich und dabei doch gemessen wie bei dem Edelwilde unserer Wälder. So lange der Kudu ungestört ist, schreitet er ziemlich langsam an den Bergwänden dahin, dem dornigen Gestrüpp vorsichtig ausweichend und an günstigen Stellen sich äsend. Knospen und Blätter verschiedener Sträuche bilden einen guten Theil seines Geäses; doch verschmäht er auch Gräser nicht und tritt deshalb, zumal gegen Abend, auf grüne Blößen im Walde heraus. Aufgescheucht trollt er ziemlich schwerfällig dahin, und nur auf ebenen Stellen wird er flüchtig. Aber auch dann noch ist sein Lauf verhältnismäßig langsam. In den Buschwäldern muß er, um nicht aufgehalten zu werden, sein Gehörn soweit nach hinten legen, daß die Spitzen desselben fast seinen Rücken berühren. Ehe er flüchtig wird, stößt er ein weithin hörbares Schnauben und zuweilen ein dumpfes Blöken aus. Wie Pater Filippini mir sagte, rührt letzteres aber bloß vom Thiere her; der Bock schreit nur zur Brunftzeit, dann aber in derselben ausdrucksvollen Weise wie unser Edelhirsch.
In Habesch soll der Bock Ende Januar auf die Brunft treten. Von der Höhe herab vernimmt man um diese Zeit gegen Abend sein Georgel, mit welchem er andere Nebenbuhler zum Kampfe einladet. Daß heftige Streite zwischen den verliebten Böcken ausgefochten werden, unterliegt wohl kaum einem Zweifel; denn der Kudu zeigt sich auch sonst als ein höchst muthiges und wehrhaftes Thier. Filippini hat zwar niemals einem solchen Kampfe beigewohnt, wohl aber die Abessinier davon erzählen hören. Der Satz fällt mit dem Anfange der großen Regenzeit zusammen, gewöhnlich Ende August: das Thier würde also sieben bis acht Monate hochbeschlagen gehen. Nur höchst selten findet man noch Böcke bei den Thieren, nachdem sie gesetzt haben: die Mutter allein ernährt, bewacht und beschützt ihr Kalb.
In allen Ländern, wo der stolze, schön gezeichnete Kudu vorkommt, ist er der eifrigsten Verfolgung ausgesetzt. Sein Wildpret ist, wie ich mich selbst überzeugt habe, ganz vorzüglich und erinnert in Geschmack an das unseres Edelhirsches. Das Mark der Knochen gilt manchen südafrikanischen Völkerschaften als ein unübertrefflicher Leckerbissen. Zumal die Kaffern haben, wenn sie einen Kudu erlegten, nichts eiligeres zu thun, als das Fleisch von den Knochen abzuschälen, diese zu zerbrechen und dann das Mark aus den Röhren zu saugen, roh, wie es ist. Auch das Fell wird im Süden Afrikas hochgeschätzt und gilt für manche Zwecke geradezu als unersetzlich. Die holländischen Ansiedler kaufen es zu hohen Preisen, um Peitschen, insbesondere die sogenannten Schmitzen oder Vorschläge, welche als Haupterfordernis einer zum Knallen geeigneten Peitsche angesehen werden, daraus zu verfertigen. Außerdem verwendet man das Leder zu Riemen, mit denen man Häute zusammennäht oder Päckte schnürt, ebenso auch zu Geschirren, Satteldecken, Schuhen etc. In Habesch gerbt man das Fell und bereitet sich aus den Stangen des Gehörns, nachdem man sie mit Hülfe der Fäulnis von ihrem Knochenkern befreit hat, Füllhörner zur Aufbewahrung von Honig, Salz, Kaffee und dergleichen.
Die Jagd des Kudu wird in sehr verschiedener Weise ausgeführt. Filippini zog den Pirschgang jeder übrigen Jagdart vor. Er kannte die Lieblingsstellen des Wildes und suchte sich hier an die weit sichtbaren, hohen Gestalten vorsichtig anzuschleichen. Am liebsten jagte er des Nachmittags, weil um diese Zeit der Agasén in die Thäler herab zur Tränke zieht. Die meisten Antilopen begnügen sich mit dem Nachtthau, welchen sie von den Blättern der Bäume ablecken, der Agasén aber bedarf sehr viel Wasser und muß allabendlich von seinen Bergen herabsteigen, um sein Bedürfnis zu befriedigen. Hierzu sucht er nun gewisse, ihm besonders günstig erscheinende Stellen der kleinen Bäche oder der in Regenbetten gelegenen Tümpel abessinischer Gebirgsthäler auf, und wer solche Stellen kennt, braucht, um sicher zu Schusse zu kommen, eben bloß anzustehen. Auch der Anstand auf dem Wechsel würde unzweifelhaft ein günstiges Ergebnis haben, weil der Agasén jenen sehr genau einhält. Ob sich das Thier treiben läßt wie unser Hochwild, wage ich nicht zu entscheiden, glaube es aber bejahen zu dürfen. Vorsichtig muß man jedenfalls zu Wege gehen; denn der Kudu ist außerordentlich wachsam, und seine vorzüglich scharfen Sinne unterrichten ihn immer rechtzeitig von der Ankunft eines etwaigen Feindes. Näher als zweihundert Schritte kommt man selten an ihn heran, und solche Entfernung ist doch nur europäischen Schützen gerecht. Die Kaffern, deren schlechte Waffen bei der Vorsicht des Thieres sich gänzlich erfolglos zeigen, haben eine eigene Jagdweise erfunden: sie gehen in größeren Gesellschaften zur Jagd hinaus und verfolgen die von ihnen aufgescheuchten Antilopen, weil sie wissen, daß diese sehr bald ermatten. Das Wild hin- und hertreibend, führen sie es der einen oder der anderen Abtheilung ihrer Jagdgehülfen zu, lassen von diesen die Verfolgung fortsetzen und gönnen ihm so keinen Augenblick Ruhe, sondern zwingen es, stundenlang rasch zu laufen. Ihre Frauen sind mit einer Tracht wassergefüllter Straußeneier hier und da vertheilt, um die abgehetzten Männer zu erquicken, und diesen gelingt es, dank ihrer nie ermattenden Ausdauer, endlich wirklich, die stattlichen Antilopen zu ermüden, und nun geht alles mit Geschrei der willkommenen Beute entgegen. Das Altthier ergibt sich widerstandlos seinen Verfolgern; die starken Böcke aber nehmen diese an, senken den Kopf nieder, so daß ihr furchtbares Gehörn wagerecht zu stehen kommt, und stürzen plötzlich pfeilschnell auf ihre Angreifer los. Letztere sind verloren, wenn sie nicht rechtzeitig geschickt auf die Seite springen. Gegen Hunde, welche den Kudu nach wenigen Minuten im Laufe einholen, vertheidigt er sich regelmäßig, und zwar auch mit den Läufen; seine starken Schalen sind immer noch scharf genug, um böse Wunden zu schlagen. Deshalb gebrauchen die Kaffern die treuesten Jagdgehülfen nicht bei ihren Hetzen, helfen sich vielmehr lieber selbst und werfen so viele Wurfspieße auf das von ihnen umringte Wild, daß es seinen Wunden schließlich erliegen muß.
Sogleich nach der Tödtung des Kudu beginnt ein großes Fest. Es wird ein Feuer angezündet, dessen Rauch auch die fernstehenden Jagdgenossen herbeizieht. Viele Hände beschäftigen sich mit dem Zerlegen des Wildprets; andere unterhalten das Feuer und werfen, wenn sich ein tüchtiger Kohlenhaufen gebildet hat, eine Menge Steine hinein, um sie glühend zu machen. Mittlerweile ist das Wildpret zerlegt und zerschnitten worden. Man ordnet die Steine einigermaßen zu einem Herde und bedeckt sie nun dicht mit den zerschnittenen Wildpretstücken. Während diese langsam braten, fällt die hungrige Bande über die Knochen her, und jeder kauert, lüsternen Auges das Fleisch betrachtend, mit dem Knochen in der Hand und zwischen den Zähnen, vor dem Feuer. Der Braten wird noch halbroh von den Steinen genommen und gierig verschlungen. Genau in derselben Weise richten sich auch die Abessinier ihr Wildpret zu, nur mit dem Unterschiede, daß sie nicht die rohen Knochen benagen und ihr Mark gleich aufessen, sondern das letztere aus den zerschlagenen Röhren pressen und zur Fettung des Fleisches benutzen. Wir unsrerseits brieten das Wildpret in europäischer Weise, und ich darf wohl versichern, daß ich selten schmackhafteres Fleisch genossen habe; zumal die aus den Lenden geschnittenen und saftig gebratenen Fleischstücke waren ausgezeichnet. Außer dem Menschen dürfte der erwachsene Kudu wenige Feinde haben. Daß sich König Leu, welcher den wilden Büffel niederschlägt, vor dem scharfspitzigen Schraubengehörn des Kudu nicht fürchtet, unterliegt wohl kaum einem Zweifel; vor dem Leoparden, diesem Hauptjäger aber, ist der starke, wehrhafte Bock und selbst das Altthier wahrscheinlich gesichert, und die Wildhunde kommen ebenfalls schwerlich zum Ziele. Dagegen soll der Agasén einen anderen Feind haben, welcher ihn sehr belästigt. Ein deutscher Kaufmann in Massaua überließ mir ein Kudugehörn, welches sich durch eigenthümliche lederartige Anhängsel auszeichnete, mit den Worten: »Schneiden Sie die Auswüchse nicht ab; denn diese sah ich schon an den Hörnern, als ich die Antilope erlegt hatte«. Wie die genaue Untersuchung ergab, waren die sonderbaren Zotteln nichts anderes, als Gespinste einer Wespenlarve, welche den hornigen Theil der Stange bis auf den Knochenkern durchbohrt und das durch sie verursachte Loch außen übersponnen hatte. Ich gebe dies mit allem Vorbehalte, weil ich vielleicht getäuscht wurde, d.+h. weil das Kerbthier sich erst nach dem Tode des Agasén das Gehörn zum Wohnsitz erkoren haben könnte: so viel aber ist sicher, daß beide Stangen ihrer Wurzel einmal zahlreich von einem wespenartigen Thiere bevölkert gewesen sind. An anderen Gehörnen dieser und der übrigen Antilopen oder überhaupt der scheidenhörnigen Thiere habe ich ähnliches nie gesehen, und deshalb scheint mir obiges immerhin der Aufzeichnung werth.
Jung eingefangene Kudus werden sehr zahm. Anderson, welcher ein kleines Kalb fing, rühmt es als ein niedliches, spiellustiges Geschöpf. Das kleine Ding war, als man es erlangte, noch so zart, daß man ihm die Milch aus einer Flasche reichen mußte, welche man mit einem leinenen Pfropfen leicht verkorkt hatte. Bald aber gewöhnte sich der Pflegling so an seinen Herrn, daß er zu einem vollständigen Hausthiere wurde. Am Kap würde man unzweifelhaft schon Versuche gemacht haben, Kudus zu zähmen und für die Haushaltung zu verwenden, hätte man nicht in Erfahrung gebracht, daß sie der furchtbaren » Pferdekrankheit«, welche so viele südafrikanischen Thiere dahinrafft, unterworfen sind und ihr fast regelmäßig unterliegen.
Nach Europa ist der Kudu bis jetzt nur einige Male lebend gekommen, und noch heutigen Tages, wo für die Thiergärten so viel Wild oft auf unbegreifliche Weise gefangen wird, gehört er zu den größten Seltenheiten.
Schließlich verdient noch erwähnt zu werden, daß die Araber die männlichen und weiblichen Kudus als verschiedene Thiere ansehen und deshalb auch mit besonderen Namen bezeichnen. Der Bock wird in der Gegend von Manassa Garrea (zu Deutsch: der Kühne), das Altthier dagegen Nellet (zu Deutsch: die Gewandte oder Starke) genannt.
Die Waldböcke ( Tragelaphus) sind ungemein zierlich gebaute, etwa rehgroße Antilopen, mit kurzen Hörnern, einem Rückenkamme und eigenthümlicher Zeichnung. Der Kopf ist schlank, nach vorn zu gleichmäßig verschmälert, die Schnauze fein und zierlich, die nackte Muffel birnförmig, oben gerundet, nach den Nasenlöchern zu ausgebaucht, an der Lippe spitzig zulaufend, das Auge groß, sein Stern quergestellt, das Ohr groß, breit und an der Spitze gerundet, außen mit sehr kurzen, am unteren Ohrrande innen mit einem breiten wimperartigen Haarbüschel besetzt, der Hals schlank, der Leib hoch, seitlich zusammengedrückt, auf der Rückenfirste gewölbt, von vorn nach hinten verstärkt, der Oberarm wie der Schenkel breit und kräftig, der Lauf nach unten stark verschmächtigt, der Huf ungemein zierlich, der Wedel sehr breit und ziemlich lang. Thränendrüsen sind nicht vorhanden. Das nur dem Bocke zukommende Gehörn hat länglich eiförmigen Querschnitt mit einem vorn und einem hinten beginnenden Grate, welche sich mit dem Horne selbst bis zur Spitze schwach schraubig drehen, ist über den Augen eingesetzt, der Gesichtslinie fast gleich gerichtet, bald ein wenig nach vorn, bald etwas nach hinten geneigt, seitlich ausgebogen, gegen die Spitze hin gleichlaufend. Ein dichtes, längs des ganzen Rückens zu einem Kamme verlängertes, absonderlich bunt gezeichnetes Haarkleid trägt fernerhin zur Kennzeichnung der Gruppe bei.
Häufiger als jeder andere Waldbock gelangt die in Westafrika lebende Schirr-, Streifen- oder Hieroglyphenantilope ( Tragelaphus scriptus, Antilope scripta und maculata) lebend in unsere Thiergärten. Die Gesammtlänge des erwachsenen Bockes beträgt 1,6 Meter, wovon etwa 15 Centim. auf den Schwanz kommen, die Schulterhöhe etwa 85, die Kreuzhöhe 90, die Länge der Hörner 20 Centim. Das an und für sich dichte und lange Haarkleid entwickelt sich längs des ganzen Rückens zu einer kammartigen Mähne und verlängert sich ebenso an dem hinteren Theile der Schenkel wie an dem Wedel, von welchem es fächerförmig nach allen Seiten hin ausstrahlt. Seine Färbung ist eine sehr bunte, indem namentlich drei Farben mit einander abwechseln. Da die am Kopfe und Halse vorherrschend rostroth, an der Wurzel grau gefärbten Haare schwärzliche und grauliche Spitzen haben, erscheinen diese Theile anders als der übrige Leib, der Kopf fahlgrau, Hals, Vorderleib und Rücken dunkel rehgrau, wogegen die Leibesseiten und Hinterschenkel die rein rostrothe Färbung zeigen. Schwarzbraun sind Nasenrücken, Vorderbrust, Vorderarm und die Fesselgegend, braunschwarz die Kammhaare des Vorderrückens, braunschwarz mit weißen Spitzen die des Hinterrückens, weiß endlich ein Fleck unter dem Auge, ein anderer dicht daneben am Unterkiefer, ein dritter hinten am Grunde des Ohres, Oberlippe und Kinn, ein quer gestellter Kehlfleck und ein breites halbmondförmiges Band zwischen Hals und Brust, Achsel- und Weichengegend, Vorder- und Hinterläufe vorn und innen vom Hand- oder Fuß- bis zum Fesselgelenk, ein Fleck auf den Fesseln selbst, die nicht allein je nach den Stücken, sondern auch je nach der einen und anderen Seite des Thieres verschiedene Geschirrzeichnung, bestehend aus einem mäßig breiten, in der unteren Leibeshälfte verlaufenden Längsstreifen, mehreren schmalen, senkrecht und in ziemlich gleichweiten Abständen sich herabziehenden, manchmal auch sich kreuzenden Querstreifen, welche von jenem aufgenommen werden oder in ihm endigen, und runden und eiförmigen Flecken, welche auf dem Oberarme einzeln und spärlich, auf dem Oberschenkel theils gehäuft, theils in einer gebogenen Linie stehen sowie endlich die seitlichen Haare des übrigens rostbraunen Schwanzes. Die Iris ist dunkelbraun, die Muffel schwarz, das Gehörn graulich Hornfarben, der Huf glänzend schwarz.
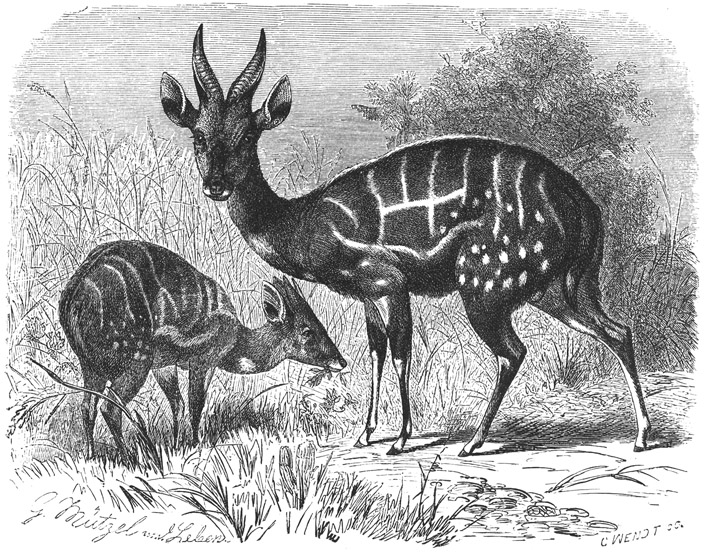
Schirrantilope ( Tragelaphus scriptus). 1/14 natürl. Größe.
Ueber das Freileben der Waldböcke wissen wir bis jetzt nur soviel, daß diese anmuthigen Geschöpfe paarweise in den Waldungen leben, sich hier im dichtesten Gebüsch aufhalten, nicht gerade scheu sind, vom Jäger unbemerkt gern bis auf einige Schritte Entfernung stehen oder liegen bleiben und dann mit behenden und gewandten Sprüngen davoneilen. Während der großen Hitze des Tages regen sie sich nicht, treten vielmehr erst gegen Abend zur Aesung heraus, bleiben, wie es scheint, einen guten Theil der Nacht munter, äsen sich am Morgen nochmals und begeben sich dann zur Ruhe. Ihre Paarzeit fällt in diejenigen Monate ihrer Heimat, welche wir mit unserem Herbste vergleichen können, der Satz in den Beginn der Regenzeit, welche, wie schon wiederholt bemerkt, unserem Frühlinge entspricht. Dann folgt das eine Kälbchen, welches das Thier zur Welt bringt, beiden Eltern geraume Zeit, trennt sich jedoch schon vor der nächsten Paarungszeit von ihnen und sucht nun mit anderen seines gleichen sich zu vereinigen, ein Pärchen oder höchstens einen kleinen Trupp bildend. Die Stimme der südafrikanischen Art erinnert nach Harris in so hohem Grade an das Bellen eines Hündchens, daß man sich leicht täuschen kann. Obwohl das Fleisch aller Wildböcke nicht geschätzt wird, jagt man ihnen doch überall mit einem gewissen Eifer nach, weil die Jagd höchst anziehend ist und ebenso geschickte Jäger als geübte Hunde erfordert. Nur mit Hülfe der letzteren gelingt es, Waldböcke zum Schusse zu bringen; die Bewegungen dieses Thieres sind jedoch so behend, und die Oertlichkeit bietet so viele Schwierigkeiten dar, daß in der Regel nur ein sehr gewandter Schütze Beute gewinnt. Schwächeren Hunden gegenüber vertheidigen sich ältere Waldböcke mit überraschendem Muthe und oft mit Erfolg.
Wenige Antilopen gleicher Größe halten sich leichter in Gefangenschaft als Waldböcke. Ihre Aesung im Freien besteht zwar vorzugsweise in zarten Blättern, Knospen und Trieben, welche sie mit ihrer ungemein langen und höchst beweglichen Zunge abbeißen; sie gewöhnen sich jedoch sehr rasch an das Futter unserer Hausthiere, zeigen sich überhaupt anspruchslos und verursachen dem Pfleger kaum besondere Mühe. So nur erklärt es sich, daß wir Schirrantilopen so häufig lebend erhalten. Bei uns zu Lande verlangen sie selbstverständlich Schutz gegen die ihnen ungewohnte Witterung und im Winter einen warmen Stall, dauern aber, falls man ihnen diese Bedingungen erfüllt, vortrefflich aus und pflanzen sich auch ziemlich oft im Käfige fort. Wenn man sich viel mit ihnen beschäftigt, werden sie sehr zahm, beanspruchen, daß man ihnen schmeichelt und befinden sich augenscheinlich nur dann wohl, wenn sich jemand viel mit ihnen abgiebt. Launisch und wetterwendisch sind aber auch sie. Aus der Spiel- und Necklust, welche sie anfänglich zeigen, wird leicht bitterer Ernst; im buchstäblichen Sinne des Wortes sich in den Nacken werfend, nehmen sie eine ganz sonderbare Stellung an, wölben ihren Nacken zu einem Katzenbuckel, sträuben den Haarkamm, spreizen das Haar des erhabenen Wedels und biegen sich dann plötzlich nach vorn und unten, um zu stoßen. In dieser Haltung erinnern sie lebhaft an einzelne Hirsche; der Eindruck, welchen sie auf den Beschauer machen, ist aber ein ungleich zierlicherer, wie sie überhaupt zu den anmuthigsten Arten ihrer Familie zählen.
Die Gruppe der Rindsantilopen ( Buselaphus) stellt gewissermaßen ein Verbindungsglied dar zwischen den Antilopen und den Rindern. Der Leib der hierher zu rechnenden Arten ist plump, schwerfällig, dick und stark, der Hals kurz und gedrungen, der Kopf groß, der Wedel einem Kuhschwanze ähnlich, die Haut des Vorderhalses zu einer weit herabhängenden Wamme verlängert, das Gehörn, welches beide Geschlechter tragen, auf der Höhe des Stirnbeines aufgesetzt, in der Gesichtslinie zurückgebogen, ziemlich gerade oder leicht ausgeschweift, kantig und infolge des schraubenförmig umlaufenden Kieles mehrfach gedreht, unten querrunzelig, die Muffel klein, schmal, aber deutlich. Thränengruben sind nicht vorhanden. Das Weibchen ähnelt dem Männchen; sein Euter hat vier Zitzen.
Vertreter dieser Gruppe ist die Elenantilope, das größte und schwerste Mitglied der ganzen Unterfamilie. »Wahrscheinlich«, sagt Schweinfurth sehr richtig, »verdankt das stattliche Thier der kühnen Phantasie irgend eines belesenen Ansiedlers seinen Namen Eland, dessen hochnordisches Urbild den holländischen Boers doch wohl nur als ein Thier der Mythe und der Heldensage vorschweben konnte. So wenig nun auch Färbung und Hörner dieser Antilope etwas mit dem Elen gemein haben, so zeigt es mir in seiner Natur immerhin einige Anklänge an das stolze Wild unserer nordischen Heimat; der kropfartige, zottige Haarbesatz vorn unter dem Halse, die buschigen Borstenhaare auf der Stirn, vor allem der gewaltige Schwanz und gemähnte Widerrist rechtfertigen einigermaßen diesen Vergleich. Weit auffallender dagegen ist die Aehnlichkeit dieser Thiere mit den Zeburassen der afrikanischen Rinder, welche an und für sich das Antilopengepräge in hohem Grade verrathen. Das kurze Gestell, der aufgetriebene, runde Leib, die lang herabhängende Wamme, der buckelartige Widerrist, das isabellfarbige Fell schließlich sind noch weit bessere Merkmale als die vorher genannten, welche für einen solchen Vergleich sprechen.«
Die Elen- oder Elandantilope, beziehentlich Kanna, Poffo und Impufo der Kaffern, Tgann der Hottentotten ( Buselaphus Oreas, Antilope, Damalis und Buselaphus Oreas, Alce capensis, Antilope, Oreas und Buselaphus Canna), erreicht eine Länge von fast 4 Meter, wovon 70 Centim. auf den Schwanz kommen, bei 2 Meter Höhe am Widerrist und fünfhundert, nach Harris sogar bis tausend Kilogramm an Gewicht, kommt also einem mittelgroßen Ochsen an Größe und Schwere vollkommen gleich. Die Färbung ändert sich nach dem Alter. Erwachsene Böcke sind auf der Oberseite hellbraun oder gelblichgrau, rostroth überlaufen, an den Seiten weißgelblich. unten und auf den Außenseiten der Unterschenkel gelblichweiß, am Kopf hellgelblichbraun, während die Nackenmähne und ein Haarbüschel am Unterhalse gelblichbraun oder dunkelbraunroth aussehen. Der Rückenstreifen hat etwa dieselbe Färbung. Ein Fleck über dem Beuggelenke der Vorderbeine ist braun und ein Ring, welcher sich um die Fesseln zieht, rothbraun. Die Kuh ist weit kleiner und leichter gebaut, ihr Gehörn länger und schlanker, in der Regel auch weiter auseinander gestellt und verschieden gebogen, die Wamme klein oder fehlend, die Färbung stets dunkler als die des Bockes. Ein im Frankfurter Thiergarten geborenes Junge war 65 Centim. hoch, hatte einen äußerst feinen und schlanken Kopf mit etwa 3 Centim. hohen Hörnchen, hohe, im Gelenk ungemein stark entwickelte Läufe und im allgemeinen die schöne gelblichgraue Färbung der Mutter, zeigte jedoch auf der einen Seite zehn, auf der anderen acht weiße Querlinien von höchstens 1 Centim. Breite, welche vom Rücken aus quer über die Seiten her unter dem Bauche verliefen.

Elenantilope ( Buselaphus Oreas). 1/24 natürl. Größe.
Gray und später Heuglin haben andere Arten von Rindsantilopen beschrieben, wahrscheinlich aber nur Spielarten der Elenantilope vor sich gehabt. In ihrer äußeren Erscheinung ist die Elenantilope, wie Schweinfurth sehr richtig bemerkt, ebenso veränderlich wie das Hartebeest und andere weit verbreitete Antilopenarten, besonders was das Gehörn anlangt, da dieses hinsichtlich seiner Gestalt und Biegung wie beziehentlich seiner Windungen vielfach abweicht. »So viel ich ihrer gesehen«, sagt genannter Forscher, »waren die Elenantilopen stets durch eine hell-ledergelbe, an den Seiten isabellfarbene, äußerst kurze und glatte Behaarung ausgezeichnet, die aufrechtstehenden Mähnenhaare aber schwarz. In den von mir bereisten Gegenden scheint das Fell stets deutlich gestreift zu sein, und dies ist sicherlich kein Merkmal der Jugend, wie einige Reisende vermuthet, da ich sehr alte Böcke gesehen habe, welche beiderseits je fünfzehn schmale, gleichlaufende Querstreifen von reiner weißer Färbung aufzuweisen hatten. Diese Streifen sind nur so breit wie ein Finger, nehmen von der Schwanzlängslinie des Rückens ihren Ursprung und verlaufen bis mitten auf den Bauch herab, welcher oft durch einen großen schwarzen Fleck gezeichnet ist.«
Das Verbreitungsgebiet der Elenantilope erstreckt sich über einen viel größeren Theil von Afrika, als man früher angenommen hatte. Bis zu Heuglins und Schweinfurths Forschungen nahm man an, daß das Thier nur im Süden des Erdtheils vorkomme; gegenwärtig wissen wir, daß es von hier aus in allen geeigneten Gegenden der Südhälfte und noch bis weit diesseit des Gleichers auftritt. Im vorigen Jahrhunderte lebte es noch innerhalb der Ansiedelungen des Vorgebirges der guten Hoffnung; anfangs dieses Jahrhunderts, als Lichtenstein genannte Gegenden besuchte, hielt es sich noch in ziemlich großen Herden von zwanzig bis dreißig Stück an den Grenzen der Ansiedelungen auf; gegenwärtig ist es weiter nach dem Innern zurückgedrängt und jenseit des Wendekreises des Steinbocks bereits so selten geworden, daß Fritsch glaubt, der letzte Europäer gewesen zu sein, welcher einen Trupp von fünfzig Stück südlich dieses Wendekreises gesehen hat. Häufig dagegen tritt es auch jetzt noch überall in den südlich und nördlich des Gebirges gelegenen Theilen von Mittelafrika auf. Im Bongolande, am oberen Weißen Nil, ist es, nach Schweinfurth, gemein, obschon es hier nur selten in so starke Herden sich zusammenschlagen dürfte, wie dies, laut Harris, im südlichen Afrika geschieht. Seine bevorzugten Weideplätze sind die mit Mimosen spärlich bestandenen grasigen Ebenen, von denen aus es zur Zeit der Dürre nach den wasserreichen Niederungen herabkommt. Auffallenderweise findet es sich aber auch in gebirgigen Gegenden und hier auf den rauhesten Stellen, auf schwer zugänglichen Gipfelflächen z. B., wo es, in hohem Grade begünstigt durch die Oertlichkeit, vor den Nachstellungen des Jägers meist gesichert ist. Lieblingsplätze von ihm sollen niedere, sandige, einzeln mit Mimosen bestandene Hügel sein, wie sie, gleich Inseln im Meere, im südlichen Afrika so oft aus den steinigen und kiesigen, pflanzenlosen Ebenen hervortreten. Am häufigsten bemerkt man es in Trupps von acht bis zehn Stück, von denen eins, höchstens zwei männlichen Geschlechtes sind. Zu gewissen Zeiten des Jahres aber rudeln sich solche Trupps zuweilen zu Herden von bedeutender Anzahl: Harris spricht von einer solchen, welche gegen dreihundert Stücke zählen mochte. Eine derartige Herde ähnelt, von fern gesehen, der des Hausrindes in so hohem Grade, daß man sie mit solcher verwechseln kann. Einige der Thiere gehen, langsam grasend, auf und nieder, andere sonnen sich, andere ruhen wiederkäuend im dürftigen Schatten der Mimosen; kurz der Trupp gleicht friedlich weidenden Kühen auf das täuschendste. Beim Verändern des Weidegebietes trollt die Elenantilope unter Leitung eines alten Bullen in geschlossenen Massen ihres Weges fort, einem Reiterregiment vergleichbar, welches unter sicherer Führung langsam seines Weges zieht. Verfolgt fallen die Thiere in einen zwar nicht raschen, aber doch ungemein fördernden Trab, hart bedrängt in sausenden Galopp, bei welchem, wie Schweinfurth sagt, die runden, dünnen Leiber auf den schwachen und kurzen Beinen förmlich vorüberzufliegen scheinen. Junge Bullen und Kühe laufen weit schneller und ausdauernder als die alten und schlagen häufig das beste Pferd, wogegen die alten Böcke in der Regel nur kurze Zeit ausdauern und jedem gut berittenen und geübten Reiter sicher zur Beute werden. Gleichwohl ersteigen sie Hügel und Berge mit Leichtigkeit, wissen auch über unzugängliche Gipfel zu kommen. Wenn sie auf der Flucht die Wahl haben, laufen sie regelmäßig gegen den Wind, so daß man annehmen muß, sie wären sich dieses Vortheils dem Reiter gegenüber wohl bewußt.
Die Aesung der Elenantilope besteht, nach Lichtenstein, in denselben Kräutern, welche in den bewohnteren Gegenden das treffliche Futter für die Schafe und Rinder abgeben, und deren würzige Eigenschaften allem Vieh so besonders wohlthätig zu sein scheinen. »Beim Ausweiden des Thieres erfüllt der Geruch der in dem Magen und den Eingeweiden enthaltenen Kräuter die Luft rings umher, obgleich eben diese Kräuter, wenn man sie trocken abpflückt, wenig duften, und man erst durch den Geschmack von ihrer Kraft überzeugt wird.« Wie manche Rinder- und viele Antilopenarten verbreiten die alten Bullen einen so starken Moschusgeruch, daß man an diesem nicht allein das Thier auf weithin wahrnehmen, sondern auch die Plätze, auf denen es der Ruhe pflegte, noch geraume Zeit, nachdem es sie verlassen, deutlich zu erkennen vermag.
Mit Ausnahme der dürren Monate, welche Mangel und damit eine gewisse Entmuthigung über die Herden der Elenantilopen bringen, liegen die alten Böcke oft mit einander im Streite, und ihre Kämpfe werden zuweilen so heftig, daß sie sich gegenseitig tiefe Wunden zufügen oder ihre Hörner abstoßen. Einzelne bösartige Bullen vertreiben in der Regel alle übrigen Männchen von der Herde und zwingen sie, sich ihrerseits zusammen zu rudeln, während sie einzig und allein die Kühe unter ihre Obhut nehmen. Eine bestimmte Brunstzeit scheint nicht stattzufinden; Harris versichert wenigstens, daß man zu allen Jahreszeiten trächtige Kühe und neugeborene Kälber finde. Die Dauer der Trächtigkeit beträgt, wie man an Gefangenen beobachtet hat, 282 Tage.
Jung eingefangene Elenantilopen lassen sich ebenso leicht, vielleicht leichter noch zähmen als gutmüthige Wildrinder, begeben sich ohne Bedenken unter die Pflegerschaft einer kalbfreundlichen Kuh, mischen sich später unter die Herden des Weidehornviehes und erweisen sich selbst noch in höherem Alter als verhältnismäßig sanftmüthig und lenksam.
In der Neuzeit sind sie in den Thiergärten Europas eine gewöhnliche Erscheinung geworden. Alle hier vertretenen Stücke stammen, wie Weinland berichtet, von zwei Paaren ab, welche in den Jahren 1840 und 1851 der Earl von Derby in England eingeführt hat. Ein Nachkomme des ersten Paares, welcher im Jahre 1846 geboren wurde, lebt heute noch. Von London aus kamen die Thiere zunächst in die Gärten und Parks Großbritanniens, und von dort aus wieder nach den Thiergärten des übrigen Europa. Sie zeigen die Gutmüthigkeit und Dummheit des Rindes und pflanzen sich ohne Schwierigkeiten fort. Man hat sie deshalb als sehr geeignet zur Einbürgerung in Europa erkannt und bereits mehrfach günstige Versuche angestellt. Die Engländer nahmen sich der Sache mit besonderem Ernste an. In dem Regentspark sind schon alle zu erwartenden Jungen im voraus von reichen Gutsbesitzern bestellt, und einzelne geben sich der kühnen Hoffnung hin, nach geraumer Zeit diese Antilope auf allen größeren Gütern unter den Rindern weiden zu sehen.
Vor einigen Jahren wurde ein junger Bulle geschlachtet und sein Fleisch sowohl auf der königlichen Tafel zu Windsor, wie an einer Tafel in den Tuilerien zu Paris und auch an einer Tafel von Lords und Gemeinen gekostet und daran die richtige Mischung von Feistlagen zwischen den Muskelfasern als besonders vorzüglich gerühmt. Die Engländer, welche man hierin als gute Richter anerkennen muß, behaupten, daß es gar kein besseres Fleisch gäbe. Sie bestätigen hierdurch die Berichte früherer Reisenden in Südafrika, welche einstimmig sind im Lobe des Wildprets der Elenantilope. Kein Wunder daher, daß man das großen Gewinn bringende Thier überall, wo es vorkommt, eifrig jagt. Am Vorgebirge der Guten Hoffnung soll man es früher in Fallgruben und Schnellgalgen, welche in der Umzäunung der Felder und Gärten angebracht wurden, gefangen haben; gegenwärtig jagt man es so gut wie ausschließlich zu Pferde, hetzt es, bis es ermattet, und schießt ihm dann eine Kugel durch den Leib. Fritsch schildert eine derartige Jagd mit gewohnter Meisterschaft. Man erblickte einen Trupp dieses Wildes, ohne es zu erkennen, stritt sich jedoch nicht lange darüber, ob es Springböcke, Elands oder Quaggas wären, sondern sprengte in scharfem Galopp näher und näher.
»Nie werde ich«, so schildert unser, als Jäger wie als Forscher gleich tüchtiger Reisender, »die nächsten Augenblicke vergessen, wenn sie sich auch in sinnverwirrender Schnelligkeit folgten: sie gehören zu den denkwürdigsten meines Lebens; nie werde ich mir aber ganz klar darüber werden, wie wir uns plötzlich sozusagen zwischen den Thieren befanden, über deren Natur wir eben noch der großen Entfernung wegen gestritten hatten.
»Eine fieberhafte Aufregung schien nicht nur die Reiter, sondern auch die Pferde erfaßt zu haben, welche uns in rasendem Laufe durch das gerade offene Terrain dahintrugen. Durch den dröhnenden Hufschlag der Pferde und das wilde Stampfen der aufgescheuchten Thiere tönte M'Cabe's Stimme zu mir herüber, der entzückt ausrief: » By Jove, they are Elands!« (Beim Jupiter, es sind Elands!). Im nächsten Augenblicke rollte er im schweren Sturze mit seinem Pferde zusammen; aber, wer dreht sich mitten im Gefecht nach einem fallenden Gefährten um, wer hält, das flüchtige Wild im Auge, um einem Gestürzten aufzuhelfen?
»Beim Jupiter, es waren Elands! Wenigstens fünfzig an der Zahl zogen die mächtigen Thiere in stolzem Trabe vor uns dahin, zeitweise die Köpfe nach uns zurückwendend, und bald theilten sie sich, von den Verfolgern gedrängt, in mehrere Abtheilungen, in denen sich jeder sein Opfer zu wählen hatte. Auf die alten, feisten Bullen war es zunächst abgesehen, da diese würdigen Herren wegen ihres gerundeten Bäuchleins nicht mehr so gut laufen können und zugleich die reichste Beute abgeben; in der Abtheilung vor mir befand sich indessen kein solcher, wohl aber ein prächtiger, junger Bulle, dem ich meine besondere Aufmerksamkeit zuwandte.
»Dahin ging die wilde Jagd durch das Gestrüpp, die Dornen zerissen im Vorbeistreifen die Kleider, man achtete es nicht; Zweige schlugen gegen den Kopf des Reiters, wenn er sich nicht tief genug bückte, er fühlte es nicht; man sah nur das Wild vor sich, hörte nur ein eigenthümliches Sausen in den Ohren, hervorgerufen mehr durch das Toben des Blutes in den Adern, denn durch das Vorbeistreifen der Luft.
»Näher und näher drängte mein Pferd gegen die Thiere heran, bis sie endlich den Trab, ihre natürlichste Gangart, in welcher sie unermüdlich sind, aufgaben und in den verhängnisvollen Galopp fielen, den sie nur kurze Zeit auszuhalten vermögen. Der Bulle trennte sich jetzt von den flüchtigen Kühen und Kälbern, deren schlankere Figuren schnell zwischen den Bäumen verschwanden, während mein Opfer die schweren Glieder nur noch mühsam im Galopp bewegen konnte.
»Zu wiederholten Malen versuchte das Eland in den bequemeren Trab zurückzufallen; aber mein Pferd hielt sich prächtig bei dieser Jagd, so daß ich durch gelindes Antreiben stets das Wild aufs neue zum Galoppe brachte, bis es endlich vollständig erschöpft im Schritte vor dem dicht aufjagenden Pferde einherzog. Eine Kugel, die ich ihm von hinten in das Kreuz schoß, fing sich in den Knochen, eine zweite, welche das Eland im Vorbeisprengen in die Schulter erhielt, erfüllte ebenfalls ihren Zweck nicht, so daß ich absprang, um den einen Lauf wieder zu laden. Bevor die Antilope, welche sich nur noch mühsam bewegen konnte, zwischen den Büschen verschwand, war ich wieder im Sattel; wenige Galoppsprünge brachten mich aufs neue an ihre Seite, und ich versuchte nun, dieselbe in der Richtung des Wagens zurückzutreiben. Dreimal brachte ich das Thier zum Umdrehen; doch stets drang es nach wenigen Schritten mit den gewaltigen Hörnern gegen mich an, so daß ich ihm Raum geben mußte, und die Unausführbarkeit meines Vorhabens einsehend, streckte ich es endlich durch einen Schuß hinter das Blatt nieder.
»Vor und hinter mir drangen jetzt aus der Ferne auch die Schüsse der Jagdgefährten zu mir herüber, und der alte Führer, welcher meine Spur aufgenommen hatte, kam fröhlich über die glückliche Jagd auf seinem mageren Gaule angesprengt. Wie eine Henne ihre Küchlein herbeilockt, so rief seine gellende Stimme die Jäger zusammen, welche sich auch in kurzer Zeit ziemlich vollständig zusammenfanden. Zu meiner Freude erschien auch M' Cabe wohl und munter auf seinem Rößlein, und sein zufriedenes Gesicht verrieth deutlich, daß er die Elands nicht ganz ungerupft hatte entrinnen lassen. Das scharfe Auge der Afrikaner hatte schnell in dem Trupp zwei besonders alte Bullen erkannt, deren schwerfällige Gangart ihnen eine leichte Jagd versprach, und obgleich aufgehalten durch seinen Sturz, hatte M' Cabe doch seine Leute nicht aus dem Auge verloren; schnell war er wieder im Sattel und warf nach kurzer Jagd das Eland durch eine Kugel nieder. Der zweite Bulle wurde durch den Achterrijder verfolgt, welcher das Thier, trotzdem es das älteste aus dem ganzen Trupp war, erst nach langer Jagd einholte und mit vier Kugeln endlich auf den Grund brachte. So waren uns binnen einer halben Stunde die drei schwersten Stücke des Trupps als Beute verfallen, und wir brauchten uns nicht zu schämen, nach dem Dorfe zurückzukehren.
»Es galt nun noch das Bergen der Beute, zu welchem Zwecke wir, nachdem Wachen beim Walde zurückgelassen waren, alsbald zu den Wagen eilten, um dieselben zum Abholen des Fleisches zu beordern. Die vorgerückte Zeit nöthigte uns, diese Arbeit bis zum nächsten Tage zu verschieben, der sich ebenfalls bereits zum Ende neigte, als der Wagen mit den zerlegten Elands zurückkehrte. Am Lagerplatze waren unterdessen Trockengestelle errichtet worden, und sobald die Beute ankam, stürzte sich alles darüber her, um das Fleisch zuzubereiten.
»Auf ebenso unbegreifliche Weise, wie sich die Aasvögel Kunde von dem Vorhandensein der Beute verschaffen, wird es den Buschleuten bekannt, daß irgendwo etwas für sie zu erhaschen ist: nach wenigen Stunden war eine ganze Anzahl derselben vorhanden, und unserer Einladung folgend, betheiligten sie sich eifrig an dem Zerlegen des Fleisches, indem sie anstatt der Messer sich der langen Klingen ihrer Assegaien beim Schneiden bedienten. Allmählich rundeten sich die Bäuchlein der ausgehungerten Wilden mehr und mehr; jede Pause in der Arbeit wurde schleunigst dazu benutzt, Fleischstücke in die Asche zu legen, bevor sie noch ordentlich warm waren, dieselben herauszuzerren und zu verzehren.
»Die Thaten, welche ich hier von menschlichen Kinnbacken verrichten sah, waren geradezu erstaunlich; einer der Buschleute röstete sich z. B. die Achillessehne eines Elands und verzehrte dieselbe mit dem größten Appetite, ohne daß seine Kauwerkzeuge in der Zähigkeit der Speise die geringste Schwierigkeit zu finden schienen. Durch die Unterstützung so eifriger Gehülfen hatten wir bald die Beute klein gemacht, und die Gestelle waren dicht behangen mit den Streifen des Wildprets, welche vor dem Aufhängen mit Salz besprenkelt wurden.«
Wie Lichtenstein bemerkt, behaupten die Bauern am Vorgebirge, daß man die Elenantilope leichter als irgend eine andere durch anhaltendes Verfolgen zu Tode jagen könnte, und führen als besondere Merkwürdigkeit an, daß man in solchen niedergehetzten Thieren das Fett des Herzbeutels, in vollkommen flüssigem Zustande antrifft, ja daß wahrscheinlich in dem Schmelzen des Fettes die Ursache des Todes eines gehetzten Elands zu finden sein müsse.
Der Nutzen, welche eine erfolgreiche Jagd der Elenantilopen bringt, ist sehr bedeutend. Ein schweres Eland wiegt über fünfhundert, das unter dem Herzen abgelagerte Fett allein zuweilen fünfundzwanzig Kilogramm. Jenes wird, wie wir gesehen haben, auf dem Jagdfelde selbst zerschnitten und entweder gedörrt oder eingesalzen, in Felle gepackt und auf dem mitgenommenen Wagen nach Hause gebracht, wo es geräuchert einen Vorrath von einem sehr gesunden und wohlfeilen Nahrungsmittel abgibt; letzteres wird, mit etwas Rindertalg und ein wenig Alaun vermischt, zu guten Kerzen verwendet, die ungemein dicke, zähe Haut endlich zu vortrefflichen Riemen verarbeitet, von denen man das Stück mit anderthalb Mark unseres Geldes bezahlt. Das Elandwildpret hat, nach Lichtenstein, am meisten Aehnlichkeit mit dem unseres Rindfleisches, jedoch einen Nebengeschmack, welcher vorzüglich auffallend und unangenehm wird, wenn man genöthigt ist, mehrere Tage hinter einander von frischem Elandfleische sich zu nähren; geräuchert aber verliert es diesen Geschmack ganz und gar, und besonders die sogenannten »Biltongen« oder Keulenzungen, welche man roh genießt, bilden eine wahre Leckerei. Dieselben bestehen aus geräucherten Muskeln der Keule, welche man nach ihrer ganzen Länge ausschneidet, sodann schwach räuchert und zu dünnen Scheiben schneidet, mit denen man Butterbrod belegt.
Abgesehen von dem Menschen hat die Elenantilope zwar von mancherlei Feinden zu leiden, aber doch nur wenige derselben zu fürchten. Schmarotzer verschiedener Art quälen sie ebenso wie das am Vorgebirge lebende Rindvieh, von Raubthieren dürfte ihr aber wohl nur der Löwe gefährlich werden.
In der Neuzeit ist eine indische Antilope, welche die Reisenden unter dem Namen » blauer Ochse« oft erwähnen, der Nilgau ( Portax pictus, Antilope picta, albipes, leucopus und tragocamelus), häufig zu uns gekommen, während dasselbe Thier in früheren Jahrhunderten selbst in Indien nicht gerade oft in Gefangenschaft gesehen wurde. Der Nilgau, in Gestalt und Färbung eine der ausgezeichnetsten Arten der ganzen Unterfamilie, erscheint gewissermaßen als ein Mittelding zwischen Hirsch und Rind. Kopf, Hals und Beine sind kurz gebaut, die übrigen Leibestheile erinnern an die der Stiere. Der Leib ist schwach gestreckt, ziemlich dick, am Widerriste höher, an der Brust stärker und breiter als am Hintertheile, auf den Schultern mit einem schwachen Höcker bedeckt, der Hals mäßig lang, der Kopf schmal, schlank, schwach gewölbt an der Stirne, breit an der Schnauze, mit lang geschlitzten Nasenlöchern, behaarter Oberlippe, mittelgroßen, lebhaften Augen, kleinen, aber tiefen Thränengruben, großen, langen Ohren und aufrecht stehenden, kegelförmigen, sanft halbmondförmig gebogenen, an der Wurzel dicken, nach vorn schwach gekielten, etwa 18 Centim. langen Hörnern, welche beiden Geschlechtern zukommen, beim Weibchen aber viel kürzer als beim Männchen sind oder ihm auch gänzlich fehlen. Die Läufe sind hoch und verhältnismäßig stark; die Füße haben große, breite Hufe und abgeplattete und abgestumpfte Afterklauen. Der Wedel reicht bis zum Fesselgelenke herab und ist zu beiden Seiten und an seiner Spitze mit langen, oben aber mit kurzen Haaren bekleidet, so daß er einer gleichfahnigen Feder ähnelt. Das Weibchen hat zwei Paar Zitzen. Eine kurze, glatt anliegende, etwas steife Behaarung bedeckt den Körper, verlängert sich aber im Nacken zu einer aufrecht stehenden Mähne und am Vorderhalse, unterhalb der Kehle, zu einem Büschel, welcher lang und tief herabhängt. Ein dunkelbraunes Aschgrau mit einem schwachen Anfluge ins Bläuliche ist die allgemeine Färbung; das einzelne Haar ist in seiner unteren Hälfte weiß oder fahl, in der oberen schwarzbraun oder blaugrau. Der Vordertheil des Bauches, die Vorderbeine, die Außenseite der Hinterschenkel sind schwärzlichgrau, die Hinterbeine schwarz, der mittlere und hintere Theil des Bauches und die Innenseite der Schenkel aber weiß. Zwei Querbinden von derselben Färbung verlaufen über die Fußwurzel, die Fesseln ringartig umgebend; ein großer, halbmondförmiger Flecken steht an der Kehle. Der Scheitel, die Stirn, die Nackenmähne und der Halsbüschel sind schwärzlich. Alte Weibchen haben eine mehr fahle, oft hirschartig graubraune Färbung. Erwachsene Böcke werden an der Schulter 1,4 Meter hoch und 2 Meter lang.
Ostindien und Kaschmir, am häufigsten der Landstrich zwischen Delhi und Lahore, sind die Heimat unseres Thieres. In den Küstenländern ist es selten, im Innern häufig. Ueber seine Lebensweise ist wenig bekannt. Man weiß, daß es gewöhnlich in Paaren, am liebsten an den Rändern der Dschungeln lebt, in deren Mitte es, aus Furcht vor dem Tiger, nicht einzudringen wagt. Ueberzählige Böcke müssen einsiedeln, bestehen aber mit ihres Gleichen heftige Kämpfe um die Thiere. Der Nilgau ist viel entschlossener und bösartiger als alle seine Verwandten. Verfolgt, soll er sich wüthend gegen den Jäger kehren, auf die Beugen niederfallen, unter tiefem Brüllen einige Schritte vorwärts rutschen, sodann blitzschnell gegen den Feind anspringen und versuchen, ihm durch schnelles Emporschleudern des Hauptes und der Hörner gefährliche Verletzungen beizubringen. Ganz in derselben Weise kämpfen die Böcke in Sachen der Liebe mit einander, und mancher edle Kämpe unterliegt einem gut gezielten Hornstoße. Die weiblichen Thiere, welche sich ihnen nicht sofort fügen wollen, mißhandeln sie, so lange sie brünstig sind, in abscheulicher Weise. Auch nach langer Gefangenschaft verliert der Nilgau seine Böswilligkeit nicht, und seine Tücke wird von allen Wärtern gefürchtet. Er zeigt sich zwar bald zahm und sanft, doch ist ihm, zumal während der Brunstzeit, nie zu trauen. In England stürzte einmal ein Nilgau, als ein Mensch seiner Umzäunung sich näherte, mit solcher Gewalt gegen die Balken seines Geheges, daß er sich ein Horn abbrach und dadurch seinen Tod herbeiführte; ein von mir gepflegter Bock verletzte einen Angestellten in lebensgefährlicher Weise.
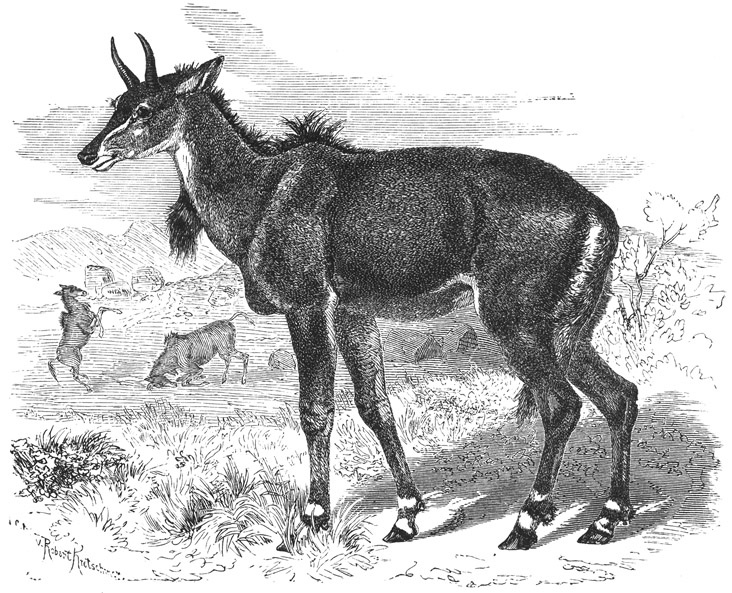
Nilgau ( Portax pictus). 1/20 natürl. Größe.
Die Bewegungen des Nilgau haben viel eigentümliches wegen der sonderbaren Stellungen, welche das Thier annimmt. Gewöhnlich ist der Schritt allerdings ganz so wie bei anderen Antilopen auch, sobald der Nilgau aber erregt wird, krümmt er den Rücken, zieht den Hals ein und schleicht dann langsam dahin, finstere Blicke um sich werfend und schielend. Der Wedel wird dabei zwischen den Schenkeln eingekniffen. In voller Flucht dagegen trägt sich der Nilgau stolz, würdevoll und gewährt namentlich dann, wenn er den Wedel senkrecht emporhebt, einen wundervollen Anblick.
Nach den Angaben der indischen Reisenden liegt der Nilgau während des Tages im Walde verborgen. Nach Sonnenuntergang und in den ersten Morgenstunden geht er auf Aesung, und in den bebauten Gegenden wird er der Verwüstung wegen, die er anrichtet, bitter gehaßt. Er soll alles, was er genießt, vorher beschnoppern, die Pflanzen sorgfältig sich auswählen und gerade deshalb sehr lästig werden.
Das Thier geht acht Monate hochbeschlagen und setzt das erstemal ein Kalb, dann aber jedesmal deren zwei. In Indien soll der December die Satzzeit sein, und die Brunstzeit mit Ende März beginnen. In den Thiergärten Europas wurden die Kälber in den Sommermonaten geboren; das erste Junge eines von mir gepflegten Paares kam am 8. August zur Welt. In ihrer Färbung ähneln sowohl Hirsch- wie Thierkälber der Mutter; denn erst gegen das Ende des zweiten Lebensjahres färbt sich der Bock. Das Kälbchen erlangt einige Tage nach seiner Geburt die Behendigkeit, welche Junge seiner Art sonst kennzeichnet, verläßt den Platz, auf welchem es gesetzt wurde, nur selten, verbringt vielmehr die meiste Zeit auf seinem Lager; die Mutter behandelt es mit größter Liebe, beleckt es, während es säugt, auf das zärtlichste, pflegt dabei auch den Wedel so einzuziehen, daß er in gewissem Grade zum Schutze des Jungen wird. Gefangen gehaltene Nilgauweibchen folgen dem Pfleger, sobald er sich ihrem Kälbchen naht, mit besorgten Blicken, nähern sich auch wohl in der Absicht, in der rechten Zeit zur Abwehr überzugehen, geben aber sonst in der Regel kein Zeichen ihrer Erregung, wie solches bei den Hirschen gewöhnlich der Fall ist. Die Jungen wachsen rasch heran, gefallen sich anfänglich in Spielen nach Kinderart, nehmen aber bald den Ernst und das ruhige Wesen ihrer Eltern an.
Die Jagd des Nilgau wird von den Indiern mit Leidenschaft betrieben, und die Herrscher des Landes bieten, wie es dort gewöhnlich ist, wahre Heere auf, welche ganze Länderstrecken durchstreifen müssen, damit die hohen Herren mit möglichster Bequemlichkeit Heldenthaten verrichten können, welche dann Hofdichter und Schranzen besingen und rühmen dürfen. Schon seit alten Zeiten machen sich die Untergebenen indischer Fürsten ein Vergnügen daraus, ihren Herren und Gebietern gerade diese Antilope gefangen zuzuführen; man sieht sie daher bei den Großen des Reichs hier und da in Parks. Erst im Jahre 1767 kam das erste Paar nach England, zu Ende des Jahrhunderts gelangten andere nach Frankreich, Holland und Deutschland. Jetzt sieht man den Nilgau in allen Thiergärten, woselbst er sich regelmäßig fortpflanzt. Die Erziehung der Jungen ist so leicht, daß wir in kurzer Zeit wahrscheinlich keine Nilgaus mehr von Indien einzuführen brauchen, sondern sie aus den Thiergärten erhalten können. Mehr als alle anderen scheint sich diese Antilope zur Einbürgerung in Europa zu eignen. In dem Thiergarten des Königs von Italien brachte man im Jahre 1860 vier, und im Jahre 1862 noch weitere zwölf Nilgaus ein, welche sich so rasch vermehrten, daß sie mit ihren Nachkommen bereits nach drei Jahren eine Herde von vierzehn Böcken und fünfunddreißig Thieren bildeten. Im Jahre 1866 begann man mit dem Versuche, sie im freien Walde auszusetzen. Sie zerstreuten sich in den ihnen angewiesenen Jagdgehegen des Königs, überstanden den Winter, trotz der manchmal bis auf 16º Réaumur fallenden Wärme, und suchten dann höchstens unter freistehenden Heuschuppen Schutz. Mehr als die Blätter der Eiche und Haselnußstaude ästen sich diese freigelassenen Nilgaus von Robinien; mit Vorliebe fraßen sie auch Kohl und Salat. Ihr schmackhaftes Wildpret und ihre vortreffliche Haut stempeln sie zu einem werthvollen Jagdthiere; gleichwohl dürfte ihre Einbürgerung in unseren Waldungen kaum zu empfehlen sein, den Forderungen der Forst- und Landwirte jedenfalls in keiner Weise entsprechen.
Ehe wir von Indien wieder nach dem eigentlichen Vaterlande der Antilopen zurückkehren, gedenken wir noch einer der merkwürdigsten Arten der ganzen Familie, ja aller Wiederkäuer, der Schikara (Tetraceros quadricornis, Antilope quadricornis, striatricornis und Chicara), Vertreterin der Sippe der Vierhornantilopen ( Tetraceros). Unter den gezähmten Wiederkäuern kommen einzelne vor, welche vier, ja sogar acht Hörner tragen; sie begründen aber niemals eine eigene Art, sondern sind als sonderbare Ausnahmen zu betrachten. Kein einziges wild lebendes Thier zeigt eine ähnliche Wucherung der Hörner wie die genannte Antilope. Sie steht deshalb, nach den bisherigen Erfahrungen wenigstens, durchaus vereinzelt für sich da. Ein Reisender will zwar noch eine ihr verwandte Art gefunden haben, allein bei unserer so geringen Kenntnis der einen Art sind wir noch nicht im Stande zu entscheiden, ob die betreffende Abweichung auf Alters- oder auf Geschlechtsverschiedenheit beruht oder nicht.
Die Vierhornantilope oder Schikara ist ein kleines, zierliches Thier. Ihre Länge beträgt 85 Centim., die des Schwanzes 14 Centim., die Höhe am Widerrist 50 Centim. Das vordere Hörnerpaar sitzt oberhalb des vorderen Augenwinkels und ist etwas nach rückwärts geneigt, das hintere Paar steht über dem hinteren Augenwinkel, wendet sich in seiner unteren Hälfte stark nach hinten und krümmt sich in der oberen nach vorn, ist unten geringelt, nach der Spitze aber glatt und gerundet. Große abgerundete Ohren, lang ausgezogene Thränengruben, eine breite, nackte Nasenkuppe, schlanke Läufe und ein langes und straffes Haarkleid, welches auf der oberen Seite braunfahl, unten weiß und bei dem Weibchen lichter als beim Männchen ist, kennzeichnen das Thier noch außerdem.
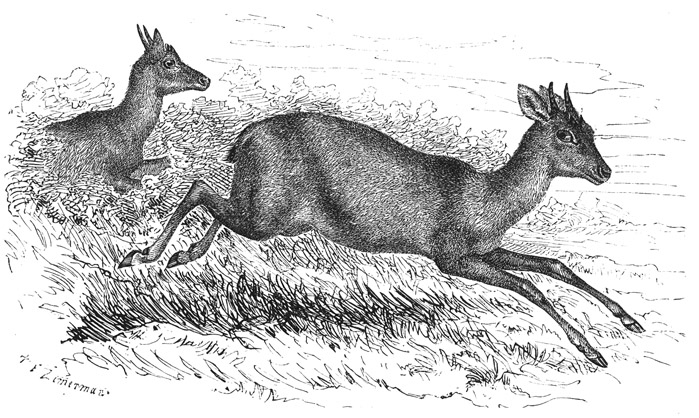
Vierhornantilope oder Schikara ( Tetraceros quadricornis). 1/10 natürl. Größe.
Nach Hartwicke's Berichten ist die Schikara in Indien durchaus nicht selten, in den westlichen Gegenden Bengalens sogar häufig. Sie bewohnt dort die Hügel und die bewaldeten Gegenden. Ihre große Scheu und Behendigkeit machen die Beobachtung der frei lebenden schwierig, und von den wenigen, welche man in der Gefangenschaft hielt, weiß man auch bloß, daß selbst jung eingefangene mit zunehmendem Alter immer bösartiger wurden. Böcke zeigten sich zur Brunstzeit so aufgeregt, daß sie dreist auf jedes andere Hausthier losgingen und mit boshafter Entschlossenheit selbst den bekannten Wächter angriffen, welcher sie täglich fütterte. Die Gefangenen, welche Hartwicke hielt, pflanzten sich fort. Das Weibchen setzte zwei Kälber auf einmal.
Mit dem Namen Schopfantilopen ( Cephalolophus) bezeichnet man kleine Arten mit kurzen, geraden, meist beiden Geschlechtern zukommenden Hörnern, großer Muffel, einer Furche zwischen Auge und Nase und langem, aufrichtbarem Haarschopfe zwischen den Hörnern.
Der Ducker oder Taucherbock ( Cephalolophus mergens, Capra, Antilope und Cephalophorus mergens, Antilope nicticans), eine der größten und bekanntesten Arten der Gruppe, erreicht eine Länge von 1,1 Meter, wovon etwa 20 Centim. auf den Schwanz kommen, bei 55 Centim. Schulterhöhe. Seine geraden, pfriemenförmigen, vier- bis sechsmal flach geringelten Hörner von 9 Centim. Länge, welche von dem Gehör verdeckt oder wenigstens weit überragt werden, verschwinden fast zwischen den Haaren des Schopfes. An der Stelle der Thränengruben liegt vor den Augen ein gebogener, nakter Streifen. Die Läufe sind sehr schlank, die Hufe und Afterklauen klein, der bequastete Schwanz ist kurz. Die vielfach abändernde Färbung ist auf der Oberseite meistens graulich olivenfarbig, beim Männchen auch wohl dunkelgelbbraun, längs des Rückens und der Keulen schwarz punktirt, und geht an den Knöcheln und der Vorderseite der Läufe ins Schwarzbraune, an der Unterseite ins Weiße über.
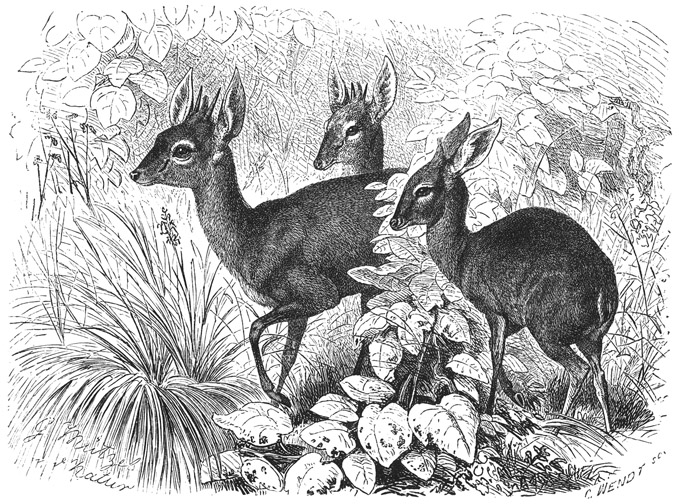
Ducker (Cephalolophus mergens). 1/12 natürl. Größe.
Der Ducker ist in verschiedenen Theilen der Ansiedelungen des Vorgebirges ungemein häufig, auch eine der ersten Antilopen, mit denen der Neuling im Lande zusammentrifft, da jener die Buschdickichte der Seeküste in fast noch größerer Anzahl bewohnt als die Waldungen des inneren Landes. Wie allen kleineren und zwerghaften Antilopen begegnet man ihm entweder einzeln oder in Paaren. Niemals läßt er sich außerhalb der ihn deckenden Gebüsche sehen. Innerhalb des ärgsten Dickichts bewegt er sich mit einer Gewandheit, Vorsicht und Schlauheit, daß der ihm von den Holländern zuertheilte Name vollständig gerechtfertigt erscheint. Aufgescheucht von seinem versteckten Lager, gewinnt er mit einem kräftigen Satze den nächsten Busch und eilt nun zwischen den niederen Zweigen und dem Grase so listig und behend dahin, daß er in vielen Fällen dem ihn verfolgenden Jäger glücklich entgeht. »Bei Annäherung eines Menschen oder eines anderen Feindes«, sagt Drayson, »bleibt er ruhig in seinem Lager; regungslos, starr wie eine Bildsäule schaut er auf den Ankommenden, bis er glaubt, er werde beobachtet: dann springt er plötzlich auf und stürzt dahin, schlägt eine Reihe scharfer Haken, setzt über Büsche und schlüpft durch sie hindurch, duckt sich und kriecht, so wie er sicher ist, seinen Verfolgern aus den Augen gekommen zu sein, in dem langen Grase oder zwischen den Büschen so still dahin, daß man glaubt, er wäre förmlich verschwunden oder habe sich niedergelegt. Aber letzteres ist nie der Fall; denn er geht dann immer weiter unter den Blättern fort, bis er einen guten Vorsprung erlangt hat: dann eilt er auf und davon. Selbst der klügste Jäger und der beste Hund werden durch den Ducker oft genug gefoppt; wenn man aber seinen Weg überwachen und den Ort entdecken kann, wo er sich nach seinen Gängen niedergelegt hat, kommt man leicht unter dem Winde an ihn heran. Doch muß man ihm dann einen guten Schuß geben, wenn man sicher sein will, ihn auch zu erhalten; denn so klein er ist, eine so starke Ladung von Rehposten nimmt er auf sich. Die Büchse ist kaum zu gebrauchen, weil er bei seinem unregelmäßigen Hin- und Herspringen einen überaus geschickten Schützen verlangt. Oft kommt es vor, daß er nach dem Schusse mit größter Schnelligkeit davon geht, als ob ihn kein Schrotkorn berührt habe; dann hält er plötzlich an und gibt unverkennbare Zeichen seiner Verwundung. Selbst tödtlich getroffene Böcke sprangen vor mir auf, als ob ihnen kein Leid geschehen wäre.
»Schon ein gewöhnlicher Hund kann den Ducker im Laufe einholen. Ein alter Vorsteher, welcher mir diente, fing mehr als einmal ganz gesunde Böcke und hielt sie, bis ich herankam.
»Aus dem Felle des Duckers flicht man am Kap die langen Wagenpeitschen; das Wildpret gibt eine vortreffliche Suppe. Gewöhnlich ist das Fleisch der südafrikanischen Thiere sehr mittelmäßig, trocken und geschmacklos; allen Feinschmeckern aber kann ich die Leber der kleinen Antilope als ein ungemein feines Gericht empfehlen. Die holländischen Bauern spicken das Wildpret des Duckers mit Elen- oder Nilpferdspeck und bereiten dann einen höchst schmackhaften Braten.«
In der Gruppe der Zwergantilopen ( Neotragus) vereinigt man die kleinsten Arten der Familie, überaus zierlich gebaute, einander höchst ähnliche Thierchen, bei denen nur die Männchen sehr kleine und dünne, aufrecht stehende, pfriemenartige, unten mit wenigen Ringen oder Halbringen umgebene Hörner tragen; der rundliche Kopf, die spitzige Nase mit kleiner Muffel kennzeichnen sie außerdem. In ihrer Lebensweise und ihrem Wesen ähneln sich alle bekannten Arten, so daß es genügen dürfte, wenn ich vorzugsweise eine von mir selbst beobachtete Zwergantilope ins Auge fasse und mit dieser Schilderung das über andere Arten bekannte verbinde.
Die Windspielantilope, Beni Israel der Bewohner Massauas, Edro der Tigrier ( Neotragus Hemprichii, Antilope Hemprichiana, Nanotragus Hemprichii), ist einer der zierlichsten Wiederkäuer, welche es gibt. Der Bock trägt ein kleines Hörnerpaar mit zehn bis zwölf Halbringen an der unteren Hälfte der Außenseite und mit nach vorn gebogenen Spitzen, welche von dem stark entwickelten Haarschopfe fast verdeckt und durch die sehr langen Ohren gänzlich in den Schatten gestellt werden. Der Leib ist gedrungen, der Schwanz ein kurzbehaarter Stummel; die Läufe sind mittellang, aber außerordentlich schwach, die Hufe lang, schmal und zugespitzt, die Afterklauen kaum bemerklich. Sehr feine und ziemlich lange Haare decken den Leib. Das Kleid erscheint fuchsig und graubläulich, weil die einzelnen, an der Wurzel graubräunlich aussehenden Haare vor der dunklen, aber kaum bemerklichen Spitze licht oder röthlich umrandet sind. Auf dem Rücken geht die Färbung in das Rothbraune, auf dem Nasenrücken und der Stirn in das Fuchsrothe über; die Vorderschenkel sind oft gefleckt, die unteren Theile und die Innenseite der Läufe weiß. Ein breiter Streifen über und unter den Augen ist weiß; die Ohren sind schwärzlich gesäumt, die Hörner, Hufe und Thränengruben schwarz.
In Abessinien wird man vom Meeresstrande an bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe unsere Beni Israel (zu Deutsch: Kinder Israel) an geeigneten Orten selten vermissen. Fast alle Zwergantilopen sind Bewohner der Buschwälder, an denen Afrika so reich ist. Dickichte, welche für andere, größere Antilopen so gut wie undurchdringlich sein würden, gewähren diesen Liliputanern prächtige Wohnsitze. Für sie findet sich auch zwischen den engsten Verschlingungen noch ein Weg und in den ärgsten Dornen noch ein Pförtchen. Der Edro zieht das Thal entschieden der Höhe vor. Am liebsten sind ihm die grünen Waldsäume der Regenstrombetten. Hier gibt es herrliche Versteckplätze. Mimosen, Christusdornen, einige Wolfsmilchgesträuche und andere größere Pflanzen werden von einem wahren Netze von Schlingpflanzen umflochten und durchwebt. Es finden sich köstliche Lauben und nach außen vollkommen abgeschlossene Gebüsche, deren Inneres wohnlich und gänzlich verborgen ist, oder aber schmale Dickichte, welche jedoch auf lange Strecken hin ununterbrochen verbunden sind. Weiter von der belebenden Wasserader weg stellen sich die Büsche einzelner, und ein grünes, saftiges Gras kann dort sich erheben. Hier begegnet man dem Edro mit aller Sicherheit. Er lebt, wie die meisten seiner Verwandten, über welche wir Kunde haben, streng paarweise, niemals in Trupps, es sei denn, daß ein Pärchen einen Sprößling erhalten habe, welcher der Mutterpflege noch bedarf. Dann trollt auch dieser hinter den Eltern her.
Im Anfange wird es dem Jäger schwer, das kleine Thierchen zu entdecken; wenn man aber mit seinen Sitten und Gebräuchen vertrauter geworden ist, lernt man es auffinden, weil man folgerichtig zu Werke geht. Die Färbung des Felles, welche mit der Umgebung übereinstimmt und in dieser förmlich aufgeht, trägt wesentlich dazu bei, unsere Zwerge zu verbergen. »Das allergeübteste Auge«, sagt Drayson sehr richtig, »ist erforderlich, um ein Busch- oder Blauböckchen zu entdecken, weil sein Fell der Dämmerung des Unterholzes so vollständig gleicht, daß man das kleine Ding nicht bemerken würde, wenn nicht die im Laufe berührten Zweige sich bewegten. Gewöhnlich ist das Böckchen, lange bevor der Jäger sich überzeugen konnte, daß er es wirklich gesehen habe, schon auf und davon. Wenn ich so mit den Kaffern ging, deren Falkenaugen das Dickicht durchbohren, ist es mir oft vorgekommen, daß sie mit großer Bestimmtheit sagten: »Dort geht ein Blauböckchen, sieh, dort ist es, dort, dort!« Aber für mich waren solche Fingerzeige vergebens. Ich mochte mich anstrengen und nach dem bezeichneten Fleck hinsehen, wie ich wollte: alles andere sah ich, nur nicht das Böckchen.« Genau so ging es mir im Anfange mit den Windspielantilopen. Doch das Jägerauge findet sich. Wenn man recht sorgfältig das Gebüsch absucht und seine Aufmerksamkeit hauptsächlich auf dunkle, freie Stellen im Gelaube richtet, sieht man die zierlichen Waldeskinder sicherlich. Gerade auf diese Blößen stellen sie sich, wenn sie aufgescheucht werden. Ihre ungemein feinen Sinne und namentlich das mit den großen Ohren in Einklang stehende scharfe Gehör verrathen ihnen die Ankunft des Menschen lange vorher, ehe dieser eine Ahnung von ihrem Vorhandensein hat. Beim geringsten verdächtigen Geräusche springt der Bock auf und lauscht scharf nach der bezüglichen Seite hin; allein diese Untersuchung genügt ihm nicht: er muß auch sehen, und deshalb geht er langsam nach einem jener offenen Plätze, stellt sich dort starr wie eine Bildsäule auf und schaut dem herankommenden Feinde entgegen. Das Thier folgt in kurzer Entfernung seinem Gatten, überläßt aber diesem so lange als möglich die Sorge um die Sicherheit. Aufrecht steht der Bock da, den Kopf hoch erhoben; kein Glied außer dem Gehör bewegt sich. Nur der Haarkamm auf dem Kopfe wird so gesträubt, daß er die zarten und kurzen Hörner vollkommen überdeckt. So lauscht und äugt er scharf nach dem gefahrdrohenden Gegenstande hin. Eine neue Bewegung des Gefürchteten macht ihn erstarren: der Fuß, welcher erhoben ist, bleibt so, das Gehör rührt sich nicht, aber die Lichter richten sich auf den einen Punkt; nicht ein einziges Zeichen verräth das Leben des schlauen Geschöpfes. Sowie es ihm dünkt, daß Gefahr im Verzuge sei, duckt er sich nieder und schleicht, jeden Lauf so leise und gleichmäßig hebend, als ginge er in menschlicher Weise auf den Zehen, unhörbar in das Dickicht zurück, verläßt es auf der entgegengesetzten Seite, eilt in den dünner bestandenen Buschwald hinaus und kehrt, einen großen Bogen um den Feind beschreibend, wieder nach seinem grünen Verstecke zurück. Am liebsten wendet er sich, wenn er einmal Nachstellungen erfahren hat, rückwärts; getrieben aber, geht er in Bogen nach vorwärts, immer wieder den grünen Waldsaum berührend und von neuem in ihm sich verbergend. Das Thier folgt ihm in geringer Entfernung auf Schritt und Tritt getreulich nach. So lange nicht ein Schuß fiel oder ein Hund sich zeigte, trollt auch das aufgescheuchte Pärchen bald wieder gemächlich dahin. Unmittelbar vor dem Flüchtigwerden stößt der Bock einen scharfen Schneuzer aus, welcher sechs-, ja achtmal wiederholt wird, wenn man auf ihn schoß, ohne ihn zu treffen oder sogleich zu tödten. Selten flüchtet das Pärchen weit weg. Bereits nach wenigen Sätzen trollt es wieder; der Bock hält an, sichert, geht weiter, sichert von neuem und unterbricht seinen Lauf schließlich alle zehn bis zwanzig Schritte weit. Wurde aber auf den Edro geschossen, gleichviel ob mit oder ohne Erfolg, so flüchtet er während der ersten vier- bis sechshundert Meter, welche er zurücklegt, überaus eilfertig. Dann erst zeigt sich seine ganze Beweglichkeit. In weiten Bogensätzen jagt er dahin, die Vorderläufe im Sprunge dicht an den Leib gelegt, die hinteren wie den Kopf lang vorgestreckt. Eine so in voller Flucht dahineilende Zwergantilope ist sehr schwer zu erkennen. Die Bewegung erfolgt so rasch, und die gewohnte Gestalt des Thieres hat sich so gänzlich verändert, daß das Auge ein durchaus fremdartiges Geschöpf zu erblicken vermeint. Nicht selten ist man geneigt, den zierlichen Wiederkäuer für einen Hasen zu halten, und erst nach einiger Uebung lernt man ihn auch während seines vollsten Laufes richtig erkennen.
An dem einmal gewählten Standorte scheint jedes Paar der Windspielantilope treulich festzuhalten, so lange es von dort nicht vertrieben oder ihm in der Nähe ein noch besserer Versteckplatz geboten wird. An einigen Regenstrombetten in der Samhara Abessiniens, welche ich während meines kurzen Aufenthaltes viermal berührte, fand ich den Edro immer genau auf denselben Stellen, wo ich ihn früher gesehen oder bezüglich erlegt hatte. Die meinem Gewehre entgangenen Paare waren bis auf ihren Busch hin wieder auf den alten Stand gerückt; der überlebende Theil eines durch mich zersprengten Pärchens hatte den Stand wahrscheinlich verlassen, und dieser war dann durch ein anderes ersetzt worden. An jenen Regenstrombetten kann der Jäger schon von weitem den Busch oder den Theil der Dickung bestimmen, in welchem er Windspielantilopen finden wird: der dickste, verschlungenste Busch, und wenn er nicht mehr Raum bedeckt als fünfundzwanzig Geviertmeter, ist sicherlich ihr eigentliches Haus. Fern ab von solchen besonders begünstigten Stellen trifft man das Thierchen bloß in Gebirgsthälern an, in deren Grunde Dickichte in ähnlicher Weise sich ausbreiten, und wohl nur gezwungen besteigt es die Gehänge und Kämme der Berge. Man begegnet ihm allerdings noch in ziemlich bedeutender Höhe über dem Meere, nie aber auf Bergwänden und Bergrücken.
Alle Zwergantilopen äsen sich vorzugsweise von dem Blätterwerk der Gebüsche, in denen sie hausen. Dem Beni Israel gibt wahrscheinlich die Mimose den größten Theil seiner Nahrung. Außer den zart gefiederten Blättern, denen man es gleich anzumerken meint, daß sie solchen kleinen Leckermäulern wohl genügen müssen, werden aber grüne Triebe und Knospen auch nicht verschmäht, und oft sieht man, wie südafrikanische Jäger versichern, die gewandten Geschöpfe sogar an schiefen Stämmen der Buschwälder emporsteigen, um sich an höheren Aesten zu äsen. Mir hat diese Angabe durchaus nichts auffallendes, weil ich das Baumklettern der Wiederkäuer wiederholt und zwar von den kleinen Ziegen des Innern Afrikas gesehen habe.
Auch der Beni Israel schlägt sich, wie die Gazelle, seichte Kessel aus, in denen er seine Losung absetzt. Diese, in Gestalt, Größe und Färbung Hasenschroten gleich, gibt dem Jäger jederzeit den sichersten Anhaltspunkt zu der nicht unwichtigen Bestimmung, ob das Pärchen, von welchem der Kessel herrührt, noch zu finden sein wird oder bereits getödtet, bezüglich vertrieben wurde. Gewöhnlich findet sich ein solcher Abort der reinlichen Thiere zwischen zwei dichteren Büschen, unweit der Laube, welche den Lieblingsaufenthalt bildet.
Ueber die Fortpflanzung der Zwergantilopen sind bisher nur sehr dürftige Angaben gemacht worden. Auch ich erfuhr wenig. Wann die Windspielantilope auf die Brunst tritt, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, ebensowenig auch, wie lange sie hochbeschlagen geht. Ein abessinischer Jäger erzählte mir, daß zur Zeit der Brunst, welche zu Ende der großen Regenzeit fallen soll, die Böcke ihre Hörnchen, so klein diese auch sind, mit großer Wuth und vielem Nachdrucke zu gebrauchen wissen; doch muß ich hierbei wiederholen, daß die Abessinier nicht eben die zuverlässigsten Erzähler sind, weil sie den Leuten nach dem Munde reden, alle Fragen ohne weiteres bejahen und die Antwort auch noch mit hübschen Geschichten ausschmücken. Unter den hunderten der Beni Israel, welche ich sah, habe ich übrigens nicht einen einzigen überzähligen Bock beobachtet, vielmehr überall und immer nur Pärchen bemerkt. Ehrenberg gibt den Monat Mai als Satzzeit des Beni Israel an; ich habe aber bereits im März und häufiger im April Junge bei den Pärchen gesehen. In der zweiten Hälfte des März waren fast alle von mir erlegte Riken, wie ich zu meinem größten Bedauern fand, hochbeschlagen; im April sah ich die Pärchen mit ihren Sprößlingen und erhielt selbst ein vor wenig Tagen gesetztes Kälbchen.
Es scheint, daß in Habesch nur die jungen, eben gesetzten und noch unbehülflichen Beni Israel gefangen werden; wenigstens konnte ich, ungeachtet meiner Bemühungen, erwachsene Thiere nicht erhalten. Die Kaffern dagegen legen ihren Zwergböckchen Schlingen in den Weg, welche durch einen der Läufe der Antilopen zugezogen werden, oder stellen ihnen, wenn es ihnen nur um das Wildpret zu thun ist, solche, welche ein Schnellgalgen zuschnürt. Man biegt zu diesem Ende einen Baum um, bindet an ihn die Schlinge, stellt sie in einen der leicht erkenntlichen Gänge im dichten Gebüsch und richtet einen Pflock so, daß er von dem laufenden Wilde weggestoßen wird. Der Hals desselben steckt dann bereits in der Schlinge; der Baum richtet sich plötzlich auf, der arme Schelm baumelt und ist nach wenigen Minuten eine Leiche.
Wenn man erst die Sitten des Edro kennen gelernt hat, ist seine Jagd ebenso einfach als ergiebig. Zwei Jäger brauchen sich keine große Mühe zu geben. Der eine folgt dem satzweise dahinflüchtenden Pärchen, der andere bleibt dort stehen, von wo es aufging. Oft genug kommt der verfolgende zum Schuß, sicher der, welcher sich anstellt. Ist die Jagdgesellschaft größer, so bildet sie einen einfachen Halbmond und läßt durch Treiber oder durch Hunde den Buschrand an beiden Ufern des Regenstromes absuchen. Nach einigen Schüssen geht der Beni Israel regelmäßig zurück und muß die Schützenlinie kreuzen. An Orten, wo er noch keine Nachstellungen erfuhr, bleibt er häufig ruhig auf den Blößen in der Dickung stehen, vielleicht, weil er seine Gleichfarbigkeit mit der Umgebung überschätzt. Anfänglich gebrauchte ich bei meinen Jagden die Büchse, später das Schrotgewehr, und dieses ist auch die einzige geeignete Waffe zur Jagd unseres Thierchens. Ganz abgesehen, daß der Zwerg, wenn er selbst nur auf siebzig oder achtzig Schritte draußen steht, mit der Büchse auf das Korn genommen sein will, hat der Jäger selten Freude, wenn er seine Lieblingswaffe benutzte, weil die Kugel fast regelmäßig ein so ungeheures Loch in den kleinen Körper reißt, daß er das erlegte Wild nicht gern mehr ansehen mag. Das Schrotgewehr kommt übrigens auch zu seinem Rechte; denn eine in voller Flucht dahinjagende Zwergantilope ist vor jedem Sonntagsschützen sicher: sie verlangt ein sehr gutes Auge und eine geübte Hand. Zudem wimmeln dieselben Büsche, in denen das Zwergböckchen lebt, von Frankolinen und Perlhühnern, welche man doch auch nicht gern unbehelligt wegfliegen läßt, aber selbstverständlich mit der Büchse nicht erlegen kann.
Wenn man bei der Jagd der Windspielantilope festhält, daß der Bock sich immer höher und stolzer trägt als das Thier, und daß er auf der Flucht regelmäßig vorauseilt, erspart man sich bald den Kummer, ein Thier, zumal ein hochbeschlagenes, zu erlegen; an anderen Kennzeichen vermochte ich die Geschlechter nicht zu unterscheiden, selbst wenn ich auf vierzig bis fünfzig Schritte zum Schuß kam.
Das Wildpret des Beni Israel ist ziemlich hart und zähe, obwohl noch immer eine leidliche Speise. Es eignet sich fast mehr zur Bereitung von Suppe als zum Braten. Auf Draysons Rath habe ich mich hauptsächlich an die Leber der Zwergantilope gehalten und muß jenem Gewährsmanne Recht geben, daß sie ein wahrer Leckerbissen ist.
Ueber alt gefangene Zwergantilopen habe ich selbst keine Beobachtungen sammeln können, und das erwähnte Kälbchen blieb, ungeachtet der sorgfältigsten Pflege, nur wenige Tage am Leben. Meine Frau, deren ganz besonderer Liebling das wirklich reizende Geschöpf war, hielt ihm eine melkende Ziege und überwachte seine Ernährung mit der größten Sorgfalt. Es besäugte auch seine Pflegemutter ohne besondere Umstände und schien in den ersten Tagen seiner Gefangenschaft sich wohl zu befinden. Bereits hatte es sich an seine Pflegerin so gewöhnt, daß es nicht die geringste Furcht mehr vor ihr zu erkennen gab und zu den schönsten Hoffnungen berechtigte. Da bekam es plötzlich eine Geschwulst an der Kehle, und am folgenden Tage war es eingegangen. Von anderen Beobachtern erfahre ich, daß man Zwergantilopen schon mehrmals in der Gefangenschaft gehalten hat. Außerhalb ihres Vaterlandes erliegen sie freilich bald den Einflüssen des fremden Klimas, und es ist deshalb sehr schwer, sie lebend bis nach Europa zu bringen. Allein am Kap und in anderen Theilen Afrikas hat man sie längere Zeit im Zimmer oder im Gehöfte gehalten. Man sagt, daß jung eingefangene bald warme Anhänglichkeit an ihren Pfleger zeigen, seinem Rufe folgen, sich gern berühren, krauen, auf dem Arme umher tragen lassen und überhaupt dem Menschenwillen widerstandslos sich ergeben. Eine überaus große Gutmüthigkeit, Sanftmuth und Liebenswürdigkeit wird gerühmt. Brod, Möhren, Kartoffeln und Grünzeug genügen zur Ernährung der Gefangenen, Früchte und Blüten verschmähen sie auch nicht, Salz belecken sie, wie die meisten anderen Wiederkäuer, mit Vergnügen, Wasser ist ihnen ein Bedürfnis. Sie halten sich so rein, daß man sie ohne Sorge zum Genossen der Wohnstube wählen könnte; nur ihr Harn riecht unangenehm. Wenn sie sich nach ihrem Pfleger sehnen, stoßen sie ein leises Blöken aus; die Furcht geben sie durch Schneuzen zu erkennen. Dies kann man namentlich bei Gewittern bemerken: sie schnaufen bei jedem heftigen Donnerschlage. Oft pressen sie eine klebrige, ölige Schmiere aus den Furchen, welche ihre Thränengruben vertreten. Diese Masse riecht wie Moschus, und die Thiere scheinen entschiedenen Wohlgefallen an diesem Geruche zu bekunden. Im übrigen behalten sie auch in der Gefangenschaft ihre Sitten bei. So legen sie niemals ihre Schreckhaftigkeit ab, fliehen eiligst davon, wenn jemand, zumal ein Fremder, eine rasche Bewegung macht, versuchen sogar sich zu ducken und zu verbergen; allein schon nach kurzer Zeit zeigen sie gegen Bekannte dieselbe Zutraulichkeit wieder wie vorher.
Nach Europa kommen lebende Zwergantilopen außerordentlich selten herüber. Die hauptsächlichste Ursache scheint darin zu liegen, daß es schwer hält, den zarten und hinfälligen Thierchen unterwegs ein passendes Futter zu verschaffen. Erst nachdem ich afrikanische Freunde darauf aufmerksam gemacht hatte, daß alle Zwergantilopen Zweigfresser sind und mit getrockneten Baumblättern anstatt mit Heu gefüttert werden müssen, gelang es mir, von Sansibar aus einen nahen Verwandten der Windspielantilope, das Moschusböckchen ( Neotragus moschatus), zu erhalten. Das ungemein zierliche Geschöpf war auf der Ueberreise sorgfältig gepflegt und sehr zahm geworden, zeigte daher bei der Ankunft von der wilden Scheu anderer frisch gefangenen Antilopen keine Spur, fühlte sich sofort in dem ihm angewiesenen Raume heimisch und nahm es dankbar an, wenn man sich mit ihm beschäftigte und ihm schmeichelte. Jede Bewegung war höchst anmuthig. Beim Gehen hielt sich das Thierchen gewöhnlich sehr gestreckt, Kopf und Hals niedergebogen, die Schritte wurden fast regelmäßig mit Auf- und Niederschnellen des Schwanzes begleitet. Ein sorgfältig ausgewähltes Futter, der Hauptsache nach aus geschnittenen Möhren, Kartoffeln, Kohl und etwas Kleie bestehend, wurde gern genommen, außerdem aber frische Baumzweige mit oder ohne Blätter in genügender Menge gereicht. Nebenbei äste sich mein gefangenes Böckchen von Grasspitzen, welche es eins nach dem anderen abbiß und gemächlich kaute. Der einzige Laut, welchen ich vernahm, war ein Schneuzen und ein leises, lammartiges Blöken.
Nächst dem Menschen ist der schlimmste Feind der Zwergantilopen wohl überall der Leopard. In Habesch zieht er gerade die Dickichte, wo sich Edros aufhalten, allen übrigen Jagdplätzen vor. Wenn auch die Windspielantilopen den ganzen Tag über in Bewegung sind, zeigen sie doch in den Frühstunden und noch mehr gegen Abend eine besondere Regsamkeit. Um diese Zeit begegnet man der gewandten Katze häufig genug auf ihren Schleichwegen, und noch viel öfter mag sie vorhanden sein, ohne daß man eine Ahnung hat. Ein alter italienischer Jäger, der schon genannte Pater Filippini, versicherte mir, daß der Leopard nur dann in die Dörfer komme, wenn ihm seine Antilopenjagd mißglücke, und ich habe keinen Grund, an der Glaubwürdigkeit dieser Angabe zu zweifeln. Im Süden mag der Serwal und im Sudan die Falbkatze dem widerstandsunfähigen Zwerge ebenfalls nachstellen, und höchst wahrscheinlich nimmt auch der Raubadler hier und da wenigstens ein Kälbchen weg. Ob die in Afrika so häufigen Schakale und Füchse sowie die wilden Hundearten ebenfalls zu den Feinden des Beni Israel und seiner Verwandten gezählt werden müssen, wage ich nicht zu behaupten; ich kann bloß sagen, daß ich Schakale und Füchse in den von Beni Israel bewohnten Dickichten häufig gesehen habe.
Unter dem Namen Zierböckchen ( Calotragus ) vereinigt Sundevall mehrere andere kleine, ebenfalls äußerst zierliche und zarte Antilopen mit deutlicher Muffel, quergestellten und gebogenen Thränengruben, kurzem, gequastetem Schwanze und kurzen, geraden oder an der Spitze etwas gebogenen Hörnern, welche nur dem Männchen zukommen.
Einer der bekanntesten Vertreter dieser Gruppe ist der Bleichbock oder Urebi der Ansiedler des Vorgebirges der Guten Hoffnung ( Calotragus scoparius, Antilope scoparea und melanura, Scopohorus scoparius). Das Thier ist kaum schwächer als unser Reh, 1,1 Meter lang, auf den Schultern 60 Centimeter, am Kreuze noch etwas darüber hoch, und durch seine zierlichen und regelmäßigen Formen besonders ausgezeichnet. Die Färbung ist ein lichtes Fuchsroth oder Gelbbraun auf der Oberseite und ein fast schneeiges Weiß auf der Unterseite, d. h. am Unterleibe, der Innen- und Hinterseite der Beine. Auch ein Fleck über den Augen, die Lippen, das Kinn und die Innenseite der Ohren sind weißlich, während die Ränder der letzteren schwarzbraun erscheinen. Das kleine, fast gerade aufsteigende, erst schwach nach hinten, dann etwas nach vorn geneigte, dünne Gehörn, welches, wie bei den Zwergantilopen, nur der Bock trägt, ist am Grunde etwa neunmal deutlich geringelt. An den Vorderläufen hängen ziemlich lange Kniebüschel herab. Der Schwanz ist kurz, aber gequastet.
Das Leben des Bleichbocks schildert Drayson in seinen »Jagdbildern aus Südafrika« wie folgt: »Während die meisten Thiere, und zumal die Antilopen, dem Menschen ausweichen so gut sie können, während die großen Antilopen am Kap sich gern bis hundert Meilen weit von den Wohnsitzen der Pflanzer aufhalten, gibt es einige, welche thun, als wäre ihnen jede Furcht vor dem Erzfeinde der Thiere fremd, einige, welche ihren Wohnsitzen anhängen, so lange sie es im Stande sind, oder so lange sie nicht ihre Zutraulichkeit mit dem Leben bezahlen müssen. Vielleicht sind manche Gegenden diesen Thieren so einladend, daß unmittelbar, nachdem eine gewisse Oertlichkeit frei wurde, andere derselben Art von unbekannten Orten herkommen, um den Platz in Besitz zu nehmen. So ist es mit dem Bleichböckchen oder Urebi. Dieses schmucke, zierliche Geschöpf hält sich in der nächsten Nähe der Ortschaften auf, gerade da, wo es täglich gezwungen wird, vor seinem schlimmsten Feinde zu flüchten.
»Wenn ein Jäger Tag für Tag sein Gebiet durchstreift und dabei alle Bleichböckchen, welche ihm vorkommen, niedergestreckt hat, braucht er wahrhaftig keine fünf Tage zu warten, ehe er wiederum ein Wild erbeuten kann; denn wenn er nach dieser Zeit von neuem zur Jagd hinausgeht, findet er sicherlich wiederum mehrere dieser kleinen Antilopen, welche sich rings um die Dörfer angesiedelt haben. Man trifft sie gewöhnlich paarweise in den Ebenen, und auch wenn sie verfolgt werden, suchen sie selten den Busch oder Wald zu erreichen. Ihr gewöhnlicher Stand ist das lange Gras, welches zurückbleibt, nachdem man die Steppe angezündet hat, oder die zerklüfteten Wände der Hügel, wo sie sich zwischen Felsen und Steinen verbergen.
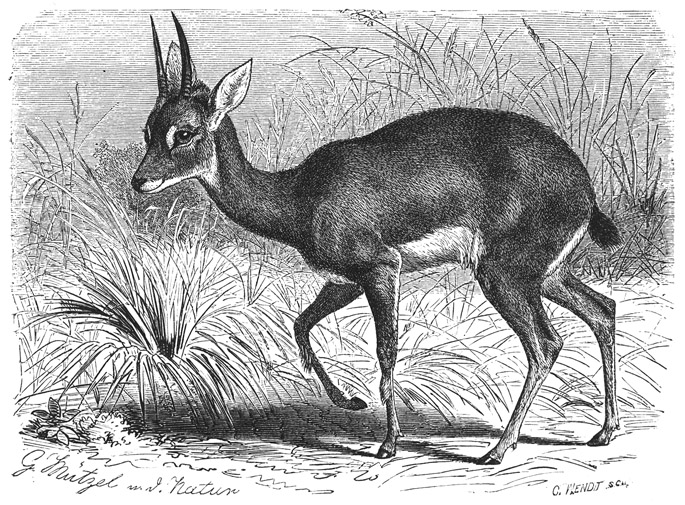
Bleichbock ( Calotragus scoparius). 1/10 natürl. Größe.
»Wirklich reizend ist die Art und Weise ihrer Flucht, wenn sie aufgeschreckt oder gestört werden. Sie fliehen mit der größten Schnelligkeit dahin, springen dann plötzlich meterhoch in die Luft, werden von neuem flüchtig und machen nochmals einen Luftsprung, wahrscheinlich in der Absicht, ihre nächste Umgebung besser zu überschauen; denn sie sind zu klein, als daß sie über das Gras wegäugen könnten. Manchmal, besonders wenn irgend ein verdächtiger Gegenstand bei dem ersten Sprunge entdeckt wurde, schnellt der Bleichbock mehrere Male nach einander auf, und dann will es auch dem unbefangenen Auge erscheinen, als ob er ein mit Schwingen begabtes Geschöpf wäre und die Kraft habe, in der Luft schwebend sich zu erhalten. Wenn z. B. ein Hund auf seiner Fährte ist und ihm eifrig durch das lange Gras folgt, springt er wiederholt nach einander hoch auf, beobachtet während des Schwebens genau die Gegend, aus welcher sein Verfolger herbeikommt, schlägt plötzlich einen Haken und kommt dem bösen Feinde oft genug aus dem Gesicht. Beim Herabspringen fällt das Thier immer zuerst mit den Hinterläufen auf den Boden. Der aufgeschreckte Bleichbock eilt in den ersten Minuten seines Laufes in ähnlicher Weise auf dem Boden dahin, in welcher eine aufstehende Schnepfe durch die Luft fliegt. Im Zickzack wendet er sich von einer Seite zur anderen, durchkriecht oder überspringt er mit Blitzesschnelle die Gräser, und gewöhnlich ist er bereits hundert Schritte weit hinweg, ehe der Jäger nur sein Gewehr zurecht legen kann.
»Gute Schützen erlegen diese Antilopen mit Rehposten oder feuern, noch ehe sie sich von ihrem Lager erhoben. In den ersten Tagen verfuhr ich ebenso, zuletzt aber fand ich, daß es besser und jagdgerechter ist, die Kugel anstatt der Schrote zu verwenden. Dort, wo das Gras zwei Meter hoch war, mußte ich jedoch, um das Thierchen nur zu sehen, zu Pferde jagen; allein dieser Jagd gerade verdanke ich, daß ich mein Wild genau beobachten konnte.
»Hat man den Bleichbock mit der Kugel verwundet, so darf man seiner Beute sicher sein; denn das zarte Geschöpf verträgt bei weitem keinen so starken Schuß wie der Ducker oder Riedbock. Freilich setze ich bei dieser Angabe voraus, daß der Jäger dem nach dem Schusse eiligst dahinstürzenden Wilde mit Aufmerksamkeit folgt. Der Bleichbock versucht es gewöhnlich, wenn er sich schwer verwundet fühlt, in dem langen Grase so gut als möglich sich zu verstecken. Er kriecht hier leise weiter bis zu einem Busche, einem großen Steine, einem Ameisenhügel, duckt sich dort und sieht dem Verenden entgegen. Beim Nachgehen findet man ihn meistens an solchen Stellen liegen. Uebersieht man aber den noch nicht Verendeten, so springt er auf und flieht mit möglichster Schnelle weiter. Im Anfange entkamen mir viele; als ich aber mit meinem Wilde vertrauter geworden war, faßte ich es scharf ins Auge und ritt nun um das Lager herum, mehr und mehr mich nähernd, bis ich noch einen sichern Schuß anbringen konnte.
»Das einzige Kalb, welches das Thier setzt, kann durch einen guten Hund leicht gefangen werden, und sein Wildpret gilt bei den Ansiedlern als eine Leckerei, welche mit besonderer Kunstfertigkeit zubereitet wird.«
Ueber das Gefangenleben des Bleichbockes finde ich nirgends eine Angabe.
Alle Bergantilopen zeichnen sich vor den übrigen durch ihren gedrungenen, kräftigen Leibesbau aus. Die Schlankheit der Formen und namentlich die Höhe der Läufe, welche einzelne Arten uns so anmuthig erscheinen läßt, ist bei den Gebirgskindern fast ganz verschwunden. Sie sind im Gegentheile verhältnismäßig dickleibig und kurzbeinig und ihre Hufe so gestellt, daß das ganze Gewicht des Thieres auf den Spitzen ruht. Der Fuß bekommt hierdurch etwas sehr bezeichnendes: der Huf verkürzt sich, die Schale läuft nach vorn hin nicht so spitzig aus, sondern ist mehr gerundet; auch reichen die Afterklauen weiter herab als bei denen, welche nur die Ebene beleben. Ein mehr oder weniger dichtes und straffes Haarkleid kennzeichnet die Bewohner der kühlern Höhe nicht minder. Solcher Leibesbau ist allen gemeinsam; hinsichtlich der Behornung aber finden sich Unterschiede, indem bald beide Geschlechter, bald nur die Männchen bewaffnet sind; auch ändern die Hörner vielfach ab.
Unter den hierher zu zählenden Antilopen vertritt der Klippspringer, der Ansiedler des Vorgebirges der Guten Hoffnung oder die Sassa der Abessinier ( Oreotragus saltatrix, Antilope saltatrix und oreotragus, Calotragus oreotragus) eine besondere Gruppe. Hinsichtlich seiner Gestalt steht dieses reizende Thier zwischen der Gemse und manchen kleinen Ziegenarten ungefähr in der Mitte. Der Leib ist gedrungen, der Hals kurz, der Kopf stumpf und rundlich, der Schwanz zu einem kurzen Stummel verkümmert, die Läufe sind niedrig und etwas plump. Sehr lange und breite Ohren, große Augen, welche von einem kahlen Saume umrandet sind und vorn deutliche Thränengruben haben, hohe, an den Spitzen plattgedrückte, unten rund abgeschliffene, klaffende Hufe sowie ein grobes, brüchiges und sehr dickes Haar sind anderweitige Kennzeichen des Thieres. Der Bock trägt kurze, gerade, schwarze Hörner, welche senkrecht auf dem Kopfe stehen und am Grunde geringelt sind. In der Gesammtfärbung ähnelt die Sassa unserem Reh. Sie ist oben und außen olivengelb und schwarz gesprenkelt, unten blässer, aber immer noch gesprenkelt; nur die Kehle und die Innenseiten der Beine sind einförmig weiß. Die Lippen sind noch lichter als die Kehle, die Ohren außen auf schwarzem Grunde mit kurzen, innen mit langen, weißen, an den Rändern mit dunkelbraunen Haaren besetzt. Die einzelnen Haare sind an der Wurzel weißgrau, gegen die Spitze hin dunkler, bräunlich oder schwarz und an der Spitze selbst gelblichweiß oder dunkel, etwa bräunlichgelb. Die Länge beträgt gegen 1 Meter, die Höhe etwa 60 Centimeter.
»Oft habe ich,« sagt Gordon Cumming, »wenn ich in einen Abgrund hinunterschaute, zwei oder drei dieser anziehenden Geschöpfe neben einander liegen sehen, gewöhnlich auf einer großen, flachen Felsenplatte, welche durch den freundlichen Schatten des Sandels oder anderer Gebirgsbäume vor der Gewalt der Mittagssonne geschützt war. Scheuchte ich die Flüchtigen auf, so sprangen sie in unglaublicher Weise mit der federnden Kraft eines Gummiballes von Klippe zu Klippe, über Klüfte und Abgründe hinweg; immer mit der größten Behendigkeit und Sicherheit.«
Diese Worte des berühmten Jägers fielen mir ein, als ich im Mensathale zum erstenmal hoch oben auf haarscharfem Grate zwei Antilopen stehen sah, gemächlich hin und her sich wiegend, als gäbe es keine Abgründe zu beiden Seiten. Das mußten Klippspringer sein: ich wußte es, ohne jemals vorher einen von ihnen oder auch nur eine Gemse im Freileben gesehen zu haben. Später fand ich Gelegenheit, die schmucken Geschöpfe noch etwas besser kennen zu lernen, bin aber weit entfernt, zu behaupten, daß ich von ihnen ausführlich erzählen könnte.

Klippspringer ( Oreotragus saltatrix). 1/10 natürl. Größe.
Rüppel ist meines Wissens der erste, welcher mit aller Bestimmtheit behauptet, daß die Sassa und der Klippspringer ein und dasselbe Thier sind. Bis zu seiner Beobachtungsreise in Habesch hatte man kaum Kunde von dem Vorkommen dieser Antilope in so nördlich gelegenen Gegenden; wenigstens weisen alle Forscher vor ihm dem Klippspringer ausschließlich das Kapland zur Heimat an.
Der Klippspringer oder die Sassa findet sich auf nicht allzu niederen Gebirgen, in den Bogosländern etwa auf solchen zwischen 600 und 2500 Meter unbedingter Höhe. Am Vorgebirge der Guten Hoffnung soll er den Quadersandstein allen übrigen Felsarten vorziehen; in Habesch belebt er wohl jede Gesteinsart ohne Unterschied. Die Berge sind hier weit reicher und lebendiger als im Süden des Erdtheils: eine dichte Pflanzendecke überzieht ihre Gehänge, und namentlich die Euphorbien bilden oft auf große Strecken hin einen bunten Teppich an den Wänden, in welchem die Kronen der Mimosen und anderer höheren Bäume wie eingestickte grüne Punkte erscheinen. Hier haust unsere Sassa, allerdings mehr in der baumarmen Höhe als in der Niederung, obwohl sie auch ziemlich tief in den Thälern gefunden werden kann.
Sie lebt paarweise wie die Schopfantilope; dennoch sieht man von ihr häufig kleine Trupps aus drei und selbst aus vier Stücken bestehend, entweder eine Familie mit einem Jungen oder zwei Pärchen, welche sich zusammengefunden haben und eine Zeitlang mit einander dahinziehen. Bei gutem Wetter sucht jeder Trupp soviel als möglich die Höhe auf, bei anhaltendem Regen steigt er tiefer in das Thal hinab. In den Morgen- und Abendstunden erklettern die Paare große Felsblöcke, am liebsten solche oben auf der Höhe des Gebirges, und stellen sich hier mit ziemlich eng zusammengestellten Hufen wie Schildwachen auf, manchmal stundenlang ohne Bewegung verharrend. So lange das Gras thaunaß ist, treiben sie sich stets auf den Blöcken und Steinen umher; in der Mittagsglut aber suchen sie unter den Bäumen oder auch unter großen Felsplatten Schutz, am liebsten gelagert auf einen beschatteten Block, welcher nach unten hin freie Aussicht gewährt. Von Zeit zu Zeit erscheint wenigstens einer der Gatten auf der nächsten Höhe, um von dort aus Umschau zu halten. Jedes Paar hält an dem einmal gewählten Gebiete mit großer Zähigkeit fest. Pater Filippini in Mensa konnte mir mit vollster Bestimmtheit sagen, auf welchem Berge ein Paar Sassas ständen: er wußte die Aufenthaltsorte der Thiere bis auf wenige Minuten hin sicher zu bestimmen.
Das Geäse des Klippspringers besteht aus Mimosen und anderen Baumblättern, Gräsern und saftigen Alpenpflanzen und wird in den Vormittags- und späteren Nachmittagsstunden eingenommen. Um diese Zeit versteckt sich die Sassa förmlich zwischen den Euphorbiensträuchern oder dem hohen Grase um die Felsblöcke herum, und der Jäger bemüht sich vergeblich, eines der ohnehin schwer wahrnehmbaren Thiere zu entdecken, wogegen er in den Früh- oder Abendstunden dieses Wild wegen der Eigenthümlichkeit der Stellung, welche es auf den höchsten Steinen annimmt, und dank der reinen Luft jener Höhen auf mehrere Kilometer weit sehen und unterscheiden kann.
Man darf nicht behaupten, daß die Sassa besonders scheu sei; jedoch ist dies wahrscheinlich bloß deshalb der Fall, weil die Abessinier wenig Jagd auf sie machen. Mehrmals habe ich sie von niederen Bergrücken ruhig und unbesorgt auf uns unten im Thale herabäugen sehen, obgleich wir in gerechter Schußnähe dahinzogen. Sie stand gewöhnlich starr wie eine Bildsäule, auf einer vorspringenden Felsplatte, die Lichter fest auf uns gerichtet, das große Gehör seitlich vom Kopfe abgehalten, ohne durch eine andere Bewegung, als durch Drehen und Wenden der Ohren, Leben zu verrathen. Augenscheinlich hatte sie die Tücke des Menschen hier noch nicht in ihrem vollen Umfange erfahren; denn überall, wo sie schon Verfolgung erlitten hat, spottet sie der List des Jägers und entflieht schon auf ein paar hundert Meter Entfernung vor ihm. Der Knall eines Schusses bringt bei dem Klippspringer eine merkwürdige Wirkung hervor. Wenn der Jäger fehlte, sieht er ihn bloß noch eine Viertelminute lang; später ist er verschwunden. Mit Vogelschnelle springt das behende Geschöpf von einem Absatze zum anderen, an den steilsten Felswänden und neben grausigen Abgründen dahin, mit derselben Leichtigkeit, wenn es aufwärts, wie wenn es abwärts klettert. Die geringste Unebenheit ist ihm genug, festen Fuß zu fassen; seine Bewegungen sind unter allen Umständen ebenso sicher als schnell. Am meisten bewundert man die Kraft der Läufe, wenn die Sassa bergaufwärts flüchtet. Jede ihrer Muskeln arbeitet. Der Leib erscheint noch einmal so kräftig als sonst, die starken Läufe wie aus federndem Stahl geschmiedet. Jeder Sprung schnellt das Thier hoch in die Luft; bald zeigt es sich ganz frei den Blicken, bald ist es wieder zwischen den Steinen oder in den meterhohen Pflanzen verschwunden, welche die Gehänge bedecken. Mit unglaublicher Eile jagt es dahin; wenige Augenblicke genügen, um es außer Bereich der Büchse zu bringen. Zuweilen kommt es aber doch vor, daß man die Verfolgung noch einmal aufnehmen und ein zweites Mal zum Schusse gelangen kann. In Gegenden, wo das Feuergewehr nicht üblich ist, achten alle Thiere anfangs sehr wenig auf den Knall, und die Klippspringer zumal scheinen an das Krachen und Lärmen der herabrollenden Steine im Gebirge so gewöhnt zu sein, daß sie ein Schuß kaum behelligt. Ich selbst habe aus einer Familie von drei Stück noch den Bock erlegt, nachdem ich ihn das erstemal gefehlt hatte. Der Trupp war nach dem Knalle zwar einigermaßen verwundert, aber doch furchtlos auf nahe stehende Felsblöcke gesprungen, um sich von dort aus Sicherheit über den Vorfall zu verschaffen, und weil ich mich ganz ruhig verhielt, zog die Gesellschaft später nur langsam weiter an den Bergwänden hin, so daß ich sie bald wieder einholen und nunmehr die Büchse besser richten konnte. Wenn man sich gleich vom Anfange an vorbereitet hat, zweimal zu schießen, kann man beide Gatten des Pärchens erlegen; denn die eine Sassa bleibt regelmäßig noch einige Augenblicke neben ihrem getödteten Gefährten stehen, betrachtet ihn mit großem Entsetzen und läßt dabei den so vielen Antilopen eigenthümlichen scharfen Schneuzer des Schreckens oder der Warnung vernehmen. Fürst Hohenlohe erlegte einmal beide Böcke eines Doppelpärchens mit zwei rasch aufeinander folgenden Schüssen.
Wie es scheint, fällt in Habesch die Satzzeit der Sassa zu Anfang der großen Regenzeit. Im März traf ich ein Pärchen, in deren Geleite sich der etwa halbjährige Sprößling noch befand. Genaues wußten mir die Abessinier nicht anzugeben, obwohl der Klippspringer ihnen allen ein sehr bekanntes Thier ist.
Die Betschuanen sind, wie man erzählt, der sonderbaren Ansicht, daß der Klippspringer durch Geschrei den Regen beschwöre. Sie suchen sich deshalb, wenn sie von Trockenheit leiden, sobald als möglich lebende Klippspringer zu verschaffen und plagen die armen Geschöpfe durch Schlagen, Kneipen und Zwicken, damit sie laut aufschreien und ihnen Regen bringen. In Habesch hält man die Sassa nirgends in der Gefangenschaft; wohl aber jagt man sie ihres Wildprets halber, vorausgesetzt nämlich, daß man ein Feuergewehr besitzt und dies zu handhaben weiß. Die Decke wird hier nicht benutzt, während man sie am Kap zu Polstern, Satteln und dergleichen verwendet.
Der einzige Klippspringer, welchen ich in einem Thiergarten gesehen habe, lebt gegenwärtig (1875) in Berlin. Man merkt es dem Thierchen an, daß es als neugeborenes Kälbchen unter die Pflege des Menschen gekommen sein muß; denn es wetteifert an Zutraulichkeit mit dem zahmsten Hausthiere. Furchtlos nähert es sich jedem, welcher es besucht, beschnuppert die ihm dargebotene Hand wie jeden anderen Gegenstand, welcher seine Neugierde erregt, und nimmt einen ihm gereichten Leckerbissen gern entgegen, ohne jedoch um solchen zu betteln. Unter dem ihm vorgelegten Futter dagegen sucht es sich wählerisch stets das beste aus. Wie es scheint, bevorzugt es Grasblätter und Rispen den Baumzweigen und deren Blättern, vielleicht aber nur infolge längerer Gewohnheit. Seine Haltung ist eher mit der einer Ziege als mit der einer Gemse zu vergleichen; seine Beweglichkeit kommt jedoch, weil man verabsäumt hatte, die Hufe zu beschneiden, noch nicht zur Geltung. Das rauhe Haar liegt so dicht an, daß der Pelz ein glattes Ansehen erhält und eine wärmere Decke bildet, als es den Anschein hat.
Die außerordentliche Fertigkeit im Bergsteigen, welche dem Klippspringer die Bewunderung des Menschen errungen hat, besitzt auch der indische Goral, ein Thier, welches zur Gruppe der Waldziegenantilopen ( Nemorhoedus) gehört. Dieser Name deutet ebensowohl auf Gestalt wie auf Lebensweise der betreffenden Wiederkäuer hin, da die hierher gehörigen Antilopen große Ähnlichkeit mit den Ziegen haben. Beide Geschlechter sind ziegenähnlich behornt, nur daß ihre unten geringelten, erst gerade aufsteigenden, dann gegen die Spitze hin ein wenig nach hinten gekrümmten Hörner nicht gekantet sind wie bei den Ziegen. Thränen- und Weichengruben fehlen. Bis jetzt kennt man bloß wenige Arten jener Gruppe und auch diese noch nicht genau.
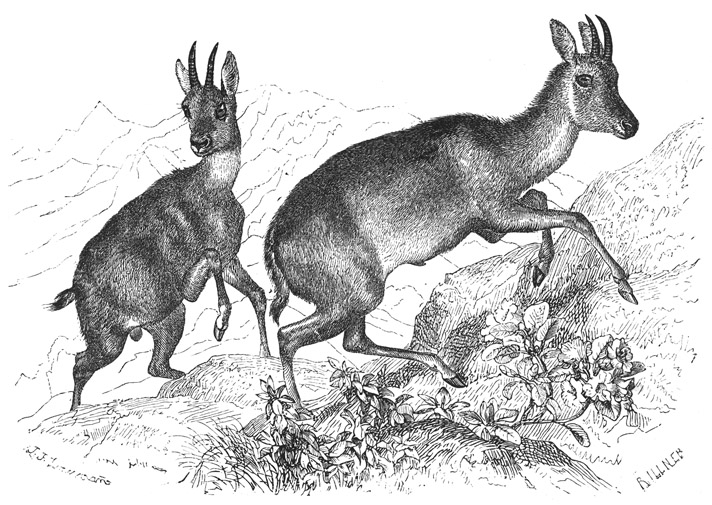
Goral ( Nemorhoedus Goral). 1/12 natürl. Größe.
Der Goral ( Nemorhoedus Goral, Antilope, Capricornis und Hemitragus Goral) hat die Größe einer Ziege. Seine Länge beträgt etwas über 1 Meter, die des Schwanzes 10, mit dem Haarpinsel 20 Centim., die Höhe am Widerrist 70 Centim. Das Gehörn des Bockes ist etwa 60 Centim. lang, kurz, dünn, gerundet; an der Wurzel stehen beide Stangen sehr nahe zusammen, gegen das Ende hin biegen sie sich von einander ab. Die Anzahl der Wachsthumsringe schwankt zwischen zwanzig und vierzig. Als Artkennzeichen gelten: gedrungener Leib mit geradem Rücken, schmächtige Beine, mittellanger Hals und kurzer, nach vorn zu verschmälerter Kopf mit eiförmigen, großen Augen und langen, schmalen Ohren, kurzes, dichtes, etwas abstehendes, zumal an Leib und Hals lockeres Haarkleid von grauer oder röthlichbrauner Färbung, welches oben an den Seiten und auch unten, mit Ausnahme eines schmalen gelben Längsstreifens am Unterleibe, schwarz und röthlich gesprenkelt, an Kinn und Kehle sowie einem von hier aus hinter den Wangen nach dem Ohre zu verlaufenden Streifen weiß, auf dem längs des Rückens verlaufenden Haarkamme aber schwarz ist. Die Hörner der Rike sind kürzer und schwächer als die des Bockes, beide Geschlechter aber sonst gleich gestaltet und gefärbt.
Das Verbreitungsgebiet des Goral beschränkt sich, laut Adams, auf den unteren und mittleren Gürtel des westlichen Himalaya. In der Nähe von Musori ist er gemein. Wilde und rauhe, steile und felsige, aber mit Gras bewachsene Höhenzüge bilden seine beliebtesten Wohngebiete. Selten sucht er den Schatten der Waldungen auf, lebt vielmehr auf Felsen und steinigen Abhängen. Er schlägt sich stets in starke Rudel und Herden, äst sich von den verschiedenartigsten Gräsern und Kräutern des Gebirges und dem Gelaube der Bäume, zieht morgens ins Geklüfte und zu den Quellen, und steigt während des Tages mehr und mehr im Gebirge empor, auf demselben Wege abends wieder nach unten zurückkehrend.
Alle Bewegungen des Goral stehen denen des Klippspringers kaum oder nicht nach: die Einwohner von Nepal sehen in ihm das schnellste aller Geschöpfe. Aeußerst furchtsam, scheu und flüchtig, mit vortrefflichen Sinnen begabt, klug und listig, läßt er sich schwer beschleichen und noch weniger verfolgen. Aufgescheucht, stößt er, wie die Gemse, einen scharfen Schneuzer aus und eilt sodann mit überraschender Schnelligkeit seines Weges dahin, gleichviel ob derselbe auf guten und gangbaren oder aber auf halsbrechenden Pfaden dahinführe. An den schroffsten Felswänden klettert er mit derselben Leichtigkeit wie die Gemse.
Ueber die Fortpflanzung wissen wir noch nichts; wohl aber ist es bekannt, daß jung eingefangene Thiere, welche man durch Ziegen groß ziehen läßt, sehr leicht zahm werden, während ältere Gefangene auch bei der sorgfältigsten Behandlung immer scheu und wild bleiben. Dabei sind sie schwer zu halten, weil sie, wie die Steinböcke, an den Wänden emporklettern und regelmäßig zu entfliehen wissen, wenn man nicht besondere Vorkehrungen trifft.
Ein Goral, welcher sich im Besitze eines englischen Statthalters befand und auf einem viereckigen Platze gehalten wurde, versuchte mehrmals, die etwa drei Meter hohe Umzäunung zu überspringen, und erreichte auch bei jedem Satze fast die erwünschte Höhe. Nach Europa ist bis jetzt noch kein lebender Goral gekommen, und selbst die Bälge dieser Thiere gehören zu den Seltenheiten in den Museen.
An diese fremden Antilopen können wir unsere deutschen anschließen, das anmuthige, vielfach verfolgte Kind unserer Gebirge, die Gemse. Sie gilt als der Vertreter einer eigenen Untersippe (Capella), deren Kennzeichen folgende sind: Der Leib ist gedrungen und kräftig, der Hals ziemlich schlank, der Kopf kurz, nach der Schnauze zu stark verschmächtigt, die Oberlippe gefurcht, die Nase behaart, das Nasenfeld zwischen den Nasenlöchern klein, der Schwanz kurz; die Füße sind lang und stark, die Hufe ziemlich plump, inwendig viel niedriger als außen, hinten niedriger als vorn, die Afterhufe außen flach; die Ohren sind spitzig, fast halb so lang als der Kopf, ungefähr ebenso lang wie der ziemlich kleine, mäßig behaarte Schwanz; die drehrunden, an der Wurzel geringelten und mit Längsriefen durchzogenen, an der Spitze glatten Hörner, steigen von der Wurzel an senkrecht vom Scheitel auf und krümmen sich mit der Spitze rückwärts und fast gleichlaufend der Wurzel abwärts; die Vorderzähne sind mäßig dick und rundlich, an der Schneide fast gleich breit; Thränengruben fehlen, dagegen befinden sich zwei Drüsengruben hinter der Wurzel der Hörner.
Die Gemse, Gams oder Gambs (Capella rupicapra, Capra und Antilope rupicapra), die einzige Art der Sippe, erreicht eine Länge von 1,1 Meter, wovon auf den Schwanz 8 Centim. kommen, bei einer Höhe am Widerrist von 75, am Kreuze von 80 Centim. sowie ein Gewicht von 40 bis 45 Kilogr. Die Hörner sind, der Krümmung nach gemessen, ungefähr 25 Centim. lang, stehen bei dem Bocke weiter aus einander und sind auch stärker und gekrümmter als bei der Geis. Im übrigen gleichen sich beide Geschlechter fast vollständig, obwohl die Böcke in der Regel etwas stärker sind als die Geisen. Das Haar ist ziemlich derb, im Sommer kurz, d. h. höchstens 3 Centim. lang, an der Wurzel braungrau, an der Spitze hellrostfarben, im Winter dagegen 10 bis 12 Centim., das der Rückenfirste, welche den sogenannten Bart bildet, sogar 18 bis 20 Centim. lang und am Ende schwarz. Hierdurch wird je nach der Jahreszeit ein verschiedenfarbiges Kleid bedingt. Im Sommer geht die allgemeine Färbung, ein schmutziges Rothbraun oder Rostroth, auf der Unterseite ins Hellrothgelbe über; längs der Mittellinie des Rückens verläuft ein schwarzbrauner Streifen; die Kehle ist fahlgelb, der Nacken weißgelblich; auf den Schultern, den Schenkeln, der Brust und in den Weichen wird diese Färbung dunkler; ein Streifen auf der Hinterseite zeigt eine Schattirung der gelben Farbe fast bis zum Weiß. Der Schwanz ist auf der Oberseite und an der Wurzel rothgrau, auf der Unterseite und an der Spitze schwarz. Von den Ohren an über die Augen hin läuft eine schmale, schwärzliche Längsbinde, welche scharf von der fahlen Färbung absticht. Ueber den vorderen Augenwinkeln, zwischen den Nasenlöchern und der Oberlippe stehen rothgelbe Flecken. Während des Winters ist die Gemse oben dunkelbraun oder glänzend braunschwarz, am Bauche weiß; die Beine sehen unten heller aus als oben und ziehen mehr ins Rothfarbene; die Füße sind gelblichweiß wie der Kopf, welcher auf dem Scheitel und an der Schnauze etwas dunkelt. Die Längsbinde von der Schnauzenspitze zu den Ohren ist dunkelschwarzbraun. Beide Kleider gehen so allmählich in einander über, daß das reine Sommer- und Winterkleid immer nur sehr kurze Zeit getragen werden. Junge Thiere sind rothbraun und heller um die Augen gefärbt.
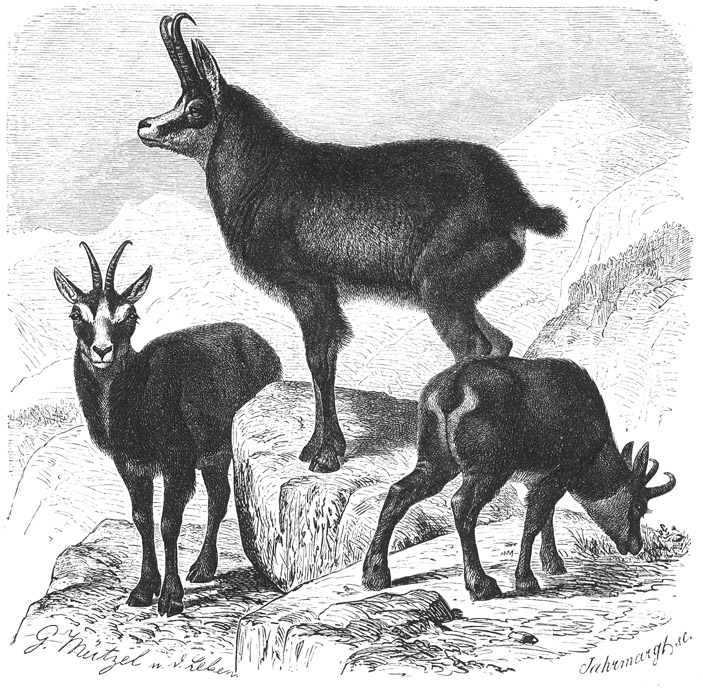
Gemse (Capella rupicapra). 1/12 natürl. Größe.
Lichtfarbige Spielarten oder Weißlinge werden selten beobachtet: unter mindestens viertausend Gemsen, welche Graf Hans Wilczek zu sehen Gelegenheit hatte, befand sich nur eine einzige von weißlicher Färbung. Auch Mißbildungen des Gehörns sind selten. Hier und da zeigt man zwar Schädel mit vier Hörnern; sie aber sind nichts anderes als in betrüglicher Absicht mit Krickeln besetzte vierhörnige Ziegenschädel. Wenn Mißbildungen vorkommen, war stets eine Verletzung des Gehörns deren Ursache.
Alle Jäger unterscheiden Grat- und Waldthiere, oder aber Kees-, d. i. Gletscher-, und Laubgemsen. Erstere sind stets schwächer von Wildpret als letztere, jedenfalls nur infolge der minder reichlichen Nahrung, über welche sie verfügen können, und in der Regel auch weniger dunkel gefärbt; beide aber dürfen nicht einmal als Spielarten aufgefaßt werden.
Einzelne Forscher haben die Ansicht ausgesprochen, daß die auf den Pyrenäen und den Gebirgen der kantabrischen Küste und ebenso die auf dem Kaukasus lebenden Gemsen von der unserigen bestimmt sich unterscheiden und deshalb als besondere Arten zu betrachten seien; es fehlen uns jedoch zur Zeit genügende Beweise für die Richtigkeit dieser Auffassung.
Die iberische Gemse, auf den Pyrenäen » Isard« genannt (Capella pyrenaica), ist, wie mir mein Bruder schreibt, durch ihre geringere Größe und die auffallend kleinen Hörner sowie durch das fuchsrothe Sommerkleid ohne Rückenstreifen sehr ausgezeichnet, und auch die im Kaukasus lebende » Atschi« genannte Form (Capella caucasica) soll von der Alpengemse nicht unwesentlich verschieden sein; ich glaube jedoch, daß es sich bei beiden einzig und allein um örtliche Spielarten handeln dürfte, wie solche bei den meisten weit verbreiteten Säugethieren beobachtet werden, und trage deshalb Bedenken, beide Formen als besondere Arten aufzuführen.
Als die wahre Heimat der Gemse dürfen die Alpen bezeichnet werden. Ihr Verbreitungsgebiet dehnt sich allerdings noch bedeutend weiter aus, da Gemsen auch in den Abruzzen, Pyrenäen, den Gebirgen der kantabrischen Küste, Dalmatiens und Griechenlands, auf den Karpaten, insbesondere den Gipfeln der Hohen Tatra, den transsylvanischen Alpen und endlich auf dem Kaukasus, in Taurien und Georgien gefunden werden; als Brennpunkt dieses Gebietes dürfen wir jedoch unsere Alpen ansehen. Vergeblich hat man versucht, in Norwegen sie einzubürgern, die Angelegenheit freilich auch nicht mit Nachdruck betrieben. In den Alpen findet sie sich gegenwärtig in der Schweiz selten, jedenfalls in ungleich geringerer Anzahl als in den östlichen Alpen, wo sie namentlich in Oberbayern, Salzburg und dem Salzkammergute, Steiermark und Kärnten, gehegt und geschont durch wohlhabende und jagdverständige Großgrundbesitzer oder Jagdpächter, in sehr bedeutender Menge lebt. Auch die steilen, unzugänglichen Höhen der Mittelkarpaten beherbergen sie, obgleich sie dort keine Hegung genießt, in erfreulicher Anzahl. In Tirol beginnt der Gemsenstand neuerdings wieder sich zu heben, in der Schweiz dagegen, wo in den meisten Kantonen jedermann berechtigt ist zu jagen und die hier und dort erlassenen Jagdgesetze wenig Beachtung finden, nimmt er von Jahr zu Jahr ab. Hier kann man wochenlang die Gebirge durchstreifen, ohne eine einzige Gemse zu sehen, während in den Ländern des österreichischen Kaiserstaates und in den bayerischen Alpen Rudel von dreißig bis fünfzig Stücken keine Seltenheit sind, und man bei Treibjagden buchstäblich Hunderte an sich vorüberziehen sehen kann.
Die allgemein verbreitete Meinung, daß die Gemse ein Alpenthier im engsten Sinne des Wortes sei, d. h. ausschließlich über dem Waldgürtel, in unmittelbarer Nähe der Gletscher, sich umhertreibe, ist falsch; denn sie gehört von Hause aus zu den Waldantilopen. Ueberall, wo sie geschont wird, bewohnt sie mit entschiedenster Vorliebe jahraus jahrein den oberen Holzgürtel. Von diesem aus steigt sie im Sommer allerdings in mehr oder minder großer Anzahl zu den höheren Lagen des Gebirges empor, hält sich wochen- und monatelang in der Nähe des Firnschnees und der Gletscher auf, die höchstgelegenen Matten und das baumlose Gefelse zeitweilig zu ihrem Aufenthalte erwählend; die Mehrzahl aller Gemsen eines Gebietes aber wird auch im Laufe des Sommers im oberen Waldgürtel angetroffen, und selbst die sogenannten Grat- oder Gletscherthiere finden sich bei heftigem Unwetter, insbesondere vor starken Stürmen, welche sie oft schon zwei Tage vorher zu ahnen scheinen, oder im Spätherbste und Winter im Walde ein, kehren jedoch sobald als möglich wieder zur gewohnten Höhe zurück, weil hier der Schnee fast immer früher abgeweht wird oder wegthaut als im Thale. Der zeitweilige Stand wird im Sommer auf den westlichen und nördlichen Bergseiten, in den übrigen Jahreszeiten dagegen auf den östlichen und südlichen gewählt, und dies erklärt sich auch einfach dadurch, daß die Gemse, wie alles feinsinnige Wild, ihren Aufenthaltsort der jeweiligen Witterung anpaßt. Ungestört hält das Rudel so ziemlich an demselben, freilich stets weit begrenzten Stande fest; doch wechselt es ebenso ohne äußere Ursache, und zwar je nach der Gegend verschieden, mir gewordenen glaubwürdigen Mittheilungen erfahrener Gemsjäger zufolge, sogar bis zu zehn oder zwölf Gehstunden weit, gelangt dabei zuweilen, obschon in seltenen Fällen, auch wohl in Gebiete, in denen seit Menschengedenken Gemswild nicht mehr vorgekommen ist. Alte Böcke sind zu derartigen Streifzügen stets mehr geneigt als Geisen und junge Böcke oder überhaupt Gemsen, welche sich rudeln.
Wie der größere Theil aller Antilopen, gehört auch die Gemse zu den Tagthieren. Sie ist bei Tage in Bewegung und ruht des Nachts. Mit Beginn der Morgendämmerung erhebt sie sich von dem Lager, auf welches sie sich mit Dunkelwerden einthat, und tritt auf Aesung, hierbei in der Regel langsam abwärts schreitend; die Vormittagsstunden verbringt sie wiederkäuend im Schatten vorstehender Felsen oder unter den Zweigen älterer Schirmtannen, größtentheils, auf den zusammengebogenen Läufen liegend, behaglich hingestreckt; um die Mittagszeit steigt sie langsam bergauf, ruht nachmittags wiederum einige Stunden unter Bäumen, auf vorspringenden und glatten Felsenplatten, auf Firnschnee und ähnlichen Oertlichkeiten, meist auf freien und nicht auf bestimmten, regelmäßig wieder aufgesuchten Stellen, sondern beliebig bald hier, bald dort, tritt gegen Abend nochmals auf Aesung und legt sich nach Eintritt der Dämmerung zur Ruhe nieder. Von diesem Tageslaufe soll sie während des Sommers in hellen Mondscheinnächten dann und wann eine Ausnahme machen. Im Spätherbste und Winter weidet sie während des ganzen Tages, und nachdem Schnee gefallen ist, steigt sie in den tiefen Lagen des Gebirges, welche sie jetzt bezogen hat, besonders gern auf die Sonnenseite der Berge, weil hier der Schnee nicht so leicht haftet wie auf der im Schatten gelegenen. Das nächtliche Lager wird sehr verschieden gewählt, immer aber auf solchen Stellen aufgeschlagen, welche eine weite Umschau und namentlich einen mühelosen Ueberblick der Tiefe gewähren. Besondere Vorbereitungen trifft unsere Antilope nicht, lagert sich vielmehr an jeder ihr passend erscheinenden Stelle ohne weiteres auf den Boden und beziehentlich auf den Felsen.
Als höchst geselliges Thier vereinigt sich die Gemse zu Rudeln von oft sehr beträchtlicher Anzahl. Diese Gesellschaften werden gebildet durch die Geisen, deren Kitzchen und die jüngeren Böcke bis zum zweiten, höchstens bis zum dritten Jahre. Alte Böcke leben außer der Brunstzeit für sich oder vereinigen sich vielleicht mit einem, zweien oder dreien ihres Gleichen, pflegen jedoch, wie es scheint, mit diesen niemals längere Zeit innige Gemeinschaft. Im Rudel übernimmt eine alte erfahrene Geis die Leitung, wird aber keineswegs dazu von den übrigen Mitgliedern des Trupps erwählt und noch weniger bei mangelnder Wachsamkeit aus demselben ausgestoßen, wie vormals von alten Jägern behauptet worden ist. Dieses Leitthier regelt meist, aber durchaus nicht immer, die Bewegungen des Rudels, ebensowenig als dieses sich einzig und allein auf seine Wachsamkeit verläßt. Allerdings bemerkt man bei jedem gelagerten Rudel regelmäßig eine oder mehrere aufrecht stehende und um sich blickende Gemsen, und diese sind es zumeist auch wohl, welche den übrigen vom Herannahen eines gefahrdrohenden Wesens Kunde geben; sie aber üben nicht ein ihnen übertragenes Amt aus, sondern folgen einfach einem Triebe, welcher alle gleichmäßig beherrscht und bei allen in gleicher Weise sich äußert. Jede Gemse, welche etwas verdächtiges gewahrt, drückt dies durch ein auf weithin vernehmbares, mit Aufstampfen des einen Vorderfußes verbundenes Pfeifen aus, und das Rudel ergreift, sobald es sich von der Thatsächlichkeit der Gefahr überzeugt hat, nunmehr sofort die Flucht, wobei immer eine, wahrscheinlich die älteste Geis die Führung übernimmt. Ihr folgt, laut Grill, das zuletzt gesetzte Kitzchen, diesem der sogenannte Jährling und hierauf das übrige Rudel in mehr oder minder bunter Reihe.
Hinsichtlich ihrer Bewegungen wetteifert die Gemse mit den uns bereits bekannten Bergsteigern ihrer Familie. Sie ist ein geschickter Kletterer, ein sicherer Springer und ein kühner und rüstiger Bergsteiger, welcher auch auf den gefährlichsten Stellen, wo keine Alpenziege hinaufzuklettern wagt, rasch und behend sich bewegt. Wenn sie langsam zieht, hat ihr Gang etwas schwerfälliges, plumpes und die ganze Haltung etwas unschönes; sowie aber ihre Aufmerksamkeit erregt und sie flüchtig wird, ändert sich das ganze Thier gleichsam um. Es erscheint frischer, kühner, edler und kräftiger und eilt mit raschen Sätzen dahin, in jeder Bewegung ebensoviel Kraft als Anmuth kundgebend. Ueber die außerordentliche Sprungfähigkeit sind einige bestimmte Beobachtungen gemacht worden. Von Wolten maß, wie Schinz berichtet, den Sprung einer Gemse und fand ihn sieben Meter weit. Der genannte Beobachter sah eine zahme Gemse auf eine vier Meter hohe Mauer hinauf-, auf der anderen Seite hinab- und einer Magd, welche eben dort graste, auf den Rücken springen. Wo nur immer ein kleiner Vorsprung sich zeigt, kann die Gemse ansetzen, und sie erreicht in wenigen Sätzen die Höhe wie im Fluge, indem sie dabei einen Anlauf nimmt und schief aufwärts zu kommen sucht. Ueber die steilsten Klippen läuft sie mit derselben Sicherheit wie ihre Geistes- und Leibesverwandten, und da, wo man glauben sollte, es sei unmöglich, daß ein Thier von solcher Größe Fuß fassen könnte, eilt sie mit Blitzesschnelle sicher davon. Sie springt leichter bergauf als bergab und setzt mit außerordentlicher Behutsamkeit die Vorderfüße, in denen sie eine große Gelenkigkeit besitzt, auf, damit sie keine Steine lostrete. Selbst schwer verwundet stürmt sie noch flüchtig auf den furchtbarsten Pfaden dahin; ja sogar dann, wenn ihr ein Bein weggeschossen wurde, zeigt sie kaum geringere Behendigkeit als solange sie noch gesund ist. »Wie oft man es auch gesehen haben mag«, sagt Kobell, »immer ist zu staunen, wie die Gemsen an ganz steilen Wänden, wo nur ein Wechsel, den sie selber mit einer gewissen Vorsicht annehmen, beim fallenden Schusse durcheinander rumpeln, ohne daß eine ungetroffen herunterstürzt. Es reicht eine hervorragende Stelle von zwei Centimetern hin, um ihnen fortzuhelfen, wobei sie oft mit gewaltigen Sprüngen über ganz unhaltbare Stellen wegsetzen und doch gleich wieder anhalten können. Unter Umständen vertragen sie auch ein Abstürzen, welches man gesehen haben muß, um es für möglich zu halten.« Eine Bestätigung der letzteren Angabe wurde mir durch Herrn Mühlbacher, den verläßlichen Oberjäger des Grafen Wilczek, welcher sah, daß ein Gemsbock, im Springen das ins Auge gefaßte Ziel verfehlend, ohne die Wand zu berühren, in eine Tiefe stürzte, welche, nach Mühlbachers Schätzung, wenig unter hundert Meter betragen konnte. Glücklicherweise fiel das Thier auf eine sogenannte Schütte, einen feinkörnigen Schotterkegel, welcher die Wucht des Sturzes brach. Ohne erkennbare Verletzung, ja sogar ohne merkliches Unbehagen setzte dieser Bock nach kurzem Besinnen seinen Weg fort und erklomm, rüstig wie ein gesunder, die Wand an einer anderen Stelle. Ungeachtet ihrer Geschicklichkeit und Gewandtheit sollen sich, laut Schinz, die Gemsen zuweilen doch so versteigen, daß sie weder vorwärts noch rückwärts kommen, keinen Fuß mehr fassen können und entweder durch Hunger verderben oder in den Abgrund stürzen müssen. Tschudi berichtigt diese Angabe dahin, daß die Gemse unter allen Umständen versuche, das Unmögliche möglich zu machen, indem sie in den Abgrund springt, und ob sie auch unten zerschelle. »Nie verstellt sich eine Gemse, d. h. bleibt unbeholfen und rettungslos stehen, wie oft die Ziegen, welche dann meckernd abwarten, bis der Hirt sie mit eigener Lebensgefahr abholt. Die Gemse wird sich eher zu Tode springen. Doch mag dieses sehr selten geschehen, da ihre Beurtheilungskraft weit höher steht als die der Ziege. Gelangt sie auf ein schmales Felsenband hinaus so bleibt sie einen Augenblick am Abgrunde stehen und kehrt dann, die Furcht vor den folgenden Menschen oft überwindend, pfeilschnell auf dem Herwege zurück. Hat das Thier, wenn es über eine fast senkrechte Felswand heruntergejagt wird, keine Gelegenheit, einen faustgroßen Vorsprung zu erreichen, um die Schärfe des Falles durch wenigstens augenblickliches Aufstehen zu mildern, so läßt es sich dennoch hinunter, und zwar mit zurückgedrängtem Kopfe und Halse, die Last des Körpers auf die Hinterfüße stemmend, welche dann scharf am Felsen hinunterschnurren und so die Schnelligkeit des Sturzes möglichst aufhalten. Ja, die Geistesgegenwart des Thieres ist so groß, daß es, wenn es im Sichhinunterlassen noch einen rettenden Vorsprung bemerkt, alsdann im Fallen mit Leib und Füßen noch rudert und arbeitet, um diesen zu erreichen, und so im Sturze eine krumme Linie beschreibt.« Daß die Gemsen in der von Tschudi geschilderten Weise an steilen Felsenwänden hinunterschnurren, ist eine allen Kärntner und Steierischen Jägern wohlbekannte Thatsache; mein alter, erfahrener Jagdfreund Morhagen erzählte mir auch, daß hartbedrängte Gemsen nöthigenfalls ohne Bedenken, weil in der Regel mit Glück, zwölf bis sechzehn Meter tief hinabspringen. Höchst vorsichtig bewegt sich die Gemse beim Ueberschreiten schneebedeckter Gletscher und weicht hier verschneiten Spalten stets sorgfältig aus, obgleich sie dieselben durch das Gesicht nicht wahrnehmen kann. Ebenso geht sie auf Felsengehängen äußerst besorglich und langsam dahin. Einige Glieder des Trupps richten ihre Aufmerksamkeit auf die Pfade; die übrigen spähen unablässig nach anderer Gefahr. »Wir haben gesehen«, erzählt Tschudi, »wie ein Gemsenrudel ein gefährliches, sehr steiles, mit Geröll bedecktes Felsenkamin überschreiten wollte, und uns über Geduld und Klugheit der Thiere gefreut. Eines ging voran und stieg sacht hinauf, die übrigen warteten der Reihe nach, bis es die Höhe ganz erreicht hatte, und erst als kein Stein mehr rollte, folgte das zweite, dann das dritte und so fort. Die oben angekommenen zerstreuten sich keineswegs auf der Weide, sondern blieben am Felsenrande auf der Spähe, bis die letzten sich glücklich zu ihnen gesellt hatten.« Dieselbe Vorsicht und dasselbe Geschick beweist die Gemse, wie mir ein erfahrener Gemsenjäger mittheilte, beim Uebersetzen der rauschenden Wildbäche des Gebirges. Nöthigenfalls springt sie allerdings mitten ins Wasser und schnellt sich dann weiter; wenn sie jedoch nicht bedrängt ist, überlegt sie erst lange, an welcher Stelle sie den Uebergang bewerkstelligen soll, läuft zu diesem Ende am Wildwasser hinauf und herab, besichtigt die verschiedenen Stellen, welche ihr Vorhaben ausführbar erscheinen lassen, und wählt schließlich die geeignetste. Mein Gewährsmann sah eine Gemse den hochgeschwollenen, über sechs Meter breiten Wildbach des Elendthales in Kärnten mit zwei gewaltigen Sätzen überspringen. Hart verfolgt, geängstigt oder verwundet wirft sie sich selbst in die Wellen eines Alpsees, in der Hoffnung, schwimmend Rettung zu finden. So sah Wilczek eine von ihm angeschossene Gemse in den Teufelssee sich stürzen und hier mindestens eine halbe Stunde lang umherschwimmen, weil sie sich scheuete, angesichts der an den Ufern stehenden Jäger das Land zu betreten. Sie schwamm mit wenig eingetauchtem Leibe und unter kräftigen Stößen ihrer Hinterläufe überraschend leicht und rasch, ohne Ermüdung zu verrathen.
Eine ungewöhnliche Ortskenntnis kommt der Gemse bei ihren kühnen Wanderungen sehr zu statten. Sie merkt sich jeden Weg, welchen sie nur einmal gegangen, und kennt in ihrem Gebiete sozusagen jeden Stein; deshalb gerade zeigt sie sich ebenso heimisch im Hochgebirge, wie sie unbeholfen erscheint, wenn sie dasselbe verläßt. »Im Sommer 1815«, berichtet Tschudi ferner, »stellte sich, zu nicht geringem Erstaunen der Augenzeugen, plötzlich ein wahrscheinlich gehetzter Gemsbock auf den Wiesen bei Arbon ein, setzte ohne unmittelbare Verfolgung über alle Hecken und stürzte sich in den See, wo er lange irrend umherschwamm, bis er, dem Verenden nahe, mit einem Kahne aufgefangen wurde. Einige Jahre vorher wurde im Rheinthale eine junge Gemse im Moraste steckend lebend ergriffen.«
Ungemein scharfe Sinne befähigen die Gemse in gleich hohem Grade wie irgend ein anderes Thier ihrer Verwandtschaft. Geruch und Gehör scheinen am besten ausgebildet, das Gesicht minder gut entwickelt zu sein. Die Schärfe des ersteren Sinnes offenbart sich nicht allein durch ihre feine Witterung, sondern auch durch ein überraschendes Spürvermögen, welches sie befähigt, eine Fährte aufzunehmen und mit Sicherheit ihr zu folgen. So sieht man bei Treibjagden in Hochgebirgswäldern zuweilen versprengte Kitzchen denselben Weg, welchen mehrere Minuten vorher die Muttergeis nothgedrungen wählen mußte, mit solcher Sicherheit aufnehmen, daß man sich dieses genaue Folgen nur durch Annahme eines außerordentlichen Spürvermögens erklären kann. Ebenso gewahrt man, daß Gemsen jederzeit stutzen, nicht selten sogar zurückkehren, wenn sie die Spur eines Menschen kreuzen. Hinsichtlich der Witterung stehen unsere Gebirgsantilopen wahrscheinlich keinem Mitgliede ihrer Familie nach. Wer Gemsen beobachten oder sich ihnen nähern will, hat den Wind auf das sorgfältigste zu prüfen, weil sonst die scheuen Thiere unbedingt entfliehen. Auf wie weithin ihre Witterung reicht, läßt sich mit Bestimmtheit nicht feststellen, wohl aber behaupten, daß sie die Entfernung eines Büchsenschusses noch erheblich übersteigt. Jedenfalls ist der Sinn des Geruches derjenige, welcher die Gemse stets am ersten und am untrüglichsten vom Herannahen einer Gefahr überzeugt und, was dasselbe, sofort zur Flucht bewegt. Das Gehör täuscht sie, obgleich es ebenfalls sehr fein ist, weit eher. Um das Poltern der herabfallenden Steine bekümmert sie sich gewöhnlich sehr wenig: denn dieses ist sie im Gebirge gewohnt; selbst das Krachen eines Schusses macht nicht immer einen besonderen Eindruck auf sie. Wenn Gemsen erfahren haben, was der Schuß zu bedeuten hat, und sie das Krachen desselben richtig erkennen, ergreifen sie freilich ohne Besinnen die Flucht; in vielen Fällen aber stutzen sie nach dem Knalle und geben unter Umständen dem Jäger Gelegenheit, ihnen eine zweite Kugel zuzusenden. Dies erklärt sich zum Theil daraus, daß es im Gebirge auch für den Menschen sehr schwer ist, zu beurtheilen, in welcher Richtung ein Schuß fiel, oder selbst, ob man einen solchen und nicht das Knallen eines sich loslösenden und unten aufschlagenden Steines vernahm. Das Gesicht unserer Thiere beherrscht unzweifelhaft weite Fernen, muß aber doch viel schwächer sein als bei anderen Wiederkäuern, weil die Gemsen einen still sitzenden oder stehenden Jäger meist übersehen oder von dem umgebenden Gestein nicht zu unterscheiden vermögen. Obgleich nur meine Jagdfreunde dies im voraus mitgetheilt hatten, war ich bei meiner ersten Gemsjagd doch nicht wenig überrascht, die getriebenen Gemsen anscheinend in vollster Sorglosigkeit auf mich zukommen und in verhältnismäßig sehr geringer Entfernung an mir vorüberlaufen zu sehen. Wie die meisten niederen Wirbelthiere, namentlich die Fische, scheinen sie den sich ruhig verhaltenden Menschen nicht als solchen zu erkennen und erst dann einen Gegenstand der Furcht in ihm zu erblicken, wenn er sich bewegt. Aus diesem Grunde flüchten sie vor dem gehenden Jäger, wenn sie ihn einmal wahrgenommen haben, meist schon in weiter Entfernung, während sie den sich unter Benutzung des Windes herbeischleichenden Schützen nicht selten bis auf günstige Schußweite herankommen lassen.
Schon aus dem vorstehenden geht hervor, daß die geistigen Fähigkeiten der Gemse zu einer hohen Entwickelung gelangt sind. In jeder ihrer Bewegungen, in ihrem ganzen Wesen spricht sich ein bemerkenswerther Grad von Verstand aus. Sie ist eigentlich nicht scheu, wohl aber in hohem Grade vorsichtig: sie prüft sorgfältig, bevor sie handelt; sie überlegt, bedenkt, berechnet und schätzt. Ein vortreffliches Gedächtnis erleichtert ihr, gewonnene Erfahrungen auf Jahre hinaus zu verwerten. Sie ist vertraut mit allen Wechselfällen, welche das Gebirge und ihr Leben in demselben mit sich bringt, kennt die Gefahren, welche herabrollende Lawinen oder Steine ihr bereiten können, sehr wohl und sucht ihnen soviel als möglich zu entgehen, begibt sich niemals leichtsinnig in Gefahr, sondern strebt jedes ihr drohende Unheil, so gut als in ihren Kräften steht, von sich abzuwenden, benimmt sich mit einem Worte durchaus den Umständen gemäß. Wie alles Wild, beträgt sie sich da, wo sie verfolgt wird, ganz anders als in Gehegen, in denen sie Schonung erfährt. Dem Menschen mißtraut sie zwar immer, meidet hier und da aber doch seine Nähe und sein Treiben nicht so ängstlich, als man von vornherein annehmen möchte. So wenig sie sonst in die Nachbarschaft der Gebäude kommt, so geschieht es doch zuweilen, daß sie sich einzeln gelegenen Alm- oder Jägerhütten bis auf wenige Schritte Entfernung nähert und unbekümmert um den aus den Essen aufsteigenden Rauch auf den Matten vor dem Hause sich äst. So beobachtete mein Gewährsmann, der erfahrene Gemsenjäger Klampferer, von dem oberen Jägerhause des Elendthales aus, daß zwei Gemsen mehrere Tage nach einander in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung erschienen und Aesung nahmen. Mit dem Verstande paart sich List und Verschlagenheit. Wenn die Gemse einen Menschen wahrnimmt und als solchen erkennt, verhält sie sich oft ganz ruhig auf einer und derselben Stelle, eilt aber, sobald sie glaubt, daß man sie nicht mehr sehen könne, so schleunig als möglich davon. Neugierig ist sie freilich ebenfalls und läßt sich daher in derselben Weise täuschen wie Gazellen und Wildziegen, insofern man nämlich ihre Aufmerksamkeit beschäftigen und damit von sich selbst ablenken kann. Hierin erinnert die Gemse lebhaft an die Ziege, mit welcher sie außerdem den Hang zu Neckereien und allerlei Spielen theilt. Junge Böckchen führen oft die lustigsten Scheinkämpfe aus und üben sich gleichsam für den Streit, welchen das Alter ihnen sicher bringt. »Auf den schmalsten Felsenkanten«, schildert Tschudi, »treiben sie sich umher, suchen sich mit den Hörnchen herunterzustoßen, spiegeln an einem Orte den Angriff vor, um sich an einem anderen bloßzustellen, und necken sich auf die muthwilligste Art. Oft sieht man ganze Rudel stundenlang an muthwilligen Sprüngen sich ergötzen, zuweilen förmlich in allerlei Turnkünsten sich überbieten.« Von einer ganz absonderlichen Art ihrer Spiele berichtet mir der vorher erwähnte Gemsenjäger, und seine Angaben wurden mir später durch Förster Wippel so vollständig bestätigt, daß ich nicht wohl einen Zweifel an denselben hegen darf. Wenn nämlich Gemsen im Sommer bis zu dem Firnschnee emporgestiegen sind und sich vollkommen ungestört wissen, Vergnügen sie sich oft damit, daß sie sich an dem oberen Ende stark geneigter Firnflächen plötzlich in kauernder Stellung auf den Schnee werfen, mit allen Läufen zu rudern beginnen, sich dadurch in Bewegung setzen, nunmehr auf der Schneefläche nach unten gleiten und oft hundert bis hundertundfünfzig Meter in dieser Weise, gleichsam schlittenfahrend, durchmessen, wobei der Schnee hoch aufstiebt und sie wie mit Puderstaube überdeckt. Unten angekommen springen sie wieder auf die Läufe und klettern langsam denselben Weg hinauf, welchen sie herabrutschend zurückgelegt hatten. Die übrigen Mitglieder des Rudels schauen den gleitenden Kameraden vergnüglich zu, und eines und das andere Stück beginnt dann dasselbe Spiel. Oft fährt eine und dieselbe Gemse zwei-, drei- und mehrmal über den Firnschnee herab; oft gleiten mehrere unmittelbar nach einander in die Tiefe. So sehr sie übrigens ein derartiges Spiel auch beschäftigen mag: ihre Sicherung lassen sie deshalb niemals aus dem Auge, und der bloße Anblick eines Menschen, befände sich derselbe selbst noch in weitester Ferne, beendigt sofort das Spiel und ändert mit einem Schlage das Wesen und Benehmen der mißtrauischen Geschöpfe.
Mit anderen harmlosen Säugethieren befassen sich die Gemsen wenig; mit einzelnen, beispielsweise mit den Schafen, leben sie sogar in erklärter Feindschaft, betrachten sie wenigstens mit entschiedenem Widerwillen. Sobald Schafe auf den Höhen weiden, welche sonst von Gemsen besucht werden, verschwinden letztere, kehren auch erst im Spätherbste, wenn der Schafdünger verwitterte, auf solche Stellen zurück. Wie es scheint, beunruhigt sie das massenhafte Auftreten der Schafe weniger, als ihnen der Geruch des Schafdüngers widerlich ist. Die Ziegen, welche mehr noch als die Schafe ihnen nachsteigen, die meisten der von ihnen bewohnten Plätze besuchen können und deshalb viel mehr angethan scheinen, sie zu behelligen, werden von ihnen durchaus nicht gemieden, im Gegentheile oft freiwillig aufgesucht. Auch Rinder, Hirsche und Rehe haben die Gemsen gern, fürchten sich wenigstens nicht vor ihnen und erscheinen nicht selten in deren unmittelbarer Nähe.
Gegen die Brunstzeit hin, welche um die Mitte des November beginnt und bis anfangs December währt, finden sich die starken Böcke bei den Rudeln ein, streifen von einem zum anderen, laufen ununterbrochen hin und her und verlieren dabei ihr Feist in sechs bis acht Tagen. So schweigsam sie während der übrigen Zeit des Jahres zu sein pflegen, so oft lassen sie jetzt ihre Stimme, ein schwer zu beschreibendes dumpfes und hohles Grunzen, vernehmen. Bei ihrem Erscheinen stieben die jungen Böcke erschreckt aus einander; alte Recken dagegen, welche sich bei einem Rudel treffen, halten regelmäßig Stand und kämpfen mit einander, da der starke Bock einen zweiten nicht bei dem Rudel duldet, und ob dasselbe auch aus dreißig bis vierzig Stücken bestehe. Ihre Eifersucht wird nur von ihrem Ungestüm überboten: mißtrauisch spähen sie in die Runde, in ihrer Erregung zuweilen sogar den Jäger übersehend und vergessend; kampflustig gehen sie jedem von fern sich zeigenden starken Bocke entgegen und nehmen, sowie er Stand hält, mit ihm den Kampf auf. Auf ihre blinde Eifersucht hat man in den östlichen Alpen eine eigene Jagdweise begründet, indem man eine weiße Schlafhaube oder eine eigens hierzu verfertigte und mit Krickeln besetzte Kappe aufsetzt, angesichts eines Gemsbockes sich in gebückter Stellung auf Augenblicke zeigt und wieder verbirgt, den Bock hierdurch auf sich aufmerksam und eifersüchtig macht und ihn so bis auf Schußweite heranlockt. Gegen die Geisen zeigen sich die verliebten Böcke ungeduldig und rücksichtslos, treiben sie heftig und mißhandeln diejenigen, welche nicht gutwillig sich fügen wollen. Wie bei den Hirschen geschieht es, daß sie oft um der Minne Sold geprellt werden, da sie vor lauter Eifer nicht zum Beschlage kommen, und junge Böcke sich jede Gelegenheit zu nutze machen, um den auch bei ihnen sich regenden Geschlechtstrieb zu befriedigen. Letzterer scheint bei den Geisen nicht minder lebhaft zu sein als bei den Böcken. So spröde jene anfänglich sich zeigen, so willig geben sie später den Liebkosungen des Bockes sich hin, fordern diesen, wie Beobachtungen dargethan haben, sogar förmlich zum Beschlage auf und begnügen sich keineswegs mit einer ein- oder zweimaligen Paarung.
Ueber die Trächtigkeitsdauer widersprechen sich die Angaben verschiedener Beobachter. Schöpff, auf dessen Mittheilungen ich zurückkommen werde, erfuhr, daß seine gefangenen Gemsen genau hundertundfünfzig Tage nach der Paarung setzten, und konnte umsoweniger getäuscht werden, als die Böswilligkeit des Bockes seine Absperrung nach dem Beschlage nöthig machte; alle Gemsenjäger dagegen nehmen eine längere Tragzeit an. In den Alpen Steiermarks und Kärntens beginnt die Brunst nicht vor der angegebenen Zeit und scheint gegen den zehnten December hin bestimmt zu Ende zu sein; die Satzzeit aber fällt erst in die letzten Tage des Mai oder in den Anfang des Juni, und es würde somit die Trächtigkeitsdauer auf etwa achtundzwanzig Wochen oder zweihundert Tage anzunehmen sein. Je nach der Lage, Höhe und Beschaffenheit des Gebirges verrücken sich Brunst- und Satzzeit um einige Tage, möglicherweise um Wochen; schwerlich aber unterliegt die Tragzeit so großen Schwankungen, wie dies aus den beiden sich entgegenstehenden Angaben hervorzugehen scheint. Alte Geisen setzen manchmal zwei, in Ausnahmefällen sogar drei, jüngere stets nur ein Kitzchen. Die Jungen, allerliebste, mit dichten, wolligen, blaßfahlrothen Haaren bekleidete Geschöpfe, folgen ihrer Mutter, sobald sie trocken geworden sind, auf Schritt und Tritt und zeigen sich schon nach ein paar Tagen fast ebenso gewandt wie diese. Mindestens sechs Monate lang behandelt sie die Geis mit der wärmsten Zärtlichkeit, zeigt sich äußerst besorgt um sie und lehrt und unterrichtet sie in allen Nothwendigkeiten des Lebens. Mit einem entfernt an das Meckern der Ziege erinnernden Laute leitet sie ihre Sprossen, lehrt sie klettern und springen und macht ihnen unter Umständen manche Sprünge ausdrücklich so lange vor, bis sie geschickt genug sind, das Wagestück auszuführen. Die Jungen hängen mit inniger Zärtlichkeit an ihrer Mutter und verlassen dieselbe, so lange sie jung sind, nicht einmal im Tode. Mehrfach haben Jäger beobachtet, daß junge Gemsen zu ihren erlegten Müttern zurückkehrten und klagend bei ihnen stehen blieben; ja, es sind Beispiele bekannt, daß solche Thiere, obgleich sie ihre Scheu vor dem Menschen durch einen dumpfen, blökenden Laut deutlich zu erkennen gaben, von der Leiche ihrer Mutter sich wegnehmen ließen. Verwaiste Kitzchen sollen von Pflegemüttern angenommen und vollends erzogen werden. Der Bock bekümmert sich nicht im geringsten um seine Nachkommenschaft, behandelt jedoch junge Gemsen, so lange bei ihm die Erregung der Brunst nicht ins Spiel kommt, wenigstens nicht unwirsch, erfreut sich trotz seines Ernstes vielleicht sogar an ihrem lustigen und heiteren Wesen. Die Kitzchen wachsen ungemein rasch heran, erhalten schon im dritten Monate ihres Lebens Hörner und haben im dritten Jahre fast die volle Größe der Alten erlangt, sind mindestens zur Fortpflanzung geeignet. Das Alter, welches sie erreichen, schätzt man auf zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre, ob mit Recht oder mit Unrecht, läßt sich kaum bestimmen.
Zuweilen geschieht es, daß ein Gemsbock unter die auf den Alpen weidenden Ziegen sich mischt, die Zuneigung einer oder der anderen Geis gewinnt und mit ihr sich paart. Wiederholt und noch in der Neuzeit hat man auch von Erzeugnissen derartiger Liebesverhältnisse, also von zweifellosen Gemsen- und Ziegenblendlingen gesprochen. »Seit einigen Tagen«, so berichtet man der Jagdzeitung aus Chur unter dem 27. Mai 1867, »befinden sich hier ein paar Bastardgemsen, Bock und Geis, welche die Theilnahme der Jäger in hohem Grade erregen. Bekanntlich gelang es öfters, Hausziegen mit zahmen Gemsböcken zu paaren, und die Jungen hatten dann von der Mutter bloß die Farbe und die Hörnerform, vom Vater aber den ausgezeichnet starken Gliederbau. Schon Bechstein erzählt von einer Bastardgemse, welche im Gliederbau, besonders in der hohen Stirne, der Gemse, in der Färbung dagegen der Ziege geglichen habe. Auch sind nach Tschudi's Erfahrungen, welche ich bestätigen kann, zuverlässige Beispiele von fruchtbarer Kreuzung unserer einheimischen Ziege mit der Gemse im Freien bekannt. Der Ziegenhirt von Koffna, woher oben erwähnte Gemsbastarde kommen, erzählte, daß er während des Sommers zu verschiedenen Malen auf der Koffner Alpe Nascharignas einen mächtigen Gemsbock gesehen habe, welcher von der Höhe des nahen Scherenhorns an den steilen, felsigen Abhängen zu der unten weidenden Ziegenherde herabgekommen und auf der grünen, blumigen Weide unter den Ziegen so lange hochzeitlich verweilt habe, bis er den Hirten sich nahen gesehen, und dann, mit einigen kühnen Sprüngen die Felsen hinaufkletternd, gegen die Spitze des Berges verschwunden wäre. Im März 1866 warf eine Ziege des Jakob Spinas in Koffna ein weibliches und im April 1866 eine Ziege des Johann Baptist Durlandt ein männliches Zicklein, welche beide als Bastarde von Gemse und Ziege erkannt wurden. Sie waren nackt, und die Leute schrieben diese Erscheinung dem Umstande zu, daß die Gemsen eine längere Tragzeit haben als die Ziegen. Solche Bastardthiere bleiben auch später arm an Haaren und sind gegen Kälte empfindlich, darum auch hinfällig. Sehr selten bleiben sie am Leben. Diese beiden aber sind unter der sorgfältigen Pflege des Jakob Pool aus Schwüringen, welcher sie kaufte, nun schon mehr als ein Jahr alt geworden und gesund und munter geblieben. Beide sind sehr eigenthümliche Thiere; namentlich der Bock ist beachtenswerth. Sein Stammbaum ist unverkennbar, ganz besonders am schwarzen, fast unbehaarten Kopfe mit dem lebhaften, dunklen Augenpaare. Die Hörner sind ziegenartig, groß und dunkel. In allem übrigen verräth der Kopf auf den ersten Blick die stolze Gemsnatur. Die Bastardgeis unterscheidet sich wenig von der Ziege, ist unten am Bauche fast nackt und sonst im allgemeinen schlecht behaart. Der Bock zeigt sich auch sehr klug und macht seinem Pflegeherrn manchen Spaß. Des Morgens kommt er aus dem Stalle an das Hausthor, klopft mit dem Gehörn an, und wenn ihm nicht gleich aufgemacht wird, stößt er zur Abwechselung das Thor ein, wiederholt dann dasselbe Verfahren an der Stubenthüre, springt im Zimmer auf das Kanapee, zieht mit den Zähnen die Schublade des Tisches hervor und läßt sich das Brod schmecken. Für einen Thiergarten dürfte dieses Pärchen, welches trotz häufiger Beschläge des Bockes unfruchtbar geblieben, einen nicht geringen Werth haben.« Für unmöglich halte ich eine fruchtbare Vermischung von Gemse und Ziege zwar nicht, meine jedoch, daß derartige Angaben, so lange nicht unzweifelhafte, jede Täuschung ausschließende Beobachtungen vorliegen, immer mit dem entschiedensten Mißtrauen aufgenommen werden müssen.
Ungeachtet mancherlei Gefahren vermehren sich die Gemsen da, wo sie gehegt und nur in vernünftiger Weise beschossen werden, außerordentlich rasch; denn sie sind, wie der erfahrene Kobell sagt, das einzige Wild, welches von harten Wintern verhältnismäßig wenig leidet. Auf den steilen Gehängen, von denen der Schnee meist weggeweht wird, oder unter den Felsen und Schirmbäumen, welche ihn etwas abhalten, finden sie noch immer Aesung, während Hirsche und Rehe zu Thale getrieben werden und ohne künstliche Fütterung häufig erliegen. Eine Wildstandsübersicht aus Tegernsee vom Jahre 1800 weist nur zwanzig Gemsen auf, während im Jahre 1847 daselbst sechshundertundfünfzig Stück standen; ebenso befanden sich im Hohenschwangauer Leibgehege im Jahre 1828 nur etwa einhundert, im Jahre 1853 aber zwölf- bis fünfzehnhundert Gemsen. Dasselbe hat man überall beobachtet, wo man die Schonzeit strenge einhielt und willentlich nur Böcke abschoß. In dem bereits (Bd. I, S. 492) erwähnten Jagdgebiete des Fürsten Friedrich zu Liechtenstein standen im Jahre 1844 im ganzen nur noch acht alte Gemsen und einige Böcke, während gegenwärtig hier mindestens zweihundert Stücke Gemswild vorhanden sind und jährlich sechszehn bis zwanzig abgeschossen werden können. Diese Vermehrung hat jedoch, wie Kobell hervorhebt, ihre Grenze, insofern sie von der Oertlichkeit bedingt ist. Denn eine gewisse Anzahl Gemsen verlangt, wie jedes Wild, einen Standort von einer bestimmten Größe, und wenn ihrer zu viele werden, so verläßt der Ueberschuß den Platz und wechselt nach anderen Bergen.
Während des Sommers äst sich die Gemse von den besten, saftigsten und leckersten Alpenpflanzen, insbesondere von denen, welche nahe der Schneegrenze wachsen, außerdem von jungen Trieben und Schößlingen der Sträucher jener Höhen, vom Alpenröschen an bis zu den Sprossen der Nadelbäume; im Spätherbste und Winter dagegen müssen ihr das lange Gras, welches aus dem Schnee hervorragt, sowie allerlei Moose und Flechten genügen. Salz scheint ihr, wie den meisten anderen Wiederkäuern, unentbehrlich zu sein; Wasser zum Trinken dagegen bedarf sie ebensowenig wie andere Antilopen, da sie, ohne ihren Stand zu wechseln, auch auf vollkommen quellenlosen Gebirgsrücken lebt. Wahrscheinlich stillt sie ihren Durst durch Belecken der thaunassen Blätter zur vollständigen Genüge. Sie ist lecker, wenn sie es sein kann, und anspruchslos, wenn sie es sein muß, nimmt bei guter Aesung rasch an Feist und demgemäß beträchtlich an Umfang und Gewicht zu, magert aber auch bei dürftiger Aesung sehr bald wieder ab. Wenn tiefer Schnee den Boden deckt, hat auch sie oft Noth, um ihr Leben zu fristen; denn selbst in den niederen Waldungen findet sie nicht immer genügende Nahrung, obgleich sie sich unter allen Umständen tage- und wochenlang nur von den langen, bartartigen Flechten äst, welche von den unteren Aesten herabhängen. Um die Heuschober, welche man in einzelnen Alpengegenden im Freien aufstapelt, sammeln sich manchmal Rudel von Gemsen und fressen nach und nach so tiefe Löcher in die Schober, daß sie sich im Heue gleich gegen die Stürme decken können; auf anderen Oertlichkeiten dagegen, wo sie solche Heuschober nicht kennen, nimmt sie selbst im strengsten Winter kein Futter an, und leidet und kümmert. Tschudi hält es für unwahrscheinlich, daß Gemsen im Winter verhungern; erfahrene Jäger aber wissen nur zu gut, daß ein strenger Winter innerhalb nicht allzu ausgedehnter Gebiete oft dutzenden und selbst Hunderten von ihnen das Leben raubt. In dem zwanzigtausend österreichische Joch umfassenden Jagdgehege um Wildalpen in Obersteiermark, dessen Jagdrecht gegenwärtig dem Fürsten Hohenlohe und dem Grafen Wilczek gehört, gehen in jedem Winter durchschnittlich vierzig Gemsen ein; in dem überaus schneereichen Winter des Jahres 1874/75 dagegen wurde hier die dreifache Anzahl verendeter und zweifellos verhungerter Stücke gefunden. So arg wie das Hochwild, welches hier, durch Mangel entkräftet und entmuthigt, bis an die Häuser kam und in die Viehställe eingetrieben werden konnte, litten sie freilich nicht, immerhin aber so bedeutend, daß einzelne Theile des Jagdgebietes jahrelang unbedingte Schonung erfordern dürften, bis alle Verluste ersetzt sein werden.
Außer dem Mangel, welchen der Winter mit sich bringt, bedroht er die Gemsen auch noch durch Schneelawinen, welche zuweilen ganze Gesellschaften von ihnen begraben. Die Thiere kennen zwar diese Gefahr und suchen Stellen auf, wo sie am sichersten sind; das Verderben aber ereilt sie doch. Auch herabrollende Steine und Felsenblöcke erschlagen gar manche von ihnen; Krankheiten und Seuchen räumen ebenfalls unter ihnen auf, und eine Reihe von Feinden, namentlich Luchs, Wolf und Bär, Adler und Bart- oder Lämmergeier, sind ihnen beständig auf der Ferse. Luchse lauern ihnen im Winter in den Wäldern auf und richten oft große Verheerungen unter ihnen an; Wölfe folgen ihnen namentlich bei tiefem Schnee nach, und Bären beängstigen sie wenigstens in hohem Grade. Im Engadin soll es geschehen sein, daß ein Bär einer Gemse bis in das Dorf nachlief, in welchem sie sich in einen Holzschuppen rettete. Adler und Bartgeier gefährden sie nicht minder, da sie sich wie ein Blitz aus heiterem Himmel auf sie herniederstürzen, junge Kitzchen ohne weiteres vom Boden aufnehmen und ältere trotz deren Abwehr in den Abgrund zu stoßen suchen. Zu diesen in den gehegten Gebieten glücklicherweise fast ausgerotteten Verfolgern gesellt sich als schlimmster Feind der Mensch überall da, wo nicht bestimmte Jagdgesetze oder Jagdgebräuche eine geregelte Schonung dieses edlen Wildes erstreben und gewährleisten. Der ungezügelte Sohn der freien Berge fragt freilich noch heutigen Tages wenig nach solchen Gesetzen, und deshalb sind die Gemsbestände auch allerorten, wo jedermann jagen darf, auf wenige Stücke beschränkt, während sie, wie wir gesehen haben, unter geordneter Pflege in erfreulicher Weise sich vermehren.
Von jeher galt die Gemsjagd als ein Vergnügen, würdig des besten Mannes. Maximilian, der große Kaiser Deutschlands, stieg mit Lust zu den gewandten Alpenkindern empor, kletterte ihnen selbst nach in Höhen, wo es, wie die Sage berichtet, eines Wunders bedurfte, um ihn wieder herab in die menschenfreundliche Tiefe zu führen. Nach ihm gab es wenige deutsche Fürsten, welche die Gemsenjagd mit gleicher Leidenschaft betrieben. Dann übten sie die Erzbischöfe aus und erließen Gesetze zur Hegung und Pflege des bereits seltener werdenden Wildes. Zur Zeit des Bezoaraberglaubens wurde ihm unbarmherzig nachgestellt. Dann trat gewissermaßen ein Stillstand von fast hundert Jahren ein. Unter den Großen der Erde griff erst der Erzherzog Johann von Oesterreich wieder zur Büchse; ihm folgten die Könige Bayerns und einige der deutschen Herzöge. Gegenwärtig ist die Jagd ein fürstliches Vergnügen geworden. Die gemsenreichsten Gebiete befinden sich im Besitze des Kaisers von Oesterreich, des Königs von Bayern, verschiedener Erzherzöge des kaiserlichen Hauses und reicher Edlen des österreichisch-ungarischen Kaiserstaates, werden durch tüchtige, meist inmitten der Reviere lebende Jäger überwacht und gewähren deshalb alljährlich ebenso anziehende als lohnende Jagden.
Der Liebenswürdigkeit des Grafen Hans von Wilczek danke ich mehrere genußreiche Tage in dem erwähnten Jagdgebiete um Wildalpen, bin dabei auch so glücklich gewesen, manchen guten Gemsbock zu erlegen; gleichwohl halte ich meine bei dieser Gelegenheit gesammelten Erfahrungen und Beobachtungen nicht entfernt für ausreichend, um über eine solche Jagd schreiben zu können, und ziehe es vor, einen alten, erfahrenen Jäger, dessen schlichten und doch ungemein anmuthenden Bericht ich Wort für Wort unterschreiben möchte, Franz von Kobell, für mich reden zu lassen.
»Ueber das Jagen der Gemsen«, sagt dieser treffliche Waidmann und Beobachter, »ist gar viel geschrieben worden, und manchmal hat einer, welcher kaum ein paar Jagden gesehen, die Feder ergriffen und je nach Stimmung und Erlebnissen diese Jagd zur gefährlichsten aller gemacht oder sie auch wieder in der Weise dargestellt, als wäre sie nicht viel mehr als ein Treiben auf Hasen und Rehe. Daß diese Jagd romantischer ist als die meisten anderen, liegt in der Natur des Gebietes, auf dem sie sich bewegt; was aber die Gefahren des Jägers betrifft, so kommt es auf die Art und Weise des Jagens und auf die Verhältnisse an, unter denen man jagt. Wer viele Gemsbirschen gemacht hat, wird schwerlich den Gefühlen inneren Grausens entgangen sein, wenn er über eine Wand oder durch eine Schlucht stieg und plötzlich über ihm ein Steingerumpel von flüchtigen Gemsen losging und kaum der Vorsprung eines Felsens den Leib zu decken vermochte, oder wenn er, einer angeschossenen Gemse nachsteigend, unversehens an Stellen kam, wo für das Mißlingen eines Schrittes oder Sprunges, welcher unvermeidlich gemacht werden mußte, die Folgen nur zu deutlich vor Augen lagen. Es ist dann ganz eigen, einem Steine nachzusehen, welchen der Fuß von der Wand löste, wie er gellend in die Tiefe fällt und auf dem Grunde steiler Gräben in weithin geschleuderte Trümmer zerschellt. Und nun bedenke man, daß gar oft ein Jäger den erlegten Bock von dem Platze, wo er verendete, nicht anders fortbringen kann, als indem er ihn auf den Rücken ladet und eine Wildschlucht hinuntersteigt oder quer durchs Felsengehänge, und das allein, ohne Gefährten, fern von aller Hülfe, auf sich selbst angewiesen, auf seine Gewandtheit und seinen Muth.
»Das Steigen will geübt sein. Wer z.+B. an einer Wand, an welcher überhaupt noch fortzukommen ist, in der Art herniedersteigen wollte, daß er mit dem Gesichte gegen die Wand, mit Händen und Füßen sich anklammernd, den Versuch machte, wie man auf einer Leiter herniedersteigt, der würde geradezu das Leben wagen, weil er die Stelle, wo er den Fuß setzen will, nicht sieht, sondern mit diesem nur fühlt und nicht weiß, was dann weiter kommt. Man hat in solchen Fällen sich niederzusetzen und sitzend mit den Händen zu halten, während man hinuntersieht und die Stellen erforscht, welche verläßlich scheinen, die Füße darauf niederzulassen, weil man nur so einen Plan des Weiterkommens entwerfen kann. Dabei ist die Büchse und der Stock oft sehr hinderlich, und muß man diesen manchmal hinunterwerfen, wenn er dadurch nicht verloren geht; man trennt sich aber nicht gern vom Stocke, welcher eine große Hülfe gewährt, und ist oft schlimm genug daran, wenn er einem an solchen Plätzen aus der Hand gleitet und abfährt. So lange man noch etwas anzufassen hat und nicht gezwungen ist, zu springen oder zu laufen, geht es noch gut; wenn aber das Anfassen nicht mehr möglich und man auf einem schiefen, schmalen Grate gehen oder durch eine Stelle in einem steilen Graben laufen oder darüber springen muß, dann ist es bedenklich: und doch soll man nicht viel darüber denken und keine Furcht haben. Es kommen Fälle vor, wo Gehen- und Rutschenwollen weit gefährlicher ist, als ein paar flinke Schritte zu machen, und derjenige, welcher darüber ängstlich ist, thut besser umzukehren, wobei freilich auch zuweilen das Umkehren noch schlimmer ist als das Weitergehen. Alles dies steigert oder mindert sich an Gefahr unter sonst gleichen Umständen, je nachdem man allein ist oder ein Jäger vorsteigt. In Gesellschaft eines solchen macht man Wege mit Leichtigkeit, welche drohend und schreckhaft herschauen, wenn man allein steigt. Es ist dabei nicht die Hülfe, welche der Jäger gewährt: denn dieser kann oft gar nichts helfen; aber es ist die erlangte Gewißheit, daß der Gang überhaupt zu machen, und es ist die Vorzeichnung des Weges, welchen man nehmen soll, was wesentlich ermuntert und forthilft. Steigeisen sind nur mit Vorsicht und vorzüglich auf Graslaanen zu gebrauchen; man verwöhnt sich aber leicht damit, und ich kenne ausgezeichnete Steiger, welche ein Eisen nur selten an den Fuß nehmen, außer auf gefrorenem Boden oder wo es schwer zu tragen gibt. Die Graslaanen sind übrigens nur zu scheuen, wenn sie sehr steil, vom Regen naß oder verschneit, oder auch wenn sie sehr trocken sind. Enden sie nach unten an einer Wand, so sind sie natürlich doppelt gefährlich; fällt man auf einer solchen und kommt auf den Rücken zu liegen, so ists vorbei, wenn man sich nicht sogleich auf den Bauch herumwirft und auf dem Rasen noch anklammern kann. Es ist in der That merkwürdig, wie wenig Unglücksfälle beim Steigen vorkommen; wenn sie aber vorkommen, so geschieht es selten bei Jagden, dagegen oft genug beim Brechen des verlockenden Edelweiß. An Stellen, wo die Gefahr augenscheinlich ist, geschieht auch weniger ein Unfall, weil man behutsam zu Werke geht. Außerdem wird leicht übersehen, daß beim Fallen und Abfahren ein Sichhalten nicht immer möglich und somit auch keine Rettung ist. Am gefährlichsten sind schief hängende Steinplatten, wo man die Schuhe ausziehen und in Strümpfen oder besser noch barfuß gehen muß.
»Es versteht sich nach dem Gesagten von selbst, daß man schwindelfrei sein muß, um fortzukommen. Gleichwohl kann sich unter Umständen eine Anwandlung von Schwindel einstellen. Ich habe wohl ein paar hundert Gemsjagden mitgemacht, wo zuweilen auch Lagen vorkamen, welche ich nicht gerade noch einmal erleben möchte, und ich kann mich nicht erinnern, während des Steigens oder Gehens an Gehängen schwindlich geworden zu sein; dagegen geschah mir dieses einige Male beim stundenlangen Sitzen an einer gefährlichen Stelle und beim fortgesetzten Hinunterschauen. Dann hilft ein Schluck Rum, Cognac oder dergleichen, aber es hilft auch der Anblick der nahenden Gemsen. Ich erinnere mich einer solchen Anwandlung, da mein Stand bei einem Treiben auf einem Keile zwischen steilen Gräben war, wo kaum noch genug Platz zum Sitzen. Nachdem ich fast drei Stunden da gesessen und den Schwindel fühlte, wollte ich einen anderen Stand nehmen, als plötzlich fünf Gemsen in den Graben hereinsprangen. Da war aller Schwindel weg: ich schoß einen guten Bock, und wohlgemuth sah ich ihm nach, als er stürzte und in den Graben hinunterkugelte.
»Man muß sich natürlich nicht vorstellen, daß Gemsen und Jäger immer an den Gehängen herumzukrabbeln haben wie die Fliegen an der Wand. Die Oertlichkeit ist oft so günstig, daß man ohne besondere Kunst und Mühe seine Beute erringt, besonders beim Treiben, wenn z. B. die Wechsel über einen Alpenweg gehen oder durch einen Waldgrund oder durch die Thalsohle selbst. Es gibt kaum eine Jagd, wo diese Verhältnisse mannigfaltiger und wechselnder wären.
»Einen guten Bock auf der Birsche zu schießen, hat immerhin seine Schwierigkeiten; aber wie der Zufall manche Birsche verdirbt, so begünstigt er auch wieder manche andere. Besonders die Jäger kommen bei den vielen Gängen, welche sie machen, oft da zum Schusse, wo sie gar nicht daran denken. Der Gang solcher Birschen ist mitunter ziemlich weitläufig. Da muß man am frühen Morgen von einem geeigneten Platze aus das Einziehen der Gemsen beobachten und sehen, wo der Bock sich niederthut, was gewöhnlich unter einer Wand auf einem Felsenvorsprunge geschieht, wo er eine schöne Aussicht hat. Wenn man nun weiß, wo er sich niedergethan, hat man sich vom Beobachtungsplatze möglichst ungesehen wegzubirschen und zu warten, bis die Sonne hoch genug steht, daß der Wind aufwärts zieht; dann steigt man über den Bock oft auf weiten Wegen und rutscht dann auf dem Bauche über die Wand, unter welcher er sich niedergethan hat, vorsichtig und die Büchse immer schußfertig, hinaus und schießt so liegend hinunter. Nun geschieht es aber nicht selten, daß man den in der Ruhe befindlichen Bock, ob man gleich an der rechten Wand ist, von oben nicht sehen kann, z.+B. wenn die Wand etwas überhängig, eine hinderliche Latsche (Knieholz) vorhanden ist etc. Dann hat man zu warten, bis der Bock zum Aesen freiwillig wieder aufsteht, oder man wirft einige Steinchen hinunter, um das Aufstehen zu veranlassen. Mancher beschwerliche Gang aber wird trotz aller Vorsicht umsonst gemacht.
»Je nach dem Wildstande werden nur starke Böcke oder auch Geisen und geringe Gemsen geschossen. Das Erkennen des Bockes ist mitunter schwer; wenn man aber Zeit zum Beobachten hat und ein gutes Fernrohr zur Hülfe nimmt, dann hat es keinen Anstand. An den stärkeren Krickeln und den mehr eingebogenen Enden derselben unterscheidet man den Bock ziemlich leicht von der Geis, und um so leichter, wenn er ein starker Bock ist. Kommt man nahe genug, so erkennt man wohl auch den Pinsel, welcher in wenigen langen Haaren besteht. Beim Treiben ist es schwer, und soll nur ein Bock geschossen werden, so kann man als Regel annehmen, eine einzeln kommende, starke Gemse immer zu schießen, wenn man an derselben nicht die dünnen und weniger eingebogenen Krickeln der Geis deutlich erkennt; denn im schlimmsten Falle schießt man dann eine Geltgeis, um die nicht viel Schade ist. Kommt aber ein Rudel, so muß man die letzten nach dem dickeren und kürzeren Halse und der mehr gedrungenen Gestalt, welche auch den Bock kennzeichnet, mustern, und es gehört ein geübtes Auge dazu, sich nicht zu täuschen. Man soll mit dem Schusse nicht eilen und, wenn die Gemsen flüchtig sind, überhaupt nur schießen, falls weiter keine Aussicht bleibt, sie zu bekommen. Außerdem aber ist der Augenblick zu benutzen, wo sie stutzen, und das geschieht öfters und kann auch durch Anpfeifen oder einen kurzen Ruf bewerkstelligt werden. Wenn man mit ihrer Art und ihrem Wesen bekannt ist und den Platz wohl angeschaut hat, so läßt sich fast mit Gewißheit bestimmen, wo sie stutzen werden, so daß man, während sie kommen, die Büchse gleich auf einen solchen Platz richten, gut zusammenschauen und sie abwarten kann.
»Die Art, wie die Gemsen beim Treiben kommen, ist sehr verschieden und bietet tausenderlei Bilder dar; denn die Gehänge, Gräben und Schluchten wechseln auf das vielartigste. Je nachdem sie nur den entfernten Lärm der Treiber hören und ihr Standort nicht zu tief im Bogen ist, steigen sie oft ganz vertraut auf eine hohe Kuppe und bleiben da, nach dem Treiben sich öfters hinwendend, wohl eine halbe Stunde oder länger, ehe sie weiter vorwärts gehen; kommt ihnen aber ein Treiber plötzlich zu Gesicht, so springen sie oft mit unglaublicher Geschwindigkeit einen Hang herunter und verschwinden in dem Graben, um dann an einer Scharte des Grates wieder zu erscheinen. An scharfen Wänden nimmt das Rudel, wenn es nicht beschossen wird, fast immer denselben Weg; über eine Kluft springt eines wie das andere, und manchmal geht es im Zickzack herunter ohne Aufhalten. In den Latschen verstecken sie sich gern, und es ist kaum zu begreifen, wie schnell sie durch ihre widerstrebenden und wirr sich deckenden Stämme und Aeste fortkommen können. Wenn der Wind gut ist, sind sie in der Regel leicht vorwärts zu treiben; Hauptsache aber bleibt es, daß sie den Treiber sehen, denn abgelassene Steine sprengen sie wohl auf, wenn sie nahe niederrasseln, bekümmern sie aber nicht viel. Sie wissen recht wohl, ob ihnen die Steine etwas anhaben können oder nicht; deckt sie also ein Felsenvorsprung, so bleiben sie trotz alles Steinregens, welcher darüber heruntergeht, ganz ruhig stehen. Wenn Nebel liegt, ist mit der Gemsjagd nur dann etwas auszurichten, wenn der Treiber sehr viele sind und diese geschlossen vorkommen können. Die Felsengrate bieten mancherlei enge Schluchten und Kamine, welche die Gemsen gern annehmen. Wenn sie in solchen ansteigen und der Schütze oben ist, sind sie leicht zu schießen. Es gibt Wechsel, wo die Rudel kommen, und andere, wo nur ein guter Bock kommt; man kann je nach den Umständen darüber ebenso sicher sein wie über einen guten Fuchsriegel. Die alten Böcke sind übrigens sehr schlau, und ich habe manchen in einen Graben hinaufsteigen sehen, während ein Treiber in einem ganz nahe daran gelegenen mit lautem Rufen und Pfeifen herniederstieg. Nicht selten verstecken sich die Gemsen so, daß sie erst unmittelbar vor den Treibern zum Vorschein kommen. Ist der Wind schlecht, so bringt sie nichts vorwärts. Wenn ein Rudel naht, kann man nicht selten mit Vergnügen beobachten, daß die Gemsen ein leichtsinniges Volk sind. Denn der Haupttrupp überläßt die Sorgen der anführenden Kitzgeis, und wenn diese anhält, um zu horchen und zu sichern, was zu thun ist, so stoßen und raufen sich oft die anderen, es wäre denn, daß ihnen das Treiben gar zu nahe gekommen.
»In Betreff der Entfernung, besonders über einen Graben hinüber, kann man sich sehr täuschen, und manche Gemse wird deshalb gefehlt. Als Regel gilt, daß es zum Schießen zu weit ist, wenn man die Krickeln nicht mehr sieht. Der beste Schuß ist freilich ein Blattschuß; es kommen aber oft Waidwundschüsse vor. Eine so angeschossene Gemse thut sich bald nieder; wird sie aber angegangen oder der Hund darauf gelassen, so geht sie fort und steigt meistens in eine Wand ein, wo der Hund nicht folgen kann; dann birscht man sich an und schießt sie von der Wand herunter. Im schärferen Gebirge kann man wegen des Abfallens keinen Hund gebrauchen, doch findet man hier gewöhnlich die Rothfährte leicht auf den grauen Steinen. Zuweilen ist es aber für den Jäger unmöglich, auf den Platz vorzudringen, wo die Gemse verendete, und sie muß verlassen werden und geht verloren.
»Je wilder die Gegend, desto schöner ist diese Jagd. In den hohen Gebirgsgürteln von Berchtesgaden, am Funtnsee, Simmelsberg etc. ist es wild und einsam genug, daß es zuweilen den Schein hat, als hätten manche Vögel, denen man begegnet, noch keinen Menschen gesehen; denn mit offenbarer Neugier umfliegen sie den auf dem Stande lauernden Schützen. Den herrlichen Karminspecht (Mauerläufer) hätte ich manchmal mit einem Schmetterlingsnetze leicht fangen können; die hell kreischenden Steindohlen mit den rothen Ständern stoßen sogar zuweilen auf das fremde Menschenwesen. Dabei gewährt es einen eigenthümlichen Reiz, Stellen zu betreten, von denen man wohl sagen kann, daß sie vorher nie ein menschlicher Fuß berührt. Wenn man nun an einem solchen Platze oft mehrere Stunden in mancherlei Betrachtungen weilt und wird plötzlich durch das Klingen und Sausen fallender Steine aufgeschreckt, und es steigt ein starker Bock ›schwarz wie der Teufel‹ herein über ein Eck und kommt am Gewänd herunter, immer näher und näher – wärs ein Wunder, wenn einen da das Jagdfieber befiele? Es befällt wohl manchen jungen Schützen, daß ihm die Zähne klappern! Gehts aber gut, und sitzt der Schuß am rechten Flecke, und der Bock stürzt durch Gestein und Alpenrosen in den Graben, während die Echos wiederhallen von Berg zu Berge – was soll ich schreiben, wie einem da wird? Nennt es einen materiellen Genuß, eine bedauerliche Grausamkeit, nennt es, wie ihr wollt, ihr Jagdbekrittler; wir anderen rufen freudig: ›es lebe das Waidwerk.‹
Das Wildpret der Gemse darf sich an Wohlgeschmack mit jedem anderen messen, übertrifft meiner Ansicht nach sogar das unseres Rehes, welches bekanntlich als das zarteste und schmackhafteste der einheimischen Wildarten gilt, noch bei weitem, da es sich durch einen würzigen, mit nichts zu vergleichenden Beigeschmack auszeichnet. Nur während der Brunstzeit soll es etwas bockig schmecken und an Ziegenfleisch erinnern, welches letztere, nachdem es eine besondere Beize durchgemacht hat, von den betriebsamen und erfindungsreichen Schweizer Gastwirten durchreisenden Fremden sehr oft als Gemsbraten aufgetischt wird. Fast ebenso werthvoll als das Wildpret ist die Decke, welche man zu vorzüglichem Wildleder verarbeitet. Auch die Hörner finden mancherlei Verwendung; die Haare längs der Rückenfirste endlich dienen als Hutschmuck ebensowohl der zünftigen Jäger wie jagdlustiger Sonntagsschützen, und wenn dieselben auch noch keine freilebende Gemse gesehen haben sollten.
Die Gemse spielt in der Volksdichtung unserer Alpenbewohner genau dieselbe Rolle, welche der Gazelle durch die Morgenländer zugesprochen wurde. Hunderte von Liedern schildern sie und ihre Jagd in ebenso treffender wie anmuthender Weise; mancherlei Sagen umranken ihre Naturgeschichte, so weit diese dem Volke zum Bewußtsein gekommen ist. Ein allgemein verbreiteter Aberglaube bestimmt den Jäger, das Herz des aufgebrochenen Wildes zu öffnen und das hier noch sich findende Blut zu trinken, in der Zuversicht, dadurch Muskeln und Sinne zu stählen und den gefürchteten Schwindel zu vertreiben; ein anderer Volksglaube schützt eine weiße Gemse vor dem tödtlichen Blei, weil derjenige, welcher eine solche erlegte, sein Leben stets durch einen Sturz in die Tiefe enden soll. Die Begriffe von Recht und Unrecht verwirren sich selbst in den klarsten Köpfen der ehrlichsten Gebirgsleute, wenn es sich um die Gemse handelt, und der Sohn der Alpen sieht in ihr noch heutigen Tages das ihm gehörende Eigenthum, das Wild, welches er jagt, wo es auch sei.
Jung eingefangene Gemsen lassen sich zähmen. Man ernährt sie mit Ziegenmilch, mit saftigem Grase und Kräutern, mit Kohl, Rüben und Brod. Wenn man gutartige Ziegen hat, kann man diesen das Pflegeelterngeschäft anvertrauen. Dabei gedeihen die kleinen, heiteren Gebirgskinder nur um so besser. Lustig spielen sie mit dem Zicklein, keck und munter mit dem Hunde; traulich folgen sie dem Pfleger, freundlich kommen sie herbei, um sich Nahrung zu erbitten. Ihr Sinn strebt immer nach dem Höchsten. Steinblöcke in ihrem Hofe, Mauerabsätze und andere Erhöhungen werden ein Lieblingsort für sie. Dort stehen sie oft stundenlang. Sie werden zwar nie so kräftig wie die freilebenden Gemsen, scheinen sich aber ganz wohl in der Gefangenschaft zu befinden. Bei manchen bricht im Alter auch eine gewisse Wildheit durch; dann gebrauchen sie ihre Hörnchen oft recht nachdrücklich. Ihre Genügsamkeit erleichtert ihnen die Gefangenschaft. Im Alter zeigen sie sich noch weniger wählerisch hinsichtlich ihrer Nahrung als in der Jugend. Abgehärtet sind sie von Mutterleibe an. Im Winter genügt ihnen ein wenig Streu unter einem offenen Dächlein. Sperrt man sie in einen Stall, so behagt es ihnen hier nicht; einen Raum zur Bewegung und frisches Wasser müssen sie unbedingt haben. Alt eingefangene bleiben immer furchtsam und scheu.
Selten entschließen sich die Gemsen in der Gefangenschaft zur Fortpflanzung, und wenn sie es wirklich thun, hat der Pfleger mit der größten Sorgfalt zu verfahren, um den Bock im Zaume zu halten. Laut Tschudi erhielt Laufer 1853 von seiner zahmen Gemsziege ein Junges, welches bald nach der Geburt starb, im Mai 1855 aber ein zweites, gesundes und munteres Thierchen. Im Jahre 1863 hatte Schöpff die Freude, seine gefangenen Gemsen zur Paarung schreiten zu sehen, und am 30. Juni bemerkte er, daß sich bei der hochbeschlagenen Geis Geburtswehen einstellten. Da die Geburt schwer von statten ging, wurde ärztliche Hülfe in Anspruch genommen und durch dieselbe ein junger gesunder Bock zur Welt gebracht. Die alte Gemse verhielt sich ganz ruhig dabei; kaum aber waren beide, Mutter und Böckchen, auf den Beinen, so stieß erstere gewaltig nach dem Kleinen und würde dasselbe getödtet haben, hätte man es nicht schleunigst entfernt. Höchst wahrscheinlich zeigte sich die Gemse nur aus dem Grunde so wenig mütterlich, weil das Junge sogleich nach der Geburt von menschlicher Hand berührt worden war. Das Thierchen erhielt eine Ziege zur Pflege, gedieh und wuchs so rasch heran, daß es bereits nach anderthalb Jahren fast ebenso groß wie die Mutter war. Die alte Gemse setzte ein Jahr mit der Brunst aus und verlangte erst im folgenden den Bock wieder. Letzteren mußte man, weil er sehr kräftig und böse war, von Mutter und Sohn getrennt halten, durfte ihn auch nur unter strengster Aufsicht zu der Geis bringen, da er dieselbe, wenn sie ihn nicht annehmen wollte, wüthend verfolgte, mit den Hörnern unterfuhr und sie ohne Dazwischentreten der Wärter unzweifelhaft stark verletzt haben würde. Elf Tage nach einander stand Schöpff mit seinen Wärtern, alle mit Stöcken bewaffnet, in dem Gehege der Thiere, um im geeigneten Augenblicke den in hohem Grade erregten Bock von der beabsichtigten Mißhandlung abzuhalten. Erst nach Verlauf dieser Zeit ging die Paarung ohne Zwischenfälle vor sich. Im folgenden Jahre pflanzten dieselben Thiere wiederum sich fort. In Schönbrunn hat man ebenfalls Gemsen gezüchtet.
Von allen bekannten Antilopen weicht die im Nordosten unseres Erdtheils häufige Steppenantilope oder Saiga, Saigak der Russen, Gorossun der Kalmücken ( Colus tataricus, Antilope Saiga und scythica, Capra und Saiga tatarica, Ibex imberbis), durch wesentliche Eigenthümlichkeiten so erheblich ab, daß man sie mit Fug und Recht als Vertreter einer besonderen Sippe ansieht. Sie erinnert in Gestalt und Wesen an das Schaf, in gewisser Beziehung aber auch wieder an das Ren. Ihre Gestalt ist sehr plump, der Leib dick und gedrungen, auch verhältnismäßig niedrig gestellt, da die Läufe wohl schlank, aber nicht hoch sind, das Fell außerordentlich langhaarig und so dicht, daß es eine glattwollig erscheinende Decke bildet. Mehr als durch jedes andere Merkmal aber zeichnet sich die Saiga durch die Gestaltung ihrer Schnauze und insbesondere durch die Bildung ihrer Nase aus. Die Schnauze ragt über die Kinnlade vor, ist von der Stirn an zusammengedrückt, durch eine Längsfurche getheilt, knorpelhäutig, in Runzeln zusammenziehbar und deshalb sehr beweglich, an der abgestutzten Spitze von runden, am Rande behaarten, in der Mitte nackten Nasenlöchern durchbohrt, so daß das Ganze einen förmlichen Rüssel bildet und man deshalb der Gruppe den Namen »Rüsselantilopen« geben könnte. Die Hörner des Bockes, welche etwas entfernt von einander über der Augenhöhle stehen, sind leierförmig, unten mit etwas verwischten Ringen gezeichnet und gestreift, an der Spitze verdünnt und glatt, blaß von Farbe und durchscheinend. Die großentheils im Pelze versteckten Ohren sind kurz, stumpf, im Umrisse rauh, innen mit lockeren Zotten bekleidet; die mittelgroßen, weit hinten in sehr vorstehenden Augenhöhlen gelegenen Augen haben fast nackte Lider, oben volle, unten nur in der Mitte dicht stehende Wimpern, länglichen Stern und braungelbe Iris. Die Thränengruben, welche sich unten in einiger Entfernung von den Augenwinkeln befinden, sind weit, ihre Oeffnungen aber sehr eng, werden von einem Hofe umgeben und strotzen von einer bockig riechenden Salbe. Die außen weißgrau behaarten, oben am platten Rande schwarzfleckigen Lippen sind durch eine Furche gespalten. Am Halse steht der Kehlkopf etwas vor, ohne jedoch einen eigentlichen Kropf zu bilden. Die schlanken Gliedmaßen sind etwas einwärts gedreht, die Vorderhufe kurz, hinten von schwieliger, gewölbter Fersenhaut umgeben und vorn dreieckig, die hinteren ähnlich gestaltet, aber spitziger; die kleinen und stumpfen, an den hinteren Füßen dickeren Afterklauen stehen entfernt von dem Hufe. Der Schwanz ist kurz, an der Wurzel ziemlich breit, unten nackt, außen mit aufrechten, nach der Spitze hin längeren Haaren besetzt. Tief ausgehöhlte Leistengruben, welche hinten durch eine Falte vom Beutel nach der Hüfte zu begrenzt werden, sondern ebenfalls eine stark riechende Salbe ab. Das Weibchen ist hornlos und trägt ein zweizitziges Euter. Im Sommer erreicht das kurze Haar höchstens 2 Centim. an Länge, wogegen es im Laufe des Spätherbstes bis zu 7 Centim. und darüber nachwächst. Rücken und Seiten sehen des Sommers graugelblich, die Gliedmaßen unter dem Knie dunkler, Hals- und Unterseiten des Rumpfes sowie die inneren Seiten der Läufe weiß, Stirn und Scheitel gelbgrau oder aschgraulich aus; ein lanzettförmiges Rückenmal in der Kreuzgegend, welches mit gröberen und längeren Haaren besetzt ist, hat schwärzlichbraune Färbung. Gegen den Winter hin lichtet sich die Decke, und das Thier erhält dann ein blasses, graugelbliches, nach außen hin weißliches Haarkleid. Bei den Jungen ist das Haar sehr weich, über den Scheitel und bis zum Mittelrücken hin bei neugeborenen Lämmern krauswollig, seine Färbung graulicher als bei den Alten, auf Scheitel und Rücken fast schwarzbraun. Die Länge des erwachsenen Bockes beträgt 1,3 Meter, wovon 11 Centim. auf den Schwanz zu rechnen sind, die Höhe am Widerriste kaum 80 Centim., die Länge der Hörner eines ausgewachsenen Bockes der Krümmung nach gemessen 25 bis 30 Centim.
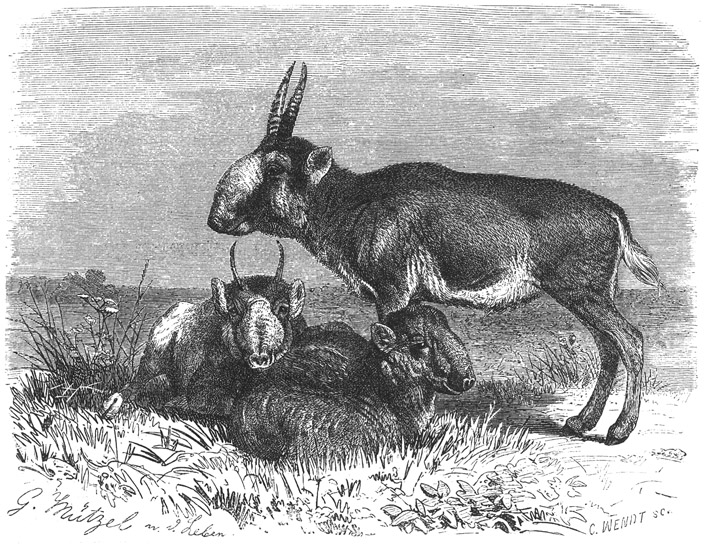
Steppenantilope (Colus tataricus), jung. 1/12 natürl. Größe.
Die Saiga bewohnt die Steppen Osteuropas und Sibiriens, von der polnischen Grenze bis zum Altai. Von den südlichen Donauländern und von den Karpaten an begegnet man ihr in den Steppen des südöstlichen Polen, in Kleinrußland längs des Schwarzen Meeres, um die kaukasischen Gebirge, das Kaspische Meer und den Aralsee bis zum Irtisch und den Ob, nach Norden hin bis zum 55. Breitengrade. Sie lebt stets in Gesellschaften, sammelt sich mit Beginn des Herbstes aber in Herden von mehreren tausend Stück, welche ziemlich regelmäßig wandern und erst gegen das Frühjahr hin rudelweise nach ihren früheren Standorten zurückkehren Aeußerst selten sieht man eine einzelne Steppenantilope; denn auch während des Sommers halten sich die alten Böcke zur Herde. Eine solche stellt unter allen Umständen Wachen auf; wenigstens beobachtete Pallas, dem wir bis jetzt die einzigen ausführlichen Nachrichten über das Freileben dieser Thiere verdanken, daß niemals alle auf einmal ruhten, sondern einzelne stets weideten und sicherten, während die anderen wiederkäuend am Boden lagen, sich auch keines von ihnen zur Ruhe begab, ohne vorher ein anderes Stück durch ein eigenthümliches Zunicken und ein nicht minder absonderliches Entgegenschreien zum Aufstehen eingeladen oder zur Ablösung bestimmt zu haben. Erst wenn dieses sich erhob und die Wache übernahm, legte jenes sich nieder. Ungeachtet dieser Vorsicht kann man nicht sagen, daß die Saigas besonders begabte Thiere wären. Sie bethätigen nur geringe Gewandtheit, durchschnittlich nicht eben scharfe Sinne und unbedeutende geistige Fähigkeiten. Erwachsene laufen zwar so schnell, daß weder Pferde noch Windhunde sie einholen können, jüngere werden aber leicht athemlos, und auch die älteren fallen vereinten Anstrengungen der Raubthiere, beispielsweise der Wölfe, bald zur Beute. Ihr Gang ist querbeinig, und sieht deshalb nicht anmuthig aus, weil sie den Hals weit vorstrecken und den Kopf niederhängen lassen; die Sprünge greifen zwar ziemlich weit aus, erinnern aber kaum noch an die zierlichen Sätze anderer Antilopen, sind vielmehr plump und ungeschickt. Unter ihren Sinnen steht der des Geruches obenan, denn man bemerkt, daß sie vorzüglich winden; das Gesicht hingegen scheint sehr schwach zu sein, denn sie laufen bisweilen, von der Sonne geblendet, auf Wagen zu oder sehen sich angesichts eines Feindes unentschlossen und blöde um, als ob sie den Gegenstand nicht zu erkennen vermöchten. Auch von dem Verstande dieser Thiere läßt sich schwerlich etwas rühmliches sagen. Sie sind scheu, wie alle Steppenthiere, aber keineswegs überlegend klug und wissen sich bei wirklichen Gefahren selten in verständiger Weise zu helfen. Auch unterscheiden sie kaum zwischen ihren gefährlichen Feinden oder anderen harmlosen Thieren, geben sich vielmehr, sobald sie ein fremdes Wesen gewahren, sofort auf die Flucht, laufen zuerst zusammen, sehen sich zagend um und fliehen dann lautlos in einer langen Reihe, selbst auf der Flucht noch beständig hinter sich blickend. Der Bock geht in der Regel voran, doch übernimmt auch ein Altthier zuweilen die Leitung. Eine Stimme vernimmt man nur von den Jungen, welche wie Schafe blöken; die Alten sind immer still.
Die Aesung der Saiga besteht vorzugsweise aus Salzkräutern, welche die sonnigen, dürren, von Salzquellen öfters unterbrochenen tatarischen Steppen hier und da in ungeheuren Massen bedecken. Nach Pallas sollen die Thiere nur rückwärts gehend und immer von der Seite weiden, weil ihnen die vorhängende Nase verwehrt, anders sich zu äsen. Ebenso sollen sie beim Trinken das Wasser nicht allein durch den Mund, sondern auch durch die Nase einschlürfen. Beide Angaben, von denen die letztere schon von Strabo herrührt, sind, wie selbstgepflegte Gefangene mir bewiesen haben, gänzlich aus der Luft gegriffen. Wohl infolge der eigenthümlichen Nahrung erhält das Wildpret der Saiga einen scharfen balsamischen Geruch, welcher wenigstens den Neuling derartig anwidert, daß er nicht im Stande ist, es zu genießen. Die Steppenbewohner behaupten, daß die Salzpflanzen den Thieren ungewöhnliche Kräfte verleihen, insbesondere die Böcke befähigen, eine erhebliche Menge von Riken, zwanzig bis dreißig an der Zahl, geschlechtlich zu befriedigen: daß diese Ansicht eine irrige ist, bedarf wohl kaum des Beweises, da bekanntlich auch andere Wiederkäuer dasselbe vermögen wie gedachte Antilopen. Die Böcke treten gegen Ende November auf die Brunst, kämpfen unter sich lebhaft um die Riken, treiben eine Menge von ihnen zusammen und beschlagen sie dann; die Riken gehen bis zum Mai tragend und setzen um diese Zeit, gewöhnlich schon vor der Mitte des Monats, ein einziges, anfänglich sehr unbehülfliches Junge.
Ungeachtet des schlechten Wildprets jagen die Steppenbewohner Saigas mit Leidenschaft. Man verfolgt sie zu Pferde und mit Hunden und holt sie in der Regel ein, wenn sie weit flüchten müssen. Wie einigen anderen Antilopen werden ihnen manchmal unbedeutende Wunden gefährlich. Die Kirgisen hauen Pfade in das Steppengras und Schilf, schneiden hier die Halme bis zu einer gewissen Höhe ab und treiben sodann zu Pferde Herden von Saigas hinein; diese verletzen sich an den scharfen Spitzen des Rohres und erliegen den Verwundungen. Häufiger erlegt man sie mit dem Feuergewehr, und hier und da fängt man sie mit Beizvögeln. Zu diesen nimmt man auffallenderweise nicht Edelfalken, sondern Steinadler, welche von Haus aus zu den gefährlichsten Feinden der Antilopen gehören und willig und gern der ihnen angeborenen Jagdlust folgen. Auch Wölfe richten arge Verwüstungen unter jenen an, reißen oft ganze Rudel nieder und fressen die getödteten bis auf Schädel und Gehörn auf. Letzteres sammeln dann die Kirgisen oder die Kosaken und verkaufen es wohlfeil nach China. Und noch ist die Zahl der Feinde nicht erschöpft. Eine Dassel- oder Biesfliegenart legt ihnen Eier in die Haut, oft in solcher Menge, daß die auskriechenden Maden brandige Geschwüre verursachen und das Thier umbringen.
Jung aufgezogene Steppenantilopen werden sehr zahm, folgen ihren Herren wie Hunde, selbst schwimmend durch die Flüsse, fliehen vor wilden ihrer Art und kehren des Abends aus freien Stücken wieder in ihren Stall zurück. Durch Vermittelung des Thiergartens in Moskau, neuerdings durch die Bemühungen des Thierhändlers Stader daselbst, sind Saigas wiederholt auch nach Deutschland gebracht worden und gehören gegenwärtig in unseren Thiergärten nicht eben zu den Seltenheiten. Nach Staders mündlichen Mittheilungen fängt man sie wenige Stunden nach der Geburt ein und läßt sie so lange von Ziegen und Schafen bemuttern, bis sie selbständig fressen und die weite, beschwerliche Reise aushalten können. Nachdem sie etwa ein Jahr alt geworden sind, versendet man sie weiter. Diese jungen Thiere haben ein durchaus eigenthümliches Aussehen und erinnern, wie bemerkt, ebenso an Renthiere wie an Schafe. Ihre Bewegungen sind aber entschieden antilopenartig. Gewöhnlich gehen sie einen ruhigen, regelmäßigen Paß; derselbe wird jedoch oft durch einige rasche Sprünge unterbrochen, welche sie ziemlich hoch in die Luft schnellen. Sie weiden, wie andere Wiederkäuer ruhig vorwärts gehend. Ihre Beutelnase ist dabei in beständiger Bewegung und schleift dicht über den Boden dahin. Gegen Witterungseinflüsse zeigen sie sich vollkommen unempfindlich, bleiben auch in den kältesten Nächten gern in ihrem Gehege, ohne ihren Stall zu betreten, und liegen am Morgen, dick mit Reif belegt oder selbst mit Schnee bedeckt, anscheinend höchst behaglich auf derselben Stelle, auf welcher sie sich niederließen. Das Niederthun selbst geschieht niemals ohne einige Umstände: sie suchen vorher erst lange nach einem passenden Platze, drehen sich über demselben einige Male herum und lassen sich dann erst auf die Vorderkniee und schließlich auf den Leib nieder. Die von mir gepflegten Saigas fraßen von allem geeigneten Futter, welches ich ihnen reichen ließ, waren, wie die meisten übrigen Antilopen, ungemein begierig auf Salz und nahmen außerdem täglich eine ziemlich bedeutende Menge von Erde zu sich. Ihre Losung ähnelt der unserer Ziegen und Schafe.
Obwohl die von mir gepflegten und sonstwie beobachteten Saigas binnen kurzer Zeit mit ihrem Wärter sich befreundet hatten und sehr zahm geworden waren, gelang es doch bloß bei sehr wenigen, sie jahrelang am Leben zu erhalten. Hieran war nur in einzelnen Fällen die ihnen vielleicht nicht ganz zusagende Nahrung, viel häufiger ihre geringe geistige Begabung schuld; denn die meisten, welche zu Grunde gingen, verendeten infolge ihrer Schreckhaftigkeit oder Ungeschicklichkeit, indem sie, durch irgend ein ungewöhnliches Vorkommnis erregt, plötzlich wie unsinnig gegen die ihnen doch wohlbekannten Gitter stürmten und dabei sich das Genick brachen oder zwischen den Gitterstäben sich erhängten. Jede andere mir bekannte Antilope, ja jedes Schaf benimmt sich klüger, jeder Wiederkäuer lernt leichter den ihm angewiesenen Raum kennen und die Gefahren desselben meiden als die Saiga. Der erste Eindruck, welchen sie auf den Beschauer macht, ist kein günstiger; denn sie erscheint dem Beobachter sofort als ein in hohem Grade geistloses und dummes Wesen, und ihr Benehmen straft diesen Eindruck nicht Lügen.
Wohl die auffälligsten aller Antilopen sind die Gnus ( Catoblepas), höchst absonderliche Wiederkäuer, Mittelglieder, falls man so sagen darf, zwischen Antilope, Rind und Pferd, wahre Zerrbilder der edlen und zierlichen Gestalten ihrer Familie. Man bleibt im Zweifel, welches Geschöpf man eigentlich vor sich hat, wenn man ein Gnu zum erstenmale ansieht. Das Thier erscheint als ein Pferd mit gespaltenen Hufen und einem Stierkopfe, und es beweist durch sein Betragen, daß sein ganzes Wesen mit dieser Zwittergestalt bestens im Einklange steht. Unmöglich kann man das Gnu ein schönes Thier nennen, so zierlich auch der Bau mancher einzelnen Theile sein mag.
Die Merkmale der artenarmen Gruppe der Gnus sind folgende. Der auf mäßig hohen, schlanken Läufen ruhende Leib ist gedrungen, vorn merklich höher gestellt als hinten, der Kopf fast viereckig, die Muffel breit wie bei den Rindern, das Nasenloch wie gedeckelt, das wie von einem Sternenkranze weißer Borsten kreisartig umgebene Auge von wildem und bösartigem Ausdrucke, das Ohr klein und zugespitzt, das Gehörn, welches beide Geschlechter tragen, auf der Stirnleiste aufgesetzt, platt gedrückt, sehr breit, narbig, seitlich abwärts und mit den Spitzen aufwärts gebogen, der Schwanz lang bequastet wie ein Roßschweif, die Gesichtsfirste, der Hals, Rücken, die Kehle und Wange stark bemähnt, das Haar übrigens glatt anliegend. Im Innern der Nasenlöcher befindet sich eine bewegliche Klappe; auf der Wange stehen an Stelle der fehlenden Thränengruben drüsige Warzen.
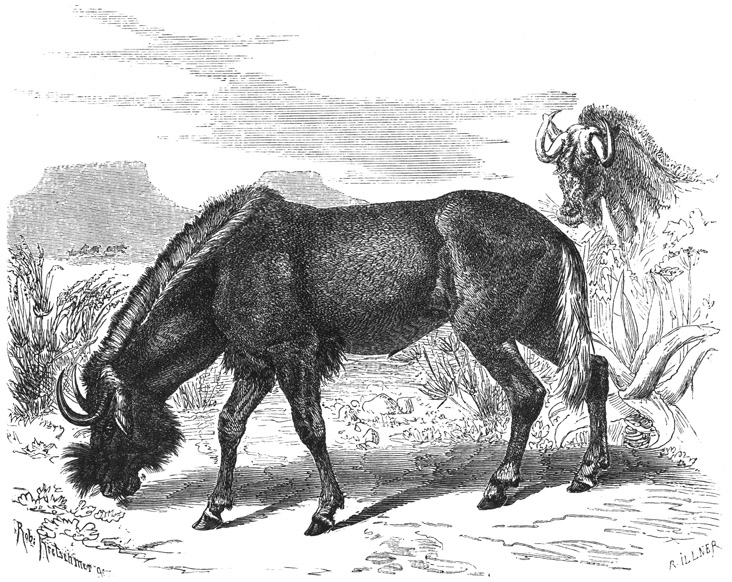
Gnu ( Catoblepas Gnu). 1/18 natürl. Größe.
Das Gnu oder Wildebeest, d. h. Wildochse, der Ansiedler des Vorgebirges der Guten Hoffnung, Impatumo der Matabili ( Catoblepas Gnu, Antilope und Bos Gnu, Bos connochaetes), erreicht eine Gesammtlänge von 2,8 Meter, einschließlich des Schwanzes, welcher ohne Haar 50 Centim., mit den Haaren aber 80 bis 90 Centim. mißt, bei 1,2 Meter Schulterhöhe. Die vorherrschende Färbung ist ein dunkles Graubraun, welches an manchen Stellen heller, an manchen dunkler erscheint und bald mehr ins Gelbe oder Röthliche, bald mehr ins Schwärzliche zieht; die Nackenmähne sieht weißlich aus, weil die Haare derselben an der Wurzel grauweiß, in der Mitte schwarz und an der Spitze röthlich sind; dagegen haben Brust- und Halsmähne, die Haarbüschel auf dem Nasenrücken und unter dem Auge braune, die Borstenhaare um die Augen, die Schnurborsten, der Kinnbart und das Schweifhaar weißliche, die Haare der Schwanzruthe an der Wurzel graubraune und an der Spitze weißliche Färbung. Das Weibchen ist kleiner und sein Gehörn leichter, seine Färbung der des Männchens vollkommen gleich. Jung geborene Kälber haben noch kein Gehörn, aber schon die Hals- und Nackenmähne.
Das Gnu bewohnt Südafrika bis gegen den Gleicher hin. Früher im Kaplande häufig, sind diese Antilopen dort jetzt ausgerottet, so weit der Europäer vorgedrungen ist; im Lande der Hottentotten und Kaffern dagegen finden sie sich noch in zahlreicher Menge. Nach den Angaben glaubhafter Beobachter wandern sie alljährlich, nach der Meinung A. Smiths, wie die Vögel, aus angeborenem Wanderdrange, welcher sie zwingt, blindlings ihrem Geschicke entgegenzugehen, selbst wenn dieses ihr Verderben sein sollte, nach unserer Ansicht, wie die übrigen Antilopen, aus Mangel an Weide. Es sind höchst bewegliche, muthwillige Thiere, welche es meisterhaft verstehen, die weiten Ebenen zu beleben. »Unter allen Thieren«, sagt Harris, »erscheint das Gnu als das ungeschickteste und das absonderlichste, ebensowohl was sein äußeres Ansehen als was seine Sitten und Gewohnheiten anlangt. Die Natur hat es in einer ihrer Launen gestaltet, und es ist kaum möglich, seine ungeschickten Geberden ohne Lachen zu betrachten: nach allen Richtungen hin sich schwenkend und beugend, das zottige und bebartete Haupt zwischen die schlanken, muskelkräftigen Glieder herabgebogen, den langen, weißen Schwanz dem Winde preis gebend, macht dieses possenhafte und stets scheue Thier gleichzeitig einen ebenso wilden als lächerlichen Eindruck. Plötzlich steht es still, gibt sich den Anschein, als ob es sich vertheidigen wolle, und legt das bärtige Haupt zum Stoße zurecht: sein Auge scheint Blitze zu sprühen, und sein Grunzen, welches an das Brüllen des Löwen erinnert, erschallt mit Kraft und Ausdruck; dann plötzlich wieder peitscht es die Seiten mit dem langen Schwanze, springt, bäumt und dreht sich, fällt auf die Fesselgelenke nieder, erhebt sich und saust einen Augenblick später über die Ebene dahin, daß der Staub hinter ihm in Wolken aufwirbelt.« So lernt es jeder Reisende kennen, welcher das Innere Südafrikas betritt; denn es ist neugierig im höchsten Grade und nähert sich absichtlich jedem Gegenstande, welcher seine Aufmerksamkeit erregt, namentlich aber dem sich zeigenden Menschen. Gesellig, lebhaft und ungemein rastlos, weder an Wasser, noch an Gras, noch an Schatten gebunden, wandert es je nach der Jahreszeit von einem Platze zum anderen, und der Reisende begegnet deshalb ihm fast allerorten in großen Herden, regelmäßig in Gesellschaft des Quaggas und des Springbocks, welche mit ihm gemeinsame Verbände bilden. Eine solche Herde ist in ununterbrochener Bewegung, weil die Gnus kaum der Ruhe bedürfen und sich beständig in den tollsten Possen gefallen. Zuweilen geschieht es, daß der Reisende zwischen ihren Herden förmlich Spießruthen laufen muß, da sie mit neckischen Sprüngen, immer in einer gewissen Entfernung sich haltend, den Menschen umgehen und ihn gleichsam verhöhnen zu wollen scheinen.
Gordon Cumming erfuhr, daß das Wildebeest auch dann nicht den Platz verläßt, wenn es von einer größeren Anzahl von Jägern getrieben wird. In endlosen Ringen umherkreisend, die merkwürdigsten und sonderbarsten Sprünge ausführend, umlaufen die zottigen Herden dieser sonderbar und grimmig aussehenden Antilopen ihre Verfolger. Während diese auf sie zureiten, um diese oder jene zu erlegen, umkreisen sie rechts und links die anderen und stellen sich auf dem Platze auf, über welchen die Jäger wenige Minuten vorher hinwegritten. Einzeln und in kleinen Trupps von vier bis fünf Stück sieht man zuweilen die alten Wildebeestböcke in Zwischenräumen auf der Ebene einen ganzen Vormittag regungslos stehen und mit starren Blicken die Bewegungen des anderen Wildes betrachten, wobei sie fortwährend ein lautes, schnaubendes Geräusch und einen eigenthümlichen kurzen, scharfen Schneuzer von sich geben. Sobald sich ein Jäger ihnen naht, beginnen sie, ihre weißen Schwänze hin und her zu schleudern, springen dann hoch auf, bäumen sich und folgen einander in gewaltigen Sätzen mit der größten Schnelligkeit. Plötzlich machen sie Halt, und zuweilen fangen zwei dieser Stiere einen furchtbaren Kampf an. Mit vieler Kraft gegen einander rennend, stürzen sie auf die Kniee nieder, springen jählings wieder auf, rennen im Kreise umher, wedeln auf höchst bewunderungswürdige Weise mit dem Schwanze und jagen, in eine Staubwolke gehüllt, über die Ebene.
Mehrere Reisende nennen das Gnu ein Bild unbegrenzter Freiheit und schreiben ihm Stärke und Muth im hohen Grade zu. Die Hottentotten und Kaffern erzählen viele Fabeln, und selbst Europäer lassen sich, wahrscheinlich durch die abenteuerliche Gestalt des Thieres bestochen, verleiten, die sonderbarsten Dinge von ihm zu berichten. So viel ist sicher, daß das Gnu in seinem Betragen ebensoviel räthselhaftes hat wie in seiner Gestalt. Die Bewegungen sind eigenthümlich. Das Gnu ist ein entschiedener Paßgänger und greift selbst im Galopp noch häufig mit beiden Füßen nach einer und derselben Seite aus. Alle seine Bewegungen sind rasch, muthwillig, wild und feurig. Dabei zeigt es eine Neck- und Spiellust wie kein anderer Wiederkäuer. Wenn es ernste Kämpfe gilt, beweisen die Böcke denselben Muth wie die Ziegen. Ihre Stimme ähnelt dem Rindergebrüll. Die holländischen Ansiedler übersetzen das eigenthümliche Geschrei jüngerer Thiere mit den Worten: »Nonja, gudtn avond« oder »Jungfrau, guten Abend!« und behaupten, oft vom Gnu getäuscht worden zu sein, so deutlich habe es in ihrer Sprache sie angeredet.
Die Sinne, zumal Gesicht, Geruch und Gehör, sind vortrefflich; die geistigen Fähigkeiten dagegen scheinen gering zu sein. Die Spiele haben mehr etwas verrücktes und tolles als etwas vorherbedachtes an sich. In der Gefangenschaft zeigt sich das Gnu oft unbändig und wild, unempfänglich gegen Schmeicheleien und gegen die Zähmung, aber auch ziemlich gleichgültig gegen den Verlust der Freiheit. Es kommt wohl an die Gitter seines Behälters heran, wenn man ihm etwas vorwirft, beweist sich aber keineswegs dankbar und geht ohne Wahl von einem Zuschauer zum anderen. Seine Haltung im ruhigen Zustande ist ganz die der Rinder; der Paßgang unterscheidet es aber sofort von diesen. Dabei bewegt es den Hinterfuß immer etwas eher als den vorderen. In Trab ist es nur schwer zu bringen, und wenn man ihm Gewalt anthun will, geräth es wohl in Zorn, ist aber nicht zu vermögen, weite Sätze zu machen.
Die weiblichen Gnus bringen in verschiedenen Monaten des Jahres ein Junges zur Welt, welches sich schon wenige Tage nach seiner Geburt in denselben Sprüngen und Possen gefällt wie seine Eltern, seiner geringen Größe halber aber noch drolliger erscheint als diese. Die Mutter liebt es mit warmer Zärtlichkeit und gibt sich seinetwegen ohne Bedenken Gefahren preis. Grausame Jäger reiten oft ein Kalb zu Boden, um die Mutter zu erbeuten, da diese sich ihrem gestürzten Kinde regelmäßig naht und nunmehr leicht eine Beute des Schützen wird.
Die Jagd des erwachsenen Gnu hat ihre Schwierigkeiten wegen der unglaublichen Schnelligkeit und Ausdauer des Thieres. Es wird behauptet, daß dieses wüthend auf den Jäger losrenne und ihn durch Stoßen und Schlagen mit den Vorderläufen zu tödten versuche, falls es zweifelt, in der Flucht Rettung zu finden. Verwundete sollen sich zuweilen, um ihren Qualen ein Ende zu machen, in Abgründe oder in das Wasser stürzen. Die Hottentotten gebrauchen vergiftete Pfeile, um es zu erlegen, die Kaffern lauern ihm hinter Büschen auf und schleudern ihm die Lanze oder den sicheren Pfeil durch das Herz. Gejagte Gnus zeigen eine auffallende Aehnlichkeit mit verfolgten wilden Rindern. Ihr Benehmen, wenn sie aufgestört werden, die Art und Weise, wie sie den Kopf aufwerfen, wie sie sich niederducken, wie sie ausschlagen, bevor sie fliehen, alles erinnert lebhaft an diese Wiederkäuer. Wie die Rinder, haben auch sie die eigenthümliche Gewohnheit, vor dem Rückzuge die Gegenstände ihrer Furcht zu betrachten. Deshalb fliehen, wie schon aus Cummings Berichten hervorgeht, die Wildebeeste selbst dann nicht, wenn das tödtliche Geschoß mehrere aus ihrer Mitte niedergestreckt hat. Es soll nicht selten geschehen, daß eine Herde Gnus einen Zug von Jägern herankommen läßt, ohne die Flucht zu ergreifen. Das Knallen der Gewehre versetzt sie freilich in großen Schrecken und bewegt sie zu den possenhaftesten Sprüngen.
Nur zufällig fängt man ein Gnu in Fallgruben oder in Schlingen. Alteingefangene geberden sich wie toll und unsinnig, Junge dagegen werden, wenn man sie mit Kuhmilch aufzieht und sich viel mit ihnen abgibt, bald so zahm, daß man sie mit den Herden auf die Weide gehen lassen und ihnen alle Freiheiten eines Hausthieres gewähren kann. Da die Bauern jedoch glauben, daß solche Junge zu Hautkrankheiten neigen und ihre Hausthiere anstecken könnten, befassen sie sich nur selten mit der Aufzucht junger Gnus, und diese gelangen daher auch nicht eben oft lebend in unsere Thiergärten.
Der Nutzen des erlegten Gnus ist derselbe, welchen andere Wildarten Afrikas bringen. Man ißt das Fleisch seiner Saftigkeit und Zartheit halber, benutzt die Haut zu allerlei Lederwerk und verfertigt aus den Hörnern Messerhefte und andere Gegenstände.

Streifengnu ( Catoblepas taurinus). 1/20 natürl. Größe.
Die zweite Art der Sippe, das Streifen- oder Rindergnu, Korun der Bedschuanen, Kaop und Baas der Namaquas und Hottentotten, Bastardwildebeest der Ansiedler ( Catoblepas taurinus, Antilope taurina und Gorgon), ist merklich größer als das Gnu, da seine Gesammtlänge reichlich 3 Meter, die Höhe am Widerrist 1,6 Meter beträgt, unterscheidet sich auch durch die stark gebogene Rammsnase, den bedeutend höheren Widerrist sowie die längere Nacken- und Halsmähne wesentlich von dem Verwandten. Die vorherrschende Färbung ist ein dunkles Aschgrau, von welchem schwarze Querstreifen deutlich sich abheben; das Gesicht sieht schwarzbraun aus, der Scheitel, die Halsmähne und die Kinnlade haben schwarze, die Kopfseiten blaß düsterbraune Färbung, die Seiten sind rostfarbig überlaufen, die Außenseite der Vorderbeine ist in der oberen Hälfte rostfarben-gelblichbraun, die Innenseite licht-graubraun, die Unterhälfte licht-röthlichbraun, der Schwanz oben und in der Mitte gelblichbraun, übrigens tief schwarz.
Das Streifengnu bewohnt in außerordentlich zahlreichen Herden das innere Südafrika und dehnt sein Verbreitungsgebiet von hier an bis in die oberen Nilländer aus. Lieblingsplätze von ihm sind jene mit kurzem Grase bedeckten Ebenen, auf denen verschiedene Mimosenarten hier und da zu Hainen zusammentreten oder mindestens aus wenigen Bäumen bestehende Gruppen bilden; hier lebt es, zu gewissen Zeiten ebenfalls wandernd, ebenso regelmäßig in Gesellschaft des Dauw wie das Gnu in Gesellschaft des Quagga. In seinen Sitten und Gewohnheiten weicht es wenig von den Verwandten ab. Es gefällt sich ebenfalls in tollen Sprüngen und verschiedenen Possen, trabt neugierig auf den sich zeigenden Menschen zu, nimmt die Miene an, als wolle es zum Angriffe übergehen, bleibt dann plötzlich stehen, wendet um und ergreift, wie unsinnig über die Ebene jagend, so eilig als möglich die Flucht. So lange es ruhig weidet, erinnert es oft lebhaft an den Büffel, sowie es sich in Bewegung setzt, einzig und allein an seinen Verwandten, mit dessen Leben und Treiben das seinige übereinzustimmen scheint.
Ziegen und Schafe bekunden eine so innige Verwandtschaft unter sich, daß es kaum möglich erscheint, für beide Gruppen durchgreifende Unterscheidungsmerkmale aufzustellen. Wir vereinigen beide in einer besonderen Unterfamilie und belegen diese zu Ehren der klügsten und gewecktesten Mitglieder mit dem Namen Geisen ( Caprina ), haben dabei jedoch festzuhalten, daß gedachte Unterfamilie ebenso gut als die der Schafe ( Ovina ) oder Böcke ( Aegocerina ) bezeichnet werden darf und von verschiedenen Thierkundigen tatsächlich so benannt wird.
Zur Kennzeichnung der Geisen läßt sich nachstehendes anführen. Alle hierher gehörigen Arten erreichen nur eine mittlere Wiederkäuergröße, sind kräftig, zum Theil sogar plump gebaut, haben kurzen Hals und meist auch gedrungenen Kopf, niedere und stämmige Beine mit verhältnismäßig stumpfen Hufen und kurzen, abgerundeten Afterklauen, runden oder breiten und dann mehr oder weniger dreieckigen, unten nackten Schwanz, kurze oder doch nur mittellange Ohren, ziemlich große Augen mit quer gestelltem, länglich viereckigen Stern, mehr oder weniger zusammengedrückte und eckige, nach hinten und zur Seite gerichtete, nicht selten schraubenartig gedrehte, seltener leierähnlich gestaltete, regelmäßig runzelige und oft stark wulstige Hörner, welche beiden Geschlechtern zukommen, bei den Weibchen jedoch beträchtlich kleiner sind als bei den Männchen, bald Thränengruben und Klauendrüsen, bald nur die einen oder die anderen, bald weder diese noch jene, bis auf einen zuweilen vorkommenden nackten Fleck zwischen den Nasenlöchern behaarte Muffel und ein sehr dichtes, aus langem Grannen- und reichlich wucherndem Wollhaar bestehendes, düsterfarbiges Kleid. Das Euter der Weibchen hat zwei Zitzen. Den sechs, nach hinten zu ziemlich gleichmäßig an Größe zunehmenden Backenzähnen fehlt das anhängende Schmelzsäulchen und demgemäß auch die von ihm veranlaßte Falte auf der Kaufläche, welche außerdem durch die geringe Deutlichkeit der bei den Wiederkäuern allgemein vorkommenden sichelförmigen Gruben auffällt; unter den acht Schneidezähnen sind die äußersten am kürzesten und breitesten, die inneren am längsten und schmälsten. Am Schädel sind bemerkenswerth das Fehlen einer Leiste zwischen den Hörnern, die verhältnismäßige Kürze und Breite der vorn schlank auslaufenden, mit dem Zwischenkiefer gar nicht, mit dem Oberkiefer nur auf einer kurzen Strecke verbundenen Nasenbeine, im übrigen Gerippe die kurzen, mit ziemlich langen Dornen versehenen Halswirbel, die abgerundeten Körper der Rippenwirbel, dreizehn an der Zahl, die sehr langen und schmalen Querfortsätze der folgenden sechs rippenlosen Wirbel etc.
Dem Sprachgebrauche Rechnung tragend und mehreren hervorragenden Thierkundigen uns anschließend, stellen wir die beiden Gruppen der Unterfamilie einander gegenüber und betrachten jede für sich.
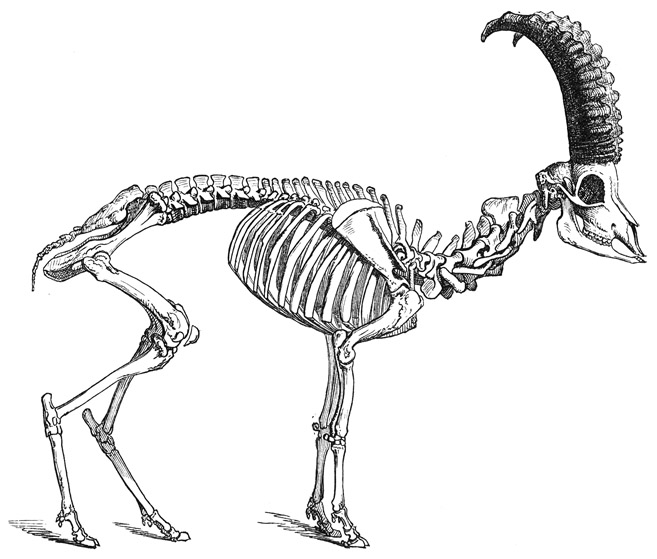
Geripp des Alpensteinbockes. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
Der stämmige und kräftige Leib der Ziegen ( Capra ), denen wir unbedenklich die höhere Stellung innerhalb ihrer Unterfamilie einräumen, ruht auf starken, nicht sehr hohen Beinen; der Hals ist gedrungen, der Kopf verhältnismäßig kurz und breit an der Stirn; der Schwanz, welcher aufrecht getragen zu werden pflegt, wie oben beschrieben, dreieckig und unten nackt. Die Augen sind groß und lebhaft, Thränengruben nicht vorhanden, die Ohren aufgerichtet, schmal zugespitzt und sehr beweglich. Die abgerundet vierseitigen oder zweischneidigen, deutlich nach den Jahreszuwüchsen gegliederten, vorn wulstig verdickten Hörner, welche beiden Geschlechtern zukommen, wenden sich entweder in einfach halbmondförmiger Richtung nach hinten oder biegen sich dann noch leierartig an der Spitze aus. Bei den Böcken sind sie regelmäßig viel schwerer als bei den Ziegen. Das Haarkleid ist ein doppeltes, da die feinere Wolle von groben Grannen überdeckt wird. Bei manchen Arten liegen die Grannen ziemlich dicht an, bei anderen verlängern sie sich mähnenartig an gewissen Stellen, bei den meisten auch am Kinne zu einem steifen Barte. Immer ist die Färbung des Pelzes düster, erd- oder felsenfarbig, vorzugsweise braun oder grau. Erwähnenswerth, weil zur Kennzeichnung der Thiere gehörend, ist schließlich noch der durchdringende Geruch, bezeichnend Bockgestank genannt, womit alle Ziegen jederzeit, während der Brunstzeit aber in besonderer Stärke, unsere Nasen beleidigen.
Ursprünglich bewohnten die Ziegen Mittel- und Südasien, Europa, Nordafrika; heutzutage haben wir die gezähmten über die ganze Erde verbreitet. Sie sind durchgehends Bewohner der Gebirge, zumal der Hochgebirge, wo sie einsame, menschenleere Stellen aufsuchen. Die meisten Arten gehen bis über die Grenze des ewigen Schnees hinauf. Sonnige Stellen mit trockener Weide, dünn bestandene Wälder, Halden und Geröllabstürze, sowie auch kahle Klippen und Felsen, welche starr aus dem ewigen Schnee und Eise emporragen, sind ihre Standorte. Alle Arten lieben die Geselligkeit. Sie sind bewegliche, lebendige, unruhige, kluge und neckische Thiere. Ohne Unterlaß laufen und springen sie umher; nur während des Wiederkäuens liegen sie ruhig an einer und derselben Stelle. Bloß alte, von dem Rudel abgeschiedene Männchen leben einsiedlerisch; die übrigen Stücke halten stets mit anderen ihrer Art treu zusammen. Obwohl thätig bei Tage und Nacht, geben sie doch dem Tage den Vorzug. Ihre Eigenschaften offenbaren sich bei jeder Gelegenheit. Sie sind überaus geschickt im Klettern und Springen und bekunden dabei einen Muth, eine Berechnung und eine Entschiedenheit, welche ihnen große Ehre machen. Sicheren Tritts überschreiten sie die gefährlichsten Stellen im Gebirge, schwindelfrei stehen sie auf den schmalsten Kanten, gleichgültig schauen sie in die furchtbarsten Abgründe hinab, unbesorgt, ja förmlich tollkühn, äsen sie sich an fast senkrecht abfallenden Wänden. Sie besitzen eine verhältnismäßig ungeheuere Kraft und eine wunderbare Ausdauer und sind somit ganz geeignet, ein armes Gebiet zu bewohnen, in welchem jedes Blättchen, jedes Hälmchen unter Kämpfen und Ringen erworben werden muß. Neckisch und spiellustig unter sich, zeigen sie sich vorsichtig und scheu anderen Geschöpfen gegenüber und fliehen gewöhnlich bei dem geringsten Lärm, obwohl man nicht eben behaupten darf, daß es die Furcht ist, welche sie in die Flucht schreckt; denn im Nothfalle kämpfen sie muthig und tapfer und mit einer gewissen Rauflust, welche ihnen sehr gut ansteht.
Saftige Gebirgspflanzen aller Art bilden die Nahrung der Ziegen. Lecker in hohem Grade, suchen sie sich stets die besten Bissen heraus, verstehen es auch vortrefflich, Orte auszuwählen, welche ihnen gute Weide bieten, und wandern deshalb oft von einer Gegend in die andere. Alle Arten sind Freunde vom Salz und besuchen daher Stellen, wo diese Leckerei sich findet, sehr regelmäßig. Wasser ist für sie Bedürfnis, daher meiden sie Gegenden, in denen es weder Quellen noch Bäche gibt.
Die höheren Sinne scheinen ziemlich gleich entwickelt zu sein. Sie äugen, vernehmen und wittern sehr scharf, manche Arten wirklich auf unglaubliche Entfernungen hin. Ihre geistigen Fähigkeiten stehen, wie schon angedeutet, auf ziemlich hoher Stufe; man muß sie als kluge, geweckte Thiere bezeichnen. Das Gedächtnis ist zwar nicht besonders gut; aber Erfahrung witzigt sie doch bald in hohem Grade, so daß sie mit vieler Schlauheit und List drohenden Gefahren zu begegnen wissen. Manche Arten muß man launenhaft nennen, andere sind förmlich boshaft und tückisch.
Die Anzahl ihrer Jungen schwankt zwischen Eins und Vier. Alle wildlebenden Arten gebären höchstens deren zwei, die gezähmten nur in sehr seltenen Fällen vier. Die Zicklein kommen ausgebildet und mit offenen Augen zur Welt und sind schon nach wenigen Minuten im Stande, der Alten zu folgen. Wildlebende Arten laufen am ersten Tage ihres Lebens ebenso kühn und sicher auf den Gebirgen umher wie ihre Eltern.
Man darf wohl sagen, daß alle Ziegen vorwiegend nützliche Thiere sind. Der Schaden, welchen sie anrichten, ist so gering, daß er kaum in Betracht kommt, der Nutzen dagegen sehr bedeutend, namentlich in solchen Gegenden, wo man die Thiere gebraucht, um Oertlichkeiten auszunutzen, deren Schätze sonst ganz verloren gehen würden. Die öden Gebirge des Südens unseres Erdtheils sind förmlich bedeckt mit Ziegenherden, welche auch an solchen Wänden das Gras abweiden, wo keines Menschen Fuß Halt gewinnen könnte. Von den wilden Arten kann man fast alles benutzen, Fleisch und Fell, Horn und Haar, und die zahmen Ziegen sind nicht bloß der Armen liebster Freund, sondern im Süden auch die beinahe ausschließlichen Milcherzeuger.
Die Unterscheidung der Wildziegen ist außerordentlich schwer, weil die Arten sich sehr ähneln und der Beobachtung ihres Lebens viele Hindernisse entgegentreten. So viel scheint festzustehen, daß der Verbreitungskreis der einzelnen ein verhältnismäßig beschränkter ist, und daß somit fast jedes größere Gebirge, welches Mitglieder unserer Familie beherbergt, auch seine eigenen Arten besitzt. Diese Arten lassen sich in vier verschiedene Unterabtheilungen ordnen, welche wir Steinböcke, Ziegen, Halbziegen und Schneeziegen nennen; es ist denselben jedoch kaum die Bedeutung von Sippen zuzusprechen. Noch können wir nicht sagen, inwieweit sich das Leben der verschiedenen Arten unterscheidet; denn bis jetzt sind wir bloß im Stande, das Treiben von einzelnen in allgemeinen Umrissen zu zeichnen: schwebt doch selbst über der Herkunft unserer Hausziege ein bis jetzt noch keinesweges aufgehelltes Dunkel!
Die Steinböcke, nach Auffassung einzelner Forscher eine besondere Untersippe ( Capra ) bildend, bewohnen die Gebirge der Alten Welt und auf ihnen Höhen, woselbst andere große Säugethiere verkümmern würden. Nur wenige Wiederkäuer folgen ihnen in die Hochgefilde, auf denen sie jahraus jahrein sich umhertreiben, höchstens während des eisigen Winters in etwas tiefer gelegene Gelände herabsteigend. Mit dieser Lebensweise geht Hand in Hand, daß jede Steinbockart nur eine geringe Verbreitung hat. Einzelne Naturforscher wollen zwar die verschiedenen Steinbockarten bloß als Abänderungen einer und derselben Hauptart gelten lassen und nehmen nicht nur für Europa, sondern überhaupt bloß eine einzige Art an, bleiben uns aber die Erklärung schuldig, wie diese Stammart sich allgemach so verbreitet hat, daß sie gegenwärtig nicht bloß auf den Alpen, den Pyrenäen und dem Gebirgsstocke der Sierra Nevada, sondern auch auf dem Kaukasus, den Hochgebirgen Asiens, den Alpengebirgen des Steinigten Arabien und Abessinien zu finden ist. Wenn auch zugegeben werden mag, daß die Steinböcke erst durch die Verfolgungen der Menschen hier und da, z.+B. auf unseren Alpen, in die Höhen getrieben worden sind, in denen sie sich jetzt ständig aufhalten, steht doch so viel fest, daß sie nicht fähig sind, die Ebenen zu durchwandeln, welche zwischen den erwähnten Gebirgen liegen, daß wir somit schon aus diesem Grunde die verschiedenen Formen als Arten ansehen müssen. Wenn wir dies thun, haben wir in den Steinböcken ein reiches Geschlecht vor uns. Europa allein zählt zwei, vielleicht drei verschiedene Steinbockarten. Eine derselben ( Capra Ibex) bewohnt die Alpen, eine ( Capra pyrenaica) die Pyrenäen und andere spanische Gebirge, eine dritte ( Capra caucasica) den Kaukasus. Außerdem findet sich ein Steinbock ( Capra sibirica) in Sibirien, einer ( Capra Beden) im Steinigten Arabien, ein dritter ( Capra Walie) in Abessinien, ein vierter ( Capra Skyn) auf dem Himalaya. Alle diese Thiere sind einander sehr ähnlich in Gestalt und Färbung und unterscheiden sich hauptsächlich durch das Gehörn und den Bart am Kinne. Zur Zeit besitzen wir noch keineswegs Stoff genug, um über die Frage, ob hier überall Artverschiedenheiten zu Grunde liegen oder nicht, mit der nothwendigen Sicherheit entscheiden zu können. Unsere Museen sind bis jetzt noch durchaus nicht solche Vorrathskammern zu den Arbeiten eines Naturforschers gewesen, wie er sie braucht; denn die besten Museen zeigen höchstens ein oder zwei Stücke von Steinböcken, und von einer Sammlung der Thiere, in welcher alle Altersverschiedenheiten und mancherlei Abweichungen, wie sie ja immer vorkommen, vertreten wären, ist noch keine Rede. Uebergänge von einer zur anderen Form sind jedoch noch nicht nachgewiesen, und somit müssen wir die erwähnten einstweilen wohl als verschiedene Arten betrachten.
Unter allen Steinböcken geht uns selbstverständlich diejenige Art am nächsten an, welche unsere Alpen bewohnt. Mit Unrecht übersetzt man den lateinischen Namen Capra Ibex noch immer mit »europäischer Steinbock«; denn von allen anderen Arten unseres Erdtheiles leben sicherlich gegenwärtig ihrer noch viel mehr als von dem Steinbocke der Alpen, welcher leider seinem gänzlichen Untergange entgegengeht.

Alpensteinbock
Der Alpensteinbock ( Capra Ibex, C. alpina, Aegoceros Ibex und Ibex alpinus) ist ein stolzes, ansehnliches und stattliches Geschöpf von 1,5 bis l,6 Meter Leibeslänge, 80 bis 85 Centim. Höhe und 75 bis 100 Kilogramm Gewicht. Das Thier macht den Eindruck der Kraft und Ausdauer. Der Leib ist gedrungen, der Hals mittellang, der Kopf verhältnismäßig klein, aber stark an der Stirn gewölbt; die Beine sind kräftig und mittelhoch; das Gehörn, welches beide Geschlechter tragen, erlangt bei dem alten Bocke sehr bedeutende Größe und Stärke und krümmt sich einfach bogen- oder halbmondförmig schief nach rückwärts. An der Wurzel, wo die Hörner am dicksten sind, stehen sie einander sehr nahe; von hier entfernen sie sich, allmählich bis zur Spitze hin sich verdünnend, weiter von einander. Ihr Durchschnitt bildet ein längliches, hinten nur wenig eingezogenes Viereck, welches gegen die Spitze hin flacher wird. Die Wachsthumsringe treten besonders auf der Vorderfläche in starken, erhabenen, wulstartigen Knoten oder Höckern hervor, verlaufen auch auf den Seitenflächen des Hornes, erheben sich hier jedoch nicht so weit als vorn. Gegen die Wurzel und die Spitze zu nehmen sie allmählich an Höhe ab; in der Mitte des Hornes sind sie am stärksten, und hier stehen sie auch am engsten zusammen. Die Hörner können eine Länge von 80 Centim. bis 1 Meter und ein Gewicht von 10 bis 15 Kilogramm erreichen. Das Gehörn des Weibchens ähnelt mehr dem einer weiblichen Hausziege als dem des männlichen Steinbockes. Die Hörner sind verhältnismäßig klein, fast drehrund, der Quere nach gerunzelt und einfach nach rückwärts gekrümmt. Ihre Länge beträgt selbst bei erwachsenen Thieren nicht mehr als 15 bis 18 Centim. Schon im ersten Monate des Lebens sproßt bei dem jungen Steinbocke das Gehörn hervor; bei einem etwa einjährigen Bocke sind es noch kurze Stummel, welche hart über der Wurzel die erste querlaufende, knorrige Leiste zeigen; an den Hörnern der zweijährigen Böcke zeigen sich bereits zwei bis drei wulstige Erhöhungen; dreijährige Böcke haben schon Hörner von 45 Centim. Länge und eine erhebliche Anzahl von Knoten, welche nun mehr und mehr steigt und bei alten Thieren bis auf vierundzwanzig kommen kann. Einen sicheren Schluß auf das Alter des Thieres gewähren diese Knoten ebensowenig wie die wenig bemerklichen Wachsthumsringe zwischen ihnen, oder die flachen Erhebungen zu beiden Seiten des Hornes, aus deren Anzahl die Jäger die Jahre des Thieres bestimmen zu können vermeinen.
Die Behaarung ist rauh und dicht, verschieden nach der Jahreszeit, im Winter länger, gröber, krauser und matter, im Sommer kürzer, feiner, glänzender, während der rauhen Jahreszeit durchmengt mit einer dichten Grundwolle, welche mit zunehmender Wärme ausfällt, und auf der Oberseite des Leibes pelziger, d. h. kürzer und dichter als unten. Außer am Hinterhalse und Nacken, wo die Haare mähnenartig sich erheben, verlängern sie sich bei dem alten Männchen auch am Hinterkopfe, indem sie hier zugleich sich kräuseln und einen Wirbel herstellen, und ebenso am Unterkiefer, bilden hier jedoch höchstens ein kurzes Stutzbärtchen von nicht mehr als 5 Centim. Länge, welches jüngeren Böcken wie den Steinziegen gänzlich fehlt. Im übrigen ist das Haar ziemlich gleich lang. Die Färbung ist nach Alter und Jahreszeit etwas verschieden. Im Sommer herrscht die röthlichgraue, im Winter die gelblichgraue oder fahle Färbung vor. Der Rücken ist wenig dunkler als die Unterseite; ein schwach abgesetzter, hellbrauner Streifen verläuft längs seiner Mitte. Stirn, Scheitel, Nase, Rücken und Kehle sind dunkelbraun; am Kinne, vor den Augen, unter den Ohren und hinter den Nasenlöchern zeigt sich mehr rostfahle Färbung; das Ohr ist außen fahlbraun, inwendig weißlich. Ein dunkel- bis schwarzbrauner Längsseitenstreifen scheidet Ober- und Unterseite; außerdem sind Brust, Vorderhals und die Weichen dunkler als die übrigen Stellen, und an den Beinen geht die allgemeine Färbung in Schwarzbraun über. Die Mitte des Unterkörpers und die Umgebung des Afters sind weiß; der Schwanz ist oben braun, an der Spitze schwarzbraun. Auf der Rückseite der Hinterläufe verläuft ein heller, weißlich-fahler Längsstreifen. Mit zunehmendem Alter wird die Färbung gleichmäßiger.
Das Haarkleid der Steingeis entspricht im wesentlichen durchaus dem des Bockes, zeigt jedoch keinen Rückenstreifen und ist noch gleichartiger und mehr fahlgelblich-braun, im Grunde aber dunkler grau gefärbt, die Mähne kürzer und undeutlicher, von einem Barte endlich keine Spur zu sehen. Die Zicklein ähneln bis zur ersten Härung der Mutter, haben aber, wenn sie männlichen Geschlechtes sind, schon von Geburt an den dunkleren Rückenstreifen.
Bereits vor Hunderten von Jahren waren die Steinböcke sehr zusammengeschmolzen, und wenn im vorigen Jahrhunderte nicht besondere Anstalten getroffen worden wären, sie zu hegen, gäbe es vielleicht keinen einzigen mehr. Nach alten Berichten bewohnten sie in früheren Zeiten alle Hochalpen der Schweiz, in vorgeschichtlicher Zeit scheinen sie sich sogar auf den Voralpen aufgehalten zu haben. Während der Herrschaft der Römer müssen sie häufig gewesen sein; denn dieses prunkliebende Volk führte nicht selten ein- bis zweihundert lebendig gefangene Steinböcke zu den Kampfspielen nach Rom. Schon im fünfzehnten Jahrhunderte waren sie in der Schweiz selten geworden. Im Kanton Glarus wurde 1550 das letzte Stück geschossen, in Graubünden konnte der Vogt von Kastel dem Erzherzoge von Oesterreich im Jahre 1574 nur mit Mühe noch Böcke schaffen. In den Bergen des Bergell und Oberengadin zählten sie im sechzehnten Jahrhunderte noch nicht zu den ungewöhnlichen Thieren. Im Jahre 1612 verbot man ihre Jagd bei fünfzig Kronen Geldbuße, schon einundzwanzig Jahre später bei körperlicher Strafe. Ende des vorigen Jahrhunderts traf man sie noch in den Gebirgen, welche das Bagnethal umgeben, zu Anfang dieses Jahrhunderts noch in Wallis; seitdem hat man sie auf Schweizer Gebiete ausgerottet.
In Salzburg und Tirol sind sie, wie neuere Untersuchungen alter Urkunden glaublich erscheinen lassen, wahrscheinlich erst um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts und vermuthlich durch die reichen Herren von Keutschbach eingebürgert worden, haben sich auch nur kurze Zeit dort gehalten. Wilddiebe gefährlichster Art stellten ihnen, weil Gehörn und Blut, »Herzknochen«, »Bocksteine« etc. als kräftige Heilmittel galten, mit solchem Eifer nach, daß sich der Jagdbesitzer des von ihnen bewohnten Gebietes im Jahre 1561 schutzbittend an seinen Fürsten, den Erzbischof von Salzburg, wendete, welcher endlich 1584 die Jagdgerechtigkeit selbst übernahm. Er und seine Nachfolger wandten verschiedene Mittel an, um die Ausrottung der edlen Thiere zu verhindern. Sie vervierfachten die Anzahl ihrer Jäger, setzten Wildhüter in kleine Hütten auf die höchsten Alpen und ließen junges Steinwild einfangen, um es in Thiergärten aufzuziehen. Achtzig bis neunzig der geschicktesten und muthigsten Jäger waren vom April bis zum Juni beschäftigt, um Steinböcke, wenn sie bei der Schneeschmelze tiefer herab in die Nähe der Sennhütten kamen, mit Garnen zu berücken. Gleichwohl konnten sie in drei Sommern nicht mehr als zwei Böcke, vier Geisen und drei Kitzen erlangen. So ging es durch das ganze Jahrhundert fort, weil die Erzbischöfe Steinböcke zu Geschenken an auswärtige Höfe benutzten. Man zahlte damals für jeden »Herzknochen« des Steinbockes einen Dukaten, für ein gefundenes Horn zwei Reichsthaler, für eine Gemskugel zwei Gulden. Deshalb waren 1666 im Zillerthale kaum noch Steinböcke und bloß noch etwa sechzig Gemsen übrig. Von nun an durfte niemand mehr einen Steinbock schießen, falls er nicht einen vom Erzbischof eigenhändig unterzeichneten Befehl aufzuweisen hatte. Man gab den Alpenbesitzern jährlich hundert Thaler, damit sie kein Vieh mehr auf die obersten Weiden führten, wo sich die Steinböcke aufhielten. Bis zum Jahre 1694 hatte sich das stolze Wild auf zweiundsiebzig Böcke, dreiundachtzig Geisen und vierundzwanzig Junge vermehrt. Als nun aber die Wilddiebereien wieder zunahmen, ließ man die Thiere von neuem einfangen, um sie zu versetzen oder zu verschenken. Im Jahre 1706 wurden fünf Böcke und sieben Geisen gefangen, und seitdem sah man keine mehr.
Ein neuerer ungenannter Berichterstatter, dessen Darstellung eine sorgfältige, an Ort und Stelle vorgenommene Quellenforschung nicht verkennen läßt, glaubt übrigens, daß die Bischöfe selbst der Vermehrung des Steinwildes hinderlich waren und schließlich den Befehl zum Abschießen desselben gaben. Nachdem nämlich Erzbischof Guidobald, Graf von Thun, welcher in den Jahren 1654 bis 1668 den Krummstab führte, durch seinen Leibarzt Oswald Krems berichtet worden war, daß die Heilkraft einzelner Bestandtheile des Steinwildes eine außerordentliche sei, ließ der Kirchenfürst in der Hofapotheke zu Salzburg eine förmliche Niederlage von allerlei Steinbocksarzeneien errichten und dieselben theuer verkaufen. Sein Nachfolger Max Gandolph, Graf von Kühnberg, hegte das Wild waidmännisch, ohne es kaufmännisch zu verwerthen, und der ihm folgende Bischof Graf Johann Ernst von Thun, welcher von 1687 bis 1709 auf dem Stuhle saß, trat nicht allein in seines Vorgängers Fußstapfen, sondern verschärfte die Jagdgesetze in unmenschlicher Weise, so daß unter seiner Regierung jeder ergriffene Wildfrevler den Verlust der Hand oder Galerenstrafe zu gewärtigen hatte. Unter seiner Regierung erreichte der Steinwildstand Tirols und Salzburgs seinen Höhepunkt, indem im Jahre 1699 im Floitenthale über dritthalbhundert Stück gezählt wurden. Sieben Jahre später waren die Steinböcke verschwunden, und das Volk flüsterte sich zu, daß die ewige Gerechtigkeit handelnd eingegriffen habe, um die Fürstbischöfe für ihre grausame Strenge zu bestrafen. Der wirkliche Sachverhalt war ein anderer. Fürstbischof Johann Ernst selbst befahl das Steinwild auszurotten, nachdem man ihn überzeugt hatte, daß durch die ungeheuerlichen Gesetze, Todschlag und Meuchelmord, ja förmliche Schlachten zwischen Wildhütern und Wilddieben in erschrecklicher Weise sich häuften. Fortan hielt man in diesem Gebiete nur noch in den Thiergärten Steinwild.
Wie in den bisher erwähnten Theilen der Alpen nehmen sie auch auf den südlichen Zügen des Gebirges so jählings ab, daß schon im Jahre 1821 Zummstein bei der damaligen piemontesischen Regierung auf das wärmste für sie sich verwendete. In der That erwirkte er ein strenges Verbot, das edle Wild fernerhin zu jagen. Diesem Verbote haben wir es zu danken, daß der Steinbock noch nicht gänzlich ausgestorben ist und wenigstens auf einem, wenn auch sehr beschränkten Gebiete noch ständig vorkommt. Tschudi behauptet noch im Jahre 1865, in der mir vorliegenden siebenten Auflage seines »Thierlebens der Alpenwelt«, daß seit einigen Jahren die stolzen Thiere wieder in ziemlich zahlreichen Stücken am Monterosa erschienen seien, wo man zum letztenmale in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts etwa vierzig Stück bei einander, dann aber fünfzig Jahre lang kein einziges gesehen hatte. »An den Aiguilles Rouges und Dents des Bouquetins schoß man dann vor dreißig Jahren, wie man glaubte, die letzten Steinböcke, und als man einige Jahre später auf der Seite gegen Arolla hin sieben solcher Thiere durch eine Lawine verschüttet fand, hielt man sie nun für völlig ausgerottet. Heute sieht man, ohne Zweifel infolge des in Piemont sechzehn Jahre lang streng ausgeübten Jagdverbotes am südlichen Monterosagebirge und in dessen Verzweigungen als Seltenheit wieder eine Familie von zehn bis achtzehn Stück bei einander.« Letztere Angabe Tschudis ist nicht begründet; vielmehr steht es nach übereinstimmenden, bereits mehrere Jahre vor dem Erscheinen der genannten Auflage des Tschudischen Werkes veröffentlichten Nachrichten und mir durch besondere Güte des Grafen Wilczek gewordenen neueren Mittheilungen unzweifelhaft fest, daß gegenwärtig am Monterosa keine ständigen Trupps, sondern höchstens dann und wann noch versprengte Stücke unseres Wildes gesehen werden. »Ich stellte«, sagt King in seinem im Jahre 1858 erschienenen Werke über die italienischen Thäler der Penninischen Alpen, »viele Nachforschungen an und zwar an den verschiedensten Oertlichkeiten, bei Leuten, welche ich für vertrauenswürdig halten durfte, und sie alle wußten nichts mehr von dem Vorkommen des Steinbockes auf dem Monterosa und irgend einem Gebiete desselben seit Menschengedenken. Als ich die Val Tournanche erwähnte, lachten sie nur. Ueber das Val de Lys konnte mir niemand besser Auskunft geben als Baron Peccoz und die Albesinis, die Nimrode des Val Macugnaga; der eine wie die anderen aber versicherten einstimmig, daß der Steinbock hier nirgends mehr sich finde. Sein ausschließliches Gebiet bilde vielmehr die Grajische Kette der Alpen und zwar der hohe Schnee- und Eisgürtel der Thäler Cogne, Savaranche, Grisanche und vielleicht Dignes, also die zwischen Piemont und Savoyen gelegenen Gebirgszüge, eine Alpenwelt im allergroßartigsten Stile. Ein Hauptstand von ihnen sei der Pik von Grivola, von welchem alle in diesem Jahrhunderte erbeuteten Stücke herrühren sollen«. Ein Berichterstatter der »Jagdzeitung«, vermuthlich Baron Peccoz selbst, welcher im Lysthale größere Güter besitzt und daselbst jedes Jahr im Hochsommer fleißig der Gemsjagd obliegt, gibt im Jahre 1864 genau dieselben Oertlichkeiten wie King als die zeitige Heimat des Steinwildes an. »Dasselbe«, sagt er, »lebt gegenwärtig nur noch im Cognethale, Val d'Aosta, in Piemont, achtzehn Gehstunden vom Monterosa entfernt. Dort allein findet es einen für den Jäger unzugänglichen Aufenthalt, und ist ihm deshalb noch eine ferne Zukunft gesichert. Der Hauptstand von Steinwild beschränkt sich auf die Nebenthäler von Cogne sowie die Gombe de Lila, Lauzon, Granval, la Rossa, la Grivola, Pointe de l'Oeille, sodann auf die Gletscher von Champorcher, welche zunächst an Cogne grenzen. Im Val Locana und Cerisole kommt es nur als Wechselwild vor, und in Savoyen gibt es, obgleich viele das Gegentheil behaupten wollen, gar kein Steinwild mehr.« Daß sich die Verhältnisse in den letzten zehn Jahren nicht geändert haben, geht aus Mittheilungen des Grafen Wilczek hervor, welcher, vom Könige von Italien eingeladen, im Jahre 1874 im Val Cogne auf Steinböcke jagte. »Das Steinwild«, so schreibt mir dieser ausgezeichnete Beobachter, Gebirgskenner und Jäger, »lebt nur noch in drei Thälern, welche vom Aostathale in südwestlicher Richtung streichen (also im Val Cogne, Savaranche und Grisanche). Am Südabhange des Montblanc treibt sich bloß eine alte Geis umher, welche den Schweizern bis jetzt noch entkommen ist; am Monterosa und nördlich und östlich vom Aostathale ist das Steinwild vollständig ausgerottet worden.« Nach diesen jeden Zweifel ausschließenden Feststellungen meiner Gewährsmänner sind Tschudi's Angaben zu berichtigen. Versprengte Stücke werden, nach Wilczeks Erfahrungen, nicht allzuselten und zuweilen weit von ihren Standorten angetroffen: so begegnete ein Gemsjäger im Jahre 1874 einem gewaltigen Bocke in den Gebirgen um Nauders, an der Tiroler und Schweizer Grenze. Ein Umstand absonderlichster Art deutet darauf hin, daß ähnliche Streifereien alter, einsiedlerisch lebender Steinböcke öfter vorkommen, als bisher festgestellt werden konnte. In allen Theilen der an das Wohngebiet des Thieres grenzenden Hochalpen nämlich vernimmt man von Zeit zu Zeit aus dem Munde unerschrockener und wahrheitsliebender Jäger oder Bergsteiger, daß sie, und zwar regelmäßig auf den gefährlichsten Stellen dem Teufel in höchsteigener Person begegnet seien, daß er ihnen den Weg vertreten oder sie in die Tiefe zu stürzen versucht, endlich aber von ihnen abgelassen habe, und dergleichen mehr. Forscht man genauer nach, so entpuppt sich aus der Erscheinung allmählich ein gewaltiger Steinbock, welchem von dem geträumten Wahngebilde des Aberglaubens zuletzt nur die feurigen Augen noch bleiben. Wie bestimmt der Steinbock mit dem Teufel in Beziehung gebracht wird, geht auch daraus hervor, daß man im Jagdgehege des Cognethales einen alten Steinbock allgemein »einen großen Teufel« (un grand diable), einen als Stück bekannten aber »den großen Teufel« (le gran diable) nennt.
Ich will schon an dieser Stelle bemerken, daß wir die Erhaltung des Steinbocks in unserer Zeit niemand anderem verdanken als dem Könige von Italien, Victor Emanuel, welcher, wie Lessona und Salvadori, die Herausgeber der vortrefflichen italienischen Uebersetzung der ersten Auflage dieses Werkes, bemerken, vom Antritte seiner Regierung an die größte Sorgfalt an den Tag legte, um der Ausrottung des edlen Wildes entgegenzutreten und seine Vermehrung zu fördern. Nach der oben angegebenen Mittheilung der »Jagdzeitung« haben im Jahre 1858 die Gemeinden Cogne, Val Savaranche, Champorcher und Bomboset ihr Jagdrecht als ausschließliches Eigenthum dem Könige überlassen, welcher nunmehr und nachdem er im Jahre 1863 auch die Gems- und Steinbockjagd von der Gemeinde Courmajeur im Val d'Aosta an der Gebirgskette des Montblanc von Col de Ferrex bis zum Col de la Seigne erworben hatte, einen Standort des Steinwildes schaffen und denselben allen Raubschützen und Bubenjägern wenigstens ziemlich unzugänglich machen konnte. Wie Tuckott, ein Mitglied des englischen Alpenvereins, gelegentlich mittheilt, trifft der Gebirgsreisende in jedem Thale des Jagdgebietes Seiner Majestät auf Warnungstafeln, welche die Jagd verbieten. In jedem Hauptorte von Cogne, Campiglia, Cerisole und Savaranche wohnen je zwei Jagdaufseher, welche unter einem in Cogne seßhaften Oberjäger stehen und das Gehege auf das strengste überwachen. Infolge dieser Maßnahmen hat sich der Stand in erfreulicher Weise vermehrt, und läßt sich, laut Wilczek, die Anzahl des gegenwärtig vorhandenen Steinwildes auf drei- bis fünfhundert Stück annehmen.
Ob der Steinbock in früheren Zeiten eine über die Alpen hinausgehende Verbreitung gehabt hat, beziehentlich noch heutigen Tages auf anderen Gebirgen vorkommt, vermag ich mit Bestimmtheit nicht anzugeben, vielmehr nur das nachstehende zu sagen. Mehrere jagd- und thierkundige Siebenbürger haben mir versichert, daß das edle Wild in früheren Zeiten auch auf den Transsylvanischen Alpen gelebt habe, aber schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts daselbst ausgerottet worden sei. Noch jetzt finde man hier und da Gehörne von ihm auf, welche die Bauern der höheren Gebirgsthäler bisher zwar aufbewahrt, jedoch wenig beachtet hätten. Bemerkenswerther als diese Angabe scheint mir eine Mittheilung meines Bruders Reinhold, welcher den Alpensteinbock oder wenigstens eine ihm durchaus ähnliche Art als Bewohner des westlichen Theiles der Pyrenäen aufführt, und zwar gestützt auf einen im Museum zu Madrid stehenden Bock, welcher aus den Pyrenäen stammen soll, und die Aussage eines in Deutschland erzogenen gebildeten Franzosen, Herrn von Coutouly, welcher auf das bestimmteste versichert, in den Pyrenäen frisch erlegte Steinböcke mit nach hinten gebogenen, wulstigen Hörnern gesehen zu haben. Coutouly, ein eifriger Gemsjäger, nahm einmal an einer von meinem Bruder geleiteten Jagd auf Bergsteinwild theil und wunderte sich nicht wenig, in den erlegten Böcken der Sierra de Gredos von dem Steinwilde des Hauptstockes der Pyrenäen gänzlich verschiedene Thiere zu erblicken, hob auch, unbefragt, sofort den bezeichnenden Unterschied des Gehörnes hervor.
Das Steinwild bildet Rudel von verschiedener Stärke, zu denen sich die alten Böcke jedoch nur während der Paarungszeit gesellen, wogegen sie in den übrigen Monaten des Jahres ein einsiedlerisches Leben führen. »Im Sommer«, so schreibt mir Graf Wilczek, »halten sie sich regelmäßig in den großartigsten und erhabensten, an furchtbaren Klüften und Abstürzen reichen, den Menschen also unzugänglichen Felsenwildnissen auf, und zwar meist die Schattenseite der Berge erwählend, wogegen sie im Winter tiefer ins Gebirge herabzusteigen pflegen.« Die Ziegen und Jungen leben zu allen Jahreszeiten in einem niedrigeren Gürtel als die Böcke, bei denen der Trieb nach der Höhe so ausgeprägt ist, daß sie nur Mangel an Nahrung und die größte Kälte zwingen kann, überhaupt in tiefere Gelände herabzusteigen. Stechende Hitze ist dem Alpensteinwilde weit mehr zuwider als eine bedeutende Kälte, gegen welche es in hohem Grade unempfindlich zu sein scheint. Nach Berthoud von Berghem, dessen Angaben in die meisten Lebensbeschreibungen des Thieres übergegangen sind und noch heute Gültigkeit beanspruchen, nehmen alle über sechs Jahre alten Böcke die höchsten Plätze des Gebirges ein, sondern sich immer mehr ab und werden zuletzt gegen die strengste Kälte so unempfindlich, daß sie oft ganz oben, gegen den Sturm gewendet, wie Bildsäulen sich aufstellen und dabei nicht selten die Spitzen der Ohren erfrieren. Wie die Gemsen weiden auch die Steinböcke des Nachts in den höchsten Wäldern, im Sommer jedoch niemals weiter als eine Viertelstunde unter der Spitze einer freien Höhe. Mit Sonnenaufgang beginnen sie weidend aufwärts zu klettern und lagern sich endlich an den wärmsten und höchsten, nach Osten oder Süden gelegenen Plätzen; nachmittags steigen sie wieder weidend in die Tiefe herab, um womöglich in den Waldungen die Nacht zuzubringen. Wie Tuckott von einem Jagdaufseher des Königs Victor Emanuel erfuhr, sieht man Steinböcke am häufigsten vor sechs Uhr morgens und nach vier Uhr nachmittags; in der Zwischenzeit ruhen sie. Bei ihren Weidegängen halten sie nicht allein ihre Wechsel ein, sondern lagern sich auch regelmäßig auf bestimmten Stellen, am liebsten auf Felsenvorsprüngen, welche ihnen den Rücken decken und freie Umschau gewähren. Erfahrene Jäger versichern, Steinböcke tagelang nach einander auf einer und derselben Stelle wahrgenommen zu haben, und diese Angaben werden durch das Betragen gefangener nur bestätigt. »Gelegentlich meiner Beobachtungen des Steinwildes«, so bemerkt Herr Mützel, welcher, um die Schönbrunner Gefangenen zu zeichnen, zehn Tage nacheinander jedesmal mehrere Stunden in dem von ihnen bewohnten Gehege sich aufhielt, »ist mir die Ordnungsliebe der kleinen Herde aufgefallen. Die Thiere scheinen sich gewissen selbstgegebenen Gesetzen unterzuordnen und diese streng zu befolgen. Bei den Schönbrunner Gefangenen äußerte sich der Ordnungstrieb darin, daß fast jedes einzelne der älteren Stücke seinen bestimmten Ruheplatz sowie seine Stelle an der Heuraufe behauptete. An der hohen Umfassungsmauer, welche vormittags von der brennenden Sonne getroffen wird, ruhen dieselben Böcke und eine leicht kenntliche Geis immer auf demselben Platze. Sie standen öfters auf, um ein Maul voll Heu zu nehmen oder mit den Besuchern zu verkehren, und es kam dann vor, daß eines der jüngeren Thiere auf dem schon eingedrückten muldenförmigen Lager sich wohl sein ließ: sobald jedoch der alte Herr wieder nahte, erhob sich der Eindringling, um jenem sein Recht einzuräumen. Dies geschah bestimmt nicht aus augenblicklicher Furcht vor dem älteren; denn dicht neben oder vor ihm that sich der jüngere Bock wieder nieder, ohne den Nachbar weiter zu beachten oder von diesem belästigt zu werden. So hatten auch zwei Geisen mit ihren Kitzchen ihre festen Ruheplätze auf einem vor dem Schaugitter errichteten Steinhaufen; beide lagen immer auf denselben Steinen. An der Raufe behaupteten die beiden älteren Böcke den rechten und linken Flügel, wogegen die jüngeren und die Weibchen den Zwischenraum einnahmen. In der Körperhaltung beim Liegen spricht sich eine rege Wachsamkeit aus; denn fast immer werden die Hinterläufe, zum schnellen Erheben geschickt, dicht unter den Leib gezogen, und nur ein einziges Mal sah ich einen Bock mit gestreckten Hinterläufen ruhen. Von den Vorderläufen wird fast stets der eine nach vorn hin ausgestreckt, während der andere umgeschlagen ist; ausnahmsweise kommt es vor, daß auch beide Vorderläufe ausgestreckt werden. Im höchsten Grade auffallend war mir die Stellung der alten schlummernden Böcke. Wenn sie es sich bequem machten, setzten sie die Nasenspitze dicht vor die Brust auf den Boden und ließen nun den Kopf mit den schweren Hörnern nach vorn sinken, so daß dann Nasenrücken, Stirn und unterer Theil der Hörner fast auf dem Erdboden lagen. Bei einem ungewohnten Geräusche erhoben sie den Kopf für einen Augenblick, ließen ihn jedoch bald wieder in die frühere Lage zurücksinken. Es erschien mir diese Stellung so eigenthümlich, daß ich täglich mehrmals das Gehege besuchte, um mich von der stetigen Wiederkehr derselben von neuem zu überzeugen.«
Kein anderer Wiederkäuer scheint in so hohem Grade befähigt zu sein, die schroffsten Gebirge zu besteigen, wie die Wildziegen insgemein und der Steinbock insbesondere. »Die geschwinde des springens und die weyte der sprung von einem felsen zu den anderen«, sagt schon der alte Geßner, »ist yemants müglich zu glauben, er habe es dann gesähen; dann wo es yenen mit seinem gespaltnen und spitzigen klawen behafften mag, so ist ihm kein spitz zu hoch, den er nit etlich schrit überspringet, auch selten kein fels so weyt von dem anderen, den es nit mit seinem sprung erreiche.« Alle Beobachter stimmen dieser Schilderung bei. Jede Bewegung des Steinwildes ist rasch, kräftig und dabei doch leicht. Der Steinbock läuft schnell und anhaltend, klettert mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit und zieht mit unglaublicher, weil geradezu unverständlicher Sicherheit und Schnelligkeit an Felswänden hin, wo nur er Fuß fassen kann. Eine Unebenheit der Wand, welche das menschliche Auge selbst in der Nähe kaum wahrnimmt, genügt ihm, sicher auf ihr zu fußen; eine Felsspalte, ein kleines Loch etc. werden ihm zu Stufen einer gangbaren Treppe. Seine Hufe setzt er so fest und sicher auf, daß er auf dem kleinsten Raume sich erhalten kann. Graf Wilczek bestätigt diese Angaben. »Der starke Steinbock«, sagt er, »ist das schönste Jagdthier, welches ich je gesehen. Er hat die würdevolle Hauptbewegung des Hirsches; das fast unverhältnismäßig große Gehörn beschreibt bei der kleinsten Kopfbewegung einen weiten Bogen. Seine Sprungkraft ist fabelhaft. Ich sah eine Gemse und einen Steinbock denselben Wechsel annehmen. Die Gemse mußte im Zickzack springen, wie ein Vogel, welcher hin- und herflattert: der Steinbock kam in gerader Linie herab wie ein Stein, welcher fällt, alle Hindernisse spielend überwindend. An fast senkrechten Felsenwänden muß die Gemse flüchtig durchspringen; der Steinbock dagegen hat so gelenkige Hufe, daß er, langsam weiter ziehend, viele Klaftern weit an solchen Stellen hinschreiten kann: ich sah ihn beim Haften an Felswänden seine Schalen so weit spreizen, daß der Fuß eine um das dreifache verbreitete Fläche bildete.« Gefangene Steinböcke setzen nicht minder in Erstaunen wie die freilebenden. Schinz beobachtete, daß sie mit der größten Sicherheit den Platz erreichen, nach welchem sie gezielt haben. Ein ganz junger Steinbock in Bern sprang einem großen Manne ohne Anlauf auf den Kopf und hielt sich daselbst mit seinen vier Hufen fest. Einen anderen sah man mit allen vier Füßen auf der Spitze eines Pfahles, einen dritten auf der scharfen Kante eines Thürflügels stehen und eine senkrechte Mauer hinaufsteigen, ohne andere Stützpunkte als die Vorsprünge der Mauersteine, welche durch den abgefallenen Mörtel sichtbar waren, zu benutzen. Gleichlaufend mit der Mauer sprang er mit drei Sätzen auf dieselbe. Er stellte sich dem Ziele, welches er erreichen wollte, gerade gegenüber und maß es mit dem Auge, durchlief sodann mit kleinen Schritten einen gleichen Raum, kam mehrmals auf dieselbe Stelle zurück, schaukelte sich auf seinen Beinen, als wenn er deren Schnellkraft versuchen wollte, sprang und war in drei Sätzen oben. Aehnliche Kraftstücke führten die gefangenen Steinböcke der kaiserlichen Menagerie in Schönbrunn zu wiederholten Malen aus, indem sie die durch zwei in einem sehr stumpfen Winkel zusammenstoßende Mauern gebildete Ecke benutzten, um die über drei Meter hohe Wand zu erklimmen. Sie sprangen von der einen Mauer gegen die andere, wandten sich bei jedem Satze und erreichten so, anscheinend ohne Anstrengung, die Höhe mit wenigen Sätzen. Beim Springen scheinen sie die Felsen oder die Mauer kaum zu berühren und ihren Körper wie einen Ball in die Höhe zu schnellen. Wahrhaft bewunderungswürdig ist auch die Sicherheit, mit welcher der Steinbock über Abgründe und Felsenklüfte setzt. Spielend schwingt er sich von einer Klippe zur anderen, und ohne Besinnen springt er aus bedeutenden Höhen herab in die Tiefe. Die alten kindlichen Berichterstatter ersannen wunderliche Märchen, um diese auffallenden Fähigkeiten der Steinböcke zu erklären, und manche dieser Märchen haben sich Jahrhunderte fortgesponnen, werden auch heute noch von Unbewanderten auf Treu und Glauben hingenommen. So meint Geßner, daß das Thier seine gewaltigen Hörner hauptsächlich dazu benutze, um sich aus bedeutenden Höhen auf sie zu stürzen, sie aber auch anwende, um herabrollende, ihm Verderben drohende Steine aufzufangen. Wenn der Steinbock merke, daß er sterben müsse, steige er auf des Gebirges höchsten Kamm, stütze sich mit den Hörnern auf einen Felsen, gehe in Kreisen rings um denselben herum, und treibe dieses Spiel fort, bis daß die Hörner ganz abgeschliffen wären: dann falle er um und verende.
Die Stimme des Steinbockes ähnelt dem Pfeifen der Gemse, ist aber gedehnter. Erschreckt läßt er ein kurzes Niesen, erzürnt ein geräuschvolles Blasen durch die Nasenlöcher vernehmen; in der Jugend meckert er. Unter den Sinnen steht das Gesicht oben an. Das Auge des Steinwildes ist nach Wilczeks Erfahrungen viel schärfer, die Witterung dagegen weit geringer als bei dem Gemswilde, das Gehör vortrefflich. Die geistigen Begabungen dürften mit denen der Ziegen insgesammt auf derselben Stufe stehen, wie auch das Wesen im allgemeinen mit dem Auftreten und Gebaren der Hausziegen übereinstimmt. Ein hoher Grad von Verstand läßt sich nicht in Abrede stellen. Der Steinbock beweist seine Klugheit durch die Wahl seiner Aufenthaltsorte und Wechsel, durch berechnende Vorsicht an Stelle der plumpen Scheu anderer Wiederkäuer, sorgfältiges Ueberlegen seiner beabsichtigten Handlungen, geschicktes Ausweichen von Gefahren und leichtes Sichfügen in veränderte Umstände. Nach Art der Ziegen gefällt er sich in der Jugend in neckischen, noch im Alter selbst in muthwilligen Streichen, tritt aber immer selbstbewußt auf und bekundet erforderlichenfalls hohen Muth, Rauf- und Kampflust, welche ihm keineswegs schlecht ansteht. Gefährlichen Thieren weicht er aus, schwächere behandelt er übermüthig oder beachtet sie kaum. Mit den Gemsen will er, wie behauptet wird, nichts zu thun haben und hält sich, unbedrängt, fern von ihnen; Hausziegen dagegen sucht er, vielleicht in richtiger Erkenntnis der zwischen beiden bestehenden Verwandtschaft, förmlich auf, paart sich auch freiwillig mit ihnen.
In stillen, vom Menschen wenig besuchten Hochthälern äst sich das Steinwild in den Vor- und Nachmittagsstunden, in Gebieten dagegen, wo es Störung befürchtet, nur in der Früh- und Abenddämmerung, vielleicht auch des Nachts. Leckere Alpenkräuter, Gräser, Baumknospen, Blätter und Zweigspitzen, insbesondere Fenchel- und Wermutarten, Thymian, die Knospen und Zweige der Zwergweiden, Birken, Alpenrosen, des Ginsters und im Winter nebenbei auch dürre Gräser und Flechten bilden seine Aesung. Salz liebt es außerordentlich, erscheint daher regelmäßig auf salzhaltigen Stellen und beleckt diese mit solcher Gier, daß es zuweilen die ihm sonst eigene Vorsicht vergißt. Ein auf weithin vernehmbares, eigenthümliches Grunzen drückt das hohe Wohlbehagen aus, welches dieser Genuß ihnen bereitet.
Die Brunstzeit fällt in den Januar. Starke Böcke kämpfen mit ihren gewaltigen Hörnern muthvoll und ausdauernd, rennen wie Ziegenböcke auf einander los, springen auf die Hinterbeine, versuchen den Stoß seitwärts zu richten und prallen endlich mit den Gehörnen so heftig zusammen, daß man das Dröhnen des Kampfes auf weithin im Gebirge wiederhallen hört. An steilen Gehängen mögen diese Kämpfe zuweilen gefährlich werden. Fünf Monate nach der Paarung, meist in der letzten Woche des Juni oder im Anfange des Juli, wirft die Ziege ein oder zwei Junge, an Größe etwa einem neugeborenen Zicklein gleich, leckt sie trocken und läuft bald darauf mit ihnen davon. Das Steinzicklein, ein äußerst niedliches, munteres, wie Schinz sagt, »schmeichelhaftes« Geschöpf, kommt mit feinem, wolligem Haar bedeckt zur Welt und kleidet sich erst vom Herbste an in ein aus steiferen, längeren Grannen bestehendes Gewand. Bereits wenige Stunden nach der Geburt erweist es sich fast als ebenso kühner Bergsteiger wie seine Mutter. Diese liebt es außerordentlich, leckt es rein, leitet es, meckert ihm freundlich zu, ruft es zu sich, hält sich, so lange sie es säugt, mit ihm in den Felsenhöhlen verborgen und verläßt es nie, außer wenn der Mensch ihr gar zu gefährlich scheint, und sie das eigene Leben retten muß, ohne welches auch das ihres Kindes verloren sein würde. Bei drohender Gefahr eilt sie an fürchterlichen Gehängen hin und sucht in dem wüsten Geklüfte ihre Rettung. Das Zicklein aber verbirgt sich äußerst geschickt hinter Steinen und in Felsenlöchern, liegt dort mäuschenstill, ohne sich zu rühren, und äugt und lauscht und wittert scharf nach allen Seiten hin. Sein graues Haarkleid ähnelt den Felswänden und Steinen derart, daß auch das schärfste Falkenauge nicht im Stande ist, es wahrzunehmen oder vom Felsen zu unterscheiden, und dieser vertritt daher einstweilen Mutterstelle. Sobald die Gefahr vorüber ist, findet die gerettete Steinziege sicher den Weg zu ihrem Kinde wieder; bleibt sie aber zu lange aus, so kommt das Steinzicklein aus seinem Schlupfwinkel hervor, ruft nach der Alten und verbirgt sich dann schnell wieder. Wird die Mutter getödtet, so flieht es anfangs furchtsam und entsetzt, kehrt aber bald und immer wieder um und hält lange und fest an der Gegend, wo es seine treue Beschützerin verloren, kümmerlich sein Leben fristend. Wurde die Mutter nur verwundet, so soll der junge Steinbock, wenn jene zu ihm zurückkommt, zwar freudig auf sie zulaufen, aber, sobald er den Geruch des Blutes wahrnimmt, ängstlich von ihr fliehen und durch keine Liebkosungen der Alten zu bewegen sein, wieder zu ihr zurückzukehren.
Bei Gefahr vertheidigt die Steinbockziege ihr Junges nach besten Kräften. Der berühmte Steinbockjäger Fournier aus dem Wallis sah einmal sechs Steinziegen mit ihren Jungen weiden. Als ein Adler über ihnen kreiste, sammelten sich die Mütter mit den Zicklein unter einem überragenden Felsblocke und richteten die Hörner nach dem Raubvogel, je nachdem der Schatten des Adlers auf dem Boden dessen Stellung bezeichnte, nach der bedrohten Seite sich wendend. Der Jäger beobachtete lange diesen anziehenden Kampf und verscheuchte zuletzt den Adler.
Mit ihren nächsten Verwandten, unseren Hausziegen, paaren sich die Steinböcke ohne sonderliche Umstände und erzeugen Blendlinge, welche wiederum fruchtbar sind. Solche Vermischungen kommen selbst während des Freilebens der Thiere vor: zwei Hausziegen im Cognethale, welche den Winter im Gebirge zugebracht hatten, kehrten, wie Schinz mittheilt, im darauffolgenden Frühjahre trächtig zu ihrem Herrn zurück und warfen bald unverkennbare Steinbocksbastarde. Echte Steinböcke paarten sich in Schönbrunn wie in Hellbronn wiederholt mit passend ausgewählten Hausziegen und erzeugten starke und kräftige Nachkommen, welche in der Regel dem Steinbocke mehr glichen als der Ziege, obgleich sie im Gehörn mit dem Ziegenbocke noch große Aehnlichkeit hatten. Ihre Färbung war sehr veränderlich; bald ähnelten sie dem Vater, bald wiederum der Mutter. Die aus der Kreuzung des Steinwildes mit der Hausziege hervorgegangenen Blendlinge wurden wiederum mit Steinböcken gepaart, und so erhielt man Dreiviertelblut, welches noch größere Aehnlichkeit mit dem Steinwilde zeigte, bis man durch nochmalige Vermischung der nunmehr gewonnenen Zucht unechter Steinböcke Thiere erzielte, welche kaum noch von der Urart zu unterscheiden waren.
Verschiedene Ursachen wirken zusammen, daß das Steinwild auch da, wo es sorgsam gehegt wird, nur langsam sich vermehrt. Mit Ausnahme des Menschen hat es von ihm gefährlich werdenden Feinden wenig zu leiden. Große Raubvögel, namentlich der Steinadler und vielleicht auch der Bartgeier, bedrohen, wie aus vorstehend mitgetheilter Beobachtung Fourniers hervorgeht, junge Zicklein, jagen aber, dank der Wachsamkeit ihrer Mütter, wohl nur in seltenen Fällen mit Erfolg auf sie; älteres Steinwild mag unter Umständen durch Luchs, Wolf und Bär gefährdet sein: meines Wissens liegen jedoch keine bestimmten Beobachtungen über Angriffe seitens der genannten Raubthiere vor. Verderblicher als alle genannten Feinde zusammengenommen erweist sich die Unwirtsamkeit des Aufenthaltsortes im Winter und im Frühlinge. Wie Wilczek im Val Savaranche erfuhr, verlieren durch Lawinenstürze alljährlich verhältnismäßig viele Steinböcke ihr Leben, und zwar meist starke Böcke, welche der Gefahr mit kühlerem Muthe in das Auge zu sehen scheinen als die jüngeren, furchtsameren und vorsichtigeren. Die alte Geis soll immer nur ein Jahr um das andere ein Kitzchen bringen und nicht bloß so lange dieses säugt, sondern so lange sie überhaupt mit ihm geht, nicht beschlagen werden. Der schlimmste Feind auch des Steinwildes aber ist und bleibt der Mensch, und zwar der Raubschütze und Bubenjäger in Bauerngestalt. Jenen locken weniger der durch Verwerthung des Wildes zu erzielende Gewinn als die Gefährlichkeit der noch heutigen Tages mit harten Strafen verbotenen Jagd; diesen bewegt einzig und allein der schnöde Vortheil. Wahrscheinlich gibt es kein beschwerlicheres und gefahrbringenderes Unternehmen als die Steinwildjagd, wie sie von den unberechtigten Raubschützen betrieben wird. Alles, was von den Gefahren der Gemsjagd gesagt werden kann, gilt auch, wie Schinz treffend hervorhebt, und in noch höherem Grade von der Steinbockjagd. Wegen der Seltenheit seines Wildes muß sich der Jäger gefaßt machen, acht bis vierzehn Tage, fern von allen menschlichen Wohnungen, also meist unter freiem Himmel im Hochgebirge zu verleben; Frost und Schnee, Hunger und Durst, Nebel und Sturm zu ertragen, bei eisigem Winde oft mehrere Nächte nach einander auf harten Felsen ohne alles Obdach zuzubringen und sehr oft nach langen Prüfungen seines Muthes leer nach Hause zu kehren; er muß selbst im günstigsten Falle mit der mühsam erworbenen Beute alle begangenen Pfade vermeiden, um jeder Begegnung mit Jagdaufsehern auszuweichen; er muß schwindelfrei die furchtbarsten Pfade wandeln können und im Tragen schwerer Lasten geübt, um überhaupt im Stande zu sein, den Lohn seiner Anstrengungen heim zu bringen. So geschieht es nur zu oft, daß er anstatt eines erlegten Wildes Noth und Elend in seine ärmliche Hütte bringt, ganz abgesehen davon, daß er jeden Tag Gefahr läuft, durch Abstürzen oder durch die Kugel des Jagdberechtigten gefällt, in grausiger Tiefe zu zerschellen und Adlern und Geiern zur Speise zu werden. Der von solchen Raubschützen glücklich erlegte Steinbock wird, wie Tschudi berichtet, auf der Stelle ausgeweidet, um die schwere Last zu vermindern, sodann an den Läufen und mit dem schweren Gehörn festgebunden und über die Stirn gelegt; denn nur so ist es einem Manne, welcher außerdem noch Gewehr und Jagdranzen zu tragen hat, möglich, mit seiner sechzig bis achtzig Kilogramm schweren Bürde den Rückweg anzutreten.
So verwerflich dieses wie alles Raubschützenthum auch erscheinen mag, mit der nichtswürdigen Bubenjägerei, welche die Bauern betreiben, läßt es sich nie vergleichen. Noch heutigen Tages ist es möglich, junge lebende Steinböcke für einen verhältnismäßig geringen Preis zu erhalten: ich selbst habe einen solchen um die Summe von fünfhundert Franken gekauft; aber es ist dies nur möglich, weil die italienischen und schweizer Raubschützen noch immer nicht gänzlich von dem Jagdgebiete des Königs von Italien ausgeschlossen werden können. Mit Ausnahme der wenigen Steinböcke, welche Victor Emanuel an Thiergärten verschenkte, werden alle, welche gegenwärtig auf den Markt kommen, von italienischen Bubenjägern auf dem Jagdgebiete des Königs gestohlen, und zwar immer als nur wenige Stunden alte Zicklein, welche man erbeutet, indem man schonungslos die Mutter des Thierchens wegschießt. Daß die Jagdaufseher des Königs gegenüber solchem Gesindel, welches außerdem ihr eigenes Leben fortwährend bedroht, unbedenklich zu der Kugelbüchse greifen, läßt sich, wenn auch nicht immer rechtfertigen, so doch entschuldigen, mindestens begreifen.
Rechtmäßige Jagden werden gegenwärtig ausschließlich von Victor Emanuel ausgeführt. Ich danke meinem Gönner und Freunde Wilczek, dem einzigen, welcher jemals die Ehre hatte, von dem hohen Jagdherrn eingeladen zu werden, die nachstehenden Mittheilungen über diese Jagden. Der König verwendet, seitdem er das Jagdrecht der oben namentlich aufgezählten Gemeinden erworben, verhältnismäßig bedeutende Summen auf die Hege des edlen Wildes und bringt alljährlich im Juli und August, d.+h. sobald der Schnee auf den Gletschern geschmolzen ist, mehrere Wochen im Gebirge zu, hier zwischen drei- und viertausend Meter über dem Meere gelegene Jagdhütten oder selbst ein offenes, nicht einmal dem Regen genügend widerstehendes Zelt bewohnend. Von solcher Herberge aus reitet er auf für ihn eigens hergerichteten, jedoch noch immer ungemein wilden Pfaden oft fünf bis sechs Stunden weit bis zu seinem Stande, nachdem seine Jäger am Tage zuvor durch das Fernrohr ausgekundschaftet haben, ob Steinwild in der Kluft steht. In solchen Fällen werden ein- bis zweihundert Treiber aufgeboten, um das scheue Wild gegen die Stände zu treiben. In letzteren, roh ausgeführten Steinthürmen mit Schießlöchern, muß der vom Kopfe bis zum Fuße in Grau gekleidete Schütze vollständig verborgen sein und regungslos verharren, um dem scharfsichtigen Wilde unbemerkt zu bleiben; wird er von ihm gesehen, so ist der Anstand auch trotz der vielen Treiber vergeblich. Da das Steinwild nur nach Verwundung oder in höchster Bedrängnis Gletscher annimmt, dienen solche oft als Seitenwand eines Treibens und werden ebensowenig wie für Wild unzugängliche Felswände durch Treiber verwahrt. Letztere gehen langsam vorwärts, Moränen, Halden und einigermaßen zugängliche Wände als Pfade benutzend, und treiben das Steinwild vor sich her. Dieses bewegt sich nur mit äußerster Vorsicht, beobachtet alles, was vorgeht, auf das genaueste, durchspäht die Gegend mit reger Aufmerksamkeit und verweilt, wenn nicht getrieben, zuweilen stundenlang äugend und windend as einer und derselben Stelle, schreitet überhaupt nur mißtrauisch und zögernd weiter vor. Ungünstiger Wind hindert die Jagd weniger, braucht mindestens nicht in demselben Grade berücksichtigt zu werden wie bei der Gemsjagd; auch darf man ein und dasselbe Gebiet mehrmals nach einander treiben, da die starken Böcke, welche entkamen, an dem folgenden und zweitfolgenden Tage ihren alten Standplatz gewiß wieder aufsuchen. Der gegenwärtige Wildstand gestattet alljährlich fünfzig Böcke abzuschießen; Geisen gelten selbstverständlich als unverletzlich. Außer auf diesen Treibjagden erlegt man das Wild auch wohl auf dem Anstande in der Nähe oft begangener Wechsel oder an den oben erwähnten Salzlecken. Der König geht seinem Gefolge in Ertragung von allerlei Beschwerden und Mühsalen mit dem besten Beispiele voran und bethätigt eine geradezu bewunderungswürdige Ausdauer.
Jung eingefangene Steinböcke gedeihen, wenn man ihnen eine Ziege als Amme gibt, in der Regel gut, werden auch bald zahm, verlieren diese Eigenschaft jedoch mit zunehmendem Alter. Sie haben viel von dem Wesen unserer Hausziege, bekunden aber vom Anfange an größere Selbständigkeit als diese und gefallen sich schon in den ersten Wochen ihres Lebens in den kühnsten und verwegensten Kletterversuchen. Neugierig, neckisch und muthwillig wie junge Zicklein sind auch sie und anfänglich so spiellustig und drollig, daß man seine wahre Freude an ihnen haben muß. Mit ihrer Amme befreunden sie sich schon nach wenigen Tagen, mit ihrem Pfleger nach geraumer Zeit, unterscheiden diesen bestimmt von anderen Leuten und legen Freude an den Tag, wenn sie denselben nach längerer Abwesenheit wieder zu sehen bekommen. Ihre Anhänglichkeit an die Pflegemutter beweisen sie durch kindlichen Gehorsam; denn sie kehren stets zurück, wenn die Ziege meckernd sie herbeiruft, so gern sie auch möglichst ungebunden sich umhertreiben und dabei Höhen erklimmen, welche der Pflegemutter bedenklich zu sein scheinen. Gegen Liebkosungen höchst empfänglich, lassen sie sich doch nicht das geringste gefallen und stellen sich bald auch ihrem Wärter trotzig zur Wehre, den Kopf mit dem kurzen Gehörn in unendlich komischer Weise herausfordernd bewegend. Lammfromm halten sie still, wenn man sie zwischen den Hörnern kraut, muthwillig aber vergelten sie solche Wohlthaten nicht selten durch einen scherzhaft gemeinten, jedoch nicht unempfindlichen Stoß. Je älter sie werden, um so selbstbewußter und übermüthiger zeigen sie sich. Schon mit halberwachsenen Steinböcken ist nicht gut zu scherzen, erwachsene aber rennen, sobald sie erzürnt wurden, den stärksten Mann über den Haufen und sind im Stande, geradezu lebensgefährliche Verletzungen beizubringen.
Auch alt eingefangene Steinböcke lassen sich bis zu einem gewissen Grade zähmen. Graf Wilczek erfuhr aus Victor Emanuels eigenem Munde, daß sie, ebensowenig wie Bergsteinböcke, es aushalten, wenn sie von einem starken Manne über die Schultern gelegt und mit aller Vorsicht getragen, ohne besondere Schwierigkeit dagegen befördert werden können, wenn man eine Bahre für sie herrichtet, sie auf derselben in aufrechter Stellung behutsam fesselt und sie solcherart in die Tiefe schleppt. Im ersteren Falle verenden sie regelmäßig nach wenigen Stunden, meist bereits auf den Schultern des Mannes, unter Anwendung der beschriebenen Vorsichtsmaßregeln gelangen sie weitaus in den meisten Fällen wohlbehalten an ihrem Bestimmungsorte an. Ein in dieser Weise in den Zwinger des Königs von Italien gebrachter Bock nahm eine halbe Stunde nach seiner Ankunft Brod aus der Hand seines hohen Pflegers und Beschützers an.
In Schönbrunn pflegt man gegenwärtig Steinböcke und deren mit Hausziegen erzielten Blendlinge, in der Absicht die östlichen Alpen wiederum mit Steinwild zu bevölkern. Daß solches Vorhaben nicht so leicht ist, als man glaubt, beweisen Versuche, welche man, laut Schinz, in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts in Bern anstellte. Hier wies man den Steinböcken und ihren Blendlingen einen Theil der Stadtwälle an, nährte sie entsprechend und erhielt in erwünschter Weise Nachzucht. Wie die Steinböcke selbst vergaßen auch die Bastarde bald die ihnen erwiesenen Wohlthaten und gaben zuletzt dem Menschen gegenüber weder Liebe noch Furcht zu erkennen. Ein Bastardbock vergnügte sich auf den Wällen die Schildwachen anzugreifen und bekundete dabei eine Beharrlichkeit, welche ihn bald sehr verhaßt machte. Einmal unterbrach er die Beobachtungen des auf seiner Warte arbeitenden Sternkundigen und riß ihm den Rockärmel auf; später gefiel er sich, an den Lustwandelungen der guten Bürger theilzunehmen und die Leute in die Flucht zu jagen; schließlich fiel es ihm ein, auf die Dächer der Gebäude zu steigen und hier die Ziegeln zu zertrümmern. Zahlreiche Klagen wurden laut, und die hochwohlweise Behörde sah sich genöthigt, denselben Rechnung zu tragen: der neckische Bock wurde feierlich verbannt und mit seinen Ziegen auf einem Berge bei Unterseen ausgesetzt. Die Ziegen fanden die Höhe bald nach Wunsch, der Bock aber meinte den bewohnten Gürtel des Gebirges der Nähe der Gletscher vorziehen zu müssen. Zunächst besuchte er die Alpenhütten, befreundete sich hier inniger mit den Ziegen, als den Sennen lieb war, und wurde zuletzt ein so regelmäßiger und zudringlicher Gast, daß er sich nicht mehr vertreiben ließ, sondern von seinem Gehörn den ausgiebigsten Gebrauch machte. Den Sennen stieß er zu Boden, sobald dieser versuchte, sich ihm zu widersetzen, und einmal spielte er dem Manne so arg mit, daß er ihn wahrscheinlich getödtet haben würde, wäre nicht die besorgte Sennerin zu Hülfe geeilt und hätte den Bock geschickt und derb beim Barte, seiner empfindlichsten und fast auch einzigen schwachen Stelle, ergriffen. Solche Gewaltthätigkeiten und Unfug anderer Art machten endlich seine Fortschaffung gebieterisch nothwendig. Vier starke Männer wurden beordert, ihn weiter hinauf in das Gebirge bis auf die Höhe des Saxetenthales zu bringen. Man fesselte den Wildling an einem starken Seile; mehr als einmal aber warf er sein gesammtes Geleite zu Boden. Nunmehr übernahm ein kräftiger Gemsenjäger die Aufsicht über die beabsichtigte Steinbockszucht. Doch auch er hatte seine liebe Noth; denn der Bock schien von Dankbarkeit durchaus keinen Begriff zu haben. Einmal forderte er seinen Hüter zu einem Zweikampfe heraus, welchen dieser wohl oder übel annehmen mußte, weil sich der Vorfall hart am Rande eines Abgrundes zutrug, und der Bock die entschiedenste Lust bezeigte, seinen Herrn und Gebieter in die Tiefe zu stürzen. Eine volle Stunde lang mußte der Mann mit dem Thiere ringen, bevor es ihm gelang, sich seiner zu erwehren. Abgesehen von derartigen Ritterthaten verübte der Bock auch anderweitigen Unfug. Nach wie vor war er der Schrecken der Sennen, welche er, von den Höhen bis zu den Hütten herabkommend, geradezu überfiel und mißhandelte. Nach eigenem Behagen stieg er in die Tiefe hinab, und wenn ihn der Gemsjäger von neuem glücklich zu den ihm angewiesenen Höhen emporgebracht hatte, war er gewöhnlich schneller wieder unten als jener, stieß mit seinen mächtigen Hörnern die Thüren in den Ställen ein, in denen er Ziegen gewittert, besprang dieselben und verfolgte selbst die Sennerinnen in Küche und Milchkeller. Die Hoffnung, daß das Thier nach Beendigung der Brunstzeit wieder zu seiner alten Gesellschaft, welche währenddem ruhig auf den höheren Alpen weidete, zurückkehren würde, erwies sich als eitel; denn wenige Tage, nachdem er einer über ihn verhängten Haft entlassen und auf seine Höhen zurückgebracht war, erschien er plötzlich zu Wilderswyl, hinter einer Herde von Ziegen einherrennend, welche, von ihm gejagt, in voller Eile in das Dorf gelaufen kam. Entsprechend seiner ungebändigten Urkraft hatte unser Bock binnen kurzem mit den Hausziegen der Alpen eine zahlreiche Nachkommenschaft erzeugt und dieser viele von seinen Tugenden vererbt. Seine Sprößlinge liebten wie er das Erhabene, erkletterten die höchsten Spitzen, verführten die sittsamen Hausziegen zu ähnlichen Streichen und verwandelten schließlich die Milch der frommen Denkungsart der Geisen und ihrer Herren und Herrinnen in gährend Drachengift. Von neuem wurde die höhenbewohnende Menschheit klagbar, und eine nochmalige Versetzung des Bockes war die Folge. Man wies ihm die Grinselalpe an; aber auch hier verharrte er in seinem Sinne, band mit allen Hunden, selbst den größten an und warf sie, wenn sie sich stellten, mit kühnem Schwunge seines Gehörnes übermüthig über seinen Kopf weg, stellte sich herausfordernd auf den Pfad der höhenklimmenden Gebirgswanderer und verursachte Schrecken und Entsetzen, wo und wann er sich zeigte. So sah sich endlich die Behörde genöthigt, gegen ihn einzuschreiten; ein hochnothpeinliches Halsgericht wurde über ihn verhängt und der freiheitsdurstige, urkräftige Gesell vom Leben zu Tode gebracht. Eine der Bastardziegen, welche treuinnig mit ihm zusammengehalten hatte, blieb verhältnismäßig sanft und fromm bis an ihr Ende; die Nachkommen aber, welche er in unrechtmäßiger Ehe mit Hausziegen erzeugt hatte, zeichneten sich bei Zunahme des Alters gleichfalls durch besondere Wildheit aus. So lange sie noch jung waren, belustigten sie die Sennen durch ihre muthwilligen Sprünge und Geberden; als sie jedoch älter und kräftiger wurden, fielen sie den Eignern zur Last und wurden sämmtlich geschlachtet. So endete die Berner Steinbockszucht, ohne daß der beabsichtigte Zweck durch sie erreicht werden konnte.
Ueber die Steinbockszucht in Hellbronn bei Salzburg theilt mir Zeller, ein in der Nähe wohnender Waidmann, nachstehendes mit. »Unter großen Kosten ließ sich der verstorbene Erzherzog Ludwig Steinböcke aus Savoyen kommen und setzte dieselben zunächst in besagtem Gehege aus. Anfangs wollten die Thiere hier nicht heimisch werden und gingen bald zu Grunde oder wurden theilweise blind; erst späterhin, als man geeignetes Futter reichte und sie ihrer Natur angemessen behandelte, begannen sie heimisch zu werden. Einer der alten Böcke war so bösartig, daß Fremde nur in Begleitung des Försters den Theil des Parkes betreten durften, welcher dem Steinwilde als Tummelplatz diente; derselbe Bock brach sich später einen Lauf, lebte aber noch lange und hinterließ viele muntere, gesunde Nachkommen, welche theils von wirklichen Steinziegen, theils von gewöhnlichen Gebirgs- und zwar sogenannten Gemsgeisen herrührten. Ein Paar dieser oder der in Hellbronn gezüchteten Steinböcke wurde auf Befehl des Kaisers von Oesterreich in dem Leibgehege von Ebensee ausgesetzt, zwei andere in dem Gehege Hintersee freigelassen. Dort wie hier hielten sie sich gut und schlossen bald Freundschaft mit den auf den Alpen weidenden Ziegen, gesellten sich beim Abtriebe von der Alm im Herbste denselben zu und gingen mit ihnen in den Stall. Nach diesen Wahrnehmungen überließ man den Bauern die edlen Thiere; aber noch gegenwärtig begegnet man in der Umgegend von Ebensee wie von Abtenau Nachkommen jener Steinböcke. Von den im kaiserlichen Reviere von Ebensee freigelassenen Steinböcken trieb es einer ganz ähnlich wie der vorerwähnte in der Schweiz; die übrigen wurden von Zeit zu Zeit noch öfter gesehen, zumal wenn sie die zahmen Ziegen besuchten, bis sie endlich verschwanden, wahrscheinlich weil sie ein Opfer der Wildschützen geworden waren.«
Durch Graf Wilczek, welcher die Güte gehabt hat, meine, durch ihn so wesentlich bereicherte Schilderung des Alpensteinwildes im Vordruck zu überlesen, erfahre ich zu meiner Freude, daß die Versuche, gewisse Alpen des Salzkammergutes wiederum mit den edlen Thieren zu bevölkern, doch nicht gänzlich gescheitert sind. Vor wenigen Wochen (August 1875) schoß der Erzherzog Kronprinz Rudolf in der Nähe der Lambathseen unweit Ebensees einen starken Gemsbock an, welcher in einem sogenannten Kahr oder Karr, einen bis auf die mündende Thalschlucht mit hohen Felsenwänden umgebenen Gebirgskessel, Rettung suchte. Um dem allbeliebten Thronerben eine Freude zu bereiten, entschloß sich einer der verwegensten Bergsteiger der Gegend, dem kranken Wilde in den bisher noch nicht von Menschen betretenen Kessel nachzusteigen. Auf halsbrechenden Pfaden oder vielmehr Unpfaden erreicht der kühne Mann endlich die grausige Tiefe und sieht plötzlich vor sich zwei mächtige »Teufel« in Gestalt riesiger Steinböcke, gefolgt von einer alten Geis nebst Kitzchen und zwei Stück Steinwild mittleren Alters. Einige von den im Jahre 1867 ausgesetzten Steinböcken hatten hier, in dem menschenleersten Theile des Gebirges, ihren Stand genommen und nicht allein sich erhalten, sondern auch fortgepflanzt. Kronprinz Rudolf selbst theilte diese erfreuliche Thatsache meinem Gewährsmanne mit. Nach dieser Wahrnehmung liegt kein Grund mehr vor, an dem endlichen Gelingen der bisher mit so vielen Kosten verbundenen Versuche zu zweifeln. Die wesentlichen Bedingungen für gutes Gedeihen des edlen Wildes sind vorhanden, einige Steinböcke zur Reinhaltung des Blutes aus den Gehegen des Königs von Italien zu erlangen, und somit dürfen wir hoffen, in nicht allzu langer Zeit das Steinwild wiederum unter die Bewohnerschaft der östlichen Alpen zu zählen.
In den ersten Novembertagen des Jahres 1856 unternahm ich in Gesellschaft meines Bruders Reinhold und eines gemeinschaftlichen Freundes, unter Leitung eines eingeborenen kundigen Jägers, eine Besteigung der Sierra Nevada in Südspanien, in der Absicht, auf Steinwild zu jagen. Die Zeit der Jagd fällt eigentlich in die Monate Juli und August, weil dann der Jäger einige Tage lang im Hochgebirge verweilen kann; wir aber kamen erst im November in die Nähe des reichen Gebirges und wollten nicht weiterziehen, ohne wenigstens versucht zu haben, ein Stück des stolzen Gewildes zu erbeuten. Es war ein gewagtes Unternehmen, in der jetzigen Jahreszeit zu Höhen von dreitausend Meter über dem Meere emporzuklettern, und es stand von vornherein zu erwarten, daß unsere Jagd erfolglos sein würde. Dies hinderte uns jedoch nicht, bis zu dem Picacho de la Veleta aufzusteigen und die hauptsächlichsten Jagdgebiete abzusuchen; Schneegestöber und eintretende Kälte zwangen uns aber leider zur Umkehr, und so kam es, daß wir nur die frischen Fährten des ersehnten Wildes, nicht aber Steinböcke selbst entdecken konnten.
Um so erfolgreicher jagte mein Bruder später auf Steinböcke in den mittleren Theilen des Landes, nachdem er sich, zum Danke für geleistete ärztliche Hülfe, der Mitwirkung der Bewohnerschaft eines Dorfes am Fuße der Sierra de Gredos versichert und in den Jagdgebieten gedachter Ortschaft werthvollere Rechte erworben hatte, als irgend jemand vor ihm. Ausgerüstet mit allen erforderlichen Mitteln, insbesondere aber mit einer vortrefflichen Beobachtungsgabe, gelang es ihm nicht allein, eine stattliche Reihe von Bergsteinböcken zu erlegen, sondern auch das Leben der Thiere so eingehend zu belauschen und zu erkunden, daß seine Angaben ebensowohl ein mustergültiges Lebensbild der in Rede stehenden Art zeichnen, wie sie unsere Kenntnis der Steinböcke überhaupt in dieser und jener Beziehung erweitern. Ich gebe im nachfolgenden Beobachtungen meines Bruders wieder und damit die erste eingehende Leibes- und Lebensbeschreibung des schönen, bis jetzt nur als Balg bekannten Wildes.

Bergsteinbock ( Capra pyrenaica). 1/12 natürl. Größe.
Der Bergsteinbock, wie ich das Thier, seinen spanischen Namen »Cabramontés« frei übersetzend, genannt wissen möchte, der Pyrenäensteinbock älterer Forscher ( Capra pyrenaica, C. hispanica, Ibex oder Aegoceros pyrenaicus und hispanicus), erreicht vollkommen die Größe des Alpensteinbocks, unterscheidet sich jedoch von ihm sehr wesentlich durch die Gestalt und Bildung der Hörner. Der ausgewachsene Bock ist 1,45 bis 1,6 Meter lang, wovon auf den Schwanz ohne Büschel 12 Centim. zu rechnen sind, und am Widerriste 75 Centim., am Kreuze dagegen 78 Centim. hoch; die Ziege erreicht höchstens drei Viertheile der angegebenen Länge und bleibt in der Höhe um durchschnittlich 10 Centim. hinter dem Bocke zurück. Die Gehörne des letzteren stehen an der Wurzel so dicht zusammen, daß vorn ein Zwischenraum von höchstens 4, hinten von nur 1 Centim. bleibt, steigen anfangs steil aufwärts, nur wenig nach außen sich wendend, biegen sich vom ersten Drittheil ihrer Länge an scharf nach außen, wenden sich, leierförmig aus einander tretend, fortan zugleich nach hinten, erreichen mit Beginn des letzten Drittheils ihren weitesten Abstand von einander, kehren nunmehr die Spitzen wieder gegen einander und richten sie ebenso etwas aufwärts. Ihr Querschnitt ist im allgemeinen birnenförmig gestaltet, da sie, schief von vorn gesehen, abgerundet und an der gegenüberstehenden Seite beinahe scharfkantig zusammengedrückt sind; außer der hinteren, vorder- und hinterseits aus sanft abgeflachten Bogen hervorgehenden, wulstig erscheinenden Kante zeigen sie jedoch noch eine zweite, welche vorn, gerade über der Stirne, entspringt, mit jener, gegen die Spitze hin zusammenlaufend, in gleichmäßig abnehmendem Abstande längs des ganzen Hornes verläuft und mit diesem derartig sich dreht, daß sie im ersten Drittheil der Gehörnlänge nach vorn, im letzten nach außen gewendet ist, während die stärkere und schärfere Hinterkante ebenso mehr und mehr nach vorn und oben sich kehrt. Nach der Spitze zu verlieren sich die Kanten allmählich, und das Horn erscheint rundlich, obgleich die Neigung, ein an der Wurzel abgerundetes Dreieck zu bilden, auch jetzt noch wahrnehmbar bleibt. Die Wachsthums- oder Jahresringe sind als Querwülste deutlich erkennbar, ohne jedoch eine so bestimmte Gliederung wie beim Alpensteinbocke zu bilden. Länge und Dicke der Hörner nehmen beim Bocke mit den Jahren merklich zu, wogegen das bei weitem schwächere, an Stärke dem unserer Hausziege etwa gleichkommende, ungefähr 15 Centim. lange, einfach nach hinten gekrümmte, bis zu zwei Dritttheilen seiner Länge mit vielen und dicht stehenden, schmalen Wülsten bedeckte Gehörn der Ziege, falls dieselbe erst ein gewisses Alter erreicht hat, kaum noch sich verändert. »Ich besitze«, schreibt mir mein Bruder, »das Gehörn eines alten Bergsteinbockes, dessen Stangen bei 76 Centim. Länge, 22 Centim. Umfang an der Wurzel und doch nur elf Jahresringe zeigen, zweifle jedoch nicht, daß die Hörner, der Krümmung nach gemessen, bis zu einem Meter an Länge erreichen können.«
Beschaffenheit und Färbung des im Winter ungemein dichten, im Sommer dünnen Haarkleides ändern nicht allein nach Jahreszeit, Alter und Geschlecht, sondern, wie bei allen Felsenthieren, auch nach der Oertlichkeit nicht unwesentlich ab. Nachdem im Mai der Haarwechsel eingetreten und das wollige Kleid in dichten Flocken und Büscheln ausgefallen ist, wachsen, wie üblich, zunächst die von der Wurzel bis zur Spitze gleichgefärbten Grannen hervor und erreichen bis Ende August eine Länge von 2 Centim., wogegen ein mähnenartiger, hinter den Hörnern beginnender und bis zu den ersten Rückenwirbeln sich fortsetzender Haarstreifen ebenso wie der Bart und die Schwanzquaste einem ähnlichen Wechsel nicht unterworfen ist, vielmehr durch theilweises Nachwachsen der Haare ergänzt wird. Es haben deshalb diese Haarwucherungen jahraus jahrein annähernd dieselbe Länge, jener eine solche von 8 bis 9, der Bart von 9, der Schwanzbüschel von 12 Centim., sind jedoch merklich weniger dicht als im Winter. Ein schönes, nur auf Nasenrücken, Stirn und Hinterkopf dunkelndes, hier oft mit Schwarz gemischtes Hellbraun ist jetzt die vorherrschende Färbung des Thieres; ein dreieckiger, mit der Spitze dem Rücken zugekehrter Fleck, ein die Ober- und Unterseite trennender Flankenstreifen und die Vorderseite der Läufe sind schwarz, Oberlippe, Backen, Halsseiten, Innenfläche der Schenkel hellgrau, die übrigen Untertheile weiß. Im Spätherbste beginnt die Wucherung des kurzen, dichten, weichen weißgrauen Wollhaares und gleichzeitig die Umfärbung der inzwischen reichlicher nachgewachsenen Grannen, welche im Winter zwischen 3 bis 4 Centim. an Länge erreicht haben, dann sehr dicht stehen und an der Wurzel hellgrau, in den übrigen zwei Drittheilen ihrer Länge dunkel gefärbt sind. Im vollendeten Winterkleide herrschen ein in das Braune spielendes Schwarz und Grau vor, erstere Färbung auf Nasenrücken, Stirn und Vorderhalse, letztere zwischen Auge und Ohr an den Kiefergelenken, den Halsseiten bis zu den Schulterblättern und auf den Seiten bis zur Mitte des Hinterschenkels; doch mischt sich an allen genannten Theilen Schwarz oder Schwarzbraun ein, weil viele Grannen in schwarze Spitzen endigen. Die Begrenzung der Farbenfelder ist folgende: Nasenrücken bis zur Oberlippe, Stirn, Unterkiefer, Bart, ganze Vorderseite des Halses, Brust, Seiten des Bauches, Hinterkopf, Hinterhals und Rücken sind schwarz, Vorderseite der Läufe bis zu den Hufen herab und ein am Hinterkopfe beginnender, die im Sommer wie im Winter gleichgefärbte Mähne in sich fassender, in gerader Linie längs des Rückgrats bis zur Schwanzspitze verlaufender, 3 bis 4 Centim. breiter Streifen, ein auf den Schulterblättern von ihm sich abzweigender, bis zu den Vorderläufen sich erstreckender, mit jenem ein Kreuz bildender Querstreifen kohlschwarz, Oberlippe, Backen vom oberen Augenlide bis zum Kieferwinkel, Seiten, vom Schulterblatte an beginnend, hellgrau, ein die Seiten unten und hinten einfassender Streifen und die Hinterschenkel schwarzbraun, letztere durch einzelne graue Haare gesprenkelt, ein auf dem Brustbeine beginnender, 3 Centim. breiter Streifen endlich, welcher sich auf dem Bauche ausbreitet und zuletzt diesen wie die innere Fläche der Hinterschenkel bedeckt, sowie seine Fortsetzung nach oben hin, wo er den schwarzen Schwanz beiderseitig saumartig einfaßt und dem langen Büschel desselben einzelne, mit ihm gleich gefärbte Haare einmischt, reinweiß von Farbe.
Die Färbung der Ziege ist wenig veränderlich, jedoch ebenfalls im Sommer heller, im Winter dunkler. Rehfarben oder Hellbraun herrscht vor; schwarz sind die Vorderseiten der Läufe, von den Hand- und Fersengelenken an bis zu den Hufen herab, schwarz mit grau gemischt die Hinterseiten derselben. Auch ein Streifen längs des Brustbeines von 3 Centim. Breite und doppelter Länge hat schwarze Färbung. Die Zicklein gleichen der Mutter, ihre Hauptfärbung ist jedoch nicht hell-, sondern dunkelkastanienbraun, die der Läufe schwarzbraun.
Von der vorstehend beschriebenen Art glaubte Schimper den auf den süd- und ostspanischen Gebirgen lebenden Steinbock unter dem Namen Capra hispanica unterscheiden zu dürfen; die Merkmale des einen und anderen Thieres sind aber so übereinstimmende, daß sich die Trennung schwerlich aufrecht erhalten läßt. Die Steinböcke der Sierra de Gredos wie die der Serrania de Ronda und der Sierra Nevada in Andalusien, der Sierra de Segura in Murcia, der Sierra de Cuenca und dem Monte Carroche in Valencia haben dasselbe Gehörn wie der Bergsteinbock, sind jedoch in der Regel etwas kleiner und heller gefärbt; insbesondere ist das Schwarz nicht so ausgedehnt wie bei diesem. Auf so unbestimmte und ungewichtige, wahrscheinlich auch nur für das Sommerkleid geltende Merkmale läßt sich keine Art begründen, und ich habe deshalb kein Bedenken getragen, beide in Spanien lebende Steinböcke zu vereinigen.
Demgemäß erstreckt sich das Verbreitungsgebiet des Bergsteinbocks von der Küste des Golfs von Biscaya bis zum Mittelmeere und von den Pyrenäen bis zur Serrania de Ronda. Außer den oben genannten Gebirgen bewohnt er die Sierra Morena, die Montes de Toledo, die Pyrenäen und alle höheren Gebirgszüge Nord- und Mittelspaniens, in besonderer Häufigkeit namentlich die Sierra de Gredos, wogegen er auf den Gebirgen der kantabrischen Küste gänzlich zu fehlen scheint. »Die Sierra de Gredos«, so schildert mein Bruder, »wird durch die höchste Erhebung der Cordillera Carpeto gebildet, jenes Gebirgszuges, welcher sich von Moncayo an durch Kastilien und Estremadura zieht, die Wasserscheide zwischen Duero und Tajo herstellt, Altkastilien von Neukastilien trennt, als Sierra des Estrella in Portugal eintritt und als Sierra de Cintra am Gestade des Atlantischen Weltmeeres endet. Der höchste Berg dieses langen Gebirgszuges, der Almanzor, welcher zu 2650 Meter aufsteigt, nebst Umgebung ist der Lieblingsaufenthalt unseres Steinwildes. Im Winter mag es, zumal auf der Südseite des Gebirges, nach Estremadura hin, etwas tiefer herabsteigen; im Sommer aber wird man es in der nächsten Umgebung des Almanzor niemals vermissen und in der Regel in starken Rudeln, namentlich solchen, welche aus alten Böcken bestehen, mit Sicherheit beobachten können.
»Das Bergsteinwild lebt während des größten Theiles vom Jahre nach dem Geschlechte getrennt; nur gegen die Paarzeit hin vereinigen sich Böcke und Ziegen. Beide bilden Rudel, nicht selten aber auch förmliche Herden, welche aus ein- bis anderthalbhundert Stück bestehen können. Ich selbst konnte einmal hundertundfünfunddreißig Böcke genau zählen. Es mag sein, daß solche Herden fast alle auf der Gredos lebenden Böcke in sich vereinigen; doch habe ich gelegentlich eines Treibens auch einmal vierundsiebzig Ziegen, welche gewöhnlich in kleinen Trupps über das ganze Gebirge zerstreut zu sein pflegen, zusammen gesehen und gezählt. Unbekümmert um Schnee und Kälte in dem von ihnen erwählten Gebiete bewohnen die Böcke in der Regel ausschließlich den oberen und höchsten Theil des Gebirges, wogegen die Ziegen schon im Spätherbste die nach Süden gelegenen Wände aufsuchen und in strengen Wintern bis in die Nähe der Dörfer hinabsteigen. Das Rudel wie die Herde wird stets von dem stärksten und, was wohl gleichbedeutend, von dem ältesten und erfahrensten Stücke geleitet. Langsamen Schrittes sieht man das Bergsteinwild an den steilen Wänden und auf den Graten eines Gebirgszuges dahinziehen, unter allen Umständen vorsichtig nach jeder Seite hin äugend und spähend und ebenso fort und fort windend. Das Leitthier schreitet dem Rudel voran und sichert, bleibt darauf, nachdem es eine Entfernung von zehn bis zwölf Schritten zurückgelegt hat, seinerseits stehen, das Rudel, welches sich nunmehr in Bewegung setzt, erwartend, worauf es wie vorher weiter zieht. Wenn ein Trupp von Bergsteinziegen weidet, stellen sich stets mehrere Stücke so auf, daß sie als Wachen dienen können und sichern und winden beständig. Bemerkt eine Wachtgeis etwas verdächtiges, oder führt ihr der Wind die Witterung eines Feindes zu, so stößt sie ein pfeifendes Schnauben aus, stürzt sich von ihrem Auslugpunkte herab, und wird, wie der ihr folgende Trupp, sofort flüchtig, entweder trabend oder in Galopp fallend, je nachdem die Gefahr ferner oder näher ist. Nach kurzer Zeit unterbricht das Rudel seine Flucht, um die Ursache der Störung genauer zu erkunden. Führte diese das Erscheinen eines Menschen herbei, so geht der Trupp oder die Herde rascheren Schrittes weiter und wechselt dann meist bis auf eine halbe, oft bis auf eine volle Gehstunde; war es ein Wolf oder Hund, welcher schreckte, so erklettert das Bergsteinwild einfach eine steile Wand und nimmt hier Stellung auf Oertlichkeiten, welche den genannten Verfolgern vollkommen unzugänglich sind. Unglaublich scheint es, daß das Bergsteinwild beinahe senkrechte Wände, an denen man auch nicht den geringsten Anhaltepunkt wahrzunehmen vermag, nicht allein mit der größten Sicherheit, sondern auch mit überraschender Leichtigkeit und Schnelle zu ersteigen im Stande ist, und daß schon die kleinsten Zicklein, ebensogut wie die alten Ziegen, mit ihren scharfkantigen Hufen an solchen Felsen förmlich sich ankleben können.
»Wähnt sich die Herde vollkommen sicher, so legt sich ein Theil derselben mit ausgestreckten Läufen behaglich nieder, um auszuruhen und wiederzukäuen, während ein anderer Theil die Spitzen der Gräser und die saftigsten Mitteltriebe anderer Alpenpflanzen, insbesondere aber die Blüten der niederen Ginsterbüsche ( Spartium scoparium und Sp. horridum) abäst und zwei oder drei Stück als Wachtthiere dienen. Brennt die Sonne gar zu stark, so lagert sich das Rudel im Schatten vorspringender Felsen oder tritt in Höhlen ein, niemals jedoch, ohne durch ausgestellte Wachtgeisen für Sicherung genügend gesorgt zu haben.
»Die Böcke sind immer weniger achtsam und vorsichtig als die Geisen. Sehr alte zumal bleiben öfters hinter dem Rudel oder der Herde zurück und lassen zuweilen einen gegen den Wind sich anschleichenden Menschen bis in ihre nächste Nähe kommen. Anstatt sogleich die Flucht zu ergreifen, wie die Ziegen fast stets thun, springen sie auf einen Felsen oder höheren Steinblock, äugen den Feind einige Minuten an und bieten so dem Jäger oft ein sicheres Ziel. Ich selbst habe unter solchen Umständen einmal einen sehr starken Bock erlegt. Auch auf seinen Wanderungen ist ein von der Herde getrennter Bock weit weniger scheu, als wenn er letztere begleitet. Ein durch die Treiber in weiter Entfernung von uns angestellten Schützen aufgeregter Bergsteinbock ging langsam auf meinen Nebenmann zu, wurde von diesem zweimal gefehlt, hierauf für kurze Zeit flüchtig, fiel, nachdem er einige hundert Schritte rasch zurückgelegt hatte, wieder in seinen ruhigen Gang, gelangte hinter meinen, nach vorn hin gut verbauten, auf der Rückseite aber offenen Stand, staunte mich, der ich nichts ahnte, wenigstens fünfzehn Minuten lang an und zog dann ruhig weiter. So erzählten mir meine Jagdgenossen nach beendigtem Treiben zu meinem großen Verdrusse.
»Harmlosen Thieren gegenüber bekundet das Bergsteinwild weder Furcht noch Zuneigung. Doch sieht man in der Sierra de Gredos im Hochsommer, wenn die Ziegenherden der Dörfler am Fuße des Gebirges bis in das Gebiet der Steinböcke emporsteigen, zuweilen beide Thierarten friedlich neben einander weiden.
»Anfangs November tritt die Brunstzeit ein. Nunmehr gesellen sich die Böcke zu den Ziegen, und es beginnen gleichzeitig die heftigsten Kämpfe zwischen ersteren, zumal zwischen sehr alten Herren, jedenfalls als fesselndes Schauspiel für die jungen Thiere, welche ruhige Zuschauer bleiben. Schon im December trennen sich beide Geschlechter wieder; jedoch halten sich auch dann noch meist einige junge, d.+h. ein- bis dreijährige Böcke zu der Ziegenherde. Ende April oder anfangs Mai, also zwanzig- bis vierundzwanzig Wochen nach der Paarung, setzt die Ziege ein Junges, welches wenige Stunden nach seiner Geburt der Mutter auf ihren Pfaden leicht und sicher folgt und von ihr sorgsam gepflegt und gehütet wird. Nur auf der Südseite des Gebirges und hier an den sonnigsten Wänden nehmen jetzt die Ziegen ihren Stand, und, anstatt kahle Abhänge aufzusuchen, wählen sie die mit Ginstergebüsch bewachsenen Lehnen und Schluchten und verbringen auf und in ihnen den größten Theil des Spätfrühlings und Frühsommers. Werden sie aufgeschreckt, so laufen die Zickelchen neben der Mutter her; können diese bei hitziger Verfolgung der alten Geisen nicht nachkommen, so ducken sie sich unter einem dichten Strauche, hinter einem schützenden Felsblocke, in einer Felsenspalte etc. und verharren hier bis zur Rückkehr der Alten. Schneefelder übersteigen die Bergsteinziegen überhaupt sehr ungern, vermeiden sie aber, wenn sie Zicklein führen, fast ängstlich.
»Auch das Bergsteinwild soll seit fünfundzwanzig Jahren in der Sierra de Gredos bedeutend abgenommen haben, und in der That kann dies kaum anders sein, da der Spanier von einer Hegezeit keine Vorstellung hat, außerdem gerade in unserem Gebirge jeder Hirt ein Gewehr führt und während seines monatelangen Aufenthaltes in den Höhen bei Tag und Nacht dem edlen Wilde nachschleicht. Wollte und könnte man streng verbieten, Geisen während der Frühlingsmonate zu erlegen, so würde sich gerade das Steinwild, welches außer dem Menschen wenige Feinde hat, in kürzester Frist wieder bedeutend vermehren. Bartgeier, Stein- und Kaiseradler nehmen wohl öfters ein Zicklein weg, getrauen sich aber, nach Aussage der von mir befragten Hirten, niemals an alte Böcke oder Geisen. Diesen wird außer dem Menschen höchstens der Wolf gefährlich; aber auch er schadet, weil er kaum jemals in bedeutendere Höhen emporsteigt, eigentlich nur im Winter, wenn ein Rudel Bergsteinwild in die Tiefe herabgezogen ist, bei hohem Schnee von Isegrimm in einiger Entfernung von den rettenden Felsenwänden überrascht und durch den Schnee an erfolgreicher Flucht verhindert wird; denn unter solchen Umständen bleiben die Steinböcke nicht selten ermattet liegen oder stecken und fallen dann dem gierigen Räuber leicht zur Beute.
»Der spanische Jäger erlegt das Bergsteinwild entweder auf der Birsche oder auf dem Anstande. Bekleidet mit Hanfschuhen, welche selbst da noch Sicherheit des Ganges gewähren, wo sogar der Alpenschuh versagen würde, klimmt er, oft auf den wildesten Pfaden, zu den Gebirgskämmen empor, sucht, unter genauester Beobachtung des Windes, eine gewisse Höhe zu gewinnen, kriecht, auf Händen und Knien rutschend, bis zur oberen Kante der Felsenwand vor, legt sich hier, nachdem er den Hut abgenommen, platt nieder und sieht in die grausigen Abgründe hinab. Erblickt er kein Wild, so ahmt er den schnaubenden Pfiff desselben nach, um etwa verborgen liegende Stücke aufzuregen, lockt auch, wenn er wohl versteckt ist, nicht selten einzelne Böcke mit demselben Pfiffe bis auf zwanzig Schritte an sich heran, zielt auf die sich ihm schußgerecht bietende Beute lange und sorgsam und gibt dann seinen Schuß ab. Zu solcher Jagd sind jedoch die Lungen und Beine eines eingeborenen Gebirglers unerläßliche Bedingung, für jeden anderen Jäger ist sie zu anstrengend.
»Ich habe auf der Sierra de Gredos die Treibjagd eingeführt und dadurch ausgezeichnete Erfolge erzielt. Unter sorgfältigster Wahrnahme des Windes besetze ich mit den von mir eingeladenen Schützen den Kamm eines Thalkessels; wir kriechen auf allen Vieren nach dem am äußersten Rande der Felsenwände errichteten Stande und vermeiden nach Möglichkeit, daß das etwa im Thalkessel oder an den Wänden sich nähernde Bergsteinwild das geringste, was seine Aufmerksamkeit erregen könnte, wahrzunehmen vermag. Die Treiber haben inzwischen auf weiten Umwegen und geräuschlos alle entfernteren Höhen rings um die an unseren Kessel grenzenden Thäler und Schluchten besetzt und beginnen rechtzeitig, durch Schreien und Hinabrollen von Steinen alles in ihnen sich aufhaltende Wild aufzuregen und in Bewegung zu bringen. Bis auf die Pässe, welche nach dem von uns Jägern besetzten Kessel führen, sind den Bergsteinböcken alle übrigen verlegt worden: sie müssen uns also kommen. Nach und nach wird es lebendig auf den gegenüberliegenden Kämmen; es erscheinen, oft stehen bleibend und auf das von den Treibern verursachte Gelärm lauschend, stärkere oder schwächere Rudel des Wildes; sie steigen endlich langsamen Schrittes in unseren Kessel herab oder ziehen eben so längs den Wänden auf uns zu. Oft beobachtet man, bevor man zum Schusse kommt, mehr als eine Stunde lang das Wild, und gerade darin liegt der Hauptreiz dieser Jagd. In der Regel nähert sich die Herde so langsam dem Stande des Schützen, daß dieser Zeit findet, mit aller Ruhe zu zielen, um dem nichts ahnenden Opfer das tödtliche Blei ins Herz zu senden. In das Herz aber will der Bergsteinbock getroffen sein, sonst ist er, in den meisten Fällen wenigstens, für den Jäger verloren. Sein Leben ist ein so zähes und seine Kraft eine so ausgibige, daß er, wenn auch schwer verwundet, fast regelmäßig noch eine steile Wand ersteigt, sich hier auf einen vorspringenden Felsen oder in irgend einer Höhle lagert und auf diesem für Menschen unzugänglichen Sterbebette verendet. Oft bleibt das Rudel nach dem ersten Schusse ruhig stehen, als sei nichts vorgefallen, und läßt dem Jäger, vorausgesetzt, daß es diesen weder eräugen noch erwinden kann, hinlänglich Zeit, noch einen zweiten Schuß abzugeben. Ist alles zweckentsprechend angeordnet und läßt keiner der Schützen das Wild ungekränkt an sich vorbeiziehen, so können mehrere Jäger nach einander zum Schuß kommen. Jedenfalls ist diese Jagdart die bequemste und sicherste von allen, zumal auf der Sierra de Gredos, wo meine Jäger die zu besetzenden Pässe genau kennen und das Treiben zu leiten verstehen. Fünf bis sieben Tage pflege ich allsommerlich auf diese Jagd zu verwenden, und jedesmal bietet sie mir einen neuen Genuß. Vor Ende Juni ist übrigens kein spanischer Treiber zu bewegen, die Schneefelder um den Almanzor abzusuchen, und schon in den letzten Tagen des August geht die Jagd zu Ende, weil dann bereits wieder Schneestürme sich einstellen, welche in jenen einsamen, aller Unterkunft baren Gebirgen auch den abgehärteten, wettergestählten Jäger auf das äußerste gefährden.
»Für den eingeborenen Schützen ist der Gewinn der Jagd nicht unbedeutend. Jener weidet das erlegte Bergsteinwild sofort nach dem Schusse aus, füllt die Leibeshöhlen mit wohlriechenden Kräutern an und schleppt dann die schwere Last, auf oft halsbrechenden Wegen, in die Tiefe, zunächst bis zu einer passend gelegenen Meierei, von wo aus die Beute auf Maulthieren weiter geführt wird. Das Wildpret ist sehr beliebt und steht deshalb überall hoch im Preise; aber auch Haut und Gehörn bezahlt man recht gut.
»Der Fang unseres Wildes ist Sache des Zufalls. Besonders geübte Jäger machen sich tiefen Schnee zu Nutze, um Bergsteinwild, nachdem sie die Pässe besetzt haben, mit Hunden zu hetzen. Da kommt es denn vor, daß Bergsteinböcke lebend gefangen werden. Im vergangenen Winter erbeutete man bei einer derartigen Jagd sieben Stück. Auch im Sommer suchen verwegene Gebirgsleute Bergsteinwild zu berücken. So bin ich selbst einmal Zeuge gewesen, daß ein Jäger unter dem Winde unbemerkbar bis an eine Höhle, in welcher ein starker Bock Schutz gegen die Hitze gesucht hatte, sich heranschlich und hier, anstatt zu schießen, versuchte, das Thier lebend zu fangen, indem er diesem den engen Ausweg vertrat. Gedachter Versuch mißglückte aber: denn kaum gelang es dem kühnen Jäger, sich so fest zu halten, daß er von dem herausstürmenden Bocke nicht in den Abgrund gestürzt wurde. Alt eingefangene Bergsteinböcke in Gefangenschaft zu erhalten, scheint übrigens unmöglich zu sein. Jenen sieben Stücken band man nach dem Fange die Läufe zusammen, um sie so nach dem Dorfe hinabschaffen zu können. Fünf von ihnen starben nach etwa zweistündigem Marsche bereits unterwegs, hauptsächlich wohl infolge der sie quälenden Angst und Furcht; die beiden übrigen langten zwar lebend im Dorfe an, rasten sich aber in dem ihnen angewiesenen Stalle binnen wenigen Stunden zu Tode.«
Die Ziegen im engsten Sinne ( Hircus) sind durchschnittlich etwas kleiner als die Steinböcke, ihre Hörner mehr oder weniger zusammengedrückt, beim Männchen schneidig und mit Querwülsten oder Runzeln versehen, beim Weibchen geringelt und gerunzelt. Im übrigen ähneln die Ziegen den Steinböcken in jeder Beziehung, können auch kaum von ihnen getrennt werden und stellen deshalb eine Untersippe von zweifelhaftem Werthe dar.
Auch unsere Hausziege theilt das Schicksal der übrigen Hausthiere: man weiß nicht, von welcher Art sie abstammt. Ueber die wildlebenden Ziegen, welche namentlich Asien bewohnen, wissen wir noch so wenig, daß wir nicht im Stande sind, ihre Artenzahl auch nur annähernd anzugeben. Viele Naturforscher glauben, daß wir vor allen anderen wildlebenden Arten der Bezoarziege die Ehre zuerkennen müssen, uns mit einem so nützlichen Hausthiere bereichert zu haben. Letzteres stimmt in der That in allen wesentlichen Merkmalen mit ersterer überein; nur die Richtung und Windung der Hörner ist eine andere.
Die Bezoarziege oder der Paseng ( Capra Aegagrus, Hircus und Aegoceoros Aegagrus, Capra bezoartica, Aegoceros pictus) ist zwar etwas kleiner als der europäische Steinbock, aber doch merklich größer als unsere Hausziege. Die Länge des ausgewachsenen Bockes beträgt etwa 1,5 Meter, die Länge des Schwanzes 20 Centim., die Höhe am Widerrist 95 Centim. und die am Kreuze 2 Centim. mehr. Die Ziege ist merklich kleiner. Der Leib ist ziemlich gestreckt, der Rücken schneidig, der Hals von mäßiger Länge, der Kopf kurz, die Schnauze stumpf, die Stirn breit, längs des Nasenrückens fast gerade, das Auge verhältnismäßig, das Ohr ziemlich groß; die Beine sind verhältnismäßig hoch und stark, die Hufe stumpf zugespitzt; der Schwanz ist sehr kurz und gleichmäßig mit langen zottigen Haaren besetzt. Die sehr großen und starken, von beiden Seiten zusammengedrückten und hinten und vorn scharfkantigen, auf der äußeren Seite aber gerundeten oder gewölbten Hörner, welche schon bei mittelgroßen Thieren über 40 Centim., bei alten oft mehr als das Doppelte messen, bilden, von der Wurzel angefangen, einen starken, einfachen und gleichförmig nach rückwärts gekrümmten Bogen, welcher bei alten Männchen ungefähr einen Halbkreis beschreibt, stehen an der Wurzel eng zusammen, beugen sich sodann bis über ihre Mitte hin allmählich nach abwärts, wenden sich aber mit der Spitze wieder stark nach vor- und einwärts, so daß sie an ihrem äußersten Ende um 12 bis 15 Centim. näher zusammenstehen als in der Mitte, wo die Entfernung zwischen beiden 30 bis 40 Centim. beträgt. Das rechte Horn ist schwach mit der Spitze nach rechts, das linke nach links gewunden. Die Knoten oder Querwülste des Gehörns, zwischen denen zahlreiche Querwurzeln liegen, steigen bei alten Thieren bis auf zehn und zwölf an. Beide Geschlechter tragen einen starken Bart; die übrige Behaarung besteht aus ziemlich langen, straffen, glatt anliegenden Grannen und kurzen, mittelmäßig feinen Wollhaaren. Die Färbung ist ein helles Röthlichgrau oder Rostbräunlichgelb, welches an den Halsseiten und gegen den Bauch hin wegen dem hier reichlicher auftretenden weißspitzigen Haare lichter wird; Brust und Unterhals sind dunkelschwarzbraun, Bauch, Innen- und Hinterseite der Schenkel weiß. Ein scharf abgegrenzter, von vorn nach hinten sich verschmälernder, dunkelschwarzbrauner Längsstreifen verläuft über die Mittellinie des Rückens bis zu dem einfarbigen schwarzen Schwanze. Hinter den Vorderbeinen beginnt ein gleichfarbiger Streifen, welcher die Ober- und Unterseite scharf von einander scheidet. Die Vorderläufe sind vorn und seitlich dunkelschwarzbraun, über der Handwurzel, wie die hinteren, weiß gestreift. Der Kopf ist an den Seiten röthlichgrau, auf der Stirn braunschwarz, vor dem Auge und an der Wurzel des Nasenrückens wie Kinn- und Kehlbart dunkelschwarzbraun, an den Lippen weiß.
Das Verbreitungsgebiet der Bezoarziege erstreckt sich über einen ausgedehnten Landstrich West- und Mittelasiens. Sie findet sich auf der Südseite des Kaukasus, im Taurus und den meisten übrigen Gebirgen Kleinasiens und Persiens, bis weit nach Süden hin, kommt aber auch auf mehreren Inseln des Mittelländischen, insbesondere des Griechischen Meeres und vielleicht sogar auf den höheren Gebirgen der Griechischen Halbinsel vor. Wie die neuesten Untersuchungen fast außer Zweifel stellen, ist sie nämlich dasselbe Thier, dessen Homer bei Schilderung der Kyklopeninsel gedenkt:
»Der Ziegen unendliche Menge durchstreift sie,
Wilden Geschlechts, weil nimmer ein Pfad der Menschen sie scheuchet«.
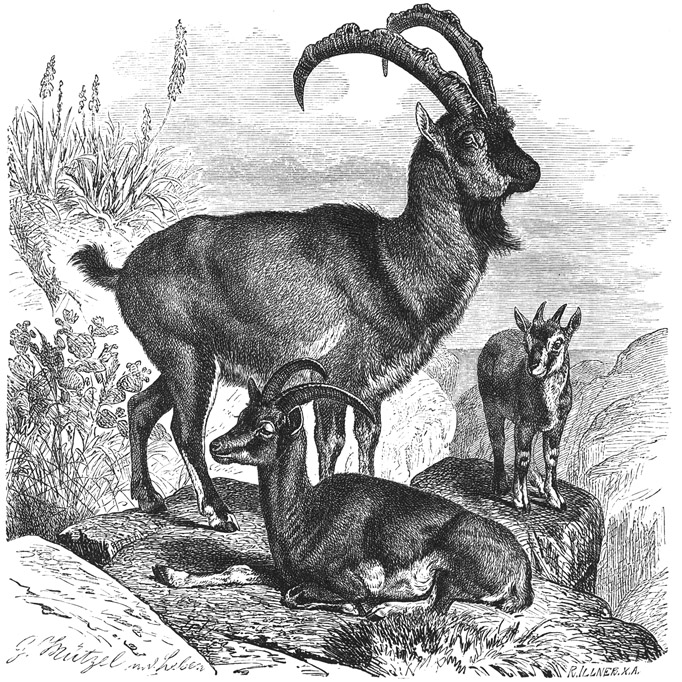
Bezoarziege ( Capra Aegagrus). 1/18 natürl. Größe.
Schon seit Belons Zeiten, seit Mitte des sechzehnten Jahrhunderts also, wußten wir, daß auf Kreta eine Wildziege lebe, und später wurde in Erfahrung gebracht, daß dasselbe Thier oder ein ihm sehr ähnliches auch auf den Kykladen vorkommt. Im Jahr 1844 berichtet Graf von der Mühle folgendes: »Auf der Insel Joura bei Skopelos, nördlich von Euböa, welche, einen alten Einsiedler ausgenommen, ganz unbewohnt ist, wimmelt es von einer Ziegenart, – von welcher, konnte ich nicht erfahren, selbst trotz aller Anstrengungen und Versprechungen nicht einmal ein Gehörn erhalten. Sie sind so schlimm, daß sie den Jäger anfallen, und, wenn er nicht vorsichtig ist, ihn über die Felsen hinabstürzen. Im Jahre 1839 wurde eine Abtheilung griechischer Soldaten durch widrigen Wind auf diese Insel verschlagen, welche in kurzer Zeit zwanzig Stück theilweise mit den Bajonetten erlegten. Dieselbe Ziege kommt auch auf dem Veluchi- und Oetagebirge vor«. Zehn und beziehentlich zwölf Jahre später theilt nun Erhard mit, daß auch er von dem Vorkommen wilder Ziegen auf Kreta, mehreren Kykladen und Strophaden Kunde gewonnen habe und im Mai des Jahres 1854 in den Besitz einer auf Eremomelos oder Antimelos, einem kleinen, aber sehr hohen und fast unwegsamen Felseneilande, erlegten Wildziege gekommen sei. Der von ihm untersuchte Balg eines erwachsenen männlichen Thieres im Sommerkleide schien ihm mit der Beschreibung des Bezoarbockes nicht übereinzustimmen, und er sah sich deshalb veranlaßt, das fragliche Thier unter den Namen Aegoceros pictus als neue Ziegenart zu beschreiben. In seiner Ansicht wurde er bestärkt, nachdem er im Frühlinge des Jahres 1856 einen von der Insel Joura stammenden, etwa drei Monate alten Bock mit dem seinigen verglichen hatte und in letzterem wie auch in dem ihm später von Kreta zugegangenen Stücke die Bezoarziege erkannte. Nachdem nun aber in den letzten Jahren durch die Bemühungen des englischen Konsuls Sandwith auf Kandia ein lebender Bock der hier vorkommenden Wildziege nach London gelangt war, stellte man die Arteinheit aller Wildziegen der Griechischen Meere und der Bezoarziege fest, und somit zählen wir nunmehr die letztere auch zu den europäischen Thieren. Die auf den Gebirgen des Festlandes vorkommende sogenannte Wildziege soll, nach Erhard, mit unserer Art nichts zu thun haben, und nichts anderes als die Gemse sein. Dagegen ist mir noch in der neuesten Zeit von beachtenswerther Seite versichert worden, daß englische Jäger von Korfu aus die Albanischen Hochgebirge besuchen, um dort auf Wildziegen zu birschen; es erscheint demnach nicht unwahrscheinlich, daß der Paseng auch in diesem, bis jetzt noch so überaus wenig bekannten Theile Europas vorkommt.
Ueber das Freileben der Bezoarziege auf den vorher genannten Inseln gibt Erhard eine, später durch Sandwith vollkommen bestätigte Mittheilung. Auf Kreta findet man unsere Ziege noch auf den meisten Gebirgen, namentlich aber um und auf dem Ida, welcher sich zu 2500 Meter Höhe erhebt, in bedeutender Anzahl. Gewöhnlich sieht man Herden von vierzig bis fünfzig Stück beisammen, welche sich jedoch mit Beginn der Paarungszeit, in der Mitte des Herbstes, in kleinere Rudel von sechs bis acht Stück auflösen. Die Ziege wirft meist noch vor Beginn des Frühlings zwei, seltener drei Junge, welche vom Tage ihrer Geburt an der neu sich bildenden Herde zugesellt werden. Zuweilen begatten sich die Bezoarziegen auch mit ihren gezähmten Abkömmlingen oder Verwandten und erzeugen dann Blendlinge, welche, der Sitte des wilden Vaters getreu, fern von jeder menschlichen Wohnung auf den hohen Spitzen des Ida schwer zugängliche Standorte suchen. Ein solcher Blendlingsbock, größer als jeder andere seiner Verwandten, soll in den fünfziger Jahren auf dem Ida sich umhergetrieben haben und wegen seines bis zum Weiß ergraueten Haares ein allen Hirten wohlbekanntes Thier gewesen sein. Saftige und dürre Kräuter fast ohne Wahl werden als Aesung gedachter Wildziegen angegeben; doch sollen sie den Kapernstrauch mit Vorliebe aufsuchen. Auf Eremomelos lebte unsere Ziege von jeher in viel kleineren Herden und in den oben erwähnten Jahren nur noch in einzelnen Stücken; ihre rasche Verminderung aber soll weniger der Jagd als dem Umstande zuzuschreiben sein, daß Schafe, welche vor Jahren zur Weide auf Antimelos getrieben worden, ihnen eine Seuche mitgetheilt haben, an welcher viele zu Grunde gingen. Da auf dem beschränkten Gebiete der kleinen Insel weder Baum nach Grashalm wächst, so kann die Aesung, laut Erhard, nur in Knospen der alle Inseln des Kykladenmeeres reichlich überziehenden Stachelkräuter, namentlich des Ginsters und Stachelginsters, Strauchbibernells, des Sumach, der Tamariske, des Thymians, Wundklees, Pfefferkrautes, der Flockenblume und anderer niederer Pflanzen bestehen.
Im westlichen Asien, wo die Bezoarziege in allen höheren Gebirgen lebt und meist sehr zahlreich auftritt, bewohnt sie, laut Kotschy, regelmäßig einen Höhengürtel von 1500 Meter an aufwärts, am liebsten diejenigen Stellen des Gebirges, wo um die kahlen Felsspitzen hohe, gelblichblühende Doldengewächse, ihre hauptsächlichste Aesung, in reichlicher Fülle wachsen. Nach Angabe türkischer Jäger, welche sie »Gejick«, die alten Böcke »Thöke« nennen, liebt sie wie der Steinbock die Gipfel der Berge und gefällt sich in der Nähe des ewigen Schnees und der Gletscher. Insbesondere sind es die Böcke, welche im Sommer bis hierher emporsteigen, um, nach Art ihres Geschlechtes zeitweilig, zumeist auf nördlichen Lagen des Gebirges sich aufhaltend, einsiedlerisch zu leben, wogegen die Ziegen und die Zicklein wie die jüngeren Thiere beiderlei Geschlechtes das niedere Alpenland bevorzugen und namentlich die Cederbestände des Hochgebirges zu ihren Ständen erwählen. Nach Kotschy verbringen sie den Tag auf schattigen Felsenrücken in Verstecken und ziehen erst des Nachts auf Aesung, bei dieser Gelegenheit bis über die Baumgrenze hinauf zu dem höheren Alpengürtel aufklimmend. Anderen Angaben zufolge steigen sie frühzeitig am Morgen von dem Walde, in welchem sie die Nacht verbrachten zu den Höhen empor, weiden auf dem Gipfel und auf den höchst gelegenen Gehängen der Gebirge oft in unmittelbarer Nähe der Gletscher, und kehren des Abends nach den Wäldern zurück. Saftige Alpenpflanzen bieten ihnen im Sommer, dürres Gras, Cedernadeln, Blätter und Früchte verschiedener Eichenarten im Winter genügende Aesung, Baumschößlinge und Blattknospen in jeder Zeit erwünschte Zukost; salzhaltige Thonlager, von den türkisch redenden Hirten »Dusla« genannt, werden von ihnen so regelmäßig aufgesucht, daß man auf solchen Stellen mit ziemlicher Sicherheit eine Begegnung mit ihnen erwarten darf und dann wohl auch beobachten kann, wie sie, den Boden beleckend, dahinschreiten, als wären sie mit Grasen beschäftigt. Sobald der eintretende Winter die hohen Kuppen mit Schnee umhüllt, steigen die Böcke zu den Ziegen herab, um sich zu paaren und in ihrer Gesellschaft die ärmere Jahreszeit zu verleben. Mit Beginn des Frühjahres beziehen letztere zuerst die höheren bereits vom Schnee entblößten Lager des Gebirges, um hier ihre Jungen zur Welt zu bringen.
In ihrem Auftreten, Wesen und Gebaren erinnert die Bezoarziege lebhaft an den Steinbock. Rasch und sorglos läuft sie auf schwierigen Wegen dahin, steht oft stundenlang, schwindelfrei in die ungeheueren Abgründe schauend, auf vorspringenden Felszacken, klettert vortrefflich und wagt gefährliche Sätze mit ebensoviel Muth als Geschick. Sie ist außerordentlich scheu und weiß den meisten Gefahren zu entgehen. Ihre Sinne sind vortrefflich entwickelt: sie wittert auf ungeheuere Entfernungen hin und vernimmt auch das leiseste Geräusch. Auch ihre geistigen Fähigkeiten stehen ungefähr auf derselben Stufe wie die des Steinwildes.
Während der Brunst, welche in den November fällt, kämpfen die Böcke hartnäckig und gewaltig mit einander, wie die Scharten und halb abgestoßenen Splitter an der Vorderkante der Hörner zur Genüge beweisen. Der Satz erfolgt im April oder Mai, und zwar bringen jüngere Ziegen ein oder zwei, ältere regelmäßig zwei, nicht allzuselten aber auch drei Zicklein zur Welt. Diese folgen der Mutter sofort nach der Geburt, vom dritten Tage ihres Lebens an selbst auf den schwierigsten Pfaden, wachsen rasch heran und sind, wie alle Ziegen, jederzeit zu Scherz und Spiel geneigt.
Um solche Jungen zu fangen, begeben sich, laut Kotschy, drei bis vier gute Bergsteiger des Cilicischen Taurus, bevor noch die Gerstenernte in den Gebirgsdörfern beginnt, in die Alpen und spähen nach trächtigen Bezoarziegen aus, welche vor dem Wurfe einen schwer zugänglichen Lagerplatz zu erwählen und regelmäßig zu ihm zurückzukehren pflegen. Ist eine solche Ziege aufgefunden und der Zugang zu ihrem Lager als möglich erachtet worden, so bleiben die Bergsteiger in ihrem Verstecke, das Thier beobachtend, bis es geworfen. Am dritten Tage nach der Geburt versuchen sie das Zicklein zu fangen, indem sie die Ziege in die Flucht scheuchen. Nach gelungenem Fange eilt man mit der gewonnenen Beute sofort in das Dorf hinab, um das junge Wildzicklein einer Hausziege, welche kurz vorher zum erstenmal geworfen hat, in Pflege zu geben. Da die Wildziege nicht so milchreich ist wie die Hausziege, überbindet man deren Euter mit einem Lederbeutel, welcher den Zitzen der Bezoarziege täuschend nachgemacht wurde. Alten Ziegen legt man niemals Wildlinge an das Euter, weil sie dann nicht gedeihen. Obwohl die Milch der Bezoarziegen reicher und süßer ist als die der Hausziegen, gewöhnen sich die Wildzicklein doch nicht selten an die Pflegemutter und ihre Milch. Am leichtesten soll die Aufzucht einer zeitig im Jahre und nicht als Zwilling geworfenen Bezoarziege gelingen. Solche wächst, nach Versicherung der Eingeborenen, schnell heran und erhält weit stärkere und längere Hörner als jedes Zwillingsthier, so daß ein alleingeborener Bezoarbock später, wenn er erwachsen ist, für die vorzüglichste Beute erklärt wird.
Unsere Thiergärten erhalten lebende Bezoarziegen noch immer recht selten, obgleich der Versand der von frühester Jugend an eingewöhnten Thiere dieser Art wenig Schwierigkeiten bereitet.
In Westasien treten den Bezoarziegen mehrere Raubthiere feindlich entgegen. Pardelluchs und Panther werden im Taurus, Tiger und Löwe in den persischen Gebirgen den alten, mehrere Adler und vielleicht auch der Bartgeier allüberall den jungen gefährlich. Gelegentlich der Besteigung des hohen Damavendkegels in Nordpersien wurde Kotschy Augenzeuge einer vom Tiger ausgehenden Verfolgung der Bezoarziegen, welche aus Furcht vor dem schlimmen Feinde die ihnen sonst eigene Scheu verloren und sich unter die weidenden Maulthiere unseres Berichterstatters mengten, um hier Schutz zu suchen. Erst als einer der Treiber erschreckt auf einen Tiger zeigte, welcher auf einer Anhöhe, den Ziegen gegenüber, in einer Entfernung von kaum fünfhundert Schritten sichtbar wurde, nunmehr aber, durch den Rauch des Feuers überrascht und gescheucht, murrend und ärgerlich mit dem Schweife wedelnd, von weiterer Verfolgung abstand, erklärte sich die bis dahin unbegreifliche Zutraulichkeit der Wildziegen, welche beim Erscheinen des Raubthieres sofort ihr Heil im Ersteigen der zerklüfteten Felsenwände jenes Bergkegels suchten.
Ein noch heute vielfach verbreiteter, obschon längst widerlegter Aberglaube ist Ursache, daß in vielen Ländern Asiens auch der Mensch den munteren Gebirgskindern eifrigst nachstellt. In dem Magen der erlegten Bezoarziegen vermeint man nämlich jene Kugeln, welche zu dem Namen unserer Thiere Veranlassung gegeben haben, häufiger als bei anderen Wiederkäuern zu finden, und führt deshalb überall da, wo man noch an die Wunderkräfte der Bezoarkugeln glaubt, einen wahren Vernichtungskrieg gegen ihre Erzeuger. Bereits seit uralten Zeiten maßen sich die Fürsten das Vorrecht an, den Bezoarhandel in ihre Hände zu nehmen. Schon der alte Bontius weiß, daß alle, diesen Wunderkugeln zugeschriebenen Kräfte durchaus keinen Arzneiwerth haben; Rumph erzählt, daß die Indianer den Europäer auslachen, welcher behauptet, Bezoarkugeln im Magen wilder Ziegen gefunden zu haben, weil sie ihrerseits wissen wollen, daß die gesuchte Arznei aus den Magen der Affen käme; auch ist es wohl bekannt, daß alle Bezoarkugeln überhaupt benutzt werden, nicht bloß die unserer Ziegen, sondern auch die, welche man bei anderen Wiederkäuern gefunden hat: gleichwohl wird das leidige Quacksalbermittel noch heutigen Tages in ganz Indien und Persien hoch bezahlt und fordert unternehmende Jäger immer zu neuen Vertilgungszügen gegen die Bezoarziegen auf.
Die Jagd ist nicht eben leicht, weil sie nur im hohen Gebirge stattfinden kann, und die Ziege die Verfolgung auch dort noch oft zu vereiteln weiß. Es gilt also, alle Listen und Kunstgriffe anzuwenden, welche bei der Steinbockjagd nothwendig sind. Kämpfer, welcher im Jahre 1686 einer Jagd auf Bezoarziegen beiwohnte, erzählt, daß man erst sechs Stunden auf den schlimmsten Wegen des Gebirges Benna in Persien klettern mußte, ehe man nur in das eigentliche Gebiet der Thiere gelangte. Dort aber gab es deren eine große Menge. Am ersten Tage bekam man nichts, am zweiten wurde ein Bock geschossen, dessen Magen eine Bezoarkugel enthielt. Nach viertägiger Jagd hatte man zwei der letzteren erbeutet, und hierin bestand der ganze Gewinn der Jagd.
Weder auf den Griechischen Inseln noch im Kaukasus oder Cilicischen Taurus scheint man etwas von dem Heilschwindel mittels der Bezoarkugeln zu wissen und stellt daher unseren Wildziegen einzig und allein des Wildprets, der Decke und des Gehörns halber nach. Auf Antimelos wie auf Kreta wird die Jagd bloß an einzelnen Stellen von wenigen mit dem Gebirge wohl vertrauten Hirten betrieben; denn noch heute gelten für die Berge Kretas des Dichters Worte:
»Nie auch wandern hinein nachspürende Jäger, die mühvoll
Durch das Gehölz arbeiten und luftige Gipfel umklettern«.
Dazu kommt die Vorsicht der Wildziegen, welche regelmäßig Wachen auszustellen pflegen, sowie die außerordentliche Lebenszähigkeit der Thiere, welche mit Schüssen durch Lungen und Darm fast ebenso schnell wie unverwundete an den steilen Felswänden hinauflaufen und so dem Jäger meist verloren gehen. Im Nothfalle sollen alte Böcke verwegen genug sein, unvorsichtige Jäger über die furchtbaren Klippen hinabzustürzen. Aus Eremomelos betreibt man die Jagd meistens vom Bote aus, mit Hülfe weittragender Kugelbüchsen, da die hohen Klippen an den meisten Stellen nur mit Lebensgefahr oder gar nicht begangen werden können. Das Fleisch wird als äußerst wohlschmeckend gerühmt und feuert manchen Hirten zur Jagd an; aber selten nur »schenkt ein Gott muthstärkendes Wildpret«, und bloß in wenigen Hütten sieht man den Schmuck des Gehörnes erlegter Böcke als Zeugnisse glücklicher Jagden. Erhard befürchtet, daß die Bezoarziege auf Antimelos unter den vernichtenden Einflüssen des Menschen und der Zeit bald erliegen dürfte; Sandwith dagegen verspricht ihr auf Kreta noch ein längeres und wenig gestörtes Sein, da außer dem Steinadler und Bartgeier, denen doch immer nur jüngere zur Beute fallen, kein anderes Raubthier auf dem Eilande vorkommt. Im Taurus beginnen die Jagden, laut Kotschy, wenn die zahlreichen Herden bereits seit vier Wochen das Alpenland verlassen haben, die Vorräthe für den Winter im Haushalte geordnet und die letzten Feldarbeiten beendet sind. Vier oder fünf Jäger, geübte und ausdauernde Bergsteiger, versehen sich für fünf bis sechs Tage mit einem kuchenartig gebackenen, in Rollen gewickelten Brode, Käse, Zwiebeln, Kaffee und Tabak, welche Vorräthe sie in einem Sacke aus Wildziegenfell auf dem Rücken tragen, steigen zu dem Alpengürtel des Gebirges hinauf, erforschen die Wildfährten und legen sich dann auf den Anstand, in der Regel am Saume eines Gehölzes, in welchem die Bezoarziegen zu ruhen pflegen, weil diese an anderen Stellen des Gebirges nur ausnahmsweise bis auf Schußweite sich beschleichen lassen. Auf erfolgversprechenden Wechseln veranstaltet man auch wohl Treibjagden. Nicht selten durchstreift man das Gebirge mehrere Tage nach einander, ohne auch nur ein Stück des geschätzten Wildes zu sehen, wogegen man zu anderer Zeit mehrmals an einem Tage Trupps von vier bis zwölf Böcken oder Ziegen zu Gesicht bekommt. Ein gewöhnlicher Schütze ist zufrieden, wenn er im Laufe des Winters vier bis fünf Bezoarziegen erbeutet; Kotschy lernte jedoch auch einen Jäger kennen, welcher innerhalb fünfzehn Jahren gegen anderthalbhundert, damit aber doch noch nicht einmal die Hälfte der von seinem verstorbenen Vater getödteten Stücke dieses Wildes erlegt hatte.
Der durch die Jagd erzielte Nutzen ist selbst im Taurus nicht unbedeutend. Das ausgezeichnet schmackhafte Wildpret, welches an das unseres Rehes erinnert und ebenso zart und mürbe wie letzteres ist, wird entweder frisch genossen oder in lange, schmale Streifen geschnitten und an der Luft getrocknet, um es später verwenden zu können, die im Winter erbeutete, langhaarige Decke von den Muselmännern als Gebetteppich benutzt und, weil man ihren scharfen Geruch angenehm findet, hoch geschätzt, die kurzhaarige Sommerdecke zu Schläuchen, das Gehörn zu Säbelgriffen, Pulverhörnern und anderen Kleinigkeiten verarbeitet, so daß sich ein erlegter Bezoarbock immerhin mit dreißig bis vierzig Mark unseres Geldes verwerthet.

Schraubenziege ( Capra Falconeri). 1/12 natürl. Größe.
Unter den übrigen Ziegen verdient zunächst die Schraubenziege, der Markhor oder Markhur, zu deutsch »Schlangenfresser«, der Afganistanen, die Rawacheh oder »Großhornziege« der Tibetaner, die Tsura oder »Wasserziege« der Bewohner Kaschmirs, der Rafs und Rusch anderer Völkerschaften des Himalaya ( Capra Falconeri, Capra megaceros), der Erwähnung, weil auch sie zur Erzeugung der Rassen unserer Hausziegen beigetragen haben dürfte. Die Schraubenziege steht dem Alpensteinbocke an Größe kaum nach: ihre Gesammtlänge beträgt 1,55 Meter, wovon 18 Centim. auf den Schwanz zu rechnen sind, ihre Höhe am Widerrist 80 Centim. Der auf mittelhohen Beinen ruhende Leib ist eher schlank als gedrungen zu nennen, der Hals ziemlich lang, aber kräftig, der Kopf verhältnismäßig groß, das Ohr klein und spitzig, der Schwanz mittellang, das Haarkleid reich und durch einen sehr starken Bart nebst Brustbehang besonders ausgezeichnet. Mehr als alle bisher erwähnten Merkmale treten jedoch die gewichtigen und eigenthümlichen Hörner hervor, obgleich gerade sie in weit höherem Grade als bei anderen Wildziegen abändern. Sie können, der Krümmung nach gemessen, bis zu einem vollen Meter an Länge erreichen, haben einen halbeiförmigen Querschnitt, an dessen beiden Enden sich je eine leistenartige Wulst ansetzt, stehen mit den Wurzeln sehr eng neben einander, richten sich mehr oder weniger gerade nach oben und hinten und drehen sich bald in engerem, bald in weiterem Raume schraubenförmig von innen nach außen, anderthalb bis zwei Windungen beschreibend; ihre hintere Seite ist stärker gekielt als die vordere; die rund umlaufenden Querwülste sind deutlich, die Jahresringe ziemlich tief eingeschnitten. Bei einzelnen Böcken ähneln die Hörner Korkziehern, bei anderen weiten sich die Windungen stärker aus, ohne jedoch ihre schraubige Gestalt zu verlieren; in ersterem Falle erheben sie sich fast senkrecht vom Kopfe und sind vollkommen gerade, in letzterem Falle biegen sie sich mehr nach hinten und außen, verflachen sich auch wohl und erhalten dann ein von jenen so verschiedenes Ansehen, daß man geneigt sein könnte, ihre Träger für eine besondere Art zu erklären, wiedersprächen dem nicht die übrigen sich vollkommen gleichbleibenden Merkmale, insbesondere Beschaffenheit und Färbung des Haarkleides. Letzteres verlängert sich auf dem Oberhalse, den Schultern und längs der Rückenmitte bis zum Kreuze herab so bedeutend, daß es ein mähnenartiges Gepräge annimmt, wuchert aber mit besonderer Stärke an der Vorderseite des Thieres, indem es nicht allein einen starken Kinnbart bildet, sondern sich auch als reicher Behang über Vorderhals und Brust fortsetzt, bei alten Böcken bis auf die Fußwurzelgelenke herabfallend; vom Rücken an nach dem Bauche zu verkürzt es sich mehr und mehr, bis es auf den Beinen wie an der Nase seine geringste Länge erreicht. Die langen Haare erscheinen wegen ihrer welligen Drehung theilweise gelockt, die kurzen dagegen sind glatt und schlicht. Je nach der Jahreszeit ist die Färbung eine etwas verschiedene, im ganzen jedoch immer gleichmäßige. Im Sommerkleide herrscht ein helles, auf dem Oberkopfe und nach den Beinen zu dunkler werdendes Fahl- oder Lichtgraubraun vor, wogegen der Bart und der zweizeilig behaarte Schwanz dunkelbraune Färbung zeigen; an den langhaarigen Theilen des Felles machen sich wellige Streifungen bemerklich, weil hier viele der meist einfarbigen Haare in braune Spitzen endigen, welche, sich deckend, jene Streifung hervorrufen. Die dunklere Färbung der Beine wird am kräftigsten auf der Vorderseite derselben, wo sie, die graulich isabellfarbenen Handwurzeln und die weiße, durch einen braunen Strich getrennte Elnbogenecke freilassend, sich über das ganze Bein ausdehnt; unterhalb der Fußwurzeln drängt sich diese dunklere Färbung zu einem keilförmigen Streifen zusammen, dessen Spitze nach der Theilungsstelle der Zehen gerichtet ist, und welcher von der allgemeinen, auch auf der Fessel herrschenden Färbung begrenzt wird. Die Innenseite der Beine und die Unterseite des Leibes ist heller, fast weißgrau. Gegen den Winter hin verbleichen die Spitzen, und die jetzt reichlich wuchernde Unterwolle tritt stärker hervor, weshalb dann das Kleid viel lichter erscheint als im Sommer. Die Hörner haben lichthorngraue, die Hufe und Afterhufe schwarze Färbung; die Iris ist erzfarben. Die merklich kleinere Ziege unterscheidet sich durch die Färbung nicht vom Bocke, trägt aber ein bedeutend schwächeres, höchstens 25 Centim. langes, flach gedrücktes und stumpfes Gehörn und einen im Vergleiche zum Bocke nur angedeuteten Bart.
Die Schraubenziege wurde von dem Reisenden und Forscher Baron von Hügel in den höchsten Theilen des tibetanischen Himalaya erbeutet und zu Ehren seines Freundes Falconer, damaligen Vorstehers des Pflanzengartens zu Scharampur, benannt, unter diesem Namen auch, und zwar im Jahre 1839, von Wagner beschrieben. Fast gleichzeitig, im Jahre 1840 nämlich, lernte Vigne sie kennen, beschrieb sie ebenfalls und wählte ihren landesüblichen Namen Großhornziege zur wissenschaftlichen Bezeichnung. Von beiden Reisenden erfahren wir eigentlich nur, daß unsere Ziege die höchsten Gebirge ihrer Heimat bewohnt, oft auf niederen, jedoch unersteiglichen Felsen in der Nähe des Wassers sich zeigt und deshalb den Namen Tsura führt, auch in dem Rufe steht, Schlangen zu verzehren. Erst Adams gibt einen etwas ausführlicheren Bericht. Nach seinen Beobachtungen beschränkt sich der Verbreitungskreis des Thieres auf die Gebirge des oberen Indus- und Oxuslaufes. Die Schraubenziege ist häufig auf allen Gebirgen rund um das Thal von Peschawur in Kleintibet und kommt von hier an zu beiden Seiten des Indus vor, etwa bis Torbela hinabreichend, wogegen sich ihr Verbreitungskreis nach Westen hin bis zur Verbindung des Indus und Sudledge erstreckt; nicht minder häufig als hier tritt das Thier aber auch auf dem Hindukusch, in Kaschmir und Afganistan auf, soll sogar noch im südlichen Persien gefunden werden; nach Osten hin dagegen scheint sie höchstens bis zum Biasflusse sich zu verbreiten und im östlichen Himalaya nicht vorzukommen. Innerhalb des von Adams besuchten Gebietes begegnet man ihr in kleinen Trupps, regelmäßig auf pflanzenarmen und felsigen Bergen, je nach der Jahreszeit höher oder tiefer. Ihre Lebensweise gleicht der des Skyn oder Himalayasteinbockes, beziehentlich aller Wildziegen insgemein; doch findet man Skyn und Markhor nur ausnahmsweise auf demselben Gebiete, weil sich, nach Aussage eines wohlunterrichteten Eingeborenen, beide nicht vertragen, vielmehr sofort zu kämpfen beginnen, wenn sie zusammentreffen. Dagegen sieht man sie zuweilen in Gesellschaft des Tahir. Hinsichtlich des Volksglaubens, welcher sie als Schlangenfresser bezeichnet, forschte Adams vergeblich nach Belegen und erfuhr nur das eine, daß die zweifellos unbegründete Meinung unter den Gebirgsbewohnern allgemein verbreitet ist.
Blyth glaubt, in der Schraubenziege nichts anderes als eine vielleicht verwilderte Spielart der Hausziege zu erkennen; Adams aber widerspricht dieser Auffassung auf das bestimmteste und meint, daß der Markhor eher als eine der Stammarten unseres Hausthieres zu betrachten sein dürfte. Die Beobachtung des lebenden Thieres, welches in der Neuzeit wiederholt nach Europa gelangte und in verschiedenen Thiergärten sich fortpflanzte, unterstützt letztere Ansicht mehr als die erstere; denn die Schraubenziege macht vollständig den Eindruck eines ursprünglichen, nicht aber eines durch den Menschen umgestalteten Geschöpfes. Sie bekundet dieselben Eigenschaften wie ihre Verwandten, die Steinböcke und Wildziegen insbesondere, bethätigt ebensoviel Kraft als Gewandtheit und Behendigkeit, zeigt dieselbe Unternehmungslust, den Muthwillen, die Kampfbereitschaft und andere hervorragende Züge des Wesens der übrigen Wildziegen und weicht wohl in keiner Beziehung von diesen ab. Mit ihrem Wärter befreundet sie sich bis zu einem gewissen Grade, ohne sich jedoch unbilliger Knechtschaft geduldig zu fügen. In der Jugend heiter, neck- und spiellustig, dabei jedoch vorsichtig und sogar einigermaßen scheu, nimmt sie mit zunehmendem Alter mehr und mehr das trotzige, herausfordernde Gebaren ihres Geschlechtes an und wird schließlich zu einem achtunggebietenden Gegner selbst des stärksten Mannes.
Bei dem Versuche, die Frage der Abstammung unserer Hausziege und ihrer ungemein zahlreichen Rassen zu lösen, lassen uns Sage und Geschichte vollständig im Stiche. Paseng und Markhor scheinen allerdings die meisten Anrechte auf die Stammvaterschaft des nützlichen Hausthieres zu haben; wir sind aber nicht im Stande, zu bestimmen, wann die eine oder andere Art in den Hausstand übergeführt wurde, wann und ob überhaupt zuerst Kreuzungen zwischen beiden stattfanden, und wie sich die seit Jahrtausenden nachweislich erhaltenen Eigenthümlichkeiten der Rassen herausgebildet haben. Während der ersten Steinzeit war die Hausziege in der Schweiz häufiger als das Schaf; aber diese so alte Rasse wich in keiner Beziehung von der heutzutage noch auf den Alpen lebenden gemeinsten Form ab. Auf den egyptischen Denkmälern tritt uns eine ähnliche Wahrnehmung entgegen. »Die egyptische Ziege«, bemerkt Dümichen, »vermissen wir keineswegs unter den Abbildungen auch der ältesten Denkmäler, sondern werden, soweit unsere Kunde der letzteren reicht, durch sie in Bild und Schrift belehrt, daß von den ältesten Zeiten an Ziegen zu den Hausthieren der alten Nilthalbewohner zählten und jederzeit einen Hauptbestandtheil ihres Viehreichthums bildeten. In den Darstellungen und Schriften aus allen Zeiträumen der egyptischen Reichsgeschichte wird wiederholt geredet von Ziegen und Ziegenherden, vom Weiden der Herden und von Ziegenhirten, von der Milch und dem Fleische der Ziegen, von ihrem Felle und ihrer Haut, welche letztere man vor der allgemein gewordenen Benutzung des Papyrus, also in den ältesten Zeiten der egyptischen Geschichte, als Schreibmaterial zubereitete. Wenn in den Schriften geredet wird von uralten Urkunden, dann heißt es nicht selten, daß dieselben auf Ziegenhaut geschrieben gewesen. Das Wort Ar bezeichnet in den egyptischen Texten gleichermaßen die Ziege wie die Ziegenhaut, ganz ebenso geschrieben und nur durch das noch hinter das Wort tretende Bestimmungszeichen unterschieden, die zur Aufnahme von Schriften bereitete Thierhaut, die auf Leder geschriebene Urkunde, welches Wort dann wohl auch mitunter ganz allgemein für Schriftrolle gebraucht wird. Eine bemerkenswerthe Inschrift im Bibliothekzimmer des Tempels von Edfu sagt, daß daselbst aufgestellt gewesen zahlreiche Kisten, enthaltend Papyrus- und große Lederrollen. Letztere sind auch hier durch das Wort Ar bezeichnet. In Gräbern von Giseh und Sakhâra, in Sauiet el Meitîn und Beni-Hassan, in Siut, Theben und El Kab begegnen uns überall Abbildungen von Ziegen in den das Leben des Altegypters als Landwirt behandelnden Darstellungen.
Es möge mir gestattet sein, das von meinem gelehrten Freunde Hartmann Gesagte anzuführen, da dieser gerade den Hausthieren Egyptens seine besondere Aufmerksamkeit zugewendet und, selbst Kundiger von Fach, nicht versäumt hat, auf seiner für die Wissenschaft so fruchtbaren Reise in Nordostafrika auch den auf den egyptischen Denkmälern abgebildeten Thieren Beachtung zu schenken. In einer in unserer altegyptischen Zeitschrift vom Jahre 1864 veröffentlichten Abhandlung äußert er sich in Bezug auf die egyptische Ziege, hieroglyphisch Ar oder Au genannt, folgendermaßen: »Die in Egypten schon seit den ältesten Zeiten unter den Pyramidenerbauern gezüchteten Ziegen gehören zu der äthiopischen Rasse ( Capra hircus aethiopica), welche der syrischen Mamberziege ( Capra hircus mambrica) verwandt ist. Sie zeichnet sich durch gewölbten Nasenrücken, lange Schlappohren, großes, ziemlich langes Haar und langes Hängeeuter aus; Hörner, welche sich mehrmals nach hinten und außen biegen, finden sich bei beiden Geschlechtern (können aber auch, wie hier einzuschalten ist, bei beiden Geschlechtern fehlen). Man bemerkt besonders zwei Hauptrassen, eine mit sehr stark gewölbtem Nasenrücken ( Capra hircus thebaica) und eine mit schwach gewölbtem Nasenrücken ( Capra hircus aegyptiaca). Uebergänge zwischen beiden finden sich häufig in Egypten und Nubien; fortwährende Kreuzungen erzeugen manche Mittelformen mit bald kürzeren, bald längeren Ohren, mehr oder minder stark gewölbtem Nasenrücken, mit und ohne Fleischklunkern am Halse, wie denn Kreuzungen dieser Thiere mit libyschen Ziegen ( Capra hircus lybica) und sennarischen Blendlingen sowie der mittelsudanesischen Spielart ( Capra hircus reversus) nicht selten sind. Die kurzohrige egyptische Ziege ist eine durch künstliche Zucht gewonnene Kulturrasse. Die Alten nun haben den Charakter der äthiopischen Spielart meist ganz gut wiedergegeben, und man sieht, daß ihnen die genannten Ziegenrassen bis auf die wohl erst später erzeugte kurzohrige bekannt gewesen. Darstellungen in Giseh zeigen neben der von Fitzinger thebaische Ziege ( Hircus thebaicus) genannten Rasse auch die egyptische Ziege ( Hircus aegyptiaca). Niemals fehlt diesen Darstellungen der Bart«.
Aus vorstehendem geht also hervor, daß bereits in den ältesten Zeiten Ziegenrassen vorhanden waren, welche von den in unseren Tagen lebenden sich durchaus nicht unterschieden, und gerade diese Beständigkeit der betreffenden Rassen erschwert es, auch nur Muthmaßungen über den Ursprung auszusprechen. Die, wie schon bemerkt, außerordentlich große Anzahl der Rassen gestattet zur Zeit noch nicht einmal eine Aufzählung, geschweige denn eine wissenschaftlich begründete und übersichtliche Darstellung derselben. Jeder Reisende, welcher bisher noch wenig besuchte oder beachtete Theile Innerafrikas und Asiens betritt, findet neue Rassen auf, und die Unterschiede zwischen ihnen sind so bedeutend, daß man versucht sein möchte, mehrere von ihnen als besondere Arten anzusprechen; Fitzinger hat dies wirklich gethan und zwölf von ihnen, die gemeine europäische Hausziege, die berberische, die Sunda-, die platthörnige, die Zwerg-, Angora-, Kaschmir-, die zottige, die nepalische, die egyptische, die Mamber- und die thebaische Ziege als vermeintliche Stammarten der Rassen aufgestellt. Gestalt, Größe, Drehung und Wulstung der Hörner, Entwickelung der Ohren und des Euters, Ausbildung des Haarkleides etc. sind ebenso verschieden wie die Größe und Gestalt des Leibes, die Bildung der Glieder und die Färbung. Die Hörner erreichen vollständig die Größe und das Gewicht mächtiger Gehörne des Paseng, verkümmern und schrumpfen zusammen, verkleinern sich bis zum Stummelhaften, verkümmern gänzlich oder treten doppelt auf, so daß eine Ziege deren vier trägt; die Ohren sind aufrecht stehend oder hängend, nach vorn oder hinten gerichtet, klein und zierlich gestaltet oder so großlappige Schlappohren, daß sie beim Gehen fast den Boden berühren. Clark maß die einer auf der Moritzinsel lebenden Rasse und fand, daß sie bei 12 Centim. Breite 50 Centim. Länge hatten. Nach Gordon weichen, wie Darwin hervorhebt, die Euter der verschiedenen Zuchtrassen der Form nach bedeutend ab: bei der gewöhnlichen Ziege sind sie verlängert, bei der Angoraziege halbkugelig, bei den Ziegen von Syrien und Nubien zweilappig etc. Das Vorhandensein von Klauendrüsen an allen vier Füßen wurde früher für die Sippe Schaf und ihre Abwesenheit für die Sippe Ziege als ein bezeichnendes Merkmal erklärt; Hodgson hat aber gefunden, daß bei der Mehrzahl der Himalayaziegen Klauendrüsen an den Vorderfüßen vorhanden sind. Mehrere Rassen tragen ein ungemein langes Vlies mit seidenartig feinen Wollhaaren, wieder andere zeigen auf solchem Felle verschiedenartige Haarwucherungen in Gestalt von Mähnen, Seitenstreifen und dergleichen; der bekannte Bocksgeruch ist bei einzelnen bis zum Ekel ausgeprägt und bei anderen fast vollständig verloren worden. Somit dürfte kaum ein einziges Merkmal aufzufinden sein, welches als allen Rassen gemeinsam bezeichnet werden könnte; und gleichwohl lassen sich alle unter einander kreuzen und erzielen wiederum fruchtbare Blendlinge.
Es würde, selbst wenn der Raum unseres Buches dies gestatten sollte, zur Zeit noch ein fruchtloses Unterfangen sein, auf diese so unendlich verschiedenen Ziegenrassen näher einzugehen; demungeachtet verdienen wenigstens einige von ihnen eine kurze Besprechung.

Angoraziege ( Capra hircus angorensis). 1/12 natürl. Größe.
Als die edelste unter allen dürfen wir wahrscheinlich die Angoraziege ( Capra hircus angorensis ) hinstellen, nach Ansicht einzelner Forscher einen Abkömmling der Schraubenziege darstellend, ein schönes, großes Thier von gedrungenem Leibesbau, mit starken Beinen, kurzem Halse und Kopfe, sehr eigenthümlich gewundenem Gehörn und auffallendem Haar. Beide Geschlechter tragen Hörner. Diese sind bei dem Bocke stark zusammengedrückt, nicht gedreht, scharf gekantet und hinten stumpf zugespitzt, stehen gewöhnlich wagerecht von dem Kopfe ab, bilden eine weite, doppelte Schraubenwindung und richten sich mit der Spitze nach aufwärts, erscheinen also dreifach gebogen. Die Ziege trägt kleinere, schwächere, runde, einfach gebogene Hörner, welche in der Regel, ohne sich über den Kopf oder Hals zu erheben, um das Ohr sich herumdrehen, d. h. einfach stark nach abwärts und dann nach vorn und abwärts wenden, wobei die bis zum Auge reichende Spitze nach außen gerichtet ist. Nur das Gesicht, die Ohren und der unterste Theil der Läufe sind mit kurzen, glatt anliegenden Haaren bedeckt; das übrige Vlies ist überaus reichlich, dicht und lang, fein, weich, glänzend, seidenartig, lockig gekräuselt, und besteht vorwiegend aus Wollhaaren, welche die spärlich vorhandenen Grannen fast überwuchern. Beide Geschlechter tragen einen ziemlich langen, aus straffen oder steifen Haaren gebildeten Bart. Ein blendendes, gleichmäßiges Weiß ist die vorherrschende Färbung dieser Ziegenrasse; seltener kommen solche vor, welche auf lichtem Grunde dunkle Flecken zeigen. Im Sommer fällt das Vlies in großen Flocken aus, wächst aber sehr rasch wieder nach. Französische Züchter haben gefunden, daß ein Vlies zwischen 1250 und 2500 Gramm wiegt.
Die Angoraziege scheint den Alten gänzlich unbekannt gewesen zu sein. Belon ist der erste, welcher einer Wollziege Erwähnung thut, deren Vlies fein wie Seide und weiß wie der Schnee sei und zur Verfertigung des Kamelot oder Kämmelgarns verwandt werde. Ihren Namen trägt die Ziege nach der kleinen Stadt Angora im türkischen Paschalik Anadoli in Kleinasien, der schon bei den Alten hochberühmten Handelsstadt Ankyra. Von hier aus hat man sie weiter verbreitet, neuerdings mit Glück auch in Europa eingeführt. Ihre Heimatsgegend ist trocken und heiß im Sommer, jedoch sehr kalt im Winter, obwohl dieser nur drei oder vier Monate dauert. Erst wenn es keine Nahrung auf den Bergen mehr gibt, bringt man die Ziegen in schlechte Ställe, wogegen sie das ganze übrige Jahr auf der Weide verweilen müssen. Sie sind höchst empfindlich, obwohl die schlechte Behandlung nicht dazu beiträgt, sie zu verweichlichen. Reine, trockene Luft ist zu ihrem Wohlsein eine unumgänglich nothwendige Bedingung. Während der heißen Jahreszeit wäscht und kämmt man das Vlies allmonatlich mehrere Male, um seine Schönheit zu erhalten oder doch zu steigern.
Die Anzahl der Ziegen, welche man überhaupt in Anadoli hält, wird auf eine halbe Million angeschlagen. Auf einen Bock kommen etwa hundert Ziegen und darüber. Im April ist die Schur, und unmittelbar darauf wird die Wolle eingepackt. Angora allein liefert fast eine Million Kilogramm, welche einem Werthe von 3,600,000 Mark entsprechen. Zehntausend Kilogramm werden im Lande selbst zur Fertigung starker Stoffe für die Männer und feinerer für die Frauen, sowie auch zu Strümpfen und Handschuhen verarbeitet, alles übrige geht nach England. In Angora selbst ist fast jeder Bürger Wollhändler.
Man hat beobachtet, daß die Feinheit der Wolle mit dem Alter ihrer Erzeuger abnimmt. Bei einjährigen Thieren ist das Vlies wunderbar schön; schon im zweiten Jahre verliert es etwas; vom vierten Jahre an wird es rasch schlechter und schlechter; sechsjährige Thiere muß man schlachten, weil sie zur Wollerzeugung gar nicht mehr geeignet sind.
Schon seit der ersten Kunde, welche man über die Angoraziege erhielt, hat man Versuche gemacht, sie bei uns einzuführen. Die spanische Regierung brachte im Jahre 1765 einen starken Trupp Angoraziegen nach der Iberischen Halbinsel; was aus ihnen geworden ist, weiß man aber nicht. Im Jahre 1787 führte man einige Hunderte in den französischen Niederalpen ein, woselbst sie so ausgezeichnet gediehen, daß man einen hübschen Gewinn erlangte. Später brachte man sie auch nach Toscana und selbst nach Schweden. Im Jahre 1830 kaufte Ferdinand VII. hundert Angoraziegen und setzte sie zuerst im Parke des Schlosses El Retiro bei Madrid aus. Hier vermehrten sie sich so rasch, daß man sie auf Berge des Escorial übersiedeln mußte. In dieser ihnen sehr günstigen Gegend machte man die Beobachtung, daß ihre Wolle sich ebenso fein erhielt wie in ihrem eigentlichen Vaterlande. Später wurden sie nach Südcarolina gebracht, und auch dort befanden sie sich wohl. Endlich führte die kaiserlich französische Gesellschaft für Einbürgerung fremder Thiere im Jahre 1854 die Angoraziege von neuem in Frankreich ein, und man hat bis jetzt keine Ursache gehabt, über das Mißgedeihen derselben zu klagen; es wird sogar behauptet, daß die Wolle der in Frankreich geborenen Thiere feiner wäre als die ihrer Eltern.
Nur die Bockzeit hat das französische Klima verändert. Bei der Einführung brunsteten die Angoraziegen im Oktober, später aber immer im September. Sie fürchten ebensowenig Hitze als große Kälte, sind auch nur unmittelbar nach der Schur so empfindlich, daß Erkältung sie tödten kann; Feuchtigkeit aber wird ihnen verderblich. Nach genauen Berechnungen, welche man angestellt hat, ergab sich ein Reingewinn von jährlich 23,74 Franken für jede Ziege, wobei zu erwägen, daß man in Frankreich die Stallfütterung anwendet, die Haltung dieser Thiere also in trockenen Ländern, wie Spanien, Algier etc., noch weit vortheilhafter sein wird. Schon jetzt hat man festgestellt, daß die Zucht viel gewinnreicher ist als die der Schafe, und es steht zu erwarten, daß sich dieses werthvolle Thier nach und nach weiter und weiter verbreiten wird.
Kaum minder werthvoll als die eben beschriebene ist die Kaschmirziege ( Capra hircus laniger), ein ziemlich kleines, aber gefällig gebautes Thier von beinahe l,5 Meter Gesammtlänge und 60 Centim. Schulterhöhe. Der auf stämmigen Läufen ruhende Leib ist gestreckt, der Rücken gerundet, das Kreuz kaum höher als der Widerrist, der Hals kurz, der Kopf ziemlich dick, die Augen sind klein, die Hängeohren etwas länger als der halbe Kopf, die langen zusammengedrückten, schraubenförmig gedrehten, auf der Vorderseite scharf gekanteten Hörner biegen sich von der Wurzel seitlich aus einander und steigen schief nach auf- und rückwärts, kehren aber ihre Spitze wieder einwärts. Ein langes, straffes, feines und schlichtes Grannenhaar überdeckt die kurze, außerordentlich feine, weiche, flaumartige Wolle; nur Gesicht und Ohren sind kurz behaart. Die Färbung wechselt. Gewöhnlich sind die Seiten des Kopfes, der Schwanz und die übrigen Theile des Leibes silberweiß oder schwach gelblich, jedoch kommen auch einfarbige Kaschmirziegen vor, bald rein weiße, bald sanft gelbe oder hellbraune, bald dunkelbraune und schwarze. Das Wollhaar ist bei lichtgefärbten Thieren weiß oder weißlichgrau, bei dunkleren aschgrau.
Von Groß- und Kleintibet an reicht der Verbreitungskreis dieser schönen Ziege über die Bucharei bis zum Lande der Kirgisen. In Bengalen wurde sie eingeführt; in den Gebirgen Tibets, welche auch im Winter und bei der heftigsten Kälte von ihr bewohnt werden, ist sie häufig.
Lange Zeit war man im Zweifel, von welchem Thiere das Haar gewonnen werde, welches man zur Anfertigung der feinsten aller Wollgewebe benutzt, bis Bernier, ein französischer Arzt, welcher im Jahre 1664 in Begleitung des Großmoguls Tibet besuchte, erfuhr, daß zwei Ziegen, eine wildlebende und eine gezähmte, solche Wolle lieferten. Später reiste ein armenischer Kaufmann im Auftrage eines türkischen Handelshauses nach Kaschmir und berichtete, daß man nur in Tibet Ziegen besitze, welche so feine Wolle liefern, wie die Weber in Kaschmir sie bedürfen. Die Böcke liefern mehr, aber minder feine Wolle als die Ziegen. Im Mai und Juni findet die Schur statt. Das gewonnene Gemenge wird gereinigt und das Grannenhaar zur Fertigung gewöhnlicher Stoffe verwendet, wogegen das Wollhaar noch einmal der sorgfältigsten Prüfung und Ausscheidung unterliegt. Am gesuchtesten ist das reine Weiß, welches in der That den Glanz und die Schönheit der Seide besitzt. Ein einzelnes Thier liefert etwa drei- bis vierhundert Gramm brauchbaren Wollflaums. Zur Verfertigung eines Gewebes von einem Geviertmeter sind fast achthundert Gramm oder das Erzeugnis von sieben bis acht Ziegen erforderlich.
Unter der Herrschaft des Großmoguls sollen vierzigtausend Shawlwebereien in Kaschmir bestanden haben; als aber das Land unter die Afganen kam, sank dieser gewichtige Erwerbszweig so sehr herab, daß von den sechszigtausend Menschen, denen die Weberei ihren Lebensunterhalt verschaffte, tausende aus Mangel an Arbeit zum Auswandern gezwungen wurden. Noch jetzt hat sich die Weberei nicht wieder erholen können, weil ungeeignete Gesetze den freien Handel mit der Wolle hindern und Zölle aller Art den Verkehr lähmen.
Erklärlicherweise dachte man schon seit Jahren daran, dieses gewinnbringende Thier in Europa einzubürgern. Ternaux, welcher die Shawlwebereien in Frankreich einführte, kam auf den Gedanken, sich Kaschmirziegen zu verschaffen, und der berühmte Jaubert bot ihm seine Dienste zur Erreichung des Zweckes an. Im Jahre 1818 schiffte sich letzterer nach Odessa ein, erfuhr hier, daß die Nomadenstämme in den Steppen zwischen Astrachan und Orenburg Kaschmirziegen hielten, reiste zu diesen Leuten, überzeugte sich durch genaue Untersuchung des Flaums von der Echtheit der Thiere und kaufte dreizehnhundert Stück von ihnen an. Diese Herde brachte er nach Kaffa in der Krim, schiffte sich mit ihr ein und landete im April 1819 zu Marseille. Aber nur ihrer vierhundert Stück hatten die lange, beschwerliche Seereise ausgehalten, und diese waren so angegriffen, daß man wenig Hoffnung hatte, Nachzucht von ihnen zu erhalten. Namentlich die Böcke hatten sehr gelitten. Glücklicherweise sandten fast zu gleicher Zeit die französischen Naturforscher Diard und Duvaucel einen kräftigen Bock der Kaschmirziege, welchen sie in Indien zum Geschenk erhalten hatten, an den Thiergarten in Paris. Er wurde der Stammvater aller Kaschmirziegen, welche gegenwärtig in Frankreich leben und dem Lande fünfzehn bis zwanzig Millionen Franken einbringen. Von Frankreich aus kam die Kaschmirziege auch nach Oesterreich und Würtemberg; doch erhielt sich hier die Nachzucht leider nicht.
Die Mamberziege ( Capra hircus mambrica) ähnelt wegen ihrer langen Haare einigermaßen der Kaschmirziege, unterscheidet sich von dieser aber durch ihre außerordentlich langen, schlaff herabhängenden Ohren, welche in gleicher Größe und Gestalt bei keiner anderen Ziege gefunden werden. Sie ist groß und hoch, aber gedrungen gebaut, der ziemlich gestreckte Kopf auf der Stirn sanft gewölbt, längs des Nasenrückens gerade. Beide Geschlechter tragen Hörner, der Bock gewöhnlich stärkere und mehr gewundene als die Ziege. Die Hörner beschreiben einen Halbkreis, dessen Spitze nach vorn und aufwärts gerichtet ist. Die Augen sind klein, die Ohren etwa dritthalb Mal so lang als der Kopf, verhältnismäßig schmal, stumpf abgerundet, gegen die Spitze zu nach außen etwas aufgebogen. Eine reichliche und dichte, zottige, straffe, seidenartig glänzende Behaarung deckt den Leib mit Ausnahme des Gesichts, der Ohren und der Unterfüße, welche kurz behaart sind. Beide Geschlechter tragen einen mittellangen, schwachen Bart.
Auch diese Form muß schon seit Jahrtausenden in den Hausstand übergegangen sein, da sie bereits Aristoteles kannte. Gegenwärtig findet man sie in der Nähe von Aleppo und Damaskus in großer Anzahl. Von Kleinasien aus scheint sie durch einen großen Theil des Erdtheils vorzukommen. So halten sie z.+B. die kirgisischen Tataren in Menge, pflegen ihr aber die langen Ohren mehr als zur Hälfte abzuschneiden, damit sie beim Weiden nicht hinderlich sind.
Ferner scheint mir die Nil- oder egyptische Ziege ( Capra hircus aegyptica), dieselbe, welche auf den Denkmälern so vielfach dargestellt wurde, der Erwähnung werth zu sein. In der Größe steht sie unserer Hausziege merklich nach, ist aber hochbeiniger und kurzhörniger und besonders ausgezeichnet durch ihren kleinen Kopf und die gewaltige Ramsnase. Ein Gehörn fehlt gemeiniglich beiden Geschlechtern oder ist, wenn vorhanden, klein, dünn und stummelhaft; auch einen Bart habe ich bei den von mir beobachteten vermißt. Verhältnismäßig kleine Augen, schmale und langgezogene Nasenlöcher, etwa kopflange, schmale, stumpfe, gerundete und flache Schlappohren, ein paar Hautklunkern an der Kehle und glatte, gleichmäßige, meist lebhaft rothbraune, an den Schenkeln mehr ins Gelbliche ziehende Färbung sind anderweitige Merkmale dieser Rasse. Schiefergraue oder gefleckte Nilziegen gehören zu den selteneren Erscheinungen.
Das Thier wird im unteren Nilthale allgemein gezüchtet und reicht bis Mittelnubien herauf, von wo ab eine andere Rasse an seine Stelle tritt.
Diese, die Zwergziege ( Capra hircus reversa), ein Thier von höchstens 70 Centim. Länge, 50 Centim. Höhe am Widerrist und nicht über 25 Kilogramm Gewicht, gehört zu den anmuthigsten Erscheinungen der ganzen Gruppe. Ihr auf kurzen und starken Beinen ruhender Leib ist gedrungen; der verhältnismäßig breite Kopf trägt bei beiden Geschlechtern kurze, kaum fingerlange Hörner, welche sich von der Wurzel an sanft nach rück- und auswärts biegen und im oberen Drittheil wieder schwach nach vorwärts krümmen. Die ziemlich kurze, aber dichte Behaarung zeigt gewöhnlich dunkle Färbungen: Schwarz und Röthlichfahl im Gemisch sind vorherrschend. Oft ist der ganze Leib auf dunklem Grunde weiß gefleckt oder getupft. Der Schädel, der Hinterkopf, der Nasenrücken und ein Streifen, welcher sich über den Rücken hinwegzieht, sind gewöhnlich schwarz, die Seiten weißlichfahl. Von der Kehle zieht sich eine schwarze Binde bis zur Brust herab, wo sie sich theilt und über die Schultern weg bis zum Widerriste verläuft. Die Unter- und Innenseite ist schwarz bis auf eine breite weiße Binde, welche über die Mitte des Bauches verläuft. Röthliche, gelbbraune und ganz schwarze Zwergziegen kommen selten vor.
Vielleicht dürfen wir als Heimatskreis dieser Rasse alle Länder annehmen, welche zwischen dem Weißen Flusse und dem Niger liegen. An dem erstgenannten Strome begegnete ich ihr in großer Anzahl; Schweinfurth fand sie und andere ihr nahe stehende, offenbar in denselben Formenkreis gehörige Rassen bis in das tiefste Innerafrika verbreitet.
Wegen des von allen Völkern anerkannten Nutzens bewohnen die Hausziegen gegenwärtig fast die ganze Erde, finden sich wenigstens bei allen Völkern, welche ein nur einigermaßen geregeltes Leben führen, gewiß. Sie leben unter den verschiedensten Verhältnissen, größtentheils allerdings als freies Herdenthier, welches bei Tage so ziemlich eigenmächtig seiner Weide nachgeht, nachts aber unter Aufsicht des Menschen gehalten wird. Verwilderte Ziegen kommen wohl nur hier und da in den südasiatischen Gebirgen und auf einzelnen kleinen Eilanden des Mittelmeeres vor, so auf der Insel Tavolara bei Sardinien, woselbst La Marmora solche beobachtete und erlegte. Wie er mittheilt, gibt es ebensowohl weiße, schwarze und gefleckte wie rothbraune Stücke unter diesen ohne allen Schutz und jede Bevormundung des Menschen lebenden, durch ihre gewaltigen Hörner sehr ausgezeichneten und auffallenden Ziegen; es unterliegt daher keinem Zweifel, daß man es nicht mit wilden, sondern nur mit verwilderten zu thun hat.
Die Ziege ist für das Gebirge geschaffen. Je steiler, je wilder, je zerrissener ein solches ist, um so wohler scheint sie sich zu fühlen. Im Süden Europas und in den übrigen gemäßigten Theilen der anderen Erdfesten wird man wohl schwerlich ein Gebirge betreten, ohne auf ihm weidenden Ziegenherden zu begegnen. Sie verstehen es, das ödeste Gefelse zu beleben und der traurigsten Gegend Reiz zu verleihen.
Alle Eigenschaften der Ziege unterscheiden sie von dem ihr so nahestehenden Schafe. Sie ist ein munteres, launiges, neugieriges, neckisches, zu allerlei scherzhaften Streichen aufgelegtes Geschöpf, welches dem Unbefangenen Freude gewähren muß. Lenz hat sie vortrefflich gezeichnet: »Schon das kaum ein paar Wochen alte Hippelchen«, sagt er, »hat große Lust, außer den vielen merkwürdigen Sprüngen auch halsbrechende Unternehmungen zu wagen. Immer führt sie der Trieb bergauf. Auf Holz- und Steinhaufen, auf Mauern, auf Felsen klettern, Treppen hinaufsteigen: das ist ihr Hauptvergnügen. Oft ist es ihr kaum oder gar nicht möglich, von da wieder herabzusteigen, wo sie sich hinaufgearbeitet. Sie kennt keinen Schwindel und geht oder liegt ruhig am Rande der fürchterlichsten Abgründe. Furchterregend sind die Gefechte, welche gehörnte Böcke, ja selbst Ziegen liefern, welche zum erstenmal zusammenkommen. Das Klappen der zusammenschlagenden Hörner tönt auf weithin. Sie stoßen sich ohne Erbarmen auf die Augen, das Maul, den Bauch, wie es trifft, und scheinen dabei ganz unempfindlich zu sein; auch läßt ein solcher, oft eine Viertelstunde dauernder Kampf kaum andere Spuren als etwa ein rothes Auge zurück. Ungehörnte Ziegen stoßen sich ebenfalls mit gehörnten und ungehörnten herum und achten es nicht, wenn ihnen das Blut über Kopf und Stirn herniederläuft. Ungehörnte legen sich aufs Beißen, doch ist dies ungefährlich. Mit den Füßen schlägt keine. Wenn man eine Ziege, welche mit anderen zusammengewöhnt ist, allein sperrt, so meckert sie ganz erbärmlich und frißt und säuft oft lange nicht. Wie der Mensch, so hat auch die Ziege allerhand Launen: die muthigste erschrickt zuweilen so vor ganz unbedeutenden Dingen, daß sie über Hals und Kopf Reißaus nimmt und gar nicht zu halten ist«.
Der Bock hat etwas ernstes und würdevolles in seinem ganzen Betragen, zeichnet sich auch vor der Ziege durch entschiedene Keckheit und größeren Muthwillen aus. »Wenn es ans Naschen oder ans Spielen und Stoßen geht«, sagt Tschudi, »stellt er seine ganze Leichtfertigkeit heraus. Das Schaf hat nur in der Jugend ein munteres Wesen, ebenso der Steinbock: die Ziege behält es länger als beide. Ohne eigentlich im Ernste händelsüchtig zu sein, fordert sie gern zum munteren Zweikampfe heraus. Ein Engländer hatte sich auf der Grimsel unweit des Wirtshauses auf einem Baumstamme niedergesetzt und war über dem Lesen eingenickt. Das bemerkt ein in der Nähe umherstreifender Ziegenbock, nähert sich neugierig, hält die nickende Kopfbewegung für eine Herausforderung, stellt sich, nimmt eine Fechterstellung an, mißt die Entfernung und rennt mit gewaltigem Hörnerstoß den unglücklichen Sohn des freien Albions an, daß er sofort fluchend am Boden liegt und die Füße in die Luft streckt. Der siegreiche Bock, fast erschrocken über diese Widerstandslosigkeit eines Britenschädels, steigt mit dem einen Vorderfuße auf den Stamm und sieht neugierig nach seinem zappelnden und schreienden Opfer.«
Ich erinnere mich mit Vergnügen eines sehr starken Ziegenbockes, welcher ruhig wiederkäuend in einem Dorfe lag. Es war die lustige Zeit des Schülerlebens und wir, übermüthige Gesellen, vermochten nicht, das behaglich hingestreckte Thier so ganz unbehelligt zu lassen. Einer von uns forderte durch einen Stoß mit der flach vorgehaltenen Hand den Bock zum Kampfe heraus. Der erhob sich langsam, streckte und reckte sich, besann sich erst geraume Zeit, stellte sich sodann aber seinem Herausforderer und nahm nunmehr die Sache viel ernsthafter, als jener gewollt hatte. Er verfolgte uns durch das ganze Dorf, entschieden mißmuthig, daß wir ihm den Rücken kehrten; denn sobald sich einer nach ihm herumdrehte, stellte er sich augenblicklich ernsthaft auf und nickte bedeutungsvoll mit dem Kopfe. Erst nachdem er uns etwa zehn Minuten weit begleitet und zu seinem großen Bedauern gesehen hatte, daß mit solchen Feiglingen kein ehrenfester Strauß auszufechten, verließ er uns und trabte, grollend über die verpaßte Gelegenheit, seinen Muth zu zeigen, wieder dem Dorfe zu.
Kämpfe mit dem Menschen und mit anderen Thieren sind selten ernst gemeint; es scheint eher, daß es dem Bock darum zu thun ist, seine Bereitwilligkeit zum Kampfe zu zeigen, als den Gegner wirklich zu gefährden.
Die Ziege hat eine natürliche Zuneigung zum Menschen, ist ehrgeizig und für Liebkosungen im höchsten Grade empfänglich. Im Hochgebirge begleitet sie den Wanderer bettelnd und sich an ihn schmiegend oft halbe Stunden weit, und denjenigen, welcher ihr nur einmal etwas reichte, vergißt sie nicht und begrüßt ihn freudig, sobald er sich wieder zeigt. Weiß eine, daß sie gut steht bei ihrem Herrn, so zeigt sie sich eifersüchtig wie ein verwöhnter Hund und stößt auf die andere los, wenn der Gebieter diese ihr vorzieht. Klug und verständig wie sie ist, merkt sie es wohl, ob der Mensch ihr eine Unbilde zugefügt oder sie in aller Form Rechtens bestraft hat. Geschulte Ziegenböcke ziehen die Knaben bereitwillig und gern, selbst stundenlang, widersetzen sich aber der Arbeit aufs entschiedenste, sobald sie gequält oder unnötigerweise geneckt werden. Ja, der Verstand dieser vortrefflichen Thiere geht noch weiter: ich kenne Ziegen, welche die menschliche Sprache verstehen. Daß abgerichtete Ziegen auf Befehl die verschiedensten Dinge ausrichten, ist bekannt, daß sie aber, sozusagen, sprechende Antworten auf vorgelegte Fragen geben, ohne irgendwie abgerichtet zu sein, kann ich nach eigener Erfahrung versichern. Meine Mutter hält Ziegen und achtet sie hoch, ist deshalb auch um ihre Abwartung sehr besorgt. Sie kann sofort erfahren, ob ihre Pfleglinge sich befriedigt fühlen oder nicht; denn sie braucht nur zum Fenster heraus zu fragen, so erhält sie die richtige Antwort. Vernehmen die Ziegen die Stimme ihrer Gebieterin und fühlen sie irgendwie sich vernachlässigt, so schreien sie laut auf, im entgegengesetzten Falle schweigen sie still. Genau so benehmen sie sich, falls sie unrechtmäßigerweise gezüchtigt wurden. Wenn sie einmal in den Garten gerathen und dort mit ein paar Peitschenhieben von den Blumenbeeten oder Obstbäumen weggetrieben werden, vernimmt man keinen Laut von ihnen; wenn aber die Magd im Stalle ihnen einen Schlag gibt, schreien sie jämmerlich.
Auf den Hochgebirgen Spaniens wendet man die Ziegen, ihrer großen Klugheit wegen, als Leitthiere der Schafherden an. Die edleren Schafrassen werden dort während des ganzen Sommers auf den Hochgebirgen, im Süden oft in Höhen zwischen zwei bis dreitausend Meter über dem Meere geweidet. Hier können die Hirten ohne Ziegen gar nicht bestehen; allein sie betrachten die ihnen so nützlichen Thiere doch nur als nothwendiges Uebel.
»Glauben Sie mir, Señor«, sagte mir ein gesprächiger Andalusier auf der Sierra Nevada, »wenn ich sonst wollte, über meine beiden Leitziegen könnte ich mich todt ärgern! Sie thun sicherlich niemals das, was ich will, sondern regelmäßig das gerade Gegentheil, und ich muß sie gewähren lassen! Sie dürfen überzeugt sein, daß ich heute nicht hier weiden wollte, wo Sie mich gefunden haben; aber meine Ziegen wollten hier weiden, und ich mußte folgen. Nicht einmal mein Hund kann mit ihnen fertig werden. Wollte ich sie hetzen: sie führten meine ganze Herde in das Verderben. Da sehen Sie selbst!« Bei diesen Worten zeigte der gute Mann auf die beiden bösen Lockbuben der frommen, dummen Schafe, welche soeben eine der gefährlichsten Felsenklippen erstiegen hatten und der Herde freundlich zumeckerten, zu diesem Punkte, welcher sicherlich eine schöne Aussicht versprach, aufzusteigen. Der Hund wurde abgesandt, um die störrischen herabzuholen; doch dies war keine so leichte Aufgabe. Zuerst zogen sich die beiden Böcke auf die höchste Spitze des Grates zurück, und Chizo, welcher ihnen folgen sollte, gab sich vergebliche Mühe, da hinauf und ihnen nach zu klettern. Der treue Diener des entrüsteten Hirten rutschte beständig von den glatten Felsen herab; sein Eifer wurde dadurch aber nur angespornt, und weiter und weiter kletterte er empor. Niesend begrüßten ihn die Ziegen, bellend antwortete der Hund, dessen Zorn sich mehr und mehr steigerte. Endlich glaubte er die Frevler erreicht zu haben; aber nein – sie setzten mit einem ebenso zierlichen als geschickten Sprunge über ihn weg und standen zwei Minuten später auf einem anderen Felszacken, dort das alte Spiel von neuem beginnend. Die Schafherde hatte sich mittlerweile so vollständig in die Felsen eingewirrt und lief mit solcher Todesverachtung auf den schmalen Stegen dahin, daß dem Hirten und auch mir vom bloßen Zusehen bange wurde. Aengstlich rief jener den Hund zurück, und befriedigt nahmen die Ziegen dies wahr. Augenblicklich stellten sie sich wieder als Leiter der Herde auf und führten dieselbe nach Verlauf von einer reichlichen halben Stunde, ohne eins der theuren Häupter zu gefährden, aus dem Felsenwirrsal glücklich heraus. Ich war entzückt von dem unterhaltenden Lustspiele.
Die Ziegenhirten der Schweiz haben noch mehr zu leiden als mein guter Andalusier. »Der Wanderer«, sagt Tschudi, »trifft, nachdem er halbe Tage lang in den endlosen Trümmer- und Eislabyrinthen umhergestiegen ist, ohne Menschen und Thiere zu bemerken, plötzlich und zu seinem höchsten Erstaunen eine elende Stein- und Mooshütte, einen verwilderten Buben, den Sonne, Wind und Schmutz um die Wette gebräunt haben, und eine kleine, höchst muntere Ziegenherde, welche sich malerisch auf den kleinen Blöcken, auf den Grasflecken der Felsen und auf den grünen Matten vertheilt hat und den Besucher mit neugierigen Blicken betrachtet. Es sind dies gewöhnlich milchlose Herden, welche auf möglichst wohlfeile Weise übersommert werden sollen und drei bis fünf Monate in den ödesten und wildesten Gebirgslagen zuzubringen haben, ohne irgend eine Pflege zu genießen, als das bischen Salz, welches ihnen der Junge von Zeit zu Zeit auf den Felsen streut, um sie beisammen zu halten.
»Diese Hirtenbuben führen wohl das armseligste Leben, welches in der Nähe der Kulturländer möglich ist. Im Frühlinge ziehen sie mit ihrer bestimmten Zahl von Thieren ins Gebirge, ohne Strümpfe und Schuhe, Weste und Rock, in den erbärmlichsten Kleiderbruchstückchen, mit einem langen Stecken, einem Salztäschchen, einem Wetterhute und etwas magerem Käse und Brod versehen. Das ist ihre einzige Speise während des ganzen Sommers; von warmer Nahrung ist keine Rede. Oft bringt ihnen ein anderer Junge aus dem Thale alle vierzehn Tage, oft nur alle Monate, neues Brod und Käse. Diese Nahrungsmittel werden in der Zwischenzeit beinahe ungenießbar; der arme Tropf nagt wochenlang an einem ganz durchschimmelten Brodstücke und einem schwarzbraunen, steinharten Käsereste, in dem man nur mühsam eine menschliche Speise zu erkennen vermag. Bei schlechtem Wetter kauert er tagelang, ohne Feuer, ohne ein Wort, vor Kälte und Hunger zitternd, in seinem feuchten Loche, aus dem er nur herauskriecht, seine Thiere zu überblicken, welche es, obgleich auch sie schutzlos dem Wechsel der Alpenwitterung preisgegeben sind, doch weit besser haben als ihr Hirt. Gegen den Herbst hin rückt die Gesellschaft dann gegen die milderen Kuhalpen.«
Den griechischen Hirten, in deren Gesellschaft ich mehrere Tage in der Nähe des Anakulsees verlebte, ergeht es nicht viel besser. Sie werden nachts von den Mücken weidlich gepeinigt und müssen bei Tage in der glühenden Sonnenhitze auf allen den steilen Felsen umherklettern, um ihre übermüthige Gesellschaft zusammenzuhalten. In Griechenland sind die Ziegen fast das einzige Herdenvieh, welches man sieht; sie beleben alle Berge und künden sich dem Wanderer schon von weitem durch den empfindlichsten Bockgeruch an. Auf dem Wege zwischen Athen und Theben kamen wir durch ein enges Thal, in welchem wir es vor Gestank kaum aushalten konnten. Viele Hunderte von Ziegen in kleinen Herden liefen auf halsbrecherischen Pfaden dahin, und die Hirten folgten ihnen mit beispiellosem Geschick auf allen Wegen nach.
In vielen Orten überläßt man die Ziege sich selbst, so auch in den Alpen. Man treibt sie in ein bestimmtes, gänzlich abgelegenes Weidegebiet und sucht sie im Herbste wieder zusammen, wobei dann nicht selten manch theures Haupt fehlt, oder man schickt ihnen täglich oder auch nur wöchentlich durch einen Knecht etwas Salz, welches sie auf einer bestimmten, ihnen wohlbekannten Steinplatte zur bestimmten Stunde sehnsüchtig erwarten. Da kommt es dann oft vor, daß sie sich zu den Gemsen begeben und mit diesen wochenlang ein ungebundenes Freileben führen. Solche von Jugend auf im Gebirge weidende Ziegen ähneln ihren wilden Verwandten nicht allein hinsichtlich ihrer Gestalt, sondern auch in der Sicherheit und Kühnheit ihres Auftretens, klettern mit Gemsen und Steinböcken um die Wette und lernen die Höhe, ihre Freuden und Leiden, ihre Wirtlichkeit und Gefahren ebenso gut kennen wie wilde Gebirgsthiere. In den Krainer Alpen habe ich die schönen rothbraunen Hausziegen fast mit demselben Genusse, welchen Gemsen mir bereitet, stundenlang beobachtet. Sie weiden ohne alle Aufsicht, jederzeit in geschlossenen Trupps, nehmen bestimmte Wechsel an und halten sie ein, meiden Stellen, wo Rollsteine sie verletzen können und weichen solchen, welche sie bedrohen, mit ungemeinem Geschick und bewunderungswürdiger Gewandtheit aus. Letzteres erfuhr ich zufällig, als ich über eine steile, dem Anscheine nach thierleere Wand größere Steine rollte und plötzlich eine meinem Auge bisher verborgene, in wilder Flucht dahinstürmende Ziegenherde erblickte, welche durch den rollenden Stein aus ihrer Ruhe aufgestört worden war. Die klugen Thiere flüchteten, sobald sie das Getöse des zur Tiefe stürzenden Steines vernahmen, und wählten, ohne sich zu besinnen oder zu täuschen, die der Sachlage und ihrer Absicht genau entsprechende Richtung. In der That werden selbst in den überaus wilden Kalkalpen Kärntens und Krains nur in seltenen Fällen Ziegen durch Rollsteine erschlagen, ebenso, wie es hier bloß ausnahmsweise einmal vorkommt, daß eine mit dem Gebirge vertraute Ziege sich versteigt oder durch Abstürzen ihr Leben verliert.
Im Innern Afrikas weiden die Ziegen ebenfalls nach eigenem Gutdünken, kommen aber abends in eine sogenannte Seriba oder Umzäunung von Dornen, wo sie vor den Raubthieren geschützt sind. Nicht selten begegnet man mitten im Urwalds einer bedeutenden Ziegenherde, deren eine Hälfte buchstäblich auf den Bäumen herumklettert, während die andere unten weidet. Unter allen Ziegen nämlich, welche ich kennen lernte, ist mir die Zwergziege als die beweglichste und geschickteste erschienen; denn zu meiner nicht geringen Bewunderung hat sie mich belehrt, daß Wiederkäuer auch Bäume besteigen können. Es gewährt einen reizenden Anblick, wenn fünf bis zehn solcher kleinen Ziegen auf dem Wipfel einer größeren Mimose des Urwaldes sich umher treiben. Irgend ein schief geneigter Stamm hatte das Erklimmen der Höhe ermöglicht, in welcher nun Aeste und Zweige weitere Brücken bilden. Oft sieht man das kühne Geschöpf in Stellungen, welche man Wiederkäuern kaum zutrauen möchte: mit jedem einzelnen Fuße steht die Ziege auf einem Zweige und weiß sich, unbekümmert um das Schaukeln ihres schwankenden Standortes, nicht allein im Gleichgewichte zu erhalten, sondern dehnt und reckt sich auch noch nach Bedürfnis, um den saftigen Mimosenblättern beizukommen. Unter den schirmförmigen Strauchbäumen der Steppen, welche ihnen das Besteigen erschweren, erheben sich die Zwergziegen meist auf die Vorderfüße, um bis zu höheren Zweigen emporreichen zu können, und erscheinen dann, wie Schweinfurth sehr richtig hervorhebt, in so absonderlicher Weise, daß man sie, von fern betrachtet, als menschliche Gestalten ansehen kann. Nähert man sich solchem Baume, so sieht man sich plötzlich umringt von einer geringeren oder größeren Anzahl der heiteren Geschöpfe, welche nach Art ihres Geschlechtes jeden sich nähernden Menschen bettelnd angehen. Dann trifft man wohl auch ein armseliges Zelt, in welchem ein paar zerlumpte, sonnenverbrannte Araber hausen, deren ganzes Besitzthum ein Wasserschlauch, ein Getreidesack, ein Reibstein und eine Thonplatte zum Rösten ihres Mehlbreies ist. Nachts geht es oft laut zu in der Seriba. Es gibt nicht viele Wiederkäuer, welche so wenig schlafen wie die Ziegen; einige sind beständig rege, und selbst bei der ärgsten Dunkelheit werden noch Gefechte ausgeführt, Wettläufe veranstaltet und Kletterkünste unternommen. Grauenvoll aber ist der Aufruhr, wenn sich ein Raubthier, zumal ein Löwe, einer solchen Seriba naht. Man glaubt, daß jede einzelne Ziege zehnerlei Stimmen zu gleicher Zeit ertönen läßt. Aus dem muthwilligen Meckern wird ein im höchsten Grade ängstliches Blöken oder Stöhnen; und wenn dann die eingepferchten Thiere die glänzenden Augen des Räubers durch den Dornenzaun hindurch leuchten sehen, kennt ihre Bestürzung keine Grenzen mehr. Wie besessen rennen sie in der Seriba auf und nieder, wie unsinnig stürzen sie sich gegen die dornigen Wände, klettern an diesen empor und bilden einen sonderbaren Kranz der sonderbaren Umhegung. Die Nomaden wollen wahrgenommen haben, daß der Löwe nur beim allerärgsten Hunger unter eine Ziegenherde fällt, während er den Rinderherden aufs äußerste verderblich wird; dagegen gilt der Leopard als der schlimmste Feind, welchen unsere Thiere in Afrika haben können.
Amerika hat die Ziege erst durch die Europäer erhalten. Heutzutage ist sie über den Süden wie über den Norden des Erdtheils verbreitet; doch betreibt man ihre Zucht nicht immer räthlich, scheint sie in manchen Gegenden sogar sehr zu vernachlässigen, so in Peru und Paraguay, in Brasilien und Surinam, wogegen man in Chile mehr auf sie achtet.
In Australien ist das nützliche Geschöpf erst neuerdings eingeführt worden, hat aber schon eine bedeutende Verbreitung erlangt.
Nach Beobachtungen, welche man angestellt haben will, frißt die Ziege bei uns zu Lande von 576 Pflanzenarten 449. Ihre Unstetheit und Launenhaftigkeit zeigt sich deutlich bei dem Aesen. Sie hascht beständig nach neuem Genusse, pflückt allerwärts nur wenig, untersucht und nascht von diesem und jenem, und hält sich nicht einmal beim besten auf. Besonders erpicht ist sie auf das Laub der Bäume, richtet deshalb in Schonungen auch sehr bedeutenden Schaden an. Merkwürdigerweise frißt sie einzelne Pflanzen, welche anderen Thieren sehr schädlich sind, ohne den geringsten Nachtheil: so Wolfsmilch, Schellkraut, Seidelbast, Pfaffenhütchen und Eberwurz, den scharfen Mauerpfeffer, Huflattig, Melisse, Salbei, Schierling, Hundspetersilie und ähnliches Kraut, mit Vergnügen auch Rauchtabak, Cigarrenstummel und dergleichen. Vom Genusse der Wolfsmilch bekommt sie gewöhnlich den Durchfall; Eibe und Fingerhut sind Gift für sie; Flohkraut, und Spindelbaum behagen ihr ebenfalls schlecht. Am liebsten nimmt sie junge Blätter und Blüten von Hülsenpflanzen, Blätter der Kohl- und Rübenarten und die der meisten Bäume; am gedeihlichsten sind ihr alle Pflanzen, welche auf trockenen, sonnigen, fruchtbaren Höhen wachsen. Wiesen, welche mit Mist oder sonstwie stinkender Masse besudelt sind, können nicht als Weideplätze für Ziegen benutzt werden: sie ekeln sich auch da noch, wo schon lange vorher gedüngt wurde. Freiweidende Ziegen bekommen nur Wasser zu trinken, Stallziegen eine lauwarme Maische aus Roggenkleie, etwas Salz und Wasser.
Die Ziege ist schon mit einem Alter von einem halben Jahre zur Fortpflanzung geeignet. Ihre Paarungslust, welche gewöhnlich in die Monate September bis November fällt und zuweilen noch ein zweites Mal im Mai sich einstellt, zeigt sich durch vieles Meckern und Wedeln mit dem Schwanze an. Läßt man ihr den Willen nicht, so wird sie leicht krank. Der Bock ist zu allen Zeiten des Jahres brünstig und reicht, wenn er im besten Alter, d. h. in seinem zweiten bis achten Jahre steht, für hundert Ziegen hin. Einundzwanzig bis zweiundzwanzig Wochen nach der Paarung wirft die Mutterziege ein oder zwei, seltener drei und nur ausnahmsweise vier oder fünf Junge; in diesem Falle aber geht sie oder wenigstens ihre Nachkommenschaft gewöhnlich zu Grunde. Wenige Minuten nach ihrer Geburt richten sich die Zicklein auf und suchen das Euter ihrer Erzeugerin; am nächsten Tage schon laufen sie herum, und nach vier bis fünf Tagen folgen sie der Alten überall hin. Sie wachsen rasch: im zweiten Monate sprossen die Hörnchen hervor; nach Verlauf eines Jahres haben sie fast ihre volle Größe erreicht.
Der Nutzen der Ziege, welche man in vielen Gegenden als den größten Freund des Armen bezeichnen darf, ist sehr bedeutend. Ihre Unterhaltung kostet wenig, im Sommer sozusagen gar nichts: sie aber versorgt das Haus mit Milch und liefert dem Unbemittelten auch noch den Dünger für sein gemietetes Feldstück. Lenz hat gewissenhaft Buch geführt und gefunden, daß eine Ziege, wenn sie gut gefüttert wird, in einem Jahre 1884 Nösel Milch liefern kann, welche bereits im Jahre 1834 etwa achtzig Mark werth waren; gegenwärtig aber wird sich der Ertrag einer Ziege etwa auf neunzig Mark belaufen und der Ueberschuß noch immer erheblich sein.
Hier und da, so in Egypten, treibt man die Ziegen mit strotzendem Euter vor die Häuser der Milchverkäufer und melkt die gewünschte Menge gleich vor der Thüre. Der Käufer hat dadurch den Vortheil, lauwarme Milch zu erhalten, und der Verkäufer braucht nicht erst zu Künsteleien, namentlich zu der ihm oft als nothwendig erscheinenden Verbesserung durch Wasser, seine Zuflucht zu nehmen. Man begegnet selbst in den größten Städten Egyptens einer Frau, hinter welcher eine zahlreiche Ziegenherde meckernd herläuft. Sie ruft » lebn, lebn hilwe«, d. h. »süße, süße Milch«, und hier und dort öffnet sich ein Pförtchen, und ein mehr oder minder verschleierter dienstbarer Geist weiblichen Geschlechts oder ein brauner Aethiopier, welcher die Küche eines Junggesellen zu besorgen hat, schlüpft heraus, kauert sich auf den Boden hin, die Verkäuferin melkt ihm sein Gefäß voll, und weiter geht die Rufende mit ihrer meckernden Gesellschaft. Die Ziegen der Nomaden und festwohnenden Sudânesen werden täglich zweimal gemolken und rennen, wenn die Milch sie drückt, wie toll zu dem einfachen Zelte oder Hause ihres Herrn, gleichviel, ob sie heute hier und morgen dort eingestellt werden; denn sie wissen den jeweiligen Wohnplatz ihres Gebieters mit aller Sicherheit aufzufinden.
Außer der Milch und dem von ihr gewonnenen Käse, welcher in Griechenland eine große Rolle spielt, oder der Butter und der Wolle nützt die Ziege durch ihr Fleisch, ihr Fell und ihre Hörner. Das Fleisch junger Zicklein ist sehr wohlschmeckend, obwohl fast etwas zu zart, das älterer Ziegen nicht schlecht; und wenn wir es nicht so hoch achten wie andere Völkerschaften, beispielsweise die Araber Sansibars, welche es dem Rindfleische vorziehen, beweisen wir damit nur, daß mit dem Geschmacks nicht zu rechten ist. Das Fell wird zu Korduan und Saffian, seltener zu Pergament verarbeitet; für erstere Lederarten bildet das Morgenland immer noch die Hauptquelle. Aus den Fellen der Böcke verfertigt man Beinkleider und starke Handschuhe, in Griechenland Wein- und in Afrika Wasserschläuche. Das grobe Haar wird hier und da zu Pinseln benutzt oder zu Stricken gedreht. Die Hörner fallen den Drechslern, im Morgenlande dem Wundarzte anheim, welcher sie als Schröpfköpfe zu verwenden pflegt. So nützt also das vortreffliche Thier im Leben wie im Tode.
Als Vertreter der Halbziegen ( Hemitragus) gilt der Thar, Tahir oder Iraharal, wie sein Entdecker, Hamilton Smith, ihn nannte. Die Eigenthümlichkeiten der Untersippe liegen in den seitlich zusammengedrückten, vorn gekanteten Hörnern, welche bei dem Männchen drei- oder vierseitig und mit ringelartigen Querwülsten bedeckt, beim Weibchen aber mehr gerundet und gerunzelt sind, in der kleinen, nackten Nasenkuppe und den vier Zitzen des Weibchens.

Tahir ( Capra jemlaica). Nach Wolf. 1/10 natürl. Größe.
Der Tahir ( Capra jemlaica, Hemitragus jemlaicus) ist ein schönes großes Thier von 1,8 Meter Leibes-, 9 Centim. Schwanzlänge und 87 Centim. Höhe am Widerrist. Hinsichtlich seines Leibesbaues ist er eine echte Ziege; denn auch die Hörner, auf denen seine Sonderstellung beruhen soll, unterscheiden sich nicht erheblich von denen anderer Mitglieder seiner Sippschaft. Sie stehen ziemlich hoch über den Augen und stoßen am Grunde beinahe zusammen, erheben sich in schiefer Richtung, fast an den Scheitel angepreßt, nach rückwärts, weichen nach außen von einander ab und drehen sich im letzten Drittheil ihrer Länge wieder nach ein- und abwärts, mit der Spitze aber nochmals nach außen. Die aus längeren, groben Grannen und sehr zartem, feinem Wollhaare bestehende Behaarung ist am ganzen Leibe reichlich, an manchen Theilen aber auffallend verlängert. Das Gesicht, die Unterseite des Kopfes und die Füße sind kurz behaart, der Hals, die Vorderschenkel und die hinteren Seiten bekleidet mit einer etwa 30 Centim. langen Mähne, welche jedoch bei dem Weibchen nur angedeutet ist. Beiden Geschlechtern fehlt der Bart. Wie man an dem Bocke im Londoner Thiergarten beobachtete, unterscheiden sich Sommer- und Wintertracht nicht unerheblich. Mit dem Alter nimmt die Länge der Mähne auffallend zu, und ebenso ändert sich die Färbung. Alte Männchen sind weißlich fahlbraun, an einzelnen Stellen dunkelbraun; ein schwarzer, breiter Längsstreifen zieht sich über die Stirne bis an das Schnauzenende hin und läuft hinten über den ganzen Rücken bis zur Schwanzspitze fort. Jüngere Männchen und Weibchen sind dunkelbraun und ihre Beine, mit Ausnahme eines lichteren Streifens auf der Hinterseite, fast schwarz. Nicht selten ist die vorherrschende Färbung aber auch ein fahles Schiefergrau, in welches sich an den Seiten Rostroth einmischt. Die Stirn, die Oberseite des Halses und Rückens sind roth oder dunkelbraun, die Kehle, die Unterseite des Halses, der mittlere Theil des Bauches und die Innenseite der Gliedmaßen schmutzig gelb, schiefergrau überflogen. Ein rother oder dunkelbrauner Streifen zieht sich erst ringartig um das Auge und läuft dann seitlich bis zum Maule herab, wo er, sich verbreiternd, erblaßt; ein ähnlicher Flecken steht an der unteren Kinnlade. Hörner und Hufe sind graulichschwarz. Unsere Abbildung stellt einen noch jugendlichen Bock des Londoner Thiergartens in seiner Sommertracht dar.
Markham gibt in seinen »Jagden im Himalaya« eine Beschreibung der Aufenthaltsorte dieses wenig bekannten Thieres. »Den gewöhnlichen Wohnplatz des Tahir«, sagt er, bilden felsige und grasreiche Abstürze der Hügel, namentlich wenn sie baumfrei sind; doch bewohnt das schöne Wild auch die Wälder selbst, falls nur der Grund dort zerrissen und felsig ist. Wenn die genannten Stellen in einer Höhe von mehr als zweitausend Meter liegen, bestehen die Wälder auf dem südlichen und westlichen Abhange hauptsächlich aus Eichen. Der Grund ist trocken und gewöhnlich felsig, die Bäume stehen sehr vereinzelt, und die niedere Pflanzenwelt hat fast dasselbe Gepräge wie die Weiden auf waldlosen Hügeln selber. Auf der Schattenseite, wo die Wälder viel dichter und baumreicher sind, kommt der Tahir niemals oder nur sehr selten vor.« Wie weit der Verbreitungskreis sich erstreckt, ist bis jetzt noch nicht genauer ermittelt worden.
Ueber die Lebensart des Tahir im Freien ist bis jetzt noch wenig bekannt. Nach Adams, welcher ihn in den Gebirgen Kaschmirs häufig antraf, hält er sich in Herden zusammen, verbringt den Tag in Waldungen und auf schattigen Plätzen, tritt gegen Abend auf Aesung und weidet nicht selten in Gesellschaft des Markhor oder der Schraubenziege. Jung eingefangene Tahirs gewöhnen sich leicht an den Hausstand, werden bald zahm, sind kletterlustig, heiter und neckisch wie die übrigen Ziegen und könnten allem Anscheine nach ohne sonderliche Mühe zu vollständigen Hausthieren gemacht werden. In Indien hat man mehrere auch in den wärmeren Gegenden gehalten und beobachtet, daß sie das ihnen eigentlich nicht zusagende Klima ohne Beschwerde ertragen. Mit dem Kleinvieh befreundet sich der Tahir bald, und zumal die Böcke scheinen in den weiblichen Schafen und Ziegen des Umgangs durchaus würdige Genossen zu erblicken, verfolgen dieselben oft mit großer Ausgelassenheit und sind sofort geneigt, mit Ziegenböcken, welche Uebergriffe in ihre Gerechtsame nicht dulden mögen, einen ernsten Strauß auszufechten. So selten man den Tahir in Gefangenschaft hielt, so hat man doch beobachten können, daß er sich ohne Umstände mit Hausziegen und sogar mit Schafen paart; die Eingeborenen behaupten sogar, daß für einen echten Tahirbock unter Umständen auch ein weibliches Moschusthier Gegenstand der regsten Theilnahme sein könnte. Innige Verhältnisse dieser Art sollen aber nicht von dem seitens des Bockes erwünschten Erfolge gekrönt werden.
Aus allen Angaben geht hervor, daß unser Thier in seinem ganzen Wesen und Sein eine echte Ziege ist: eigensinnig und muthwillig, aufmerksam, und selbständig, beweglich, ausdauernd und vorsichtig, dem anderen Geschlechts sehr zugethan und deshalb Gleichgesinnten gegenüber händelsüchtig und rauflustig wie die übrigen Glieder seiner Sippschaft.
Auf den hohen Gebirgen Nordamerikas lebt eine Ziege, welche durch ihr Gehörn sich so erheblich von den Familiengenossen unterscheidet, daß man sie zum Vertreter einer besonderen Sippe ( Aplocerus) erhoben und als Antilope angesehen hat. Ich vermag nicht, einer solchen Ansicht beizupflichten, muß vielmehr das fragliche Thier als eine echte Ziege erklären, weil mit Ausnahme des Gehörns alle übrigen Merkmale für meine Ansicht sprechen.
Die Schneeziege, Berg- oder Weißziege der Amerikaner, Nane der Kanadier ( Capra montana, Ovis montana, Capra, Antilope, Rupicapra und Mazama americana, Aplocerus oder Haplocerus americanus, lanigerus und montanus, Capra columbiana, Antilope lanigera, Mazama sericea und dorsata), hat durchaus die Gestalt der Hausziege, sieht jedoch infolge ihrer sehr reichen Behaarung gedrungener und kurzhälsiger aus als eine solche, obgleich ihr Leib eigentlich schlank genannt werden muß. Der Kopf ist gestreckt, das Auge groß, das Ohr mittellang und scharf zugespitzt. Die Hörner fallen durch ihre geringe Größe und Schlankheit, ihre Richtung und Wulstung auf, sind höchstens 20 Centim. lang, an der Wurzel fast rund und in der unteren Hälfte leicht geringelt, im zweiten Drittheil seitlich etwas zusammengedrückt, an der Spitze wieder gerundet, zeigen weder Kanten noch Grate, dagegen unterhalb der Hälfte der Länge eine rundum laufende Schwellung, welche nahe der Spitze noch einmal, jedoch in schwächerem Maße sich wiederholt, und richten sich in einfachem, sanftem Bogen nach oben, hinten und außen; der kurze Schwanz ist oben und seitlich buschig behaart; die Beine sind stämmig und erscheinen wegen der reichen Behaarung noch stärker als sie sind; Afterklauen und Hufe, welche letztere in ihrer oberen Hälfte von starren Haaren bedeckt werden, entsprechen dem kräftigen Baue des Beines, unterscheiden sich jedoch nicht wesentlich von denen anderer Wildziegen. Das am ganzen Körper gleichfarbige, weiße Haarkleid besteht aus langem, hartem Grannenhaare und aus feiner, langer, schlichter Unterwolle, welche beide theils einzeln, theils vereinigt auftreten, bedeckt den Leib und seine Glieder jedoch in sehr verschiedener Weise. Im Gesicht und auf der Stirne bemerkt man fast nur dichte, feine, krausgelockte Wolle ohne Grannen; am Halse, den Seiten, dem Bauche und den Schenkeln bilden beide Haararten gemeinschaftlich die Bekleidung; im Nacken, auf dem Oberhalse, dem Rücken, Schwanze und dem mähnenartigen Behange des Unterhalses, der Brust, Schulter und Vorderseite der Hinterschenkel fehlt die Wolle gänzlich. Auf dem Hinterkopfe steht ein dicker, langer Haarbusch, welcher nach allen Seiten herabfällt und in die Mähne des Oberhalses und Rückens übergeht; am Kinne und Unterkiefer hängt der üppige Bart in dichten, förmlich abgetheilten Locken herab; den Hals bedeckt ein über das Schulterblatt herabfallender Kragen langer Haare, welcher sich auf der Vorderseite der Schultern und der Oberarme in einen mähnenartigen Behang fortsetzt und die Vorderbeine fast verhüllt, d. h. nur das untere Drittheil derselben frei läßt; eine ähnliche Mähne umkleidet die Vorderseite der Hinterbeine, entwickelt sich jedoch erst oberhalb der Ferse; der Schwanz endlich ist mit einer langen und dicken Grannenquaste bestanden. Im Gesicht bekleidet die Wolle alle Theile, die Augen bis an den Spalt der Lider, die Nase bis an den Rand der Nasenlöcher; das hängende Ohr dagegen ist außen wie innen mit steifen, dichten Grannen bedeckt, welche, abweichend von der Ohrbehaarung anderer Thiere, sich nach der Spitze richten. Das Fell fühlt sich fettig an wie Schafwolle und besitzt einen ziemlich festen Zusammenhang, indem die einzelnen Haare merklich aneinander haften. Die Gesammtlänge des Thieres beträgt 1,2 Meter, die Schwanzlänge 9 Centim., die Höhe am Widerrist 68, die Kreuzhöhe 73 Centim.
Von dem vorstehend beschriebenen Thiere, einer im Museum zu Leyden befindlichen Ziege, unterscheidet sich, nach Angabe amerikanischer Forscher, der Bock einzig und allein durch etwas bedeutendere Größe, ein wenig stärkere, jedoch im wesentlichen gleichgestaltete Hörner und den längeren Bart. Ein Zicklein des Leydener Museums hat keine Unterwolle, sondern nur ein mittellanges, schlichtes, bloß auf der Stirn und im Nacken etwas verlängertes Haarkleid von ebenfalls reinweißer Färbung.
Das Verbreitungsgebiet der Schneeziege beschränkt sich auf den nördlichen Theil des Felsengebirges und reicht nach Norden hin bis zum 65. Breitengrade. Laut Baird tritt sie am häufigsten auf den Hochgebirgen des Washingtongeländes, laut Prinz von Wied hier besonders im Quellgebiete des Columbiaflusses auf. Ueber ihre Lebensweise sind wir erst in der neuesten Zeit einigermaßen unterrichtet worden. Nach Angabe des ungenannten Berichterstatters bewohnt sie einen so bedeutenden Höhengürtel, daß sie zu ihrer Aesung nichts anderes findet als Flechten und Moose und Alpenpflanzen der ausdauerndsten Art, im günstigsten Falle einige wenige verkümmerte Gebüsche einer Kiefer ( Pinus contorta) und ähnliche dürftige Gebüsche. Gleichwohl führt sie um diese Zeit ein recht behagliches Leben, und die Sorge tritt erst an sie heran, wenn sie im Winter genöthigt ist, ihre Hochalpenweiden zu verlassen. Während des Sommers klimmt sie bis zu fünftausend Meter unbedingter Höhe im Gebirge empor und wählt ihren Stand dann mit Vorliebe am unteren Rande der schmelzenden Schneefelder, im Winter pflegt sie etwas tiefer herabzusteigen, ohne jedoch das eigentliche Hochgebirge zu verlassen. In solchen Gebirgswildnissen, welche nur ausnahmsweise von Menschen betreten werden, geht sie mit sorgloser Eile ihre verschlungenen Pfade, mit der Sicherheit ihres Geschlechtes von einem Felsblocke zum anderen springend und die scheinbar unzugänglichsten Wände bekletternd. Abweichend von anderen Ziegenarten sollen Böcke die Führung übernehmen und ihnen Ziegen und Kitzchen in einfacher Reihe folgen. Aufgescheucht, oder durch einen Schuß erschreckt, eilen die Trupps in vollem Galopp an den Rändern der fürchterlichsten Abgründe dahin oder kreuzen eine Schlucht, eine nach der anderen dieselbe Stelle betretend, eher mit der Leichtigkeit und Anmuth eines beschwingten Geschöpfes als nach Art des behendesten und gewandtesten Vierfüßlers. Außerordentlich vorsichtig und begabt mit ungemein scharfem Gehör und Geruch, vereitelt die Schneeziege in den meisten Fällen jede Annäherung seitens des Menschen und läßt sich deshalb ebenso schwer beobachten als erlegen. Die Satzzeit fällt in den Anfang des Juni; denn von dieser Zeit an sieht man kleine Kitzchen, und zwar regelmäßig je eins hinter jeder Mutterziege, in selteneren Fällen Zwillinge. Die Kitzchen sind überaus niedliche, wie alle Ziegen spiellustige, in der Behendigkeit ihrer Sprünge geradezu unübertreffliche Wesen.
Abgesehen von einzelnen Naturforschern und leidenschaftlichen Bergjägern der weißen Rasse befassen sich nur die Indianer mit der Jagd in jenen menschenleeren Höhen, ohne jedoch die Schneeziege mit besonderem Eifer zu verfolgen. Das Wildpret derselben wird nicht geschätzt, weil es ebenso zähe als mit einem heftigen, nicht einmal dem des Kitzchens fehlenden Bockgeruche behaftet ist und selbst den Indianern, deren Geschmack bekanntlich keineswegs als heiklig bezeichnet werden darf, aus diesem Grunde widersteht. Man jagt deshalb die Schneeziege fast ausschließlich des Felles wegen, welches entweder an die Niederlagen der Hudsonsbaigesellschaft abgegeben oder von den Indianern zu einer kunstlosen Decke verarbeitet wird. Im Anfange der sechziger Jahre standen die Vliese ziemlich hoch im Werthe, weil man damals Muffe und Kragen aus dem Felle eines afrikanischen Affen mit Vorliebe trug und die gefärbte Decke der Schneeziege infolge ihrer Gleichartigkeit mit dem Affenfelle zu gleichen Zwecken verwendete. Mit dem Wechsel der Mode verlor das eine wie das andere seinen Werth, so daß gegenwärtig kaum mehr als eine Mark unseres Geldes für das Vlies bezahlt wird. Lord, welcher in den letzten Jahren die Schneeziege beobachtete und ihre Wolle sowie die aus derselben gefertigten Zeuge genauer untersuchte, erachtet das Thier als zur Einbürgerung auf europäischen Höhen besonders geeignet, scheint dabei jedoch zu vergessen, daß wir die Kaschmirziege, deren Nutzen offenbar größer sein dürfte, weit leichter verbreiten könnten als eine wilde Stammart, welche meines Wissens noch niemals in Gefangenschaft gehalten worden ist und selbst in den meisten Reichsmuseen gegenwärtig noch fehlt.
In leiblicher Hinsicht stehen die Schafe ( Ovis) den Ziegen außerordentlich nah, in geistiger Hinsicht haben nur die wild lebenden Arten beider Gruppen Aehnlichkeit mit einander. Die Schafe unterscheiden sich von den Ziegen durch die regelmäßig vorhandenen Thränengruben, die flache Stirn, die kantigen, etwa dreiseitigen, querrunzeligen, schneckenförmig gedrehten Hörner und den Mangel eines Bartes. Im allgemeinen sind sie schlankgebaute Thiere mit schmächtigem Leibe, dünnen, hohen Beinen und kurzem Schwanze, vorn stark verschmälertem Kopfe, mäßig großen Augen und Ohren und doppelter, zottiger oder wolliger Behaarung. Im Geripp macht sich zwischen ihnen einerseits und den Ziegen, Antilopen und Hirschen anderseits ein erheblicher Unterschied nicht bemerklich. Dreizehn Wirbel tragen Rippen, sechs sind rippenlos, drei bis zweiundzwanzig bilden den Schwanz. Der innere Leibesbau bietet keine besonderen Eigenthümlichkeiten.
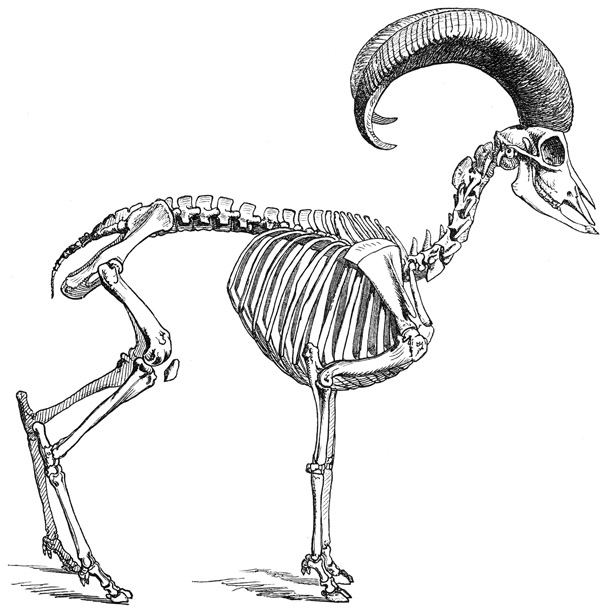
Geripp des Mufflon. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
Alle wildlebenden Schafe bewohnen Gebirge der nördlichen Erdhälfte. Ihre eigentliche Heimat ist Asien; ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich jedoch bis Südeuropa, Afrika und den nördlichen Theil von Amerika. Jede Gebirgsgruppe Asiens besitzt eine oder mehrere ihr eigenthümliche Arten, wogegen Europa, Afrika und Amerika sehr arm erscheinen und, so viel bis jetzt bekannt, je nur eine einzige Art aufzuweisen haben. Mehrere Arten stehen einander sehr nahe und sind hauptsächlich auf die Verschiedenheit ihrer Hörner begründet worden, deren beziehentliche Größe und Windung als maßgebend betrachtet wird. Bei den einen ist das rechte Horn von der Wurzel bis zur Spitze links und das linke rechts gewunden: dann treten die Hornspitzen nach außen hin auseinander; bei den anderen ist das rechte Horn rechts und das linke links gewunden: dann wenden sich die Hornspitzen nach hinten, und das Gehörn erinnert somit an das der Ziegen. Ob und in wie weit man berechtigt ist, nach diesen und anderen Verschiedenheiten der Gehörne alle von den Forschern bisher aufgestellten Arten anzuerkennen und festzuhalten, läßt sich gegenwärtig nicht ermitteln: wir kennen die Wildschafe noch viel zu wenig, als daß wir im Stande wären, ein bestimmtes Urtheil über sie zu fällen. Doch hat sich herausgestellt, daß ungeachtet einer nicht unerheblichen Veränderlichkeit des Gehörns einer und derselben Art das Gepräge der Hornbildung unzweifelhaft als eins der Hauptmerkmale zur Bestimmung der Arten angesehen werden darf.
Sämmtliche Schafe sind echte Gebirgskinder, scheinen sich nur in bedeutenden Höhen wohl zu fühlen und steigen meist bis über die Schneegrenze, einzelne bis zu sechs- und siebentausend Meter unbedingter Höhe empor, wo außer ihnen nur noch Ziegen, ein Rind, das Moschusthier, und einige Vögel leben können. In ebenen Gegenden hausen bloß zahme Schafe, und man sieht es denen, welche in Gebirgsländern gezüchtet werden, deutlich genug an, wie wohl es ihnen thut, eine ihnen zusagende Oertlichkeit bewohnen zu dürfen. Grasreiche Triften oder lichte Wälder, schroffe Felsen und wüste Halden, zwischen denen nur hier und da ein Pflänzchen sprießt, bilden die Aufenthaltsorte der Wildschafe. Je nach der Jahreszeit wandern sie von der Höhe zur Tiefe oder umgekehrt: der Sommer lockt sie nach oben, der eisige Winter treibt sie in wohnlichere Gelände, weil er ihnen in der Höhe den Tisch verdeckt. Die Nahrung besteht im Sommer aus frischen und saftigen Alpenkräutern, im Winter aus Moosen, Flechten und dürren Gräsern. Die Schafe sind lecker, wenn sie reiche Auswahl haben, und genügsam im hohen Grade, wenn sich ihnen nur weniges bietet: dürre Gräser, Schößlinge, Baumrinden und dergleichen bilden im Winter oft ihre einzige Aesung, ohne daß man ihnen deshalb Mangel anmerkt.
Mehr als bei anderen Hausthieren, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des Renthieres, sieht man an den Schafen, wie die Sklaverei entartet. Das zahme Schaf ist nur noch ein Schatten von dem wilden. Die Ziege bewahrt sich bis zu einem gewissen Grade auch in der Gefangenschaft ihre Selbständigkeit: das Schaf wird im Dienste des Menschen ein willenloser Knecht. Alle Lebhaftigkeit und Schnelligkeit, das gewandte, behende Wesen, die Kletterkünste, das kluge Erkennen und Meiden oder Abwehren der Gefahr, der Muth und die Kampflust, welche die wilden Schafe zeigen, gehen bei den zahmen unter; sie sind eigentlich das gerade Gegentheil von ihren freilebenden Brüdern. Diese erinnern noch vielfach an die munteren, klugen, geweckten und übermüthigen Ziegen: denn sie stehen ihnen in den meisten Eigenschaften und Fertigkeiten gleich und haben denselben regen Geist, dasselbe lebhafte Wesen; die zahmen sind unausstehliche Geschöpfe und können wahrhaftig nur den Landwirt begeistern, welcher aus dem werthvollen Vliese guten Gewinn zieht. Charakterlosigkeit ohne Gleichen spricht sich in ihrem Wesen und Gebaren aus. Der stärkste Widder weicht feig dem kleinsten Hunde; ein unbedeutendes Thier kann eine ganze Herde erschrecken; blindlings folgt die Masse einem Führer, gleichviel ob derselbe ein erwählter ist oder bloß zufällig das Amt eines solchen bekleidet, stürzt sich ihm nach in augenscheinliche Gefahr, springt hinter ihm in die tobenden Fluten, obgleich es ersichtlich ist, daß alle, welche den Satz wagten, zu Grunde gehen müssen. Kein Thier läßt sich leichter hüten, leichter bemeistern als das zahme Schaf; es scheint sich zu freuen, wenn ein anderes Geschöpf ihm die Last abnimmt, für das eigene Beste sorgen zu müssen. Daß solche Geschöpfe gutmüthig, sanft, friedlich, harmlos sind, darf uns nicht wundern; in der Dummheit begründet sich ihr geistiges Wesen, und gerade deshalb ist das Lamm nicht eben ein glücklich gewähltes Sinnbild für tugendreiche Menschen. In den südlichen Ländern, wo die Schafe mehr sich überlassen sind als bei uns, bilden sich ihre geistigen Fähigkeiten anders aus, und sie erscheinen selbständiger, kühner und muthiger als hier zu Lande.
Die Vermehrung der Schafe ist ziemlich bedeutend. Das Weibchen bringt nach einer Tragzeit von zwanzig bis fünfundzwanzig Wochen ein oder zwei, seltener drei oder vier Junge zur Welt, welche bald nach ihrer Geburt im Stande sind, den Alten nachzufolgen. Die wilden Mütter vertheidigen ihre Jungen mit Gefahr ihres Lebens und zeigen eine außerordentliche Liebe zu ihnen: die zahmen sind stumpf gegen die eigenen Kinder, wie gegen alles übrige und glotzen den Menschen, welcher ihnen die Lämmer wegnimmt, unendlich dumm und gleichgültig an, ohne sich zu wehren. Nach verhältnismäßig kurzer Zeit werden die Jungen selbständig und bereits vor ihrem erfüllten ersten Lebensjahre selbst wieder fortpflanzungsfähig.
Fast alle wilden Arten lassen sich ohne erhebliche Mühe zähmen und behalten ihre Munterkeit wenigstens durch einige Geschlechter bei, pflanzen sich auch regelmäßig in der Gefangenschaft fort. An Leute, welche viel mit ihnen sich abgeben, schließen sie sich innig an, folgen ihrem Rufe, nehmen gern Liebkosungen entgegen und können einen so hohen Grad von Zähmung erlangen, daß sie mit anderen Hausthieren auf die Weide gesandt werden dürfen, ohne günstige Gelegenheiten zur Wiedererlangung ihrer Freiheit zu benutzen. Die zahmen Schafe hat der Mensch, welcher sie seit Jahrtausenden pflegte, ihres hohen Nutzens wegen über die ganze Erde verbreitet und mit Erfolg auch in solchen Ländern eingeführt, welche ihnen ursprünglich fremd waren.
An die Spitze der zu schildernden Wildschafe dürfen wir eine Art stellen, welche wegen des Mangels der Thränengruben und des noch wenig entwickelten Gehörns an die Ziegen erinnert: das Mähnenschaf ( Ovis tragelaphus, Ammotragus tragelaphus), Vertreter einer gleichnamigen Untersippe ( Ammotragus), ein wegen seiner lang herabfallenden Mähne sehr ausgezeichnetes Thier. Der Bau ist gedrungener als bei den meisten übrigen Schafen, der Leib sehr kräftig, der Hals kurz, der Kopf gestreckt, aber zierlich, an der Stirn breit, nach der Muffel zu gleichmäßig verschmächtigt, der Nasenrücken gerade, das Auge groß und wegen der erzfarbenen Iris, aus welcher der quergestellte Stern deutlich hervortritt, ungewöhnlich lebhaft, das Ohr klein, schmal und von beiden Seiten her gleichmäßig zugespitzt, die Muffel sehr klein und schmal, auf die Umrandung der Nasenlöcher beschränkt. Das auf der Stirn aufgesetzte Gehörn biegt sich anfangs ein wenig nach vorn, sodann gleichmäßig nach hinten und außen, mit den Spitzen etwas nach unten und innen, hat dreieckigen Querschnitt, bildet auf der Vorderseite eine breite, sanft gewölbte, in der Mitte kantig vorgezogene Fläche, wogegen die innere und untere Seite eben und scharfkantig erscheinen, und ist von der Wurzel bis zur Spitze auf allen Seiten mit dicht aneinanderstehenden, wenig erhabenen, welligen Wülsten bedeckt, welche nur an der abgeplatteten Spitze fehlen. Der mittellange, breite, zu beiden Seiten behaarte, am Ende gequastete Schwanz reicht mit seinem Haarbüschel bis über die Hackengelenke herab; die Läufe sind kurz und kräftig, die Hufe hoch, die Afterhufe klein und im Haar versteckt. Das Vlies besteht aus starken, harten, rauhen, nicht besonders dicht stehenden Grannen und feinen, gekräuselten, den Leib vollständig bekleidenden Wollhaaren. Jene verlängern sich auf dem Oberhalse, im Nacken und auf dem Widerriste zu einem aufrechtstehenden kurzen, mähnigen Haarkamme und entwickeln sich vorder- und unterseits zu einer reichen und vollen, fast bis auf den Boden herabfallenden Mähne, welche an der Kehle beginnt, einen längs des Halses verlaufenden, am Unterhalse sich theilenden und beiderseits in der Schlüsselbeingegend weiter ziehenden Streifen einnimmt, aber auch noch auf die Vorderläufe sich fortsetzt, indem diese unterhalb des Elnbogengelenkes durch einen vorn, außen und hinten angesetzten mähnigen Busch geziert sind, ebenso wie oberseits die ebenfalls verlängerten Haare der Halsseiten, welche hier wie dicke Polster aufliegen, sie verstärken. Endlich bemerkt man noch zu beiden Seiten des Unterleibes kammartig aufgekräuselte Haare, wogegen das Vlies im übrigen sehr gleichmäßig entwickelt ist. Das einzelne Haar hat an der Wurzel hellgraue, hierauf dunkel braunschwarze, gegen die Spitze hin rehbraune Färbung und endet entweder mit einer fahlgelben oder mit einer schwarzen Spitze; nur ein längs des Nackens verlaufender, jedoch nicht die ganze Breite des Kammes einnehmender Mittelstreifen und der obere Theil der Kehlmähne werden durch mehr oder weniger braunschwarze Haare hergestellt. Es bildet somit ein sehr gleichmäßiges Fahlrothbraun die vorherrschende Färbung des Thieres, wogegen der erwähnte Streifen schwarz erscheint; der Mittelbauch ist dunkelbraun, ein verlängerter Haarkranz über den Hufen, welcher diese theilweise bedeckt, dunkel kastanienbraun; der Augenbrauenbogen, das Maul, ein Fleck hinter dem Ohre in der Kieferfuge, die Hinterschenkel, die Vorderläufe hinten, die untere Hälfte der Hinterläufe und die Innenseite des Schwanzes haben isabellgelbe, Achselgegend und Innenseite der Oberarme und Schenkel weißlich isabellgelbe, die langen Mähnenhaare, mit Ausnahme einiger schwarz gespitzten, einen Fleck bildenden, isabellfahlbraune Färbung. Das Weibchen unterscheidet sich hauptsächlich durch die schwächere Mähne vom Männchen; denn sein Gehörn ist ebenfalls groß und kräftig. Vollkommen erwachsene Böcke erreichen, einschließlich des etwa 25 Centim. langen Schwanzes, eine Gesammtlänge von 1,8 bis 1,9 Meter, bei einer Schulterhöhe von 95 Centim. bis 1 Meter, erwachsene Schafe eine Gesammtlänge von 1,55 Meter bei 90 Centim. Schulterhöhe; das Gehörn kann, der Krümmung nach gemessen, bei jenen 65 bis 70 Centim., bei diesen 35 bis 40 Centim. lang werden.
Bereits im Jahre 1561 beschrieb Cajus Britannicus das Mähnenschaf, dessen Fell ihm aus Mauritanien gebracht worden war. Seitdem verging lange Zeit, ehe wieder etwas über das Thier verlautete; erst Pennant und später Geoffroy erwähnen es von neuem. Letzterer fand es in der Nähe von Kairo im Gebirge auf; andere Forscher haben es am oberen Nil und in Abessinien beobachtet. Am häufigsten tritt es im Atlas auf. Ueber seine Lebensweise war nichts bekannt, und auch ich würde, da mir das Thier auf meinen Reisen nie vorgekommen ist, höchstens über das Gefangenleben berichten können, hätte Dr. Buvry nicht nachstehendes mir mitgetheilt.

Mähnenschaf ( Ovis tragelaphus). 1/15 natürl. Größe.
»Das Mähnenschaf wird im südlichen Algerien von den Einheimischen im allgemeinen Arui genannt, während der Widder Feschtâl, das Schaf Massa und das Junge Charúf heißen. In der Provinz Konstantine bewohnt das Thier die Südabhänge des Aurasgebirges; nach den Angaben der Araber soll es jedoch auch in den dieses Gebirge begrenzenden Steppen und selbst in der Sandwüste des Wadi-Sinf angetroffen werden. Im Westen findet es sich auf dem Djebel-Amúr und in der Provinz Orân auf dem Südabhange des Djebel-Sidi-Schëich. Unzweifelhaft wird es in den höheren Theilen des Gebirges, in dem marokkanischen Atlas noch häufiger sein als in Algerien, da Unzugänglichkeit und Abgeschiedenheit vom menschlichen Verkehr, welche jenen Theil des Gebirges auszeichnen, einem Wiederkäuer nur zusagen können.
»Der Arui liebt die höchsten Felsengrate der Gebirge, zu denen man bloß durch ein Wirrsal zerklüfteter Stein- und Geröllmassen gelangen kann, und deshalb ist seine Jagd eine höchst mühselige, ja oft gefährliche. Dazu kommt, daß sie nicht viel Gewinn verspricht; denn das Mähnenschaf lebt einzeln, und nur zur Bockzeit, welche in den November fällt, sammeln sich mehrere Schafe und dann auch die Widder, halten einige Zeit zusammen und gehen hierauf wieder zerstreut ihres Weges. Gelegentlich der Paarung kommt es zwischen den Widdern oft zu überaus hartnäckigen Kämpfen. Die Araber versichern, daß man bei solchen Gelegenheiten in Zweifel sein müsse, was man mehr bewundern solle, die Ausdauer, mit der sich die verliebten Böcke gesenkten Kopfes halbe Stunden und länger einander gegenüber stehen, oder die Furchtbarkeit des gegenseitigen Anpralls, wenn sie gegen einander anrennen, oder endlich die Festigkeit der Hörner, welche Stöße aushalten, die, wie man glauben möchte, einem Elefanten die Hirnschale zerschmettern müßten.
»Die Nahrung des Arui ist beziehentlich dieselbe wie bei den übrigen wildlebenden Schafen und Ziegen: saftige Alpenpflanzen im Sommer, dürre Flechten und trockene Gräser im Winter; vielleicht mögen ihm auch einzelne von den niederen gestrüppartigen Gebüschen willkommen sein.
»Die Jagd auf das Mähnenschaf hatte ich mir leichter vorgestellt, als sie war. In Begleitung Ali-Ibn-Abels verließ ich die Oase Biskra und ritt in nordöstlicher Richtung nach dem Djebel el Melch, einem Theil des Aurasgebirges, welches hier ziemlich steil in die Ebene abfällt und, wie gewöhnlich, am Fuße mit wüsten Halden und zerspaltenen und zerrissenen Felsstücken bedeckt ist. Wir mußten lange suchen, ehe wir einen Weg durch das Wirrsal fanden und konnten immer noch von Glück sagen, daß überhaupt einer vorhanden war; denn ohne Weg würden wir schwerlich nach oben gekommen sein. Mühselig kletterten wir einige Stunden fort und mochten eine Höhe von sechszehnhundert Meter über dem Meere erstiegen haben: da winkte eine frische plätschernde Quelle zur Ruhe. Wir schlürften entzückt das köstliche Wasser und entdeckten dabei die Fährte eines Arui. Das Mähnenschaf, welches heute hier getrunken, war mir so gut als sicher: ich wußte, daß es wieder hierher zurückkehren würde. Gleichwohl ließ uns die Ungeduld nicht recht zur Ruhe kommen, und noch ehe wir uns gehörig erfrischt hatten, begannen wir weiter nach oben zu steigen, in der Hoffnung, vielleicht schon jetzt etwas von dem Thiere zu sehen. Aber vergebens waren unsere Anstrengungen. Wir kletterten den ganzen Tag umher, ohne auch nur ein Anzeichen des Wildschafes zu finden. Die Nacht brach schnell herein und nöthigte uns ein Unterkommen zu suchen. Ein Felsenabhang in der Nähe jener Quelle mußte uns Herberge geben. Der Morgen graute noch nicht, als wir schon auf dem Anstande lagen. In erwartungsvoller Stille mochten wir etwa anderthalb Stunden gelegen haben: da schritt langsamen Ganges ein gewaltiger Feschtâl zu uns heran. Jede Bewegung war edel und stolz, jeder Schritt sicher, fest und ruhig. Vorsichtig suchte er den sanftesten Strand; jetzt bückte er den Kopf zum Trinken: da blitzte das Feuer aus unseren beiden Gewehren. Mit einem Schrei sank der Widder zusammen; aber plötzlich raffte er sich wieder auf und dahin ging es in rasender Eile, mit Sätzen, wie ich sie vorher noch nie geschaut. Gemsengleich, sicher und kühn, jagte er dahin, und wir standen verblüfft und schauten ihm nach. Doch getroffen war er, und weit konnte er unseres Erachtens nicht gekommen sein: also auf zur Verfolgung! Aber Stunde um Stunde verlief und immer noch eilten wir hinter dem Thiere drein, dessen Fährte jetzt durch die Blutspuren dem scharfen Auge meines arabischen Begleiters nur zu deutlich war. Vier bis fünf Stunden mochte unsere Verfolgung gedauert haben, da führte die Fährte nach einem Felsengrate hin, welcher schroff und steil sechzig Meter tief nach einem Kessel abfiel. Hier verlor sich jedes Zeichen. Es schien uns unmöglich, daß der Widder da hinab einen Sprung gewagt hätte. Wir standen lange Zeit rath- und thatlos da, bis endlich der Araber doch einen, wie er sagte, wohl vergeblichen Versuch machen wollte, da hinab zu kommen. Er kletterte zur Tiefe nieder und hatte den Boden des Kessels kaum erreicht, als mich ein lauter Freudenschrei benachrichtigte, daß seine Bemühungen vom besten Erfolge gekrönt sein müßten; unten lag der Widder verendet.
»Nach den Ringen der Hörner zu urtheilen, mochte das Thier acht bis zehn Jahre alt sein aber mein Araber und die übrigen, welche ich später befragte, meinten einstimmig, daß dieser Bock noch keineswegs zu den großen gezählt werden könne, und versicherten, weit schwerere gesehen zu haben. Für uns war nicht daran zu denken, unsere Jagdbeute aus dem Kessel heraus zu schaffen; es blieb mir deshalb nichts anderes übrig, als den Widder gleich hier abzuhäuten.
»Die Araber sind große Liebhaber des Fleisches dieser Wildschafe, und auch ich muß gestehen, daß der Schlegel, welchen der Schêch Ali trotz seines Seufzens zur Tiefe schleppen mußte, mir vortrefflich geschmeckt hat. Das Wildpret steht dem des Hirsches sehr nahe, ist aber nach meiner Ansicht weit feiner. Aus den Fellen bereiten die Araber Fußdecken; die Haut wird hier und da gegerbt und zu Saffian verwandt.
»Obwohl der Arui zu den selteneren Thieren gezählt werden muß, wird derselbe doch manchmal jung von den Gebirgsbewohnern in Schlingen gefangen und dann gewöhnlich gegen eine geringe Summe an die Befehlshaber der zunächstliegenden Kriegsposten abgegeben. In den Gärten des Gesellschaftshauses zu Biskra sah ich einen jungen Arui, welcher an einer fünf Meter hohen Mauer, der Umhegung seines Aufenthaltsortes, mit wenigen, fast senkrechten Sätzen emporsprang, als ob er auf ebener Erde dahinliefe, und sich dann auf der kaum handbreiten Firste so sicher hielt, daß man glauben mußte, er sei vollkommen vertraut da oben. Oft machte er sich das Vergnügen, außerhalb seines Geheges zu weiden, und wenn in einem Garten irgend etwas seine Leckerkeit erregt hatte, fiel es ihm gewiß zum Opfer; denn Hag und Mauer waren nirgends so hoch, daß der Spring- und Kletterkünstler nicht darüber weggekommen wäre. Er entfernte sich oft weit von seinem Wohnorte, kehrte aber immer aus eigenem Antriebe und auf demselben Wege zurück. Gegen die Menschen zeigte er sich nicht im geringsten furchtsam, kam zu jedem hin und nahm ohne Umstände Brod und andere Leckereien, welche man ihm vorhielt, aus der Hand.«
Neuerdings ist das Mähnenschaf öfters lebend nach Europa gekommen, und gegenwärtig in Thiergärten keine Seltenheit. Ueber sein Gefangenleben läßt sich wenig sagen, weil das Thier, abgesehen von seiner Kletterfertigkeit, hervorragende Eigenschaften nicht bekundet. Unserem Hausschafe gegenüber zeigt es allerdings eine gewisse Selbständigkeit und Eigenwilligkeit, ist auch leiblich weit beweglicher als dasselbe, übertrifft selbst ein solches, welches im Gebirge groß geworden, unter Leitung von Ziegen klettern gelernt hat und ganz andere Fähigkeiten offenbart als das leiblich wie geistig verkommene Geschöpf, welches uns Flachländern Fleisch und Wolle liefert; diese leibliche Beweglichkeit darf jedoch nicht zu falschen Schlüssen auf das geistige Wesen verlocken: denn das Mähnenschaf ist ebenso dumm und beschränkt, ebenso halsstarrig oder eigensinnig, ebenso scheu und furchtsam wie das Hausschaf, läßt sich daher schwer behandeln und zähmen und erweist sich keineswegs immer so gutartig, als es nach vorstehender Schilderung Buvrys scheinen möchte. Seinen Wärter lernt es kaum von anderen Menschen unterscheiden, ihn wenigstens nicht als Pfleger und Freund, sondern höchstens als einen ihm willigen Diener erkennen, welcher regelmäßig Futter bringt; in ein wirkliches Freundschaftsverhältnis zu ihm tritt es nie. So lange es jung ist, flieht es den täglich gesehenen Mann wie alle anderen Menschen, im Alter stellt es sich trotzig und störrisch zur Wehre. Ein gewisser Ernst, welchen man fast Murrsinn nennen könnte, zeichnet es aus; das neckische Wesen der Ziegen fehlt ihm vollständig. Es kann wegen einer Kleinigkeit in Zorn, wegen einer Geringfügigkeit in Wuth gerathen und pflegt dann in beiden Fällen zu beweisen, daß es sich seiner Stärke wohl bewußt ist. Wenn er will, nimmt der Bock es mit dem stärksten Manne auf, indem er seinen Gegner einfach über den Haufen rennt. Mit anderen Thieren scheint das Mähnenschaf leichter als mit dem Menschen in ein gewisses Einvernehmen zu treten; von einem wirklichen Freundschaftsverhältnisse kann aber auch in diesem Falle nicht gesprochen werden. Ihm auffallende oder gefährlich scheinende Thiere, Hunde z.+B., fürchtet er und rennt bei ihrem Erscheinen mit der allen Schafen eigenen Sinnlosigkeit wie toll gegen die Gitterwände an; mit ihm nahe stehenden Verwandten, Ziegen und Schafen, Steinböcken oder Mufflons, verträgt es sich zwar zuweilen, selten jedoch längere Zeit: denn sobald es, mindestens der Bock, in ihnen einen ihm ebenbürtigen Genossen erkennt, kämpft er ebenso wie mit anderen Böcken seiner Art beharrlich, ernst und ausdauernd, falls die Liebe ins Spiel kommt, thatsächlich auf Leben und Tod, da er unter Umständen nicht eher ruht, als bis einer der Kämpen leblos auf dem Platze bleibt. Die Brunst erhöht auch seine unliebenswürdigen Eigenschaften, namentlich seine Rauf- und Stoßlust in besonderem Grade und macht den Bock sogar zuweilen weiblichen Thieren der eigenen Art gefährlich. Dem entsprechend pflegt man erwachsene Mähnenschafe nach ihrem Geschlechte getrennt, alte Böcke selbstverständlich einzeln, zu halten, sie auch bloß dann zu den weiblichen Thieren zu lassen, wenn die Brunst auf beiden Seiten erkennbar geworden und man im Stande ist, die Paarung zu beaufsichtigen. Nach alledem kann man das Mähnenschaf nicht als einen angenehmen Gefangenen bezeichnen: durch seine Größe, seine Gestalt und die eigenthümliche Haarmähne macht es einen gewissen Eindruck auf den Beobachter, ist aber wenig geeignet, diesen länger zu fesseln.
Einhundertundsechzig Tage nach der Paarung, manchmal auch einen oder zwei Tage früher, oder zwei bis drei Tage später, bringt das Mähnenschaf ein oder zwei Lämmer zur Welt, kleine, niedliche und bereits nach wenigen Stunden höchst bewegliche, auch sehr muntere Thierchen, welche wegen ihrer Kletterlust mehr an Zicklein als an Hauslämmer erinnern. Vierundzwanzig Stunden alt, besteigen sie bereits alle Höhen, welche in ihrem Gehege sich finden, mit ersichtlichem Vergnügen, und wenn sie ihr Leben erst auf zwei oder drei Tage gebracht haben, legen sie eine Behendigkeit und Gewandtheit an den Tag, daß man wohl einsieht, wie schwer es halten mag, sie im Freien zu fangen. Allgemach gehen die ersten kindischen Sprünge in spielendes Necken über: eines der Geschwister jagt hinter dem anderen her, und dieses stellt sich schließlich trotzig zur Wehre, ohne jedoch ernstlich mit dem Kameraden zu kämpfen. Die Mutter folgt allen Bewegungen ihrer Sprößlinge mit etwas weniger Gleichmuth, als wir bei den Schafen zu sehen gewohnt sind, steigt auch wohl dann und wann den übermüthigen Kleinen nach oder lockt sie durch ein blökendes Mahnen zu sich heran, worauf beide fast gleichzeitig das Euter zu verlangen pflegen und, nach Art der Hauslämmer und Zicklein saugend, durch heftige Stöße gegen das Euter möglichst viele Milch zu gewinnen streben. Bei günstiger Witterung wachsen sie rasch heran, beginnen etwa vom achten Tage ab einzelne Hälmchen aufzunehmen, fressen, einen Monat alt geworden, bereits von allem Futter, welches der Alten gereicht wird, saugen jedoch noch immer und entwöhnen sich erst gegen die Brunstzeit hin, oder richtiger, werden von der Alten nicht mehr zugelassen.
Man hat in der Neuzeit auch auf das Mähnenschaf sein Augenmerk geworfen und die Absicht ausgesprochen, es in den Hausstand überzuführen oder doch in unserem Hochlande einzubürgern. Die Möglichkeit des Gelingens nach einer oder der anderen Richtung hin kann nicht in Abrede gestellt werden. Unser Klima legt keine Hindernisse in den Weg, und auch die Züchtung verursacht kaum nennenswerthe Schwierigkeiten; es fragt sich jedoch, ob sich das Mähnenschaf als Hausthier oder Wild wirklich nutzbringend erweisen dürfte. Wie unser Hausschaf ist es wählerisch, beansprucht die beste Nahrung und eine sorgfältige Pflege, weil es ungeachtet seiner kraftvollen Erscheinung leicht und oft ohne erklärliche Ursache zu Grunde geht. So ist man zur Zeit herzlich froh, wenn man in Thiergärten einen gewissen Bestand erhält, dem entsprechend auch durchaus noch nicht im Stande, so viele Mähnenschafe zusammenzubringen, als zum Aussetzen in Gebirge oder zur Bildung einer Herde erforderlich wären. Einzelne Thiergärten züchten allerdings mit Glück, in anderen dagegen ist binnen wenig Wochen der ganze Bestand der Mähnenschafe ausgestorben, ohne daß man die Ursache erklären konnte. Solche Erfahrungen mindern die Hoffnung auf ein Gelingen der Einbürgerung in erheblicher Weise und lassen es ebenso sehr fraglich erscheinen, ob ein Aussetzen in Gebirge zu günstigeren Ergebnissen führen würde.
Nur zwei Breitengrade trennen das Mähnenschaf von dem Mufflon ( Ovis Musimon, Capra, Aegoceros und Caprovis Musimon, Capra und Aegoceros Ammon), Vertreter der Untersippe der Bergwidder ( Ovis ), dem einzigen Wildschafe, welches Europa und zwar die Felsgebirge der Inseln Sardinien und Corsica bewohnt. Ziemlich allgemein nimmt man an, daß der Mufflon in früheren Zeiten noch in anderen Theilen Südeuropas vorgekommen sei, sich beispielsweise auch auf den Balearischen Inseln und in Griechenland gefunden habe, vermag diese Meinung jedoch in keiner Weise zu begründen. In Spanien, dessen südöstlicher Theil als Heimat des Mufflon angegeben wird, ist er nicht mehr zu finden, und wahrscheinlich auch niemals zu finden gewesen. Man hat einfach den Bergsteinbock mit ihm verwechselt. Ich habe mich mit besonderer Sorgfalt nach dem Mufflon erkundigt und alle Sammlungen von Thieren oder Gehörnen genau geprüft, auch alle zünftigen Jäger und die gut beobachtenden Bergbewohner befragt, immer aber erfahren, daß außer dem Bergsteinwilde keine andere Wildziegen- oder Wildschafart auf der Iberischen Halbinsel lebt. Zur Zeit findet sich der Mufflon auf Sardinien und Corsica noch immer in Rudeln von fünfzig bis hundert Stück, und ist dort allen Gebirgsbewohnern unter dem Namen Muffione, Muffuro und Muffla oder Mufflon wohl bekannt. Die alten Römer unterschieden den korsischen Mufflon von dem sardinischen; Plinius nennt den einen Musmon, den anderen, wie die Griechen, Ophion, die mit dem Schafe erzeugten Blendlinge aber Umbri.

Mufflon ( Ovis Musimon). 1/12 natürl. Größe.
Aus alten Berichten erfahren wir, daß diese Wildschafe außerordentlich häufig waren. Bisweilen wurden auf einer einzigen großen Jagd vier- bis fünfhundert Stück erlegt; gegenwärtig ist man froh, wenn man einige Stücke bekommt; auf Jagden der Vornehmen, welche mit allen Mitteln ins Werk gesetzt werden, erbeutet man nur in höchst seltenen Fallen dreißig bis vierzig Stück. Schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts, zu Zeiten des Abtes Cetti, welchem wir die erste ausführlichere, auch im nachstehenden wiedergegebene Lebensschilderung des Mufflon verdanken, gehörte es zu den glücklichsten Jagdereignissen, wenn man einmal hundert dieser Wildschafe erjagte. Wie der eben genannte, recht tüchtige Forscher ausführt, bewohnen dieselben nämlich keineswegs alle Gebirge Sardiniens, sondern bloß einzelne Bergzüge und hier auch nur die höchsten Spitzen, zuweilen solche Gipfel ersteigend, von denen man das ganze die Insel einfassende Meer erblicken kann. Eine Ansiedelung der Thiere befindet sich auf dem Gebirge Argentiera in Nurra, eine andere in den Landschaften Iglesias und Teulada; der eigentliche Stamm lebt in dem östlichen Theile, besonders zahlreich auf dem Lerrone, einem Gebirge in Patada, ferner in Budoso und Nuoro; der Mittelpunkt ihrer Wohnplätze aber scheint der Berg Pradu in Oliena zu sein, von wo aus sie sich über Fonni bis Sarabus verbreitet haben. Spätere von Lamarmora herrührende Angaben sind dürftig und mangelhaft. Im Gegensatze zu Cetti behauptet dieser Berichterstatter, daß der Mufflon um die Mitte der zwanziger Jahre auf Sardinien noch ebenso häufig gewesen sei als zu Plinius Zeiten, infolge der verbesserten Gewehre aber sich vermindert und durch den sehr strengen Winter von 1830 ungemein gelitten habe. Von seiner Lebensweise weiß der edle Graf nichts mitzutheilen, was nicht schon von Cetti besser und ausführlicher gesagt worden wäre. Auch Mimaut, welcher das Thier weitschweifig schildert, bereichert seine Naturgeschichte kaum wesentlich.
Der Mufflon gehört zu den kleinsten Wildschafen, obgleich seine Länge, einschließlich des höchstens 10 Centim. langen Schwanzes, immerhin 1,25 Meter, die Höhe am Widerriste 70 Centim. und das Gewicht zwischen 40 bis 50 Kilogramm beträgt. Die Hörner erreichen, der Krümmung nach gemessen, eine Länge von etwa 65 Centim. und ein Gewicht von 4 bis 6 Kilogramm. Der Leibesbau ist der gedrungene aller Wildschafe. Die ziemlich kurze Behaarung liegt glatt an, ist zumal im Winter, weil dann das kurze, feine und krause Wollhaar in reichlicher Menge auftritt, außerordentlich dicht, verlängert sich an der Brust und bildet gleichsam eine kurze Mähne. Die Rückenlinie ist dunkelbraun, die übrige Färbung ein fuchsiges Roth, welches am Kopfe ins Aschgraue spielt und an der Schnauze, am Kreuze, am Rande des Schwanzes, an den Fußenden und auf der Unterseite ins Weiße übergeht. Einzelne Haare sind fuchsroth, andere schwarz, die Wollhaare aschgrau. Im Winter dunkelt das Fell und geht mehr ins Kastanienbraune über, und es sticht dann zu beiden Seiten ein großer, fast viereckiger, blaßgelblicher oder weißlicher Flecken von der allgemeinen Färbung ab. Das Gehörn des Bockes ist stark und lang, an der Wurzel sehr dick, erst von der Mitte der Länge an allmählich verdünnt und zugespitzt, sein Querschnitt dreieckig, jede Seite in der Mitte mehr oder weniger deutlich eingebuchtet, und die eine gegen die entsprechende des anderen Hornes, die zweite nach außen, die dritte nach innen gerichtet. Beide Hörner stoßen an der Wurzel fast zusammen, wenden sich aber bald seitlich von einander und krümmen sich in einer beinahe sichelförmigen Windung schief nach ein-, aus- und abwärts, mit der Spitze aber nach ab-, vor- und einwärts. Das rechte Horn ist nach links, das linke nach rechts gewunden. Dreißig bis vierzig Runzeln, welche dicht an einander gedrängt und mehr oder weniger unregelmäßig sind, erheben sich auf der Oberfläche von der Wurzel an bis fast zur Spitze. Das merklich kleinere Weibchen unterscheidet sich durch seine mehr ins Fahle spielende Färbung sowie durch das Fehlen oder seltene Vorkommen des Gehörns vom Bocke; seine Hörner sind, wenn überhaupt vorhanden, immer sehr kurz, höchstens 5 bis 6 Centim. lang, stumpfen Pyramiden vergleichbar.
Im Gegensatze zum Mähnenschafe soll sich der Mufflon in Scharen von fünfzig bis hundert Stück rudeln, deren Leitung ein alter und starker Bock übernimmt. Diese Rudel erwählen sich, laut Mimaut, die höchsten Berggipfel zu ihrem Aufenthalte und nehmen hier an schroffen und mehr oder weniger unzugänglichen Felsenwänden ihren Stand. Wie bei anderen gesellig lebenden Wiederkäuern halten stets einige Stück sorgfältig Umschau, stoßen bei Wahrnehmung eines verdächtigen Gegenstandes einen Schreckruf aus und benachrichtigen dadurch die Genossen, welche darauf hin mit jenen sofort flüchtig werden. Zur Brunstzeit trennen sich die Rudel in kleine, aus einem Bocke und mehreren Schafen bestehende Trupps, welche der leitende Widder erst durch tapfere Kämpfe sich erworben hat. So furchtsam und ängstlich der Mufflon sonst ist, so kühn zeigt er sich im Kampfe mit seines Gleichen. In den Monaten December und Januar hört man das Knallen der an einander gestoßenen Gehörne im Gebirge widerhallen, und wenn man vorsichtig dem Schalle folgt, sieht man die starken Widder des Rudels gesenkten Kopfes sich gegenüberstehen und mit solcher Gewalt gegen einander anrennen, daß man nicht begreift, wie die Streiter auf ihren Kampfplätzen sich erhalten können. Nicht selten geschieht es, daß einer der Nebenbuhler über die Felsenwände hinabgestoßen wird und in der Tiefe zerschellt.
Einundzwanzig Wochen nach der Begattung, im April oder Mai, bringt das Schaf ein oder zwei Junge zur Welt, welche der Mutter schon nach wenigen Tagen auf den halsbrechendsten Pfaden mit der größten Sicherheit folgen, und ihr bald in allen Kunstfertigkeiten gleichkommen. Im Alter von vier Monaten sprossen bei den jungen Böckchen die Hörner; nach Jahresfrist denken sie bereits an die Paarung, obwohl sie erst im dritten Jahre völlig ausgewachsen und mannbar sein dürften.
Die Bewegungen des Mufflon sind lebhaft, gewandt, schnell und sicher, aber nicht eben ausdauernd, am wenigsten auf ebenem Boden. Seine Meisterschaft beruht im Klettern. Cetti sagt, daß er sehr furchtsam ist und bei dem geringsten Geräusche vor Angst und Schrecken am ganzen Leibe zittert, auch sobald als möglich flüchtet. Wenn ihn seine Feinde so in die Enge treiben, daß er sich nicht mehr durch seine Kletterkünste retten kann, harnt er vor Angst, oder spritzt, wie andere glauben, den Harn seinen Feinden entgegen. Als solche darf man den Wolf und den Luchs ansehen; Junge fallen wohl auch den Adlern und möglicherweise dem Geieradler zur Beute.
Der Mensch gebraucht jedes Mittel, um das werthvolle Jagdthier zu erlangen. Während der Brunstzeit sollen die Böcke von den im Dickicht verborgenen Jägern durch das nachgeahmte Blöken der Schafe herbeigezogen werden können; die gewöhnliche Jagd ist jedoch die Birsche, obgleich sie nur in seltenen Fällen ein günstiges Ergebnis liefert. Die Sarden sind, wie alle Italiener überhaupt, schlechte Büchsenschützen und die Mufflons, gleich anderen Wildschafen, zählebige Thiere; es gilt daher unter allen Jägern als erwiesen, daß der Mufflon nicht verende, bevor er den letzten Blutstropfen verloren hat, und man verwundert sich nicht über die Seltenheit eines glücklichen Schusses. Das Wildpret der erlegten Stücke liefert ein auserlesenes Gericht, da es würzigen Wildgeschmack mit dem des Hammelfleisches vereinigt. Ende Mai beginnt die Feistzeit des Mufflons, welcher dann fast ebensoviel Fett angesetzt hat wie ein wohlgenährter, halbgemästeter Hammel. Als besonderer Leckerbissen gilt das gereinigte, strickartig zusammengedrehte und gebratene Gedärm, welches Corda genannt wird. Außer dem Wildpret verwendet man Fell und Gehörn; höher als alles zusammen aber werthet man Bezoare, welche man dann und wann in der ersten Abtheilung des Magens findet und als unfehlbar wirkendes, schweißtreibendes Mittel betrachtet.
Alte, erwachsene Mufflons fängt man wohl nie, junge nur, nachdem man ihre Mutter weggeschossen hat. Sie gewöhnen sich, laut Cetti, bald an ihren Pfleger, bewahren aber ungeachtet der großen Zahmheit, welche sie erlangen, immer die Munterkeit und das gewandte Wesen, welches die wilden so auszeichnet. Auf Sardinien und Corsica trifft man in den Dörfern häufig gezähmte Mufflons an; einzelne zeigen sich so anhänglich an den Menschen, daß sie ihm, gleich einem Hunde, auf allen Pfaden folgen, auf den Ruf hören etc. Nur durch ihren Muthwillen werden sie lästig. Sie durchstöbern alle Winkel im Hause, stürzen dabei Geräthe um, zerbrechen die Töpfe und treiben noch anderen Unfug, zumal in denjenigen Räumen des Hauses, über welche sie unumschränkte Herrschaft haben. Alte Böcke werden manchmal wirklich bösartig und lassen sich selbst durch Züchtigung nicht bändigen, verlieren überhaupt alle Scheu vor dem Menschen, sobald sie ihn kennen gelernt, und kämpfen dann nicht bloß zur Abwehr, sondern aus reinem Uebermuthe mit ihm. Alle von mir beobachteten Gefangenen haben mir bewiesen, daß ihr Verstand sehr gering ist. Sie sind schwachgeistig, ohne Urtheilsfähigkeit und sehr vergeßlich. Ich legte ihnen Fallen und lockte sie durch vorgehaltenes Futter, zumal durch besondere Leckereien, in dieselben. Sie gingen ohne Besinnen immer wieder in die Schlingen und Netze, obgleich es ihnen höchst unangenehm zu sein schien, wenn sie sich gefangen hatten. Ein gewisser Ortssinn, schwache Erinnerung an empfangene Wohlthaten, Anhänglichkeit an die gewohnten Genossen und Liebe zu den Jungen: das sind die Anzeichen ihrer geistigen Thätigkeit, welche ich an ihnen beobachtet habe.
Schon die Alten wußten, daß Mufflon und Hausschaf sich fruchtbar vermischen, nicht aber, daß auch die Blendlinge, von ihnen Umber genannt, unter sich oder mit anderen Hausschafen wiederum fruchtbar sind. Beide Thiere scheinen, wie Cetti sich ausdrückt, zu fühlen, »daß sie eines Geblütes sind, und alles Unterschiedes ungeachtet, ihren gemeinschaftlichen Ursprung eines in dem anderen zu finden. Der Mufflon erkennt es gleichsam selbst, daß er ein Schaf, das Schaf, daß es ein Mufflon ist. Ihre Stimme ist ihre Losung. Bisweilen verläßt der Mufflon seinen gebirgigen Aufenthalt und kommt freiwillig zu den Schafen, um mit ihnen zu leben, mit ihnen sich zu paaren; bisweilen auch sucht ein mutterloses Lamm ein Mufflonschaf auf, verfolgt es blökend, um zu saugen und scheint es um gerechtes Erbarmen anzustehen, als ob es nach dem Rechte der Blutsverwandtschaft ihm die Last der Erziehung auferlegen wolle«. Im Dorfe Atzara deckte ein Mufflon ein Schaf, welches einen Umber warf; dieser paarte sich ebenfalls mit einem Hausschafe und erzeugte einen anderweitigen Blendling. Später angestellte Versuche hatten dasselbe Ergebnis. In der kaiserlichen Menagerie zu Schönbrunn wurden, wie Fitzinger berichtet, mehrere Male Mufflons mit deutschen Landschafen gepaart. Die Bastarde aus dieser Kreuzung paarte man zuweilen wieder mit dem Mufflon, zuweilen mit dem Hausschafe, und immer mit Erfolg. Manche Blendlinge hatten große Aehnlichkeit mit dem Wildschafe, nur waren die Hörner weniger gebogen und minder stark. Einige Männchen erhielten vier Hörner wie jene Schafe, von denen Oppian berichtet, und welche wahrscheinlich auch nichts anderes waren als solche Bastarde. Dagegen sollen Versuche, Mufflon und Hausziege zu kreuzen, fruchtlos geblieben sein.
Ebenso leicht als in engerer Gefangenschaft hält sich der Mufflon in größeren Wildgärten. Schon seit den Zeiten Kaiser Karls des Sechsten, seit Anfang des vorigen Jahrhunderts also, leben im kaiserlichen Thiergarten unweit Wiens Mufflons im halbwilden Zustande, ohne andere Pflege zu genießen als die dort eingehegten Hirsche und Wildschweine. Sie haben sich, da man ihnen von Zeit zu Zeit frisches Blut zuführte, nicht allein erhalten, sondern auch alle Gewohnheiten und Sitten der Wildlinge bewahrt, sind ebenso scheu, ebenso flüchtig wie ihre Stammeltern auf Sardinien und Corsica, vermehren sich regelmäßig und gelten mit Recht als ebenso seltenes wie fesselndes Jagdwild. Ihr Bestand, welcher kaum fünfzig Stück übersteigt, ließe sich wahrscheinlich leicht vermehren, wenn man sich entschließen wollte, einmal in größerer Menge frisches Wild zuzuführen. Jedenfalls ist der Beweis erbracht worden, daß der Mufflon bei uns sich einbürgern und auch unter wesentlich veränderten Umständen in gutem Stande erhalten läßt.
Die Gruppe der Archare ( Caprovis) umfaßt die größten, durch gewaltiges Gehörn und hohe Beine ausgezeichneten Wildschafe Mittelasiens und Nordamerikas. In der Neuzeit hat man viele Arten von ihnen beschrieben; die Untersuchungen sind jedoch noch keineswegs als beendet zu betrachten und irrthümliche Auffassungen über den Werth dieser Arten nicht ausgeschlossen.
Die zuerst beschriebene Art dieser Gruppe ist der Argali oder Argalei der Mongolen, Archar der Kirgisen, der Ugulde der Sojoten und Burjäten ( Ovis Argali, Aegoceros und Caprovis Argali, Ovis Ammon), ein gewaltiges Schaf von der Größe eines dreivierteljährigen Kalbes. Ein von Brandt bestimmter Argalibock des Berliner Museums ist kräftig, aber keineswegs unzierlich gebaut, der Kopf stark und breit, im Gesichtstheile nach der Muffel zu gleichmäßig verschmächtigt, das Auge mittelgroß, das Ohr klein, schmal, stumpf geendet, der Hals gedrungen, der Schwanz sehr kurz; die Beine sind hoch und schlank, die Hufe schmal und kurz, die im Haar versteckten Afterhufe klein. Die mächtigen dreiseitigen breiten Hörner kehren die schmale Grundlinie des Dreiecks ihres Querschnittes nach vorn und oben, die Spitze nach unten, stehen an der Wurzel dicht beisammen, biegen sich zuerst nach hinten und außen, sodann nach unten und seitwärts, mit der Spitze aber wieder nach hinten und oben, beschreiben also, von der Seite gesehen, beinahe einen vollen Kreis, wenden sich, von vorn betrachtet, das rechte links, das linke rechts am Raume und sind von der Wurzel an mit deutlich hervortretenden, rings um das ganze Horn laufenden, wellenförmigen oder wie ineinander verflochtenen Wülsten bedeckt, zwischen denen man in Abständen von durchschnittlich 16 Centim. die Jahreswachsthumringe als tiefere Furchen bemerkt. Dichtstehende, wellige und brüchige Grannen, welche sich nur am Vorderhalse und am Widerriste etwas verlängern, nebst feinen, kurzen Wollhaaren bilden das, eine mit kurzen, straffen Haaren bekleidete Stelle in der Achselgegend hinter dem Oberarme ausgenommen, überall sehr gleichmäßige Haarkleid, dessen vorherrschende Färbung, ein mattes Fahlgrau, im Gesicht, auf den Schenkeln, in der oberen Hälfte der Läufe, an den Rändern des Spiegels und am Hinterbauche in ein merklich dunkleres Bräunlichgrau, im Vordertheile der Schnauze, auf dem breiten Spiegel, in der unteren Hälfte der Beine aber in Graulichweiß übergeht. Die einzelnen Haare sind an der Wurzel weißlich, nehmen nach und nach fahlbraune Färbung an und enden meist mit helleren Spitzen. Einschließlich des 11 Centim. langen Schwanzes beträgt die Gesammtlänge 1,93 Meter, die Höhe am Widerriste 1,12 Meter, die Höhe vom Boden bis zum Kopfe 1,46 Meter; die Hörner messen an der vorderen Querseite 7 Centim., an der Breitseite 14 Centim., längs der Krümmung aber von der Wurzel bis zur Spitze 1,22 Meter und stehen mit den Spitzen 93 Centim. auseinander. Das merklich schwächere Schaf ähnelt bis auf die kleineren, namentlich kürzeren Hörner dem Bocke.
Das Verbreitungsgebiet des Argali erstreckt sich von den Bergen des Bezirkes von Akmolinsk an bis zum Südostrande der mongolischen Hochebene und vom Altai an bis zum Alatau, möglicherweise noch weiter südlich. Innerhalb der so umschriebenen Grenzen gehört er jedoch keineswegs allen Gebirgszügen an, ist hier und da wohl auch neuerdings ausgerottet worden: so, laut Radde, in den dreißiger Jahren in Daurien. Im Süden vertritt ihn der Katschkar, im Osten das Dickhornschaf oder ein demselben sehr nahe stehender Verwandter, im äußersten Nordosten das Schneeschaf. Alle übrigen Wildschafe seiner Größe, welche neuerdings von Sewerzoff, Brooke und Peters aufgestellt worden sind, beruhen auf einzelnen Stücken und unterscheiden sich nur durch etwas abweichende Bildung des Gehörns und kaum erheblich veränderte Färbung des Felles; sie halte ich daher günstigsten Falles für Abarten oder Stämme der vier genannten Wildschafe, nicht aber für besondere Arten.
Der Argali meidet feuchte, waldbedeckte Gebirge, und ebenso bedeutendere Höhen. Bergzüge von sechshundert bis tausend Meter über dem Meere, welche reich an nacktem Gefelse, deren Abhänge spärlich bewaldet und deren Thäler breitsohlig sind, bilden seine bevorzugten Wohnplätze. Hier lebt er im Winter wie im Sommer auf annähernd demselben Gebiete, da er höchstens von einem Bergzuge zum anderen wechselt. In Gegenden, wo er keine Verfolgungen zu erleiden hat, dient nicht selten ein einzelner Bergstock einer und derselben Herde viele Jahre nach einander zum Aufenthalte. Bis gegen die Paarungszeit gehen Böcke und Schafe getrennt ihres Weges dahin, erstere in Trupps von drei bis fünf Stücken, letztere meist einzeln; kurz vor der Paarzeit vereinigen sie sich zu kleinen Herden von durchschnittlich zehn, höchstens fünfzehn Stücken.
Ihr Tageslauf ist in bemerkenswerther Weise geregelt. Sie sind Tagthiere. Am frühen Morgen verlassen sie die gesichertsten Stellen ihres Wohngebietes, schwer zu ersteigende und freie Umschau gewährende Felsplatten nahe der Gipfel der Berge, steigen gemächlich an den Gehängen herab und weiden hier, am Fuße der Berge und in den Einsattelungen zwischen ihnen, auch in den breiteren Thälern oder auf den Ebenen um die Berge. Während dem erklimmt bald ein, bald das andere Thier den nächsten Felsen, um zu sichern, verweilt, je nach Bedürfnis oder Laune, mehrere Minuten bis zu einer halben Stunde auf solcher Warte und gesellt sich hierauf wiederum zu den übrigen. Gegen Mittag erklettert die Herde eine steil abfallende Hochfläche, thut sich nieder und pflegt, träumerisch wiederkäuend, längerer oder kürzerer Ruhe. Ist die Gegend unsicher, so übernimmt auch jetzt noch ein oder das andere Stück die Wache; wurde die Herde seit langer Zeit nicht gestört, so ruhen alle ohne Besorgnis. Gegen Abend treten sie nochmals auf Aesung, trinken, nachdem sie vorher etwas Salz geleckt haben, und steigen endlich langsam wieder bergaufwärts, um noch vor dem Verglühen des Abendrothes ihre Schlafplätze zu erreichen.
Während des Sommers äst sich der Argali von allen Pflanzen, welche auch dem Hausschafe behagen, während des Winters begnügt er sich mit Moos, Flechten und vertrocknetem Grase. Dann steigt er auf die Felsspitzen und Grate, wo der Wind den Schnee weggefegt und die Flechten bloßgelegt hat. Wählerischer als in der Aesung zeigt er sich beim Trinken, da er stets zu bestimmten Quellen kommt und diese anderen entschieden bevorzugt. Salzige Stellen werden des allbeliebten Leckerbissens wegen oft besucht. Bei Unwohlsein reinigt er sich mit Küchenschellen und anderen scharfen Anemonen. Solange der Schnee nicht allzudicht liegt, bekümmert der Winter trotz seiner Armut ihn wenig; denn sein dichtes Vlies schützt ihn gegen die Unbilden des Wetters. Es wird gesagt, daß er sich bei dichtem Schneefalle einschneien lasse und unter seiner Schneedecke so stätig verweile, daß es dem Jäger möglich werde, ihn im Liegen mit der Lanze zu erlegen: wahrscheinlich gilt dies höchstens für solche Winter, welche ihn bereits aufs äußerste heruntergebracht haben.
Die Zeit der Brunst wird verschieden angegeben. Nach den Mittheilnngen, welche Przewalski durch die Mongolen wurden, tritt der Argalibock im Südosten der hohen Gobi bereits im August auf die Brunst, nach den Angaben, welche ich von den Kirgisen erhielt, im südwestlichen Sibirien nicht vor Mitte Oktober. Schon vorher nehmen die alten Böcke bestimmte Stände ein und lassen hier jüngere oder schwächere überhaupt nicht zu. Mit gleichstarken kämpfen sie um den Stand und um die Schafe. Ihre Streitigkeiten werden nach Art der Widderkämpfe ausgefochten. Beide Recken gehen stolz auf einander los, erheben sich auf die Hinterfüße und prallen mit den mächtigen Gehörnen unter weit vernehmbarem Getöse zusammen. Zuweilen, jedoch sehr selten, geschieht es, daß einer den anderen in den Abgrund stößt; ebenso kommt es vor, daß beide sich verfangen, die Gehörne nicht mehr lösen können und Raubthieren oder Menschen zur Beute werden oder, verhungernd, elendiglich zu Grunde gehen. Nach beendeter Brunst enden die Kämpfe, und der stärkste Widder führt, unangefochten von anderen, die jetzt vereinigte Herde.
Sieben Monate nach der Paarung bringt das Argalischaf ein oder zwei Lämmer zur Welt, eine jüngere Mutter regelmäßig wahrscheinlich nur eins, eine ältere dagegen deren zwei. Die Lämmer sind merklich größer als die des Hausschafes: ihre Länge beträgt 65, die Schulterhöhe 54 Centimeter. Die vorherrschende, gleichmäßig graufahle Färbung geht auf dem Vorderkopfe und Schnauzenrücken in Dunkelgrau, auf dem Spiegel in Graulichisabell, auf der Unterseite, zumal in der Achsel- und Weichengegend, in Blaßgelb über; ein kurzer Streifen auf dem Kreuze sieht ebenfalls dunkelgrau aus. Die Lämmer folgen den Müttern wenige Stunden nach ihrer Geburt auf allen Wegen, auch den schwierigsten Pfaden, nach und eignen sich bald deren Lauf- und Kletterfertigkeit an. Droht ihnen in den ersten Tagen ihres Lebens eine Gefahr, welcher sie noch nicht zu entrinnen vermögen, so ducken sie sich, wahrscheinlich auf ein Zeichen ihrer Alten, in dem Gefelse zwischen Steinen nieder, legen Hals und Kopf platt auf den Boden, werden gewissermaßen zu einem lebendigen Steine und entziehen sich dadurch dem Auge vieler Feinde, zumal diese durch die vor ihnen weiterflüchtende Alte gefesselt und abgelenkt werden. In dieser Lage verbleiben sie bis das Mutterschaf zurückkehrt, liegen bis dahin sehr fest, wie ein Hase im Lager, und entfliehen, gleich letzterem, erst, wenn ein laufender Feind in unmittelbare Nähe gelangt ist. Wird ihre Mutter unversehens getödtet, so verstecken sie sich ebenfalls und in gleicher Weise. Sie sind allerliebst, anmuthig, behend und gewandt in jeder Bewegung, saugen nach Art aller Zicklein, unter derben Stößen gegen das Euter, umspringen spiellustig die Alte und blöken, wenn sie hungrig werden, fast wie Hauslämmer, jedoch merklich gröber. Bis zur nächsten Brunstzeit bleiben sie in Gesellschaft ihrer Mütter, besaugen diese aber so lange, als die Alte es duldet.
Die Bewegungen des Argali entsprechen seinem kräftigen, gedrungenen und dennoch nicht unzierlichen Baue. Sein gewöhnlicher Lauf, ein rascher Trab, wird auch, wenn ihm ein Berittener folgt, nicht wesentlich beschleunigt, weil er so schnell fördert, daß kein belastetes Pferd nachkommen kann; die schnellste Gangart, welche ich sah, ist ein ungemein leichter Galopp, bei welchem Vorder- und Hintertheil des Thieres abwechselnd hoch aufgeworfen werden. Während der Flucht ziehen gesellte Argalischafe fast unwandelbar in einer Reihe hinter einander, ganz ebenso, wie Stein- und Gemswild zu thun pflegen. Auf dem Gefelse bewegen sie sich mit ebenso viel Kraft und Geschick als Behendigkeit und Sicherheit, erklimmen, anscheinend ohne alle Anstrengung, steil abfallende Felsenwände, überspringen ohne Besinnen weite Klüfte oder setzen ohne Bedenken in bedeutende Tiefen hinab. »Die Erzählungen, daß sich der Bock bei Gefahr in tiefe Abgründe stürzt und dann immer auf die Hörner fällt«, sagt Przewalski, »sind reine Erfindungen. Ich habe durch eigene Anschauung mich selbst davon überzeugt, daß ein Argali aus einer Höhe von sechs bis zehn Meter herabsprang, aber immer auf die Füße fiel, ja, daß er sich sogar bemühete, am Felsen herabzugleiten, um den Fall abzuschwächen«. In den Arkâtbergen südlich von Semipalatinsk, wo ich in Gemeinschaft meiner Reisegefährten auf Argalischafe jagte und eines erlegte, habe ich ähnliches beobachtet, nämlich gesehen, wie ein Mutterschaf mit seinem Lamme über eine fast senkrecht abfallende Bergwand herabkam, ohne eigentlich den Halt unter den Hufen zu verlieren. Selten handeln Argalis ohne Besinnung; ebenso selten beschleunigen sie ihren Lauf zu unüberlegter Eile; ebenso wenig aber mindern sie die ihnen eigene Schnelligkeit in Lagen, welche bei weniger geübten Bergsteigern Bedenken erregen würden, gleichviel, ob sie auf- oder abwärtsklettern. Getrieben, bleiben sie oft stehen, erklettern während der Flucht auch regelmäßig alle im oder am Wege liegende Höhen oder Berggipfel, um von ihnen aus zu sichern, und setzen erst, wenn die Treiber ihnen wiederum näher gekommen, ihren Lauf fort; nur beim Ueberschreiten weiterer Thäler ziehen sie ohne Unterbrechung dahin.
Ihre Sinne scheinen vortrefflich und einheitlich entwickelt zu sein. Sie sehen, hören und wittern ausgezeichnet, sind lecker, wenn sie es sein können, und werden wohl auch hinsichtlich des Gefühls nicht verkürzt sein. In ihrem Wesen spricht sich Bedachtsamkeit und Selbstbewußtsein aus; auch Urtheils- und Erkennungsvermögen darf man ihnen zugestehen. Da, wo wiederholte Verfolgung sie gewitzigt hat, zeigen sie sich stets vorsichtig, wenn auch nicht gerade scheu, unter entgegengesetzten Umständen überraschend vertrauensselig. Die Kirgisen, mit denen wir jagten, mahnten zur Befolgung aller Jagdregeln, welche man vorsichtigem Wilde gegenüber anzuwenden hat; Przewalski dagegen fand den Argali im Sumachadagebirge so wenig scheu, daß der Jäger bis auf fünfhundert Schritte auf eine Herde zuschreiten konnte, ohne ein Mitglied derselben zu beunruhigen. Die Thiere waren hier, wo Chinesen und Mongolen, aus Mangel an Gewehren, ihnen kaum nachstellen, so an den Menschen und sein Treiben gewöhnt, daß sie häufig neben dem Vieh der Mongolen weideten und mit ihm zur Tränke kamen, trotzdem die Jurten meist in der Nähe einer solchen errichtet waren. »Als wir«, so erzählt der treffliche Forscher, »zum ersten Male in der Entfernung eines halben Kilometers von unserem Zelte eine am grünen Abhange des Berges ruhig weidende Herde dieser stolzen Thiere erblickten, wollten wir unseren Augen nicht trauen.« Im Gefühle ihrer Sicherheit dachten die Argalischafe hier nicht einmal daran, Wachen auszustellen, und weideten ohne solche auch in Senkungen, bis zu denen ein geschickter Jäger mühelos sich anschleichen konnte. Derartige Unvorsichtigkeit lassen sie sich in der Kirgisensteppe gewiß nicht zu Schulden kommen. Bemerkenswerth und für das Wesen der Argali- und anderer Wildschafe bezeichnend, ist alberne, unter Umständen höchst gefährliche Neugier. Schon der alte Steller erzählt, daß die Jäger Kamtschatkas das auf den dortigen Gebirgen lebende Dickhornschaf, beziehentlich dessen Verwandten, durch eine aus ihren Kleidern gefertigte Puppe beschäftigen und währenddem aus Umwegen bis in Schußnähe anschleichen; Przewalski erfuhr vom Argali dasselbe und erprobte die Wahrheit der mongolischen Aussage, indem er sein Hemd auf den in den Boden gepflanzten Ladestock hing und hierdurch die Aufmerksamkeit einer auf der Flucht begriffenen Wildschafherde für eine Viertelstunde fesselte.
Ungeachtet solcher Listen erfordert die Jagd auf Argalischafe einen geübten Jäger und noch mehr einen sicheren Schützen. Die Oertlichkeit legt dem Waidmann in der Regel besondere Schwierigkeiten nicht in den Weg. In den Arkâtbergen trieben die uns behilflichen Kirgisen reitend und vermochten den Argalischafen zu Pferde fast überallhin zu folgen. Auch in anderen von diesem Wilde bewohnten Gebirgen ist ein Fußgänger wohl selten um den Weg verlegen. Die Jagdschwierigkeiten beruhen darin, daß der Argali nicht überall getrieben und noch weniger allerorten beschlichen werden kann, unter allen Umständen aber einen unbedingt tödtlichen Schuß erhalten muß. Dem Argalischafe, welches ich erlegte, hatte ich vorher eine Kugel schief von hinten her durch die Brust gejagt; gleichwohl lief es noch über tausend Schritte, kletterte, als wäre ihm nichts geschehen, an einem steil abfallenden Berge empor und würde verloren gegangen sein, hätte ich ihm nicht den Weg abgeschnitten und eine zweite Kugel durch die Brust geschossen. Przewalski erfuhr dasselbe und bemerkt, daß es sehr schwer sei, ein Argalischaf im Feuer zu fällen, weil es den schwersten Verwundungen erst spät erliege, mit zerrissenen Lungen noch mehrere hundert Schritte weit laufe und dann erst niederstürze. Nach seinen Erfahrungen sind die Morgen- und Abendstunden zur Jagd besonders geeignet. »Ein Schuß«, sagt er, »erfüllt die ganze Herde mit Furcht: sie stürzt dann im vollen Laufe nach der entgegengesetzten Seite, bleibt aber auch jetzt bald wieder stehen, um sich über die Gefahr zu vergewissern und verweilt manchmal so lange auf einer und derselben Stelle, daß es dem Jäger möglich ist, sein Gewehr, selbst einen Vorderlader, wiederum zum Schusse fertig zu machen. Stürzt ein angeschossenes Stück der Herde verendend zu Boden, so halten alle übrigen im Laufe an, betrachten ihren gefallenen Genossen und bieten sich währenddem, anscheinend verwirrt, dem Jäger zu fernerem Schusse.« Das Wildpret wird von den Kirgisen sehr geschätzt, ist auch in der That vortrefflich, obschon etwas streng von Geschmack.
Außer dem Menschen stellen dem erwachsenen Argali Tiger, Wolf und Alpenwolf nach, jedoch in seltenen Fällen mit Erfolg. Eher gelingt es diesen Raubthieren, ein Argalilamm zu erbeuten; der schlimmste Feind des letzteren aber ist der Steinadler. Sein scharfes Auge läßt sich nicht täuschen, wenn ein Argalilamm, wie beschrieben, in Stein sich verwandelt, und das junge, hilflose Säugethier ist rettungslos verloren, wenn seine Mutter nicht rechtzeitig wiederkehrt. Während unserer Jagden in den Arkâtbergen brachten uns die Kirgisen ein von dem gewaltigen Raubvogel zerrissenes Lamm. Wir hatten dessen Mutter vor den Treibern flüchten und bald darauf zurückkehren sehen; die kurze Frist ihrer Abwesenheit war aber doch hinreichend gewesen, in Gestalt des Adlers sein Verderben herbeizuführen.
Unsere Jagdgenossen fingen zwei muntere Argalilämmer ein und brachten sie lebend zu den Jurten. Ohne Umstände nahmen sie das Euter einer zu Ammendiensten gezwungenen Ziege und würden unzweifelhaft gediehen sein, hätten sich die Kirgisen entschließen können, ihnen, wie von unserem Jagdgeber, General von Poltoratski, befohlen, ebenso viele Aufmerksamkeit wie ihren Hausthieren zu widmen. Solche Lämmer in größerer Anzahl zu erlangen und großzuziehen, dürfte nicht allzuschwierig sein. Gelänge es, sie zu zähmen: man würde an ihnen ein Hausthier gewinnen, welches große Bedeutung erlangen könnte. Dieses, dem strengen Winter wie dem glühenden Sommer der Steppe trotzende Thier würde zur Einbürgerung in anderen Gegenden sich eignen wie kaum ein zweites.
Der berühmteste Reisende des Mittelalters, Marco Polo, welcher Ende des dreizehnten Jahrhunderts das Innere Asiens durchwanderte, erzählt, daß er auf der östlich von Bokara, etwa fünftausend Meter über dem Meere gelegenen Hochebene von Pamir viele wild lebende Thiere, insbesondere aber riesige Schafe gesehen habe. Die Hörner derselben hätten eine Länge von drei, vier oder selbst sechs Handbreiten und würden von den Hirten als Gefäße zur Aufbewahrung ihrer Nahrungsmittel benutzt. Viele von besagten Wildschafen fielen den Wölfen zur Beute, und man finde daher große Mengen von Gehörnen und Knochen, aus denen die Hirten Haufen aufzuthürmen pflegten, um den Reisenden die Richtung des Weges anzugeben, wenn Schnee die Ebene decke. Im ersten Drittel unseres Jahrhunderts erwähnt Burnes in seiner Reise nach Bokara desselben Thieres, welches, nach den ihm gewordenen Mittheilungen, bei den Kirgisen den Namen Rasse, bei den Bewohnern der tieferen Gelände den Namen Kuschgar führt, größer als eine Kuh, aber kleiner als ein Pferd, von weißer Färbung ist, unter dem Kinne lang herabhängende Haare zeigt, in den kältesten Höhen lebt, seines hochgeschätzten Fleisches halber von den Kirgisen gern gejagt, mit Pfeilen erlegt wird und nach glücklicher Jagd zwei Pferde erfordert, um die gewaltige Last seines Leibes fortzuschaffen. Leutnant Wood, Begleiter von Burnes und Verfasser einer Reisebeschreibung nach den Oxusquellen, unterscheidet zwischen Rasse und Kuschgar und berichtet über den letzteren ungefähr das nachstehende: »Wir sahen, nachdem wir in einer Höhe von dreizehntausendfünfhundert Fuß und in der Nähe der Oxusquellen angekommen waren, in allen Richtungen zerstreute Schafhörner liegen, die Ueberreste der Ausbeute kirgisischer Jäger. Einzelne dieser Hörner waren von einer überraschenden Größe und gehörten einem Thiere an, welches zwischen Ziege und Schaf mitteninnen zu stehen scheint und die Steppen des Pamir in Herden von vielen Hunderten bewohnt. Die Enden der gewaltigen Hörner ragten über den Schnee hervor und zeigten uns die Richtung des Weges an. Da, wo wir größere Mengen von ihnen im Halbkreise aufgethürmt fanden, erkannten unsere Führer die Lager einer kirgisischen Sommeransiedelung«. Derselbe Reisende fügt später hinzu, daß er eines der Schafe im Fleische gesehen habe. »Es war ein stolzes Thier, so hoch wie ein zweijähriges Füllen, mit ehrwürdigem Barte und zwei prachtvollen Hörnern, welche mit dem Kopfe so schwer wogen, daß es eine große Anstrengung erforderte, sie vom Boden aufzuheben. Der ausgeweidete Leib gab eine volle Ladung für einen Pony. Das Wildpret war zähe und schlecht, soll aber im Herbste viel besser sein und dann einen feinen Wildgeschmack haben.« Nach Vergleichung eines Paares von Wood mitgebrachter Hörner des Thieres erkannte Blyth, daß besagtes Schaf weder mit dem Argali noch mit seinen amerikanischen Verwandten übereinstimme, und beschrieb es unter dem Namen des Pamirschafes, es zu Ehren seines ersten Beschreibers Marco Polo benennend. Bis in die neueste Zeit erfuhren wir nichts näheres über das ausgezeichnete Thier, und es blieb erst Sewerzoff und Przewalski vorbehalten, uns nicht allein mit Gestalt und Färbung, sondern auch mit der Lebensweise dieses größten aller bisher beschriebenen Wildschafe bekannt zu machen. Sewerzoff, welcher im Thianschan nicht weniger als vier von ihm als verschieden angesehene Wildschafarten gefunden und beschrieben hat, traf zuerst im Hochlande des oberen Naryn auf die Spuren des bis dahin nur nach dem Gehörn bekannten Wiederkäuers und sammelte nicht bloß eine größere Anzahl von Schädeln mit den Gehörnen, sondern war auch so glücklich, mehrere Katschgare, wie er sie nennt, zu erbeuten. Fast gleichzeitig mit ihm, im Jahre 1874, beschrieb auch Stolicza, und drei Jahre später Przewalski dasselbe Schaf, und somit sind wir gegenwärtig in erwünschter Weise unterrichtet.

Katschkar( Ovis Polii). 1/17 natürl. Größe.
Der Katschkar ( Ovis Polii, Caprovis Polii) erreicht thatsächlich fast die Größe, welche von Burnes angegeben wurde; denn die Gesammtlänge des erwachsenen Bockes beträgt nach Stolicza 1,96, nach Sewerzoff ohne Schwanz sogar 2,04 Meter, die Kopflänge 35, die Schwanzlänge 11 Centim., die Schulterhöhe 1,2 Meter, das Gewicht 14 Pud oder rund 230 Kilogr. Der stämmige Leib ruht auf starken, aber hageren und deshalb wohlgestalteten Beinen; der Kopf, welcher von dem Thiere beständig erhoben getragen werden soll, ist trotz der leicht gebogenen Nase und der geneigten Muffel ausdrucksvoll, das Auge mäßig groß, aber lebhaft, sein Stern braun, das Ohr verhältnismäßig klein, schmal und scharf zugespitzt; mäßig große und tiefe Thränengruben sind vorhanden. Die fast dreiseitigen, auf der ganzen Oberfläche mehr oder weniger deutlich gewulsteten Hörner des alten Bockes berühren einander an der Wurzel, wenden sich sodann allgemach in einem weiten Bogen nach rück- und auswärts, beschreiben einen vollen Kreis, kehren sich mit ihren zusammengedrückten Spitzen wieder rück- und auswärts und erreichen, der Krümmung nach gemessen, eine Länge von 1,5 Meter und darüber bei einem Wurzelumfange von 50 Centim. Das Fell verlängert sich auf dem Hinterkopfe und im Nacken, bildet auch rings um den Hals eine Mähne aus groben, wolligen, 13 bis 14 Centim. langen Haaren, wird auf dem Rücken etwa halb so lang und besteht aus starken, harten, sehr dichtstehenden Grannen, zwischen deren Wurzeln eine spärliche, aber außerordentlich feine Wolle hervorsproßt. Die allgemeine Färbung des alten Bockes im Winterkleide ist nach Stolicza ein schimmeliges oder wie bereift erscheinendes Braun, welches auf dem Oberhalse und über den Schultern in Röthlich- oder Hellbraun übergeht, in der Lendengegend aber dunkelt; über den Rücken bis zum Schwanze herab verläuft eine dunkle Mittellinie; der Kopf ist oben und an den Seiten graulichbraun, am dunkelsten am Hinterkopfe, die Mitte des Unterhalses schimmeligweiß, etwas mit hellbraun getrübt; die Seiten des Körpers und der obere Theil der Beine sind braun und weiß gemischt, weil die Haare hier weiße Spitzen zeigen, das Gesicht und die Untertheile, einschließlich der Füße und des Schwanzes, sowie ein breiter Spiegel, welcher sich bis zur Mitte der Oberschenkel erstreckt, rein weiß. Sewerzoff nimmt an, daß das von ihm nie erlegte Weibchen wie bei allen ihm bekannten Wildschafen bedeutend kleiner und fast um die Hälfte leichter sei als das Männchen; Stolicza hingegen bemerkt ausdrücklich, daß beide Geschlechter in der Größe wenig von einander abweichen: nur der Kopf des Mutterschafes sei weniger groß und die Hörner verhältnismäßig klein, der Krümmung nach gemessen höchstens 40 Centimeter lang, seitlich sehr zusammengedrückt, ohne breite Vorderkante und in einfachem Bogen nach hinten und außen gerichtet. Die Färbung weicht nicht erheblich von der des Männchens ab; doch erstreckt sich das lichte Weißgrau des Unterhalses in der Regel nicht so weit als bei jenem; die Schnauze ist bei einzelnen Stücken braun, bei einzelnen ganz weiß, ein Fleck vor dem Auge aber immer dunkel und im letzteren Falle sehr deutlich. Ein von Sewerzoff erlegter junger Bock war auf dem Rücken dunkelbraun, ohne irgend welche röthliche Beimischung, an den Seiten lichter graubraun, nach dem weißen Bauche zu noch heller, der weiße Spiegel von einem scharf abstechenden, schwärzlichen Streifen umzogen.
Das Verbreitungsgebiet des Katschkar läßt sich zur Zeit noch nicht mit Sicherheit feststellen; doch scheint das Thier keineswegs auf das Thianschangebiet und Nordtibet beschränkt zu sein, sondern auch auf anderen Hochflächen Innerasiens vorzukommen. Nach allen bis jetzt vorliegenden Beobachtungen lebt es ausschließlich auf den höchsten Ebenen, laut Sewerzoff jedoch nur in der Nähe von felsigen Stellen, welche ihm eine Zufluchtsstätte gewähren. Auf der Hochebene von Aksai bilden solche vorzüglich das Bos-Adyrgebirge und die Felsen auf dem linken Atpascha-Ufer. Zu steile und wilde Gelände werden nicht von ihm bevölkert, sondern den sibirischen Steinböcken oder Teken überlassen. Von anderen verwandten Arkaren scheint sich der Katschkar dadurch zu unterscheiden, daß er ausschließlich Berghöhen über der Holzgrenze bewohnt, nicht aber wie jene auch in tiefere Gelände hinabsteigt. Sewerzoff bezeichnet ihn als das eigentliche Hochland- oder Pamirschaf und betont ausdrücklich, daß eine über der Holzgrenze gelegene Hochebene unumgängliche Bedingung für sein Vorkommen sei. Höchst wahrscheinlich fesseln ihn an seinen Stand die in jenen Hochebenen wachsenden würzigen und nahrhaften Alpenkräuter, Schwingel, Wermut, Salzkraut und andere, welche den Schafen insgemein am besten zusagen.
Abgesehen von der Wahl seiner Aufenthaltsorte, welche ihn mit dem wilden Jak, mehreren Gebirgsantilopen und unter Umständen mit dem Kulan oder Kiang zusammenführen, lebt der Katschkar im wesentlichen nach Art des Argali. Przewalski, dem wir die eingehendsten Nachrichten über seine Lebensweise verdanken, traf im Winter Herden von fünf bis fünfzehn, ausnahmsweise aber auch solche von fünfundzwanzig bis dreißig Stück an. In jeder Herde befinden sich ein, zwei oder drei Böcke, von denen einer die Führung und Leitung der Schafe übernimmt. Letztere vertrauen der Wachsamkeit des Führers unbedingt; sobald er zu laufen beginnt, stürzt die Herde ihm blindlings nach. Der Bock geht gewöhnlich voran, hält aber von Zeit zu Zeit an, um zu sichern, und ebenso thut die ganze Herde, drängt sich jedoch dabei eng zusammen und schaut scharf nach der Gegend, aus welcher Gefahr droht. Zu besserer Sicherung ersteigt der Bock von Zeit zu Zeit einen nahen Felsen oder Hügel. Hier nimmt er sich prachtvoll aus, weil auf der Felsenspitze seine ganze Gestalt frei sich zeigt und seine Brust im Strahle der Sonne glänzt wie frischgefallener Schnee. Przewalski versichert, auf die sich selbst vorgelegte Frage: welches Thier schöner sei, der wilde Jak oder der Katschkar, immer nur die Antwort gefunden zu haben, daß jedes schön in seiner Art, der Katschkar also, seines schlanken Leibes, der langen gewundenen Hörner, der hellweißen Brust und des stolzen Ganges halber, ebensogut wie der Jak uneingeschränkt verdiene, ein ausgezeichnet schönes Thier der tibetanischen Hochwüsten genannt zu werden.
In den Morgenstunden äsen sich die Katschkare auf den Berggehängen oder in den Thälern; kaum aber hat die Sonne höher sich erhoben, so lagern sie, um wiederzukäuen. Hierzu wählen sie sanft geneigte, gegen den Wind geschützte Bergeshänge, welche nach allen Richtungen freie Umschau gewähren. Nachdem sie den Boden aufgescharrt haben, legen sie sich in den Staub und verweilen mehrere Stunden auf derselben Stelle. Ruht die ganze Herde, so lagern die Böcke meist ein wenig abseits, um im Ausspähen nicht behindert zu werden; besteht die Herde ausschließlich aus Böcken, ihrer drei, höchstens vier, so lagern sie nebeneinander, wenden die Köpfe jedoch nach verschiedenen Richtungen. Niemals vergessen sie, solche Vorsichtsmaßregeln zu treffen.
Von den Mongolen erfuhr Przewalski, daß die Lammzeit in den Juni, die Bockzeit dagegen in den Spätherbst fällt. Dies stimmt mit den Erfahrungen Sewerzoffs überein, wogegen Stolicza, wahrscheinlich fälschlich, den Januar als Brunstzeit bezeichnet. Ende November war im Norden Tibets diese Zeit bereits vorüber, und die Böcke lebten miteinander in Frieden und Freundschaft. Während der Brunstzeit dagegen kämpfen sie auf Leben und Tod miteinander, und diesen Kämpfen, nicht aber den Wölfen, schreibt Sewerzoff die auffallende, an einzelnen Stellen gehäufte Menge von Schädeln zu, welche man findet. Wären es Wölfe, welche die Katschkare niederrissen, so würde man auch öfter Schädel von Weibchen und jungen Böcken finden, wogegen solche kaum vorkommen. Weibchen und Junge würden leichter eine Beute der Wölfe werden als die alten Böcke; aber man findet fast nur Schädel von letzteren, und zwar von solchen, welche ein Alter von vier Jahren haben, also mannbar und kampflustig sind. Ebenso findet man mehr Schädel von Böcken mittleren Alters als von ganz alten Recken, obwohl auch die letzteren nicht selten vorkommen. Aehnliche Hörner, wie die des größten erlegten Bockes, hat Sewerzoff unter den umherliegenden Schädeln nicht aufgefunden. Unter der großen Anzahl der letzteren, welche unser Forscher zu Gesicht bekam, befand sich nur ein einziger frischer mit noch blutigen Knochen und zernagter Schnauze; alle übrigen waren gebleicht, an den mindest alten noch Reste von Haut und Haaren vorhanden, und aus dem Grade der Erhaltung vermochte Sewerzoff zu schließen, daß sie solchen Katschkaren angehört haben mußten, welche zeitweilig nur in geringer Anzahl und zwar nicht in allen Monaten, sondern nur während einer bestimmten Jahreszeit, im Herbste nämlich, umgekommen sein konnten. Diese Zeit aber stimmt mit dem Eintritte der Brunst genau überein. Die Schädel liegen nicht in Gebirgsthälern und auf Hochebenen zerstreut, sondern ausschließlich am Fuße der steilen Felswände, und unter ihnen trifft man geeigneten Orts auch solche von den sibirischen Steinböcken an; es befinden sich ferner über den steil abstürzenden Felswänden, an deren Fuße die Schädel bleichen, regelmäßig flache und mit Gras bewachsene Stellen, eben die bevorzugtesten Weideplätze unserer Thiere: also läßt sich annehmen, daß besagte Weiden auch zu den Kampfplätzen der erlegten Böcke dienen, und man darf glauben, daß einer der Kämpen den schwächeren Gegner nicht allzuselten in den Abgrund stößt. Zuweilen, obschon nicht gerade oft, wird es geschehen, daß der Sieger durch zu starken Anprall ebenfalls mit herabstürzt; denn man findet manchmal zwei Schädel neben einander oder höchstens zehn Schritte von einander entfernt, wogegen die meisten einzeln liegen. Ganz unmöglich wäre freilich nicht, daß die Wölfe gerade die Kämpfe der Katschkarenböcke benutzen, um sich an die in der Hitze des Kampfes sorgloser gewordenen Recken anzuschleichen, und daß diese durch ihre Feinde in den Abgrund gedrängt würden, wogegen die vorsichtigeren Mutterschafe sich inzwischen retten könnten. Doch widerspricht dem der Befund der Schädel; denn es läßt sich nicht einsehen, warum bei solchen Gelegenheiten nicht ebenso gut wie Böcke auch Mutterschafe durch die Wölfe zum Abspringen bewogen werden sollten, umsomehr, als es eine bekannte Eigenthümlichkeit aller Schafe ist, von sinnberaubendem Schrecken ergriffen zu werden und dann blindlings dem leitenden Thiere nachzufolgen. Am Fuße der Felsenwände liegen aber fast nur Schädel von alten Böcken; folglich können etwaige Unthaten der Wölfe kaum in Betracht kommen, gegenüber der Anzahl der muthmaßlichen Opfer ihrer gegenseitigen Kämpfe. Daß die erwähnten Räuber die Leichname der von ihnen unten an den Felsen gefundenen Katschkare ausfressen und ihr Mahl mit Bart- und Gänsegeiern theilen, braucht nicht besonders erwähnt zu werden. Sewerzoff sieht besagte Kämpfe als für die Erhaltung der Arten aller Gebirgsschafe nothwendig oder doch sehr nützlich an; sie bilden seiner Meinung nach ein einfaches, aber wirksames Mittel der natürlichen Zuchtwahl zu Gunsten der stärksten und gewandtesten Zuchtböcke, welche dann ihre kräftigen, sprungfederartigen Beine und gewaltigen Hörner, überhaupt ihre hervorragenden Eigenschaften, den Nachkommen vererben und sie dadurch nach und nach veredeln. Wie bei der Mehrzahl der Wiederkäuer insgemein genügt ein Bock für viele Schafe; folglich gibt es immer überflüssige Männchen, und gerade deshalb kämpfen diese mit einander um die Weibchen, welche sodann der Sieger, d. h. der stärkere, befruchtet. Ihre ungeheuren Hörner sind den Katschkaren wie den Steinböcken zu diesen Kämpfen nothwendig, sollen aber auch zum Laufen auf dem Gebirge, namentlich beim Herabspringen, als nützlich sich erweisen. Wie von unserem Steinbocke fabelt man, daß die Katschkare, wenn sie von oben auf einen tiefer gelegenen Felsenvorsprung setzen, mit den Hörnern sich auffallen lassen und erst nachher ihre Vorderläufe aufstemmen, um diese nicht beim Sprunge zu brechen. Glaublicher als diese ihm von verschiedenen Seiten gewordene Mittheilung erscheint es Sewerzoff daß die gewichtige Masse der Hörner geeignet sein möchte, dem schwerleibigen Bocke bei seinen Sprüngen zu einer von ihm angestrebten Veränderung des Schwerpunktes behülflich zu sein, was für ihn nothwendiger wäre als für das leichtere Weibchen.
Die Jagd auf Katschkare überhaupt wird von den eingeborenen Jägern im Thianschan in eigenthümlicher Weise betrieben. Einem einzelnen Jäger, möge derselbe auch noch so gewandt sein, gelingt es selten, eines der Wildschafe zu erlegen, weil diese nur in Ausnahmefällen auf den ersten Schuß zusammenbrechen. Aus diesem Grunde ziehen es Kirgisen wie Kosaken vor, selbander zu jagen. Ausgerüstet mit sehr langen und schweren Büchsen, welche beim Feuern auf Gabeln gelegt werden müssen, reiten sie gemeinschaftlich aus, erspähen ihr Wild, schleichen sich möglichst gedeckt und unter dem Winde an dasselbe heran und geben ihren Schuß ab. Stürzt das Thier unter dem ersten Feuer, so hat die Jagd ihr Ende erreicht; läuft es wie gewöhnlich weiter, so reitet einer der Jäger ihm so eilig als möglich voraus, wogegen der andere ihm zu Pferde auf allen Winkelzügen folgt, aber auch dabei möglichst versteckt sich hält, in der Hoffnung, unter Umständen seinerseits zum Schusse zu kommen. Hierin beruht die Hauptschwierigkeit und Hauptkunst der Jagd auf Katschkare; es gehört dazu ein sehr scharfes Auge und eine große Gewandtheit, in einer fremden Gegend jägermäßig sich zurecht zu finden, beziehentlich so zu reiten, daß man dem verfolgten und seinem Verstecke zueilenden Thiere durchaus wieder begegnen muß. Die erstaunliche Lebenszähigkeit der Katschkare erhöht die Schwierigkeiten der Jagd in besonderem Grade. Der von Sewerzoff erbeutete alte Katschkarbock war durch die erste Kugel am Geschröte und an einem Hinterfuße verletzt worden, infolge dessen das Laufen ihm schwer und schmerzlich sein und er daher oft anhalten mußte; dies gewährte den beiden ihn verfolgenden Kosaken die Möglichkeit, wiederholt auf ihn zu schießen. Eine zweite Kugel, welche die Eingeweide zerriß, fällte ihn nicht; zwei andere Kugeln auf die Hörner warfen ihn zwar jedesmal wie todt zu Boden: er stand jedoch immer wieder auf und lief weiter; auch eine fünfte Kugel, welche die Lungen durchbohrt hatte, führte den Tod noch nicht herbei, und erst die sechste, welche ihn in das Herz traf, machte seinem Leben ein Ende. Nach der Berechnung der Kosaken waren sie ihrer Beute über zehn Werst weit nachgeritten, und von diesen hatte das Thier die letzten drei noch zurückgelegt, nachdem ihm bereits zwei tödtliche Wunden beigebracht worden waren. Besonders bemerkenswerth erscheint die Festigkeit und Federkraft des Horngewebes. Eine Kugel hatte sich auf dem Horne platt gedrückt und einen breiten Bleifleck zurückgelassen, war aber trotz der Gewalt des Anprallens abgesprungen, die zweite war ein wenig eingedrungen, aber ebenfalls platt gedrückt worden und bald wieder herausgefallen; gleichwohl blieb von dem Eindrücke derselben in das Horn keine Spur zurück, da das durch die Kugel zusammengedrückte Gewebe desselben alsbald wieder sich ausgedehnt hatte. Dieser Unempfindlichkeit gegen Wunden entspricht die riesige Körperkraft des Thieres. Das Horn, welches eine Flintenkugel zurückwirft, bricht, wenn die Böcke bei ihren Kämpfen um die Weibchen sich stoßen, nicht selten ab, ohne jedoch dem Katschkar etwas zu schaden, da dieser Schläge auf die Vorderseite der Hörner ebenso gut aushält wie andere Schafe, und nur solche Erschütterungen, welche die Hörner von der Seite treffen, bis in das Gehirn sich fortsetzen.
Das Wildpret des von Sewerzoff erbeuteten jungen Katschkarbockes hielt ungefähr die Mitte zwischen feistem Hammelfleische und Hirschwildpret und war äußerst schmackhaft, das des alten Bockes keineswegs gut und mit einem unangenehmen Moschusgeruch behaftet.
Außer dem Menschen gefährden dieselben Raubthiere den Katschkar, welche auch dem Argali nachstellen. Nach Versicherung der Mongolen soll sehr alten Böcken ein schlimmer Feind in ihren eigenen Hörnern erwachsen: die Spitzen der letzteren sollen im Laufe der Zeit so lang werden, daß sie vor das Maul treten, das Thier am Fressen verhindern und so zum Hungertode verdammen. Ob etwas wahres an dieser Angabe sei, vermochte Przewalski nicht zu ergründen.
Mit dem Dickhornschafe ( Ovis montana , californiana, cervina und pygargus, Capra montana, Aegoceros montanus) wird ein in Kamtschatka lebendes Wildschaf für gleichartig erachtet, obgleich es sich durch sein im wesentlichen zwar gleichartiges, jedoch merklich schwächeres Gehörn unterscheidet.
Richardson und nach ihm Audubon geben an, daß das Dickhornschaf vom 68. Grade nördlicher Breite an bis ungefähr zum 40. hinab das Felsgebirge bewohnt und östlich von ihm nicht gefunden wird. Dagegen belebt es westlich dieses Gebirges alle Landstrecken, welche man kennen lernte, namentlich auch Kalifornien, immer und überall aber die wildesten und unzugänglichsten Gebirgsstrecken gedachter Gegenden, insbesondere einen Theil des Felsgebirges, welcher von den französischen und kanadischen Jägern Mauvaises Terres genannt worden ist. Audubon gibt eine sehr ausführliche Beschreibung dieses öden Landstriches, dessen Bergzacken er mit Zuckerhüten vergleicht, welche theilweise stehen, theilweise aber umgefallen oder in Brocken zerschlagen sind und eine Wildnis bilden, wie sie nur ein Gebirge aufweisen kann. Schroff steigen die kegelförmigen Berge Hunderte von Meter über die Ebene, auf welcher sie fußen, empor und sind dem Menschen nur hier und da zugänglich. Das Wasser hat in ihnen entsetzlich gewüthet, und jeder Regenguß macht eine Besteigung unmöglich. An einzelnen Stellen findet sich dürftiger Baumschlag, unter dessen Schutze dann saftiges Gras emporwächst, an anderen gewahrt man tiefe Höhlen und hier und da Sulzen, in denen vom Regen ausgelaugtes Salz abgelagert wird. Die Dickhornschafe finden gerade in einem so beschaffenen Gebirge alles, was sie für ihr Leben beanspruchen. Sie bilden sich Wege auf den schmalen Gesimsen, welche an den Kegelbergen sich hinziehen und sind so im Stande, auch die steilsten Wände auszunutzen; die Höhlen und Grotten gewähren ihnen erwünschte Lagerplätze, das saftige Gras eine ihnen zusagende Weide und die salzhaltigen Stellen endlich Befriedigung eines Bedürfnisses, welches, wie wir sahen, allen Wiederkäuern überhaupt gemeinsam ist. Daß sie, seitdem sie den Menschen kennen gelernt, die wildesten Theile dieser Wildnis bevorzugen, ist selbstverständlich; demungeachtet kann man sie noch häufig genug wenigstens sehen, wenn man mit dem Dampfboote die Zuflüsse des »Vaters der Ströme« befährt. So sah Prinz Max von Wied die ersten dieser Thiere auf der Spitze eines hohen Uferfelsens stehen, von wo aus sie ruhig das im Strome dahinbrausende Dampfschiff betrachteten, auf welchem dieser ausgezeichnete Naturforscher sich befand.

Dickhornschaf ( Ovis montana). 1/16 natürl. Größe.
Die Kunde, welche wir über das Dickhornschaf besitzen, ist dürftig genug, zumal was die Lebensweise anlangt. In letzter Hinsicht ist der erste Bericht Richardsons immer noch maßgebend; weder der Prinz noch Audubon wissen ihm wesentliches hinzuzufügen. Die Leibesbeschreibung dagegen läßt nichts zu wünschen übrig. Erwachsene Böcke haben eine Länge von 1,9 Meter, wovon nur 12 Centim. auf den Schwanz kommen, bei 1,05 Meter Schulterhöhe; das Schaf ist 1,4 bis 1,5 Meter lang und 90 bis 95 Centim. hoch. Jene erreichen ein Gewicht von 175 Kilogramm, da das Gehörn allein bis 25 Kilogramm wiegen kann; dieses wird 130 bis 140 Kilogramm schwer. Die Gestalt ist gedrungen, muskelkräftig, der Kopf dem des Steinbocks ähnlich, groß, auf dem Nasenrücken völlig gerade, das Auge ziemlich groß, das Ohr klein und kurz, der Hals dick, der Rücken wie die Brust breit und stark, der Schwanz schmal, der Schenkel sehr kräftig, der Lauf stark und gedrungen, der Huf kurz, vorn fast senkrecht abgeschnitten, der Afterhuf breit und stumpf. Die Länge des gewaltigen Gehörnes, längs der Krümmung auf der äußeren Seite gemessen, beträgt 68 Centim., die Länge, längs der Krümmung der unteren Kante gemessen, 46 Centim., der Umfang an der Wurzel 35 Centim., der Umfang in seiner Mitte 31 Centim., die Entfernung der Spitzen beider Hörner von einander 56 Centim. Die platt gedrückten, oder richtiger, außen geradseitigen, hinten von der stark vorspringenden Ober- und Außenkante an in einem fast regelmäßigen Bogen gewölbten, daher einen von denen der Argali durchaus verschiedenen Querschnitt zeigenden, mit vielen Querrunzeln bedeckten Hörner stehen an ihrem Grunde dicht beisammen, wenden sich hierauf etwas nach vorn und außen, drehen sich sodann nach hinten, biegen sich in einem fast kreisförmigen Bogen nach unten und vorn und kehren sich mit der verwendeten, sanft abgerundeten Spitze wieder nach außen und oben. Eine Vergleichung dieses Gehörns mit dem des Argali ergibt folgendes. Bei dem Dickhornschafe erscheinen die Hörner nie seitlich zusammengedrückt und flach, sondern bleiben im Querdurchschnitt breit und tragen zu förmlichen Leisten verschmälerte Kanten, während die Hörner des Argali seitlich stark zusammengedrückt sind und ein plattenartiges Ansehen gewinnen. Die Ausbuchtungen oder sogenannten Jahresringe stehen bei dem Dickhornschafe sehr einzeln und lassen nur undeutliche, oft unterbrochene schwache und schmale Querfurchen erkennen, wogegen die Wülste bei dem Argali sich sehr nahe stehen und viel weiter über das Horn, bis zu etwa vier Fünftel der Gesammtlänge desselben, sich erstrecken. Das Gehörn des Argali ist außerdem gewöhnlich noch stärker als der Hauptschmuck seines Verwandten. Die bedeutend schwächeren, denen der Ziegen ähnlichen, scharf zugespitzten Hörner des weiblichen Dickhornschafes biegen sich in einem einfachen Bogen nach oben, hinten und außen. Das Haar hat keine Aehnlichkeit mit Wolle, ist hart, obwohl sanft anzufühlen, leicht gewellt und höchstens fünf Centimeter lang, seine vorherrschende Färbung ein schmutziges, längs des Rückens dunkelndes Graubraun; der Bauch, die innere und hintere Seite der Beine, die Hinterschenkel und ein Streifen über dem Schwanze nach dem Rücken zu, welcher mit dem Spiegel mancher Hirscharten verglichen werden kann, das Kinn und ein Fleck auf graubraunem Grunde in der Gegend des Kehlkopfes sind weiß; der Kopf ist hellaschgrau, das Ohr außen dem Kopfe gleich, innen dagegen weißlich, die Vorderseite der Läufe dunkler als der Rücken, schwärzlich graubraun nämlich, der Schwanzrücken lichter als der Rückenstreifen. Alte Böcke sehen oft sehr hellgrau, manchmal fast weißlich aus. Im Herbste und Winter mischt sich viel Braun in das Grau ein; der Hinterrücken und die Einfassung der Schenkel aber bleiben immer rein weiß.
Die erste Nachricht über das Dickhornschaf gaben zwei Heidenprediger aus Kalifornien um das Jahr 1697. »Wir fanden«, sagt Pater Picollo, »in diesem Lande zwei Arten von Thieren, welche wir noch nicht kannten und haben sie Schafe genannt, weil sie einigermaßen diesen ähneln. Die eine Art ist so groß wie ein ein- oder zweijähriges Kalb, sein Haupt aber dem eines Hirsches ähnlich und sein sehr langes Gehörn wiederum dem eines Widders. Der Schwanz ist wie das Haar gesprenkelt, aber kürzer als beim Hirsche, die Hufe dagegen sind groß, rund und gespalten wie beim Ochsen. Ich habe von diesem Vieh gegessen; sein Fleisch ist sehr zart und schmackhaft. Die zweite Art von Schafen, von denen einige weiß und andere schwarz sind, unterscheiden sich wenig von den unserigen; sie sind etwas größer, haben auch eine gute Menge mehr Wolle, und diese ist sehr gut, läßt sich leicht spinnen und weben.«
Gegenwärtig wissen wir, daß das Dickhornschaf an geeigneten Stellen noch ziemlich häufig vorkommt. Der Prinz von Wied sah am Yellowstonefluß noch Rudel von fünfzig, achtzig und mehr Stück, Audubon in derselben Gegend eine Herde von zweiundzwanzig; Richardson gibt an, daß die Thiere gewöhnlich in Trupps von drei bis dreißig auftreten. Schafe und Lämmer pflegen besondere Herden zu bilden, wogegen die alten Widder sich, mit Ausnahme der Brunstzeit, in besonderen Gesellschaften zusammenhalten oder auch wohl einsiedeln. Im December finden sie sich bei den Schafen ein, und dann kommt es, wie bei anderen gleichstrebenden Böcken, auch zu furchtbaren Kämpfen zwischen ihnen. Sonst aber leben die Thiere friedlich unter einander nach Art unserer Hausschafe, denen sie überhaupt in ihrem Wesen sehr ähneln. Die Schafe lammen im Juni oder Juli, zuerst ein einziges, später regelmäßig zwei Junge, welche von ihren Müttern sehr bald in die unzugänglichsten Höhen geführt werden.
In ihrer Lebensweise unterscheiden sich die Dickhornschafe nicht von ihren Verwandten, nicht einmal wesentlich von den Steinböcken. Wie diese sind sie unübertreffliche Meister im Bergsteigen. Jene Wege rund um ihre Felskegel bilden sie gar nicht selten an Stellen, wo die Wand Hunderte von Metern jach abfällt. Vorsprünge von höchstens dreißig Centimeter Breite werden für die schwindelfreien Thiere zur gebahnten Straße, auf welcher sie in voller Flucht dahin rennen, zum größten Erstaunen des Menschen, der es nicht begreifen kann, daß ein Thier dort noch sich zu erhalten vermag. Sobald sie etwas fremdartiges gewahren, flüchten sie zu steilen Höhen empor und stellen sich hier an den vorspringenden Kanten auf, um ihr Gebiet zu überschauen. Ein schnaufender Nasenton gibt bei Gefahr das Zeichen zur Flucht, und auf dieses hin stürmt die Herde in rasender Eile davon. Wenn die Gegend ruhig ist, steigen die Thiere übrigens gern in die Tiefe herab und kommen dann oft auf die Wiesenstellen und Grasplätze in den Schluchten oder an die Ufer der Flüsse, um sich zu äsen. Den Höhlungen des Gebirges, an deren Wänden Salpeter und andere Salze ausblühen, statten sie täglich Besuche ab, um sich zu sulzen, und solche Plätze sind es denn auch, wo sie dem Menschen noch am leichtesten zur Beute werden. Drummont, ein erfahrener Jäger, berichtete Richardson, daß die Dickhornschafe in allen Gegenden, welche von dem Jäger selten beunruhigt werden, wenig scheu sind und dem Waidmann ohne Schwierigkeit die erwünschte Annäherung gestatten, böse Erfahrungen aber auch sie bald und dann überaus scheu machen. Wo sie den Menschen kennen gelernt haben, fürchten sie ihn ebenso sehr wie ihren zweitschlimmsten Feind, den Wolf. Ihre Aufenthaltsorte gewähren ihnen den besten Schutz. Die entsetzlichen Einöden erfordern einen Jäger, welcher die Bedürfnisse anderer Menschen kaum kennt und gefaßt sein muß, tage- und wochenlang allerlei Mühsale und Beschwerde zu ertragen, ganz abgesehen von den Gefahren, welche die Beschaffenheit der Mauvaises Terres mit sich bringt.
Bis jetzt hat es noch nicht gelingen wollen, das Dickhornschaf zu fangen; die Gewohnheit der Mutter, ihre Jungen baldmöglichst nach den wildesten Felsgegenden zu führen, mag dazu das ihrige beitragen. Ein Herr M' Kenzie versprach, wie der Prinz mittheilt, seinen Jägern ein gutes Pferd, wenn sie ihm ein Lamm dieses Schafes verschaffen würden, jedoch vergeblich. Es war selbst den ausgelerntesten Wildschützen Amerikas unmöglich, den verhältnismäßig sehr hohen Lohn zu verdienen.
Das Wildpret wird von den Weißen, wie von den Indianern gegessen, hat aber einen schafartigen Geruch, welcher namentlich bei dem Bocke und zumal während der Brunstzeit sehr merkbar wird. Die dauerhafte und starke, jedoch weiche und schmiegsame Haut wird von den Indianern zu ihren schmucken Lederhemden sehr gesucht.
Ebensowenig wie über den Ursprung anderer Wiederkäuer, welche in den Hausstand übergingen und zu vollständigen Hausthieren wurden, sind wir im Stande etwas bestimmtes über die Stammvaterschaft unseres Hausschafes anzugeben. Die Meinungen der Naturforscher gehen bei dieser Frage weit auseinander. Einige glauben, daß alle Schafrassen von einer einzigen wilden Stammart herrühren, welche vermuthlich schon seit undenklichen Zeiten vollständig ausgestorben oder gänzlich in den Hausstand übergegangen, also nirgends mehr zu finden ist, andere sprechen die Ansicht aus, daß, wie bei den Hunden, mehrere Wildschafarten in Betracht gezogen und die zahllosen Rassen des Hausschafes als Erzeugnis fortgesetzter Kreuzungen jener Rassen und ihrer Nachkommen angesehen werden müssen; diese wollen in dem Mufflon, jene in dem Argali, einzelne auch wohl in dem Arui, mehrere in dem Scha ( Ovis Vignei) Kleintibets die Stammart erkennen, andere, denen ich mich anschließen muß, gestehen offen und ehrlich ihre Unkenntnis ein und betonen mit Recht, daß bloße Annahmen die Lösung der Frage nicht fördern können. Selbst die sorgfältigsten Untersuchungen der spärlichen Knochenfunde und die Vergleichung der Darstellungen auf uralten Denkmälern erweisen sich, dem außerordentlich großen Formenspiele der Schafrassen gegenüber, als fast bedeutungslos. Rütimeyer fand in den Schweizer Pfahlbauten die Ueberbleibsel einer kleinen Schafrasse mit dünnen, langen Beinen und ziegenähnlichen Hörnern, welche von allen bekannten, gegenwärtig lebenden Schafrassen abweicht; es ergibt sich hieraus jedoch nichts anderes, als daß Schafe schon in sehr früher Zeit im Hausstande des Menschen eine Rolle gespielt haben müssen. Wir erkennen auch das gerade Gegentheil jener Befunde, indem wir auf den Denkmälern Schafe dargestellt sehen, welche mit heute noch lebenden Rassen wesentlich übereinstimmen, und werden anderseits durch unsere Landwirte belehrt, wie leicht es ist, Schafe durch beharrlich fortgesetzte Kreuzungen zu verändern. Aus den steinernen Geschichtstafeln auf den egyptischen Denkmälern scheint wenigstens eins hervorzugehen, daß das Schaf später als andere Wiederkäuer in den Hausstand des Menschen übergegangen sein muß. »Es ist auffallend«, sagt Dümichen, »und darf ich nicht unterlassen, in diesem Werke darauf aufmerksam zu machen, daß von den Wiederkäuern, Schaf, Ziege und Rind, welche heute die hauptsächlichsten Herden des Nilthales bilden, das erstere auf den alten egyptischen Denkmälern noch gar nicht auftritt. Was in Bezug auf das gegenwärtig über ganz Egypten so allgemein verbreitete Huhn und ebenso in Bezug aus Pferd und Kamel gesagt werden kann, gilt von dem Schafe. An den Wänden der dem fünften und vierten Jahrtausend vor Christi Geburt angehörigen ältesten Grabkapellen, welche sich um die Pyramiden von Giseh und Sakarah gruppiren und gerade an vorzüglichen Darstellungen so unendlich reich sind, begegnet uns auch nicht eine einzige Abbildung eines Schafes. Rinder und Ziegen und ebenso verschiedene, von den alten Egyptern gezähmte und in großen Herden gehaltene Antilopenarten sehen wir daselbst wiederholt einzeln und gruppenweise abgebildet, Schafe jedoch findet man nirgends unter denselben. Daß etwa deshalb, weil der Widder das dem Amon von Theben geheiligte Thier war, die alten Egypter aus ehrfurchtsvoller Scheu das Schaf unter die von ihnen dargestellten Hausthiere nicht mit eingereiht haben sollten, läßt sich nicht annehmen; denn dann würden sie ja aus demselben Grunde es auch später nicht abgebildet haben und ebenso andere Thiere, wie z. B. die gerade auf den ältesten Denkmälern so zahlreich dargestellten, dem Langhornschlage angehörenden Rinder, aus denen der heilige Apis genommen wurde, abzubilden haben unterlassen müssen. Es darf vielmehr aus diesem gänzlichen Fehlen der Abbildungen des Schafes auf den ältesten Denkmälern der Schluß gezogen werden, daß eben dieses Thier zu dem erst später in das Nilthal eingeführten gehörte. Das in Afrika heimische Mähnenschaf, von welchem das Berliner egyptische Museum ein paar mumificirte Köpfe besitzt, kommt einige Male auch in Abbildungen auf den Denkmälern vor, und wie Professor Hartmann geneigt ist anzunehmen, soll ein in einem Grabe von Giseh und ein in einem Grabe des Ti in Sakarah und noch ein drittes in einem Grabe von Beni Hassan angebrachtes Bild besagtes Mähnenschaf darstellen. Könnte wohl das egyptische Hausschaf von diesem Thiere abstammen? Der Thierkundige wird diese Frage zu beantworten wissen; ich beschränke mich darauf, der mumificirten Köpfe und der Abbildungen dieses Thieres, sowie des gänzlichen Fehlens der Schafe in der ältesten Zeit des egyptischen Reiches hier Erwähnung zu thun. Unter den herdenweise dargestellten Hausthieren der alten Egypter begegnet uns nun zwar auf den späteren Denkmälern des neuen Reiches das Schaf auch noch nicht; wohl aber kommen vereinzelte Darstellungen desselben nun vor, wie z. B. das schöne von Prisse mitgetheilte Bild eines Widderkampfes in einem Grabe von Gurna, auf welches mit Recht kürzlich wieder der hochverdiente Chabas in seinem bei Besprechung des Kamels erwähnten Werke aufmerksam gemacht hat. Auch aus Stein gehauene Widder, wie solche reihenweise, namentlich als einfassender Schmuck zu beiden Seiten der großen Processionsstraßen, aufgestellt wurden, begegnen uns bei den Tempeln des neuen Reiches häufig, und ebenso wird in den Inschriften jener Zeit nicht selten das hieroglyphisch ›Serau‹ und häufiger noch mit abgefallenem er ›Sau‹ genannte Hausschaf erwähnt, welches von Fitzinger seiner Zeit unter der Bezeichnung Assuanschaf ( Ovis aries syenitica) oder Hängeohrschaf ( Ovis aries catotis) als eigene Art aufgeführt wurde.« Besagte Rasse kennzeichnet sich laut Hartmann, durch eine Rammsnase, lange, ziemlich breite Schlappohren, nicht selten starke, nach außen, unten und wieder nach oben gebogene, also einmal gewundene Hörner, sowie ein mit langer, dichter Wolle bewachsenes Fell; der Schwanz ist in der Mitte sechs bis acht Centimeter dick und endigt mit einer dünneren Klunker. Von dieser Rasse gibt es wieder mehrere Spielarten und an den Schafbildern, welche die Alten auf Denkmälern gegeben haben, sind die bezeichnenden Rassenmerkmale unseres heutigen Breitschwanzschafes ( Ovis aries platyura) wohl zu erkennen: die Rammsnase wie die mehr oder weniger langen, breiten und schlaffen Ohren, der bald fettere, bald dünnere Schwanz. Nun ist aber bemerkenswerth, daß die Alten den Hörnern ihrer Widder eine nach hinten und außen, dann nach unten und wieder nach hinten und außen verlaufende Drehung verleihen, an dem durch Lepsius von Djebel Barkal nach Berlin gebrachten Granitwidder sind die oben genannten Merkmale der Spielart gut ausgeprägt, ebenso wie es scheint, an dem von Trémaux unter den Ruinen von Sobah oberhalb Chartums am Blauen Nile gefundenen Steinwidder, an welchem man aber ein gekräuseltes Wollvlies dargestellt hat, wie solches doch den um Napata und Sobah gezüchteteten behaarten Hausschafen fehlt. Ob dies nun aus Laune des Bildhauers geschehen oder deshalb, weil sich derselbe einen Widder aus Oberegypten oder Nubien zum Vorbilde gewählt, bleibt zweifelhaft. Auch Dümichen fand aus seiner ersten, der Erforschung der Denkmäler gewidmeten Reise, welche er bis oberhalb Chartums ausdehnte, während eines mehrwöchentlichen Aufenthaltes auf den Ruinenstätten des alten Sobah im Jahre 1863 einen zweiten Widder, welcher dem von Trémaux mitgebrachten gleicht und gegenwärtig dem Hofe des Regierungsgebäudes von Chartum zur Zierde gereicht.
Aus den Mittheilungen der genannten Forscher geht also hervor, daß man wenigstens in den späteren Zeiträumen des egyptischen Reiches Hausschafe züchtete, welche den noch heute im Nilthale lebenden sehr ähnlich waren; die Frage über deren Abstammung wird jedoch hierdurch ihrer Lösung keineswegs näher geführt, weil die in Rede stehenden Rassen ebensowenig als andere irgend einer wilden Stammart gleichen. Gerade in der Unähnlichkeit mit den wilden stimmen die zahmen unter sich überein. Die Unterschiede zwischen den Rassen bestehen hauptsächlich in der Windung des Gehörnes, in der Länge und Bildung des Schwanzes und in der Behaarung. »Alle bis jetzt bekannten Wildschafe«, sagt Fitzinger, »zeichnen sich durch beträchtliche Kürze ihres Schwanzes aus, während man unter den zahmen Schafen eine verhältnismäßig nur sehr geringe Menge von Rassen trifft, welche dieses Merkmal mit ihnen theilen. Daß eine solche Veränderung durch außerordentliche Einflüsse bewirkt werden könnte, ist gänzlich unerklärbar, da man durchaus nicht zu begreifen vermag, wie durch derlei Einwirkungen sogar eine Vermehrung der Wirbel stattfinden könne. Man muß sich hier von den alten Gewohnheiten und von einem übererbten Vorurtheil lossagen und kommt sicherlich bald zu der Ansicht, daß, wie bei den meisten übrigen Hausthieren, auch beim zahmen Schafe eine größere Anzahl von Stammarten angenommen werden müsse.« Um seiner Meinung Gewicht zu verleihen, führt Fitzinger zehn verschiedene Hauptstämme von Schafrassen auf, welche seiner Ansicht nach als Arten zu bezeichnen sind: außer dem Mufflon noch das Fettsteiß-, Stummelschwanz-, Kurzschwanz-, Zackel-, Land-, Fettschwanz-, Langschwanz-, Hängeohr-, Langbein- und Mähnenschaf. Stichhaltige Gründe vermag er nicht beizubringen, und wir kommen deshalb unter seiner Führerschaft nicht um einen Schritt weiter.
Neuerdings hat sich auch Darwin mit der Rassenfrage beschäftigt und dieselbe von einem anderen Gesichtspunkte beleuchtet. Ich will das wichtigste seiner Bemerkungen im Auszuge hier folgen lassen, umsomehr, als die große Menge zwar von Darwins Werken spricht, dieselben auch wohl abfällig beurtheilt, aber nicht liest. Nach den sorgfältigsten Erhebungen dieses ausgezeichneten Forschers hat fast jedes Land seine eigenthümliche Rasse, und viele Länder haben viele bedeutend von einander abweichende Rassen. Als eine der am schärfsten ausgeprägten Formen gilt die morgenländische mit langem, nach Pallas zwanzig Wirbel enthaltendem Schwanze, welcher so mit Fett durchsetzt ist, daß er, weil man ihn für einen Leckerbissen hält, zuweilen auf ein kleines Wägelchen gelegt wird, welches das lebende Thier mit sich herumfährt. Obwohl Fitzinger diese Rasse für eine bestimmte Stammform hält, so scheint sie doch in ihren Hängeohren das Zeichen einer langen Knechtschaft an sich zu tragen. Dasselbe gilt für diejenigen Schafe, welche zwei große Fettmassen am Rumpfe haben, während der Schwanz verkümmert ist. Die in Angola heimische Spielart der langschwänzigen Rasse zeigt merkwürdige Fettmassen hinten auf dem Kopfe und unter den Kiefern. Nach Hodgsons Meinung ist eine solche Zunahme des Schwanzes nichts weiter als ein Beweis der Entartung des ursprünglichen Alpenthieres. Die Hörner bieten endlose Verschiedenheiten dar, fehlen bei dem Weibchen nicht selten und vervielfältigen sich anderseits bis auf vier, ja selbst auf acht, in welchem Falle sie von einer, in eigenthümlicher Weise sich erhebenden Leiste am Stirnbeine entspringen. Auffallend erscheint, daß nach Youatts Wahrnehmung Vermehrung der Hörner allgemein, aber nicht ausnahmslos von größerer Länge und Grobheit des Vlieses begleitet ist. Als ein Merkmal der Gattung Schaf gilt das Vorhandensein eines Paares von Milchdrüsen; demungeachtet gibt es, nach Hodgson, auch bei echten Schafen einzelne Rassen, welche vier Zitzen haben. Genau dasselbe gilt für die Klauenschläuche, welche vorhanden sein und fehlen können. Merkmale, welche offenbar erst im Zustande der Zähmung erlangt wurden, drücken sich entweder ausschließlich bei den Männchen aus oder erscheinen doch bei diesen in höherer Entwickelung als bei den Weibchen: so fehlen den Mutterschafen in manchen Rassen die Hörner gänzlich, obwohl sie bei den Weibchen wilder Arten vorzukommen pflegen; bei den Widdern der wallachischen Rasse erheben sie sich fast senkrecht von dem Stirnbeine aus und erlangen dann eine schöne Schraubenkrümmung; bei den Mutterschafen dagegen treten sie fast unter rechten Winkeln vom Kopfe ab und werden dann in eigenthümlicher Weise verdreht. Auch die Rammsnase, welche mehrere ausländische Rassen kennzeichnet, ist, nach Hodgson, nichts anderes als ein Ergebnis des Hausthierstandes. Leichter als andere Hausthiere werden Schafe durch unmittelbare Einwirkung der Lebensbedingungen verändert: so entartet das fettschwänzige Kirgisenschaf nach wenigen in Rußland erzogenen Geschlechtern, und seine Fettmassen verschwinden; so verliert die Karakulrasse, welche ein feines, lockiges Vlies erzeugt, dasselbe, wenn sie aus ihren Weidegebieten bei Bokara nach Persien oder in eine andere Gegend versetzt wird. Auch große Wärme wirkt verändernd auf das Vlies: in Antigua z. B. verschwindet schon nach dem dritten Geschlechte die Wolle, um einem Haarkleide Platz zu machen. Anderseits aber leben viele wolltragende Schafe in den heißen Ländern von Indien, und wenn Lämmer in den niedrigeren und wärmeren Theilen der Kordilleren rechtzeitig geschoren werden, erhalten sie ihr Vlies, während sich, geschieht ersteres nicht, die Wolle in Flocken loslöst und nun für immer ein kurzes, glänzendes Haar wie bei einer Ziege sich bildet. Verschiedene Schafrassen gedeihen Geschlechter hindurch in ihrer Eigenart ausschließlich auf bestimmten Oertlichkeiten und scheinen demnach diesen auf das genaueste angepaßt zu sein: Marschall erzählt, daß eine Herde schwerer Lincolnshire- und leichter Norfolkschafe zusammen auf einer großen Weide gezüchtet wurden, deren einer Theil niedrig, fruchtbar und feucht, deren anderer Theil hochgelegen und trocken und mit dürftigem Pflanzenwuchse bedeckt war; wurden sie ausgetrieben, so trennten sie sich regelmäßig von einander, die schweren Schafe gingen auf den fruchtbaren Theil, die leichteren auf die dürftigere Weide, so daß beide Rassen, obgleich Gras in Fülle vorhanden war, sich so getrennt hielten wie Raben und Tauben. Während einer langen Reihe von Jahren hat man Schafe aus den verschiedensten Theilen der Erde nach dem Londoner Thiergarten gebracht; die aus heißen Klimaten stammenden überstehen hier aber niemals das zweite Jahr, sondern sterben an Schwindsucht. Aehnliches ist auch in anderen Theilen Englands in Erfahrung gebracht worden, indem hier auf einzelnen Gütern Krankheiten gewisse Schafrassen plötzlich wegrafften, welche andere nicht berührten. Nicht einmal die Trächtigkeitsdauer ist beständig, verändert sich vielmehr ebenfalls nach den Rassen und verkürzt sich bei den edelsten derselben, und ebenso erweist sich die Fruchtbarkeit je nach den Rassen verschieden; einige erzeugen bei einer Geburt Zwillinge und selbst Drillinge, wogegen andere bekanntlich nur ein einziges Lamm werfen. Daß zweckmäßig durchgeführte Zuchtwahl bei mehreren Schafrassen erhebliche Veränderungen hervorgerufen hat, bezweifelt derjenige, welcher nur irgend etwas über diesen Gegenstand weiß, nicht im geringsten. Selbst die Neigung zur Veränderlichkeit kann durch sorgfältige Zuchtwahl aufgehoben werden, und es erscheint möglich, daß gewisse, beispielsweise feinwollige Schafrassen überall gehalten werden, wo nur fleißige Menschen und sachverständige Züchter leben. Wie bei anderen Hansthieren läßt sich endlich nachweisen, daß neue Rassen plötzlich entstanden: so wurde 1791 in Massachusetts ein an den Dachshund erinnerndes Widderlamm mit kurzen, krummen Beinen und langem Rücken geboren und zum Stammvater der Otterrasse, welche nicht über die Hürden springen konnte und deshalb werthvoll zu sein schien, schließlich aber ausstarb, weil man sie durch Merinos ersetzte; bis dahin hatten sie ihre Merkmale in größter Reinheit fortgepflanzt, auch, wenn sie mit anderen Rassen gekreuzt wurden, Nachkommen erzeugt, welche mit seltenen Ausnahmen, anstatt Blendlingsformen zu zeigen, entweder der einen oder der anderen Rasse glichen. Ebenso wurde im Jahre 1828 ein Merinowidderlamm geboren, welches sich durch seine lange, glatte, schlichte, seidenartige, mit einem Worte vorzügliche, Wolle auszeichnete. Bis zum Jahre 1833 hatte der Besitzer Graux so viele Widder erzogen, daß er seine ganze Herde nach und nach umändern konnte und wenige Jahre später im Stande war, von seiner neuen Zuchtrasse zu verkaufen. Der erste Widder und seine unmittelbaren Nachkommen waren kleine Thiere mit großem Kopfe, langem Halse, schmaler Brust und langen Seiten; dieser Fehler aber wurde durch sorgfältige Kreuzungen und Zuchtwahl beseitigt. »Läge«, so schließt Darwin, »der Ursprung dieser beiden Rassen ein oder zwei Jahrhunderte zurück, so würden wir keinen Nachweis über deren Geburt haben und viele Naturforscher ohne Zweifel behaupten, daß jede Form von einer unbekannten Stammform abstamme oder mit ihr gekreuzt worden sei.«
Nach vorstehendem erscheint die Ansicht gerechtfertigt zu sein, daß auch die verschiedenen Schafrassen nichts anderes sind als ein Kunsterzeugnis des Menschen, veränderlich in Gestalt und Größe, Gehörnbildung und Vlies, Lebensart, Betragen und allen sonstigen Eigenschaften. Eine Aufzählung der von diesem oder jenem Naturforscher und Züchter mit mehr oder minder Recht unterschiedenen und beschriebenen Rassen erscheint daher fast bedeutungslos, gehört mindestens nicht in den Rahmen unseres Werkes.
Als das wichtigste und gewinnbringendste aller Hausschafe gilt gegenwärtig das Merinoschaf ( Ovis aries hispanica ), welches nachweislich in Spanien das ihm eigentümliche Gepräge erlangt hat und nach und nach zur Veredelung fast aller europäischen Rassen benutzt worden ist. Mittelgroß und voll gebaut, zeichnet es sich aus durch seinen großen, plattstirnigen, längs des Nasenrückens gewölbten, an der Schnauze abgestumpften Kopf, mit kleinen Augen und großen Thränengruben, mittellangen, schmal zugespitzten Ohren, starken, von der Wurzel an seitlich und rückwärts gebogenen und dann in Doppelschraubenwindungen nach vorn und aufwärts weiter gewendeten Hörnern, welche in der Regel nur beim Bocke vorkommen, den kurzen und dicken, stark gefalteten, unten gewammten, an der Kehle kropfartig ausgebauchten Hals, die verhältnismäßig niedrigen, aber starken und kräftigen Beine und stumpf zugespitzten Hufe sowie ein äußerst dichtes, aus kurzer, weicher und feiner, höchst regelmäßig gekräuselter Wolle bestehendes Vlies.
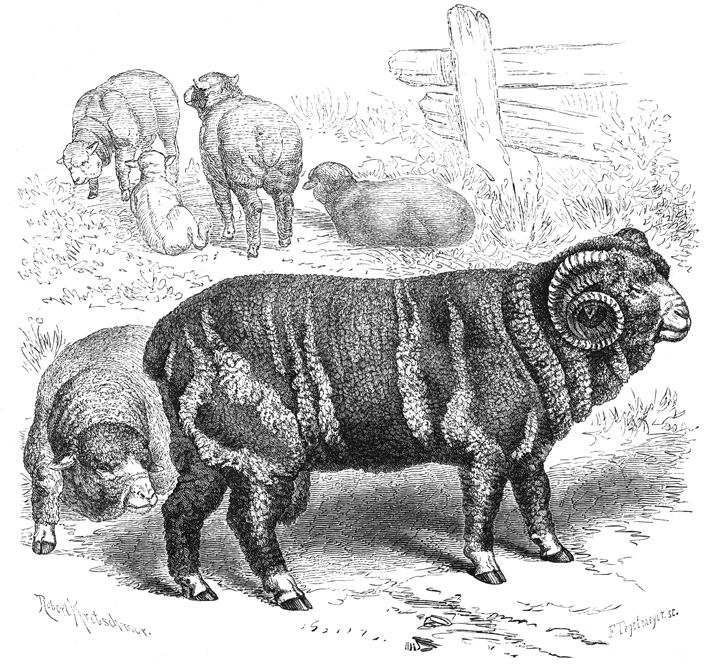
Merinoschaf ( Ovis aries hispanica). 1/12 natürl. Größe.
Um über dieses Thier und den gegenwärtigen Stand seiner Zucht in Spanien mich zu unterrichten, habe ich mich durch Vermittelung meines Bruders an den Schriftführer des Vereins der Schafzüchter Spaniens, Herrn Miguel Lopez Martinez, gewandt und von diesem das nachstehende erfahren: »In Spanien unterscheidet man drei Hauptrassen von Schafen: die Entrefina oder Mittelfeinen, die zahlreichste, die Churra, eine minder zahlreiche, und die Merino, die edelste von allen, welche gegenwärtig aber in beklagenswerther Weise sich vermindert. Viele Ausländer haben geglaubt, daß die Merinorasse die einzige wäre, welche in Spanien vorhanden gewesen und noch vorhanden sei, und es unterliegt auch keinem Zweifel, daß sie Jahrhunderte lang diejenige war, welche unseren Schafen den größten Ruf verschafft hat; verschiedene Ursachen aber, unter denen ich bloß die hauptsächlichen hervorheben will, haben mächtigen Einfluß gehabt, daß sie alljährlich mehr sich vermindert und durch die beiden anderen oben genannten ersetzt wird. Als die wirksamsten Ursachen müssen wir unsere verfassungsmäßigen Zustände betrachten. Die Zucht der Merinoherden begründete sich auf die sogenannte Sommerweide, welche durch eine besondere Gesetzgebung, die Mesta, geschützt wurde. Unter Mesta verstand man eine Vereinigung von Vorrechten, welche dem Ackerbau ebenso hinderlich als der Sommerweide förderlich waren. Diesen zufolge durften die Hirten unterwegs nach Belieben auf jedwedem Besitzthum weiden und die betreffenden Eigenthümer nur nach erlangter königlicher Erlaubnis sie von ihrem Grund und Boden verweisen, so daß, dem Geiste dieser Gesetzgebung nach, die Rechte der Landbesitzer und Ackerbauer den Vorrechten der Herdenbesitzer aufgeopfert wurden. Diese ungebührlichen Vorrechte, über welche der ›ehrbare Rath der Mesta‹ wachte und richtete, wurden selbstverständlich bei Einführung verfassungsmäßiger Gesetze aufgehoben; denn sie gaben dem Landeigenthümer alle Rechte zurück, deren er durch jene beraubt worden war. Der neue Zustand der Dinge machte sich den Herdenbesitzern in mehr als erwarteter Weise fühlbar. Nicht zufrieden mit dem, was sie erhalten hatten, verfolgten die Grundeigenthümer fortan Herden und Hirten auf das heftigste. Ganz abgesehen davon, daß man sofort die Weiden zu Getreidefeldern, Wein- und Olivengärten umwandelte oder für diejenigen, welche noch bestehen blieben, unerhörte Pachtsummen forderte, bemächtigte man sich auch der Weidwege, der Tränk- und Ruhestellen und anderer für die Sommerweide dienender Einrichtungen. Ohne Schutz auf den Wegen, ohne Ruhestellen, um sich von den Beschwerden des Weges zu erholen, genöthigt, große Umwege zu machen und hohe Pachtsummen zu zahlen, erlitten die Herdenbesitzer unglaubliche Nachtheile, und viele von ihnen, grollend mit den neueren Einrichtungen, veräußerten den größten Theil ihrer Herden. Eine andere Ursache wirkte nicht minder ungünstig auf letztere ein. Im Anfange dieses Jahrhunderts befand sich ein sehr beträchtlicher Theil des spanischen Grundbesitzes in der Todten Hand; die Klöster, die Großgrundbesitzer, Dörfer, Städte, Körperschaften besaßen ungeheuere Flächen, welche sie nach dem bestehenden Gesetze weder veräußern noch vertauschen konnten. Solche Liegenschaften gab es in allen Theilen Spaniens, und zwar in den Ebenen ebensowohl wie in den Gebirgen, und eine natürliche Folge ihrer Größe und Unveräußerlichkeit war, daß sie nur theilweise bebaut, im übrigen ausschließlich durch die Herden ausgenutzt werden konnten. Je nach der Jahreszeit nun zogen letztere auf das Gebirge und zurück in die Ebene, dorthin, um während des Sommers reiche Weide zu finden, hierher, um der winterlichen Strenge der Höhen zu entgehen. Mit Aufhebung der bisher bestehenden Hindernisse wurden auch die besagten Güter veräußerlich, und die neuen Besitzer legten selbstverständlich alle geeigneten Flächen unter Pflug und Egge oder bepflanzten andere mit Reben und Oelbäumen, beschränkten aber damit die natürlichen Weiden und verursachten den Besitzern der Herden wiederum neue Verluste, machten sogar für den größten Theil derselben jene Wanderungen fernerhin unmöglich. So entschloß man sich denn auch aus diesem Grunde, die Merinoherden zu verringern und suchte sie nach und nach durch ständige Herden anderer Schafrassen zu ersetzen, welche entweder mehr Milch oder besseres Fleisch, oder reichliche, wenn auch schlechtere Wolle lieferten. Die Vervollkommnung der Spinnereien beeinflußte diese Umwandlung ebenfalls: man lernte auch schlechtere Wolle verarbeiten, und die Merinowolle sank daher im Preise, der Nutzen der Merinozucht verringerte sich mehr und mehr, und so geschah es, daß der erheblichste Theil der berühmten großen Herden ebenso wie viele kleinere von geringerer Bedeutung zum Schlachthause wanderten, daß man heutzutage von ihnen nur noch Spuren sieht, daß die Negrettirasse gänzlich verschwunden ist.« Mein Gewährsmann führt trotzdem noch eine stattliche Reihe von Namen hervorragender Schafzüchter Spaniens auf, welche noch immer Merinos halten, gibt auch die Gegenden an, in denen die Herden weiden: ich glaube jedoch, daß diese Aufzählung mehr für ein landwirthschaftliches als für ein thierkundliches Werk Werth hat und beschränke mich darauf, zu erwähnen, daß nach den Angaben von Martinez heutzutage nicht alle Merinoschafe mehr wandern, viele Herden vielmehr zu ständigen umgewandelt worden sind.

Zackelschaf
Neben dem Merinoschafe gedenke ich noch der Fettsteißschafe ( Ovis aries steatopyga ). In ganz Mittelafrika findet sich eine fettsteißige Schafrasse in unschätzbarer Anzahl; alle Nomaden der nördlichen und inneren Länder ebensowohl als die freien Neger züchten sie. Dieses Fettsteißschaf ist ein ziemlich großes Thier mit kleinen Hörnern, von den meisten übrigen zahmen Arten durch sein vollständig haariges Vlies unterschieden. Sein Kleid ähnelt, der gleichmäßigen Kürze und Dicke der Haare wegen, dem der eigentlichen Wildschafe und hat mit einem echten Wollvliese keine Aehnlichkeit mehr, liefert auch keine Wolle, welche gesponnen und gewebt werden könnte. Nur die Lämmer tragen ein überaus feines Wollfell. Unsere Abbildung stellt das wegen seines regelmäßigen Baues und der auffallenden Färbung besonders ausgezeichnete Schwarzkopfschaf ( Ovis aries steatopyga persica. ) dar. Das Thier ist mittelgroß, kleinhörnig und trägt ein Haarkleid, welches am Leibe weißlich, am Kopfe und Oberhalse aber scharf abgesetzt dunkelschwarz gefärbt ist. Hirt und Herde sind von dem verstorbenen Kretschmer an Ort und Stelle, im östlichen Habesch, gezeichnet worden; denn hier findet sich dieses Schaf ebenso häufig wie in Indien oder in Persien, Jemen und Arabien, seiner eigentlichen Heimat.
Das Hausschaf ist ein ruhiges, geduldiges, sanftmüthiges, einfältiges, knechtisches, willenloses, furchtsames und feiges, mit einem Wort ein höchst langweiliges Geschöpf. Besondere Eigenschaften vermag man ihm kaum zuzusprechen; einen Charakter hat es nicht. Nur während der Brunstzeit zeigt es sich anderen Wiederkäuern entfernt ähnlich, entfaltet dann wenigstens einige Züge des Wesens, welche ihm die Theilnahme des Menschen erwerben können. Im übrigen bekundet das Schaf eine geistige Beschränktheit, wie sie bei keinem Hausthiere weiter vorkommt. Es begreift und lernt nichts, weiß sich deshalb auch allein nicht zu helfen. Nähme es der eigennützige Mensch nicht unter seinen ganz besonderen Schutz, es würde in kürzester Zeit aufhören zu sein. Seine Furchtsamkeit ist lächerlich, seine Feigheit erbärmlich. Jedes unbekannte Geräusch macht die ganze Herde stutzig, Blitz und Donner und Sturm und Unwetter überhaupt bringen sie gänzlich außer Fassung und vereiteln nicht selten die größten Anstrengungen des Menschen.

Schwarzkopfschaf ( Ovis aries steatopyga persica). 1/12 natürl. Größe.
In den Steppen von Rußland und Asien haben die Hirten oft viel zu leiden. Bei Schneegestöber und Sturm zertrennen sich die Herden, rennen wie unsinnig in die Steppe hinaus, stürzen sich in Gewässer, selbst in das Meer, bleiben dumm an ein und derselben Stelle stehen, lassen sich widerstandslos einschneien und erfrieren, ohne daß sie daran dächten, irgendwie vor dem Wetter sich zu sichern oder auch nur nach Nahrung umherzuspähen. Zuweilen gehen tausende an einem Tage zu Grunde. Auch in Rußland benutzt man die Ziege, um die Schafe zu führen; allein selbst sie ist nicht immer im Stande, dem dummen Vieh die nöthige Leitung angedeihen zu lassen. Ein alter Hirt schildert, wie Kohl erzählt, die Noth, welche Schneestürme über Herden und Hirten bringen, mit lebendigen Worten: »Wir werdeten unser Sieben in der Steppe von Otschakom an zweitausend Schafe und anderthalbhundert Ziegen. Es war zum erstenmale, daß wir austrieben, im März; das Wetter war freundlich, und es gab schon frisches Gras. Gegen Abend fing es an zu regnen, und es erhob sich ein kalter Wind. Bald verwandelte sich der Regen in Schnee: es wurde kälter, unsere Kleider starrten, und einige Stunden nach Sonnenuntergang stürmte und brauste der Wind aus Nordosten, so daß uns Hören und Sehen verging. Wir befanden uns nur in geringer Entfernung von Stall und Wohnung und versuchten die Behausung zu erreichen. Der Wind hatte indessen die Schafe in Bewegung gesetzt und trieb sie immer mehr von der Wohnung ab. Wir wollten nun die Geisböcke, denen die Herde zu folgen gewohnt ist, zum Wenden bringen; aber so muthig die Thiere bei anderen Ereignissen sind, so sehr fürchten sie die kalten Stürme. Wir rannten auf und ab, schlugen und trieben zurück und stemmten uns gegen Sturm und Herde; aber die Schafe drängten und drückten auf einander, und der Knäuel wälzte sich unaufhaltsam während der ganzen Nacht weiter und weiter fort. Als der Morgen kam, sahen wir nichts als rund um uns her lauter Schnee und finstere Sturmwüste. Am Tage blies der Sturm nicht minder wüthend, und die Herde ging fast noch rascher vorwärts als in der Nacht, während welcher sie von der dichten Finsternis noch mitunter gehemmt ward. Wir überließen uns unserem Schicksale; es ging im Geschwindschritte fort, wir selber voran, das Schafgetrappel blökend und schreiend, die Ochsen mit dem Vorrathswagen im Trabe, und die Rotte unserer Hunde heulend hinterdrein. Die Ziegen verschwanden uns noch an diesem Tage; überall war unser Weg mit dem todt zurückbleibenden Vieh bestreut. Gegen Abend ging es etwas gemacher; denn die Schafe wurden vom Hunger und Laufen matter. Allein leider sanken auch uns zugleich die Kräfte. Zwei von uns erklärten sich krank und verkrochen sich im Wagen unter die Pelze. Es wurde Nacht, und wir entdeckten immer noch nirgends ein rettendes Gehöfte oder Dorf. In dieser Nacht erging es uns noch schlimmer als in der vorigen, und da wir wußten, daß der Sturm uns gerade auf die schroffe Küste des Meeres zutrieb, so erwarteten wir alle Augenblicke, mitsammt unserem dummen Vieh ins Meer hinabzustürzen. Es erkrankte noch einer von unseren Leuten. Als es Tag wurde, sahen wir einige Häuser uns zur Seite aus dem Schneenebel hervorblicken. Allein obgleich sie uns ganz nahe, höchstens dreißig Schritte vom äußersten Flügel unserer Herde entfernt waren, so kehrten sich doch unsere dummen Thiere an gar nichts und hielten immer den ihnen vom Winde vorgezeichneten Strich. Mit den Schafen ringend, verloren wir endlich selber die Gelegenheit, zu den Häusern zu gelangen, so vollständig waren wir in der Gewalt des wüthenden Sturmes. Wir sahen die Häuser verschwinden und wären, so nahe der Rettung, doch noch verloren gewesen, wenn nicht das Geheul unserer Hunde die Leute aufmerksam gemacht hätte. Es waren deutsche Ansiedler, und der, welcher unsere Noth entdeckte, schlug sogleich bei seinen Nachbarn und Knechten Lärm. Diese warfen sich nun, fünfzehn Mann an der Zahl, mit frischer Gewalt unseren Schafen entgegen und zogen und schleppten sie, uns und unsere Kranken allmählich in ihre Häuser und Höfe. Unterwegs waren uns alle unsere Ziegen und fünfhundert Schafe verloren gegangen. Aber in dem Gehöfte gingen uns auch noch viele zu Grunde; denn so wie die Thiere den Schutz gewahrten, welchen ihnen die Häuser und Strohhausen gewährten, krochen sie mit wahnsinniger Wuth zusammen, drängten, drückten und klebten sich in erstickenden Haufen an einander, als wenn der Sturmteufel noch hinter ihnen säße. Wir selber dankten Gott und den guten Deutschen für unsere Rettung; denn kaum eine Viertelstunde hinter dem gastfreundlichen Hause ging es zwanzig Klafter tief zum Meere hinab.«
Ganz ähnlich benehmen sich bei uns zu Lande die Schafe während heftiger Gewitter, bei Hochwasser oder bei Feuersbrünsten. Beim Gewitter drängen sie sich dicht zusammen und sind nicht von der Stelle zu bringen. »Schlägt der Blitz in den Klumpen«, sagt Lenz, »so werden gleich viele getödtet; kommt Feuer im Stalle aus, so laufen die Schafe nicht hinaus oder rennen wohl gar ins Feuer. Ich habe einmal einen großen abgebrannten Stall voll von gebratenen Schafen gesehen; man hatte trotz aller Mühe nur wenige mit Gewalt retten können. Vor einigen Jahren erstickte fast eine ganze Herde, weil zwei Jagdhunde in den Stall sprangen und sie in solche Angst setzten, daß sie sich fast übermäßig zusammendrängten. Eine andere Herde wurde durch den Hund eines Vorübergehenden so auseinander gejagt und zerstreut, daß viele im Walde verloren gingen.«
Diese Geschichten genügen, um das Wesen des Schafes zu kennzeichnen.
In gewissem Grade freilich bekundet auch das Schaf geistige Befähigung. Es lernt seinen Pfleger kennen, folgt seinem Rufe und zeigt sich einigermaßen gehorsam gegen ihn, scheint Sinn für Musik zu haben, hört mindestens aufmerksam dem Gedudel des Hirten zu, empfindet und merkt auch Veränderungen der Witterung vorher.
Das Schaf liebt trockene und hoch gelegene Gegenden mehr als niedere und feuchte. Nach Linnés Angaben frißt es von den gewöhnlichen mitteleuropäischen Pflanzen 327 Arten, während es 141 verschmäht. Hahnenfuß, Wolfsmilch, Zeitlose, Schachtelhalme, Fettkraut, Riedgras und Binsen sind ihm Gift. Am besten gedeiht es, wenn es verschiedenerlei getrocknete Pflanzen haben kann; Getreidefütterung macht es zu fett und schadet der Wolle. Salz liebt es sehr, und frisches Trinkwasser ist ihm ein unentbehrliches Bedürfnis.
Der Fortpflanzungstrieb regt sich zuerst im März und währt von dieser Zeit an den ganzen Sommer hindurch fort. Die alten Römer ließen ihre Schafe zwischen Mai und Juni zur Paarung; die Landwirte in kälteren Gegenden ziehen die Zeit von September bis Oktober vor. Dann werden die Lämmer, weil das Schaf hundertvierundvierzig bis hundertundfünfzig Tage trächtig geht, in der zweiten Hälfte des Februar geworfen und bekommen bald gutes und frisches Futter. Gewöhnlich bringt das Mutterschaf nur ein einziges Lamm zur Welt; zwei Junge sind schon ziemlich, drei sehr selten. Anfangs müssen die kleinen Thiere sorgfältig gegen Witterungseinflüsse gehütet werden, später dürfen sie mit auf die Weide gehen. Im ersten Monate ihres Lebens brechen die Milchzähne durch, im sechsten Monate stellt sich der erste bleibende Backenzahn ein, im zweiten Lebensjahre fallen die beiden Milchschneidezähne aus und werden durch bleibende ersetzt; gegen Ende dieses Jahres erscheint der dritte bleibende Backenzahn und zugleich fallen sämmtliche Milchbackenzähne nach und nach aus, an deren Stelle nun die Ersatzzähne treten; erst im fünften Jahre aber werden die vorderen Milchbackenzähne gewechselt und damit die Zahnungen beendet. Der Landwirt benennt die Schafe nach diesen Vorgängen als Jungvieh, Zweischaufler, Zweijährige oder Zweizähnige, Zeitvieh, Vierschaufler, Dreijährige oder Vierzähnige und als Sechsschaufler, Sechszähnige oder Vierjährige, endlich als Achtschaufler, Achtgezähnte oder fünfjährige Schafe. Eigentlich müßte man das Thier erst nachdem alle Zahnungen vorüber sind, als erwachsen erklären; allein das Schaf ist schon mit einem Jahre, der Widder mit dem achtzehnten Monate paarungs- und zeugungsfähig. Alle Rassen unter sich pflanzen sich ohne Schwierigkeit fort, und eben deshalb kann man das Schaf mit Leichtigkeit veredeln.
Bei uns zu Lande hat das geachtete Hausthier wenige Feinde; schon im Norden und Süden Europas aber schleicht der Wolf häufig genug hinter den Herden her; in Asien, Afrika und Amerika stellen die großen Katzen und größeren Wildhunde, in Australien Dingo und Beutelwolf den wehrlosen Geschöpfen nach. Auch Braun, der Bär, holt sich hier und da ein Stück. Adler und Geieradler werden den Lämmern gefährlich. Dafür bleiben die am ärgsten von Feinden heimgesuchten Schafe am meisten von Krankheiten verschont, und der Schaden gleicht sich somit wieder aus. Die häufigste aller Krankheiten ist das Drehen, welches sich hauptsächlich bei jungen Schafen zeigt. Es rührt von Blasenwürmern ( Coenurus cerebralis) im Gehirn her, welche aus noch nicht ermitteltem Wege in diesen edlen Theil gelangen. Andere Eingeweidewürmer, die sogenannten Leberegel ( Distoma hepaticum), verursachen die Leberfäule, einige Fadenwürmer die Lungenfäule. Dazu kommen nun noch der Blutschlag oder die Blutseuche, die Klauenseuche, die Trabekrankheit, die Pocken, die Trommelsucht und andere oft sehr verderblich werdende Krankheiten.
Noch vor wenigen Jahrzehnten war der Nutzen des Schafes ungleich größer als gegenwärtig. In einem vollständig angebauten Lande wird zur Zeit kein großer Gewinn mehr mit dem Halten der Schafe erzielt. Die Wolle ist, seitdem man ganz Australien als Schafweide benutzt, bedeutend im Preise gefallen, und nur noch das Fleisch und der Mist kommen in Betracht. Im Süden benutzt man auch die Milch, um daraus geschätzten Käse zu machen; edle Schafe dagegen melkt man nirgends, weil man hierdurch den Wollertrag vermindert.
Das Schaf kann vierzehn Jahre alt werden; doch fallen ihm schon im neunten oder zehnten Jahre seines Lebens die meisten Zähne aus. Er wird dadurch unbrauchbar und muß so rasch als möglich gemästet und geschlachtet werden.
Die Stiere oder Rinder ( Bovina ), welche die dritte Unterfamilie der Hornthiere bilden, sind große, starke und schwerfällige Wiederkäuer, deren Merkmale hauptsächlich in den mehr oder weniger runden und glatten Hörnern, der breiten Schnauze mit den weit auseinander stehenden Nasenlöchern, dem langen, bis ans Handgelenk reichenden, gequasteten Schwanze, dem Mangel an Thränengruben und Klauendrüsen und dem vierzitzigen Euter des Weibchens liegen. Die meisten zeichnen sich auch durch eine hängende Wamme am Halse aus. Ihr Geripp zeigt sehr plumpe und kräftige Formen. Der Schädel ist breit an der Stirn und an der Schnauze wenig verschmälert; die runden Augenhöhlen stehen weit seitlich hervor, die Stirnzapfen, auf denen die Hörner sitzen, wachsen seitlich aus dem hinteren Schädel heraus; die Halswirbel sind sehr kurz, haben aber lange Dornfortsätze; dreizehn bis fünfzehn Wirbel tragen Rippen; am zwölften oder vierzehnten befestigt sich das Zwerchfell; sechs oder sieben Wirbel bilden den Lendentheil, vier oder fünf innig mit einander verschmolzene das Kreuzbein; die Anzahl der Schwanzwirbel wächst bis auf neunzehn an. Der Zahnbau ist nicht besonders auffallend. Gewöhnlich sind die inneren Schneidezähne jeder Seite die größten und unten die äußersten die kleinsten; unter den vier Backenzähnen in jedem Kiefer pflegen die vordersten klein, die hintersten aber sehr entwickelt zu sein. Die Kauflächen sind nach den Arten mannigfach verschieden. Die Hörner, welche bei einigen Rindern an der Wurzel sich verbreitern und dann fast die ganze Stirn bedecken, lassen diese bei der großen Mehrzahl frei, sind glatt, rundlich oder höchstens am Grunde quer gerunzelt und krümmen sich in sehr verschiedener Weise nach außen oder innen, nach hinten oder nach vorn, nach aufwärts und nach abwärts, oder haben leierförmige Gestalt. Das Haarkleid ist gewöhnlich kurz und glatt anliegend, verlängert sich aber bei einzelnen Arten mähnenartig an gewissen Stellen des Leibes.
Ganz Europa und Afrika, Mittel- und Südasien sowie der höhere Norden Amerikas dürfen als die ursprüngliche Heimat der Stiere betrachtet werden; gegenwärtig sind die in die Knechtschaft des Menschen übergegangenen Arten über alle Theile des Erdballs verbreitet worden. Die wildlebenden bewohnen die verschiedensten Oertlichkeiten, diese dichtere Waldungen, jene freie Blößen oder Steppen, die einen die Ebene, die anderen das Gebirge, wo sie sogar zu Höhen von fünf- bis sechstausend Meter über die Meeresfläche emporsteigen. Einige ziehen sumpfige Gegenden und Moräste, andere mehr trockene Oertlichkeiten vor. Die wenigsten sind Standthiere, führen vielmehr ein umherschweifendes Leben. Die, welche das Gebirge bewohnen, kommen im Winter in die Thäler herab, jene, welche im Norden leben, ziehen sich südlicher, andere wandern aus Mangel an Nahrung von einer gewissen Oertlichkeit in nahrungsreichere Gegenden. Alle Arten ohne Ausnahme leben gesellig und schlagen sich herdenweise zusammen; einzelne bilden Heere von tausenden. Starke, alte Thiere führen die Herden an; doch kommt es auch bei ihnen vor, daß bösartige Zugführer zuweilen vertrieben und zum Einsiedeln gezwungen werden.
Alle Rinder erscheinen zwar plump und langsam, sind aber doch im Stande, sich rasch zu bewegen, und bekunden viel mehr Fertigkeiten, als man ihnen zutrauen möchte. Ihre gewöhnliche Bewegung ist ein langsamer Schritt; allein sie traben auch schnell dahin und fallen zuweilen in einen höchst unbeholfenen Galopp, welcher sie sehr rasch fördert. Die Arten, welche Gebirge bewohnen, klettern meisterhaft, alle schwimmen leicht und gut und einzelne setzen ohne Bedenken über die breitesten Ströme. Ihre Kraft ist außerordentlich, ihre Ausdauer bewunderungswerth. Unter den Sinnen steht der Geruch obenan; das Gehör ist ebenfalls gut, das Gesicht nicht besonders entwickelt. Die geistigen Fähigkeiten sind gering; doch bekunden die wilden weit mehr Verstand als die zahmen, welche ihre Geisteskräfte nicht anzustrengen brauchen. Ihr Wesen ist verschiedenartig. Im allgemeinen sanft und zutraulich gegen Geschöpfe, welche ihnen nicht gefährlich oder beschwerlich werden, zeigen sie sich auch überaus wild, trotzig und in hohem Grade muthig, greifen, gereizt, unter Todesverachtung alle Raubthiere, selbst die stärksten, an und wissen ihre furchtbaren Waffen mit so viel Geschick zu gebrauchen, daß sie gewöhnlich Sieger bleiben; unter sich im ganzen verträglich, kämpfen sie doch zu gewissen Zeiten mit entschiedener Rauflust, und namentlich die Männchen führen während der Brunstzeit prachtvolle und dabei höchst gefährliche Kämpfe. Die Stimme besteht in hellerem oder dumpferem Gebrüll oder in einem Grunzen und Brummen, welches hauptsächlich gehört wird, wenn sie erregt sind.
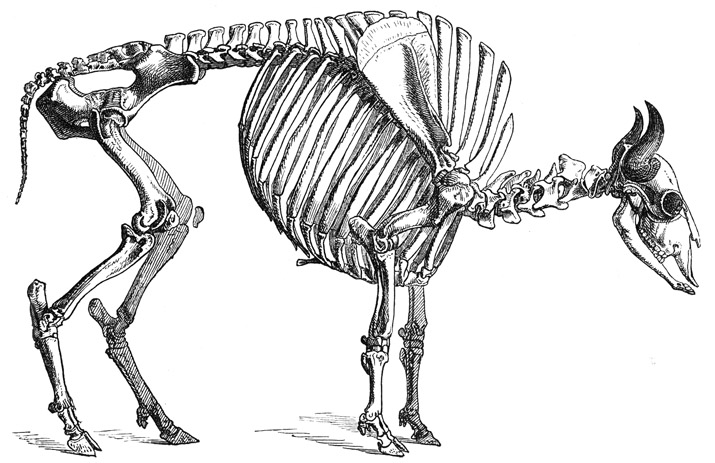
Geripp des Wisent. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
Sehr verschiedene Pflanzenstoffe bilden die Nahrung der Rinder. Sie verzehren Laub und zarte Knospen, Triebe und Zweige der allerverschiedensten Bäume, Gräser und Kräuter, Baumrinde, Moos und Flechten, Sumpf- und Wasserpflanzen, selbst scharfschneidiges Riedgras und rohrähnliche Gewächse. In der Gefangenschaft nähren sie sich von allen möglichen Pflanzenstoffen. Salz ist für alle ein Leckerbissen, Wasser ihnen Bedürfnis; manche wälzen sich mit Lust in schlammigen Lachen oder legen sich stundenlang in Flüsse und Teiche.
Der Begattung gehen gewaltige Kämpfe unter den Stieren voraus. Neun bis zwölf Monate nach ihr wirft die Kuh ein einziges Junge, sehr selten deren zwei. Das Kalb ist immer vollkommen ausgebildet und nach kürzester Zeit im Stande, der Mutter zu folgen. Diese behandelt es mit warmer Zärtlichkeit, säugt und reinigt, beleckt und liebkost es und vertheidigt es bei Gefahr mit tollkühnem Muthe gegen jeden Angriff. Nach drei bis acht Jahren ist das Junge erwachsen und zur Fortpflanzung geeignet, nach fünfzehn bis fünfzig Jahren greisenhaft und altersmatt.
Sämmtliche Rinderarten lassen sich zähmen und geben sich sodann willig dem Menschen hin, lernen ihre Pfleger kennen und lieben, folgen deren Rufe und gehorchen selbst einem schwachen Kinde, ziehen jedoch ihren Herrn eigentlich anderen Menschen nicht vor, sondern behandeln, wenn sie einmal gezähmt worden sind, alle Leute mit der gleichen Freundlichkeit.
Die Jagd der wilden Rinder gehört zu den ernstesten, welche es gibt. Ein Löwe und ein Tiger können nicht gefährlicher sein als ein gereizter Stier, dessen blinde Wuth keine Grenzen mehr kennt. Gerade deshalb aber betreibt man solche Jagd mit größter Leidenschaft, und manche Völker sehen sie als die rühmlichste von allen an.
Gegen den Nutzen, welchen die zahmen Rinder leisten, verschwindet der geringe Schaden, den die wildlebenden anrichten, fast gänzlich. Diese werden höchstens durch das Benagen der Bäume und Sträucher in den Wäldern, durch das Zerstören des Graswuchses und durch Verheerungen, die sie in Pflanzungen ausüben, dem Menschen lästig; die gezähmten dagegen nützen ihm mit ihren sämmtlichen Kräften, durch ihr Fleisch und ihre Knochen, ihre Haut und ihr Gehörn, ihre Milch, selbst durch ihr Haar und ihren Mist.
Auch die Jagd der wildlebenden Rinder liefert einen nicht unerheblichen Ertrag, da nicht allein die Haut benutzt wird, sondern auch das Fleisch, ungeachtet des ihm stets und zu gewissen Zeiten in anwidernder Weise anhaftenden Moschusgeruches, eine vorzügliche Speise gibt.
Rings um den Nordpol der Erde zieht sich als breiter Streifen die Tundra, eine Wüste der traurigsten Art, obwohl in ihr nicht die Sonne, sondern nur das Wasser zur Herrschaft gelangt, ein einziger, ungeheurer Moor und Morast, unterbrochen von einzelnen ausdruckslosen Hügelreihen, zwischen denen sich größere und kleinere Flüsse ihr Bette gebahnt haben und unzählbare Seen, Teiche und Wasserlachen ausbreiten. Inselgleich heben sich jene Höhenzüge aus dem Moore hervor, und die wenigen Stellen, welche der Mensch hier, von der Ungunst des Klimas gehindert, der Erde abrang, sind ebenfalls als Oasen zu bezeichnen. Aus ungeheuren Felsblöcken zusammengebautes und über einander geschichtetes Geröll, dessen Entstehung schwer erklärlich erscheint, bildet den Untergrund, eine Schicht vertorfter Pflanzenreste lagert sich darüber, und nur in den geschütztesten Thälern erheben sich über dieser höhere Pflanzen, Bäume, welche zu Gebüschen herabgesunken sind, Beerensträucher, Gräser und dergleichen, wogegen die Höhen, falls sie überhaupt noch Pflanzenwuchs zeigen, meist nur Flechten und Moose gedeihen lassen. Ein solches Gepräge zeigt aber nur der südlichste Theil der Tundra oder, wie wir im Deutschen sagen könnten, der Moossteppe; je weiter man nach Norden vordringt, um so öder, ärmer und unwirtlicher erscheint das Land. In den höchsten Breiten, welche man gegenwärtig erreicht hat, im Norden Grönlands z. B., bringt es, wie Payer hervorhebt, die Pflanzenwelt fast nirgends dahin, die allgemeine, durch die Felsart des Bodens bedingte Färbung abzuändern, sondern vermag höchstens dieselbe zu schattiren. Moose, Flechten, graugrüne Gräser, Ranunkeln, Steinbrecharten bilden vereinzelte ärmliche Siedelungen zwischen den verwitterten Steinfugen; die Wälder sind hier und da durch wenige Centimeter hohe Birken, deren Stämme manchmal ein Zündhölzchen an Stärke nicht übertreffen, oder durch niedriges Heidelbeergestrüpp, häufiger durch völlig am Boden hinkriechende, wurzelartig sich verzweigende Weiden vertreten. Das Gepräge dieser Landschaften bleibt dasselbe in der Höhe wie in der Tiefe: denn infolge des monatelangen Nordtages macht sich die Meereshöhe als Wachsthumsbedingung weniger fühlbar als in Europa, wo sich die pflanzliche Bedeckung der Erde um jede dreihundert Meter Erhebung merklich ändert; nur nimmt man wahr, daß die größere Sommerwärme des felsigen Binnenlandes eine mannigfaltigere Pflanzenwelt erzeugt als jene der Küstenstriche. Frühere Eskimoniederlassungen lassen sich, wenngleich meist nur auf wenige Geviertklafter Fläche beschränkt, infolge der stattgehabten günstigen Bedingungen durch ihre grünere Farbe schon aus der Ferne erkennen; Wiesen in unserem Sinne gibt es nirgends.
So arm und öde aber auch die Tundra dem Südländer vorkommen will, immerhin erhält und ernährt sie noch verschiedene ihr eigenthümliche Thierarten. Eine nicht unerhebliche Artenmenge von Vögeln bevölkert sie in großer Anzahl; außerdem wohnen und leben in ihr mehrere Nager, insbesondere Wühlmäuse, welche wiederum Raubthiere, den Eisfuchs, den Vielfraß und einige Marderarten, nach sich ziehen, aber keineswegs die alleinigen von den genannten und hier und da von Wölfen verfolgten Bewohner sind, vielmehr noch im Renthiere und in einem der auffallendsten, falls nicht dem merkwürdigsten aller Rinder Genossen haben. Die Unwirtlichkeit und Oede der Tundra, ihre Armut und die Qual, welche Milliarden von Mücken während ihres kurzen Sommerlebens all den genannten Thieren bereiten, treiben diese beständig von einem Orte zum anderen, und es findet daher, wie in den eigentlichen Wüsten und Steppen, ein reges Wanderleben sämmtlicher Thiere statt. Monatelang hausen die Wühlmäuse auf einer und derselben Stelle, durch rasch auf einander folgende Geburten eine zahlreiche Nachkommenschaft nicht selten zu unzählbaren Herden vermehrend, welche dann durch den nagenden Hunger zum Verlassen der Oertlichkeiten getrieben werden; fast beständig reisend, durchziehen die größeren, mehr Nahrung bedürftigen Thiere, das Renthier und der Schaf- oder Moschusochse das Land, und wie jenen die kleineren, so folgen diesen die größeren Raubthiere nach.
In vorgeschichtlicher Zeit lebten die genannten Wiederkäuer in weit südlicheren Gegenden, und namentlich der Schafochse hat, laut Duncan, »hart gekämpft um das Dasein«, wie die von ihm in manchem alten Flußbette Europas und Asiens zurückgelassenen Knochenstücke uns überzeugen. Mehr als fünfzehn Breitengrade tiefer lag früher die südliche Grenze seines Verbreitungsgebietes, während sie jetzt in Amerika, dem einzigen von ihm noch bewohnten Erdtheile, erst jenseit des sechzigsten Grades nördlicher Breite beginnt. Nach Hartlaub, welcher neuerdings die Angaben der verschiedenen über den Schafochsen berichtenden Nordfahrer zusammengestellt hat, erstreckt sich das Verbreitungsgebiet gegenwärtig über die Tundra des nordamerikanischen Festlandes, die Gruppe der Parry-Inseln und einen Theil von Grönland, somit etwa über einhundertfünfunddreißig Längengrade. Als Südgrenze haben wir uns eine längs des Saumes der Wälder gezogene Linie zu denken, etwa von der Mündung des Willkommflusses in die Hudsonsbai, um den sechzigsten Breitengrad herum, in einer westlichen und nördlichen Richtung, bis zum sechsundsechzigsten Grade, auf der nordwestlichen Ecke des großen Bärensees, und von dort in derselben Richtung bis Kap Bathurst, unter dem einundsiebzigsten Grade nördlicher Breite. Von hier aus nach Osten hin bevölkert das Thier alle oder fast alle größeren und wohl auch die meisten kleinen Inseln und Eilande zwischen dem Nordrande Amerikas und Grönland, insbesondere die Barren- und Montrealinsel, die größeren Eilande des Parry-Archipels, Cornwallis, Melville, Prinz-Patricks-, Grinnellinsel und andere, sowie endlich den Norden von Grönland, und zwar dessen östlichen Theil ebensowohl wie den westlichen. Sein Vorkommen in Westgrönland war schon früher mehrfach behauptet, aber ebenso oft geleugnet worden; das Auftreten des Thieres im Osten aber, und zwar auf den von Sabine und Clavering besuchten, beziehentlich nach beiden genannten Inseln, wurde erst durch die deutschen Nordfahrer festgestellt. Kurz nach unseren muthigen Landsleuten fanden auch die Mitglieder der Polarisfahrt Moschusochsen in Westgrönland auf, und zwar noch unter 81º 38' nördlicher Breite, woraus also hervorgeht, daß diese Thiere ebenso weit nach Norden hin vorzudringen scheinen als irgend ein anderes Säugethier.

Schafochse ( Ovibos moschatus). 1/15 natürl. Größe.
Der Schaf- oder Moschusochse (Ovibos moscatus, Bos moscatus) vereinigt in wundersamer Weise die Merkmale der Schafe und Rinder in sich, und es erscheint deshalb gerechtfertigt, ihn als Vertreter einer besonderen Sippe zu betrachten. Durch den Mangel einer Kehlwamme und einer nackten Muffel, die Kürze des stummelhaften Schwanzes, die verschiedenartig, d. h. unter sich nicht gleich gebildeten Hufe und das Vorhandensein von nur zwei Zitzen unterscheidet sich das Zwittergeschöpf ebenso bestimmt von anderen Rindern, als es sich den Schafen annähert. Auch die Vergleichung seines Schädels und Gerippes mit denen anderer Rinder und der Schafe führt zu demselben Ergebnis wie die Untersuchung der äußeren Theile; ja einzelne Zergliederer wollen finden, daß seine Verwandtschaft mit den Schafen eine innigere sei als die mit anderen Rindern. Gleichwohl dürfen wir ihn, unbeschadet der wissenschaftlichen Strenge, den letzteren beizählen. Ein wahrscheinlich vollständig ausgewachsener Stier des Berliner Museums gibt mir Gelegenheit, ihn eingehend zu beschreiben. Die Gesammtlänge beträgt einschließlich des nur 7 Centimeter langen Schwanzes 2,44 Meter, die Schulterhöhe 1,1 Meter. Der auf kurzen und kräftigen Beinen ruhende Leib ist massig, vorn und hinten gleich hoch, der Hals kurz und dick, der Schwanz eigentlich nur ein im Pelze versteckter Stummel, der Kopf sehr plump, verhältnismäßig schmal und hoch, die Stirne größtentheils durch die Hörner verdeckt, die Augenbrauengegend wulstig aufgetrieben, das länglich-eiförmige und nicht gerade kleine Ohr im Pelze versteckt, das Auge klein, das Nasenloch groß, eiförmig, schief gestellt und von einem nackten Rande umgeben, welcher nebst einem über die Oberlippe zum anderen Nasenloche laufenden, unbehaarten Streifen die bei den übrigen Rindern so große Muffel darstellt, das Maul groß und plump, durch seine dicken Lippen ausgezeichnet. Das Gehörn bedeckt fast die ganze Stirn, da sich die an der Wurzel stark verbreiterten und abgeflachten Hörner in der Mitte so weit nähern, daß nur eine schmale, tiefe Furche zwischen ihnen übrig bleibt; die Hörner selbst sind bis gegen ihre Mitte der Länge nach gewulstet und diese Erhöhungen als feine Streifen auf der Spitze noch zu erkennen: sie biegen sich zuerst, dicht an den Kopf sich anlegend, ein wenig nach hinten, sodann, ungefähr bis zum unteren Rande des Auges, gerade nach unten, wenden sich hierauf nach vorn und außen und kehren sich endlich mit ihren scharfen Spitzen wieder nach oben. Die Hufe sind groß, breit und rund, die Afterhufe klein und hoch angesetzt. Die Hörner haben lichthorngraue, die Hufe dunkle Färbung. Ein außerordentlich dicker Pelz bekleidet den Leib, in auffallender Dichtigkeit auch das Gesicht und die Beine. Die verhältnismäßig starken Grannen sind überall lang und mehr oder minder wellig, verlängern sich aber vom Kinne an bis zur Brust zu einer fast den Boden streifenden Mähne, bilden zu beiden Seiten, namentlich an dem Hintertheile einen bis zu den Hufen herabreichenden, 60 bis 70 Centim. langen Behang und decken ebenso in reichlicher Menge den Widerrist, hier einen kissenartigen Sattel darstellend, welcher hinter den Hörnern beginnt und den Hals von beiden Seiten überdeckt, selbst noch die Ohren einhüllt. Nur die vom Kinne an nach hinten zu mehr und mehr sich verlängernde Mähne besteht aus schlichten, das übrige Vlies durchgehends aus welligen, die Umrandung des Rückensattels aus lockigen, büschelartig zusammengefilzten, die Bekleidung des Gesichts, welche nur an den Lippen sich verkürzt und spärlich zeigt, noch immer aus dichten, bis 9 Centim. langen, pelzigen Haaren. Mit Ausnahme des Gesichtes und der mit glatten, nur etwa 5 Centim. langen Haaren bekleideten Beine sproßt überall zwischen den Grannen ein reiches Wollhaar hervor, welches die ganze Decke flockig durchzieht und auf dem Hinterrücken jene überwuchert, so daß hier ein lichterer schabrackenartiger Flecken zum Vorscheine kommt. Die allgemeine Färbung ist ein dunkles Umberbraun, welches im Gesicht und an den Haaren der Mähne ins Dunkelbraune übergeht und auf dem Sattel sich lichtet; die Lippen, ein den vorderen mähnigen Sattel umgebender Streifen und die von Wollhaaren gebildete Stelle auf dem Hinterrücken sehen graubraun, der Untertheil der Beine und ein die Hörner hinterseits einfassender, unter der mähnigen Decke versteckter Querstreifen graulich-fahlweiß aus. Abgesehen von den Grannen, welche den ersterwähnten Sattel umgeben und an der Spitze sich lichten, hat das einzelne Haar durchgehends gleichmäßige Färbung. Ein von unseren Nordfahrern eingefangenes, wenige Tage altes Kälbchen ähnelt bereits fast vollständig dem Alten, ist in ein dichtes Fell gehüllt und unterscheidet sich hinsichtlich seiner Färbung nur dadurch, daß die Beine weiter herauf graufahl und der Rücken und die Aftergegend lichter als bei dem Alten sind.
Abgesehen von einer Angabe Gomara's, eines spanischen Reisenden und Geschichtsschreibers aus der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, welche von »langhaarigen, im Reiche Quivira lebenden Schafen von der Größe eines Pferdes mit sehr kurzem Schwanze und erstaunlich großen Hörnern« handelt und auf unseren Schafochsen bezogen, ebenso gut aber auch bezweifelt werden kann, erfahren wir zuerst durch Jeremie, einen französischen Reisenden und Pelzjäger, etwas bestimmtes über den Moschusochsen, und zwar in seinem 1720 erschienenen Berichte über die Länder der Hudsonsbai. Zwischen dem Churchill- und Seehundsflusse, also am westlichen Ufer der Hudsonsbai, unter dem 59. Grade nördlicher Breite, traf gedachter Berichterstatter, wie er mittheilt, eine Art von Rindern an, welche er Moschusochsen nannte, weil sie so stark nach besagtem Stoffe rochen, »daß es zu gewissen Zeiten unmöglich war, deren Fleisch zu genießen. Man tödtete diese Thiere bei tiefem Schnee mit Lanzenstichen, da sie nicht im Stande waren zu entfliehen.« Jeremie läßt sich dann aus der Wolle des Thieres Strümpfe anfertigen, welche schöner und weicher sind als solche aus Seide, und kennzeichnet auch in dieser Beziehung das fragliche Thier zur Genüge. Später erhalten wir durch Hearne, Richardson, Parry und Franklin weitere Nachrichten über den Schafochsen, bis endlich unsere deutschen Nordfahrer, und kurz darauf die Polarisleute ihn in Ost- und Westgrönland auffinden und seine Kunde, wenn auch nicht wesentlich bereichern, so doch hier und da vervollständigen oder, was ebenso wichtig, das früher bekannte bestätigen. Versucht man alle Mittheilungen zusammenzufassen, so gewinnt man etwa folgendes Lebensbild des Thieres.
Innerhalb des vorstehend geschilderten weiten Gebietes belebt der Schafochse alle Oertlichkeiten, welche ihm wenigstens zeitweilig Unterkommen und Nahrung gewähren. Er nimmt, zu Herden von wechselnder Stärke geschart, vorzugsweise in Thälern und Niederungen seinen Stand, und seine Anzahl scheint nach Norden hinauf zuzunehmen: so wenigstens glauben unsere Nordfahrer im Osten Grönlands beobachtet zu haben. Sie begegneten Herden, welche aus zwanzig bis dreißig Stück bestanden, ihre Vorgänger noch zahlreicheren. Mocham zählte am nördlichen Ufer des Siddongolfes, westlich vom Kap Smith der Melville-Insel, auf einer Strecke von zwei deutschen Meilen einhundertundfünfzig Stück und auf der in Tafelbergen bis zu 250 Meter aufsteigenden Halbinsel zwischen Murray-Inlet und Hardybai siebzig, welche im Umkreise einer halben deutschen Meile weideten. Im Verhältnisse zu den Kühen gibt es immer nur wenige Stiere bei der Herde, selten mehr als zwei oder drei vollkommen erwachsene, weil dieselben um die Brunstzeit heftige Kämpfe miteinander bestehen und sich gegenseitig vertreiben, wobei wohl auch, wie die oft gefundenen Leichname von Stieren zu beweisen scheinen, einer den anderen ums Leben bringt. Während des Sommers halten sich diese Herden im Norden des festländischen Amerika mit Vorliebe in der Nähe von Flüssen auf, ziehen aber mit einbrechendem Herbste nach den Wäldern zurück; gleichzeitig sammeln sie sich auch zu größeren Scharen, wogegen sie früher mehr vereinzelt weideten. Wenn eine feste Eisdecke es ermöglicht, sieht man sie in langen Zügen von einer Insel zur anderen wandern, um ein zeitweilig an Nahrung reiches Gebiet aufzufinden, welches sie, nachdem sie es ausgenutzt, genau in derselben Weise verlassen. Wie weit sie ihre Wanderungen ausdehnen, weiß man übrigens noch nicht; denn nach den neuesten Erfahrungen der Polarisleute will es scheinen, als ob sie im höchsten Norden Grönlands Sommer und Winter auf einer und derselben Stelle verweilen. Eine schneefreie und mit einer verhältnismäßig üppigen Pflanzenwelt bestandene Ebene in der Nähe von Dankgotthafen unter 81° 38' nördlicher Breite war während des Aufenthaltes gedachter Nordfahrer von Moschusochsen zahlreich bevölkert, und die Thiere blieben hier auch während des Winters, obgleich es so kalt war, daß man mit Kugeln aus gefrorenem Quecksilber eine fünf Centimeter dicke Bohle durchlöchern konnte, und sie alle Nahrung unter dem Schnee hervorscharren mußten. Einzig und allein ihre unendliche Genügsamkeit ermöglicht es ihnen, den furchtbaren Winter zu überstehen. Langsam und bedächtig durchwandern sie die Schneewüste, um nach einer ihnen Unterhalt versprechenden Oase zu gelangen, und geduldig und beharrlich gewinnen sie die wenigen verdorrten Grashalme, welche hier und da aus dem Schnee hervorragen. Mit der Schneeschmelze beginnt für sie die an Sorgen ärmste, aber doch nicht aller Leiden bare Zeit. Gegenüber einem solchen Winter, welcher ihnen außer den Halmen und einzelnen Blättern der unter dem Schnee vergrabenen Pflanzen nur noch Flechten bietet, ernähren sie sich jetzt ohne Mühe von den wenigstens zeitweilig mit einiger Ueppigkeit gedeihenden, oben namentlich aufgeführten Kräutern und Bäumchen, haben aber nunmehr wie alle übrigen Thiere viel von den Mücken zu leiden und gleichzeitig die Härung zu überstehen, welche wegen des dicken Wollvließes nicht so leicht vor sich geht, sie zwingt, oft im Schlamme und Moraste sich zu wälzen, um sich von dem lästigen Pelze zu befreien, und sie längere Zeit an eine und dieselbe Stelle zu fesseln scheint, da sie erst, nachdem sie sich vollständig gehärt haben, wieder stetig und ruhig ihres Weges weiter ziehen.
Gegen Ende des August rindern die Thiere, und Ende Mai, also nach neun Monaten, bringen die Kühe ihr Kalb zur Welt: ein kleines, ungemein niedliches Geschöpf, welches von der Alten auf das zärtlichste geliebt und nöthigenfalls mit größtem Muthe vertheidigt wird. Bei einer ihrer Schlittenreisen trafen unsere Nordfahrer in einem breiten Thale mit verhältnismäßig üppiger Pflanzenwelt elf ausgewachsene Schafrinder und drei Kälber, welche dort friedlich weideten. Einige von den Thieren ließen die Fremdlinge anfänglich scheinbar furchtlos und unbekümmert nahe herankommen, nahmen dann aber doch Reißaus; drei andere dagegen, denen zwei Kälber folgten, setzten sich in Vertheidigungsstellung, drängten sich dicht aneinander, senkten die Köpfe und schnaubten ängstlich und wild, ohne jedoch wirklich zum Angriffe zu schreiten. Die Kälber standen hinter den ausgewachsenen Thieren und wurden stets wieder zurückgeschickt, wenn sie neugierig hervorkommen wollten. Ein paar wohlgezielte Schüsse jagten die muthigen Thiere in die Flucht, und nunmehr legten die Alten, Bullen wie Kühe, eine bemerkenswerthe Sorgfalt an den Tag, daß auch bei dem schnellsten Laufen keines von den Kälbern zurückbleibe. Letztere eilten, obgleich sie höchstens vierzehn Tage alt sein konnten, auf ihren wie bei so vielen jugendlichen Vierfüßlern unverhältnismäßig langen und dünnen Beinen mit überraschender Geschwindigkeit davon und kamen ihren Feinden bald aus dem Gesichte. Das Kalb behält bis zur Vollendung seines Wachsthums die helle Färbung und kleidet sich erst dann in die Tracht der Alten.
Ungeachtet der plumpen Gestalt der Schafochsen bewegen sich diese mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit, laut Roß, mit der Gewandtheit und Behendigkeit der Antilopen. Ziegen gleich klettern sie auf den Felsen umher, ohne irgend welche Anstrengungen erklimmen sie scharfe Steilungen, und schwindelfrei blicken sie von der Höhe in die Tiefe hinab. »Es war wirklich ein schöner Anblick«, so schildert Copeland, »sie an einem steilen, mit losen Steinen bedeckten Abhange mit wahrhaft überraschender Behendigkeit da hinaufspringen zu sehen, wo ein Mensch die größte Mühe gehabt haben würde, überhaupt nur festen Fuß zu fassen. Wie Thiere, welche in Herden leben, zu thun pflegen, blieben sie beim Steigen immer dicht bei einander; denn wenn sie anders gehandelt, so würde der, welcher am weitesten unten war, einem regelrechten Steinhagel ausgesetzt gewesen sein, welcher durch die vordersten in ihrem Eifer, uns zu entkommen, herabgeschleudert werden mußte.« Wurde Copeland beim ersten Zusammentreffen mit Schafochsen durch ihre große Behendigkeit und Schnelligkeit in Erstaunen gesetzt, so wuchs seine Verwunderung, als er später erfuhr, wie sie an dem Abhange eines Basaltkegels hinaufjagten, welcher so steil war, als Basalttrümmer nur irgend sein können. In höchstens drei oder vier Minuten hatten sie eine Höhe von einhundertundfünfzig Meter erstiegen, welche ihre Verfolger derartig anstrengte, daß diese eine volle halbe Stunde brauchten, um dasselbe zu erreichen. Auch hierin also beweisen sie ihre Verwandtschaft mit den Schafen, haben wenigstens unter den Rindern nur einen einzigen Genossen, den Jak, welcher einigermaßen mit ihnen wetteifern könnte.
Ueber die höheren Fähigkeiten der Thiere lauten die Urtheile verschieden, was sich wohl am besten daraus erklärt, daß wirklich beobachtungsfähige Europäer nur sehr selten mit ihnen zusammenkommen. Das kleine blöde Auge spricht nicht für eine besondere Entwickelung des Gesichtssinnes, das im Pelze fast versteckte Ohr ebensowenig für eine bemerkenswerthe Schärfe des Gehöres; der Geruch dagegen scheint ungeachtet der verkümmerten Muffel fein, mindestens ebenso ausgebildet zu sein wie bei den Schafen; über Geschmack und Gefühl läßt sich nach den bis jetzt vorliegenden Berichten schwer ein Urtheil fällen, doch liegt kein Grund vor, anzunehmen, daß diese beiden Sinne nicht ebenso gut sein sollten wie bei anderen Rindern. Dasselbe dürfte auch wohl für ihren Verstand Gültigkeit haben. Angesichts des Menschen benehmen sich wenigstens diejenigen Schafochsen, welche bis dahin kaum, vielleicht niemals mit dem Erzfeinde der Thiere zusammengekommen, oft ungeschickt und rathlos, bekunden aber bald, daß sie von der Furchtbarkeit des plötzlich in ihren höchstens vom Wolfe oder Eisbären heimgesuchten Gefilden auftretenden Gegners binnen kurzem eine richtige Vorstellung gewinnen, demgemäß ihre frühere Zutraulichkeit aufgeben und in Erkenntnis der sie bedrohenden Gefahr rechtzeitig flüchten. Anfänglich bleiben sie, um mit unseren Nordfahrern zu reden, »wie festgebannt stehen, starren den gänzlich unbekannten Feind an und kommen erst langsam und bedächtig zu einem Entschlusse.« Arglos wie sie sind, nähern sie sich auch wohl dem ihnen noch fremden Wesen und geben durch mancherlei Bewegungen und plumpe Späße ihre Verwunderung zu erkennen: so beliebten am Kap Philipp Broke vier Moschusochsen in herablassender Weise mit Payer zu scherzen, indem sie einen Angriff auf dessen Meßtisch ausführten. Diese Zutraulichkeit schlägt aber bald in das Gegentheil um. »Wird«, heißt es im Berichte unserer Nordfahrer, »eine Moschusochsenfamilie oder eine Herde mit Jungen überrascht, so drängen sie sich entweder zusammen, nehmen die Kälber in die Mitte und senken die Köpfe, als ob sie zur Vertheidigung sich anschicken wollten, oder der als Wache aufgestellte Ochse ergreift die Flucht, und die anderen jagen ihm nach. Dann ist es immer eine vergebliche Mühe, ihnen, wenngleich noch so gedeckt, anschleichend zu folgen; denn diese Thiere sind in ihrem Vorpostendienste bewunderungswürdig.« Letztere Angabe haben wir wahrscheinlich ebenso zu verstehen, wie ähnliche auf Gemsen und andere Antilopen, Wildziegen, Wildschafe und sonstige Wiederkäuer bezügliche Bemerkungen über das Wachestehen einzelner Glieder der Herde, insofern hier wie dort alle wachsam sind, dasjenige Stück aber, welches zuerst eine wirkliche Gefahr erkennt oder eine vermeintliche zu erkennen glaubt, zur Flucht sich anschickt, und die übrigen ihm folgen. Schleichen sich mehrere Jäger gleichzeitig von verschiedenen Seiten her auf eine ruhig weidende Herde von Schafochsen an, so drängen sich diese zuweilen, anstatt flüchtig zu werden und sich zu zerstreuen, dichter zusammen und gestatten den Jägern, mehrere Schüsse auf sie abzugeben. Dann entspricht die Jagd allerdings den Auffassungen unserer Nordfahrer, welche sie als eine durchaus harmlose bezeichnen; schwerlich aber läßt sich ein so abfälliges Urtheil fällen, wie von ihnen geschieht, indem sie sagen, daß eine solche Jagd nicht schwieriger sei als das Abschießen einer rings um eine Sennhütte gelagerten Ziegen- oder Kuhherde von dieser aus. »Sobald der Jäger die Thiere erblickt«, heißt es weiter, »hat er sich platt auf den Bauch und eine Patrone neben sich zu legen, das Gewehr in Anschlag zu bringen, sich völlig ruhig zu verhalten und erst dann zu schießen, wenn jene neugierig herbeieilend in nächster Nähe sind. Sollte er demungeachtet nichts treffen, so möge er mit Feuern immer fortsetzen; endlich wird doch eines der Thiere fallen.« Es mag sein, daß einer oder der andere unserer Nordfahrer Erfahrungen gesammelt hat, welche zu solchem Ausspruche zu berechtigen scheinen; gleichwohl halte ich es für unrichtig, eine derartige Beobachtung zu verallgemeinern, umsomehr als Wahrnehmungen früherer Beobachter entschieden dagegen sprechen. Verwundete Thiere gerathen in Wuth und stürzen grimmig auf den Jäger zu, welcher von Glück zu sagen hat, wenn er nicht überrannt oder von den spitzigen Hörnern durchbohrt wird. Ersteres erfuhr Tramnitz, welcher als der gewandteste Jäger unter unseren Nordfahrern geschildert wird, an sich selbst, als er einmal allein auf die Jagd der Schafochsen ausging, aber nicht nur ohne Beute, sondern auch mit verdorbenem Gewehr und zerrissener Kleidung zurückkehrte, weil ihn ein Stier umgeworfen und getreten hatte; letzteres behaupten die Indianer, welche versichern, daß die Thiere ihre Waffen ebenso gut wie andere ihrer Verwandten zu gebrauchen wissen und selbst Bären und Wölfe tödten. Auch die Eskimo, für welche die Herden der von ihnen »Umingarok« genannten Schafochsen einen Gegenstand der eifrigsten Jagd bilden, betrachten diese nicht als durchaus ungefährliche Thiere, umsomehr, als sie kein Feuergewehr besitzen und ihr Wild nach alter guter Art mit Pfeilen erlegen müssen. Wie Roß mittheilt, beginnen sie bereits im Herbste ihre Jagdzüge, nähern sich mit ebenso viel Geschick als Muth den Herden, reizen die Stiere, bis diese auf sie zustürzen, wenden sich dann schnell zur Seite und stechen ihnen entweder ihre Lanze in den Wanst oder senden ihre Pfeile auf sie ab. Einmal traf Roß selbst auf einen Schafochsen und ließ ihn durch seine Hunde stellen. Das Thier zitterte vor Wuth und stieß beständig nach den Hunden, welche ihm aber stets geschickt auswichen. Ein Eskimo, welcher die Jagd mitmachte, schoß in großer Nähe einen Pfeil nach dem anderen auf den Ochsen ab; doch alle prallten wirkungslos von seinem dichten Haarpelze zurück. Nun feuerte Roß aus einer Entfernung von wenigen Schritten und durchschoß dem armen Schelme das Herz, so daß er lautlos zu Boden stürzte. Der Eskimo war schnell bei der Hand, fing das Blut auf, vermischte es mit dem Schnee und löschte damit seinen Durst. Aeltere, besonders vereinzelte Stiere setzen, nach Angabe unserer Nordfahrer, dem Feuer selbst nach leichter Verwundung die größte Kaltblütigkeit entgegen und »begnügen sich, ihren Körper durch das Senken des unverwundbaren Kopfes und durch Vermeidung einer ihre Seiten gefährdenden Stellung zu decken. Es geschah, daß eins dieser Thiere einen Schuß auf die durch die riesigen Hörner gepanzerte Stirne aus einem Wenzelgewehre, mit welchem Eisbären der Länge nach durchschossen wurden, ertrug, ohne das geringste Zeichen einer empfundenen Störung zu bekunden; denn die Kugel fiel zu einer Scheibe platt gedrückt auf den Boden herab.«
Dem Fleische haftet stets ein merklicher Moschusgeruch an; derselbe ist jedoch bei Kühen keineswegs so heftig, daß er jenes ungenießbar machen kann, wie das bei Stieren, welche während der Brunstzeit getödtet wurden, der Fall sein soll. Unsere Nordfahrer fanden den Geschmack der Moschuskühe vortrefflich, und andere Europäer urtheilen genau ebenso. In der Gegend des Fort Wales treiben die Indianer einen einträglichen Tauschhandel mit dem Fleische des von ihnen erlegten Wildes. Sie hängen es, nachdem sie es in größere Stücke zerschnitten haben, in der Luft auf, lassen es vollständig austrocknen und liefern es dann in die Niederlassungen der Pelzjäger ab, wo es gern gekauft wird. Wolle und Haar werden von Indianern und Eskimos hoch geschätzt. Erstere ist so fein, daß man daraus sicherlich vortreffliche Gewebe erzeugen könnte, wenn man ihrer genug hätte. Aus dem Haare bereiten sich die Eskimos ihre Moskitoperrücken, aus den Schwänzen Fliegenwedel und aus der Haut gutes Schuhleder.
Für die übrigen Rinder, welche man in einer einzigen Sippe ( Bos) zu vereinigen pflegt, mit demselben Rechte aber auch in mehrere zerfällen, mindestens in wohl zu unterscheidende Untersippen eintheilen kann, gelten, außer den allgemeinen Kennzeichen, als die wichtigsten Merkmale: die breite, nackte, seitlich durch die Nasenlöcher bogig begrenzte Muffel, die breiten, vorn und hinten wesentlich gleichartig gebauten Hufe und der lange, am Ende regelmäßig gequastete Schwanz.
»Indier«, so erzählt bereits Aelian, »bringen ihrem Könige zweierlei Ochsen dar, von denen die einen sehr geschwind laufen, die anderen sehr wild sind. Ihre Farbe ist schwarz, die des Schwanzes aber, aus welchem man Fliegenwedel fertigt, blendend weiß. Das Thier ist sehr furchtsam und läuft schnell davon; kommen ihm aber die Hunde zu nahe, so steckt es seinen Schwanz in den Busch und stellt sich seinen Feinden gegenüber, weil es glaubt, man würde ihm nichts mehr thun, wenn man den Schwanz nicht sähe, wohl wissend, daß man es um dessen Schönheit willen fängt. Aber es betrügt sich. Man erlegt es mit einem giftigen Pfeile, schneidet den Schwanz ihm ab, und nimmt seine Haut, das Fleisch läßt man liegen.« Auf Aelian folgen Marco Polo, Nicolo di Conti, Belon, Pennant und andere Reisende, bis später Pallas eine ausführlichere Beschreibung, wenn auch nur des zahmen Jak, uns liefert. Erst in der neueren und neuesten Zeit haben die Reisenden Stewart, Turner, Moorcroft, Herbert, Gerard, Hamilton Smith, Radde, die Gebrüder von Schlagintweit und Sewerzoff, vor allen aber Przewalski uns genauer mit dem » Poëphagus« der Alten bekannt gemacht. Nachdem zahme Jaks in unseren Thiergärten eingeführt wurden, konnten auch Beobachtungen über diese angestellt werden.
Der Jak oder Yak ( Bos grunniens, Poëphagus grunniens, Bison poëphagus) vertritt die Untersippe oder, wie andere wollen, die Sippe der Grunzochsen ( Poëphagus), deren Merkmale die nachstehenden sind. Der Leib ist durchgehends stark und kräftig gebaut, der Kopf mäßig groß, sehr breit, von der langen und hohen, aber flachen Stirn nach der plumpen, kolbenartigen Schnauze zu gleichmäßig verschmächtigt, die Nase vorgezogen, das schmale Nasenloch schief nach vorn gestellt, die seitlich von ihm begrenzte breite Muffel unten auf der Oberlippe zu einem schmalen Streifen verschmälert, das Auge klein und von blödem Ausdrucke, sein schmaler Stern quergestellt, das Ohr klein und gerundet, überall stark behaart, das Gehörn hinten zu beiden Seiten der Stirnleiste aufgesetzt, von oben nach unten zusammengedrückt, vorn rund, hinten zu einer Kante ausgezogen, an der Wurzel deutlich, aber flach gewulstet, zuerst nach seitwärts, hinten und außen, sodann wieder nach vorn und oben, mit der Spitze nach außen und hinten gewendet, der Hals kurz und stiernackig, der Hinterhals und vordere Theil des Widerristes höckerartig erhöht, der Rücken, in reich bewegter Linie abfallend, bis zur Schwanzwurzel sanft gesenkt, der Leib in der Schultergegend schmal, in der Mitte stark ausgebaucht und hängend, der Schwanz lang und mit einer buschigen, bis auf den Boden herabreichenden Quaste geziert, das Bein kurz, kräftig, der Huf groß, breit gespalten und mit wohlentwickelten Afterhufen versehen. Das Kleid besteht durchgehends aus feinen und langen Haaren, welche auf der Stirne bis zum Hinterkopfe krauslockig und wellig sind, oft bis über das ganze Gesicht herabfallen, auf dem Widerriste und längs beider Seiten zu einer schwer herabhängenden, vorhangartigen, sanft welligen Mähne sich verlängern, welche, wie die überaus reiche, roßschweifähnliche Schwanzquaste, auf dem Boden schleift, wogegen Bauch und Innenseite der Oberschenkel und Arme sowie die Beine vom Elnbogen oder Kniegelenk an abwärts nur mit glatten, kurzen, schlichten Haaren bekleidet sind. Ein schönes, tiefes, auf dem Rücken und den Seiten bräunlich überflogenes Schwarz ist die Färbung der alten Thiere; die Haare um das Maul sind graulich, und längs des Rückens verläuft ein silbergrauer Streifen. Das Haar des Kalbes ist grau überflogen, das des Jungstieres rein schwarz. Die Gesammtlänge alter Stiere beträgt 4,25, die des Schwanzes ohne Haar 0,75, die Höhe bis zum Buckel 1,9 Meter, die Länge der Hörner 80 bis 90 Centimeter, das Gewicht 650 bis 720 Kilogramm, die Länge einer alten Kuh dagegen kaum über 2,8, die Höhe 1,6 Meter, das Gewicht 325 bis 360 Kilogramm.

Jack.
Die Hochländer Tibets und alle mit ihnen zusammenhängenden Hochgebirgszüge beherbergen den Jak; Hochebenen zwischen vier- bis sechstausend Meter unbedingter Höhe bilden seine Aufenthaltsorte. Der nackte Boden der unwirtlichen Gefilde seiner Heimat ist nur hin und wieder mit ärmlichem Grase bedeckt, welches rasende Stürme im Winter mit Schnee bedecken, wie sie im Sommer gedeihliche Entwickelung hindern. Inmitten solcher Wüsten findet der Jak Befriedigung seiner Bedürfnisse und Schutz vor dem Menschen, besteht deshalb leichter, als man annehmen möchte, den Kampf um das Dasein.
Erst dem trefflichen Przewalski danken wir eingehende Berichte über das Freileben des gewaltigen Thieres; alle früheren Mittheilungen, welche ich kenne, sind dürftig oder gehaltlos. Der muthige Reisende fand in den von ihm durchzogenen Theilen Nordtibets einsiedlernde alte Stiere und kleine Gesellschaften des Jak allerorten, zahlreichere Herden dagegen nur auf Stellen, welche reichere Weiden bieten. Solche Herden durchwandern auch wohl mehr oder minder regelmäßig weite Strecken, erscheinen, nach Aussage der Mongolen, im Sommer auf grasreichen Weiden, auf denen man sie im Winter nicht bemerkt, und bevorzugen ebenso die Nähe von Gewässern, in deren Nachbarschaft das Gras besser wächst als auf den kahlen Hochebenen, wogegen die alten Stiere, sei es aus Trägheit oder sonstigen Ursachen, jahraus, jahrein in demselben Gebiete verweilen und einsiedlerisch ihre Tage verbringen oder höchstens zu drei bis fünf sich gesellen. Jüngere, obschon bereits erwachsene Stiere schließen sich oft einer Herde älterer an, bilden jedoch häufiger eine eigene, welche dann aus zehn bis zwölf Stücken zu bestehen pflegt und zuweilen einen alten Stier in sich aufnimmt. Kühe, Jungstiere und Kälber dagegen vereinigen sich zu Herden, welche Hunderte, nach Versicherung der Mongolen selbst tausende zählen können. Solchen Massen wird es erklärlicherweise schwer, auf den ärmlichen Weiden genügende Nahrung zu finden, und sie zerstreuen sich daher, während sie sich äsen, über weite Flächen, sammeln sich aber, um zu ruhen, ebenso während heftiger Stürme, welche sie zu lagern zwingen, wiederum zu geschlossenen Herden. Wittern die Thiere Gefahr, so schließen sie sich sofort zur Herde zusammen und nehmen die Kälber in die Mitte; einige erwachsene Stiere und Kühe aber suchen über die Bedeutung der Störung sich zu vergewissern und schweifen nach verschiedenen Seiten von der Herde ab. Naht sich oder feuert ein Jäger, so ergreift der ganze gedrängte Haufen plötzlich im Trabe, häufig auch im Galopp die Flucht, im letzteren Falle den Kopf zu Boden neigend und den Schwanz erhebend. So sprengen sie, ohne sich umzuschauen, über die Ebene dahin; eine Wolke von Staub umhüllt sie, und die Erde dröhnt, auf weithin vernehmlich, unter dem Stampfen ihrer Hufe. Solch wilde Flucht währt jedoch nicht lange; selten durcheilen die jählings erschreckten Thiere mehr als einen Kilometer, häufig weniger. Langsamer beginnt die Herde zu laufen, und bald ist die frühere Ordnung hergestellt, sind die Kälber wieder in die Mitte genommen worden, und haben die alten Thiere von neuem eine lebendige Schutzwehr um sie her gebildet. Erst wenn der Jäger zum zweitenmal herannaht und feuert, flüchtet die Herde anhaltender und weiter als früher. Alte Stiere fliehen, wenn sie aufgescheucht werden, nur während der ersten Sekunden im Galopp, sodann mit weitausgreifenden Schritten.
Zum Lager wählt die Herde wo möglich den Nordabhang eines Berges oder eine tiefe Schlucht, um den Sonnenstrahlen auszuweichen. Der Jak scheut die Wärme mehr als die Kälte, legt sich daher, selbst wenn er im Schatten lagert, am liebsten auf den Schnee; falls solcher nicht vorhanden ist, scharrt er die Erdkruste auf und bildet sich eine Lagerstätte. Doch sieht man ihn hier und da, wenigstens im Winter, auch auf der Stelle liegen, wo er geweidet hat. Wasser ist ihm nothwendige Lebensbedingung. Unzählbare Fährten und Kothhaufen in der Nähe nicht zugefrorener Quellen bewiesen Przewalski, daß letztere regelmäßig aufgesucht werden. Nur an solchen Stellen, denen Wasser auf weithin mangelt, begnügt sich das Thier mit Schnee.
Ungeachtet seiner ungeheueren Kraft steht der Jak hinsichtlich seiner Begabungen anderen Thieren des Hochgebirges nach. Im Bergsteigen wetteifert er allerdings mit Wildschafen und Steinböcken; denn er klettert in dem höchsten und wildesten Gefelse, auf Graten und schroffen Abstürzen mit derselben Sicherheit wie diese; im Laufen auf ebener Fläche aber wird er von jedem Pferde eingeholt. Unter seinen Sinnen übertrifft der Geruch bei weitem alle übrigen. Einen Menschen wittert der Jak, nach Przewalski's Erfahrungen, schon aus einer Entfernung von einem halben Kilometer, unterscheidet ihn jedoch bei hellem Tage kaum auf tausend Schritte, bei bewölktem Himmel höchstens auf die Hälfte dieser Entfernung hin von einem anderen Gegenstande und vernimmt so schwach, daß der Hall von Schritten oder sonstiges Geräusch erst dann Unruhe in ihm wachruft, wenn es aus nächster Nähe sein Ohr trifft. Daß der Verstand auf tiefer Stufe steht, beweist schon das unverhältnismäßig kleine Gehirn, mehr aber noch sein Gebaren im Falle der Gefahr und Noth. »Die bemerkenswertheste Eigenschaft des Jak«, sagt Przewalski, »ist seine Trägheit. Früh und gegen Abend geht er auf die Weide; den Rest des Tages widmet er der Ruhe, welcher er stehend oder liegend sich hingibt. Währenddem bekundet nur das Wiederkäuen, daß er lebt; denn im übrigen ähnelt er einem aus Stein gemeißelten Standbilde.«
Doch dieses Wesen ändert sich gänzlich, sobald die Brunst in ihm sich regt. Nach Aussage der Mongolen beginnt die Paarzeit im September und währt einen vollen Monat. Bei Tag und Nacht sind jetzt die Stiere in Unruhe und Aufregung. Die Einsiedler gesellen sich den Herden, laufen, Kühe suchend und dabei beständig grunzend, wie sinnlos umher, treffen auf einander und treten sich streitlustig gegenüber, um im ernstesten Zweikampfe des Sieges Preis zu erringen. Unter furchtbaren Stößen, welche zuweilen ein Horn an der Wurzel brechen, stürzen sich die gewaltigen Thiere aufeinander; keiner der dicken Schädel aber bricht, und auch bedeutende Wunden, welche einer dem anderen zufügt, heilen schnell. Befriedigt oder übersättigt und ermattet ziehen sie sich nach der Brunstzeit wieder zurück, schweigen fortan und führen wiederum dieselbe Lebensweise wie früher.
Neun Monate nach der Paarung bringen die Kühe ihr Kalb zur Welt und pflegen es über ein Jahr lang, da sie, nach Angabe der Mongolen, nur alle zwei Jahre trächtig gehen sollen. Im sechsten bis achten Jahre soll der Jak erwachsen sein, im fünfundzwanzigsten altersschwach verenden, falls nicht Krankheit oder die Kugel eines Mongolen sein Leben kürzt. Andere Feinde, welche ihm verderblich werden könnten, erklimmen seine heimatlichen Höhen nicht.
Die Jagd des Jak ist für einen muthvollen und wohlbewaffneten Schützen ebenso verlockend wie gefährlich. Ohne Bedenken, wenn auch nicht unter allen Umständen, stürzt sich das gewaltige Thier, falls es nicht tödtlich getroffen wurde, auf den Jäger, und dieser kann, auch wenn er Muth, Geschick, kaltes Blut und die besten Waffen besitzt, niemals mit Sicherheit darauf rechnen, den wüthend anstürmenden, übermächtigen Gegner durch einen ferneren Schuß zu fällen. Die Kugel der schärfsten Büchse dringt nur dann zerstörend in den Kopf ein, wenn sie senkrecht auf die kleine Stelle trifft, welche das wenige Hirn umschließt, und ein Blattschuß tödtet nur in dem Falle, daß er das Herz durchbohrt. Aus diesen Gründen fürchten die Mongolen den Jak gleich einem Ungeheuer, gehen ihm gern aus dem Wege und feuern, wenn sie sich wirklich zur Jagd entschließen, immer nur aus sicherem Versteck und gemeinschaftlich, ihrer acht bis zwölf, auf den Riesen des Gebirges, hoffend, daß derselbe sie nicht wahrnehme, deshalb flüchte, nach zwei bis drei Tagen an seinen Wunden verende und dann glücklich von ihnen aufgefunden werde. Der Europäer verläßt sich auf seinen Hinterlader und die Unentschlossenheit des Jak. Trotz aller Wildheit vermag dieser seine Furcht vor einem kühn auf ihn andringenden Menschen nicht zu bemeistern, bleibt im Anlaufe zögernd stehen, wendet sich wohl auch, empfangener Wunden ungeachtet, nachdem er zaudernd überlegt, zur Flucht.
Ein Jäger vom Schlage Przewalski's verläßt am frühen Morgen, mit seinem erprobten Hinterlader ausgerüstet, die Jurte und späht von der nächsten Höhe aus nach dem gewaltigen Thiere. Schon mit unbewaffnetem Auge nimmt man den lagernden Jak in der Entfernung mehrerer Kilometer wahr, täuscht sich freilich auch manchmal, indem man ein Felsstück für das ersehnte Wild nimmt. Dieses bis auf Schußweite zu beschleichen ist nicht schwierig: falls man den Wind beachtet, kann man selbst auf freier Ebene bis auf drei- selbst zweihundert Schritte dem blödsichtigen und schwerhörigen Riesen sich nahen, vorausgesetzt, daß dieser nicht in größerer Gesellschaft lagert; im Gebirge kommt man ihm wohl auch noch näher. Der aus doppelten, mit den Lederseiten gegeneinander gekehrten Fellen gefertigte Pelz, welchen man in Sibirien trägt, und die mit Auflegegabel versehene Büchse lassen sich zur Täuschung des Jak benutzen: wenn der Jäger gebückt und mit nach oben gekehrter Gabel herbeischleicht, meint letzterer wahrscheinlich, eine Antilope zu gewahren und zeigt um so weniger Lust, davon zu gehen. Aber auch, wenn er den Menschen als solchen erkennt, flüchtet er gewöhnlich nicht. Furchtlos schaut er den herankommenden Jäger an, und unmuthig peitscht er mit seinem Schweife Schenkel und Seiten. Endlich hat sich jener genügend genähert, stellt die Büchse auf die Gabel, nimmt eine Handvoll Patronen aus der Tasche, legt sie neben sich nieder, zielt und feuert. Der Jak flüchtet entweder und wird dann mit Schüssen verfolgt, so weit die Büchse trägt, oder er stürmt mit niedergebeugtem Kopfe und gehobenem Schwanze gegen den Jäger an. Anstatt aber diesem in einem Rennen zu nahen, bleibt er nach einigen Schritten stehen, bietet sich wiederum zu sicherem Ziele, empfängt eine zweite Kugel, geht von neuem einige Schritte weiter vor, zögert wie vorher und verfährt, bis er endlich zusammenbricht, nach jedem Schusse wie nach dem ersten, nur mit dem Unterschiede, daß er immer länger zaudert, je mehr Kugeln seinen Kopf treffen oder seine Brust durchbohren. Seine Widerstandskraft und Lebenszähigkeit sind fast unglaublich groß. Einer, auf welchen Przewalski und zwei seiner Gefährten feuerten, bis die hereinbrechende Nacht es verwehrte, wurde erst am anderen Morgen mit drei Kugeln im Kopfe und fünfzehn in der Brust verendet aufgefunden; sehr wenige von allen, welche der muthige Jäger erlegte, fielen nach dem ersten Blattschusse entseelt zu Boden.
Mehr als das Wildpret schätzt man in seiner traurigen Heimat den Koth des Jak. Ersteres ist zwar, wenn es von jungen Stieren oder gelten Kühen herrührt, recht gut, steht jedoch dem äußerst schmackhaften Fleische zahmer Jaks bei weitem nach; letzterer dagegen liefert auf den kahlen Höhen Tibets den einzigen Brennstoff, welchen man verwenden kann. Einzig und allein dieser Koth ermöglicht den Aufenthalt des Menschen in jenen unwirtlichen Gefilden.
In allen Ländern, deren Hochgebirge den wilden Jak beherbergen, findet man ihn auch gezähmt als nützliches und wichtiges Hausthier. Der zahme Jak unterscheidet sich hinsichtlich seiner Gestalt und seines Haarwuchses wenig von den wilden, wohl aber hinsichtlich der Färbung. Rein schwarze Jaks sind sehr selten; gewöhnlich zeigen auch diejenigen, welche den wilden am meisten ähneln, weiße Stellen, und außerdem trifft man braune, rothe und gescheckte an. Mehrere Rassen hat man, vielleicht durch Vermischung mit anderen Rinderarten, bereits gezüchtet. Hier und da sind die zahmen Jaks auch wieder verwildert und haben dann ihre Urfärbung wieder angenommen. In der Gegend des heiligen Berges Bogdo am Altai setzten die Kalmücken ganze Herden aus, an denen sich außer den Geistlichen niemand vergreifen durfte. Radde traf im südlichen Theile des Apfelgebirges halbverwilderte Herden an, welche auch in schneereichen Wintern nicht gefüttert wurden. Eine Stallung wird den gezähmten überhaupt nie zu theil.
Auch die zahmen Herden gedeihen nur in kalten, hochgelegenen Gebirgsgegenden und gehen bei großer Wärme zu Grunde, ertragen dagegen Kälte mit Gleichgültigkeit. »An Tagen, deren Wärme nur wenige Grade über den Gefrierpunkt kam«, bemerkt Schlagintweit, »kam es vor, daß unsere Jaks, sobald sie abgeladen waren, im nächsten Bache untertauchten, ohne davon zu leiden.« Als der Engländer Moorcroft den Nitipaß erstieg und seine beladenen Jaks bei der drückenden Hitze viel gelitten hatten, rannten sie, weil sie ein Gebirgswasser in der Tiefe rauschen hörten, unaufhaltsam und mit solchem Ungestüm dem Flusse zu, daß zwei von ihnen auf den schroffen Abhängen stürzten und in der Tiefe zerschellten. Wenn der Jak kein Wasser hat, in dem er sich stundenlang kühlen kann, sucht er eifrig den Schatten auf, um der unangenehmen Wärme zu entgehen. »Die Jaks«, sagt Radde, »lagern alle auf dem Schnee, auch die Kälber; selbst die Frühgeborenen vom März bedürfen keiner Fürsorge seitens der Menschen.«
Die Kühe bekunden innige Zuneigung zu ihren Jungen, verlassen diese, wenn sie zur Weide gehen, später als die Hauskühe die ihrigen und kehren Abends mehrere Stunden vor Sonnenuntergang zu den Kälbern zurück, lecken sie zärtlich und grunzen sanft und freundlich.
Der Tibetaner benutzt den Jak als Last- und Reitthier. Gegen seine Bekannten benimmt er sich ziemlich freundschaftlich, läßt sich berühren, reinigen und vermittels eines durch seine Nase gezogenen Ringes, an einem Stricke lenken; Fremden gegenüber zeigt er sich in der Regel anders, bekundet Unruhe, senkt den Kopf gegen den Boden und geberdet sich, als wolle er seinen Gegner zum Kampfe fordern. Manchmal überkommt ihn plötzlich rasender Zorn: er schüttelt den ganzen Körper, hebt den Schwanz hoch empor, peitscht mit ihm durch die Luft und schaut mit drohenden, grimmigen Augen auf seinen Zwingherrn. Einen gewissen Grad von Wildheit behält er stets. Gegen Hausrinder benimmt er sich artiger, und es hat deshalb keine Schwierigkeit, ihn zur Paarung mit anderen Familiengenossen zu bringen.
Der Jak trägt ein- bis anderthalbhundert Kilogramm ohne Beschwerden und zwar auf den allerschwierigsten Felsenpfaden und Schneefeldern. Man ist im Stande, durch ihn Lasten über Gebirgspässe von drei- bis fünftausend Meter unbedingter Höhe zu schaffen; denn er bewegt sich auch dort oben, trotz der verdünnten Luft, welche andere Geschöpfe ermattet und beängstigt, mit größter Sicherheit. Nur auf sehr klippenreichen Pfaden kann man ihn nicht benutzen, weil dann seine Last ihn hindert, über höhere Felsen zu springen, wie er es sonst wohl zu thun pflegt. Moorcroft sah ihn ohne Umstände drei Meter hohe Felsenwände herabsetzen, ja, selbst in Abgründe von zwölf Meter Tiefe sich stürzen, ohne daß er dabei sich beschädigte.
Milch und Fleisch des Jak sind gleich gut. Aus der Haut gerbt man Leder, aus den Haaren dreht man Stricke. Das kostbarste ist der Schwanz, welcher die vielgenannten Roßschweife, jene altberühmten Kriegszeichen, liefert. Nicolo di Conti gibt an, daß die feinen Schwanzhaare mit Silber aufgewogen werden, weil man aus ihnen Fliegenwedel fertigt, welche zum Dienste der Könige und Götzen gebraucht werden; auch faßt man sie in Gold und Silber und schmückt damit Pferde und Elefanten, oder befestigt sie an den Lanzen als Zeichen einer hohen Rangstufe. Die Chinesen färben das weiße Haar brennend roth und tragen die Schwänze dann als Quasten auf ihren Sommerhüten. Belon gibt an, daß solche Schwänze vier bis fünf Dukaten kosten und wesentlich dazu beitragen, den reichen Sattelschmuck, wie ihn Türken und Perser lieben, zu vertheuern. Schwarze Schwänze gelten weniger als weiße.
Die in Europa eingeführten Jaks haben sich bisher besser gehalten, als man vermuthen durfte. Man hat deshalb sich der Hoffnung hingegeben, dieses schöne Rind in Europa heimisch machen zu können. Von einer solchen Einbürgerung erwartete man reichen Gewinn, indem man annahm, daß der Jak treffliche Wolle, schmackhaftes Fleisch, ausgezeichnete, fette Milch liefern und ein kräftiges und unermüdliches Arbeitsthier sein, sich auch mit billigerem Futter als andere Rinder begnügen werde. Für die tibetanischen und turkestanischen Hochländer läßt sich der Grunzochse allerdings nach allen diesen Richtungen hin verwenden und erweist sich deshalb als schätzbares Nutzthier; unsere europäischen Verhältnisse sind aber andere als die jener Länder, und es scheint deshalb sehr fraglich zu sein, ob die Einbürgerung sich lohnen würde. In seiner Heimat wird der Jak vorzugsweise als Saumthier geschätzt; schon in den von Sewerzoff besuchten Theilen des Thianschan aber, wo er augenscheinlich gut fortkommt, verwendet man statt seiner in den schwierigsten Gebirgspässen zum Lasttragen einfach eine Rasse von Gebirgsrindern, welche nicht so große, aber ähnliche Hufe haben wie die Jaks, ebenso gut über die Felsen klettern und mit derselben Leichtigkeit in der dünnen Luft der Höhen athmen. Für unsere Hochgebirge bedürfen wir seiner nicht; denn sie werden durch unsere Alpenrinder und Bergziegen genügend ausgenutzt. Mehr als jene würde der Jak gewiß nicht leisten.
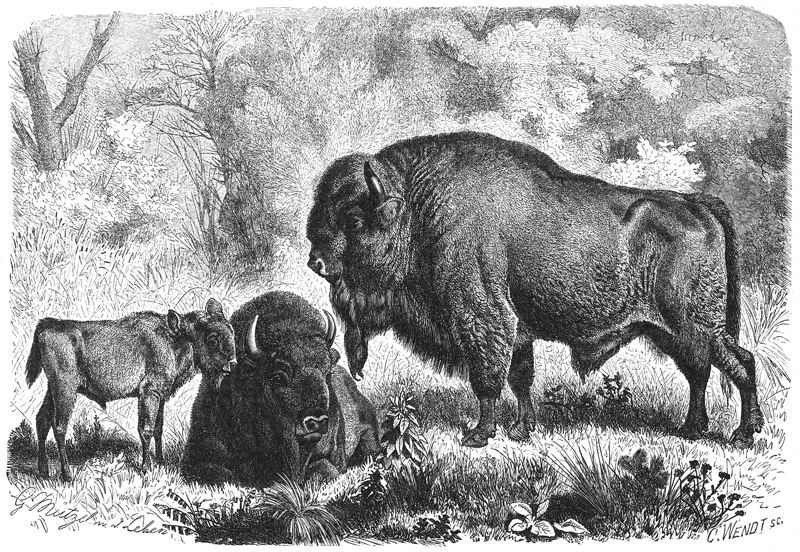
Wisent.
Die russische Provinz Grodno in Lithauen, eine spärlich bevölkerte, znm größten Theile waldlose Ebene, enthält in ihrem Innern ein Kleinod eigenthümlicher Art. Dies ist der Wald Bialowicza, Bialowesch oder Bialowies, ein echt nordischer Urwald von fünfzig Kilometer Länge und vierzig Kilometer Breite, also zweitausend Geviertkilometer Flächeninhalt. Er liegt abgesondert für sich, einer Insel vergleichbar, umgeben von Feldmarken, Dorfschaften und baumlosen Heiden. Im Inneren des Waldes finden sich nur einige wenige Ansiedelungen der Menschen, in denen aber keine Landbauern, sondern bloß Forstleute und Jagdbauern wohnen. Etwa vier Fünftheile des Bestandes werden von der Kiefer gebildet, welche auf große Strecken hin die Alleinherrschaft behauptet, in den feuchteren Gegenden treten Fichten, Eichen, Linden, Hornbäume, Birken, Ellern, Pappeln und Weiden zwischen die Kiefern herein. Alle Bäume erreichen hier ein unerhörtes Alter, eine wunderbare Höhe und gewaltige Stärke; denn der Wald zeigt heute noch dasselbe Gepräge wie vor Jahrhunderten, vielleicht vor Jahrtausenden. »Hier«, sagt ein Berichterstatter, »hat ein Sturmwind mehrere alte Riesenstämme entwurzelt und zu Boden geschleudert: wo sie hinstürzen, da sterben und verwesen sie auch. Ueber jene erheben sich tausende von jungen Stämmchen, welche im Schatten der alten Bäume nicht gedeihen konnten, und nun im regen Wetteifer nach oben streben, nach Luft, nach Licht, nach Freiheit. Ein jedes sucht sich zur Geltung zu bringen, aber doch können nicht alle dasselbe erreichen. Bald zeichnen sich einige vor den anderen aus, und einmal erst mit dem Kopfe oben, fangen sie an sich breit zu machen, wölben eine prächtige Krone und unterdrücken erbarmungslos die schwächeren Pflanzen, welche nun traurig zurückbleiben und verkümmern. Aber auch diese übermüthig emporstrebenden werden einst in das Greisenalter treten, auch ihre Wurzeln von den Stürmen gelockert und herausgerissen werden, bis über ihren Sturz Freude unter dem jungen Nachwuchs sein wird, und dasselbe Spiel, derselbe Kampf beginnt. Außerhalb der gebahnten Wege, welche der Jagd halber in Ordnung gehalten werden, ist der Wald kaum zu betreten, nicht einmal an Stellen, wo die Bäume lichter stehen, weil gerade dort ein dichter Unterwuchs von allen möglichen Straucharten wuchert. An anderen Stellen hat der Sturm Hunderte von Bäumen umgebrochen, welche so verworren über und untereinander liegen, daß selbst das Wild Mühe hat, sich durchzuarbeiten. Ab und zu gewahrt man allerdings bedeutende Lichtungen durch das Dickicht schimmern, und schon glaubt man an einer Waldgrenze zu sein oder doch eine Dorfschaft vor sich zu haben; wenn man aber auf eine solche Blöße zuschreitet, entdeckt man, daß sie ihre Entstehung einem Waldbrande zu verdanken hat, welcher in kurzer Zeit dieses ungeheuere Loch fraß und dann genug hatte; denn menschliche Kräfte vermögen wenig oder nichts über die Gewalt des Feuers in diesen Riesenwaldungen. Alle acht bis zehn Jahre kommt durchschnittlich ein Brand von größerer Ausdehnung vor; kleinere Brände aber sind ganz an der Tagesordnung.«
Der Wald von Bialowies beherbergt heute noch das größte Säugethier des europäischen Festlandes, den Wisent. Nur hier und in einigen Waldungen des Kaukasus lebt gegenwärtig noch dieses gewaltige Thier, auf der übrigen Erde ist es ausgerottet worden. Strenge Gesetze schützen es im Walde von Bialowies, und würden nicht schon seit mehreren Jahrhunderten die wechselnden Besitzer dieses wunderbaren Thiergartens solchen Schutz gewährt haben, der Wisent hätte sicherlich aufgehört, wenigstens ein europäisches Thier zu sein.
In früheren Zeiten war das freilich anders; denn der Wisent verbreitete sich nachweislich über ganz Europa und über einen großen Theil Asiens. Zur Zeit der Blüte Griechenlands war er in Päonien oder dem heutigen Bulgarien häufig; in Mitteleuropa fand er sich fast überall. Aristoteles nennt ihn »Bonassus« und beschreibt ihn deutlich; Plinius führt ihn unter dem Namen »Bison« auf und gibt Deutschland als seine Heimat an; Calpurnius bespricht ihn um das Jahr 282 n.+Chr.; die » leges allamannorum« erwähnen seiner im sechsten und siebenten Jahrhundert, das Nibelungenlied als im Wasgau vorkommend. Zu Karls des Großen Zeiten fand er sich im Harze und im Sachsenlande, um das Jahr 1000, nach Ekkehard, als ein bei St. Gallen vorkommendes Wild. Um das Jahr 1373 lebte er in Pommern, im fünfzehnten Jahrhunderte in Preußen, im sechzehnten in Lithauen, im achtzehnten zwischen Tilsit und Laubiau in Ostpreußen, woselbst der letzte seiner Art sogar erst im Jahre 1755 von einem Wilddiebe erlegt wurde.
Die Könige und Großen des Reiches Polen und Lithauen ließen sich die Erhaltung des Wisent mit Eifer angelegen sein. Man hielt ihn in besonderen Gärten und Parken, so z.+B. bei Ostrolenka, bei Warschau, bei Zamosk etc. Die mehr und mehr sich ausbreitende Bevölkerung, die Urbarmachung der Ländereien machte solchen Schutz mit der Zeit unmöglich. Noch hielt er sich eine Zeitlang in Preußisch-Lithauen und namentlich in der Gegend zwischen Laubiau und Tilsit, wo die Forstbeamten ihn schützten und zur Winterszeit in einer offenen Futterscheuer mit Nahrung versorgten. Nur höchst selten fing man einige Stücke ein, welche dann gewöhnlich zu Geschenken für fremde Höfe benutzt wurden. So gelangten im Jahre 1717 ihrer zwei an den Landgrafen von Hessen-Kassel, ebensoviele an den König Georg von England und 1738 einige an die Kaiserin Katharina von Rußland. Eine allgemeine Seuche vernichtete im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts den größten Theil dieser Herden, bis endlich der erwähnte Wilddieb dem letzten das Lebenslicht ausblies. Jedenfalls würde es den im Forste von Bialowies lebenden Wisents nicht anders ergangen sein, hätten die Könige von Polen und später die Kaiser von Rußland das seltene Thier der Jetztwelt nicht erhalten.
Länger als in Preußen lebte, nach mir gewordenen Mittheilungen des verstorbenen Grafen Lázár, der Wisent in Ungarn und namentlich in dem waldreichen Siebenbürgen, worauf auch der Umstand hindeutet, daß das Volk, vielleicht zur Erinnerung an glückliche Jagden, manchen Berg, manche Quelle und selbst Ortschaften nach ihm benannt hat. Mehrere ungarische Adelsfamilien beweisen noch heutzutage durch ihre Wappen, daß ihre Vorfahren den Wisent kannten. Die gräfliche Familie Was hatte ursprünglich keinen Ochsen, sondern einen Wisentkopf in ihrem Wappen, die Familie der Grafen Lázár einen von einem Pfeil durchbohrten Wisent, nicht aber einen Hirsch. In der Thuroci'schen Chronik, welche zur Zeit des Königs Matthias I. gedruckt wurde, finden sich reich verzierte Anfangsbuchstaben, welche damals übliche ungarische Gebräuche darstellen, und in einem derselben die Abbildung eines ungarischen Königs zu Pferde mit der Krone auf dem Haupte, die hoch erhobene Lanze nach einem dahinrasenden Wisent schwingend. Zur Zeit der Fürsten Siebenbürgens kam dieser häufig vor, und es steht ziemlich fest, daß sein Fell noch im siebzehnten Jahrhundert vielfältig verwandt wurde. Erwiesenermaßen hauste er noch im Jahre 1729 in den Gebirgswaldungen Ungarns und noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in den Szekler Bergwaldungen unweit der Ortschaft Füle.
Bevor ich zur Leibes- und Lebensbeschreibung des gedachten Wildochsen übergehe, muß ich bemerken, daß ich unter dem Namen Wisent dasselbe Thier verstehe, welches von den meisten neueren Schriftstellern Auer oder Auerochs genannt wird. Mit letzterem Namen bezeichneten unsere Vorfahren ein von jenem durchaus verschiedenes, längst ausgestorbenes Rind.
Wenn man die Schriften der Naturkundigen früherer Jahrhunderte mit Aufmerksamkeit durchliest, gelangt man zu der Ansicht, daß vormals zwei wilde Rinderarten in Europa neben einander gelebt haben müssen. Alle älteren Schriftsteller unterscheiden die beiden Thiere bestimmt. Seneca, Plinius, Albertus Magnus, Thomas Cantapratensis, Johann von Marignola, Bartholomäus Anglicus, Paul Zidek, von Herberstain und Geßner, altdeutsche Gesetze und Jagdberichte aus vergangenen Jahrhunderten sprechen von zwei gleichzeitig lebenden Wildochsen und beschreiben die beiden mit hinlänglicher Genauigkeit. Bezeichnend erscheinen ebenso die Verse des Nibelungenliedes, welche ich bereits gelegentlich der Schilderung des Elch angezogen habe. Da wir den Wisent noch zur Vergleichung vor uns haben und an ihm sehen können, daß die ihm geltende Beschreibung naturgetreu ist, dürfen wir dasselbe wohl auch von dem uns höchstens durch versteinerte Schädel bekannten Auerochsen erwarten. Plinius kennt den Bonassus oder Wisent, weil derselbe lebend nach Rom gebracht wurde, um in den Thierkampfspielen zu glänzen, und unterscheidet ihn von dem Urus oder Auer, indem er hervorhebt, daß den ersteren seine reiche Mähne, den letzteren sein großes Gehörn kennzeichnet. Cäsar erwähnt eines in Deutschland vorkommenden Wildochsen, welcher dem zahmen nicht unähnlich sei, aber viel größere Hörner als dieser besitze und an Größe dem Elefanten wenig nachstehe. Er meint den Auer, nicht den Wisent. Mit noch größerer Bestimmtheit sprechen sich die späteren Schriftsteller aus. Lukas David gibt an, daß der Herzog Otto von Braunschweig im Jahre 1240 »den Brüdern« Aueroxen und Bisonten schenkte, Cramer, daß Fürst Wradislaw um das Jahr 1364 in Hinterpommern einen Wysant erlegte, »welcher größer geachtet worden, als ein Uhrochs«, Mathias von Michow, daß es in den Wäldern Lithauens Urochsen und Wildochsen gebe, welche die Einwohner Thuri und Jumbrones nennen, Erasmus Stella, daß der Wisent (zu Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts) seltener sei als der Urus. Der österreichische Gesandte Herberstain spricht in einem von ihm verfaßten Werke über Rußland und Polen von beiden Wildochsen und fügt einer späteren Ausgabe des Buches zwei Abbildungen bei, über denen zur Erklärung die Namen der betreffenden Thiere stehen. Das Bild, welches ein unserem Hausrinde ähnliches Thier darstellt, enthält die Worte: »Ich bin der Urus, welchen die Polen Tur nennen, die Deutschen Auerox, die Nichtkenner Bison«, die zweite Abbildung, welche unseren Wisent nicht verkennen läßt, dagegen den Satz: »Ich bin der Bison, welchen die Polen Subr nennen, die Deutschen Wysent, die Nichtkenner Urochs«. »In Lithauen«, sagt Herberstain, »gibt es, außer den Thieren, welche in Deutschland vorkommen, noch Bisonten, Urochsen, Elenthiere und wilde Pferde. Die Bisonten heißen im Lithauischen Subr, im Deutschen uneigentlich Aurox oder Urox, welcher Name dem Urus zukommt, der völlig die Gestalt des Ochsen hat, wogegen die Bisonten ganz anders aussehen. Diese haben eine Mähne, lange Haare um Hals und Schultern, eine Art Bart am Kinn, nach Bisam riechende Haare, einen kurzen Kopf, große, trotzige und feurige Augen, eine breite Stirn, und so weit auseinander gerichtete Hörner, daß zwischen denselben drei ziemlich beleibte Menschen sitzen könnten, was der König von Polen, Sigmund wirklich gethan haben soll. Der Rücken ist in eine Art Buckel erhöht; hinten und vorn dagegen der Leib niedriger. Ihre Jagd fordert viel Kraft und Schnelligkeit. Man stellt sich hinter Bäume, treibt sie durch die Hunde und ersticht sie sodann mit einem Spieße. Urochsen gibt es nur in Masovien; sie heißen daselbst Thur, bei den Deutschen eigentlich Urox: denn es sind wilde Ochsen, von den zahmen in nichts verschieden, als daß alle schwarz sind und auf dem Rückgrat einen weißlichen Streifen haben. Es gibt nicht viele, und an gewissen Orten werden sie fast wie in einem Thiergarten gehalten und gepflegt. Man paart sie mit den zahmen Kühen; aber die Jungen werden dann nicht von den Urochsen in der Herde geduldet, und die Kälber von solchen Bastarden kommen todt auf die Welt. Gürtel aus dem Leder des Urochsen werden hoch geschützt und von den Frauen getragen. Die Königin von Polen schenkte mir zween dergleichen, und die römische Königin hat einen davon sehr gnädig angenommen.«
Auf ihn und Schneeberger sich stützend, gibt Geßner Abbildungen und Beschreibungen der betreffenden Thiere. Das eine Bild stellt unzweifelhaft unseren Wisent dar, das zweite ein kräftiges, untersetzt gebautes, glatthaariges Rind ohne Schulterbuckel, mit größerem und stärkerem Gehörn. Die Beschreibungen lauten, nach der Uebersetzung von Dr. Cunrat Forex aus dem Jahre 1583, wie folgt:
»Wiewol unseren biß auff diese zeyten die rechten waren Wisent der alten vnbekannt gewesen sind, so werdend doch gegenwirtiger zeyt der wilden Ochsen etlich gefangen vnnd gezeigt, welche diser beschreybung gentzlich gemäß sind, als dann in diser gegenwirtigen gestalt wol zu sehen ist. Dann dem Wisent werdend von den alten zugeben, daß er häßlich sehe, scheützlich, vil haars, mit einem dicken langen halßhaar als die Pfärdt, item gebartet, summa gantz wild vnnd vngestalt: welches sich alles im gegenwirtigen thier, so eigentlich abconterfetet worden ist, klarlich erzeigt, ist ein wunder groß, scheützlich art der wilden Ochsen; dann zwüschend den hornen, die weyte von einem zu dem anderen ist zwen gut werckschuch, söllend an der farb schwarzlecht seyn. Ein grimm thier ist dieser Ochß auch an dem ersten anschouwen zuförchten: Sommers zeyt laßt er das haar, wird jm kürtzer vnnd dünner: Winters zeyt aber vil lenger vnnd dicker, frisset höuw, als andere heimsche Rinder.
»In Sclauonia, Vngeren vnnd Preüssen auch allen anderen landen, weyt gägen Mitnacht gelägen, grosen mercklichen wälden werdend dise wilde Ochsen gefunden vnnd gejagt. Vor zeyten söllend sölche auch in dem Schwartzwald gesähen seyn.
»Aus den figuren vnnd gestalten der Auwerochßen ist die erste die rechte ware bildtnuß, dann die ander gstalt so hie zugegen in form deß geiegtes, wil sich nit beduncken gantz eigentlich contrafetet seyn. Söllend gantz ähnlich seyn den gemeinen schwartzen heimschen Stieren, doch grösser mit sonderer gestalt der hornen, als dann hie wol zu sehen ist. Sölche sind vor zeyten in dem Schwartzwald gejagt worden, jetzsonder wirt er in der Lithauw in dem ort Mazonia genannt, allein gefangen, welche je nur der Teütschen Wisent vngebürlich nennen: dann der recht ware Wisent der alten ist hievor beschrieben vnnd mit gestalt für augen gestelt worden. Es werdend zu Worms vnnd Mentz, so namhafft stett am Rheynstromen gelägen, grosse wilde Stierköpff, zwey mal grösser dann der heimschen, mit etwas geblibnen stumpen der hornen, an gmeinen Radtsheüsern der statt angehefft gesehen vnnd gezeiget, welche ohne zweyfel von etlichen wilden Ochsen kommen sind.
»Dise thier söllend seer starck, schnäll, rouw vnnd grausam seyn, niemants schonen, wäder leüt noch vech, mögen zu keinen zeyten milt gemachet werden. Ir ardt zu fahen ist, das man sölche in gruben stürtzt, in welchem geiegt sich die junge mannschafft mächtig pflägt zu üben. Dann welcher die merer zal der thieren vmbracht vnnd geschediget hatt, des selbigen wäre vrkund den herren bringt vnnd der oberkeit zeigt, der empfacht grosses Lob vnd reyche schenke davon. Es schreybend etlich daß dise Stier auch auff dem grausamen gebirg, so das Spanger land vnnd Franckreych von einander scheidet gefunden vnnd gesähen werdend.
»Aussert der Nutzbarkeit, so man von der haut vnnd fleisch der thieren hat, werdend auch seine horn als fürstliche zierd vnnd kleinot behalten, in sylber eyngefasset, gebraucht zu trinck geschiren, Fürsten vnnd Herren dargebotten: welchen brauch auff den hüttigen tag die Lithuaner behalten habend.«
Andere Schriftsteller aus dem sechzehnten Jahrhundert halten den gegebenen Unterschied ebenfalls fest. Mucante, welcher am polnischen Hofe oft Gelegenheit hatte, beide Arten lebend zu sehen, sagt ausdrücklich, daß es in einem königlichen Parke Bisonten und Thuren gegeben habe. Der Wojwode Ostrorog ertheilt denen, welche Wildparks anlegen wollen, den Rath, Bisonten und Ure nicht an demselben Orte zu halten, weil sie mit einander heftige Kämpfe aufführen. Gratiani versichert (1669), bei einem Besuche des Thiergartens zu Königsberg Auer und Wisente, beides Wildochsen, verschiedenartige Thiere eines Geschlechts, gesehen, in Preußen auch das Fleisch von Auerkälbern gekostet und dabei gefunden zu haben, daß es sich von dem zahmen Rinde nicht unterscheide. Auer und Hausochsen sollten sich, wie man erzähle, zuweilen mit einander vermischen, ihre gemeinschaftlich erzeugten Kälber jedoch nicht fortleben. Endlich wurde anfangs dieses Jahrhunderts ein altes Oelgemälde entdeckt, welches, nach Stil und Pinsel zu urtheilen, etwa aus dem ersten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts herrühren mag. Es stellt ein ziemlich rauhhaariges, mähnenloses Thier mit großem Kopfe, dickem Halse und schwacher Wamme dar. Seine mächtigen Hörner sind, gleich denen eines ungarischen oder römischen Ochsen, vorwärts und dann aufwärts gekehrt; ihre Färbung ist an der Wurzel ein lichtes Horngrau, an der Spitze ein dunkles Schwarz. Das Fell ist gleichmäßig schwarz und nur das Kinn lichter gefärbt. In einer Ecke des Bildes steht das Wort Tur. Wir haben also in dem abgemalten Thiere den Auer vor uns.
Erst im siebzehnten Jahrhundert werden die meisten Schriftsteller zweifelhaft, und fortan sprechen sie nur von einem Wildochsen, welchen sie bald Wisent, bald Urochs nennen. Der letztere, d.+h. der wahre Auer, ist inzwischen ausgestorben, und die Berichterstatter sind deshalb nicht mehr im Stande, aus eigener Anschauung zu reden. Später nimmt die Unklarheit noch mehr überhand; man bemüht sich, Widersprüche der erwähnten Schriftsteller aufzufinden und behauptet, daß der Auer, dessen ehemaliges Vorhandensein in ganz Europa und mehreren Theilen Asiens gefundene Knochen, insbesondere Schädel, außer Frage stellen, in vorgeschichtlicher Zeit ausgestorben sein müsse, stellt, auf diese Schädel gestützt, auch wohl mehrere Arten von Urstieren auf oder bezweifelt, daß der sogenannte Urstier ( Bos primigenius) und der Auer ( Bos urus) gleichartig seien, ebenso wie man die Schädel des Vorfahren des Wisent unter dem Namen Bos priscus einer von ihm verschiedenen Art zuschreiben will. Meiner Ansicht nach sind die erhobenen Einwände gegen die Angaben der älteren und ältesten Schriftsteller größtentheils hinfällig, wir daher berechtigt, die Thatsächlichkeit jener Mittheilungen anzunehmen.
Die Wisente ( Bonassus) gelten ebenfalls als Vertreter einer besonderen Untersippe der Rinder und werden durch die kleinen, runden, nach vorn gerückten und aufwärts gekrümmten Hörner, die sehr breite gewölbte Stirn, das weiche und lange Haarkleid und die große Rippenzahl gekennzeichnet. Der Wisent hat vierzehn, der amerikanische Bison fünfzehn Rippenpaare.
Obwohl mit Sicherheit angenommen werden muß, daß der Wisent ( Bos Bison, Bonassus und priscus, Bonassus Bison) an Größe abgenommen hat, ist er doch immer noch ein gewaltiges Thier. Ein im Jahre 1555 in Preußen erlegter Wisentstier war 7 Fuß hoch und 13 Fuß lang, dabei 19 Centner 5 Pfund schwer. Heutzutage erreicht auch der stärkste Stier selten mehr als eine Höhe von 1,8 und eine Länge von 3,5 Meter, bei einem Gewichte von sechs- bis achthundert Kilogramm. Der Wisent erscheint uns als ein Bild urwüchsiger Kraft und Stärke. Sein Kopf ist mäßig groß und durchaus nicht plump gebaut, vielmehr wohlgestaltet, die Stirne hoch und sehr breit, der Nasenrücken sanft gewölbt, der Gesichtstheil gleichmäßig nach der Spitze zu verschmächtigt, die Schnauze plump, die Muffel breit, den ganzen Raum zwischen den großen, runden, schief gestellten Nasenlöchern einnehmend, das Ohr kurz und gerundet, das Auge eher klein als groß, seine Umrandung über die Gesichtsfläche erhöht, der Hals sehr kräftig, kurz und hoch, unten bis zur Brust gewammt, der Leib, welcher auf kräftigen, aber nicht niedrigen, mit großen, länglichrunden Hufen und ziemlich kleinen Afterhufen beschuheten Beinen ruht, massig, vom Nacken bis zur Rückenmitte stark gewölbt, von hier an bis zum Kreuze sanft abfallend, der Schwanz kurz und dick. Die weit seitlich angesetzten, verhältnismäßig zierlichen, runden und spitzigen Hörner biegen sich zuerst nach außen, sodann nach oben und zugleich etwa nach vorn, hierauf nach innen und hinten, so daß die Spitzen fast senkrecht über die Wurzeln zu stehen kommen. Ein überall dichter und reicher, aus langen, meist gekräuselten Grannen und filzigen Wollhaaren bestehender Pelz deckt den Leib, verlängert sich aber auf dem Hinterkopfe zu einem, aus schlichten Haaren gebildeten, breiten, nach vorn über die Stirn und seitlich über die Schläfe herabfallenden Schopfe, längs des Rückens zu einem mäßig hohem Kamme, am Kinne zu einem zopfig herabhängenden Barte und am Unterhalse zu einer die ganze Wamme einnehmenden, breit herabwallenden Mähne, bekleidet auch das Gesicht sehr reichlich, beide Ohrränder fast zottig und bildet an der Spitze der Brunstruthe einen dichten Busch, am Ende des Schwanzes eine starke und lange, bis über die Fesselgelenke herabreichende Quaste. Ein mehr oder weniger ins Fahle spielendes Lichtbraun ist die allgemeine Färbung des Pelzes, geht aber auf den Kopfseiten und am Barte in Schwarzbraun, auf den Läufen in Dunkelbraun, an der Schwanzquaste in Schwarz und auf dem über den Scheitel herabhängenden Haarbusche in Lichtfahlbraun über. Die Wisentkuh ist merklich kleiner und zierlicher gebaut als der Stier, ihr Gehörn schwächer, die Mähne weit weniger entwickelt als bei letzterem, in der Färbung ihm jedoch gleich. Das neugeborene Kalb hat merklich lichtere Färbung.
Bis in die neuere Zeit war es eine noch unentschiedene Frage, ob der Wisent außer in Russisch-Lithauen auch im Kaukasus vorkomme, beziehentlich ob er mit dem dort lebenden Wildstiere gleichartig sei. Wir wußten und wissen noch heute wenig von diesem Thiere. Der erste, welcher vor mehr als zweihundert Jahren, jedoch nur nach Hörensagen, über das Vorkommen eines »wilden Büffels« an der Grenze von Mingrelien spricht, ist der Pater Archangelo Lamberti. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts theilt hierauf Güldenstädt mit, daß er in einer Höhle am Uruch oder Jref, einem Zuflusse des Terek, vierzehn Wisentschädel gefunden habe. Eichwald sammelte im Anfange unseres Jahrhunderts Nachrichten über das Vorkommen des noch lebenden Wildstieres am nördlichen Abhange des Elbrus bis zum Flusse Bubuk, welcher sich ebenfalls in den Terek ergießt, sowie in dem Gebiete des Agar, welcher sich mit dem Kuban vereinigt; aber erst Baer vermochte, auf Grund eines im Jahre 1836 durch Baron von Rosen eingesandten Felles die Gleichartigkeit des kaukasischen Wildstieres und des Wisent zu beweisen. Von nun an liefen mehrere im wesentlichen übereinstimmende Berichte über den Wildstier des Kaukasus ein, bis hier im Jahre 1866 ein junger männlicher Wisent gefangen und an den Thiergarten zu Moskau abgeliefert wurde. Auf die Bitten der thierkundlichen Gesellschaft zu Moskau hatte Großfürst Michael Auftrag gegeben, zu beobachten, ob der Wisent noch im Kaukasus lebe, und wenn dies der Fall sei, keine Anstrengung zu scheuen, um womöglich ein lebendes Thier zu erhalten. Ein Einwohner des Dorfes Kuvinsk im Kreise Zelentschuk, Adjeff mit Namen, war so glücklich, dem Befehle des Großfürsten nachkommen zu können. In einem Fichtenwalde bei dem Flecken Atcikhar bemerkte er eine aus fünfzig Stück bestehende Wisentherde, unter welcher sich eine Kuh mit ihrem etwa sechs Monate alten Kalbe befand. Es gelang ihm, sich heranzuschleichen, und die Mutter mit einem Schusse zu erlegen, worauf die ganze Herde mit dem Jungen davon rannte. Da an eine Verfolgung der flüchtig gewordenen Thiere nicht zu denken war, traf er mit seinen Genossen Vorbereitungen, um einen Imbiß zu nehmen. Noch damit beschäftigt, hörten die glücklichen Jäger das Brummen des Kalbes, welches zur Leiche seiner Mutter zurückgekehrt war; Adjeff schlich heran, umklammerte den Hals des Thieres und hielt dasselbe fest, obgleich er von ihm eine weite Strecke fortgeschleift, wiederholt gegen Bäume und Steine gestoßen und an der Brust nicht unbedeutend gequetscht wurde; erst den auf seinen Ruf herbeigekommenen Gefährten gelang es, des kleinen Unbandes Herr zu werden und denselben in das nächste Dorf zu bringen. Hier nun wurde das Thier zuerst mit Kuhmilch, später mit Baumblättern und allerlei Kräutern ernährt, während des ganzen Sommers im Dorfe gehalten und im September von Adjeff und einem Fähndriche nach Moskau gebracht, woselbst es am 19. December 1866 in vollständig befriedigendem Zustande ankam und sich als echter, von den im Walde von Bialowies lebenden Artgenossen nicht verschiedener Wisent erwies. Somit steht fest, daß unser europäischer Wildstier noch eine zweite Zufluchtstätte hat und wenigstens für die nächste Zeit gegen Ausrottung gesichert sein dürfte.
Nordmann, Tornau und Radde haben inzwischen weiteres über Vorkommen, Lebensweise und Jagd des kaukasischen Wisent mitgetheilt. Ersterer berichtet Ende der dreißiger Jahre, daß der Wisent in der Nähe der Hochstraße von Taman nach Tiflis nicht mehr vorhanden sei, im Inneren der Gebirgszüge des Kaukasus jedoch keineswegs selten auftrete. Bereits in Gelintschik erfuhr er, daß es am Kuban Gegenden gebe, in denen das Thier in größerer Anzahl vorkomme. Weiter südlich in Affhasien zeigten ihm eingeborene Fürsten Hörner des Wildstieres, welche zu Trinkgeschirren dienten. Im Spätherbste erfuhr er in Kelasur, einer affhasischen Ortschaft, daß infolge starken Schneefalles im Hochgebirge Wisente in den vom Stamme Psöh bewohnten Thälern sich gezeigt hätten. Nach allen von Nordmann gesammelten Nachrichten bewohnt das Thier ständig eine Strecke von mindestens zweihundert Kilometer Durchmesser, das Gelände vom Kuban bis zum Ursprunge des Psib oder Kapuetti nämlich. Roullier erzählt, wohl auf mündliche Berichte Tornau's sich stützend, von einer kaukasischen Wisentjagd an der großen Selentschuga und bemerkt, daß die Thiere nicht bloß an diesem Flusse, sondern auch in dem felsigen und zerklüfteten Ufergebiete des Urup und der großen Laba sowie in den Nadelholzwaldungen des Hauptkammes unter der Grenze des ewigen Schnees sich finden. Auf Befragen konnte Radde dem Akademiker von Brandt, dessen eingehenden Berichten über den Wisent ich vorliegendes entnehme, mittheilen, daß noch im Jahre 1865 ausgedehnte Kieferwaldungen westlich vom Maruchagletscher Wisente beherbergten und sie dort in Rudeln von sieben bis zehn Stück vorkamen.
Nach den Ermittelungen Nordmanns bleiben die Wisente am Kuban jahraus, jahrein auf denselben Ständen, sumpfigen Stellen des Waldes; im Lande der Abachen dagegen wandern sie im Sommer auf die Gebirge und kehren erst mit Eintritt des Winters wieder in die tieferen Thäler zurück. Auf diesen Wanderungen scheinen sie bestimmte Wege zu gehen, ebenso wie sie ihre Wechsel auf das genaueste einhalten. Tornau, welcher als Gefangener der Bergvölker drei Jahre im Gebirge lebte und Wisentjagden beiwohnte, sah mehrmals die Lagerplätze der Thiere und Pfade, welche sie sich zuweilen sogar an den steilsten Schroffen bahnen, um von einem Felsenthale aus zu einem Bache und damit zur Tränke zu gelangen. An der Selentschuga vernahm er eines Tages lautes, von den stampfenden Schritten einer Wisentherde und brechenden Zweigen herrührendes Geräusch und bekam bald darauf gegen zwanzig Kühe und Kälber zu Gesicht, welche einem riesigen, gesenkten Hauptes einherschreitenden, dem gewohnten Tränkplatze zuwandernden Stiere folgten. Dieser wurde durch Tornau's Begleiter verwundet, und das Aufnehmen der Rothfährte führte zur Entdeckung des Tränkplatzes. In der Nähe desselben legte sich die Jagdgesellschaft in der folgenden Nacht in den Hinterhalt, wobei jeder Jäger, um gegen etwaige Angriffe gesichert zu sein, zwischen Geröllstücken sich verbarg. Als die Morgenröthe anbrach, wurden im Gebirge die Wisente, zunächst als dunkle, sich bewegende Flecken, bemerkt. Sie näherten sich stetig, wiederum unter Anführung des erwähnten Stieres und gelangten endlich zum Tränkplatze. Als der Führer zu trinken sich anschickte, sank er, von sieben Kugeln durchbohrt, zusammen; alle übrigen aber entflohen so schnell, daß die ihnen nachgesandten Schüsse sie nicht mehr erreichen konnten.
Der Bestand der Wisente im Walde von Bialowies betrug im Jahre 1829 nach einer vorgenommenen Zählung oder Schätzung siebenhundertundelf Stück, worunter sich sechshundertdreiunddreißig ältere befanden, vermehrte sich im folgenden Jahre bis auf siebenhundertzweiundsiebzig Stück, verminderte sich aber im nächsten Jahre, infolge der inzwischen stattgefundenen staatlichen Umwälzungen, wieder bis auf sechshundertsiebenundfünfzig Stück. Die später erfolgten Verschärfungen der Schutzgesetze waren der Vermehrung so günstig, daß man im Jahre 1857 die Anzahl aller im Bialowieser Walde lebenden Wisente auf achtzehnhundertachtundneunzig Stück annehmen konnte; doch fragt es sich sehr, ob der Bestand wirklich die angegebene Höhe erreicht hat: denn nach neueren Nachrichten soll man wohl von Seiten der Regierung glauben, daß die Anzahl der Thiere zwischen fünfzehnhundert und zweitausend beträgt, in Wirklichkeit aber, nach gewissenhaften Schätzungen der Forstbeamten, nur ihrer acht- bis neunhundert annehmen dürfen. Im Jahre 1863 zählte man achthundertundvierundsiebzig Stück.
Im Sommer und Herbste lebt der Wisent an feuchten Orten des Waldes, gewöhnlich in Dickungen versteckt; im Winter zieht er höher gelegenes und trockenes Gehölz vor. Sehr alte Stiere leben einsam, jüngere während des Sommers in Rudeln von fünfzehn bis zwanzig, während des Winters in kleinen Herden von dreißig bis fünfzig Stück. Jede einzelne Herde hat ihren festen Stand und kehrt immer wieder nach demselben zurück. Bis zum Eintritte der Brunstzeit herrscht Einigkeit unter solchem Trupp; zwei verschiedene Herden aber vertragen sich anfangs nicht gut mit einander, und die kleinere weicht so viel als möglich der größeren aus.
Die Wisente sind ebensowohl bei Tage wie bei Nacht thätig, weiden aber am liebsten in den Abend- und Morgenstunden, zuweilen jedoch auch während der Nacht. Verschiedene Gräser, Blätter, Knospen und Baumrinde bilden ihre Nahrung; sie schälen die Bäume ab, soweit sie reichen können, und reiten jüngere, biegsame Stämme nieder, um zu der Krone zu gelangen, welche sie dann meist gänzlich vernichten. Ihr Lieblingsbaum scheint die Esche zu sein, deren saftige Rinde sie jeder anderen bevorzugen; Nadelbäume dagegen lassen sie unbehelligt. Im Winter äsen sie sich fast ausschließlich von Rinden, Zweigen und Knospen der ihnen zugänglichen Laubbäume, außerdem auch wohl von Flechten und trockenen Gräsern. Das im Bialowieser Walde auf den Wiesen geerntete Heu wird für sie aufgeschobert, anderes nehmen sie, nachdem sie die Umhegungen niedergebrochen haben, gewaltsam in Besitz. Frisches Wasser ist ihnen Bedürfnis.
Obwohl die Bewegungen der Wisente schwerfällig und plump erscheinen, sind sie doch, bei Lichte betrachtet, lebhaft genug. Der Gang ist ein rascher Schritt, der Lauf ein schwerer, aber schnell fördernder Galopp, wobei der Kopf zu Boden gesenkt, der Schwanz emporgehoben und ausgestreckt wird. Durch Sumpf und Wasser waten und schwimmen sie mit Leichtigkeit. Unter ihren Sinnen steht der des Geruches oben an; Gesicht und Gehör sind minder, Geschmack und Gefühl zu durchschnittlicher Höhe entwickelt. Das Wesen ändert sich mit den Jahren. Jüngere Thiere erweisen sich als muntere, lebhafte und spiellustige, auch verhältnismäßig gutmüthige, zwar nicht sanfte und friedfertige, aber doch auch nicht bösartige Geschöpfe, ältere dagegen, zumal alte Stiere erscheinen als ernste, fast mürrische, leicht reizbare und jähzornige, jeder Tändelei abholde Wesen. Im allgemeinen lassen zwar auch sie Menschen, welche sie nicht behelligen wollen, ruhig an sich vorübergehen; allein die geringste Veranlassung kann ihren Zorn erregen, und sie äußerst furchtbar machen. Im Sommer pflegen sie dem Menschen stets auszuweichen, im Winter gehen sie gewöhnlich niemand aus dem Wege, und es ist schon vorgekommen, daß Bauern lange warten mußten, eh es einem Wisent gefiel, den von ihm gesperrten Fußpfad zu verlassen, auf welchem es für jenen kein Ausweichen gab. Wildheit, Trotz und Jähzorn sind bezeichnende Eigenschaften auch dieser Wildrinder. Der erzürnte Wisent streckt die bläulichrothe Zunge lang heraus, rollt das geröthete Auge, sein Blick wird grimmig, und mit beispielloser Wuth stürzt er auf den Gegenstand seines Zornes los. Jüngere Thiere sind immer scheuer und furchtsamer als die alten Stiere, unter denen namentlich die einsiedlerisch lebenden zu einer wahren Geisel für die Gegend werden können. Sie scheinen ein besonderes Vergnügen darin zu finden, mit dem Menschen anzubinden. Ein alter Hauptstier beherrschte eine Zeitlang die durch den Bialowieser Wald führende Straße, wich nicht einmal Fuhrwerken aus und richtete viel Unglück an. Wenn er auf einem durchziehenden Schlitten gutes Heu witterte, erhob er gewaltsam seinen Zoll, indem er trotzig vor die Pferde trat und den Fuhrmann mit Gebrüll aufforderte, ihm Heu herabzuwerfen. Verweigerte man, ihm das verlangte zu gewähren, und versuchte man, die Peitsche gegen ihn anzuwenden, so gerieth er in furchtbaren Zorn, hob den Schwanz empor und stürzte mit niedergebeugten Hörnern auf den Schlitten los, packte ihn und warf ihn mit einem einzigen Stoße über den Haufen. Reisende, welche ihn neckten, schleuderte er einfach aus dem Schlitten heraus. Pferde bekunden von vornherein Furcht und Abscheu vor dem Wisent, und pflegen durchzugehen, wenn sie ihn wittern. Tritt ihnen aber der entsetzliche Stier plötzlich in den Weg, so geberden sie sich wie unsinnig, bäumen, werfen sich nieder und verrathen auf jede Weise ihr Entsetzen.
Die Brunstzeit, welche gewöhnlich in den August, manchmal auch erst in den September fällt, währt zwei oder drei Wochen. Um diese Zeit sind die Wisente im besten Stande, feist und kräftig. Eigentümliche Spiele und ernste Kämpfe unter den Stieren gehen dem Sprunge voraus. Dem liebestollen Thiere scheint es ein besonderes Vergnügen zu bereiten, mittelstarke Bäume aus der Erde zu wühlen und auf diese Weise zu fällen. Dabei kann es geschehen, daß sich die Wurzeln in dem Gehörn verwickeln und von den Trägern nicht gleich abgeworfen werden können. Dann laufen diese lärmend und tobend mit dem sonderbaren Kopfschmucke umher, ärgern sich schließlich und beginnen zu kämpfen, erst vielleicht nur scherzhaft, später aber in sehr ernsthafter Weise, stürzen zuletzt rasend auf einander los und prallen derart mit den Hörnern zusammen, daß man glaubt, beide müßten unter der Wucht des Stoßes zusammenbrechen. Allein auch ihre Stirn hält kräftige Stöße aus, und die Hörner sind so biegsam, als wären sie aus Stahl gebaut. Nach und nach gesellen sich die alten Einsiedler der Herde zu, und nunmehr werden die Zweikämpfe noch viel bedeutsamer; denn jenen muß ein jüngerer, schwächerer Stier entweder weichen oder erliegen. Im Jahre 1827 fand man im Bialowieser Walde einen dreijährigen todten Stier, welchem ein Bein zerschmettert und ein Horn an der Wurzel abgesprengt worden war. Und nicht bloß umgebrachte Stiere findet man nach der Brunstzeit, sondern auch getödtete Kühe. Sie haben das Kreuz gebrochen, »weil ihnen die Last des auf sie springenden Stieres zu schwer war (?)«.
Sofort nach Beendigung der Brunst trennen sich die alten Einsiedler wieder von der Herde und kehren zu ihrem stillen, beschaulichen Leben zurück. Die Kühe kalben neun Monate nach der Brunstzeit, gewöhnlich im Mai oder anfangs Juni. Vorher haben sie sich von der Herde abgesondert und im Dickichte des Waldes in einer einsamen, friedlichen Gegend einen geeigneten Platz ausgesucht. Hier verbergen sie sich und ihr Kalb während der ersten Tage, treten aber bei etwaiger Gefahr mit außerordentlichem Muthe für dessen Sicherheit ein. In der ersten Jugend drückt sich das Kalb im Nothfalle platt auf den Boden nieder, hebt und dreht das Gehör, öffnet Nüstern und Augen und schaut ängstlich nach dem Feinde, während die Alte sich anschickt, diesem entgegenzutreten. Jetzt ist es für Menschen und Thier gefährlich, einer Wisentkuh sich zu nahen: sie nimmt ohne weiteres den Gegner an, rennt ihn zu Boden und zerfleischt ihn mit den Hörnern. Einige Tage nach seiner Geburt folgt das Kalb seiner Mutter, welche es mit außerordentlicher Zärtlichkeit behandelt. Solange es noch nicht ordentlich gehen kann, schiebt sie es sanft mit dem Kopfe vorwärts; wenn es unreinlich ist, leckt sie es glatt; beim Säugen stellt sie sich auf drei Beine, um ihrem Sprößling das Euter leichter zu bieten, und während es schläft, wacht sie für dessen Sicherheit.
Diese Kälber sind niedliche, anmuthige Thiere, obgleich schon in der Jugend das in ihnen liegt, was im Alter aus ihnen werden soll. Sie wachsen sehr langsam und haben wahrscheinlich erst im achten oder neunten Jahre ihre volle Größe erlangt. Das Alter, welches die Wisente überhaupt erreichen können, wird auf etwa dreißig bis fünfzig Jahre angegeben. Kühe sterben ungefähr zehn Jahre früher als Stiere; aber auch diese werden im Alter gewöhnlich blind oder verlieren die Zähne und sind dann nicht mehr fähig, gehörig sich zu äsen, können namentlich nicht mehr die jungen Zweige abbeißen, welken rasch dahin und gehen schließlich zu Grunde.
Im Vergleiche zu anderen Rindern vermehren sich die Wisente langsam. Im Walde von Bialowies hat man in Erfahrung gebracht, daß die Kühe kaum alle drei Jahre einmal trächtig werden, und bei nur einigermaßen gereifterem Alter oft eine Reihe von Jahren hinter einander unfruchtbar bleiben, dann jedoch manchmal wieder empfangen. Im Jahre 1829 warfen von zweihundertachtundfünfzig Kühen nur dreiundneunzig; von den übrigen hundertfünfundsechzig war der größte Theil unfruchtbar, der kleinere Theil zu jung. Hierin dürfte eine der Ursachen des Aussterbens der Wisente gefunden werden.
Gegen ihre Feinde wissen sich die gewaltigen Thiere vortrefflich zu vertheidigen. Bären und Wölfe können den Kälbern gefährlich werden, aber nur dann, wenn die Mutter durch irgend welchen Zufall ihr Leben verloren hat und das Junge unbeschützt ist. Bei sehr tiefem Schnee soll es vorkommen, daß hungrige Wölfe auf einen erwachsenen vereinzelten Wisent sich stürzen, ihn mit vereinten Kräften anfallen, durch Umhertreiben ermatten und schließlich, wenn auch erst nach harten Verlusten, erlegen. Einige Berichterstatter wollen behaupten, daß drei Wölfe genügen, um einen Wisent zu überwältigen, indem der eine das angefallene Thier durch sein beständiges Hin- und Herspringen beschäftigen und seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen trachten soll, während die beiden anderen von hinten an ihn schleichen und ihm eine Wunde beizubringen suchen. Ich bezweifle diese Angaben, weil ich glaube, daß jeder Wisentstier einen Wolf, welcher sich an ihm festgebissen hätte, mit einem einzigen Schlage seiner Läufe zerschmettern oder durch sein Gewicht erdrücken würde, noch ehe derselbe eine gefährliche Wunde gerissen hätte.
Julius Cäsar berichtet, daß derjenige sich hohen Ruhm erwarb, welcher einen Ur oder einen Wisent erlegte, und alle alten Lieder preisen mit vollstem Rechte solche Helden. Noch im Mittelalter kämpften Ritter und Freie mannhaft mit Auer und Wisent. Jene pflegten zu Rosse, diese zu Fuße zu jagen, beide die Lanze als Angriffswaffe zu wählen. Immer gingen die Jäger selbander aus: der eine näherte sich dem wüthenden Thiere und suchte ihm einen tödtlichen Stoß beizubringen, der andere bemühte sich, durch Schreien und Schwenken rother Tücher dessen Aufmerksamkeit von dem Angreifer ab- und auf sich zu lenken, bis jener, vielleicht noch durch die Hunde unterstützt, ihm seine Lanze in den Leib stoßen konnte. Nach Ueberlieferungen, an denen insbesondere die Jagdgeschichte Ungarns und Siebenbürgens reich ist, bildete die Wisentjagd das mannhafteste und erregendste Vergnügen der ritterlichen Magyaren und Edlen der benachbarten Länder, wogegen das Volk, um des gewaltigen Thieres Herr zu werden, auf seinem Wechsel Fallgruben errichtete und den in die tückisch verborgene Tiefe gestürzten Wisent einfach erschlug. Zur Zeit der früheren ungarischen Könige nahm die Wisentjagd unter dem damals üblichen Waidwerke die hervorragendste Stelle ein, blieb daher auch dem Könige, beziehentlich dem regierenden Fürsten vorbehalten. Ueber solche Jagden liegen mehrere Berichte vor. »In demselbigen Jahre (1534)«, heißt es in einer deutschen Handschrift, »haben die wilden Ochsen, so in den Gebirgen von Girgaw (Gyergyo im Szeklerlande) scharenweis hausen und von die Zeckeln (Schecklern) ›Begyin‹ oder ›Beögin‹ genannt, viel Schaden gethan, auch Menschen und Weiber, so in Wald gangen, gemordet mit den Füßen. Darumb hat der Majlath Istvan nach alter Gewohnheit und Gebrauch der alten Woywoden auf Fabianistag grosse Jagd halten lassen, allwo viel Herren und Edelleut zusammenkumben seynd und auch viel und wacker gezechet worden.« Hundert Jahre später jagte man noch mit ebensoviel Gepränge. »Aus besonderer Güte und Gnade Gottes«, so schreibt Georg Rakoczy I., Fürst von Siebenbürgen, an Paul Bornemisser im Jahre 1643, »ist das Bündnis zwischen Uns und den Königen von Schweden und Frankreich zum Heile Unseres geliebten Vaterlandes zu Stande gekommen. Um ein Zeichen Unserer Erkenntlichkeit den Uns wohlwollenden Gesandten obbenannter Mächte zu geben, ordneten Wir denselben zu Ehren eine bei Uns übliche Wisentjagd an, die in Unseren Csiker- und Gyergyoergebirgen am 27. laufenden Monats abgehalten wird. Unser gnädiger Wunsch ist, daß Euer Liebden an dieser Jagd theilnehmen, weshalb Wir Euer Liebden den Auftrag ertheilen, am 23. laufenden Monats auf dem von Uns bestimmten Versammlungsplatze in Unserer Gyergyoerburg, allwo auch Wir mit den Gesandten und vielen hochgestellten Edelherren erscheinen werden, pünktlich einzutreffen sammt ihrem Jagdgefolge, insbesondere den zur Wisentjagd nöthigen Grubengräbern, sowie Hatzleuten, Jagdhunden und Gewehren.« Im Walde von Bialowies erschienen die Herrscher früherer Jahrhunderte mit zahlreichem Gefolge, boten alle Beamten des Waldes auf, zwangen die umwohnenden Bauern zu Treiberdiensten und bewegten somit eine Mannschaft von zwei- bis dreitausend Köpfen, welche ihnen die Wisente nach den Orten treiben mußte, wo sie auf sicheren Kanzeln sich angestellt hatten. Von einer der glänzendsten Jagden, welche König August III. im Jahre 1752 abhielt, berichtet heute noch eine sechs Meter hohe Spitzsäule aus weißem Sandstein in deutscher und polnischer Sprache. An dem einen Tage wurden zweiundvierzig Wisente, dreizehn Elenthiere und zwei Rehe erlegt. Die Königin allein schoß zwanzig Wisente nieder, ohne auch nur ein einziges Mal zu fehlen, und hatte dabei noch immer Zeit zum Lesen eines Romans. Die Schützen waren den Thieren, welche niedergemeuchelt wurden, unerreichbar. Um einen Begriff von der Großartigkeit der damaligen Jagd zu geben, will ich bloß noch anführen, daß auf des Königs Befehl schon Monate vor derselben viele tausende von Leibeigenen aufgeboten wurden, um das Wild von allen Seiten des damals noch viel bedeutenderen Waldes nach der zur Jagd bestimmten Abtheilung hinzutreiben. Dort wurden die scheuen Thiere eingelappt und zuerst durch drei Meter hohe Netze, später durch ein noch höheres Holzgatter umfriedigt. Dicht neben dem Gatter war ein Söller errichtet worden, auf welchem der König mit den vornehmsten seiner Gäste Platz nahm. Etwa zwanzig Schritte von diesem Söller entfernt war eine Lücke in den Umhegungen gelassen, durch welche alles hier eingeschlossene Wild getrieben wurde. Sobald ein Wisent stürzte, bliesen die Jagdgehiilfen auf ihren Halbhörnern. Nach der Jagd besichtigte der Hof unter Hörnerklang die gefallenen Stücke, deren Wildpret unter die umwohnendem Bauern vertheilt wurde. Dann ließ der König das erwähnte Denkmal setzen, zum ewigen Gedächtnis seiner ritterlichen Thaten.
Am 18. und 19. Oktober 1860 stellte der Kaiser von Rußland eine Jagd an. Der Kaiser selbst schoß sechs Wisentstiere und ein Kalb, zwei Elen-, sechs Damhirsche, drei Rehe, vier Wölfe, einen Dachs, einen Fuchs und einen Hasen. Der Großherzog von Weimar und die Prinzen Karl und Albrecht von Preußen erlegten acht andere Wisente. Die Jagd wurde in einem besonderen Werke in russischer Sprache ausführlich beschrieben.
Ueber den Fang der Thiere berichtet Dimitri Dolmatoff, Aufseher der kaiserlichen Wälder der Provinz Grodno. Der Kaiser von Rußland hatte der Königin Victoria zwei lebende Wisente für den Thiergarten in London versprochen und gab deshalb Befehl, einige derselben zu fangen. Die Jagd wurde auf den 20. Juli festgesetzt. Mit Tagesanbruch versammelten sich dreihundert Treiber und achtzig von den Jägern des Waldes, deren Flinten bloß mit Pulver geladen waren, und suchten zunächst die nächtliche Fährte der Wisente. Es war ein heiterer, windstiller Tag. Dreihundertundachzig Menschen umstellten in aller Stille das einsame Thal, in welchem die Wisentherde sich aufhielt. Schritt für Schritt und mit der größten Ruhe drang man in das Dickicht ein. Als die Grenze des Thales erreicht wurde, erblickten Dolmatoff und sein Begleiter Graf Kisseleff, welcher den kaiserlichen Befehl überbracht hatte, die auf einem Hügel gelagerte Wisentherde. Die Kälber sprangen, den Sand mit ihren flinken Füßen hoch aufwerfend, munter umher, kehrten bisweilen zu ihren Müttern zurück, rieben sich an ihnen, leckten sie und hüpften wieder ebenso munter davon. Ein Stoß ins Horn endete urplötzlich dies Stillleben. Schreckerfüllt sprang die Herde auf und schien durch Gehör und Gesicht den Feind erkundschaften zu wollen. Die Kälber schmiegten sich furchtsam an ihre Mütter. Als das Gebell der Hunde erschallte, ordnete sich die Herde eiligst in der gewohnten Weise. Die Kälber wurden vorangestellt, und der ganze Trupp bildete die Nachhut, erstere vor einem Angriffe der Hunde schützend.
Als die Herde an die Treiberlinie kam, wurde sie mit gellendem Geschrei und blinden Schüssen empfangen. Die alten Wisente durchbrachen wüthend die Treiberlinie und stürzten weiter, ohne sich um die Menschen, welche sich ängstlich gegen die Bäume drückten, viel zu kümmern. Doch war man so glücklich, jetzt schon zwei Junge zu fangen. Ein etwa drei Monate altes Kalb wurde ohne große Mühe gebändigt, ein anderes, etwa fünfzehn Monate altes, warf acht Mann zu Boden und entfloh, ward aber von den Hunden verfolgt und im Garten eines Försters zum zweitenmal gefangen. Vier andere Kälber, ein Männchen und drei Weibchen, wurden später erhascht. Eins der weiblichen Jungen war erst einige Tage alt. Man brachte es sogleich zu einer Kuh, deren graue Farbe dem Felle des Wisent entsprach. Die Kuh nahm sich des wilden, bärtigen Jungen mit vieler Zärtlichkeit an, und das Kalb saugte zum allgemeinen Erstaunen vortrefflich, starb aber leider nach sechs Tagen an einer Geschwulst im Nacken, an welcher es schon, als es gefangen wurde, gelitten hatte. Die übrigen Kälber nahmen am ersten Tage ihrer Gefangenschaft keine Nahrung zu sich, und nur das drei Monate alte Junge begann am folgenden Tage an der Hauskuh zu saugen, war auch sehr munter und lebendig. Alle anderen, mit Ausnahme des älteren, schlürften zuerst die Milch aus der Hand eines Mannes, und tranken sie dann begierig aus einem Eimer. Nach kurzer Frist verlor sich ihr wilder Blick; sie legten ihre Scheu ab und zeigten sich aufgeräumt und muthwillig. Wenn man sie aus dem Stalle in den geräumigen Hof gelassen hatte, freute sich jedermann über die Schnelligkeit ihrer Bewegungen. Sie sprangen mit der Leichtigkeit einer Ziege umher, spielten aus freiem Antriebe mit den Kälbern zahmer Kühe, kämpften mit ihnen und schienen, obwohl stärker, ihnen großmüthig den Sieg zu überlassen. Der männliche, fünfzehn Monate alte Wisent behielt längere Zeit seinen wilden, drohenden Blick, erzürnte sich, sobald ihm jemand nahte, schüttelte mit dem Kopfe, leckte mit der Zunge und wies seine Hörner; aber nach zwei Monaten war auch er ziemlich zahm und bekundete Neigung zu dem Manne, welcher ihn bisher gefüttert hatte. Von nun an konnte man ihn freier halten.
Man bemerkte an allen diesen Thieren, daß sie gern mit den Füßen auf dem Boden scharrten, Erde in die Höhe warfen und sich wie Pferde bäumten. Sobald sie aus dem Stalle kamen, wurden sie muthig, erhoben stolz den Kopf, öffneten ihre Nüstern, schnaubten und machten die lustigsten Sprünge. Sie empfanden es schwer, daß sie eingesperrt waren, und blickten sehnsuchtsvoll bald nach den ungeheuren Waldungen, bald nach den grünen Wiesen; ja es schien, als ob sie Heimweh hätten oder sich ihre ungezwungene Freiheit zurückwünschten; denn immer kehrten sie gesenkten Hauptes und traurig in den Stall zurück. Gegen ihren Pfleger bewiesen sie warme Zuneigung. Sie sahen ihm nach, wenn er ging, begrüßten ihn durch Entgegenkommen, wenn er sich nahte, scheuerten sich an ihm, leckten ihm die Hände und hörten auf seine Stimme.
Die sieben Gefangenen waren an zwei von einander entfernten Orten eingestellt worden. Die beiden auf der ersten Jagd gefangenen Männchen vertrugen das ihnen gereichte Futter sehr gut; die übrigen, welche nur Milch tranken, aber nicht saugten, litten eine Woche lang am Durchfall, wahrscheinlich weil die Milch, welche von fern herbeigeschafft werden mußte, nicht immer frisch und süß war; denn ihr Unwohlsein verlor sich, als sie warme Milch vom Euter der Kuh weg erhielten. Beide Stierkälber leckten Salz, die übrigen verschmähten es wie der ältere Stier die Milch. Dieser bekam daher vom ersten Tage an Hafer mit Häcksel gemengt, Heu von den Waldwiesen, Rinden und Blätter der Esche und verschiedene Waldkräuter. Als die übrigen Kälber nicht mehr mit Milch genährt wurden, erhielten sie dasselbe Futter. Sie tranken täglich mehrmals Wasser, die jüngeren Thiere aber erst, nachdem es mit Milch versetzt worden war. Das reichliche und abwechselnde Futter, ein Stall, welcher sie im Winter vor der Kälte und im Sommer vor den Mückenstichen schützte, war ihrem Gedeihen sehr förderlich, und sie wuchsen schnell heran. Ihren Hunger oder Durst gaben sie durch ein schweineähnliches Grunzen zu erkennen.
Später brachte man die schon halb gezähmten Thiere von Bialowies nach Grodno, zwanzig deutsche Meilen weit. Das für St. Petersburg bestimmte Paar, zwei Stiere, befanden sich in einem länglichen Käfige, welcher mit Stroh bedeckt und in zwei Abtheilungen geschieden war, so daß sich die Thiere niederlegen konnten, ohne sich von einander zu entfernen. Der neue Käfig und das Schaukeln des Wagens schien sie mit Furcht zu erfüllen. Sie verhielten sich zwar ruhig, fraßen aber in den ersten vierundzwanzig Stunden nicht, legten sich auch nicht nieder. Schon am zweiten Tage betrugen sie sich wie gewöhnlich. Das für London bestimmte Paar ward in einem geräumigen und bedeckten Käfige fortgeschafft. Der Stier zeigte sich während der ganzen Reise aufs höchste verstimmt und brüllte oft und ingrimmig. Zu Grodno brachte man beide Paare in einen geräumigen Stall und trennte sie hier anfänglich nur durch Querbalken; sie fielen aber so wüthend über einander her, daß man sie trennen mußte; denn die Scheidewände hielten sie durchaus nicht ab: sie zertrümmerten diese mit wenigen Stößen. Sonderbarerweise griffen die drei Stiere gleichzeitig die einzige Kuh an und würden sie ohne Hinzukommen der Wärter getödtet haben. Erst allmählich gewöhnten sie sich an einander.
Ich sah die Wisente zuerst im Thiergarten zu Schönbrunn. Sie bewohnten dort seit mehreren Jahren einen Stall, vor welchem sich ein mit dicken Stämmen umhegter Hof befand. Sehr starke, metertief im Boden steckende und noch außerdem durch Strebepfeiler befestigte Eichenpfosten trugen die Querbalken der Umhegung. Als ich die Thiere besuchte, hatte die Kuh ein noch saugendes Kalb, und ihre Besorgnis für dasselbe drückte sich unverkennbar in ihrem ganzen Wesen aus. Um die seltenen Geschöpfe so gut als möglich zu sehen, trat ich etwas näher an die Umhegung, als dies ihr lieb sein mochte; denn plötzlich senkte sie den Kopf, schoß brüllend, die blaue Zunge lang aus dem Halse streckend, auf mich los und rannte mit ihrem Kopfe derartig gegen die Balken an, daß selbst die eichenen Stämme zitterten. Ein anderes Geschöpf würde sich bei solchem Stoße den Schädel in Stücke zertrümmert haben: der Wisent wiederholte seine Kraftanstrengungen drei- bis viermal hintereinander, ohne sich im geringsten zu schädigen.
Später habe ich mehrere andere in verschiedenen Thiergärten gesehen, beobachtet und Erkundigungen über sie eingezogen. Sie waren und sind sich alle gleich. So leutselig sie sich in der Jugend betragen, mit zunehmendem Alter bricht ihre rasende Wildheit durch, und nicht einmal die Wärter dürfen ihnen trauen. Sie lassen sich zwar auf dem Kopfe krauen und nehmen ihren Pflegern das Futter aus der Hand; dieselben müssen sich aber doch fortwährend aufs äußerste in Acht nehmen, um dem wie Strohfeuer auflodernden Zorn der Wisente zu entgehen. Störrisch und unlenksam bleiben sie immer, obwohl sie nach und nach mit ihren Bekannten bis zu einem gewissen Grade freundlich verkehren. Jede Veränderung ihrer Lage und Gewohnheiten aber wandelt ihre behagliche Stimmung sofort in das Gegentheil um. Es erfordert unendliche Geduld, einen durch mehrere Jahre in der Gefangenschaft gehaltenen Wisent an einen anderen Ort zu bringen. Eine Kuh, welche in einen benachbarten Raum geschafft werden sollte, wurde durch zwanzig starke Männer an dicken Seilen, die ihr um den Kopf gebunden waren, festgehalten: eine einzige Bewegung des Thieres aber war genügend, alle Leute mit einem Male zu Boden zu werfen. Jedenfalls werden die Wisente im eingeschlossenen Raume, auch wenn sie tagtäglich mit Menschen zusammenkommen, in der Regel nicht zahmer als im Freien. Die Wisente, welche man zwischen Taplaken und Leuküschken in Preußen hegte und fütterte, fielen nicht nur niemals einen Menschen an, sondern wurden zuletzt so dreist, daß sie den Leuten nachliefen und sie um Futter bettelten, weil sie gewöhnt worden waren, von den Vorübergehenden fast immer etwas zu erhalten. Roth soll auch bei ihnen heftigen Zorn erregen, ein in schreiende Farben gekleideter Mensch daher mehr oder weniger gefährdet sein. Und doch scheint es möglich zu sein, die unholden Thiere bis zu einem gewissen Grade unter die Botmäßigkeit des Menschen zu beugen. »Mein Vater«, schreibt mir Lázár ferner, »erzählte als Familienüberlieferung, daß Graf Franz Lázár im Jahre 1740 bei Gelegenheit eines in Hermannstadt tagenden Landtages in einem mit Wisente bespannten Wagen umherfuhr. Besagter Graf hatte die Thiere in seinen Waldungen in Gyergyo einfangen und zähmen, auch durch reiche Verzierung und Vergoldung der Hörner so herausputzen lassen, daß das absonderliche Gespann allgemeine Bewunderung erregte.«
In unseren Thiergärten halten die Wisente bei einigermaßen geeigneter Pflege vortrefflich aus, schreiten auch ohne Umstände zur Fortpflanzung, vermehren sich sogar stärker als im Freien. Nach den Beobachtungen von Schöpff beträgt ihre Trächtigkeitsdauer zweihundertundsiebzig bis zweihundertvierundsiebzig Tage. Die Mutter behandelt das neugeborene Junge mit größter Zärtlichkeit, falls dasselbe nicht von menschlicher Hand berührt wird, wogegen sie in die größte Wuth geräth und diese an dem harmlosen Kälbchen ausläßt, wenn sich ein Wärter wider ihren Willen mit letzterem zu schaffen macht. Der Stier muß stets von der trächtigen Kuh getrennt werden, weil ein Familienleben in engem Raume bei diesen Thieren nicht durchzuführen ist. Ein am 22. Mai 1865 in Dresden geborenes Wisentkalb wurde von seinem Erzeuger sofort aufgegabelt und durch die Einfriedigung des Geheges geschleudert. Hier kam es wieder auf die Beine zu stehen, und man brachte es nunmehr in den Stall zu der inzwischen von dem Stiere getrennten Mutter; diese aber, nachdem sie es berochen und wahrscheinlich gefunden hatte, daß es von menschlicher Hand berührt worden war, warf es sofort in die Höhe und stampfte es zu Tode. Schon mehrere Wochen vor der Geburt zeigt sich auch die sanfteste Wisentkuh wild und bösartig, und wenn sie geboren und ihr Kalb angenommen hat, benimmt sie sich regelmäßig so, wie ich oben geschildert habe.
Mehrere Naturforscher haben die Ansicht verfochten, daß der Wisent einen gewissen Antheil an der Entstehung einzelner Rassen unseres Rindes habe; nach den neueren Erfahrungen scheint jedoch das Gegentheil erwiesen zu sein. Zwischen Wisent und Hausrind besteht ein heftiger Abscheu, und selbst wenn man, wie es im Bialowieser Walde geschehen ist, jung eingefangene Wisentkälber stets mit zahmen Rindern zusammenhält, ändert sich dieses Verhältnis in der Regel nicht. Als man versuchte, eine junge Wisentkuh mit einem Hausstiere zur Paarung zu bringen und diesen dicht neben ihr einstellte, durchbrach sie wüthend den Verschlag, welcher sie von ihm trennte, fiel ihn rasend an und trieb ihn mit Wuth und Kraft aus dem Stalle, ohne daß der seinerseits nun ebenfalls gereizte Stier Gelegenheit gefunden hätte, sich ihr zu widersetzen. Und doch liegen auch in dieser Beziehung Belege für das Gegentheil vor. »Im Csiterkreise«, schreibt Franz Sulzer in einem, im Jahre 1781 erschienenen Werke, »verliebte sich ein Wisentstier in eine mit der Herde täglich zur Weide gehenden Kuh und wurde mit dieser so vertraut, daß er zu nicht geringem Schrecken der Dorfbewohner allabendlich derselben nicht allein das Geleite bis zur Hausthür gab, sondern auch in ihren Stall eindrang. Schließlich gewöhnten sich die Leute an dieses zarte Verhältnis und trieben allmorgendlich den Wisentstier mit seiner Liebsten zur Weide.«
Ueber den Schaden und Nutzen des Wisent ist jetzt kaum noch zu reden. Im Bialowieser Walde kommen die Zerstörungen, welche dieses Wild, um sich zu nähren, oder aus Uebermuth anrichtet, nicht in Anschlag, der Nutzen aber ebensowenig. Das Fleisch wird gerühmt; sein Geschmack soll zwischen Rindfleisch und Hirschwildpret in der Mitte liegen und namentlich das Fleisch von Kühen und Kälbern sehr gut sein. Die Polen betrachteten das eingesalzene Wisentfleisch als einen vorzüglichen Leckerbissen und benutzten es zu Geschenken an fürstliche Höfe. Das Fell gibt ein starkes und dauerhaftes, aber lockeres und schwammiges Leder und wird gegenwärtig höchstens verwendet, um Riemen und Stränge daraus zu schneiden. Die Hörner und Hufe wurden zu allerlei Gegenständen verarbeitet, denen man eine gewisse schützende Kraft zuschrieb. Unsere Vorfahren verfertigten hauptsächlich Trinkgeschirre aus den schönen festen Hörnern; die Kaukasier gebrauchen solche heute noch anstatt der Weingläser. Bei einem Gastmahle, welches ein kaukasischer Fürst dem General Rosen zu Ehren gab, dienten fünfzig bis siebzig mit Silber ausgelegte Wisenthörner als Trinkbecher.
Dasselbe Schicksal, welches sich am Wisent nahezu erfüllt hat, steht seinem einzigen Verwandten, dem Bison, bevor. Auch er verbreitete sich früher fast über die ganze Nordhälfte der westlichen Erde und ist bereits in vielen Ländern gänzlich vernichtet, wird auch von Jahr zu Jahr weiter zurückgetrieben und mehr und mehr beschränkt. Der Weiße und der Indianer theilen sich mit dem Wolfe in Verfolgung des Thieres, und der Wolf ist von diesen drei schlimmen Feinden der mindest gefährliche, vertilgt wenigstens nicht mehr, als er zu seiner Nahrung bedarf, wogegen der Mensch dem Bison rücksichtslos entgegentritt und innerhalb seiner Herden ungleich größere Verheerungen anrichtet, als nothwendig wäre. Noch durchziehen Millionen der stolzen Thiere die ungeheuren Steppen im Westen Nordamerikas, aber es bleichen schon gegenwärtig tausendmal mehr Schädel erlegter Bisons in der Prairie, als heutigen Tages noch »Büffel« in ihr leben. Als die Europäer ihre Niederlassungen in Nordamerika zu gründen begannen, fand man den Bison an den Küsten des Atlantischen Weltmeeres, allein schon zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts sah man es als eine denkwürdige Begebenheit an, daß ein Bison am Cap Fear River erlegt wurde. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts war der Bison zahlreich in Kentucky, im Westen von Pennsylvanien und in Ohio; jetzt findet er sich nur noch im oberen Laufe des Missouri und westlich vom Mississippi, vom Großen Sklavensee, unter dem 60. Grade nördlicher Breite, bis zum Rio Grande. Sonst war gedachter See seine Grenze nach Norden hin und das Felsgebirge die Mauer, welche ihn von dem Nordwesten schied; jetzt ist er bereits bis zum 65. Grad nördlicher Breite vorgedrungen, wie ein Verfolgter, welcher Schutz in Einöden sucht, und ebenso hat er sich über das Gebirge einen Weg gebahnt, um in den nordwestlichen Ebenen Zuflucht zu finden. Auch diese Fluchtversuche werden ihn von seinem endlichen Schicksale nicht erretten können. Indianer und Weiße sitzen ihm beständig auf dem Nacken und das Morden, die Vernichtung gehen unaufhaltsam ihren Gang.

Bison (Bos americanus). 1/25 natürl. Größe.
Der Bison oder »Büffel« der Amerikaner (Bos americanus, Bison und Bonassus americanus) ist unter den nordamerikanischen Thieren dasselbe, was der Wisent in Europa: der Riese aller dortigen Landsäugethiere. Die Länge des Bullen beträgt 2,6 bis 2,9 Meter, ungerechnet des 50, mit den Haaren aber 65 Centimeter langen Schwanzes, die Höhe am Widerrist 2 Meter, die Kreuzhöhe 1,7 Meter; das Gewicht schwankt zwischen sechshundert und tausend Kilogramm. Die Kuh erreicht etwa vier Fünftel der Größe des Stieres. Die Unterschiede zwischen Bison und Wisent, mit welchem einzelne Naturforscher jenen als gleichartig erklären wollten, sind größer als bei anderen gleich nahe verwandten Rindern. Der Kopf des Bison ist sehr groß, verhältnismäßig viel größer und breitstirniger, auch plumper und schwerer, der Nasenrücken stärker gewölbt, das Ohr länger als beim Wisent, das blöde, tief dunkelbraune Auge, dessen Weiß getrübt erscheint, mäßig groß, das Nasenloch sehr schief gestellt, länglich eirund, in der Mitte oben vor-, unten ausgebuchtet; der kurze, hohe und schmale Hals steigt steil an zu dem unförmlich erhöhtem Widerriste, von welchem ab die Rückenlinie bis zur Wurzel des kurzen dicken Schwanzes stark abfällt, ebenso wie sich der in der Brustgegend verbreiterte Leib nach hinten zu außerordentlich verschmächtigt; die Beine sind verhältnismäßig kurz und sehr schlank, die Hufe und Afterhufe klein und rund. Somit müssen die Größe des Kopfes, die ungewöhnliche Entwickelung des Brusttheiles bei auffallender Verschmächtigung des Hintertheiles und die Kürze des dicken Schwanzes wie der schlanken Beine als bezeichnende Merkmale des Thieres gelten. Die Hörner, welche bedeutend stärker, an der Wurzel dicker, an der Spitze stumpfer, in ihrer Biegung einfacher als die des Wisent sind, biegen sich nach hinten, außen und oben, ohne daß die Spitzen wieder erheblich sich nähern. Das Haarkleid ähnelt dem des Wisent. Kopf, Hals, Schultern, Vorderleib und Vorderschenkel, Vordertheil der Hinterschenkel und Schwanzspitze sind lang, die Schultertheile mähnig, Kinn und Unterhals bartähnlich, Stirn- und Hinterkopf kraus, filzig behaart; und alle übrigen Leibestheile tragen nur ein kurzes, dichtes Haarkleid. Im Winter verlängert sich das Haar bedeutend; mit Beginn des Frühlings wird der Winterpelz in großen Flocken abgestoßen. Mit dieser Veränderung steht die Färbung im Einklange. Sie ist eigentlich ein sehr gleichmäßiges Graubraun, welches in der Mähne, d. h. also an Vorderkopf, Stirn, Hals und Wamme dunkler wird, nämlich in Schwarzbrann übergeht. Das abgestoßene Haar verbleicht und nimmt dann eine graulich gelbbraune Färbung an. Hörner und Hufe sowie die nackte Muffel sind glänzend schwarz. Bezeichnend für den Stier sind nach der Beschreibung des Prinzen von Wied zwei dicht neben einander, jederseits der Brunstruthe liegende gepaarte Zitzen. Weiße und weiß gefleckte Spielarten sind beobachtet worden, kommen aber selten vor.
Innerhalb des oben angegebenen Verbreitungsgebietes tritt der Bison noch immer in außerordentlicher Anzahl auf. Besonders häufig ist er in Neumejiko und Arizona, aber auch in anderen Weststaaten keineswegs selten. Im Gegensatze zu dem Wisent, einem entschiedenen Waldbewohner, muß er als ein Charakterthier derjenigen Steppengebiete angesehen werden, welche die Amerikaner Prairien nennen. »Unter diesen«, so schildert Finsch, »stellt man sich bei uns gewöhnlich Ebenen vor, welche mit dem üppigsten, mannshohen Graswuchse, gemischt mit einer Fülle der verschiedenartigsten Blumen, bedeckt sind. Ein solches durch Baum- und Gehölzgruppen abwechselndes Bild gewährt die Prairie nur an ihren Ausläufern und da, wo Wasserausflüsse eine reiche Pflanzenwelt begünstigen, wogegen sie im übrigen ein durchaus verschiedenes Gepräge zeigt. Anstatt der erwarteten unbegrenzten ebenen Fläche finden wir sanftwellige Hochländer, welche vom Flusse nach den Bergen in einer Reihe hochaufsteigender, mehr oder weniger größerer Wogen sich erheben, und in welche durch die aus schmelzendem Schnee und Eis gebildeten Gewässer oft steil und tief abfallende Rinnsale gewühlt werden. Man glaubt den Gipfel oder Kamm einer solchen Erhebung, welche kaum als eine unbedeutende Hügelkette erscheint, in höchstens einer Viertelstunde zu erreichen; aber das Auge hat auf diesen Flächen, wo eine ungemein reine und dünne Luft die Fernsicht in ungeahnter Weise begünstigt, Entfernungen noch nicht abschätzen gelernt, und man ist froh, vielleicht erst nach einer Stunde an dem erwünschten Ziele angelangt zu sein. Nichts bietet sich dem Auge als Anhaltspunkt; nur da, wo reiche Bäche Tümpel stehenden Wassers gebildet haben, finden sich Weiden und Sträucher, unter denen sich zuweilen, als weithin sichtbare Wahrzeichen, einige Bäume mächtig erheben. Im übrigen steht die Pflanzenwelt mit der Einförmigkeit der Landschaft im vollsten Einklange. Zwar sind Blumen, unter ihnen namentlich die reizenden goldgelben Zwergsonnenblumen und weiter südlich zwergartige, niedrig dahinkriechende Kakteen mit haarigen gelben und rothen Blüten häufig; aber die Charakterpflanze bleibt doch stets das eigenthümliche »Büffelgras« eine kaum mehr als 3 Centim. erreichende Grasart, welche daher keinen ununterbrochenen Rasenteppich im Sinne unserer Wiesen bildet. Dieses unscheinbare Gras ist das Lieblingsfutter der Bisonten und ernährt fast ausschließlich die Millionen, welche jetzt noch auf den Prairien weiden, und zwar unbekümmert um den Menschen und seine neueren Einrichtungen. Sowohl die Bisonten wie die bei weitem scheueren Gabelböcke haben sich an die Eisenbahn und den Anblick des heranbrausenden Zuges längst gewöhnt und lassen denselben zuweilen so nahe kommen, daß heißspornige Reisende einen Schuß auf sie abgeben können.«
Der Bison ist, wie es scheint, noch geselliger als die übrigen Rinder; jedoch bilden die Massen, welche man auf ein und derselben Ebene erblickt, nicht eine einzige Herde, sondern zerfallen in zahllose kleinere Gesellschaften. Rücksichtlich der verschiedenen Geschlechter vereinigt sich das Thier überhaupt nur in gewissen Monaten, zur Brunstzeit nämlich; den übrigen Theil des Jahres hindurch bilden die Stiere für sich abgesonderte Trupps, die Kühe mit ihren noch nicht zeugungsfähigen Kälbern andere. Die Gesammtheit bleibt übrigens in einer gewissen Verbindung: eine Herde zieht der anderen nach. Im Sommer zerstreuen sich diese in den weiten Ebenen, im Winter vereinigen sie sich mehr und suchen dann die waldigen Gegenden auf. Dann findet man sie auf baumreichen Inseln der Ströme und Seen oder längs deren waldigen Ufern in zahlloser Menge. Alljährlich unternehmen sie mit größerer oder geringerer Regelmäßigkeit eine Wanderung. Vom Juli an ziehen sie südwärts, mit Beginn des Frühjahrs kehren sie wieder nach Norden zurück und zwar in kleinere Trupps oder Herden aufgelöst. Diese Wanderungen dehnen sie von Kanada bis zu den Küstenländern des Mejikanischen Golfs und von Missouri bis zu den Felsengebirgen aus. Demungeachtet findet man allerorten, wo sie hausen, einzelne zurückgebliebene, welche sich dem großen Strome nicht angeschlossen haben. Dies sind gewöhnlich alte Stiere, schon zu steif und zu träge, um den Heersäulen zu folgen, vielleicht auch zu bösartig, als daß sie von der jüngeren Gesellschaft geduldet würden, und deshalb zum Einsiedlerleben gezwungen. Die wandernden Herden sind auch dann noch kenntlich, wenn man die Büffel selbst nicht wahrnimmt; denn ebenso wie Meuten magerer Wölfe folgen ihnen Geier und Adler und Raben in den Lüften, die einen wie die anderen sicherer Beute gewiß. Es scheint, als ob die Büffel bestimmte Straßen auf ihrer Wanderung einhalten. Da, wo sie sich fest angesiedelt haben, wechseln sie mit großer Regelmäßigkeit hin und her, namentlich von den saftigen Weideplätzen zu den Flüssen, welche sie besuchen, um sich zu tränken oder badend zu kühlen, und auf ihren Wanderungen treten sie sich jene Wege aus, die unter dem Namen »Büffelpfade« allen bekannt geworden sind, welche die Prairien durchreisten. Die Büffelpfade führen meist in gerader Richtung fort, hunderte neben einander, überschreiten Gebirgsbäche und Flüsse da, wo die Ufer zum Ein- und Aussteigen bequem sind, und ziehen sich viele, viele Meilen weit durch die Steppen dahin.
»Ueber die zeitweiligen Wanderungen«, so fährt Finsch fort, »besitzen wir noch nicht so genaue Kunde, als zu wünschen wäre. Gewiß ist, daß dieselben mit der Jahreszeit und mit dem Futterreichthume im innigsten Zusammenhänge stehen, und daß hierdurch nach den jeweiligen Verhältnissen die Richtung, das kürzere oder längere Verweilen an einer Oertlichkeit, das raschere oder langsamere Vorrücken bedingt wird. Auch der Mensch mit seinen Verfolgungen und Prairiebränden übt einen gewissen Einfluß aus, und namentlich sind es die letzteren, welche die Bisonherden über das ausgebrannte Land nach neuen Weiden treiben. Sind diese günstig und von genügender Ausdehnung, so sammeln sich die anfangs in kleineren Trupps, zu zehn bis fünfzig, ziehenden Bisonten zu unermeßlichen Herden, welche an Anzahl hinter denen der Gnus, Blaßböcke, Quaggas, Straußen etc., wie sie in Südafrika vorkommen, nicht zurückstehen.« Möllhausen sah im Jahre 1851 auf den Prairien westlich des Missouri hunderttausende von Bisonten, in solchen Massen, daß die Ebene, soweit sein Blick reichte, schwarz erschien und ein Ueberschlag der Anzahl dieser Thiere nur gewonnen werden konnte, indem man den Flächenraum, welchen sie bedeckten, nach Geviertmeilen abschätzte. Fröbel zog im Jahre 1858 mit einer Wagenkarawane von Missouri nach Mejiko und reiste acht Tage lang unaufhörlich zwischen Büffelherden dahin. »In Rotten, in Haufen, in Massen, in Heeren«, schildert Hepworth Dixon, »donnern die schwarzen zottigen Thiere vor uns her, manchmal von Norden nach Süden, manchmal von Süden nach Norden; vierzig Stunden nach einander haben wir dieselben stets im Gesichte gehabt, tausende auf tausende, zehntausende auf zehntausende, eine unzählbare Masse ungezähmter Thiere, deren Fleisch, wie wir glauben wollten, hinreicht, die Wigwams der Arrapahus, Sioux, Cheyennen und Comanchen bis in die Ewigkeit zu versorgen.« Wie Finsch ferner bemerkt, folgert Schlagintweit aus dem Umstande, daß er im Mai und Juni 1869 längs der Pacificbahn keine Bisonten zu sehen bekam, sehr mit Unrecht das bereits gänzliche Verschwinden dieses mächtigen Thieres infolge des Baues von Eisenbahnen; denn die frühere Art, durch die Prairien zu reisen, bei welcher Gelegenheit oft hunderte von Fuhrleuten und Auswanderern wochenlang sich umhertrieben, begierig, ihre Fleischtöpfe mit kräftigen Büffelzungen und fleischigen Lendenstückchen zu füllen, hat ohne Zweifel unter den Herden eine größere Vernichtung angerichtet, als dies die Eisenbahnen im Stande sind. »Während wir«, bemerkt Finsch, »anfangs Oktober auf der Hinreise nach Denver kaum mehr als einen Bison zu sehen bekamen, obgleich sie in der Nähe mancher Haltestellen, z. B. Buffalo, ziemlich häufig waren, trafen wir sie auf der Rückreise einen Monat später schon bei Kit Carson in Colorado, obwohl die Hauptzüge laut Zeitungsberichten bereits am Arkansas und Kanadienflusse eingetroffen waren. Auf unseren Jagden sind wir ihnen allerdings niemals in solchen Massen begegnet, wie sie Dixon gesehen; aber nach glaubwürdigen Zeugnissen ist seine Schilderung noch heute zutreffend.
»Den von den Leitstieren eingeschlagenen Wegen folgt die ganze Herde unter allen Umständen nach, sei es über Flüsse oder steile Abhänge hinab. Der Schienenweg macht sie gewöhnlich stutzen, die ersten Ankömmlinge bleiben stehen und beriechen das Geleis, gehen dann aber ohne Zögern hinüber und geben damit ein Zeichen für die nachfolgenden, ein gleiches zu thun. Auch die längs der Bahnstrecke zahlreich errichteten hölzernen Schneeschutzwehren beunruhigen die Bisonten nicht; sie benutzen diese wie die Telegraphenstangen, um sich daran zu scheuern. Obwohl sie menschliche Niederlassungen vermeiden, scheuen sie sich vor den einzelnen abgelegenen Prairiehäusern keineswegs und kommen sehr häufig in die Nähe derselben. Unser Wirt in Monotony, Vorsteher einer einsamen Wasserstelle an der Kansasbahn, schoß nur solche Thiere, welche sich ganz in der Nähe zeigten, um die Fortschaffung der todten Riesen zu erleichtern, und versorgte dennoch sein Haus für das ganze Jahr mit Büffelfleisch. An einem Morgen hatte er, noch ehe wir mit dem Frühstück fertig waren, schon drei gewaltige Bullen keine hundertundfünfzig Schritte von seinem Hause entfernt, erlegt. Durch ihn erfuhren wir, daß das Hauptheer der Bisonten im November südlich vorüberziehe; über den Rückzug im Frühjahr aber wußte auch er uns keinen Aufschluß zu geben, weil derselbe in viel kleineren Trupps erfolgt und weit weniger bemerkbar ist. Wir selbst vermochten nicht, uns ein Urtheil zu bilden, da die Fährten auf den bekannten Büffelpfaden, welche die Prairie zu hunderten nach allen Richtungen kreuzen, ebenso allen Richtungen der Windrose zuführen.«
Das Gesellschaftsleben der Bisonten wird hauptsächlich durch zwei Ursachen bedingt, durch den Wechsel des Jahres und durch die Fortpflanzung. Der Frühling zerstreut, der Herbst vereinigt. In den Monaten Juli und August stellen sich die wohlgenährten Stiere bei den Kühen ein, und jeder einzelne von ihnen erwählt sich eine Lebensgefährtin. Ungeachtet solcher Genügsamkeit geht es ohne Kampf und Streit nicht ab, denn auch unter den »Büffeln« befinden sich häufig genug mehrere Bewerber um ein und dieselbe Kuh. Dann entbrennen furchtbare Kämpfe, bis ein Stier als unanfechtbarer Sieger aus solchen hervorgeht. Hierauf sondert sich das Paar von der Herde und hält sich nur bis zu dem Monate zusammen, in welchem der aus solcher Vereinigung hervorgehende Sprößling geboren wird. Sobald ein Paar sich wirklich vereinigt hat, tritt der Frieden unter der Gesammtheit wieder ein. Alle Beobachter versichern, daß man sich kaum ein prachtvolleres Schauspiel denken könne, als solcher Kampf zwischen zwei kräftigen Stieren es gewährt. Der zum Gefecht sich anschickende Bison stampft wüthend den Grund, brüllt laut, schüttelt mit dem tief zu Boden gesenkten Kopfe, erhebt den Schwanz, peitscht mit ihm durch die Luft und stürzt sodann plötzlich mit überraschender Eile auf seinen Gegner zu. Die Gehörne, die Stirnen prallen laut schallend an einander. Demungeachtet hat man, wie Audubon versichert, niemals beobachtet, daß ein Stier von dem anderen in solchem Kampfe getödtet worden wäre. Der dicke Schädel, welcher außerdem durch den Wollfilz auf ihm wohlgeschützt ist, hält einen gewaltigen Stoß ohne Schaden aus, und die kurzen Hörner bilden keine geeigneten Waffen, einen gleich starken Gegner tödtlich zu verletzen. In Ermangelung eines Nebenbuhlers versucht der brünstige Stier seinen Gefühlen in anderer Weise Lust zu machen, indem er sinnlos mit dem Grund und Boden selber kämpft. An einer geeigneten Stelle beginnt er mit den Füßen zu scharren und sodann mit den Hörnern in die Erde zu bohren, schleudert Rasenstücke und die lose Erde nach allen Seiten weg und bildet so eine trichterförmige Mulde von größerer oder geringerer Tiefe. Andere Bullen, welche zu solchen Plätzen kommen, pflegen das Werk des ersten fortzusetzen und vergrößern dadurch die Vertiefung mehr und mehr. Doch scheint es, als ob mit dieser Arbeit auch noch ein anderer Zweck verbunden werde. In den trichterförmigen Vertiefungen nämlich sammelt sich schnell Wasser, und es entsteht sodann eine Badewanne, welche der von der Hitze und den Mücken geplagte Stier mit ersichtlicher Freude benutzt, um sich zu kühlen und vor den Mücken zu schützen. »Allmählich«, sagt Möllhausen, »senkt sich der Bison tiefer und tiefer in den Morast, indem er mit den Füßen stampft und sich im Kreise herumschiebt, und erst, wenn er sich zur Genüge dem Genusse hingegeben, entsteigt er dem Moorbade. Er sieht dann keinem lebenden Wesen mehr ähnlich. Der lange Bart und die dicke, zottige Mähne sind in eine triefende, klebrige Masse verwandelt und nur die rollenden Augen im vollsten Sinne des Worts das einzige, was an dem wandernden Erdhaufen von dem stattlichen Büffel geblieben. Kaum ist der Pfuhl vom ersten verlassen, so nimmt ein anderer den Platz ein, und dieser stellt ihn wieder einem dritten zur Verfügung. So treibt die Herde es fort, bis jeder der anwesenden die Merkmale dieses eigentümlichen Bades auf seinen Schultern trägt. Dort trocknen sie in eine feste Kruste zusammen, welche erst durch Wälzen im Grase oder durch den nächsten Regen allgemach entfernt wird.«
Die Brunst währt ungefähr einen Monat lang; Stiere aber, welche ihren Trieb nicht befriedigen können, bleiben noch wochenlang nach der eigentlichen Brunstzeit wüthend und bösartig. Ein unausstehlicher Moschusgeruch erfüllt die Luft, macht sie auch dem Jäger schon von weitem kenntlich und durchdringt das Wildpret in einem Grade, daß es, für Europäer wenigstens, vollkommen ungenießbar wird. Die heftige Erregung bringt das Thier außerdem sehr vom Leibe; es vergißt, sich zu äsen, magert ab, entkräftet schließlich und bleibt hinter den eigentlichen Herden zurück. Nun erst kommt es nach und nach wieder zur Besinnung. Die Einsamkeit beruhigt, die Aesung kräftigt, und gegen den Herbst hin ist die unglückliche Liebe vergessen.
Neun volle Monate nach der Paarung, gewöhnlich in der Mitte des März oder im April, bringt die Kuh ihr Kalb zur Welt. Schon früher hat sie sich von dem Stiere, mit welchem sie vorher wochenlang zusammenlebte, getrennt und dafür anderen hochbeschlagenen Kühen angeschlossen. Solche nur aus Mutterthieren bestehenden Gesellschaften erwählen sich die saftigsten Weideplätze und verweilen auf ihnen mit den Kälbern, so lange sich Weide findet. Die Kälber werden überaus zärtlich behandelt und gegen Feinde mit wildem Muthe vertheidigt, verdienen aber auch solche Liebe; denn sie sind muntere, bewegliche, spiellustige, zu heiteren Sprüngen und zu neckischen Scherzen aufgelegte Geschöpfe. Unter regelmäßigen Umständen wachsen sie rasch heran, werden bereits im Herbste entwöhnt und treiben es dann wie die Alten.«
Der Bison ist keineswegs ein so faules und der Bewegung abholdes Wesen, wie einzelne Beschreiber behauptet haben. Das uns plump erscheinende Thier bewegt sich mit überraschender Leichtigkeit. Aufmerksame Beobachter wollen gefunden haben, daß es oft mit seiner eigenen Kraft zu scherzen und zu spielen scheint. Ungeachtet seiner kurzen Läufe durchmißt der Bison rasch bedeutende Strecken. Er geht niemals in der faulen Weise, wie ein zahmes Rind, langsam dahin, sondern stets eiligen Schrittes, trabt rasch und ausdauernd und bewegt sich im Galopp mit so großer Schnelligkeit, daß ein Pferd sich anstrengen muß, um mit ihm fortzukommen. Seine Bewegungen sind eigenthümlich kurz abgebrochen und beschreiben, wenn sie beschleunigt werden, sonderbare Wellenlinien, welche dadurch entstehen, daß er die Masse des Leibes bald vorn, bald hinten aufwirft. Aber plump und ungeschickt ist er durchaus nicht, vielmehr gewandt und behend in einer Weise, welche außer allem Verhältnis zu seinem Leibesbau zu stehen scheint. Das Schwimmen übt er mit derselben Kraft und Ausdauer, welche seine Bewegungen überhaupt kennzeichnen, nimmt auch nicht den geringsten Anstand, in das Wasser sich zu begeben. Clarke sah eine Herde über den Missouri setzen, obgleich der Strom an der betreffenden Stelle über eine englische Meile breit war. In ununterbrochener Reihe zogen die Thiere mit großer Schnelligkeit durch das Wasser, eines dicht hinter dem anderen, und während die ersten drüben bereits wieder festen Fuß gefaßt hatten, stürzten sich hüben die letzten noch immer in die Wogen. Die Stimme ist ein dumpfes, nicht eben lautes Brummen, mehr ein Grollen in tiefer Brust als ein Brüllen. Wenn tausende und andere tausende zugleich sich vernehmen lassen, einen sich die Stimmen zu einem Dröhnen, welches mit dem Rollen fernen Donners verglichen wird.
Unter den Sinnen stehen Geruch und Gehör obenan. Der Bison wittert vorzüglich und vernimmt auf weite Strecken hin. Das Gesicht wird von allen Beobachtern gleichmäßig als schwach bezeichnet, obgleich das Auge wohlgebildet ist und sich wohl kaum von dem anderer Wiederkäuer unterscheidet. Wahrscheinlich hindert der dichte Haarfilz, welcher gerade den Kopf umgibt, den Bison am Sehen. Hinsichtlich der geistigen Fähigkeiten unterscheidet sich dieser nicht von anderen Verwandten. Er ist wenig begabt, gutmüthig und furchtsam, schneller Erregungen unfähig, kann aber, gereizt, alle Rücksichten, welche er sonst zu nehmen pflegt, vergessen und dann sehr muthig, boshaft und rachsüchtig sein. Leichter als an wildlebenden bemerkt man an gefangenen Bisonten, daß ihr Geist bildsam ist. Auch jene beweisen, daß sie zwischen nützlichem und schädlichem zu unterscheiden wissen; bei diesen nimmt man wahr, daß sie für ihre Verhältnisse ein Verständnis gewinnen, welches man ihnen eigentlich nicht zutraut. Sie sind der Zähmung durchaus nicht unzugänglich, wie früher oft behauptet worden ist, treten vielmehr mit dem Menschen, welcher sie recht zu behandeln weiß, in ein fast freundschaftliches Verhältnis, lernen wenigstens ihren Wärter kennen und in gewissem Grade lieben. Aber freilich währt es lange, ehe sie ihre angeborne Scheu ablegen und zu einer Aenderung ihrer vorgefaßten Meinung sich bequemen. Der Stier zeigt sich unter allen Umständen selbstbewußter, anspruchsvoller, herrschsüchtiger und deshalb muthiger und kampfeslustiger als die Kuh.
Während des Sommers bietet das unscheinbare, aber saftige Gras der Prairien den grasenden Bisonten ein gedeihliches Futter, im Winter müssen sie mit geringer Nahrung vorlieb nehmen und sind zufrieden, wenn sie neben Zweigspitzen und verdorrten Blättern dürres Gras, Flechten und Moos erlangen können. Daß sie zwischen gutem und schlechtem Futter mit Bewußtsein unterscheiden, unterliegt keinem Zweifel: sie bevorzugen wohl das bessere, begnügen sich aber auch mit dem geringsten. »Wenn die drückende Sonnenhitze die grüne Grasflur verbrannt hat«, bemerkt Finsch ferner, »genügen die trockenen Büschel dem Bison noch, und selbst die großen Prairiebrände im Herbste lassen so viele vom Feuer übersprungene Oasen inmitten der schwarzen Fläche übrig, daß die Herden auf ihrer Wanderung hinreichende Nahrung finden. Im Winter freilich sieht es schwieriger um ihre Erhaltung aus, und die kümmerlich unter dem Schnee hervorgekratzten Reste reichen kaum aus; doch eilt dann der Bison seinen südlichen Winterherbergen zu. Weniger als reichliches und frisches Futter können die Thiere des Wassers entbehren. In langen Reihen sieht man sie früh und abends eines hinter dem anderen, die lustig spielenden Kälber zur Seite, auf den von ihnen getretenen, kaum mehr als fußbreiten Wegen, welche ganz das Aussehen von Fußpfaden haben, langsam dahinziehen, ihrem ganz bestimmten Ziele, der Tränke, zustrebend. Hier entwickelt sich dann ein reges Leben. In der Reihenfolge, in welcher die schwarzen Kolosse an den Tümpel gelangen, beginnen sie ihren Durst in tiefen Zügen zu löschen; säumige werden mit sanften Hörnerstößen zur Eile getrieben, und nur hier und da kommt es zwischen recht alten Bullen zu einer ernsteren Rempelei, so daß der in gewisser Entfernung verborgene Beobachter das Aneinanderprallen der Hörner deutlich vernehmen kann.«
Viele und ernste Gefahren bedrohen das Leben des Bisons. Auch er hat zu kämpfen um das Dasein. Nicht allein Mensch und Wolf, sondern ebenso Mangel und Noth treten ihm feindlich entgegen. Der auf der Prairie meist schwere Winter vernichtet hunderte seines Geschlechts, nachdem er sie erst entkräftete und ermattete. Zwar ist der Bison wohl gerüstet, ihm zu widerstehen: sein dichter Wollfilz schützt ihn unter günstigen Umständen genügend gegen die Witterung, und der Haarwechsel seines Kleides steht, wie zu erwarten, in so genauem Einklang mit der Jahreszeit, daß ihn, so zu sagen, der Winter unvermuthet nicht überrascht; aber die Umstände können sehr traurig werden, wenn die Schneedecke allzuhoch den Boden bedeckt und das nach Nahrung suchende Thier trotz aller Anstrengungen nicht genug Aesung findet, um sein Bedürfnis zu befriedigen. Dann verzehrt sich rasch das Feist, welches er während des Sommers sich sammelte, die Entkräftung nimmt mehr und mehr überhand, und es schwindet die Möglichkeit, das Leben zu fristen. Endlich bleibt das ermattete Thier mit verzweifelnder Entsagung ruhig liegen und läßt sich widerstandslos unter der Schneedecke begraben. Jäher noch endet der Winter das Dasein des Bison, wenn dieser einer Eisdecke über die Flüsse mehr vertraut als er sollte. Seine Gewohnheit, in dichtgedrängten Scharen zu wandern, wird ihm dann oft verderblich; unter der ungeheuern Last einer Bisonherde bricht die Eisdecke: die Thiere stürzen ins Wasser, bemühen sich vergeblich, festen Boden wieder zu gewinnen, werden von hunderten, welche nachdrängen, verhindert und gehen elendiglich zu Grunde. In ähnlicher Weise kommen viele Bisonten um, wenn sie im Sommer über die Flüsse setzen und an einer Stelle landen wollen, wo Triebsand oder zäher Schlamm ihnen das Aufsteigen zum Lande erschwert. Ihre ungeheure Kraft ist nicht genügend, die Hindernisse zu überwinden: sie versinken angesichts des sicheren Bodens, im Laufe von Stunden vielleicht, aber unaufhaltsam, in den kleberigen, fesselnden Brei.
An lebenden Feinden fehlt es dem Bison ebensowenig wie irgend einem anderen seines Geschlechts. Es wird gesagt, daß der Griselbär selbst den Kampf mit dem wehrhaften Stiere nicht scheue, und ebenso, daß auch der Wolf wenigstens jüngere Büffel gefährde. Der schlimmste Feind aber bleibt doch der Mensch, zumal der in Amerika erst eingewanderte. »In früheren Zeiten«, so schildert Möllhausen, »als der Büffel gewissermaßen als Hausthier der Indianer betrachtet werden konnte, war keine Verminderung der unabsehbaren Herden bemerkbar; im Gegentheil, sie gediehen und vermehrten sich auf den üppigen Weiden. Nun kamen die Weißen in diese Gegenden. Die reichhaarigen großen Pelze gefielen ihnen, das fette Büffelfleisch fanden sie nach ihrem Geschmacke, und von beiden versprachen sie sich reichen Gewinn. Es wurden zuerst bei den Steppenbewohnern Begierden nach glänzenden oder betäubenden Erzeugnissen der Weißen erweckt und dann im kleinsten Maße für ihre Jagdbeute geboten, worauf die Verheerung begann. Tausende von Büffeln wurden der Zungen wegen, häufiger noch der zottigen Pelze halber erlegt, und in wenigen Jahren war eine bedeutende Verminderung derselben auffallend bemerkbar. Der sorglose Indianer gedenkt nicht der Zukunft; er lebt nur der Gegenwart und ihren Genüssen. Es bedarf bei ihm nicht mehr der Aufmunterung: er wird den Büffel jagen, bis der letzte ihm sein Kleid gelassen. Sicher ist die Zeit nicht mehr fern, wann die gewaltigen Herden nur noch in der Erinnerung leben und dreimalhunderttausend Indianer ihres Unterhaltes beraubt und vom wüthendsten Hunger getrieben, nebst Millionen von Wölfen zur Landplage der angrenzenden Gesittung und als solche dann mit der Wurzel ausgerottet werden.
»Mannigfach ist die Art und Weise, durch welche das Thier seinen Verfolgern unterliegen muß. Die Büffeljagd der Prairieindianer ist eine Beschäftigung, durch welche sie sich nicht nur ihren Unterhalt verschaffen, sondern welche ihnen zugleich als höchstes Vergnügen gilt. Beritten auf ausdauernden Pferden, welche sie größtentheils wild in der Steppe eingefangen haben, sind sie im Stande, jedes Wild in der Ebene einzuholen, und suchen einen besonderen Ruhm darin, mit der größten Schnelligkeit und möglichstem Erfolge vom Pferde herab ihre tödtlichen Geschosse unter eine fliehende Herde zu versenden. Beabsichtigt der Indianer eine Büffelherde zu überholen, so entledigt er sich und sein Pferd aller nur entbehrlichen und beschwerlichen Gegenstände: Kleidung und Sattelzeug bleiben zurück; nur eine zwölf Meter lange Leine, von rohem Leder geflochten, ist um die Kinnlade des Pferdes geschnürt und schleppt, über den Hals geworfen, in ihrer ganzen Länge auf der Erde nach. Sie dient zum Lenken, zugleich aber auch, um beim etwaigen Sturze oder sonstigen Unfall das lose Pferd wieder leichter in die Gewalt des Reiters zu bringen.
»Der Jäger führt in der linken Hand den Bogen und so viele Pfeile, als er bequem halten kann, in der rechten aber eine schwere Peitsche, mittels welcher er sein flüchtiges Roß durch unbarmherzige Schläge unter die fliehende Herde und an die Seite einer fetten Kuh oder eines jungen Stieres treibt. Das gelehrige Pferd versteht leicht die Absicht seines Reiters und eilt, keiner weiteren Führung bedürfend, dicht an die ausgewählte Beute heran, um dem Jäger Gelegenheit zu geben, im günstigsten Augenblicke den Pfeil bis an die Federn in die Weichen des Büffels zu senden. Kaum schwirrt die straffe Sehne des Bogens, kaum gräbt sich das scharfe Eisen durch die krause Wolle in das fette Fleisch, so entfernt sich das Pferd von dem verwundeten Thiere durch einen mächtigen Sprung, um den Hörnern des wüthend gewordenen Feindes zu entgehen, und ein anderer Stier wird zum Opfer ausgesucht. So geht die Hetzjagd mit Sturmeseile über die Ebene dahin, bis die Ermüdung seines Thieres den wilden Jäger mahnt, der unersättlichen Jagdlust Einhalt zu thun. Alle verwundeten Büffel haben sich indessen von der Herde getrennt und liegen erschöpft oder verendend auf der Straße, auf welcher vor wenigen Minuten die wilde Jagd donnernd dahinbrauste. Die Weiber des Jägers sind seinen Spuren gefolgt und beschäftigen sich emsig damit, die Beute zu zerlegen und die besten Stücke nebst den Häuten nach den Wigwams zu schaffen, wo das Fleisch in dünne Streifen zerschnitten und getrocknet, das Fell aber auf einfache Art gegerbt wird. Natürlich bleibt der bei weitem größte Theil den Wölfen.
»Da die lange Kopfmähne des Büffels demselben die Augen verdeckt und ihn am klaren Sehen und Unterscheiden hindert, wird es dem Gegner um so leichter, selbst ohne Pferd auf Beute auszugehen. Er befestigt eine Wolfshaut an seinem Kopfe und Körper, und indem er seine Waffen vor sich hinschiebt, geht er auf Händen und Füßen im Zickzack auf sein Ziel los. Wenn der Wind nicht plötzlich den Indianer in der Kleidung verräth, so gelingt es diesem sicher, aus nächster Nähe einen Büffel zu erlegen, ohne daß dadurch die übrige Herde aus ihrer Ruhe gestört würde. Selbst den Knall der Büchse scheuen diese Thiere nicht, so lange sie mit ihren feinen Geruchswerkzeugen die Anwesenheit eines Menschen nicht wahrnehmen (?). Ein wohl verborgener Schütze vermag manchen Büffel einer ruhig grasenden Herde ohne große Störung mit der Kugel zu fällen: das Todesröcheln des verwundeten veranlaßt höchstens den einen oder den anderen, seinen mähnigen Kopf auf einige Augenblicke forschend zu erheben; dann geht er wieder an seine Lieblingsbeschäftigung, an das Grasen.
»Zu allen Jahreszeiten wird dem armen Büffel nachgestellt, selbst dann, wenn der Schneesturm die Niederung mit einer tiefen Decke überzogen hat und die beliebte Jagd mit den Pferden unmöglich geworden ist. Langsam nur kann sich dann die Herde durch den mehrere Fuß hohen Schnee wühlen; der sinnreiche Indianer aber hat sich breite, geflochtene Schneeschuhe an die leichten Füße befestigt, und, ohne auf dem unsicheren Boden einzubrechen, eilt er schnell an den mühsam wadenden Riesen heran und stößt das wehrlose Thier mit der Lanze nieder.«
Heutzutage jagt der Indianer, obschon er bei gewissen Gelegenheiten Bogen und Pfeil noch immer den Feuerwaffen vorzieht, meist mit der Kugelbüchse wie die weißen Einwohner des Landes, welche aber leider nur in seltenen Fällen ein edles Waidwerk treiben.
John Franklin beschreibt eine eigenthümliche Bisonjagd. Unweit Carlston hatte man eine ungeheure Strecke mit Pfählen umzäunt und mit Schneemauern umgeben. Auf der einen Seite war der Schnee bis zur Höhe der Pfähle aufgeworfen und rampenartig geebnet. Zu diesem Pferche trieben berittene Indianer eine Bisonherde und zwangen sie durch entsetzliches Geschrei und durch Flintenschüsse, da hinein zu springen, wo sie dann leicht erlegt wurden.
Audubon theilt uns mit, daß man vom Fort Union aus sogar mit Kanonen unter die Herden schoß. Fröbel erzählt, daß immer, wenn seine Reisegesellschaft Fleisch bedurfte, ein tüchtiger Reiter ausgesandt wurde, solches herbeizuschaffen. Der Mann ritt mitten unter die Herden, welche ihn wenig beachteten, wählte sich ein Thier aus, sprengte auf dieses zu und brachte den kleinen Trupp, zu welchem es gehörte, ins Fliehen, verfolgte sodann das gewählte Opfer, bis er ihm den Revolver an die linke Schulter setzen und schießen konnte. Von Widersetzlichkeiten eines Bison wurde nichts beobachtet. Die benachbarten Herden wichen während der Jagd nur ein wenig zur Seite. Ein Mejikaner, welcher bei Fröbels Karawane war und früher acht Jahre lang als Sklave unter den Comanchen gedient hatte, zeigte sich so geschickt in Handhabung der Wurfschlinge, daß er nicht bloß Bisonkälber, sondern auch erwachsene Kühe damit fing. Er warf diesen die Schlinge um den Hals, und wenn sie dann stehen blieben, um sich loszumachen, ritt er an sie heran, wickelte ihnen die Leine um die Füße, zog sie so fest zusammen, daß die Thiere stürzten, sprang dann schnell vom Pferde und band das Ende der Leine fest um die Füße, worauf das Thier geschlachtet und zerlegt wurde. Haut, Geripp und was man sonst nicht wollte, verblieb den Geiern und Wölfen.
Der Büffeljäger von Fach bedient sich, laut Finsch, sehr schwerer Büchsen, deren Leistungen noch auf fünf- bis siebenhundert Schritte im Stande sind, einen Bison zu Boden zu werfen. Gewöhnliche deutsche Büchsen richten wenig aus, und ihre Kugeln drücken sich meistens an den Knochen platt. Doch sind es immer nur die erfahrensten Jäger, welche sich birschend an die Bisonherde schleichen und die Büchse anstatt des Revolvers gebrauchen. Der Birschgang erfordert auf den baum- und strauchlosen Flächen viele Anstrengung, ebenso ausdauernde Beine als gute Lungen und einen genügsamen Magen, welcher trotz der Sonnenhitze längere Zeit jedes Trunkes entbehren kann. Auch ist es keineswegs leicht, an die Herde sich anzuschleichen; denn nur mit Beobachtung des Windes und wenn man es versteht, wie die Indianer schlangenartig auf dem Bauche sich fortzuschieben, wird dieses überhaupt möglich. Bekundet ein Stück der Herde durch seine Unruhe, daß es etwas verdächtiges wittert, so muß der Jäger unbeweglich still liegen und darf hoffen, daß sein brauner, dem Boden gleich gefärbter Lederanzug ihn nicht sichtbar werden läßt. Auch wenn er den Schuß abgegeben hat, muß er dieselbe Vorsicht beobachten und liegen bleiben, um unter Umständen noch weitere Schüsse abgeben zu können. Zwar kennen die Bisons gegenwärtig die Bedeutung eines Gewehrschusses gar wohl und werden durch ihn jederzeit in die Flucht gejagt, jagen mit gesenktem Kopfe und hoch erhobenem Schwanze einige hundert Schritte dahin, halten hierauf an, drehen sich und glotzen, die mächtigen zottigen Köpfe nach dem Jäger gewendet in die Prairie hinaus, verlassen aber einen verwundeten Gefährten in der Regel nicht sofort. Hat nämlich die erste Kugel ein Stück tödtlich getroffen oder verwundet, so bringt dies bei den übrigen eine unerwartete, dem kundigen Jäger wohlbekannte Wirkung hervor. Anstatt zu fliehen, werden sie beim Anblick des Blutes wie von einem Zauber zurückgehalten, starren den gefallenen Genossen entsetzt an, umspringen ihn in wilden Sätzen und lassen sich erst durch wiederholte Schüsse, welche neue Opfer fordern, in die Flucht treiben. So geschieht es, daß der erfahrene Jäger oft den größeren Theil eines Truppes niederdonnert, ohne daß die Riesen, welche ihm das Jagen sehr verleiden und die Prairie, wären sie ihrer Kraft sich bewußt, bald von ihren furchtbaren Feinden säubern könnten, daran denken, zum Angriffe überzugehen.
Gleichwohl laufen nicht immer alle Bisonjagden so gut ab, als es nach dem bisher mitgetheilten scheinen möchte. Wyeth sah, daß ein Indianer, welcher einem verwundeten Bison noch zusetzte, hart büßen mußte. Das Thier wendete sich plötzlich gegen ihn, sein scheuendes Pferd warf ihn ab, und ehe er noch aufspringen konnte, hatte der Büffel ihm die Brust durchbohrt. Einen anderen derartigen Fall erzählt Richardson. In der Nähe von Carltonhouse schoß ein Handlungsdiener der Hudsonsbaigesellschaft nach einem Bison. Derselbe brach auf den Schuß zusammen, und der unvorsichtige Schütze eilt nach ihm hin, um die Wirkung seines Geschosses zu erfahren. Da erhob sich plötzlich der verwundete Büffel und stürzte auf den Gegner los. Unser Handlungsdiener, ein Mann von seltener Stärke und Geistesgegenwart, packte das Thier, als es mit den Hörnern nach ihm stieß, bei den langen Stirnhaaren und kämpfte aufs tapferste gegen den übermächtigen Gegner, verstauchte sich aber leider beim Ringen sein Handgelenk, wurde wehrlos, stürzte ermattet zu Boden und erhielt in demselben Augenblicke zwei oder drei Stöße, welche ihm die Besinnung raubten. Seine Gefährten fanden ihn im Blute schwimmend, an mehreren Stellen schwer verwundet; der Bison lagerte neben ihm, augenscheinlich darauf lauernd, daß der Besinnungslose wieder ein Lebenszeichen von sich geben möge, worauf er ihn jedenfalls sofort getödtet haben würde. Erst nachdem der verwundete Büffel sich entfernt hatte, konnte der Beschädigte weggetragen werden; er genas zwar von den unmittelbaren Folgen der Verletzung, starb aber wenige Monate später. Ein anderer Jäger mußte mehrere Stunden auf einem Baume zubringen, auf welchen er vor dem Angriff eines wüthenden Bison sich geflüchtet hatte, weil dieser ihn hartnäckig belagerte. Auch die Jagden zu Roß sind keineswegs immer leicht und ungefährlich. »Bald«, sagt Finsch, »geht die Hetze durch eine Ansiedelung der Prairiemurmelthiere (Bd. II, S. 294), ein sogenanntes Hundedorf, in dessen unterwühltem Boden Pferde und Reiter leicht zu Falle kommen, bald setzt eine drei bis vier Meter abfallende Regenrinne, in welche sich der Bison als gewandtes Thier ohne Zögern hinabstürzt, dem Verfolger ein Ziel, oder das Pferd wird im letzten Augenblicke vor dem schnaubenden Ungeheuer, wenn dieses seinen mächtigen, zottigen Kopf umwendet, scheu und springt zur Seite, wobei der Reiter aus dem Sattel kommt. Auch bietet die Büffeljagd Gelegenheit zu Reibereien zwischen verschiedenen Indianerstämmen oder zwischen diesen und den Weißen, und da die Skalpe der Bleichgesichter noch heutigen Tages bei allen Indianern hoch im Werthe stehen, so kann die Begegnung mit einer Horde jagender Indianer für einzelne Waidmänner leicht verhängnisvoll werden, selbst wenn die ersteren nicht den Kriegspfad gehen und mit dem großen Vater in Washington im tiefsten Frieden leben. So ereignete es sich noch im Jahre 1872, daß drei Engländer fröhlich auf die Bisonjagd zogen, um nimmer wiederzukehren; sie waren von Indianern überfallen und ihrer Kopfhaut beraubt worden, wie dies ihre später gefundenen Leichname bestätigten. Im ganzen jedoch geschieht wenig Unglück bei der Bisonjagd, und selbst die Fälle, daß sich ein verwundeter Stier auf seinen Angreifer stürzt, sind selten.«
Gegen die Angriffe der Wölfe und die noch schlimmeren der Bullenbeißer weiß sich der Bison mit großer Gewandtheit zu sichern. Wenn einer jener Räuber in dem zottigen Felle des Bison sich festbeißt, wird er von diesem durch eine einzige Bewegung über den Kopf hinweg geschleudert, unter Umständen aber auch auf den Hörnern aufgefangen und dann sehr bald abgethan. Selbst gut eingehetzte Doggen mußten dem Bison unterliegen. Sie griffen ihn nur von vorn an und verbissen sich fest in seine Oberlippe; allein der Stier wußte sich zu helfen, stellte rasch die Vorderbeine auseinander, zog die Hinterbeine nach, stürzte sich nach vorn auf den Hund und erstickte ihn unter seiner gewaltigen Last.
Das getrocknete Fleisch, welches unter dem Namen »Pemmikan« in Amerika bekannt ist, wird weit und breit versandt und von allen Reisenden als wohlschmeckend gerühmt; die Zunge gilt als Leckerbissen. Das Fleisch der Kühe ist noch fetter als das der Stiere und das der Kälber überaus zart. Aus dem Felle verfertigen sich die Indianer warme Kleidungsstücke, Zeltwandungen und Betten, Sättel, Gurte etc., beschlagen auch wohl das Geripp ihrer Kähne damit. Die Knochen müssen ihnen Sattelgestelle und Messer liefern, mit denen sie dann die Häute abhären; aus den Sehnen zwirnen sie sich Saiten für ihre Bogen und Faden zum Nähen; aus den Füßen und Hufen bereiten sie durch Kochen einen haltbaren Leim; die starken Haare des Kopfes und des Halses werden zu Stricken gedreht; aus den Schwänzen macht man Fliegenwedel; der Mist dient als Brennstoff. Auch die Europäer sind Liebhaber der Bisonfelle. Das Leder ist vorzüglich, obgleich etwas schwammig, das Fell mit den Haaren zu Decken aller Art zu gebrauchen, so daß fehlerfreie Stücken schon in Kanada mit drei und vier Pfund Sterling bezahlt werden. Die Wolle, von welcher ein einziges Vlies bis vier Kilogramm liefern kann, läßt sich ebensogut wie Schafwolle verarbeiten, wird auch in manchen Gegenden zur Erzeugung warmer und sehr dauerhafter Stoffe verwendet.
Leider werden viel mehr Bisonten der unbezwinglichen Jagdlust der Weißen als dem wirklichen Nutzen geopfert. »Man führt«, klagt Möllhausen, »den Ausrottungskrieg gegen die Zierde der Grassteppen auf unbarmherzige Weise fort, und keinem Gedanken auf Schonung wird Raum werden, bis der letzte Büffel, bald nach ihr die letzte Rothhaut und mit ihr die einzige Naturdichtung des großen amerikanischen Festlandes verschwunden sein wird.« Amerikanische Blätter der neuesten Zeit stimmen diesen Klagen vollständig bei. »Noch vor wenigen Jahren«, heißt es in einem mir zugegangenen Zeitungsberichte, »trabten zahllose Bisonherden über die unendliche Prairie östlich der Felsenberge: jetzt sieht man dort nur noch deren bleichende Gebeine. In welcher Weise man den Krieg gegen die Thiere führt, welches unverzeihliche Gemetzel man anrichtet, geht am besten aus einer Angabe hervor. Am Rickareeflusse allein lagerten im vergangenen Sommer (1874) zweitausend Büffeljäger, und mehrere von ihnen rühmten sich, daß sie im Laufe des Sommers gegen zwölfhundert dieser Thiere erlegt hatten; ein aus sechszehn Jägern bestehender Trupp erklärte, im Laufe einer Jahreszeit achtundzwanzigtausend Bisonten getödtet zu haben.« Das ist keine Jagd mehr, sondern nur noch ein sinnloses Morden, ein nichtswürdiges Abschlachten, welches gebildet sein wollenden Menschen offenbar zur Schande gereicht und den Untergang der Thiere nothwendig herbeiführen muß. Auch Finsch, welcher minder trübe als Möllhausen in die Zukunft sieht, kann nicht umhin, die abscheuliche Verwüstungssucht der Amerikaner zuzugestehen. »Während der rothe Mann«, sagt er, »den Bison nur zu seinem Lebensunterhalte jagt, schießt der Weiße tausende ausschließlich zu seinem Vergnügen, zum Spaße, aus ungezügelter Jagdlust todt. Es macht einen traurigen Eindruck, in der Prairie überall diesen Spuren nutzloser Verwüstung zu begegnen. Bald stoßen wir auf einzelne Schädel, bald auf mehr oder minder vollständige Gerippe und Leichname, an denen Raben, Heul- und Falbwölfe nagen, oder welche durch Prairiebrand gebraten und zu einer unförmlichen Masse umgestaltet sind; bald ist es ein verwundeter Bison, welcher todeswund da liegt oder sich mühsam hinschleppt. So verwerflich diese Vernichtungen sind, man wird milder über ihre Urheber urtheilen, wenn man bedenkt, daß in der menschenleeren Einöde ohne Fuhrwerk das Fortschaffen solcher zehn bis fünfzehn Centner schweren Fleischmassen eben eine Unmöglichkeit ist, und daß der glückliche Jäger seine herrliche Beute den Raubthieren oft überlassen muß, um sich mit der Zunge oder der Endhälfte des Schwanzes zu begnügen. Doch bleibt dieses zwecklose Hinmorden dem Indianer natürlich unbegreiflich und ein Räthsel, welchem er am liebsten mit Tomahak und Skalpirmesser ein Ende machen möchte.
»Wenn«, so schließt mein kundiger Freund, »in nicht näher zu berechnendem Zeitraume der schwarze fette Boden der Prairie durch den Fleiß und die Ausdauer des Weißen Mannes in lachende Fluren und Gefilde verwandelt sein wird, dann werden wir Spuren seines rothen Bruders, entartet oder als Mischlingsvolk, noch lange begegnen, den Bison aber nur noch in geschützten Gehegen oder in unseren Thiergärten finden. So unaufhaltsam dieses Schicksal trotz aller zu ergreifender Schutzmaßregeln sich erfüllen muß, immerhin wird für die Erhaltung des theilnahmswerthen Thieres besser gesorgt werden, als dies bei uns mit dem Wisent geschah. Wir vertrauen, daß eine Regierung, welche die Riesen des Pflanzenreiches, die mächtigen Mammuthbäume Kaliforniens, das unübertrefflich malerische und großartige Yellowstonethal mit seinen Felswänden, Seen und Wasserfällen als Volkseigenthum zum Gemeingut aller machte, welches die Seelöwen am Gestade des Stillen Meeres unter Schutz stellte, auch für die Erhaltung des Bison Bezirke abstecken wird, gegen welche der Bialowieser Wald mit seinen siebzehn Geviertmeilen verschwindet, und in denen der Bison unbehelligt von Weißen und Rothhäuten für lange Zeit unter kräftigem Schutze fortleben und gedeihen wird.«
Erst seit wenigen Jahren sieht man Bisonten in unseren europäischen Thiergärten. Ein englischer Lord soll, wie man mir in London mittheilte, einige Paare dieser Rinder aus Amerika eingeführt und auf seinen Besitzungen in Schottland eine Herde von fünfzehn bis zwanzig Stück gezüchtet haben. Nach seinem Tode wurden die Bisonten verkauft und gelangten zunächst in London auf den Thiermarkt. In der Neuzeit kamen wiederholt junge Pärchen von drüben herüber, so daß man sie gegenwärtig in jedem Thiergarten sieht. Zwei Bisons, welche ich pflegte, waren im Anfange sehr scheu und furchtsam, wichen vor dem ihnen sich nahenden Menschen eilig zurück, bedrohten ihn aber auch nicht selten in bedenkenerregender Weise, so daß der Wärter manchmal seine Noth mit ihnen hatte. An den Stall, oder richtiger an ihre Krippe, gewöhnten sie sich bald; doch kamen sie nur dann zum Fressen, wenn es in der Nähe ihres Geheges ruhig war. Von Fremden hielten sie sich möglichst fern, wie sie überhaupt gegen jede engere Verbindung mit den Menschen eine entschiedene Abneigung an den Tag legten. Dies alles verlor sich schon nach wenigen Monaten; sie erkannten die Herrschaft des Wärters an und fügten sich ihr gutwillig, achteten auf den Zuruf, kamen vertrauensvoll an das Gitter heran und nahmen ihm oder mir das vorgehaltene Futter aus der Hand. Auch gegen Fremde zeigten sie sich bald ebenso gleichgültig, als sie früher furchtsam waren. Hinsichtlich ihrer Nahrung erheben die Bisons wenig Ansprüche, obwohl sie besseres Futter von schlechterem sehr wohl zu unterscheiden wissen und entschieden bevorzugen. Dieselbe Nahrung, welche wir unseren Hauskühen reichen, genügt ihnen vollständig; eingemaischtes Futter scheinen sie jedoch zu verschmähen. In ihrem Stalle halten sie sich so wenig als möglich auf, verweilen vielmehr auch im ärgsten Wetter lieber außerhalb desselben in ihrem Gehege als in dem schützenden Gebäude. Während des Winters fanden wir sie auf dem Eise liegen, nach starkem Schneefalle oft mit einer dichten Decke belegt. Bei heftigem Regen wenden sie sich höchstens mit den Köpfen ab. Uebertages pflegen sie still und träge auf einer und derselben Stelle zu verweilen; gegen Sonnenuntergang werden sie munter und galoppiren dann mit lustigen Sprüngen leicht und behend in ihrem Gehege umher; nachts sind sie immer rege. Bei geeigneter Pflege pflanzen sie sich regelmäßig fort, und die in Gefangenschaft gebornen Kälber, welche von ihren Müttern gegen Zudringlichkeiten irgend welcher Art kräftigst in Schutz genommen werden, wachsen ebenso leicht heran wie die Nachkommen unserer Hausrinder.
Der Amerikaner Wickleff theilt Audubon mit, daß er sich dreißig Jahre mit der Bisonzucht beschäftigt und nicht allein Bisonten unvermischten Blutes gepaart, sondern sie auch wiederholt mit Hausrindern gekreuzt und Nachkommen erhalten habe, welche wiederum unter sich fruchtbar gewesen sein sollen. Der Mann zweifelt nicht, den Bison unter entsprechender Pflege mit der Zeit zu einem wichtigen Hausthiere werden zu sehen, und verspricht sich von seiner Zucht guten Erfolg. Wieviel oder ob überhaupt wahres an Wickleffs Angaben, lasse ich dahin gestellt sein.
Die Rinder im engsten Sinne ( Bos), zu denen unsere Hausthiere gehören, bilden eine Gruppe für sich, welche sich durch lange, platte Stirn, große, an ihrer Wurzel nicht übermäßig verdickte, in gleicher Höhe mit der Stirnleiste stehende Hörner, eine ziemlich dichte und kurze Behaarung, und innerlich durch dreizehn oder vierzehn rippentragende, sechs rippenlose und vier Kreuzwirbel kennzeichnen.
Noch vermögen wir nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob das Festland Indiens von einem oder aber von zwei zu der vorstehend gewürdigten Untersippe gehörigen Wildrindern bewohnt wird. Im Jahre 1802 machte Lambert die wissenschaftliche Welt mit einem indischen Wildstiere bekannt, welchen er nach einem lebend in England angelangten Männchen beschrieb und, sehr bezeichnend, Stirnrind nannte, fügte seiner Beschreibung des Thieres auch eine kurze, von Harris herrührende Lebensschilderung hinzu, aus welcher wir unter anderem erfahren, daß das Thier bei den Hindu Gayal heißt, den Eingeborenen allgemein bekannt ist, von ihnen nicht selten gezähmt und sodann wie ein Hausrind verwendet, auch wohl, behufs Veredelung der Rassen des letzteren, mit diesem gekreuzt wird. Zweiundzwanzig Jahre später beschrieb Traill unter dem einheimischen Namen Gaur einen ebenfalls auf dem Festlande Indiens lebenden Wildstier, in welchem er eine von dem Gayal verschiedene Art zu erkennen vermeinte. Die in Indien lebenden englischen Forscher und Jäger stimmen Traill bei, wogegen europäische Thierkundige, von denen einzelne durch neue Benennungen des einen oder anderen Rindes die Streitfrage zu einer noch verwickelteren machten, beide Thiere für gleichartig erklärten. Nachdem ich alle mir bekannten Mittheilungen über die beregten Rinder durchgesehen habe, muß ich mich dahin aussprechen, daß die Frage zur Zeit, aus Mangel an genügendem Stoff behufs eingehender Vergleichung, kaum entschieden werden kann, daß jedoch die vorliegenden Berichte mehr für die Artverschiedenheit als die Arteinheit der beiden Wildrinder zu sprechen scheinen.
Ueber ein gegenwärtig im Thiergarten zu Antwerpen lebendes Stirnrind, welches mit der maßgebenden Beschreibung Lamberts in allen wesentlichen Punkten übereinstimmt und von Mützel für unser Werk durch Stift und Wort geschildert werden konnte, kann ich das nachstehende mittheilen.

Gayal (Bos frontalis). 1/22 natürl. Größe.
Das Stirnrind oder der Gayal (Bos frontalis, Bos gavaeus und sylhetanus) erreicht, nach den von Lambert und anderen Forschern gegebenen Maßen, eine Gesammtlänge von 3,6 Meter, wovon 80 Centim. auf den Schwanz zu rechnen sind, und 1,5 bis 1,6 Meter Schulterhöhe. »Kaum jemals«, so schreibt mir Mützel, »ist mir ein Thier vor Augen gekommen, dessen Name ein so berechtigter wäre als der des Stirnrindes; denn dieses darf gar nicht anders heißen, weil die gewaltige, durch ihre unvergleichliche Breite jedermann auffallende Stirn es vor allen Verwandten auszeichnet und auf den ersten Blick als das bedeutsamste Merkmal sich darstellt. Das schönste Ebenmaß ist in seinen Körperverhältnissen ausgedrückt, alles an ihm gedrungen und kräftig, ohne daß irgend ein Theil plump erschiene; der Stier macht daher den Eindruck höchster Kraftfülle und vollendeter, einhelliger Schönheit und muß als eine durchaus edle Erscheinung bezeichnet werden. An dem kurzen Kopfe bildet das dicke Maul den verschmächtigten Theil einer abgestumpften Pyramide, deren Grundfläche zwischen den Hornwurzeln und den Unterkieferwinkeln liegt; doch ist diese Grundfläche keine gleichseitig viereckige, die Seite zwischen den Hornwurzeln vielmehr länger als die anderen. Nase und Maul unterscheiden sich wenig von denen des Banteng. Der Nasenrücken ist sehr kurz und breit; die Augenwülste entspringen sehr tief, treten sogleich entschieden nach außen vor und gehen flach in die Stirne über, welche sich nach den Hornwurzeln zu immer mehr verbreitert und oben mit einer fast geraden Linie abschließt. Die Breite der beinahe ebenen Stirn zwischen den Hornwurzeln gleicht ihrer Höhe von der Nasenwurzel bis zu den Scheitelbeinen und beträgt zwei Fünftel der Gesammtlänge des Kopfes. Die sehr dicken Hörner haben kegelförmige Gestalt und treten mit schwacher Biegung nach außen und hinten. Die kleinen Augen sitzen ziemlich tief unter den Wülsten; die aufrechtstehenden Ohren sind groß und spitzig. Hinter dem Kinne entspringt eine kleine, dreieckige, doppelte Wamme, welche an den beiden Unterkiefern endet. Drei bis vier tiefe Hautfalten trennen den Kopf von einer langgestreckten, dicken, buckelartigen Auftreibung, welche den ganzen Hals, den Widerrist sowie die Hälfte des Rückens bedeckt und als ausgebildeter »Stierhals« den Eindruck ungeheurer Kraft hervorruft. Der übrige Theil des Leibes ist sehr fleischig, eine Wamme am Halse kaum vorhanden, wenigstens durch an ihrer Stelle lagerndes Fett verwischt; die Beine sind stark, aber wohlgeformt, die Hufe in der Größe ihnen entsprechend, jedoch kurz und vorn steil abfallend; der dünne Schwanz reicht mit seiner Quaste, welche über den Fersen beginnt, bis zu den Afterklauen herab. Ein kurzes, dichtes, glattes und glänzendes Haarkleid deckt gleichmäßig den ganzen Körper, verlängert sich nur wenig an der Unterseite des Halses, entwickelt sich aber am unteren Viertel des Schwanzes zu einer reichen Quaste und bildet ebenso an den Handwurzeln der Vorderbeine hängende Lockenbüschel. Die vorherrschende Färbung ist ein tiefes Schwarz; die Stirnhaare sind grau- oder fahlbraun, die Haarbüschel an den Vorderbeinen kräftig sepiabraun, das Kinn, die Mundwinkel und ein schmaler Rand der Oberlippe endlich weiß. Das Innere des hier kahlen Ohres spielt ins Fleischröthliche; die Iris ist dunkelbraun; die Hörner haben graulichweiße, ihre Spitzen schwarze Färbung.« Nach Angabe Lamberts unterscheidet sich die Kuh nur dadurch von dem Stiere, daß sie kleiner und schlanker gebaut ist und bei weitem kürzere Hörner hat. Nach Hodgson besteht die Wirbelsäule, außer den Hals-, aus vierzehn Rippen-, fünf Lenden-, fünf Kreuzbein- und achtzehn Schwanzwirbeln.
Das Dschungelrind oder der Gaur und Gauwa der Hindu, Karkona oder »Waldbüffel« der Canaresen, Gawiyga der Mahratten, Urna der Mohammedaner Indiens ( Bos Gaurus, Bos oder Bibos cavifrons, Bibos subhemalachus), nach Hodgsons Ansicht Vertreter der Untersippe der Bisonochsen ( Bibos), steht dem Gayal jedenfalls sehr nahe, scheint jedoch durch verschiedene Merkmale des Aeußeren und Inneren, insbesondere durch die abweichende Rippenzahl, von diesem ständig abzuweichen. Traills erste Beschreibung ist zwar ziemlich ausführlich, aber wenig klar, so daß es sich empfiehlt, Elliot, welcher einen von ihm erlegten Gaur beschrieb, zu folgen. Nach Angabe dieses Berichterstatters unterscheidet sich der Dschungelochse wesentlich von dem gewöhnlichen indischen Rinde und nähert sich mehr dem Wisent und dem Bison, dessen Namen ihm die englischen Jäger beizulegen pflegen. Aus diesem Grunde hat man ihn vielleicht als ein Bindeglied zwischen der Gruppe der Bisonten und der Rinder anzusehen, wie man anderseits einen sehr nahen Verwandten des Vorweltstieres oder, was wohl dasselbe, des Auers in ihm erkennen will. Der Kopf ist kürzer als beim gemeinen Rinde, nach Elliots Ausdruck viereckig, die Stirne sehr breit, die Gesichtslinie gewölbt, die Muffel ausgedehnt, jedoch kleiner als bei dem Büffel und dem Hausrinde, Auge und Ohr kleiner als bei dem Büffel, der Hals kurz, dick und gedrungen, der Leib kräftig, die Brust breit, die Schulter, wie bei den meisten Rindern, erhaben, das Hintertheil viel schmäler und niedriger als das vordere, vom Rückenhöcker an steil abfallend, der Schwanz sehr kurz; die sehr entwickelten Beine, deren vorderes Paar merklich niederer als das hintere ist, fallen durch ihre ungemein kräftigen Schenkel und Schultertheile und die außerordentliche Stärke der Unterschenkel auf. Die an der Wurzel sehr starken, aber scharf zugespitzten Hörner sind seitlich des Stirnbeins angesetzt und biegen sich von hier aus in weitem Bogen leicht nach hinten und oben. Das auf dem Oberhalse und den Schultern sowie an den Schenkeln ungewöhnlich verdickte Fell ist mit kurzen, dichtstehenden, etwas fettigen Haaren bekleidet, welche sich am Unterhalse und der Brust um etwas, zwischen den Hörnern zu einem krausen Büschel verlängern. Ein schönes Dunkelbraun, die vorherrschende Färbung, geht auf der Unterseite in ein tiefes Ockergelb, an den Beinen in Schmutzigweiß, auf der Stirne in Lichtgraubraun und in der Augengegend in Grauschwarz über, wobei noch zu bemerken, daß die Vorderbeine seitlich und hinten ins Röthliche spielen. Die Iris hat lichtblaue Färbung. Nach Elliots Messungen beträgt die Gesammtlänge eines vollkommen erwachsenen Stieres dieser Art 3,8 Meter, die Schwanzlänge 85 Centim., die Schulterhöhe 1,9 Meter, die Kreuzhöhe vom Hufe bis zur Ansatzstelle des Schwanzes gemessen 1,7 Meter. Die Kuh unterscheidet sich vom Stier durch den kleineren und zierlicheren Kopf, den schwächeren Hals, den Mangel eines Höckers und das schwächere, an der Wurzel näher zusammengestellte, mit den Spitzen nicht gegen einander, sondern leicht nach hinten gekehrte Gehörn sowie die reiner weiße Färbung der Beine. Das Kalb hat dieselbe Färbung wie das betreffende Geschlecht seiner Eltern. Das wichtigste Merkmal des Schädels ist die außerordentliche Dicke der Knochen, welche, laut Hodgson, die des Hausrindes um das dreifache übertrifft; die Wirbelsäule besteht aus dreizehn rippentragenden, sechs Lenden-, fünf Kreuz- und neunzehn Schwanzwirbeln.

Gaur ( Bos Gaurus). 1/20 natürl. Größe.
Mit vorstehenden Angaben stimmen alle mir bekannten, unmittelbar von dem getödteten Gaur oder doch dessen Felle entnommenen Beschreibungen mehr oder weniger überein. Die gewaltige Größe des Thieres, die Stärke seiner Glieder, die Kürze seines Schwanzes, die blaue oder bläuliche Iris, die weiße Färbung der Beine wird stets hervorgehoben; der Gesammteindruck des so gezeichneten Bildes des Gaur ist daher ein von dem des Gayal verschiedener.
Die Lebensgeschichte beider Wildrinderarten ist, wie zu erwarten, bis jetzt noch unklar und verworren; es läßt sich also kaum sagen, welche oder wie viel von den meist von Jägern herrührenden Mittheilungen auf die eine oder andere bezogen werden müssen. Die meisten Berichterstatter sprechen von dem Gaur, die wenigsten von dem Gayal. Letzterer lebt im Nordosten und Osten von Bengalen, in den Waldungen der Gebirge, welche dieses Land von Arrakan trennen, und beweist durch seine Lebhaftigkeit und Gewandtheit, daß er ein Bergthier ist, besitzt auch in der That fast dieselbe Sicherheit im Klettern wie der Jak. Seine Lebensweise weicht von der anderer Rinder erheblich ab. Er hält sich in Herden zusammen, geht morgens, abends und bei hellen Nächten auf Nahrung aus, zieht sich vor der drückenden Mittagshitze in die dichtesten Wälder zurück und ruht dort wiederkäuend im Schatten, liebt das Wasser, nicht aber auch den Schmutz und meidet deshalb Sümpfe, wogegen er sich gern in klaren Bergwässern kühlt. Sein Wesen wird als sanft und zutraulich geschildert. Niemals wagt er einen Angriff auf Menschen, weicht ihnen vielmehr schon von weitem aus; gegen Raubthiere dagegen vertheidigt er sich muthig und soll selbst Tiger und Panther in die Flucht schlagen. Seine scharfen Sinne sichern und seine Gewandtheit und Schnelligkeit im Laufe retten ihn, wenn er sich überhaupt zur Flucht anschickt. Hier und da jagt man den Gayal, um sein Fleisch und Fell zu benutzen; weit häufiger fängt man ihn lebend ein. Die Kuki ermöglichen dies durch eine besondere List. Sie ballen aus Salz, Erde und Baumwolle Kugeln von der Größe eines Manneskopfes zusammen, um solche als Lockmittel zu verwenden, und ziehen mit zahmen Gayals den wilden entgegen. Nachdem die gezähmten, wie bald geschieht, mit ihren freien Brüdern sich vereinigt haben, werfen die Kukis jene Salzkugeln aus; die wilden Rinder, welche durch die zahmen an bestimmte Orte geführt werden, bemerken, daß in den Ballen eine Leckerei für sie enthalten ist, beschäftigen sich bald angelegentlich mit dem Belecken dieser Kugeln und fahren darin um so eifriger fort, je mehr die durch die Baumwolle gut verbundene Masse Widerstand leistet. Listig sorgen die Kuki für immer neue Zufuhr und halten so die wilden und zahmen Herden monatelang zusammen, bis beide innig vertraut geworden sind. Nunmehr nahen sich die Leute, welche sich anfangs in einem gewissen Abstande hielten, um ihr Wild nicht in Unruhe zu versetzen, mit zahmen Gayals mehr und mehr der großen Herde, gewöhnen diese nach und nach an den Anblick des Menschen, begeben sich dann mitten unter sie und streicheln ruhig und gelassen ihren zahmen Thieren Hals und Rücken, werfen dabei den wilden neuen Köder zu, strecken wohl auch ihre Hand nach einem und dem anderen aus und schmeicheln ihnen, wie vorher den zahmen, kurz, gewöhnen die Wildrinder nun auch an sich selbst und lehren sie, ohne irgendwelchen Zwang anzuwenden, ihnen zu folgen, bis eines schönen Tages die ganze Gesellschaft inmitten eines Dorfes angelangt ist. Gutmüthig und gleichgültig lassen sich die Gayals fortan auch die engere Gefangenschaft gefallen, gewöhnen sich sogar nach und nach so an ihr Dorf, daß die Kuki, wenn sie ihren Wohnsitz mit einem anderen vertauschen wollen, genöthigt sein sollen, ihre Hütten zu verbrennen, weil die Herden sonst immer wieder in die früheren Ställe zurückkehren würden.
Bei einigen Hindustämmen gilt der Gayal, wie der Zebu, für ein heiliges Thier. Man wagt es nicht, ihn zu tödten, sondern treibt ihn, wenn man den Göttern ein Opfer bringen will, höchstens nach den heiligen Hainen auf die Weide. In anderen Ländern dieses großen Reiches dagegen verwendet man die neu eingefangenen zuweilen zu Stiergefechten und ißt dort auch ohne Gewissensbisse ihr Fleisch. Zahme Herden besitzen namentlich die Gebirgsvölker der Provinzen Thipura, Silhead und Tschittagong. In der Neuzeit haben die Engländer versucht, das wichtige Thier in Bengalen einzuführen; es sagen jedoch auch dem zahmen Gayal nur waldige, schattige Gegenden zu, nicht aber heiße Landstriche, in denen er sehr leicht zu Grunde geht. Zur Arbeit wird er nirgends verwendet; die Kuki verschmähen es sogar, von seiner Milch Gebrauch zu machen.
Die Kuh bringt nach acht- bis neunmonatlicher Tragzeit ein Kalb zur Welt und säugt dieses durch acht bis neun Monate, geht aber im nächsten Jahre gelte. Mit anderen Rinderarten, beispielsweise mit dem Zebu, paart sich der Gayal, und die aus solcher Vermischung hervorgehenden Blendlinge sind ebenso gut unter sich wie mit Verwandten wiederum fruchtbar.
Viel bestimmter lauten die Berichte über den Gaur. Nach Elliots Erhebungen bevölkert das gewaltige Thier alle großen und zusammenhängenden Waldungen ganz Indiens, vom Kap Komorin bis zum Himalaya, insbesondere aber den Süden der Halbinsel, nach Fischer, Rogers und Thompson mit Vorliebe die Hügel und Berge, unter allen Umständen in den dichtesten Waldungen seinen Aufenthalt nehmend. Rogers jagte ihn auf dem Meinepatgebirge, einem einzeln sich erhebenden Bergzuge der Provinz Sergoja im südlichen Bahar, welcher eine etwa vierundzwanzig englische Meilen breite, sechsundzwanzig englische Meilen lange, gegen sechshundert Meter über dem ebenen Lande liegende Tafelebene trägt und an schroff abfallenden Wänden, an engen, dicht bewaldeten und wohl bewässerten Schluchten, dem Lieblingsaufenthalte des Gaur, sehr reich ist. In diesen dunklen, dicht verwachsenen Wildnissen finden sich, laut Traill, große, von oben herabgestürzte Felstrümmer, welche Bären und Tigern sichere Schlupfwinkel darbieten und deren Vermehrung so günstig sind, daß fünfundzwanzig Dörfer, welche einst auf dem offenen Tafellande lagen, der Raubthiere wegen von den Eingeborenen verlassen worden sind. Thompson schildert andere, in den westlichen Gaut- oder Suchiadribergen gelegene Aufenthaltsorte des Thieres, welche ähnlich wie jene beschaffen sein müssen. Was man Ebene nennen könnte, gibt es hier nicht; das ganze Gebirge ist nichts anderes als eine Folge der schroffsten Hügel mit tief eingerissenen wilden Schluchten dazwischen, welche, einige nackte Hügel ausgenommen, eine fast undurchdringliche, aus Büschen, Hecken, riesigen Farnen und blühenden Gewächsen bestehende Pflanzenwelt bedeckt und Trümmermassen überschütteten. Unter diesen so furchtbaren Umgebungen, so ungefähr drückt sich Rogers aus, behauptete sich der Gaur seit den ältesten Zeiten und zwingt selbst die Raubthiere, gewisse Strecken ihm gänzlich zu überlassen. Nach Versicherung der Eingeborenen soll sogar der Tiger vor dem erwachsenen Stiere das Feld räumen und sich höchstens von Zeit zu Zeit eines schwachen oder unbewachten Kalbes bemächtigen. Elliots und Fischers Mittheilungen widersprechen diesen Angaben nicht, obschon sie das Wesen des Thieres in ein milderes Licht stellen. Nach Fischer hält sich der Gaur für gewöhnlich auf den kühlen Höhen der Hügelkette auf, kleine Herden bildend, aus denen, wie bei anderen Rindern, die alten bösartigen Stiere entweder freiwillig ausscheiden, um mürrisch und grollend zu einsiedeln, oder von dem jüngeren Nachwuchse vertrieben werden. Wenn jedoch das Gras der Hügel durch die Hitze gedörrt oder durch Feuer vernichtet worden ist, vereinigen sich die einzelnen Trupps zu zahlreichen Herden, welche nun in geschlossenem Verbande die noch grünen Waldungen durchstreifen, sich aber, wenn die ersten Regenschauer gefallen sind und neues Wachsthum ins Leben gerufen haben, wieder trennen, um in gewohnter Weise zu leben. Bei ungünstigem, namentlich stürmischem Wetter bergen sich die Thiere in den Thälern, um den Unannehmlichkeiten der Witterung zu entgehen, und ebenso flüchten sie vor Mücken und Bremsen, welche sie arg quälen. In den Monaten Juli und August steigen sie in der Gegend von Salem regelmäßig in die Ebene hinab, wie es scheint, einzig und allein zu dem Zwecke, um die von Natron oder Soda geschwängerte Erde zu belecken und dadurch einen Ersatz für das ihnen fehlende Salz sich zu verschaffen. Wie alle übrigen Wildrinder, lebt der Gaur unter allen Umständen möglichst zurückgezogen, die Nähe des Menschen fast ängstlich fliehend. »Ich habe«, sagt Thompson, »eine erhebliche Anzahl dieser Wildstiere gesehen, aber nicht einen einzigen kennen gelernt, welcher nicht den lebhaftesten Wunsch bekundet hätte, ein Zusammentreffen mit mir zu vermeiden.« Gewöhnlich weidet der Gaur nur des Nachts, am liebsten da, wo junges Gras aufschießt, welches er nebst den zarten Bambusschößlingen allem übrigen bevorzugt. Wenn er aber in der Nähe des bebauten Landes lebt, fällt er plündernd in die Felder ein und wird unter Umständen so zudringlich und dreist, daß er sich kaum von hier vertreiben läßt. Gegen Morgen kehrt er von der Weide zurück und verbirgt sich nun entweder in den hochstämmigen Grasfeldern oder in jungen Bambusdickichten, um hier zu ruhen, zu schlummern und wiederzukäuen. Bei irgend welcher Störung erhebt sich dasjenige Stück, welches jene zuerst wahrnahm, stampft kräftig mit dem Fuße auf den Boden, als wolle es die übrigen Schläfer aufregen, und die ganze Gesellschaft bricht hierauf in wilder Flucht durch das Dickicht, vor keinem Hindernisse zurückschreckend. Wird eine weidende Herde überrascht, so stutzen alle Glieder derselben einen Augenblick und stürmen sodann mit einem lauten und kurzen Schnauben davon. Die Gulis erzählen, daß sie oft viele Gaurs sehen, wenn sie ihre Herden in den an ihre Felder grenzenden Forsten weiden. Nach Versicherung dieser Leute sind jene ängstlicher und wachsamer als irgend ein anderes Thier, ruhen jederzeit in einem Kreise, mit den gehörnten Häuptern nach außen gewendet, um sofort über eine nahende Gefahr unterrichtet zu werden, und zeigen sich stets zur Flucht bereit. Auch Fischer bestätigt diese Mittheilung, fügt aber hinzu, daß einzelne, welche ihren Wohnsitz in der Nähe von Feldern aufschlagen und in ihnen ohne alle Beschwerlichkeit sich ernähren, bald die entgegengesetzten Eigenschaften bekunden und, anstatt sich vertreiben zu lassen, die Eigenthümer des Feldes verjagen.
Während der Brunstzeit bestehen die alten Stiere erklärlicherweise heftige Kämpfe mit gleichstrebenden, verbannen auch in der Regel alle jüngeren von der Herde, bis endlich an sie die Reihe kommt, vor dem gemeinsamen Angriffe der letzteren weichen zu müssen. Nach Angabe Fischers ist die Trächtigkeitsdauer des Gaur dieselbe wie die des Hausrindes. Die Kälber werden nach dem Regen geboren, also ungefähr zwischen Juli und Oktober, hier früher, dort später.
Jung eingefangene Kälber lassen sich ebenso leicht zähmen wie andere südasiatische Wildrinderarten, wie es scheint, aber nicht leicht am Leben erhalten; Fischer wenigstens gab sich vergebliche Mühe, eins von den vielen, welche er nach und nach besaß, groß zu ziehen. Die von ihm gepflegten starben, die einen früher, die anderen später, sämmtlich nach kurzem Kranksein an einer eigenthümlichen Seuche, welche gleichzeitig auch unter den wilden Artgenossen herrschte. Fischers Gefangene wurden niemals wirklich zahm, und die Hauskühe waren nicht zu bewegen, sie saugen zu lassen; Elliot dagegen sah ein junges Kalb im Besitz einiger Gulis, der Eigenthümer einer großen Büffelherde, welches sofort nach der Geburt eingefangen und nach sieben Monaten so weit gezähmt worden war, daß es die Hand seiner Pfleger beleckte und mit den Büffelkälbern in der gemüthlichsten Weise verkehrte und spielte.
Die Gefährlichkeit der Jagd ist vielfach übertrieben worden, jedoch nicht in Abrede zu stellen. So scheu und ängstlich sich der Gaur dem Eindringling gegenüber zeigt, so ingrimmig fällt er denselben an, wenn er verwundet wurde. Unter solchen Umständen ist der Angreifer stets gefährdet, und in der That haben, wie Fischer erfuhr, viele Jäger ihr Unterfangen, Gaurs zu erlegen, mit ihrem Leben bezahlen müssen: so unter anderen in den dreißiger Jahren zwei englische Officiere, welche beide von wüthenden Stieren dieser Art getödtet wurden. Die Gefahr der Jagd ist um so größer, je stärker die angetroffenen Herden sind, weil die muthigen Geschöpfe einen bedrohten Gefährten nicht im Stiche lassen, sondern gemeinschaftlich auf ihren Gegner losgehen. Elliot schildert in sehr lebendiger Weise solche Jagd auf einen einzelnen Bullen, dessen Fährte ein Schikari oder eingeborener Büffeltreiber durch Dickicht und Wasser mit der Sicherheit eines Spürhundes verfolgt hatte, bis die lautlos hinter ihm herschreitenden Jäger endlich in schußgerechter Nähe an seinem Schlummerplatze angekommen waren und mehrere Kugeln auf ihn abgeben konnten. Obwohl schwer verwundet, stürzte das Thier doch wüthend auf die Angreifer los, welche genöthigt waren, hinter dicken Bäumen Zuflucht zu suchen, um den wiederholten Angriffen desselben zu entgehen, und letztere wurden nur deshalb nicht von Erfolg gekrönt, weil eine der Kugeln den Schulterknochen zertrümmert und so die volle Beweglichkeit des Stieres wesentlich verringert hatte. Erschöpft und abgemattet brach der schwer verwundete Kämpe nach geraumer Zeit nun zwar zusammen, aber noch immer schnaubte er wüthend und versuchte sich wieder zu erheben, wenn einer von der Jagdgesellschaft ihm sich näherte, bis schließlich eine auf den Schädel gerichtete und diesen zerschmetternde Kugel ihn von neuem zu Boden warf. Doch noch immer war er nicht verendet, und noch mehrere Kugeln mußten auf Haupt und Kopf abgefeuert werden, bevor er sein Leben aushauchte. Leichter und sicherer als solche Birschjagd führt den Jäger ein geschickt eingerichtetes Treiben zum Ziele. Wenn der Gaur durch die Treiber aufgeregt, aber noch nicht bedrängt wurde, schlendert er mit langsamen und schweren Schritten dahin, wenn ihm dagegen die Leute näher auf den Leib rücken, fällt er in einen rasenden Galopp, stürmt mit derselben Leichtigkeit, mit welcher ein Pferd durch ein Kornfeld laufen würde, in gerader Linie durch das verschlungenste Dickicht, dessen Aeste und Zweige prasselnd über ihm zusammenschlagen, und macht, wie Thompson sich ausdrückt, das Gebirge auf weithin erdröhnen. Seine Witterung ist so schwach, daß er bei jedem Winde gegen den auf einem Wechsel ausgestellten Jäger anrennt. Dieser hat zwar ein leicht zu fassendes Ziel vor sich, fällt sein Wild aber nur durch einen Schuß, welcher das Herz trifft.
Das Fleisch des Gaur ist, nach Thompsons Meinung, ungleich feiner als das jedes Hausrindes, wird auch von allen Hindus, welche einer bestimmten Kaste nicht angehören, gern gegessen, wogegen die übrigen Eingeborenen es nicht genießen, weil sie in dem Thiere einen Verwandten des geheiligten Rindes erblicken. Aus diesem Grunde weigern sie sich auch, einem Jäger behülflich zu sein, lassen ihren Widerstand in der Regel jedoch durch Geld besiegen.
Als das schönste aller bekannten, noch heutigen Tages wildlebenden Rinder muß ich den Banteng ( Bos Banteng, Bos sondaicus) erklären, ein Thier, welches hinsichtlich der Zierlichkeit seines Baues mit mehr als einer Antilope wetteifern kann und sich außerdem durch ansprechende Färbung auszeichnet. Der Kopf ist klein, aber breit, an der Stirnleiste erhaben, die Stirn eingebuchtet, der Gesichtstheil bis zur Schnauze verschmälert, vor derselben wegen der verdickten Lippen etwas aufgetrieben, die Muffel sehr groß, gewölbt, den Raum zwischen den Nasenlöchern, welcher die ganze vordere Lippe einnimmt, in der Mitte durch eine Furche getheilt, das tief dunkelbraune Auge groß und feurig, das Ohr groß, länglich rund, an seinem Innenrande sanft gewölbt, am Außenrande ausgeschweift, der Hals kurz, unmittelbar hinter dem Kopfe auffallend verschmächtigt und hierauf sehr verdickt, der Leib kräftig, aber nicht massig, der Widerrist wenig erhaben, einen sehr in die Länge gezogenen Buckel darstellend, der Rücken gerade, der Hintertheil sanft abgerundet, das Kinn mit einer kleinen, der Unterhals mit einer großen hängenden Wamme geziert, der Schwanz mittellang, schwach, nach der Spitze zu gleichmäßig verjüngt, das Bein kurz, aber ebenfalls zierlich, der Huf rund und fein. Die an der Wurzel verdickten, unregelmäßig gewulsteten, vom ersten Drittheil ihrer Länge an aber glatten, unten ein wenig abgeflachten, übrigens gerundeten und ziemlich scharf zugespitzten Hörner biegen sich zuerst in einem einfachen Bogen nach außen und rückwärts, hierauf nach oben und vorn, mit der Spitze aber nach oben und innen, und erreichen eine Länge von 40 bis 50 Centim. Das überall gleichmäßige, dicht anliegende Haarkleid hat dunkel graubraune, nach hinten etwas ins Röthliche spielende Färbung; ein Fleck an der oberen Ecke des Nasenloches und ein Streifen über der Oberlippe sind fahlbraun, die Oberlippe, soweit sie behaart, die Unterlippe, ein sehr kleiner Fleck auf der Unterseite des Unterkiefers, ein breiter Spiegel, welcher als das augenfälligste Merkmal betrachtet werden kann, die untere Hälfte der Beine, die wimperartige Behaarung des inneren und oberen Ohrrandes sowie endlich der äußere Ohrwinkel sind weiß, die mit kurzen Haaren bekleideten Spitzen der Ohren fleischfarben, die Wurzeln derselben, etwa das untere Drittheil umfassend, schwarz. Bei der merklich schlanker und zierlicher gebauten Kuh herrscht anstatt der graubraunen eine hell röthlichbraune Färbung vor, von welcher außer dem weißen Abzeichen ein dunkler, auf dem Widerriste beginnender, bis zur Schwanzwurzel fortlaufender Rückenstreifen deutlich sich abhebt; das Kalb ähnelt der Mutter. Die Gesammtlänge wird, einschließlich des 85 Centim. langen Schwanzes, auf 2,9 Meter, die Höhe am Widerriste auf 1,5 Meter angegeben. Die Anzahl der Rippenpaare beträgt dreizehn, die der Lendenwirbel sechs, der Kreuzwirbel vier, der Schwanzwirbel achtzehn.

Banteng ( Bos Banteng). 1/20 natürl. Größe.
Nach Angabe Salomon Müllers erstreckt sich das Verbreitungsgebiet des Banteng, welcher auf den Sundainseln den Gayal zu vertreten scheint, über Java, Borneo und den östlichen Theil Sumatras. Laut Junghuhn und Haßkarl beschränkt sich sein Aufenthalt auf gebirgige Wälder, innerhalb eines zwischen 600 bis 2000 Meter über dem Meere gelegenen Höhengürtels; Müller dagegen sagt ausdrücklich, daß er auch in den Waldungen längs der Küste gefunden werde. »Am liebsten nimmt er in feuchten oder moorigen, überhaupt wasserreichen Waldestheilen seinen Stand, weshalb ihm flache Bergthäler mit langsam strömenden Flüssen mehr als alle übrigen Waldestheile gefallen.« Auf Java findet er sich überall und kommt in den Gebirgen des östlichen Theiles, dem Kelut, Konvi, Tengger, Semeru und anderen ebenso häufig vor wie auf den Bergen, welche an die Sundastraße grenzen, soll außerdem auch noch in anderen Waldungen gefunden werden, ist aber in vielen, zwischen den angegebenen Höhen liegenden Gegenden der Insel, wo die Wildnisse vor der zunehmenden Bebauung gewichen sind, bereits zurückgedrängt worden. Einen bevorzugten Aufenthalt bilden die Hochwaldungen der Preanger Regentschaft, besonders der Gegenden, welche sich in Höhen von 1200 bis 2000 Meter südwärts der Hochebene Bandon ausbreiten. »Dort«, sagt Junghuhn, »fügt es der Zufall zuweilen, daß man Stiere und Nashörner überrascht, wenn sie am Rande eines Sumpfes grasen, das Wasser einer salzigen Quelle schlürfen oder nach Art zahmer Büffel in einer Schlammpfütze liegen. Findet man den dicken Leib des Nashorns mit seinem gefalteten und gerunzelten Felle plump, ja abschreckend und furchteinflößend, so kann man dem Stiere, welcher fast ebenso groß, aber viel schlanker gebaut ist, das Zeugnis wilder Schönheit nicht versagen, wenn er beim Anblicke des Reisenden aufspringt und dahinschnaubt in den Wald. Den Mist und die Fährten auf den Pfaden, welche der Stier sich durch den Wald gebahnt hat, sieht man täglich und überall, bekommt ihn selbst aber wenig zu Gesicht, weil er sich beim geringsten Geräusche, welches er im Walde hört, in die dichtverwachsensten Schlupfwinkel zurückzieht.« Wie es scheint, geht er übrigens nur ausnahmsweise bei Tage auf Aesung aus, wählt hierzu vielmehr die Nacht. »Obschon wir«, bemerkt Müller, »unser Lager wochenlang in Gebirgswäldern aufgeschlagen hatten, in denen er selten war, hörten wir ihn doch allnächtlich in unserer Nähe.«
Nach Angabe desselben Forschers lebt auch dieses schöne Wildrind in kleinen Gesellschaften, welche aus einem leitenden Stiere und vier bis sechs Kühen bestehen. Alte unverträgliche Stiere werden von dem jungen Nachwuchse gemeinschaftlich vertrieben und pflegen dann grollend und mürrisch zu einsiedeln. Die weichsten und saftigsten Gräser, welche den Waldboden decken, Blüten, Blätter und Triebe verschiedener Bäume und Sträucher bilden die Nahrung des Banteng; insbesondere äst er sich von jungen Sprossen und Blättern der Bambusen und des Allangallanggrases.
Die Wildheit und Scheu dieses Wildstieres macht seine Jagd zu einer ebenso gefährlichen wie beschwerlichen. Zwar flüchtet in der Regel auch er, wenn er die Annäherung eines Menschen wahrnimmt, achtet jedoch, in die Enge getrieben oder verwundet, den Jäger wenig, nimmt ihn nicht selten an und gebraucht dann seine spitzigen Hörner mit ebensoviel Geschick als Nachdruck. Nächst den einsiedlerisch lebenden Stieren sind die Kühe, welche saugende Kälber führen, am meisten zu fürchten. Man erlegt den Banteng mit der Kugelbüchse oder bei den Treibjagden im Allangallang mittels des schweren Waidmessers, welches der javanische berittene Jäger zum Niederhauen des getriebenen und von ihm eingeholten Wildes gebraucht, in diesem Falle jedoch nur Kühen und jungen Stieren gegenüber und durchaus nicht, ohne gefährdet zu sein, in Anwendung zu bringen pflegt, stellt ihm außerdem Schlingen oder fängt ihn in Erdgruben, welche mit Zweigen und Blättern bedeckt sind, um des Fleisches und Felles habhaft zu werden. Das Wildpret der jungen und halb erwachsenen Bantengs findet, seiner Zartheit und des ihm eigenen feinen Wildgeschmackes wegen, auch der Europäer vortrefflich, das zähe und harte, etwas nach Moschus riechende Fleisch alter Stiere dagegen nur der arme Javane überhaupt genießbar.
Erwachsene Bantengs lassen sich nicht zähmen, Kälber hingegen vollständig zu Hausthieren gewinnen, da das Wesen des Thieres sanfter und milder zu sein scheint als das aller übrigen bekannten Wildstiere. Solche Kälber weiden dann in Gemeinschaft der Hausrinder, paaren sich und erzeugen später mit ihnen wohlgestaltete Blendlinge, so daß auf Java von jeher die Gewohnheit bestand, zahme Kühe in die Wälder zu treiben, um sie von den wild lebenden Bantengstieren beschlagen zu lassen.
In den letzteren Jahren sind mehrere Bantengpaare lebend nach Europa gekommen und im Verlaufe der Zeit in alle größeren Thiergärten gelangt, da sie sich auch bei uns zu Lande leicht in der Gefangenschaft fortpflanzen. Ihr mildes und sanftes Wesen unterscheidet sie sehr zu ihrem Vortheile von den meisten ihrer Verwandten und steht so recht eigentlich im Einklange mit ihrer Schönheit, welche das Auge des Forschers wie des Landwirtes auf sich lenkt. Schon im zweiten oder dritten Geschlechte betragen sie sich kaum anders als unsere Hausrinder, begeben sich willig unter die Oberherrschaft des Menschen, lernen ihren Pfleger nicht allein kennen, sondern gewinnen nach und nach eine entschiedene Zuneigung zu ihm, gewöhnen sich an das bunte Getriebe der Besucher des Gartens, nähern sich auch Fremden vertrauensvoll, um ihnen gereichte Leckerbissen entgegenzunehmen und lassen überhaupt kaum merken, daß sie nicht von Alters her Hausthiere gewesen sind. Nur der Stier tritt dann und wann noch nach Art eines freigeborenen Rindes auf, indem er sich zuweilen launig und widerspenstig zeigt, unter Umständen auch wohl in Zorn geräth und dann sogar seinen Wärter bedroht; doch läßt sich selbst mit ihm mindestens ebenso gut umgehen wie mit einem gewöhnlichen Hausbullen, von den halbverwilderten Hausrindern Spaniens oder der südosteuropäischen und südamerikanischen Steppenländer ganz zu schweigen. Jedenfalls dürfte sich der Banteng mindestens ebenso leicht wie Jak und Gayal, ja um so leichter zum Hausthiere gewinnen lassen, als fast alle Kälber der in den verschiedenen Thiergärten gehaltenen Paare im Sommer geboren wurden. Diese Kälber stelzen anfangs in auffallend plumper Weise einher, weil sie, abweichend von anderen mir bekannten Rindern, nur auf den äußersten Rand ihrer Hufe sich stützen und demgemäß ihre Beine und Füße sehr steif halten, treten aber bereits nach etwa acht oder zehn Tagen kräftig auf, gefallen sich dann, wie andere im Kindesalter stehende Verwandte, in munteren Spielen aller Art und bekunden dabei eine Behendigkeit und Gewandtheit, welche von den ungeschickten Bewegungen anderer, selbst von wilden Rindern stammenden Kälber höchst vortheilhaft absticht. Die Mutter nimmt sich ihrer mit einer wahrhaft rührenden Zärtlichkeit an, und ihr so mildes Wesen gelangt auch bei Behandlung des Sprossen in ersichtlicher Weise zum Ausdrucke. Damit steht nicht im Widerspruche, daß sie jede von außen kommende Störung nach besten Kräften abzuwehren sucht und sich, so lange das Kälbchen klein ist, selbst gegen ihren sonst geliebten Wärter unwillig, trotzig und sogar angriffslustig benimmt.
Alle bisher eingehender geschilderten Rinder haben wahrscheinlich keinen oder, wenn wirklich, doch nur einen höchst geringen Antheil an der Erzeugung unseres Hausrindes gehabt. Das Dunkel, welches über dem Ursprunge dieses überaus nützlichen, seit uralter Zeit dem Menschen unterworfenen Geschöpfes liegt, will zwar nicht so tief erscheinen wie das, welches uns die Entstehungsgeschichte anderer Hausthiere verhüllt, konnte jedoch bisher ebensowenig wie bei letzteren vollkommen gelichtet werden. Ziemlich übereinstimmend nimmt man gegenwärtig an, daß die Rinder, welche in allen drei Theilen der Alten Welt mehr oder weniger gleichzeitig in den Hausstand übergingen, nicht auf eine einzige, sondern auf verschiedene Stammarten zurückzuführen sind; zur Bestimmung besagter Stammarten reicht aber auch die kühnste Deutung der bisher aufgefundenen Schädel ausgestorbener Wildstiere nicht aus. Wie aus vorstehendem ersichtlich geworden, werden allerdings auch heutigen Tages noch mehrere wilde Rinder gezähmt und zu Hausthieren gewonnen oder wenigstens zur Veredelung der Hausrinderstämme benutzt; die Zeit aber, in welcher der Mensch zuerst den wilden Stier bändigte oder, was wahrscheinlicher, aus seinen jung eingefangenen Nachkommen eine Herde bildete, liegt jenseits aller Geschichte und Sage. Die frühesten Erzählungen gedenken zahmer Rinderherden; auf den ältesten Denkmälern der Länder, welche wir als die Pflanzstätten der Bildung und Gesittung betrachten, finden wir sie abgebildet; aus dem schlammigen Grunde rings um die Pfahlbauten wühlen wir ihre Ueberreste hervor. Nicht mit Unrecht legen wir auf letztere ein sehr bedeutendes Gewicht; ihre sorgfältigste Untersuchung aber bringt ebensowenig wie die Vergleichung uralter bildlicher Darstellungen mit den heutzutage lebenden Rinderrassen vollständige Klarheit in die noch in mehr als einer Beziehung rätselhafte Frage, enthüllt uns das Geheimnis des Ursprungs noch keineswegs. »Ebenso wie die Ziege«, schreibt mir mein gelehrter Freund Dümichen, »finden wir auch das Rind schon in den frühesten Zeiten als Hausthier der Nilthalbewohner. Mit besonderer Vorliebe rühmen sich vornehme Egypter in den Inschriften ihrer Gräber des Besitzes zahlreicher Rinderherden, und aus den uralten Zeiten des Reiches massenhaft uns vorliegenden Abbildungen von lang- und kurzhörnigem Rindvieh, von Stieren, Kühen und Kälbern, hier in Herden auf der Weide oder ein Gewässer durchschwimmend, dort einzeln vom Treiber am Stricke geführt, oder paarweise an den Pflug gespannt, auf der Tenne das Getreide austretend oder im Stalle untergebracht, wo viele Knechte sie füttern, stricheln und melken, auch wohl kranke Thiere sorgfältig untersuchen und ihnen Arznei eingeben, hier eine Begattungsscene, dort das Kalben einer Kuh, daneben zwei in Wuth mit einander kämpfende Bullen und dort wieder das Niederwerfen und Schlachten des Opferstieres: aus allen diesen Darstellungen geht hervor, welche große Sorgfalt der Rinderzucht im alten Egypten zugewendet wurde. Diese in treffenden Zeichnungen gegebenen Thierbilder ins Auge fassend, erkennen wir in denselben deutlich drei verschiedene Rinderrassen: erstens einen Langhornschlag, die verbreitetste Rasse, welcher zugleich die hohe Ehre zu theil wurde, den heiligen Apisstier zu liefern, wieder in drei Spielarten mit gleich mächtig langen, aber entweder leier- oder halbmondförmig gebogenen oder mit mehr oder minder weit von einander abstehenden Hörnern zerfallend; zweitens eine Kurzhornrasse, jener ganz ähnlich, aber mit kurzen, viertelkreisförmig gebogenen Hörnern und drittens Buckelochsen, gewöhnlich unter den von Sudânvölkern gebrachten Tributgegenständen abgebildet.« In Betreff dieser drei deutlich zu unterscheidenden Rassen bemerkt Hartmann folgendes: »Die Beschaffenheit des Kopfes bei allen diesen Rindviehbildern zeigt die Merkmale des Zebukopfes; man sieht dies schon deutlich an den so häufig dargestellten Kälbern. Da beobachtet man die nach hinten verschmälerte Stirn, das geringe Vortreten des Augenhöhlenrandes, die auffallende Flachheit und Geradheit der ganzen Gesichtslinie. Der Buckelochse, noch gegenwärtig im ganzen inneren Afrika verbreitet, ist Stammthier des alt- und neuegyptischen Hausrindes, dieses selbst eine Höckerrindrasse. Apisschädel aus Memphis zeigen vollkommene Uebereinstimmung mit Buckelochsenschädeln aus Sennâr. Dringt man nun von Unteregypten an nilaufwärts durch Nubien und Dongola nach Sennâr vor, so bemerkt man, wie sich das hochnackige egyptische Hausrind allmählich in den echten innerafrikanischen Buckelochsen verwandelt. Im Süddongola und der Bahiudasteppe trifft man nur noch Buckelochsen. Die alte egyptische Langhornrasse, besonders die leierhörnige, gleicht durchaus dem Sanga der Abessinier; ihm fehlt zwar der hohe Fettbuckel, indessen ist dieser auch beim reinen Buckelochsenschlage Innerafrikas oft nur sehr schwach entwickelt. Die alte egyptische Langhornrasse ist gegenwärtig ausgestorben; selbst die verhältnismäßig langhörnigen Rinder, welche man hier und da in Egypten umherlaufen sieht, kommen hinsichtlich der Größe ihres Gehörnes niemals den alten Langhörnern gleich. Rinderpesten und rohe Vernachlässigung haben dem egyptischen Rindviehbestande im Laufe der Jahrhunderte großen Abbruch gethan, und um die Abgänge zu ersetzen, hat man fort und fort bis in die neueste Zeit hinein mächtige Herden des kurzhörnigen Sennârbuckelochsen nach Egypten getrieben und daselbst mit den Resten der dortigen lang- und kurzhörnigen Landesrasse gekreuzt. Hierdurch ist der Langhornschlag in Egypten allmählich vertilgt oder vielmehr in eine Kurzhornrasse übergeführt worden. Daß nun der nach Egypten und Unternubien gebrachte und daselbst vielfach gekreuzte gewaltige Buckelochse Sennârs in seinen nördlichen Nachkommen verkümmert und zu einem hochgestellten schmächtigen, fast antilopenartigen Rinde ohne Fetthöcker ausgeartet ist, muß wohl zum großen Theile in klimatischen Verhältnissen, veränderter Lebensweise und in der schlechten Pflege gesucht werden, welche der egyptische Bauer wie der Nubier seinem Rindvieh angedeihen läßt.«
Wir ersehen also aus Dümichens Angabe, daß im alten Egypten schon in frühester Zeit verschiedene Rinderrassen vorhanden waren, und aus Hartmanns Mittheilung, daß einzelne derselben vollständig verschwunden sind oder sich doch bis zur Unkenntlichkeit verändert haben, wogegen wiederum andere in allen wesentlichen Stücken sich gleich blieben.

Sanga ( Bos africanus). 1/25 natürl. Größe.
Der bereits erwähnte Sanga ( Bos africanus ), welcher sich seit Jahrtausenden nicht merklich verändert hat, darf wohl als die schönste Rasse aller Buckelochsen angesehen werden: er ist groß, schlank, aber doch kräftig gebaut, hochbeinig und ziemlich langschwänzig, der Buckel wohl entwickelt, das Gehörn sehr stark und von dem der meisten europäischen Rassen wesentlich verschieden, da die reichlich meterlangen Hörner an der Wurzel ziemlich nahe beisammen stehen, sich anfangs seitwärts, sodann in einem sanften Bogen nach auswärts, hierauf in gerader Richtung aufwärts, im Enddrittheil ihrer Länge nach einwärts, endlich aber mit der Spitze nach auswärts kehren, die Behaarung schlicht, fein und vorherrschend kastanienbraun gefärbt. In verschiedenen, unter sich nicht unerheblich abweichenden Rassen begegnet man diesem Thiere in ganz Mittelafrika und ihm mindestens sehr nahe stehenden Verwandten auch im ganzen Süden dieses Erdtheiles.
Obwohl merklich von ihm verschieden und ebenfalls in eine Reihe von Unterrassen zerfallend, müssen wir doch den Zebu- oder Höckerochsen ( Bos Zebu ) als ein ihm nahe stehendes Rind betrachten. Derselbe ist ungefähr ebenso groß, in der Regel aber verhältnismäßig stärker und kurzbeiniger als der Sanga, das Ohr lang und hängend, das Gehörn auffallend kurz, die Färbung minder gleichmäßig, da das gewöhnlich vorkommende Roth- oder Gelbbraun häufig auch in Fahlgelb oder Weiß übergeht, wie auch gescheckte Zebus keineswegs selten sind.
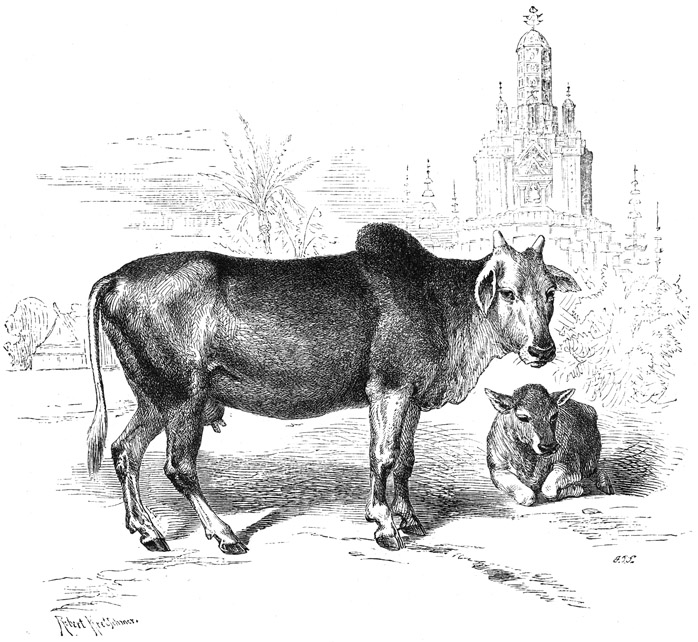
Zebu ( Bos Zebu). 1/28 natürl. Größe.
Die meisten Naturforscher von Linné bis Darwin sehen in diesem Zebu eine eigene Rinderart, andere betrachten ihn wie den Buckelochsen bloß als Spielart des Hausrindes überhaupt. Für beider Artselbständigkeit spricht, daß einzelne Theile des Gerippes wesentlich von denen unseres Hausrindes abweichen, daß der Zebu beispielsweise einen Kreuz- und zwei Schwanzwirbel weniger hat als das gemeine Rind, sowie ferner, daß er, wie Blyth hervorhebt, auch in der Lebensweise nicht unerheblich sich unterscheidet, selten den Schatten sucht und nicht in das Wasser geht, um hier, wie die europäische Art, knietief zu stehen etc. Gleichwohl läßt sich, unserer gegenwärtigen Kenntnis entsprechend, hierüber nicht so leicht urtheilen, und die entgegengesetzte Meinung anderer Forscher, welche in dem Höcker- und in dem höckerlosen Rinde nur eine und dieselbe Art sehen, nicht ohne weiteres verwerfen. Woher aber stammt das afrikanische, wie das indische in so viele Spielarten und Rassen zerfallende Höckerrind? Welcher wilden Art haben wir seine Entstehung zu verdanken? Auf diese Frage müssen wir zunächst noch die Antwort schuldig bleiben. Wohl wissen wir, daß der Zebu in einigen Theilen von Indien, vollkommen unabhängig von dem Menschen, in den Waldungen lebt und sich selbst in solchen aufhält, welche von Tigern bewohnt werden; man zweifelt jedoch nicht, daß die betreffenden Wildlinge nichts anderes sind als dem Menschen entflohene und wiederum selbständig gewordene Thiere, und sucht bis jetzt wenigstens vergeblich nach einer Stammart, welcher man die meisten Rechte auf Erzeugung der Zeburassen zusprechen könnte. Möglicherweise ist der Gayal oder Gaur an der Stammvaterschaft des Zebu mehr betheiligt als es einstweilen glaublich erscheinen will; denn es läßt sich eigentlich kein Grund erkennen, weshalb in Indien und Südasien überhaupt, wo erwiesenermaßen mehrere Rinder noch wild leben, nun gerade der Stammvater ausgestorben sein sollte. Letzterer kreuzt sich, wie verschiedene Versuche mit aller Bestimmtheit dargethan haben, leicht mit den übrigen Hausthierrassen und erzeugt mit solchen Blendlinge, welche in den verschiedensten Verhältnissen des Blutes fruchtbar sind.
Verhältnismäßig leichter erscheint die Lösung der Frage über die Stammvaterschaft der höckerlosen, also unserer europäischen Rinderrassen zu sein, obgleich auch in diesem Falle von einer Erledigung der Frage nicht gesprochen werden kann. Nach Rütimeyer sollen drei verschiedene Wildstierarten an der Stammvaterschaft der bis jetzt unterschiedenen vierzig bis fünfzig Rassen des in Europa lebenden Hausrindes betheiligt sein: erstens der Vorweltstier ( Bos primigenius), welcher wahrscheinlich mit dem oben erwähnten Auer als gleichartig angenommen werden muß, zweitens der Langstirnstier ( Bos longifrons) und der Breitstirnstier ( Bos frontosus), deren Reste man in verschiedenen Theilen Europas gefunden hat. Von letzterem glaubt Nilson, daß er möglicherweise der Stammvater des norwegischen Bergrindes sein könnte; den Langstirnstier betrachtet man als den Urvater des in der ersten neueren Steinzeit in der Schweiz als Hausthier lebenden und später durch die Römer nach England übergeführten Hausrindes, den Vorweltstier oder Auer als Erzeuger der stärkeren Rassen des Festlandes. Daß letzterer die größte Anwartschaft hat, als Stammvater der meisten Rassen unseres Rindes angesehen zu werden, ergiebt die Vergleichung seines Schädels mit dem des Hausrindes.
Nach Rütimeyers Ansicht leben unmittelbare, wenn auch entartete Nachkommen des Vorweltstieres noch heutigen Tages in halbwildem Zustande in größeren Thierparken Nordenglands und Schottlands; wenigstens versichert der eben genannte Forscher nach sorgfältigen Vergleichungen der Schädel des Vorweltstieres und eines ihm vom Lord Tankerville gesandten Schädels des Parkrindes, daß letzteres von dem Vorweltstiere weniger abweicht als irgend eine andere Rasse. Gegen Rütimeyers Ansicht lassen sich, wie wir sehen werden, Einwände erheben; für dieselbe spricht das hohe Alter der Rasse, welche das Parkrind darstellt. Wie Youatt erwähnt, war ein der Beschreibung nach dem Parkrinde ganz ähnliches Thier bereits im zehnten Jahrhunderte in Wales vorhanden. Vierhundert Stück weiße Rinder mit rothen Ohren wurden dem Könige Johann gesandt, hundert Stück eben solche, laut einer alten Urkunde, zur Sühne irgend eines Vergehens gefordert. Nachweislich lebte damals das Thier noch in wildem Zustande in einem Urwalde, welcher sich quer über ganz Nordengland und Schottland von Chillingham bis Hamilton erstreckte und in den beiden Parken gleichen Namens an den Rändern besagten Urwaldes ebenso wie das Rind noch erhalten ist. Schon um das Jahr 1260 wurde auf Veranlassung Williams von Farrarns der Park Chartly in Staffordshire durch eine Umzäunung abgeschlossen, in der Absicht, das wilde Rind auf jener moorigen Waldstrecke zu erhalten. Dieses Beispiel fand um so mehr Nachahmung, je seltener das wilde Rind wurde; auch andere Großgrundbesitzer verfuhren in gleicher Weise, und so sah man das Parkrind bereits vor der Reformation nur noch in geschlossenen Gehegen, von denen fünf bis auf die neuere Zeit erhalten wurden und meines Wissens noch bestehen. Ludwig Beckmann, der geistvolle Beobachter und Maler der Thiere, welcher im Spätherbste des Jahres 1874 eines dieser Gehege besuchte, theilt mir darüber folgendes mit.
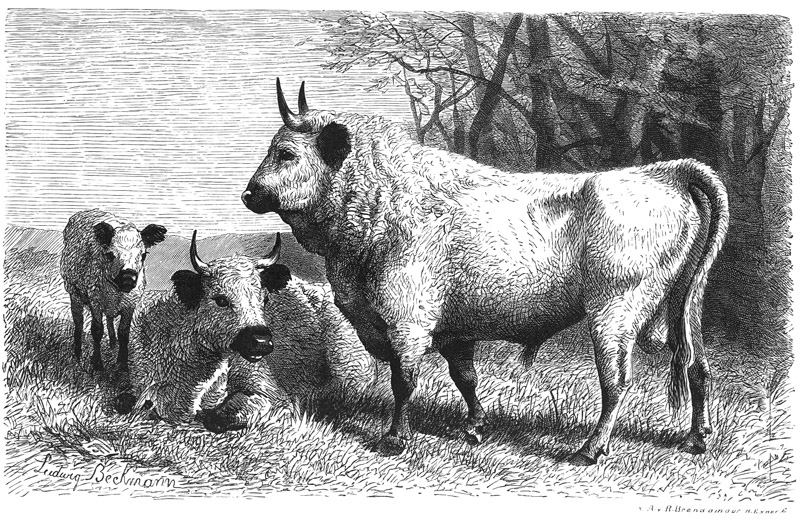
Parkrind
»In den prächtigen, meilenweiten Parks, welche die Sommerresidenz des Herzogs von Hamilton in Lanarkshire umgeben, befindet sich ein weites Gehege für gedachte Rinder. Die Landschaft erinnert sehr an die norddeutschen ›Huden‹; weite Rasenflächen, auf denen zahlreiche, mächtige Eichen unregelmäßig zerstreut sind; hier und dort deckt jüngerer Niederwald und Stockausschlag, über welchen die altersgrauen Strohdächer der Winter- und Fütterungsschuppen der Rinder malerisch hervorragen, weite Flächen. In unmittelbarer Nähe, an dem steil abfallenden Ufer des rauschenden Avon, liegen die Trümmer der alten Cadzonburg, welche dem jetzigen Rinderparke den Namen ›Cadzon-Forest‹ oder ›Cadzon-Wood‹ verliehen. Man behauptet, daß dieser Park mit seinen uralten, halb vermoderten Rieseneichen der letzte Ueberrest des ehemaligen kaledonischen Urwaldes sei, in welchem das Parkrind seit Urzeiten als wildes Thier gehauset haben soll. Ich habe nicht erfahren können, in welche Zeit die erste Einzäunung des Cadzonwaldes und die Umhegung seiner wilden Rinder fällt. Hector Boethius, der wohlbekannte schottische Geschichtschreiber, erwähnt dieses Rinderparkes in seiner im Jahre 1526 zu Paris erschienenen Geschichte Schottlands nicht, schildert aber in etwas abenteuerlicher Weise die unbändige Wildheit der vormals im kaledonischen Walde lebenden weißen Rinder, denen er eine flatternde Löwenmähne beilegt, und fügt hinzu, daß in den bergigen Geländen von Argyleshire und Norshire noch zu seiner Zeit ganze Herden ›ungezähmter Kühe‹ vorhanden waren. Die alte dichterische Auffassung vom weißen Bison mit der flatternden Mähne ist von späteren Schriftstellern festgehalten, unter anderen bekanntlich auch von Walter Scott mit großem Erfolge benutzt worden. Thatsache ist, daß das heutige Parkrind keine Mähne trägt, und in seiner ganzen äußeren Erscheinung auf den unbefangenen Beobachter gewiß eher den Eindruck einer sorgfältig rein gehaltenen, wohlgestalteten Spielart unseres Hausrindes als den eines ›Urrindes‹ macht. Schon die weiße Färbung dürfte für ein in dem milden Inselklima wild lebendes größeres Säugethier als ungewöhnlich betrachtet werden müssen; außerdem deutet das Ebenmaß der einzelnen Körperformen, der wagerechte Rücken, der hohe Ansatz des Schweifes und die Neigung und Entwickelung der faltenreichen Hautwamme alter Stiere, meiner Ansicht nach, auf eine seit langer Zeit bestandene Zähmung oder doch Beeinflussung seitens des Menschen. Das geschichtlich nachweisbar hohe Alter der Rasse gibt der Vermuthung Raum, daß dieselbe bereits in den heidnischen Vorzeiten, gleich den weißen Kühen der Hertha und den heiligen Stieren der Braminen, beim Götterdienste der Druiden eine Rolle spielten, und daß die oft erwähnten wilden weißen Bisons des kaledonischen Waldes möglicherweise nur die verwilderten Nachkommen jener heiligen Druidenrinder darstellen.
»Im Parke von Hamilton mußte die altberühmte Zucht der Parkrinder im Jahre 1760 wegen zunehmender Bösartigkeit beseitigt werden; die Thiere sind jedoch später wieder eingeführt worden. Die jetzt lebenden Parkrinder scheinen friedfertiger zu sein als ihre Vorfahren es waren; denn es ist mir von glaubwürdiger Seite mitgetheilt worden, daß man während der Dauer einer vor Jahren in Schottland wüthenden Rinderpest eine Anzahl derselben in den bei Hamilton gelegenen Kohlengruben untergebracht habe, um sie der gefürchteten Ansteckung zu entziehen.«
Bevor ich Beckmann weiter folge, will ich ältere Angaben wiederholen.
Das Parkrind ( Bos scoticus ) ist mittelgroß, stark, jedoch nicht plump gebaut, seine Behaarung dicht und kurz anliegend, auf Scheitel und Hals länger und gekräuselt, längs der Firste des Nackens bis zum Widerriste schwach vermähnt, seine Färbung, bis auf die Schnauze, die Ohren, Hörner und Hufe, milchweiß; die Ohren sind im Innern rothbraun, die vorderen Theile der Schnauze braun, die Augen schwarz umrandet, die Hufe schwarz, die mäßig langen, ziemlich dünnen, aber schlanken und scharf zugespitzten, vom Grunde an aus- und aufwärts gewendeten und mit den Spitzen wieder, aber kaum merklich nach einwärts gekehrten Hörner graulichweiß mit schwarzer Spitze. Die Wirbelsäule besteht aus dreizehn rippentragenden, sechs Lenden-, vier Kreuz- und zwanzig Schwanzwirbeln; das Parkwild kommt also zunächst mit dem Banteng, dem Zebu und dem Büffel überein und unterscheidet sich von dem gewöhnlichen Hausrinde durch die geringere Anzahl der Kreuz- und Schwanzwirbel. Innerhalb dreiunddreißig Jahren wurden ungefähr ein Dutzend Kälber mit braunen und blauen Flecken auf Wange und Nacken geboren, aber ebenso wie sonst fehlerhafte Thiere stets entfernt, ebensowohl um die Art oder Rasse vollkommen rein zu erhalten, als auch um einem absonderlichen Aberglauben zu fröhnen. In der Nachbarschaft von Chartly nämlich herrscht der Wahn, daß irgend ein Unglück dem edlen Hause von Ferrers bevorstehe, wenn von den weißen Parkrindern ein schwarzes Kalb geboren wird, weshalb man dem zu erwartenden Unfalle wenigstens nachträglich noch vorzubeugen sucht.
Laut Beckmann unterscheidet sich das Parkrind von Hamilton von dem des Geheges bei Chillingham durch etwas abweichende Färbung. »Bei ersterem sind nämlich, außer der Schnauze und den Augen, auch die ganze Außen- und Innenseite der Ohren kohlschwarz gefärbt und die Vorderbeine vom Hufe bis zu den Knien herauf schwarz gefleckt. Der übrige Körper ist milchweiß, bei alten Thieren, namentlich an Hals und Bauch, ins Schmutziggelbe oder Isabellfarbene übergehend. Die Behaarung ist weich, dicht, länger als beim gewöhnlichen Hausrinde und sanft gewellt, ohne jedoch eigentliche Zotteln zu bilden. Auf der krausen Stirne, längs des Nackens und Rückens verlängert sich das Haar bis zu etwa vier bis fünf Centimeter, ohne aber als Mähne ins Auge zu fallen. Ueberhaupt erscheint das Parkrind, aus einiger Entfernung gesehen, fast glatthaarig; nur der Hals der Stiere ist stark gekräuselt. Die schwarze Zeichnung der verschiedenen Zuchten scheint leicht abzuändern und kann wohl nur durch Zuchtwahl erhalten werden. Nicht selten sieht man Stücke mit leicht bläulich durchscheinenden Fleckchen an den Seiten des Kopfes und Rumpfes. Am lebenden Thiere ist dies allerdings schwer zu erkennen, desto deutlicher aber zeigt es sich an der Mehrzahl der ausgestopften Rinderköpfe, welche die Wände der Museen und Jagdhallen zieren. Auf einer mir vorliegenden Photographie eines frisch getödteten Hamilton-Parkrindes finden sich auf der linken Körperseite zahlreiche kohlschwarze Flecken. Bewick führt an, daß vor vierzig Jahren zu Chillingham verschiedene Kälber mit schwarzen Ohren und Nasen geboren wurden, welche der Wärter sofort tödtete. Blaine erwähnt, daß das Parkrind von Gisburne in Yorkshire völlig weiß mit braunen Ohren, dabei klein, beweglich und hornlos gewesen sei. Dieser letzterwähnte Schlag stammt aus der Whalley-Abtei in Lancashire und wurde, einer Ueberlieferung zufolge, bei Aufhebung des Klosters im Jahre 1540 durch die Macht der Musik durch Gisburne gelockt.«
Die vornehmen Besitzer aller in Schottland noch bestehenden Parks zeigen einen gewissen Stolz darin, diesen aus alter Zeit übrig gebliebenen Thieren ihren besonderen Schutz angedeihen zu lassen und verwenden nicht unerhebliche Summen auf dessen Erhaltung; eigene Aufseher wachen über die Rinder, bemühen sich soviel als möglich, Gefahren von ihnen abzuhalten und schließen endlich die wegen höheren Alters zu bösartig oder sonst unbrauchbar gewordenen Bullen ab. Die lebhafteste Theilnahme für das Parkwild hat von jeher die Familie Tankerville an den Tag gelegt, und einem der letzteren Besitzer verdanken wir eingehende Berichte hierüber.
»Zu meines Vaters und Großvaters Zeiten«, bemerkt der edle Lord, »wußte man vom Ursprunge dieser Thiere so wenig als jetzt. Wahrscheinlich bleibt immer, daß das Vieh im Chartlyparke von einem ursprünglich in England wild lebenden Ochsen abstammt und schon in alter Zeit im Parke eingehegt wurde. Der Park selbst ist uralt und wohl schon in einer sehr frühen Zeit zum Schutze der Thiere eingefriedigt worden. Ueber die Lebensweise unseres wilden Rindviehes kann der Parkwärter Cale zu Chartly die besten Nachweisungen geben; mir ist nur folgendes bekannt.
»Das Vieh hat alle bezeichnenden Eigenschaften echt wilder Thiere. Es verbirgt seine Jungen, weidet des Nachts und schläft und sonnt sich des Tages. Grimmig ist es nur, wenn es in die Enge getrieben wird; sonst zeigt es sich sehr scheu und flüchtet sich vor jedermann schon aus großer Entfernung. Je nach der Jahreszeit und der Art, wie man sich ihm naht, beträgt es sich verschieden. Im Sommer habe ich mich wochenlang vergeblich bemüht, ein Stück zu Gesicht zu bekommen; denn um diese Zeit ziehen sich die Thiere, sobald sie irgend jemand spüren, in ihren heiligen Wald zurück, welcher von niemand betreten wird; im Winter dagegen kommen sie an die Futterplätze, und weil sie sich dort an den Menschen gewöhnen, kann man, zumal beritten, fast mitten unter die Herde gelangen. Man bemerkt an ihnen viel eigenthümliches. Mitunter ergreift sie, wenn sie ruhig grasen und man über dem Winde in ihrer Nähe erscheint, ein lächerlicher Schrecken, und sie galoppiren bis in ihr Allerheiligstes. Wenn sie in den unteren Theil des Parkes herunterkommen, was zu bestimmten Stunden geschieht, gehen sie wie ein Reiterregiment in einfachen Reihen; dabei bilden die Bullen den Vortrab, wogegen sie beim Rückmarsche als Nachtrab dienen. Ihre Stimme gleicht eher der eines reißenden Thieres als der eines zahmen Rindes.«
»Die Herde«, sagt der genannte Parkwärter, welcher über dreißig Jahre in Chartly lebte, »besteht gegenwärtig (1830) aus etwa achtzig Stück oder ungefähr fünfundzwanzig Bullen, vierzig Kühen und fünfzehn Stück Jungvieh. Ihre reinweiße Färbung und die schönen halbmondförmigen Hörner geben den Thieren, zumal wenn sie sich in Masse bewegen, ein herrliches Ansehen. Die Bullen kämpfen um die Oberherrschaft, bis einige der stärksten die übrigen unterjocht haben. Die Kühe kalben erst, nachdem sie drei Jahre alt sind, und bleiben nur wenige Jahre fruchtbar. Sie verbergen ihr Kalb die ersten vier bis zehn Tage lang und kommen während dieser Zeit täglich zwei bis dreimal zu ihm, um es zu säugen. Nähert sich jemand dem Orte, wo sich ein solches Kalb befindet, so legt dieses den Kopf fest auf den Boden und drückt sich wie ein Hase im Lager. Neun Monate lang besaugen die Kälber ihre Mütter; dann schlagen diese sie ab.
»Die Parkrinder vertragen den Winter sehr gut, werden jedoch bei strenger Kälte mit Heu gefüttert. Man läßt sie selten über acht bis neun Jahre alt werden, weil sie später im Gewicht zurückgehen. Die Stiere tödtet man gewöhnlich im sechsten Jahre ihres Alters; dann wiegen sie etwa fünfzehn Centner. Das Fleisch ist schön mit Fett durchwachsen, im Geschmack aber von dem des zahmen Rindes wenig verschieden.
»Einer der Parkwärter war so glücklich, ein jung eingefangenes Paar aufzuziehen und durch sanfte Behandlung zu zähmen. Beide Thiere zeigten sich so gutmüthig wie echte Hausthiere. Der Bulle wurde achtzehn Jahre alt, die Kuh lebte nicht länger als fünf oder sechs Jahre. Man paarte sie mit einem Landbullen; allein die Kälber blieben ihr außerordentlich ähnlich. Sie gab wenig, aber fette Milch. – Im Zustande der Wildheit sterben nur sehr wenige an Krankheiten.«
Black erzählt 1851 von den im Parke von Hamilton lebenden wilden Rindern, daß sie bei Tage auf den ausgedehnten Triften weiden und abends in den Wald sich zurückziehen. Die gereizten Bullen sind äußerst rachsüchtig. Ein Vogelsteller, welcher auf einen Baum gejagt worden war, mußte dort sechs Stunden verharren, weil ihn der wüthende Stier hartnäckig belagerte. Als er sah, daß ihm sein Feind unerreichbar war, zitterte er am ganzen Leibe vor Wuth, grunzte und stürmte mit Kopf und Huf gegen den Baum. So tobte er sich müde und legte sich nieder; sobald aber der Mann sich rührte, sprang er wüthend wieder auf und raste von neuem. Einige Schäfer erlösten den Geängstigten. Ein Schreiber wurde ebenfalls auf einen Baum gejagt und mußte dort die Belagerung bis zum anderen Nachmittage aushalten.
»Ereignet es sich«, so berichtet Fitzinger nach altenglischen Quellen, »daß ein fremder Mensch den Park besucht, und glückt es ihm zufällig, in die Nähe einer Herde zu gelangen, so scharren die Stiere, sowie sie den Fremden erblicken, durch zwei- oder dreimaliges Stampfen mit den Vorderbeinen auf dem Boden die Erde auf. Die ganze Herde nimmt hierauf im raschen Galopp die Flucht, entfernt sich jedoch nicht weiter, als höchstens auf hundertundfünfzig Schritte, rennt in einem weiten Kreise einige Male um den Fremden herum und kehrt sich plötzlich gegen denselben, worauf sie mit drohend in die Höhe gehobenen Köpfen gerade auf ihn losgeht, und wenn sie ihm auf dreißig bis vierzig Schritte in die Nähe gekommen, stutzend anhält, um den Gegenstand, welcher sie in Schrecken versetzt, mit wilden Blicken ins Auge zu fassen. Auf die geringste Bewegung, welche der hierdurch in Angst versetzte Mensch unwillkürlich macht, nimmt die ganze Herde wieder mit gleicher Schnelligkeit die Flucht, entfernt sich aber nicht mehr so weit wie früher. Sie rennt nun in einem engeren Kreise herum, hält wieder an und kommt mit drohender und trotzender Miene, doch langsam und ruhigen Schrittes bis auf wenige Gänge an ihn heran. Hier macht sie abermals Halt, rennt wieder davon und wiederholt dies noch mehrere Male, dabei die Entfernungen immer verkürzend. So kommt sie endlich dem Menschen so nahe, daß dieser es für gerathen finden muß, einen der günstigen Augenblicke zu benutzen, um sich eiligst zu entfernen und zunächst vor ihren Blicken zu verstecken; denn immer bleibt es gewagt, die Thiere in ihrer Einsamkeit zu stören.«
Ludwig Beckmann gedenkt dieser altenglischen Berichte, hat jedoch bei seinem Besuche des Parks von Hamilton von all dem nichts bemerkt. »Ich fand«, so fährt er fort, »die Herde, etwa zweihundert Schritte vom Wege entfernt, behaglich im Grase liegend und wiederkauend. Zwischen den Rindern stand, hoch aufgerichtet wie eine Schildwache, ein alter Fuchswallach. Bei meiner Annäherung erhoben sich die Rinder und staunten mich unverwandt an. Die Köpfe wurden dabei nicht über die Rückenhöhe erhoben; ja die mir zunächststehenden jüngeren Rinder senkten denselben tief bis zu den Knieen herab, um mich schärfer ins Auge fassen zu können, was ihnen ein ungemein pfiffiges Ansehen gab. Als ich bis auf etwa achtzig Schritte herangekommen war, setzte sich der Zug langsam in Bewegung. Ich war gespannt auf das Benehmen des stärksten Stieres, den ich nach langem Suchen hinter mehreren Kühen versteckt fand. Derselbe hatte indeß keine Lust, unnöthigerweise einer Gefahr sich auszusetzen: es fiel ihm gar nicht ein, die Führung zu übernehmen, und sein einziges Bestreben schien darauf gerichtet zu sein, seine eigene werthe Person fortwährend durch einige Kühe oder jüngere Stiere zu decken, so daß mein beim Fuhrwerke zurückgebliebener Begleiter endlich entrüstet ausrief: ›der alte Feigling; er sollte vorausgehen, und versteckt sich hinter seinen Weibern‹. Die aus etwa dreißig Stück bestehende Herde fiel nun allmählich in Trab; hier und da galoppirte bereits ein Kalb, um nicht zurückzubleiben; dann wurden plötzlich alle flüchtig, und im rasenden Galopp, die hoch gehobenen Schweife flatternd, eilte die lange weiße Reihe mit Donnergepolter über eine Anhöhe, zwischen den mächtigen altersgrauen Stämmen hindurch: ein majestätischer Anblick! Leider wurde derselbe etwas abgeschwächt durch die Gegenwart des alten Fuchswallachs, welcher, seinen stumpfen Hahnenschwanz ebenfalls lüftend, dicht hinter dem Trupp einhergaloppirte und allen Schwenkungen desselben auf das genaueste folgte. Der flüchtige Trupp entfernte sich in weitem Bogen und machte dann auf einer Blöße plötzlich Halt, wobei die Köpfe sämmtlicher Rinder wiederum unbeweglich nach mir sich richteten. Ich versuchte nun zum zweitenmale mich anzubirschen; jetzt aber wurde die Herde bereits auf hundertundzwanzig Gänge flüchtig und machte erst in weiter Ferne wieder Halt. Die Thiere waren nunmehr bereits so scheu geworden, daß ich sie bei einem dritten Annäherungsversuche sicher gänzlich aus den Augen verloren haben würde; ich hielt es daher für das beste, vorläufig zu unserem Fuhrwerke zurückzukehren und sie von dort aus mit Hülfe eines guten Fernglases zu beobachten. Nach wenigen Minuten beruhigten sie sich, und ein Stück nach dem anderen legte sich an der Stelle, wo es stand, nieder, um wiederzukauen.
»Eine andere Eigenthümlichkeit der Parkrinder, das Weiden im geschlossenen Trupp, ist oft und mit Vorliebe als ›vererbte Gewohnheit wilder Thiere‹ bezeichnet und dabei hervorgehoben worden, daß kein Hausrind dieselbe theile. Wenn man aber, meine ich, einen Trupp Hausrinder in einem weiten Gehege sich selbst überlassen wollte, ohne die Kühe zu melken, sodann dann und wann die Herde durch Treiber in Bewegung setzen ließe, etwa um einen überflüssigen Stier mit der Büchse wie ein Stück Wild niederzuschießen, so dürften gedachte Hausrinder in kurzem wohl dasselbe Mißtrauen gegen jeden Unbekannten hegen wie das echte Parkrind, und sich ganz wie dieses betragen und bewegen. Ebenso dürfte die Neigung des letzteren, bei Verfolgung in einer weiten Bogenlinie sich zu flüchten, dann Halt zu machen und den Feind anzustarren, einfach auf das stete Bewußtsein der ringsum einschließenden Parkmauern zurückzuführen und nicht als wilde, vielmehr als echte Parkgewohnheit zu betrachten sein.«
Die Art und Weise, wie man noch bis kurz vor Ende des verflossenen Jahrhunderts einen Parkstier tödtete, erinnert lebhaft an die in alter Zeit bestandenen Jagden. An dem bestimmten Tage versammelten sich die Einwohner der ganzen Nachbarschaft, theils zu Pferde, theils zu Fuße und sämmtlich mit Flinten bewaffnet. Nicht selten erschienen zu einer solchen Jagd fünf- bis sechshundert Jäger, von denen oft mehr als hundert beritten waren. Die unberittenen nahmen ihre Plätze auf den Mauern ein, welche den großen Park umzäunen, oder kletterten mit ihren Gewehren auf die Bäume in der Umgegend des freien Platzes, auf welchem der bestimmte Stier erlegt werden sollte, während die Reiter den Wald durchstreiften und die Herde nach jenem freien Orte hintrieben. War dies gelungen, und hatte man den rings von Pferden eingeschlossenen Stier einmal ziemlich in seine Gewalt gebracht, so stieg einer von den Reitern, welchem die Ehre zugedacht gewesen, die erste Kugel abzufeuern, von seinem Pferde ab und schoß auf das ungestüme und durch die Angst in die höchste Wildheit versetzte Thier. Hierauf feuerten alle übrigen, welche zum Schusse kommen konnten, und oft geschah es, daß mehr als dreißigmal nach dem Stiere geschossen wurde, ehe man ihn tödtete. Durch den heftigen Schmerz der Wunden und das lärmende Geschrei der Jäger in rasende Wuth versetzt, achtete das blutende Thier nicht mehr auf die zahlreichen Menschen, sondern stürzte mit den letzten Kräften auf Roß und Reiter. Nicht selten brachte der Stier den Angreifern gefährliche Verwundungen bei, oder richtete unter ihnen derartige Verwirrung an, daß er sich ferneren Verfolgungen entziehen konnte. Die Unglücksfälle, welche diese Jagden herbeiführten, wurden Ursache, daß solche Feste nach und nach gänzlich abkamen.
Unter dem Landschlage des schottischen Rindes trifft man hier und da einzelne Stücke und ganze Zuchten, welche von dem Parkrinde abzustammen scheinen. Sie zeigen noch alle Eigenthümlichkeiten desselben mit Ausnahme der Färbung, welche meist ein einfaches Schwarz, Braun, Roth oder Gelblichbraun ist, wogegen die Kreise um die Augen und das Maul wie bei den halb wildlebenden schwarz sind. Beckmann macht mich darauf aufmerksam, daß, nach Angabe Colquhouns, heutigen Tages auch noch weiße Rinder desselben Schlages vorkommen. »Ich pflegte anzunehmen«, sagte der letztgenannte Berichterstatter, »daß die letzten Ueberreste unseres eingeborenen wilden Rindes als gefährliche Gegenstände der Neugierde und ernsteren Theilnahme in hoch ummauerten Parks eingeschlossen seien; vor einigen Jahren traf ich jedoch an einem über das Moor führenden Wege in Argyleshire auf eine gezähmte Herde dieser weißen Rinder, welche das Gras am Wege abrupften. Weit entfernt, unruhig oder böse zu werden, ließen sie mich, ohne mich zu beachten, mitten zwischen sich hindurch gehen und fraßen ruhig weiter. Ihre hübschen, gut angesetzten Hörner, die schwarzen Schnauzen, schneeweißen Vliese und die reinen Knochen verbürgten das Alter und die Reinheit ihrer Abkunft.
»Nicht zu verwechseln jedoch«, schließt Beckmann, »ist das schottische Parkrind mit dem zottigen, dünn- und langhörnigen Hochlandrinde, welches auf den Hebriden gezüchtet wird, dort im halbwilden Zustande lebt und alljährlich in großen Herden durch ganz Schottland getrieben wird. Diese durchaus selbständige Rasse erinnert in ihrer äußeren Erscheinung weit mehr als das Parkrind an eine wilde Stammart, ein Urrind, ist aber ungeachtet des trotzigen Aussehens äußerst friedfertig und gutmüthig.«
Nach den vorstehenden Mittheilungen über das Parkrind darf es uns nicht Wunder nehmen, zu sehen, wie die in den Hausstand übergegangenen Rinderrassen unter der oft ganz bestimmte Zwecke verfolgenden Pflege des Menschen nach und nach, unter Umständen in nicht allzu langer Zeit, wesentlich abweichende Merkmale annehmen und dieselben ebenso wie die übrigen Hausthiere auch vererben, mit anderen Worten also, wie im Verlauf einer gewissen Zeit neue Rassen entstehen und wieder vergehen. Es erscheint daher nicht einmal nothwendig, anzunehmen, daß außer dem Auer noch andere, ebenfalls und vor ihm ausgestorbene Wildrinderarten an der Erzeugung unseres Hausrindes betheiligt gewesen sein müssen, und ist jedenfalls überflüssig, zu wunderlichen Muthmaßungen seine Zuflucht zu nehmen. Wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir zugestehen, daß wir bis jetzt noch nicht im Stande sind, auch diese Frage zu lösen. – Um einzelne Rassen des höckerlosen Hausrindes anzuführen, will ich drei besonders hervorragende wenigstens erwähnen.
Als Vertreter des Alpenrindviehs, welches in sehr vielen und merklich verschiedenen Schlägen gezüchtet wird, mag das Freiburger Rind ( Bos taurus friburgensis ) gelten, ein wohlgestaltetes Thier mit mäßig großem, breitstirnigem Kopfe, kurzem und dickem, stark gewammtem Halse, gestrecktem, breitrückigem Leibe, stämmigen Gliedern, langem, stark bequastetem Schwanze und verhältnismäßig kurzen, ziemlich schwachen, aber sehr spitzigen, schwach halbmondförmig seit- und aufwärts, mit den Spitzen aus- und entweder vor- oder rückwärts gewendeten Hörnern, glatthaarigem Felle und schwarzer oder braunrother Fleckenzeichnung auf weißem Grunde.
Man züchtet diesen Schlag vorzugsweise in Freiburg und den benachbarten Kantonen der Schweiz und gewinnt von ihm ebenso vorzügliches Fleisch wie ausgezeichnet gute und viele Milch.
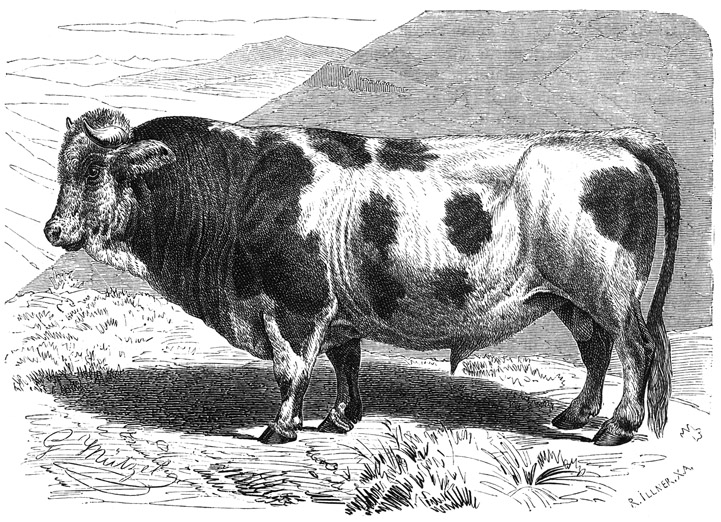
Freiburger Rind ( Bos taurus friburgensis). 1/25 natürl. Größe.
Der verbreitetste Schlag der Marschenrinder dürfte das Holländerrind ( Bos taurus hollandicus ) sein, nach Fitzingers Ansicht der unmittelbare Nachkomme des Auers. Stattliche Größe, ziemlich gleichmäßige Entwickelung aller Körpertheile und sehr gleichmäßige Färbung und Zeichnung bilden seine hervorragendsten Merkmale. Der Kopf ist lang, an der Schnauze zugespitzt, der Hals lang und dünn, der Leib tonnenförmig, d. i. gestreckt und weit, der Widerrist schmal, das Kreuz breit, der Schwanz mäßig lang, das vordere wie das hintere, besonders ausgebildete Beinpaar hoch und kräftig, nicht aber plump, das Gehörn kurz, schwach und meist seit- und vorwärts gerichtet, die Färbung buntscheckig, da auf weißem oder grauweißem Grunde in der Regel schwarze, zuweilen aber auch braune und rothe, mehr oder weniger große und sehr verschieden gestaltete Flecken stehen.
Abgesehen von Holland, woselbst dieses Rind schon seit Jahrhunderten gezüchtet wird, hält man es in den meisten Marschgegenden Deutschlands in mehr oder minder reinen Schlägen, benutzt es auch im Inneren des Landes nicht selten zur Kreuzung mit einheimischen Rassen. Milchergiebigkeit und leichte Mastfähigkeit zeichnen es aus.
Als wahrhaft abscheuliches Erzeugnis fortgesetzter planmäßiger Züchtung mag endlich noch das Durham- oder Kurzhornrind, »Shorthorn« der Engländer ( Bos taurus dunelmensis ) erwähnt sein: ein geradezu ungestaltetes Thier mit kleinem Kopfe und sehr schwachem Gehörn, geradem Rücken und kurzen Beinen, dickem Halse und unförmlichem Leibe, vorzugsweise bestimmt, als Mastvieh größtmöglichen Fleischertrag zu liefern. Die Färbung des glatten Haarkleides wechselt vielfach.
Ursprünglich wurde das Durhamrind fast ausschließlich in den Grafschaften der Ostküste von England gezüchtet; gegenwärtig sieht man es in allen Grafschaften Englands und Irlands, hier und da, obschon immer noch selten, auch wohl in Deutschland, Holland und Frankreich. An Milchertrag steht es hinter vielen Schlägen merklich zurück, an Fleischertrag übertrifft es sämmtliche Rassen, da einzelne Stiere bis dreitausend Kilogramm schwer werden sollen.
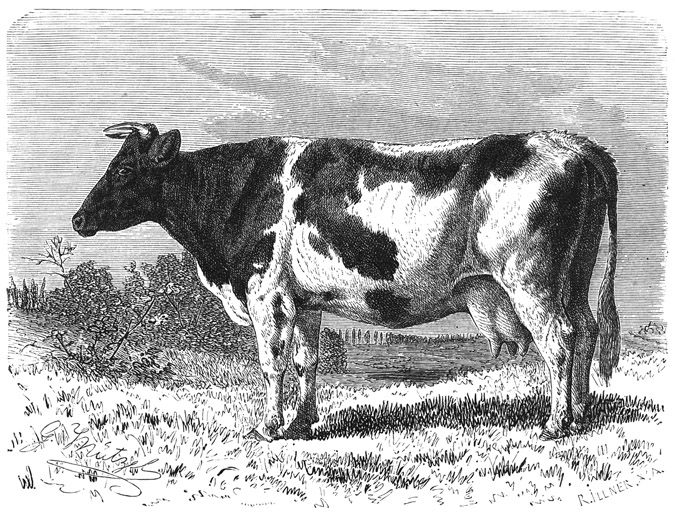
Holländerrind ( Bos taurus hollandicus). 1/25 natürl. Größe.
Obgleich auch die wieder verwilderten Rinder kaum dazu beitragen, das Dunkel des Ursprungs unseres wichtigen Hausthieres aufzuhellen, verdienen sie doch ebenfalls in Betracht gezogen zu werden. Ebenso leicht als ein wild lebendes Rind sich zähmen und in den Hausstand überführen läßt, nimmt es, der Obhut und Pflege des Menschen entronnen, wiederum die Sitten und Gewohnheiten der Urarten an. Verwilderte Rinder, d. h. solche, welche aus dem zahmen Zustande wieder in einen ganz oder halbwilden übergegangen sind, finden sich hauptsächlich da, wo die Spanier herrschten oder noch herrschen; es kann jedoch auch in Mitteleuropa geschehen, daß ein Rind der Knechtschaft sich entzieht und monatelang wie ein wildes Thier im Walde lebt. Hierfür theilt mir Forstmeister Henschel in Wildalpen einen Beleg mit. Von der Einöde Heuda entlief im Mai ein etwa vierwöchentliches Kalb, schwamm über einen langgestreckten Teich und zog den Lupper Waldungen zu, in denen es sich fortan aufhielt. Mehrmalige Versuche, es zu fangen, scheiterten und machten es überaus scheu und vorsichtig. Bald darauf bemerkte man es in Gesellschaft des Hochwildes, dem es sich angeschlossen hatte und mit welchem es auch gemeinschaftlich auf Aesung trat. Auf besonderen Befehl des Jagdherrn ließ man es bis zum Herbste unbehelligt. Es verblieb in Gesellschaft des Wildes, nahm dessen Sitten und Gewohnheiten an und würde unzweifelhaft auch den Winter überstanden haben, hätte man es nicht im Oktober erlegt. Schon viel früher war es zu einem Thiere mit allen Eigenschaften des Wildes geworden.
Der in Spanien hoch angesehene, weil zu den Gefechten unentbehrliche Stier stammt ebenfalls von zahm gewesenen Rindern ab. Er lebt ganz wie Wildrinder, kommt jahraus jahrein in keinen Stall und wird eigentlich auch nicht gehütet; denn nur ab und zu stellt sich einer der Beauftragten ein, um die Herde zu besichtigen. Nicht besonders groß, aber schön und ungemein kräftig, zeichnet er sich aus durch ziemlich lange, auswärts gebogene und sehr spitzige Hörner; die Färbung ist in der Regel, aber nicht immer, dunkelkastanien- bis schwarzbraun. Mit dem zweiten Lebensjahre bringt man die Stierkälber in die großen Herden, welche nur aus Stieren bestehen, weil die Bullen der gemischten Herden einander während der Paarungszeit tödten würden. Jeder einzelne Stier bekommt seinen Namen, und es werden über alle genaue Listen geführt, um zu erfahren, welche von ihnen am besten zu den Gefechten sich eignen werden. Viel erzählt man von der Rachsucht dieser Stiere. Ein guter »Toro«, sagt man, dürfe niemals geschlagen werden, weil er solches niemals vergessen und dann den Hirten unfehlbar umbringen würde. Obgleich dieser mit Rindern vortrefflich umzugehen und mit wunderbarer Geschicklichkeit die Schleuder zu handhaben weiß, nähert er sich doch niemals allein, vielmehr stets in Gesellschaft eines ebenso bewanderten Genossen und im Geleite starker Hunde einer Herde der ungemein reizbaren Thiere.
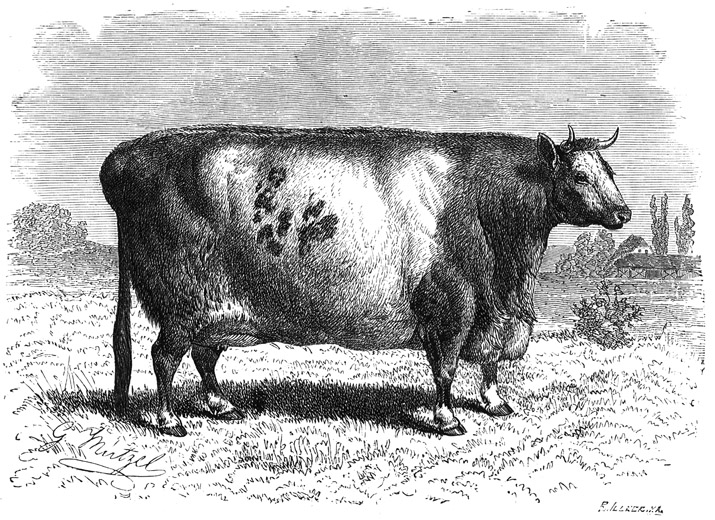
Durhamrind ( Bos taurus dunelmensis). 1/30 natürl. Größe
In den Hochgebirgen Südspaniens und in den größeren Waldungen Kastiliens begegnet man nicht selten solchen Stierherden, thut aber unter allen Umständen wohl, ihnen aus dem Wege zu gehen. Noch im November traf ich eine Herde in einer Höhe zwischen zwei- und dreitausend Meter über dem Meere, in der Nähe des Picacho de la Veleta, ohne jegliche Aufsicht weidend. Kein Wolf wagt es, solcher Gesellschaft sich zu nahen, kein Bär greift sie an; denn in geschlossener Reihe stürmen die muthigen Geschöpfe auf das Raubthier los, und fast niemals kommt es vor, daß eines dem Feinde erliegt. Mit Vergnügen beobachtete ich, wie sämmtliche Mitglieder einer solchen Herde dem Kampfe zwischen zwei jugendlich kräftigen Stieren mit größter Aufmerksamkeit folgen. Wir gingen einmal an einer Herde vorüber, welche so von einem Kampfspiele in Anspruch genommen wurde, daß sie uns gar keine Beachtung schenkte. Während des Sommers ziehen sich die Stiere mehr nach den Höhen empor, und erst der dort frühzeitiger als unten fallende Schnee treibt sie wieder zur Tiefe zurück. Den Dörfern weichen sie vorsichtig aus. Auf Vorübergehende stürzen sie sich oft ohne die geringste Veranlassung. Nur mit Hülfe gezähmter Ochsen ist es möglich, sie nach den für die Gefechte bestimmten Plätzen zu treiben. Keiner dieser verwilderten Stiere verträgt eine Fessel, keiner eine Mißhandlung. Die Fortschaffung der für das Gefecht erwählten ist für die Betheiligten immer ein Spielen mit Tod und Leben.
In Südamerika waren die Verhältnisse von jeher einer Verwilderung des Rindes günstig. Columbus brachte das nützliche Hausthier auf seiner zweiten Reise zuerst nach San Domingo. Hier vermehrte es sich mit solcher Schnelligkeit, daß man bereits wenige Jahre später Kälber beiderlei Geschlechts über die ganze Insel verbreiten konnte. Siebenundzwanzig Jahre nach der Entdeckung Domingos waren Herden von viertausend Stück schon eine gewöhnliche Erscheinung. Im Jahr 1587 wurden von der Insel allein fünfunddreißigtausend Rinderhäute ausgeführt; denn zu dieser Zeit gab es bereits verwilderte Herden.
Um das Jahr 1540 verpflanzte man Stiere aus Spanien nach den südlichen Ländern Amerikas. Sie fanden auch hier das Klima der Neuen Welt für ihr Gedeihen so ersprießlich, daß sie in kurzer Zeit von dem Menschen, welcher sie ohnehin nur lässig überwachte, gänzlich sich befreiten. Hundert Jahre später bevölkerten sie bereits in solch ungeheurer Anzahl die Pampas, daß man bei den Jagden, welche auf sie angestellt wurden, gerade so verfuhr, wie die Inder noch heute mit den Bisons verfahren, indem man sie einzig und allein deshalb erlegte, um ihre Haut zu benutzen. Ehe der Bürgerkrieg die Platastaaten zerstörte, wurden jährlich fast eine Million Ochsenhäute allein von Buenos Ayres nach Europa ausgeführt. Eine eigene Genossenschaft, die der »Vaqueros«, bildete sich aus den Gauchos heraus Leute, welche ohnehin gewöhnt waren, für wenige Groschen ihr Leben in die Schanze zu schlagen, trotzigkühne, tolldreiste Männer, welche den Stieren mit der Wurfschlinge entgegentraten und sie mit diesem verhältnismäßig so schwachen Gewehre zu bändigen wußten. Manche Landwirte hielten auf ihren ungeheuren Gütern an acht- bis zehntausend Stück Rinder, welche man fast gar nicht beaufsichtigte, gegen die Schlachtzeit hin aber in Pferche oder Umpfählungen trieb und hier entweder mit Feuergewehren massenhaft niederschoß, oder einzeln herausjagte, von den Hirten verfolgen und mit den Wurfschlingen niederreißen, in jedem Falle aber tödten ließ. Das Fleisch und Fett verblieb den zahmen und wilden Hunden und den Geiern. Solcherart betriebene Metzeleien lichteten selbst diese ungeheuren Herden, und erst die neuzeitliche bessere Verwerthung der Stücke führte zu einer Aenderung des früheren Verfahrens.
Auf den Falklandsinseln ist das Rind gänzlich verwildert und wird höchstens manchmal von Schiffern gejagt, deren Fleischvorräthe zusammengeschmolzen sind. In Kolumbien wie in den meisten übrigen Ländern Südamerikas lebt es in gleicher Freiheit, nicht aber in der Tiefe, sondern auf den Höhen der Kordilleren. Als die Jesuiten in der Provinz St. Martin ihrem Bekehrungswerke entsagen mußten, blieben ihre Rinder sich selbst überlassen und zogen sich bald bis zum Grasgürtel empor, wo sie gegenwärtig in kleinen Herden leben. Manchmal jagen sie die Bauern der am Fuße der Kordilleren liegenden Dörfer, weniger des Nutzens als des Vergnügens wegen; denn es ist den Leuten unmöglich, ihre Beute vom Gebirge herabzuschaffen. Nicht einmal gefangene Thiere lassen sich nach unten treiben, stellen sich vielmehr erst nach Kräften zur Wehre und gerathen, wenn sie die Nutzlosigkeit ihrer Bemühungen einsehen, oft in so gewaltige Aufregung, daß sie am ganzen Körper zu zittern beginnen, zusammenstürzen und sterben.
Nur in Amerika hat sich das Hausrind wieder von der Herrschaft des Menschen befreit; in allen übrigen Erdtheilen ist es dessen Sklave und zwar, wie schon bemerkt, seit uralter und vorgeschichtlicher Zeit. Im allgemeinen wurde und wird das Rind außerordentlich hoch geehrt. Die alten Egypter beteten den Gott Apis in Gestalt eines Ochsen an und erwiesen diesem unter vielen Feierlichkeiten die größten Ehren. Die Göttin Isis und später die Io der Griechen wurden mit Kuhhörnern auf dem Haupte dargestellt; beiden opferte man Ochsen, weil diese besonders heilig waren. In Libyen wurden die Rinder gezähmt, aber niemals geschlachtet; nur die Milch genoß man. In Cyrene galt es, wie heutzutage in Indien noch, als Verbrechen, eine Kuh zu schlagen. Die Kelten sahen die Kuh als ein ihnen unmittelbar von der Gottheit gegebenes Geschenk an, und die heutigen Inder stehen den alten Egyptern noch durchaus nicht nach. Ich habe schon weiter oben erwähnt, daß die verschiedenen indischen Stämme verschiedene Rinder für heilig erklären; im wesentlichen ist die Verehrung aber überall dieselbe. Bei den Brahminen Kaschmirs ist nach Hügels Erfahrungen die Kuh unverletzlich, so daß jeder mit dem Tode bestraft wird, welcher eine tödtet. Görtz nennt die Ochsen ein allgemeines Uebel aller Hindustädte. Irgend jemand hat einzelnen seiner Rinder, um ein verdienstliches Werk zu thun, das Zeichen Schiwas aufgebrannt, und diese Thiere laufen nun mit Pfaffen und Bettlern in den Straßen umher, gehen niemand aus dem Wege und drängen, schlagen und stoßen, was ihnen vorkommt. Die Bakhara-Araber, ein Volksstamm, welcher sich zwischen dem Weißen Flusse und Kordofân umhertreibt, haben ihren Namen vom Rinde selbst entlehnt; denn das Wort » Bakhara« bedeutet soviel als Rinder. Eine ähnliche Verehrung wie die Inder erweisen die Dinka, ein am Weißen Flusse lebender Negerstamm, unserem Hausthiere. »Alles, was vom Rinde kommt«, sagt Schweinfurth, »gilt für rein und edel; der Mist, zu Asche gebrannt, um darauf zu schlafen oder um sich weiß anzutünchen, der Harn, als Waschwasser und als Ersatz für das in diesen Theilen Afrikas den Negern fehlende Kochsalz, sind ihre täglichen Bedürfnisse. Der letzterwähnte Umstand entschuldigt den in unseren Augen mit dem Begriffe von Reinlichkeit schwer zusammenzureimenden Volksgebrauch. Nie wird ein Rind geschlachtet; kranke pflegt man mit Sorgfalt in eigens dazu errichteten großen Hütten; bloß die gefallenen und verunglückten Thiere werden verspeist. Jedoch scheinen die Dinka keineswegs abgeneigt, theilzunehmen an irgend welchem statthabenden Schmause von Rinderfleisch; das Rind, welches geschlachtet wird, darf nur nicht das ihrige sein. Es ist also mehr die Freude am Besitz, welche ihnen das Rind zum Gegenstande ihrer Huldigungen gestaltet. Unbeschreiblich aber ist der Gram und das tiefe Leid, welches derjenige empfindet, den der Tod oder hartherzige Fremdlinge seiner Rinder beraubten; in solcher Lage ist der Dinka bereit, den Wiederersatz der verlorenen mit den schwersten Opfern zu erkaufen, denn die Kühe sind ihm theuerer als Weib und Kind. Das gefallene Rind wird indeß nicht nutzlos vergraben, dazu ist der Neger nicht gefühlvoll genug; von den Unbetheiligten wird ein solcher Vorfall als freudiges Ereignis begrüßt, und die Nachbarn veranstalten einen Schmaus, aber nur die Nachbarn, der Betroffene selbst ist durch den Verlust zu sehr erschüttert, um es über das Herz bringen zu können, Hand anzulegen an die theuere Hülle des verschiedenen. Nicht selten gewahrt man solche Leute schweigsam und verstört in ihrem Grame viele Tage zubringen: ein solches Unglück erscheint ihnen kaum zu ertragen.« So finden wir das Rind überall als ein beliebtes, geehrtes und geachtetes Thier. Und nicht auf Erden allein erweist man ihm Ehrerbietung, selbst in den Himmel hat man es versetzt. Nach den altindischen Sagen ist die Kuh das erstgeschaffene aller Wesen, und der Ochse » Nanda« vertritt nach den Anschauungen dieses Volkes ganz die Stelle des heiligen Petrus: er ist Wächter eines der beiden Himmelsthore. Die Benennung des Sternbildes » Stier« mag wohl hiermit im Zusammenhange stehen. Selbst bei den heiligsten Glaubensgenossenschaften, welche in allem möglichen unreines erblicken, gilt das Rind als reines Thier, dessen Umgang dem Seelenheile der Gläubigen nur förderlich sein kann. Die Sudâner hören es gern, wenn man ihnen den Ehrentitel »Ochse« gibt, und vergleichen die Kraft ihrer Söhne ruhmrednerisch mit der des Stieres. Mehr als irgend ein Thier hat das Rind zur Versittlichung des Menschen beigetragen. Otto von Kotzebue bemerkt sehr treffend, daß mit dem Erscheinen Vancouvers für die Sandwichinseln ein neues Zeitalter, weil erst mit der damals geschehenen Einführung des Rindes die Gesittung der Inselbewohner begonnen habe.
Ein Blick auf das Leben des Hausrindes in den verschiedenen Ländern ist ebenso lehrreich als fesselnd. Wenden wir, gewissermaßen um geschichtlich zu beginnen, unsere Aufmerksamkeit zunächst jenen Herden zu, welche sich noch in denselben Verhältnissen befinden wie unter der Herrschaft der alten Erzväter. In den Nomaden des Ostsudân sehen wir Herdenzüchter, welche ihre Geschäfte noch heute genau ebenso betreiben, wie ihre Ururväter vor Jahrtausenden sie betrieben. Die Viehherden, welche sie besitzen, sind ihr einziger Reichthum. Man schätzt sie nach der Anzahl der Schafe und der Rinder, wie man den Lappen nach der Menge seiner Renthiere schätzt. Ihr ganzes Leben hängt mit der Viehzucht aufs innigste zusammen. Nur durch Räuberthaten erwerben sie sich noch außerdem manches, was sie zu ihrem Leben bedürfen; im allgemeinen aber muß ihr zahmes Vieh sie ausschließlich erhalten. Viele Stämme der Araber, welche die nahrungsreicheren Steppen südlich des 18. Grades nördlicher Breite durchwandern, liegen, ihrer Herden wegen, in beständigem Kriege mit einander und sind aus dem gleichen Grunde ohne Unterlaß auf der Wanderung. Es versteht sich von selbst, daß es in jenen Gegenden nur freie Zucht gibt, daß niemand daran denkt, für seine Hausthiere einen Stall zu erbauen. Bloß da, wo der Löwe häufiger auftritt, versucht man nachts Rinder, Schafe und Ziegen durch einen dicken Hag aus Mimosendornen, welcher einen Lagerplatz kreisförmig umgibt, zu schützen. Da, wo man dem Könige der Wildnis keinen Zoll entrichten muß, läßt man die Herde dort übernachten, wo sie weidesatt sich lagert.
Auch die größten unserer Rittergutsbesitzer und Viehzüchter, die Holländer und Schweizer inbegriffen, bilden sich wohl schwerlich eine Vorstellung von der Anzahl der Herden jener Nomaden. Nahe dem Dorfe Melbeß, dessen ich schon einmal Erwähnung gethan habe, tieft sich die Steppe zu einem weiten Kessel ein, in dessen Grunde man Brunnen an Brunnen angelegt hat, einzig und allein zu dem Zwecke, die täglich hier während der Mittagsstunden zusammenströmenden Herden zu tränken. In diesem Kessel kann man vom frühen Morgen an bis zum späten Abend und während der ganzen Nacht ein kaum zu beschreibendes Gewühl von Menschen und Herdenthieren bemerken. Neben jeden Brunnen hat man sechs bis acht flache Tränkteiche aufgebaut, große natürliche Tröge, welche mit thoniger Erde eingedämmt sind. Diese Tröge werden alltäglich gefüllt und von den zur Tränke kommenden Herden vollständig wieder geleert. Vom Nachmittage an, die ganze Nacht hindurch, bis gegen Mittag hin, sind fast hundert Menschen eifrig beschäftigt, aus der Tiefe der Brunnen Wasser heraufzuheben und in diese Teiche zu schütten, woselbst man der Tränke noch etwas salzhaltige Erde zuzusetzen pflegt. Gewöhnlich sind die Teiche noch nicht völlig gefüllt, wenn die Herden ankommen. Von allen Seiten ziehen unzählbare Scharen von Schafen, Ziegen und Rindern herbei, zuerst das Kleinvieh, später die Rinder. In wenigen Minuten hat sich der ganze große Kessel vollständig gefüllt. Man sieht nichts als eine ununterbrochene Herde von eifrig sich hin- und herdrängenden Thieren, zwischen denen hier und da eine dunkle Mannesgestalt hervorragt. Tausende von Schafen und Ziegen strömen ohne Unterbrechung zu, und ebenso viele ziehen getränkt von dannen. Sobald der Kessel einigermaßen sich geleert hat, stürmen die Rinder, welche bis jetzt kaum zurückgehalten werden konnten, heran, und nun gewahrt man nur eine braune, wogende Masse, über welche ein Wald von Spitzen sich erhebt. Das Braun wird zur einzigen hervortretenden Farbe; von den dazwischen hin- und hergehenden Männern ist keine Spur mehr zu entdecken. Der ganze Tränkplatz gleicht einem Stall, in welchem seit Monaten kein Reinigungswerkzeug in Bewegung gesetzt wurde. Ungeachtet der dörrenden Sonne liegt der Koth überall mehr als knietief auf dem Boden; nur die Tränkteiche werden sorgfältig rein gehalten. Gegen Abend verlieren sich endlich die letzten durstigen Seelen, und nun beginnt augenblicklich das Schöpfen von neuem, um die für den folgenden Tag nöthige Wassermenge rechtzeitig beschaffen zu können. An manchen Tagen kommen auch langbeinige Kamele daher gestelzt, ebenfalls fünfhundert bis tausend Stück auf einmal, trinken sich satt und ziehen wieder von dannen. Ich halte es unmöglich, die Menge der Rinder zu berechnen; denn in dem dichten Gewirr hört das Zählen gar bald auf; dennoch glaube ich nicht zu viel zu sagen, wenn ich die Anzahl der täglich hierher kommenden Herdenthiere auf mindestens sechzigtausend Stück anschlage, wovon etwa vierzigtausend auf die Rinder kommen mögen. Angesehene Leute des Ostsudân, welche mit Eintreibung der Steuern unter jenen Nomadenstämmen beauftragt waren, versicherten mich, daß es ganz unmöglich wäre, auch nur annähernd einen Maßstab für die Größe der Besitzthümer jener Leute zu erlangen. Als Mahammed-Aali auf den Gedanken kam, seinen Bedarf an Rindern durch Zufuhren aus dem Sudân zu decken, legten die Regierungsbehörden den Eingeborenen willkürliche Steuern an Rindern auf, welche nach und nach, aber in sehr kurzer Frist, den Herdenbesitzern nicht nur hunderttausende, sondern Millionen von Rindern entzogen. In Egypten hatten Seuchen in schrecklicher Weise unter dem dortigen Rinderstande gewüthet, die Heere, welche der stolze und unternehmende Pascha gegen die Pforte führte, außerdem auffallend viel verbraucht: und alle die entstandenen Lücken wurden nicht nur aus dem Sudân vollkommen gedeckt, sondern es zeigte sich sogar bald eine solche Ueberfüllung von Rindern, daß man den Befehl rückgängig machte. Dabei muß man nun bedenken, daß auf dem Wege von dreihundert Meilen Länge, von welchem etwa die Hälfte auf Wüsten oder wenigstens unfruchtbares Land gerechnet wird, tausende und andere tausende erlagen, ehe sie an den Ort ihrer Bestimmung gelangten. Noch heutigen Tages ist man im Stande, den Weg, welchen jene Rinderherden nahmen, ohne alle Mühe zu verfolgen: er ist durch hunderttausende von Rindergerippen, die Ueberbleibsel der erliegenden Thiere, so deutlich bezeichnet, daß man nicht irren kann. Jene Herden aber, von denen ich redete, sah ich nur wenige Jahre nach der beispiellosen Plünderung, welche die Besitzer erlitten hatten: wie groß mag erst der Bestand etwa zehn Jahre früher gewesen sein!
Auch die erwähnten Dinka besitzen zahlreiche Herden und Pflegen dieselben ebenso sorgfältig wie die genannten Araber, treiben sie auf die Weide und beherbergen sie des Nachts in freien, von ihnen »Murach« genannten Stallungen. »Bei Anlage einer solchen Stallung unter freiem Himmelsdache«, sagt Heuglin, »wählt der Neger vor allem einen möglichst erhabenen und trockenen Platz, Bedingungen, welche sich am Weißen Nile überhaupt selten finden. Dieser Platz wird mit rohem Pfahlwerke umfriedigt und, wenn das Vieh des Abends eingetrieben worden, der Zugang mit Stämmen oder Dornbüschen geschlossen. Den Tag über hat man den sorgfältig gesammelten Koth der Kühe ausgebreitet und an der Sonne getrocknet, so daß davon immer ein größerer Vorrath vorhanden ist, von dem dann gleiche Haufen gemacht und gleichförmig im Innern der Umpfählung vertheilt werden. Kommen die Herden an, so wird unter jeden dieser Haufen etwas Feuer gelegt und es entwickelt sich über dem Murach bald eine ziemlich dichte Rauchwolke, wie an einem großen Meiler. Es hat dies den Zweck, die vielen Stechfliegen abzuhalten und dem Vieh, welches ohnedem nur wenig Milch gibt, die nöthige Nachtruhe zu verschaffen. Diese sonderbare Art von Räucherung währt die ganze Nacht durch, und die eingepferchten Thiere scheinen sich recht wohl dabei zu befinden. Gleichzeitig bildet sich durch diese Verbrennung eine feine Asche, welche den Tag über ebenfalls in Haufen gesammelt und abends glatt über den ganzen Platz ausgebreitet wird, um als Streu und weiteres Schutzmittel gegen die Fliegen zu dienen. Die Rinder tragen somit Räucherwerk und Streu selbst ein, und die Masse vermehrt sich nach und nach derart, daß eine merkliche Erhöhung des Bodens eintritt und die Kühe, wie ihre Herren, tief im feinsten weichen Aschenbette sich begraben können. Beim Austreiben ist man nicht minder vorsichtig: es geschieht dies erst, nachdem gemolken worden und man sich überzeugt hat, daß der gewöhnlich in Menge sich niederschlagende Thau abgetrocknet ist.« Schweinfurth, welcher den Murach in ähnlicher Weise schildert, bemerkt, daß ein solcher Viehstall selten unter zweitausend, meist bis dreitausend Stück Rinder enthält, und daß man auf jeden Kopf der Bevölkerung dieses Negerstammes mindestens drei Rinder rechnen müsse, obgleich es unter den Dinka ebenso gut wie überall Arme und Unbemittelte gibt.
In den Gebirgen von Habesch müssen die Rinder als Last- und Zugthiere Dienste leisten, in Sudân und in Kordofân hält man sie hauptsächlich zur Zucht, benutzt jedoch ihre Milch, um aus derselben Butter zu bereiten. Die Dinka betrachten sie als Augenweide. »Es ist wohl begreiflich«, sagt Schweinfurth, »wie Menschen bloß am Besitze eines wohlgediehenen Viehstandes ihre Freude haben können; unverständlich aber muß uns das Zwecklose der von den Dinka geübten Verschneidung bleiben, wenn wir sehen, wie diese Hirten Bullen und Böcke bloß in der Absicht verschneiden, um ihre Augen an einer Fettentwickelung zu werden, welche für den Magen stets unverwerthet bleiben soll. Wenn ich Dinka befragte: »Was nützen euch Ochsen, was sollen sie bezwecken?« erhielt ich stets zur Antwort: »Es geschieht, damit sie recht fett werden und schön aussehen«. So äußert sich ihr Stolz und ihre Freude am Besitze.«
In Südrußland, in der Tatarei und wahrscheinlich auch in einem großen Theile des inneren Asien hält man ebenfalls bedeutende Rinderherden. Die ganze südrussische Steppe ist überall mit Pferde-, Schaf- und Rindviehherden bedeckt. Im Sommer leben alle diese Hausthiere Tag für Tag im Freien, im harten, langen Winter finden sie hinter einem Erdwall einigen Schutz gegen die Stürme. Wenn besagter Wall an der einen Seite ein elendes Stück Dach hat, gilt er als vorzüglicher Stall. Unter den genannten Thieren stehen die Rinder ihrer Anzahl nach obenan und haben auch in vieler Hinsicht große Vorzüge vor jenen: denn sie verunglücken nicht so leicht während der Schafen und Pferden so gefährlichen Schneestürme, weil sie die Besinnung nicht verlieren, sondern, falls die Stürme nicht allzu heftig sind, geraden Weges nach Hause eilen. In den meisten Gegenden bleiben die Herden sich selbst überlassen und werden nur insofern von den Hirten bewacht, als diese sich bemühen, sie einigermaßen zusammenzuhalten und die herangewachsenen Stierkälber von den Müttern zu trennen. Die Rinder selbst sind unglaublich genügsam, fast unempfindlich gegen die Witterung und auch bei schlechter Nahrung noch sehr ausdauernd. Bei den Kirgisen und Kalmücken, von denen sie auch zum Lasttragen verwendet werden, führen sie ein echtes Wanderleben. Im Sommer gibt die Steppe überall reiche Weide, im Winter wählt man sich Gegenden aus, welche reich an Schilf sind, mit dessen dürr gewordenen Blättern die Rinder sich begnügen müssen. In den südrussischen Steppen treibt man das Rindvieh, nachdem es am Morgen getränkt wurde, in die Einöde hinaus; gegen Abend kommt die Herde von selbst zurück, und die Mütter vereinigen sich jetzt mit den Kälbern, welche am Morgen von ihnen getrennt wurden. Die Milchkühe und Kälber werden im Winter zu Hause gefüttert, die Ochsen jedoch nur dann, wenn viel Schnee liegt. Gewöhnlich sind die jungen, frei auf der Steppe ausgewachsenen Ochsen unbändig wild, widerspenstig und dabei so faul, daß man ihrer acht bis zehn an einen Pflug spannen muß, wenn man wirklich etwas leisten will. Um sie an das Joch zu gewöhnen, treibt man ein Paar in einen Hof, wirft ihnen eine Schlinge um die Hörner und zieht sie nunmehr bis an einen Pfahl, wo man ihnen dann das Joch auf den Nacken legt. Sobald dasselbe gehörig befestigt ist, treibt man sie wieder zur großen Herde auf die Steppe und läßt sie weiden. Alles Streben, des Joches sich zu entledigen, hilft ihnen nichts; sie gewöhnen sich endlich daran und werden, wie Schlatter versichert, schließlich so anhänglich aneinander, daß sie, auch wenn sie frei vom Joche sind und unter den anderen weiden, immer sich zusammenhalten und einander in allen Nöthen beistehen. Einige Tage, nachdem man sie zum erstenmal unter das Joch legte, fängt man sie wieder ein und spannt sie vor einen Wagen. Ein Tatar besteigt den Bock, nimmt eine gewaltige Hetzpeitsche zur Hand und jagt nun, so schnell die Thiere laufen wollen, mit seinem Gespann in die Steppe hinaus, läßt ihm die vollste Freiheit und erlaubt ihm, dahin zu laufen, wohin sein Sinn es führt. Nach einigen Stunden wüthenden Dahinjagens nehmen die gedemüthigten Stiere Knechtssinn an und lassen sich nunmehr ohne sonderliche Beschwerde lenken.
In Ungarn verfuhr man früher mit den dort gezüchteten Rindern in ähnlicher Weise. Noch heute müssen sie sich selbst ernähren und genießen weder Schutz noch Pflege. Manche sind so wild, daß sie keinem Menschen gestatten, ihnen sich zu nähern. Die Kälber saugen so lange, als sie Bedürfnis dazu fühlen, und die Hirten denken gewöhnlich erst im zweiten Jahre ihres Lebens daran, sie von den Müttern zu trennen. Dies verursacht Schwierigkeiten, weil die Kühe sich wüthend auf die Hirten zu stürzen pflegen und diese unter Umständen schwer verletzen oder sogar tödten. Noch heutzutage ist die Rindviehzucht in ganz Ungarn sehr bedeutend, obgleich der lohnenden Schafzucht wegen im Abnehmen begriffen.
Selbst in Italien lebt noch ein großer Theil der Rinder im halbwilden Zustande. In der Maremma, jenem beinahe vollkommen flachen, hier und da fruchtbaren, sonst aber sumpfigen Küstenstrich zwischen Genua und Gaëta, welcher wegen seines ungesunden Klimas sehr verrufen und dünn bevölkert ist, treiben sich zahlreiche Herden des italienischen Rindes umher, welche jahraus jahrein unter freiem Himmel leben, weite Wanderungen ausführen und nur von den rohesten, abgehärtetsten Menschen beaufsichtigt werden. In der Wallachei, in Serbien, Bosnien, Bulgarien und Syrien finden wir das Rind unter ähnlichen Verhältnissen.
Eine ganz andere Pflege genießt das geschätzte Hausthier in den Gebirgsländern Mitteleuropas, namentlich in den Alpen, obgleich auch hier noch manches zu wünschen übrig bleibt. Nach Tschudi's Angaben hält die Schweiz gegenwärtig etwa 850,000 Stück Rindvieh, und zwar nimmt sonderbarerweise in den ebenen Gegenden, wo der Weidegang nach den Alpen aufgehoben wurde, die Viehzucht zu, in den Alpen dagegen ab, »weil man«, wie Tschudi sagt, »leider wenig tröstliches von dem Zustande der Rinderherden auf den Alpen erzählen kann. Meistens fehlt eine zweckmäßige, mitunter sogar jede Stallung. Die Kühe treiben sich auf ihren Alpen umher und weiden das kurze, würzige Gras ab, welches weder hoch noch breit wächst. Fällt im Früh- oder Spätjahre plötzlich Schnee, so sammeln sich die brüllenden Herden vor den Hütten, wo sie kaum Obdach finden, wo ihnen der Senn oft nicht einmal eine Hand voll Heu zu bieten hat. Bei andauerndem kalten Regen suchen sie Schutz unter Felsen oder in Wäldern. Hochträchtige Kühe müssen oft weit entfernt vom menschlichen Beistande kalben und bringen am Abende dem überraschten Sennen ein volles Euter und ein munteres Kalb vor die Hütte. Nicht selten aber geht es auch schlimmer ab. Und doch ist selbst dem schlecht geschützten Vieh die schöne, ruhige Zeit des Alpenaufenthaltes eine überaus liebe. Man bringe nur jene große Vorschelle, welche bei der Fahrt auf die Alp und bei der Rückkehr ihre weithin tönende Stimme erschallen läßt, im Frühlinge unter die Viehherde im Thal, so erregt dies gleich die allgemeine Aufmerksamkeit. Die Kühe sammeln sich brüllend in freudigen Sprüngen und meinen das Zeichen zur Alpfahrt zu vernehmen, und wenn diese wirklich begonnen, wenn die schönste Kuh mit der größten Glocke am bunten Bande behangen und wohl mit einem Strauß zwischen den Hörnern geschmückt wird, wenn das Saumroß mit Käsekesseln und Vorrath bepackt ist, die Melkstühle den Rindern zwischen den Hörnern sitzen, die sauberen Sennen ihre Alpenlieder anstimmen, und der jauchzende Jodel weit durchs Thal schallt, dann soll man den trefflichen Humor beobachten, in dem die gut- und oft übermüthigen Thiere sich in den Zug reihen und brüllend den Bergen zu marschiren. Im Thale zurückgehaltene Kühe folgen oft unversehens auf eigene Faust den Gefährten auf entfernte Alpen.
»Freilich ist es bei schönem Wetter für eine Kuh auch gar herrlich hoch in den Gebirgen. Frauenmäntelchen, Mutterkraut und Alpenwegerich bieten dem schnoppernden Thiere die trefflichste und würzigste Nahrung. Die Sonne brennt nicht so heiß wie im Thale, die lästigen Bremsen quälen das Rind während des Mittagsschläfchens nicht, und leidet es vielleicht noch von einem Ungeziefer, so sind die zwischen den Thieren ruhig herumlaufenden Staare und gelben Bachstelzen stets bereit, ihnen Liebesdienste zu erweisen: das Vieh ist munterer, frischer und gesünder als das im Thale und pflanzt sich regelmäßiger und naturgetreuer fort; das naturgemäße Leben bildet den natürlichen Verstand besser aus. Das Rind, welches ganz für sich lebte, ist aufmerksamer, sorgfältiger, hat mehr Gedächtnis als das stets verpflegte. Die Alpkuh weiß jede Staude, jede Pfütze, kennt genau die besseren Grasplätze, weiß die Zeit des Melkens, kennt von fern die Lockstimme des Hüters und naht ihm zutraulich, weiß, wann sie Salz bekommt, wann sie zur Hütte oder zur Tränke muß, spürt das Nahen des Unwetters, unterscheidet genau die Pflanzen, welche ihr nicht zusagen, bewacht und beschützt ihr Junges und meidet achtsam gefährliche Stellen. Letzteres aber geht bei aller Vorsicht doch nicht immer gut ab. Der Hunger drängt oft zu den noch unberührten, aber fetten Rasenstellen, und indem sich die Kuh über die Geröllhalde bewegt, weicht der lockere Grund, und sie beginnt bergab zu gleiten. Sowie sie bemerkt, daß sie selber sich nicht mehr helfen kann, läßt sie sich auf den Bauch nieder, schließt die Augen und ergibt sich ruhig in ihr Schicksal, indem sie langsam fortgleitet, bis sie in den Abgrund stürzt oder von einer Baumwurzel aufgehalten wird, an der sie gelassen die hülfreiche Dazwischenkunft des Sennen abwartet.
»Sehr ausgebildet ist namentlich bei dem schweizerischen Alprindvieh jener Ehrgeiz, welcher das Recht des Stärkeren mit unerbittlicher Strenge handhabt und danach eine Rangordnung aufstellt, der alle sich fügen. Die Heerkuh, welche die große Schelle trägt, ist nicht nur die schönste, sondern auch die stärkste der Herde und nimmt bei jenem Umgange unabänderlich den ersten Platz ein, indem keine andere Kuh es wagt, ihr voranzugehen. Ihr folgen die stärksten Häupter, gleichsam die Standespersonen der Herde. Wird ein neues Stück hinzugekauft, so hat es unfehlbar mit jedem Gliede der Genossenschaft einen Hörnerkampf zu bestehen und nach dessen Erfolgen seine Stelle im Zuge einzunehmen. Bei gleicher Stärke setzt es oft böse, hartnäckige Zwiegefechte ab, da die Thiere stundenlang nicht von der Stelle weichen. Die Heerkuh, im Vollgefühle ihrer Würde, leitet die wandernde Herde, geht zur Hütte voran, und man hat oft bemerkt, daß sie, wenn sie ihres Ranges entsetzt und der Vorschelle beraubt wurde, in eine nicht zu besänftigende Traurigkeit fiel und ganz krank wurde.
»Bei jeder großen Alpenviehherde befindet sich ein Zuchtstier, welcher sein Vorrecht mit sultanischer Ausschließlichkeit und ausgesprochenster Unduldsamkeit bewacht; es ist selbst für den Sennen nicht rathsam, vor seinen Augen eine rindernde Kuh von der Sente zu entfernen. In den öfters besuchten tieferen Weiden dürfen nur zahme und gutartige Stiere gehalten werden; in den höheren Alpen trifft man aber oft sehr wilde und gefährliche Thiere. Da stehen sie mit ihrem gedrungenen, markigen Körperbau, ihrem breiten Kopf mit krausem Stirnhaare am Wege und messen alles fremdartige mit stolzen, jähzornigen Blicken. Besucht ein Fremder, namentlich in Begleitung eines Hundes, die Alp, so bemerkt ihn der Herdenstier schon von weitem und kommt langsam mit dumpfem Gebrüll heran. Er beobachtet den Menschen mit Mißtrauen und Zeichen großen Unbehagens, und reizt ihn an der Erscheinung desselben zufällig etwas, vielleicht ein rothes Tuch oder ein Stock, so rennt er geradeaus mit tief gehaltenem Kopfe, den Schwanz in die Höhe geworfen, in Zwischenräumen, wobei er öfters mit den Hörnern Erde aufwirft und dumpf brüllt, auf den vermeintlichen Feind los. Für diesen ist es nun hohe Zeit, sich zur Hütte, hinter Bäume oder Mauern zu retten; denn das gereizte Thier verfolgt ihn mit der hartnäckigsten Leidenschaftlichkeit und bewacht den Ort, wo es den Gegner vermuthet, oft stundenlang. Es wäre in solchem Falle thöricht, sich vertheidigen zu wollen. Mit Stößen und Schlägen ist wenig auszurichten, und der Stier läßt sich eher in Stücke hauen, ehe er sich vom Kampfe zurückzieht.
»Die festlichste Zeit für das Alpenrindvieh ist ohne Zweifel der Tag der Alpfahrt, welche gewöhnlich im Mai stattfindet. Jede der ins Gebirge ziehenden Herden hat ihr Geläute. Die stattlichsten Kühe erhalten, wie bemerkt, die ungeheuren Schellen, welche oft über einen Fuß im Durchmesser halten und vierzig bis fünfzig Gulden kosten. Es sind die Prunkstücke des Sennen; mit drei oder vier solchen in harmonischem Verhältnis zu einander stehenden läutet er von Dorf zu Dorfe seine Abfahrt ein. Zwischen hinein tönen die kleinen Erzglocken. Trauriger als die Alpfahrt ist für Vieh und Hirt die Thalfahrt, welche in ähnlicher Ordnung vor sich geht. Gewöhnlich ist sie das Zeichen der Auflösung des familienartigen Herdenverbandes.«
Solches Herdentreiben ist sozusagen die Dichtung im Rinderleben. In den meisten übrigen Ländern hat das gute Hausthier kein so schönes Loos. In Deutschland genießt es bloß in den Gebirgen und in den nördlichen Marschgegenden während des Sommers eine mehr oder weniger beschränkte Freiheit. Die Herden im Thüringer Walde erinnern noch lebhaft an jene, welche auf den Alpen weiden. In keiner größeren Waldung dieses lieblichen Gebirges wird man die Rinder vermissen. Jede Herde besitzt ihr eigenes vollstimmiges Geläute, und gerade in ihm suchen die Hirten ihren größten Stolz. Es gibt gewisse Tonkünstler, die Schellenrichter, welche im Frühjahre von Dorf zu Dorfe ziehen, um das Geläute zu stimmen. Jede Herde muß wenigstens acht verschiedene Glocken haben, welche großer, mittler und kleiner Baß, Halbstampf, Auchschell, Beischlag, Lammschlag und Gitzer genannt werden. Man hat beobachtet, daß die Rinder das Geläute ihrer Herde genau kennen und verirrte Kühe durch dasselbe sich zurückfinden. Die Thiere weiden während des ganzen Sommers im Walde; erst im Späthherbste stallt man sie ein.
In dem Alpenlande Norwegen lebt das Rindvieh in ähnlichen Verhältnissen wie in der Schweiz. Das norwegische Rind ist abgehärtet, wie alle Hausthiere dort es sind, und treibt sich sehr viel im Freien umher; immer aber kehrt es abends in seinen warmen Stall zurück. Das Leben auf dem Hochgebirge in den Sennerwirtschaften hat sicherlich für Menschen und Thiere dieselben Reize wie das Hirten- und Herdenleben in den eigentlichen Alpen; aber nicht alle Kühe genießen die liebevolle Pflege der schmucken und reinlichen Sennerinnen, welche das Gebirge des Nordens anmuthigerweise beleben. In den Waldgegenden z. B. läßt man die Thiere ohne Aufsicht umherstreifen, und da kommt es oft genug vor, daß ein Stück tagelang verirrt in den Wäldern umherstreift, mühselig durch Sumpf und Moor sich arbeitet und nur im günstigsten Falle wieder zu den Menschen kommt, abgemattet, mager, halb verhungert. Auch die bösen Mücken schaffen dem Vieh während der Hochsommermonate arge Plage und zwingen den Besitzer zu denselben Maßregeln, wie die Dinka sie ergreifen. Auf den nördlichen Weiden Norwegens zündet man allnächtlich Torffeuer an, um den zur Vertreibung der Mücken dienenden Rauch zu erzeugen und den an diese Art von Räucherung gewöhnten Rindern zu der nöthigen Ruhe zu verhelfen. Im höchsten Norden ist namentlich der Winter eine schlimme Zeit für das Rindvieh. Der kurze Sommer Norlands und Lapplands kann nicht genug Winterfutter erzeugen; deshalb füttert man im Winter nicht bloß Heu und Stroh, Laub und Birkenzweige, Renthiermoos und Pferdemist, Meerespflanzen, Algen und dergleichen, sondern auch Fische und namentlich die Köpfe der Dorsche, welche man gerade zur Zeit des Futtermangels in großen Mengen fängt. Diese Fischköpfe, nebst Tangen aller Art und Moosen, werden in einem Kessel so lange gekocht, bis die Knochen weich oder zur Gallerte werden; dann schüttelt man die breiige Masse den Kühen vor, und diese fressen die ihnen so unnatürliche Nahrung mit Begierde. Die Bewohner der Lofodden haben mich versichert, daß man die Gerüste, auf denen die Dorsche getrocknet werden, vor den Kühen bewahren müsse, weil diese ohne Umstände an den halbtrockenen Fischen sich satt zu fressen pflegen.
In den meisten übrigen Ländern Europas ist das Rindvieh ein trauriger Sklave des Menschen; in Spanien dagegen kommt zwar nicht das Rind, wohl aber der Ochse zur Geltung. Er genießt hier eine Achtung, wie sie einem indischen Zebu zu theil werden mag; er kann sich zum Helden des Tages emporschwingen und unter Umständen weit mehr Theilnahme erregen als alles übrige, was den Spanier näher angeht. Dieser hat für die Schönheiten eines Stieres ein besonderes Auge; er prüft und schätzt ihn wie bei uns ein Kundiger ein edles Pferd oder einen guten Hund. Nicht einmal an einem frommen Zugstiere geht er gleichgültig vorüber; gegen ein viel versprechendes Kalb zeigt er sich sogar zärtlich. Dies hat seinen Grund darin, daß ebensowohl die Spanier, welche ihr ursprüngliches Vaterland, als diejenigen, welche die Neue Welt bewohnen, leidenschaftliche Freunde von Schauspielen sind, wie sie wohl die alten Römer aufführten, nicht aber gebildete und gesittete Völker leiden mögen, und daß man jeden vor das Auge kommenden Stier darauf hin ansieht, ob und wie viel er wohl bei einer Stierhatze oder einem Stiergefechte zu leisten vermöge.
Die Stierhatzen sind Vergnügungen, welche einen Sonntagsnachmittag in erwünschter Weise ausfüllen und der Menge erlauben, thätig mit einzugreifen; bei den Stiergefechten kämpfen geübte Leute, die Toreros, falls nicht junge vornehme Nichtsthuer als besonderen Beweis ihrer Gesittung ein solches Schauspiel veranstalten, d. h. das Amt der Stierkämpfer übernehmen.
Die Stierhatzen werden auf den Märkten der Städte abgehalten. Alle nach dem Platze führenden Straßen sind durch ziemlich feste Holzplanken abgesperrt. Einer dieser Abschlüsse dient als Eingang, und hier entrichtet jeder Eintretende eine gewisse Summe. Ein Kaufmann in Játiva de San Felipe hatte uns gelegentlich einer Stierhatze zu sich eingeladen, weil wir von seinem Hause aus den ganzen Marktplatz übersehen konnten. Wir genossen ein sehr eigenthümliches Schauspiel. Die Hausthüren waren geschlossen, alle Erker aber geöffnet und gedrängt voll Menschen; insbesondere die Frauen nahmen den lebhaftesten Antheil. In der Mitte des Marktes erhob sich ein Gerüst für die Musik, welche um so lauter spielte, je toller der Lärm wurde. Der ganze Markt war voll von Menschen. Ich konnte mir gar nicht erklären, wo sie hergekommen und wohin sie sich zurückziehen wollten, wenn der Held des Tages auf dem Platze erscheinen würde. Man sah wohl einige Gerüste aufgeschlagen; aber diese konnten doch unmöglich die Menschenmenge fassen, welche jetzt aus dem Markte umherwogte. Und doch war es nicht anders. Einige Schläge an die Thüre des Gehöftes, in welchem sich die Stiere befanden, benachrichtigten von dem baldigen Erscheinen des vierfüßigen Schauspielers. Augenblicklich stob die Masse auseinander. Alle Gerüste, oder vielmehr die Pfahl- und Breterverbindungen waren im Nu bis oben hinauf mit Menschen besetzt. Wie Affen hockten die Leute übereinander. Unten auf der Erde, unter den Gerüsten, lag die liebe Jugend auf dem Bauche. An manchen Häusern waren andere Vorrichtungen getroffen worden, um geschützte Plätze gegen den herannahenden Ochsen zu erhalten. Man hatte drei bis fünf starke Stäbe oder Bohlen in Seile eingebunden und letztere an den Erkern befestigt. Die Bohlen waren so schmal, daß eben nur ein Fuß darauf Platz fand, genügten aber, wie ich bald sah, vollständig zum Ausweichen. Von oben herab hingen so viele Leinen, als möglicherweise Leute auf diesen Schieferdeckergerüsten Platz finden konnten. Die Leinen waren von Fuß zu Fuß Entfernung in Knoten geschlungen und dienten zum rascheren und sicheren Erklettern des Gerüstes sowie zum Sichfesthalten da oben. Andere Zuschauer hatten auf den Bänken, welche man hier und da in den Hausthüren sieht, Platz genommen, andere standen in den Thüren, immer bereit, dieselben augenblicks zu schließen, wieder andere hatten die Thore mittels schwerer Tafeln befestigt. An dem Gerüste, auf welchem die Musikbande thronte, hingen noch außerdem über hundert Menschen, und es brach deshalb später auch glücklich zusammen.
Jetzt öffneten sich die Flügelthüren des Gehöftes. Der Gegenstand der allgemeinen Verehrung und Unterhaltung, ein zünftiger Ochse, stürmte heraus. Augenblicklich saßen alle Menschen auf ihren schwebenden Gerüsten. Die achtbare Versammlung begrüßte den herausgetretenen Stier mit endlosem Gebrüll. Verwundert sah der Ochse sich um. Die bunte Menschenmenge, der ungewohnte Lärm machten ihn stutzig. Er stampfte mit dem Fuße und schüttelte das Haupt, die gewaltigen Hörner zu zeigen, bewegte sich aber nicht von der Stelle. Das verdroß die Leute natürlich. Die Frauen schimpften und schwenkten ihre Tücher, nannten entrüstet den Ochsen ein erbärmliches Weib, eine elende Kuh; die Männer gebrauchten noch ganz andere Kraftworte und beschlossen endlich, den faulen Gesellen in Trab zu setzen. Zuerst sollten Mißklänge aller Art ihn aus seiner Ruhe schrecken. Man war erfindungsreich im Hervorbringen eines wahrhaft entsetzlichen Lärmes, pfiff auf wenigstens zwanzigfach verschiedene Weise, schrie, kreischte, klatschte in die Hände, schlug mit Stöcken auf den Boden, an die Wände, an die Thüren, zischte, als ob Schwärmer in Brand gesetzt würden; man schwenkte Tücher, schwenkte von neuem: der Ochse war viel zu sehr verwundert und stand nach wie vor unbeweglich. Ich fand dies ganz natürlich. Sein Fassungsvermögen war eben schwach, und wenn es auch sonst bei derartigen Geistern gewöhnlich nicht lange dauert, um zu begreifen, daß man selbst als Ochse der Held des Tages sein kann, schien unser Stier doch noch nicht in die ihm gewidmeten Ehrenbezeigungen sich finden zu können. Zudem war die Lage des guten Thieres wirklich ungemüthlich. Ueberall Menschen, von denen man nicht wissen konnte, ob sie verrückt oder bei Verstande waren, und aus diesem allgemeinen Irrenhause keinen Ausweg: das mußte selbst einen Ochsen zum Nachdenken bringen.
Aber solches Nachdenken sollte gestört werden. Spaniens edles Volk wollte mit dem Ochsen sich unterhalten, verbrüdern. Man griff deshalb zu anderen Mitteln, nur den erstaunten Stier zu stören. Langsam öffnete sich eine Thür; ein langes, am vorderen Ende mit spitzigen Stacheln bewehrtes Rohr wurde sichtbar; weit schob es sich heraus, endlich erschien auch der Mann, welcher es am anderen Ende festhielt. Bedächtig richtete und lenkte er besagtes Rohr: ein furchtbarer Stoß nach dem Hintertheile des Ochsen wurde vorbereitet und ausgeführt, gelang auch, doch ohne die gehoffte Wirkung. »Toro« hatte den Stoß für einen Mückenstich gehalten. Er schlug zwar wüthend nach hinten aus, das stechlustige Kerbthier zu vertreiben, blieb aber stehen. Neue Mittel ersann man; sogar das Parallelogramm der Kräfte wurde in Anwendung gebracht: von zwei Seiten zielte und stieß man zu gleicher Zeit nach dem Hintertheile des Stieres. Das trieb ihn endlich einige Schritte vorwärts. Jetzt brachten Stachelbolzen, welche man aus Blasrohren nach seinem Felle sandte, ihm zugeworfene Hüte, vorgehaltene Tücher und das bis zum äußersten gesteigerte Brüllen die gewünschte Wirkung hervor. Todesmuthig, zitternd vor Wuth, stürmte das Thier an einer Seite des Marktplatzes hinauf und fegte dieselbe gründlich rein, – aber nur für einen Augenblick; denn kaum war der Stier vorüber, so war auch die Menge wieder von ihren schwebenden Sitzen herunter und rannte ihrem Lieblinge nach.
Man benahm sich nicht bloß dreist, sondern wirklich frech. Wenn der Stier längs der Häuser dahintobte, faßten ihn einige der verwegensten Gesellen auf Augenblicke an den Hörnern, traten ihn andere von oben herab mit Füßen, stellten sich andere auf kaum mehr als zehn Schritte vor ihn hin und reizten ihn auf alle denkbare Weise, waren aber, wenn der Stier auf sie losstürzte, immer noch geschwind genug, eines der Gerüste zu erklettern. Die meisten bewiesen Muth, einige aber waren doch recht feig. Sie stachen durch kleine Löcher in den Hausthüren hindurch oder machten nur Lärm, wie ein Mann, welcher unsere Verachtung im reichsten Maße auf sich zog, weil er bloß die Thüre öffnete, mit der Hand oder dem Stocke daranschlug, sie aber, sowie der Stier die geringste Bewegung machte, schleunigst wieder verschloß. Während der Hatzen lernte ich einsehen, wie genau die Spanier ihren guten Freund kannten. So waren die untersten Planken, auf denen die Leute standen, kaum mehr als anderthalb Meter über den Boden erhöht, der Stier konnte sie also ganz bequem mit seinen Hörnern leer machen: er kam aber nie dazu; denn kurz vor seiner Ankunft faßten die auf solchen Planken Stehenden mit ihren Händen höhere Theile des Gerüstes, zogen die Beine an und erhielten sich so lange in der Schwebe, bis das wüthende Thier vorüber gestürmt war.
Um zum Schlusse zu kommen: Sechs Stiere wurden durch Menschen und Hunde so lange auf dem Markte herumgehetzt, bis sie wüthend und später müde wurden. Dann war es für sie stets eine Erlösung aus allem Uebel, wenn der zahme Leitochse erschien, dem die Pflicht oblag, sie in ihre Ställe zurück zu bringen. Dieses Mal ging die Hatze ohne Unfall vorüber, obgleich man wiederholt solchen fürchten mußte, namentlich als das erwähnte Gerüst zusammenbrach. Im ungünstigen Augenblick darf nur ein einziges Bret an den Gerüsten brechen, und ein Unglück ist vollendet. Bei einer der letzten Hatzen hatten zwei Menschen das Leben verloren. So etwas aber stört die Spanier keineswegs; selbst die Polizei thut nichts, um so ein trauriges Zwischenspiel – denn die Stierhatze wird nicht unterbrochen, wenn ein Paar Menschen dabei umkommen – zu verhüten. Hier begnügte sie sich, die aus wirklich unverantwortlich tollkühne Weise aufgestellten Leute weniger gefahrvollen Plätzen zuzutreiben; im übrigen wirkte sie selbst thätig mit.
Solche Hatzen sind einfache Sonntagsvergnügungen der Spanier, die Stiergefechte dagegen außerordentliche Feste, man darf wohl sagen, die größten des Jahres. In Madrid und in Sevilla werden während der heißen Sommermonate bei gutem Wetter jeden Sonntag Stiergefechte aufgeführt, in den übrigen Städten des Landes nur einmal im Jahre, dann aber gewöhnlich drei Tage lang nach einander. Der Reisende, welcher sich längere Zeit in Spanien aufhält, kann solchem Schauspiele nicht entgehen. Ich beschreibe ein Stiergefecht, welchem ich in Murcia beiwohnte.
Schon in den ersten Nachmittagsstunden des festlichen Sonntags drängten sich die Menschen in den dahinführenden Straßen. Ueberfüllte Wagen aller Art kreuzten sich mit leeren, welche vom Platze zurückkehrten, um neue Schaulustige herbeizuführen. Am Eingange des Schauplatzes wogte die bunte Menge unter Fluchen und Toben durcheinander, obgleich die Thüren bereits seit mehreren Stunden geöffnet waren und die ärmeren Stadtbewohner sowie die hier wie überall geizigen Landleute schon seit Mittag ihre Plätze gewählt und besetzt hatten. Fünf Stunden lang mußten diese Erstlinge die furchtbare Sonnenglut aushalten, um dann während der Vorstellung Schatten zu haben, ertrugen jedoch alles gern, um nur das erhabene Schauspiel in Ruhe genießen zu können. Der Anblick des Amphitheaters war überraschend. Die Menschenmenge verschmolz zu einem bunten Ganzen, aus welchem nur die rothen Binden der Männer der Fruchtebene und die lebhaft gefärbten Halstücher der Frauen hervorstachen. Einige junge Leute schwenkten rothe Fahnen mit darauf gestickten Ochsenköpfen und anderen passenden, d. h. auf das Rindvieh bezüglichen Sinnbildern des Festes; viele waren mit Sprachröhren versehen, um den wüsten Lärm, welcher herrschte, noch vermehren, das Gekreisch und Gebrüll vervollständigen zu können.
Unsere anfangs noch den Sonnenstrahlen ausgesetzten Plätze befanden sich hart an der zum Stierzwinger führenden Thüre. Links vor uns hatten wir die Pforte, durch welche die Kämpfer hereintreten und die getödteten Thiere hinausgeschafft werden, rechts über uns war der Schausitz der Obrigkeit, dicht vor uns, bloß durch eine Planke getrennt, der Kampfplatz. Dieser mochte ungefähr sechzig oder achtzig Schritte im Durchmesser halten und war ziemlich geebnet, jetzt aber voller Pfirsichkerne und anderer Fruchtreste, welche man von oben herabgeworfen hatte und beständig noch herabwarf. Die Planke, welche anderthalb Meter hoch sein mochte, hatte an der inneren Seite in einer Höhe von einen halben Meter ziemlich breite Leisten, dazu bestimmt, den vor dem Stier fliehenden Kämpfern beim Ueberspringen Unterstützung zu gewähren. Zwischen dieser Umhegung und den Schauplätzen war ein schmaler Gang für die Toreros leer gelassen worden; hierauf folgten »in Weiten, stets geschweiften Bogen« die für die Menge bestimmten Bänke, etwa zwanzig oder dreißig an der Zahl, auf diese Sitzreihen die gesperrten Plätze und auf sie endlich die Logenreihen, in denen man die Frauen der Stadt im höchsten Putze sehen konnte, und auf deren Dächern noch Hunderte von Menschen, den Regenschirm gegen die Sonnenstrahlen ausgespannt, erwartend standen, wahrscheinlich, weil sie unten keine Sitze gefunden hatten. Erst beim Anblick dieser Menschenmenge wurde es glaublich, daß eine Arena zwölf- bis zwanzigtausend Menschen fassen kann.
Jeder Zuschauer that, was er von seinem Platze aus thun konnte, und die Bedeutung des Sprichwortes: »Er beträgt sich, wie auf dem Platze der Stiere« wurde uns einleuchtend. Nicht ein einziger saß ruhig, sondern bewegte wenigstens Arme, Regenschirm, Fächer, oft nach allen Richtungen hin, schrie aus vollem Halse, warf mit Früchten um sich, kurz, bemühte sich so viel als möglich, dem Viehe gleichzukommen.
Mit dem Schlage der bestimmten Stunde erschien der Alcalde in seiner reich verzierten, mit dem Wappen der Stadt geschmückten Loge. Die großen Thore öffneten sich, und die Toreros traten herein. Vor ihnen her ritt ein Alguazil in seiner uralten Amtstracht; auf ihn folgten die Espadas, Bandarilleros und Cacheteros, hierauf die Picadores und zuletzt ein Gespann mit drei reichgeschmückten Maulthieren. Die Fechter trugen enge, überreich gestickte Kleider und darüber rothe, mit Goldschmuck überladene Sammetmäntel; die kurze Jacke war förmlich mit Gold und Silber überdeckt, weil man nicht allein die Schultergegend mit dicken Goldtroddeln verziert, sondern auch dicke Silberplatten, welche Edelsteine umfaßten, darauf geheftet hatte. Die schwarzen Käppchen, welche aller Köpfe bedeckten, waren aus dickem Wollzeuge eigenthümlich gewebt; die Bekleidung der Füße bestand aus leichten Schuhen mit silbernen Schnallen. Die Bandarilleros trugen anstatt der Mäntel buntfarbige, wollene Tücher über dem Arme. Ganz abweichend waren die Picadores gekleidet. Nur die Jacken waren ebenso kostbar gestickt wie bei den übrigen; die Beinkleider aber bestanden aus dickem Leder und waren über schwere, eiserne Schienen gezogen, welche die Unterschenkel und die Füße sowie den rechten Oberschenkel umhüllten; auf dem Haupte saßen breitkrempige, mit buntfarbigen Bandrosen verzierte Filzhüte. Diese Leute ritten erbärmliche Klepper, alterschwache Pferde, welche sie mit einem wirklich furchtbaren Sporn am linken Fuße antrieben, und saßen in Sätteln mit hohen Rückenlehnen und überaus schweren, wie grobe Holzschuhe gestalteten eisernen Steigbügeln. Alle Fechter trugen dünne Haarzöpfe von größerer oder geringerer Länge.
Der Zug der hereingetretenen Männer bewegte sich nach der Loge des Alcalden, verbeugte sich vor diesem und grüßte sodann die schauende Menge. Hierauf rief der Alguazil einige Worte, welche aber von ungeheurem Gebrüll der Zuschauer vollkommen verschlungen wurden, zum Manne des Gesetzes hinauf, um sich dessen Genehmigung zu Beginn der Vorstellung zu erbitten. Der Alcalde erhob sich und warf dem Alguazil den Schlüssel zum Stierzwinger zu. Dieser fing denselben auf, ritt zu der Thüre des Zwingers und gab ihn einem dort stehenden Diener, welcher die Thüre aufschloß, aber nicht öffnete. Die Espadas warfen ihre Mäntel ab, hingen sie an der Umplankung auf, ordneten ihre Degen und nahmen, wie die Bandarilleros, bunte Tücher zur Hand; die Picadores ritten zu einem besonderen Beamten, welcher Quäl- und Schlachtwerkzeuge bewahrte, und erbaten sich von diesem Lanzen, drei bis vier Meter lange, runde, etwa vier Centimeter im Durchmesser haltende Stangen, an deren einem Ende eine kurze, dreischneidige, sehr scharfe Spitze befestigt ist, aber nur soweit hervortritt, als sie in das Fleisch des Stieres eindringen soll. Nachdem sie ihre Waffen empfangen hatten, waren alle zum Beginn des Gefechtes nöthigen Vorbereitungen beendet.
Es läßt sich nicht verkennen, daß bis jetzt das Schauspiel etwas großartiges und theilweise auch anziehendes hatte; von jetzt aber sollte es anders kommen. Bisher hatte man es noch mit Menschen zu thun gehabt; von nun an aber trat das Vieh in seine Rechte.
Man öffnete die Thüre des Stalles, um dem eingepferchten Stiere einen Ausweg zu verschaffen. Der Stier war vorher regelrecht in Wuth versetzt worden. Der Stierzwinger ist ein breiter Gang mit mehreren kleinen, gemauerten oder aus Holz bestehenden Kämmerchen, in welche je ein Stier getrieben wird, oft mit großer Gefahr und Mühe, hauptsächlich durch Hülfe der zahmen Ochsen, welche gegen ihre wilden Brüder ähnlich verfahren wie die zahmen Elefanten gegen die frisch gefangenen. In seinem Kämmerchen nun wird der zum Kampfe bestimmte Stier erst stundenlang mit einem Stachelstock gepeinigt oder, wie der Spanier sagt, » gestraft«. Die Spitzen sind nadelfein, so daß sie wohl durch die Haut dringen und Qualen verursachen, aber kaum Blutverlust hervorrufen. Man kann sich denken, wie sehr sich die Wuth des gefangenen Thieres, welches sich nicht einmal in seinem Kämmerchen umdrehen kann, steigert und mit welchem Grimm es ins Freie stürzt, sobald ihm dazu Gelegenheit sich bietet.
Sofort nach dem Oeffnen des Zwingers erschien der erste der Verdammten:
»Ein Sohn der Hölle schwarz und wild,
Unbänd'ger Kraft ein schaurig Bild;
Dumpf drang aus seiner Brust die Stimme,
Er schnaubte wild im Rachegrimme«.
Um ihn noch mehr in Wuth zu versetzen, hatte man ihm eine Minute vorher die sogenannte »Devise«, eine große buntfarbige Bandrose, mittels einer eisernen Nadel mit Widerhaken durch Haut und Fleisch gestochen und damit die vorhergehenden Qualen würdig beschlossen. Beim Heraustreten stutzte er einen Augenblick, nahm sodann sofort einen der Bandarilleros an und stürzte gesenkten Hauptes auf diesen los. Der Fechter empfing ihn mit der größten Ruhe, hielt ihm das Bunttuch vor und zog sich sodann gewandt zurück, um ihn einem der Picadores zuzuführen. Diese saßen mit vorgehaltenen Lanzen unbeweglich auf ihren Pferden, denen sie, weil sie die wüthenden Stiere immer von der rechten Seite auflaufen ließen, das rechte Auge verbunden hatten, oder ritten den Stieren höchstens einige Schritte entgegen, um sie dadurch zum Angriffe zu reizen. Ihre Aufgabe war es, den Stier von den Pferden abzuhalten; allein die armen, altersschwachen, dem Tode geweihten Mähren besaßen selten genug Widerstandsfähigkeit, um dem Stoße des Picador den erforderlichen Nachdruck zu verleihen, und wurden deshalb regelmäßig das Opfer des anstürmenden Feindes. Wenn der Stier vor einem Reiter angekommen war, blieb er eine Zeitlang unbeweglich stehen, stampfte mit den Vorderfüßen den Boden und schleuderte den Sand hinter sich, schlug mit dem Schweife, rollte die Augen, senkte plötzlich den Kopf und rannte auf das Pferd los, dabei aber mit seiner vollen Kraft in die vorgehaltene Lanze, welche der Picador nach seinem Nacken gerichtet hatte. Pferd und Reiter wurden durch den Stoß des Stieres zurückgeschleudert, beide aber blieben diesmal unversehrt. Brüllend vor Schmerz und Wuth zog sich der Angreifer zurück und schüttelte den blutigen, von der Pike weit aufgerissenen Nacken. Dann stürzte er sich von neuem auf die vor ihm hergaukelnden Fußfechter, deren Mäntel ihn in immer größere Wuth versetzten, oder auf einen anderen Picador. Beim zweiten Anlaufe gelang es ihm fast immer, bis zu dem Pferde vorzudringen, und dann bohrte er im selben Augenblicke die spitzigen Hörner tief in den Leib des letzteren. Glücklich für das gefolterte Thier, wenn der erste Stoß in die Brust gedrungen und tödtlich war; wehe ihm, wenn es nur eine klaffende Wunde in das Bein oder in den Unterleib erhalten hatte! Wenn auch ein Stier dem Pferde den Unterleib aufgeschlitzt hatte und die Gedärme herausquollen oder selbst auf der Erde nachschleppten, so daß das gepeinigte edle Geschöpf mit seinen eigenen Hufen auf ihnen herumtrat: seine Marter war dann noch nicht beendigt. Die Picadores zerstießen mit ihren Lanzen die nachschleppenden Eingeweide, damit deren Inhalt ausfließen sollte, oder die Pferde traten jene selbst ab, und von neuem trieben die Reiter sie dem Stiere entgegen. Am ganzen Leibe zitternd, die Lippen krampfhaft bewegend, standen die Pferde und erwarteten einen zweiten, dritten Angriff des wüthenden Stieres, bis der herannahende Tod ihrer Qual ein Ende machte. Hingemartert brachen sie zusammen; die Picadores schleppten sich schwerfällig bis zur Umplankung und erschienen nach einiger Zeit auf einem neuen Pferde wiederum auf dem Kampfplatze. Wenn die gefallenen Pferde noch etwas Leben zeigten, wurden sie geschlagen und gemartert, in der Absicht, sie nach dem gemeinschaftlichen Todtenbette zu schaffen. Dort wurden ihnen, während die Bandarilleros den Stier auf einer anderen Seite beschäftigten, die Sättel abgerissen, und wenn es anging, schlug, stieß, schob und zog man sie von neuem, um sie von dem Platze zu bringen; denn nur ein todt zusammengestürztes oder wenigstens schon mehr als halbtodtes Pferd ließ man ruhig auf der Walstatt liegen.
Bei jedem gut abgewiesenen Anlaufe des Stieres spendeten die Zuschauer dem Picador, bei jeder Verwundung, welche ein Pferd erhielt, dem Stiere Beifall. Stimmen der empörendsten Gefühllosigkeit wurden laut: »Geh', Pferd, nach dem Krankenhause und laß dich dort heilen! Sieh, Pferdchen, welch einen Stier du vor dir hast! Weißt du jetzt, mit wem du es zu thun hattest?« Solche und ähnliche Worte vernahm man, und rohes Gelächter begleitete solche Ausrufe. Je tiefer die Verwundung eines Pferdes war, um so stürmischer erbrauste der Beifall des Volkes; mit wahrer Begeisterung aber begrüßte man die Niederlage eines Picador. Während des ganzen Gefechtes geschah es mehrere Male, daß einer dieser Leute sammt seinem Pferde von dem Stiere zu Boden geworfen wurde. Einer derselben stürzte mit dem Hinterkopfe gegen die Holzwand, daß er für todt vom Platze getragen wurde, kam aber mit einer Ohnmacht und einer leichten Schramme über dem Auge davon. Ein zweiter erhielt eine bedeutende Verrenkung des Armes und wurde dadurch für die nächste Zeit kampfesunfähig. Den ersteren würde der Stier ebenso wie sein Pferd getödtet haben, hätten die Fußfechter nicht die Aufmerksamkeit des gereizten Thieres durch ihre Tücher auf sich gelenkt und es dadurch von jenem abgezogen.
So dauerte der erste Gang des Gefechtes ungefähr fünfzehn Minuten oder länger, je nach der Güte, d. h. je nach der Wuth des Stieres. Je mehr Pferde er tödtete oder tödtlich verwundete, umsomehr achtete man ihn. Die Picadores kamen oft in Gefahr, wurden aber immer durch die Fußfechter von dem Stiere befreit; diese selbst entflohen im Nothfalle durch rasches Ueberspringen der Umplankung. Ihre Gewandtheit war bewunderungswürdig, ihre Tollkühnheit überstieg allen Glauben. Der eine Fechter faßte den Stier beim Schwanze und drehte sich mit ihm mehrere Male herum, ohne daß das hierdurch in Raserei versetzte Thier ihm etwas anhaben konnte. Andere warfen, wenn der Stier sie schon fast mit den Hörnern erreicht hatte, ihnen noch geschwind das Tuch über die Augen und gewannen so immer noch Zeit zum Entfliehen.
Nachdem der Stier genug Pikenstöße empfangen hatte, gab ein Trompetenstoß das Zeichen zum Beginne des zweiten Ganges. Jetzt nahmen einige Fußfechter die Bandarillas zur Hand. Die Picadores verließen den Kampfplatz, die übrigen behielten ihre Tücher bei. Die Bandarilla ist ein starker, ungefähr 75 Centimeter langer, mit Netzen bekleideter Holzstock, welcher vorn eine eiserne Spitze mit Widerhaken hat. Jeder Bandarillero ergriff zwei dieser Quälwerkzeuge, reizte den Stier und stieß ihm, sowie derselbe auf ihn losstürzte, beide Bandarillas gekreuzt in den durch die Pikenstöße zerfleischten Nacken. Vergeblich versuchte der Stier sie abzuschütteln, und immer höher steigerte sich seine Wuth. Im grimmigsten Zorne nahm er den zweiten und den dritten Bandarillero auf. Jedesmal erhielt er neue Bandarillas, ohne jemals den Mann erreichen zu können, welcher sofort nach dem Stoße gewandt zur Seite sprang. Binnen fünf Minuten war ihm der Nacken mit mehr als einem halben Dutzend Bandarillas gespickt. Beim Schütteln schlugen dieselben klappernd an einander und bogen sich allgemach zu beiden Seiten herab, blieben aber stecken.
Ein neuer Trompetenstoß eröffnete den dritten Gang. Der erste Espada, ein echtes Bravogesicht, schritt auf den Alcalden zu, verneigte sich und brachte ihm und der Stadt ein Hoch. Dann nahm er ein rothes Tuch in die linke, die Espada in die rechte Hand, ordnete Tuch und Waffe und trat dem Stiere entgegen. Den langen, spitzigen und starken zweischneidigen Degen, welcher ein Kreuz und einen sehr kleinen Handgriff hat, faßte er so, daß die drei hinteren Finger in dem Bügel staken, der Zeigefinger auf der Breitseite des Degens und der Daumen auf dem Handgriffe lag. Das Tuch breitete er über einen Holzstock aus, an dessen Ende es durch eine Stahlspitze festgehalten wurde. Mit dem Tuche reizte er den Stier, bis dieser auf ihn losstürzte; aber nur dann, wenn das Thier in günstiger Weise anlief, versuchte er, ihm einen Stoß in den Nacken zu geben. Gewöhnlich ließ er den Stier mehrere Male anlaufen, ehe er überhaupt zustieß. Bei einem Stiere gelang es ihm erst mit dem dritten Stoße, die geeignete Stelle hart am Rückgrate zwischen den Rippen zu treffen; die früheren Stöße waren durch die Wirbelkörper aufgehalten worden. Nach jedem Fehlstoße ließ der Mann die Espada stecken und bewaffnete sich mit einer anderen, während der Stier die erstere durch Schütteln abwarf. Wenn der Stoß gut gerichtet war, senkte sich der Degen bis zum Hefte in die Brusthöhle und kam gewöhnlich unten wieder zum Vorscheine. Sofort nach dem tödtlichen Stoße blieb der Stier regungslos stehen; ein Blutstrom quoll ihm aus Maul und Nase; er ging einige Schritte vorwärts und brach zusammen. Nunmehr näherte sich der Cachetero oder Matador, stieß dem sterbenden Thiere einen breiten Abfänger ins Genick und zog die Bandrose aus dem Nacken.
Beifallsgebrüll der Zuschauer vermischte sich mit rauschender Musik. Die breite Pforte öffnete sich, um das Gespann der Maulthiere einzulassen, welche den Stier mittels eines zwischen und um die Hörner gewundenen, am Zugholze befestigten Strickes in vollem Rennen zum Thore hinausschleiften. Hierauf wurden die gefallenen Pferde in eben derselben Weise fortgeschafft, die Blutlachen mit Sand bestreut, sonstige Vorkehrungen für das zweite Gefecht getroffen.
Ein zweiter, dritter, sechster Stier erschien auf dem Kampfplatze. Der Gang des Gefechtes war bei allen derselbe, nur mit dem Unterschiede, daß der eine mehr, der andere weniger Pferde tödtete, daß dieser erst mit dem zehnten, jener mit dem ersten Degenstoße zu Boden fiel. Bei solchem Heldenstück wollte das Brüllen der Zuschauer kein Ende nehmen. Der Espada selbst schnitt sich stolz ein Stück Haut des Thieres ab und warf es laut jubelnd in die Luft. In den Zwischenpausen spielte die Musik oder brüllten die Zuschauer. Nach sechs Uhr war das Schauspiel beendet. Auf blutgetränktem Bette lagen zwanzig getödtete Pferde und der letzte der Stiere; die übrigen hatte man bereits fortgeschafft. Zehn oder zwölf mit Ochsen bespannte Karren hielten auf dem Platze, um die Mähren abzuräumen. Einzelne Pferde lebten noch, ohne daß eine mitleidige Hand sich gefunden hätte, ihrem Dasein ein Ende zu machen. Man schnitt ihnen, unbekümmert um ihr Röcheln und ihre Zuckungen, Mähnen und Schwänze ab; man lud sie endlich auf und überließ es ihnen, zu sterben, wo und wann sie könnten.
Es ist leicht erklärlich, daß solche öffentlich aufgeführte, von der Obrigkeit geduldete, ja geleitete Thierquälerei alle Leidenschaften aufstachelt. Die Stiergefechte sind ein deutlicher Beweis der geringen Bildung und Gesittung, welche gegenwärtig noch in Spanien herrschen. Die Pfaffen haben sich, nachdem die Autodafés nicht mehr ausgeführt werden dürfen, stets bemüht, wenigstens die Stiergefechte zu erhalten, weil sie wissen, daß sie, so lange jene abgehalten werden, ihre Herrschaft behaupten können oder, was dasselbe, weil die Menschen so lange roh und ungesittet bleiben werden. So lange die Spanier den gebildeten Völkern Europas nicht gleichstehen, wird man diese Tummelplätze der scheuslichsten Barbarei, der abscheulichsten und nichtswürdigsten Verhöhnung des Menschlichen im Menschen bestehen lassen.
Die Leidenschaft, mit welcher die Spanier den Stiergefechten beiwohnen, ist unglaublich groß. Nicht nur Männer schwärmen für diese fluchwürdigen Spiele, auch Frauen versäumen, wenn sie können, kein einziges, nehmen selbst ihre säugenden Kinder mit sich auf den Kampfplatz. Stierfechter erwerben sich gewöhnlich ein bedeutendes Vermögen und werden zu Helden des Tages, obgleich sie sonst in sehr geringer Achtung stehen; der reiche und vornehme Pöbel befreundet sich mit ihnen, obgleich sie der Hefe des Volkes angehören. Mehr noch als sie selbst bewundert man die Stiere; einzelne, welche viele Pferde tödteten, genießen jahrelangen Nachruf, und von ihnen her schreibt sich die Achtung, mit welcher die Spanier das Rindvieh überhaupt behandeln.
Nach dem vorhergegangenen brauche ich über das geistige Wesen des Hausrindes nicht viel zu sagen. Das Thier steht unzweifelhaft auf niederer Stufe, denn es ist neben dem Schafe das dümmste unserer Hausthiere. Seinen Pfleger lernt es kennen und in gewissem Grade lieben, gehorcht dem Rufe und folgt der Lockung, beweist auch eine gewisse Theilnahme gegen den, welcher sich viel mit ihm beschäftigt; Gewohnheit scheint aber mehr zu wirken als eigentliche Erkenntnis. »Alles geistige«, sagt Scheitlin, »tritt in den Rindern, welche mehr im Freien als im Stalle leben, schöner auf. Die Alpenkühe lernen ihren Fütterer schneller kennen, sind munter, freuen sich lebendiger, werden frischer vom Schellenklang, erschrecken weniger, kämpfen mit einander ritterlicher im Ernst und Scherz. Ihr Ehrgefühl ist aber schwach. Hat die eine die andere zurückgedrängt, so macht dies der überwundenen gar nichts: sie schämt und ärgert sich nicht, sondern trollt sich auf die Seite, senkt den Kopf und frißt wieder. Die Siegerin zeigt nicht den mindesten Stolz, nicht die Spur von Freude; auch sie fängt sogleich wieder zu grasen an. Die Heerkuh fühlt sich freilich größer als jede andere. Man erkennt dies aus ihrem feierlichen Schritt; auch gestattet sie nicht, daß irgend eine andere Kuh ihr vorausgehe. Der Stier ist viel vorzüglicher als die geistigste Kuh, hat weit mehr Körperkräfte, schärfere Sinne, mehr Kraftgefühl, Muth, Gewandtheit, Raschheit, schaut viel frischer in die Welt und sieht mit Verstand um sich, fühlt sich als gewaltiger Beschützer seiner Herde, geht auf den Feind los und kämpft wacker mit ihm. Einen fremden Bullen duldet er nicht bei seiner Herde, sondern streitet mit ihm auf Leben und Tod.«
Das Rind ist im zweiten Jahre seines Lebens zeugungsfähig. Paarungstrieb verräth die Kuh durch Unlust am Fressen und Saufen, durch Unruhe und vieles Brüllen. Die Brunst hält nur einen halben Tag an, kehrt aber, wenn die Lust nicht befriedigt wurde, oft wieder. Die Tragzeit währt in der Regel 285 Tage, kann jedoch erheblich länger oder kürzer sein. Das Kalb erhebt sich bald nach seiner Geburt auf die Füße und saugt schon am ersten Tage seines Lebens. Die Kuh bemuttert es, bis sie wieder brünstig wird. Bei der Geburt bringt das junge Rind acht Schneidezähne mit auf die Welt, nach Vollendung des ersten Jahres wechselt es die beiden mittelsten, ein Jahr später die beiden diesen zunächststehenden, nach Verlauf des zweiten Jahres das dritte Paar und ein Jahr später endlich die beiden letzten. Mit dem fünften Lebensjahre gilben sich die anfänglich milchweißen Zähne, zwischen dem sechzehnten und achtzehnten beginnen sie auszufallen oder abzubrechen. Von dieser Zeit an gibt die Kuh keine Milch mehr, und der Stier ist zur Paarung kaum noch geeignet. Die Lebensdauer scheint fünfundzwanzig, höchstens dreißig Jahre nicht zu übersteigen.
Verschiedene Pflanzen im frischen und getrockneten Zustande, Wicken, Erbsen, junges Getreide und saftiges Gras sind die Lieblingsnahrung des Rindes. Schädlich werden ihm Flachs, Eibe, Wasserschierling, Läusekraut, Binsen, Froschlauch, Zeitlose, Wolfsmilch, Eisenhut, junges Eichenlaub und Wallnußblätter, nasser Klee und dergleichen. Petersilie, Sellerie, Lauch und Zwiebeln wirken der Milcherzeugung entgegen. Thymian, Saalbreit, Hahnfuß, Wegerich werden im Nothfalle, Früchte aller Art, Kartoffeln, Obst und Möhren leidenschaftlich gern gefressen; Salz ist Bedürfnis. Eine erwachsene Kuh bedarf etwa täglich zehn bis zwölf, ein Ochse fünfzehn bis achtzehn Kilogramm Futter. Erstere verursacht dem, welcher alles Futter kauft, einen Kostenaufwand von etwa 200 Mark, bringt aber dafür etwa 250 Mark ein. Noch besser verwerthet der Landwirt das Rind, wenn er es mästet, und zumal in der Neuzeit erzielt man durch geeignete Fütterung außerordentliche Erfolge. Das Rind gilt mit Recht als das einträglichste aller Hausthiere.
Einzelne Naturforscher erklären einen offenbar zu dem Geschlechte der Rinder gehörigen, den Büffeln zunächst verwandten Wiederkäuer noch immer als Antilope, obgleich Gestalt, Eigenheit der Hörner, Behaarung, Lebensweise und Wesen die Zusammengehörigkeit desselben mit den Rindern auf den ersten Blick erkennen lassen. Der Gemsbüffel, wie wir das in Rede stehende Thier nennen wollen, Vertreter der Untersippe gleichen Namens ( Probubalus), von den Malaien Anoa oder Sapi-Utan (zu deutsch Waldkuh) genannt ( Bos depressicornis, Antilope, Anoa und Probubalus depressicornis, Antilope compressicornis, platyceros und celebica), ist, abgesehen von einigen Zuchtrassen, der Zwerg des Rindergeschlechtes, da er bei einer Schulterhöhe von 1,3 bis 1,4 Meter, einschließlich des 30 Centim. langen Schwanzes, eine Gesammtlänge von höchstens 2 Meter erreicht. Der Leib ist gedrungen, nach der Mitte zu an Stärke zu-, nach hinten wieder abnehmend, am Widerriste höher als am Kreuze, der Hals kurz und schwach gerundet, der Kopf auf der Stirne sehr breit, gegen die Muffel hin zugespitzt, diese zu einem kurzen, breiten und nackten Felde ausgedehnt, welches die ganze Oberlippe einnimmt, auf dem Nasenrücken erhaben, das oben stark bewimperte Auge groß und dunkelbraun von Farbe, sein Stern rundlich, das Ohr kurz, ziemlich schmal, sein Außenrand etwas ausgeschweift, sein Innenrand gebogen, nur an der Wurzel behaart, an der Spitze dagegen nackt und innen am Winkel mit einem Busche von weißlichen Haaren bekleidet; das Gehörn, dessen Stangen an der Wurzel weit von einander stehen, am Rande der Stirnleiste aufgesetzt, wenig nach hinten gerichtet und schwach nach außen gebogen, das einzelne Horn von oben nach unten fast dreiseitig zusammengedrückt, unten geringelt, oben platt kegelförmig und pfriemenspitzig, der Schwanz lang, bis auf das Fesselgelenk herabreichend, von oben nach unten verschmächtigt und mit einer schwachen Haarquaste versehen; die niedrigen, plumpen, breitgestellten Beine zeigen abgerundete, durchaus rindsartig gestaltete Hufe mit ziemlich langen und abstehenden Afterklauen; Thränengruben fehlen. Die mittellange und verhältnismäßig dünn stehende, aber rauhe Behaarung, welche im Gesichte, namentlich über der Muffel und vor dem Auge, sehr spärlich auftritt, hat keinen eigentlichen Strich; ihre im allgemeinen dunkelbraune Färbung lichtet sich an den dünnbestandenen Stellen des Gesichtes und geht auf der Außenseite der Ohren in Schmutzighellbraun, auf der Unterseite in Lichtbraun über; ein langer Fleck am Unterkiefer ist weiß, ein halbmondförmiger, quergestellter am Unterhalse ebenso, jedoch mehr verwischt, die Achselgegend wie die Weichen innen gelblichweiß. Letztere Färbung zeichnet auch die Fesselgelenke, über welche sich jedoch vorn ein seitlich verbreiterter Streifen zieht, so daß die lichtere Färbung in Gestalt von zwei seitlich stehenden Flecken erscheint. Bei einzelnen Stücken bemerkt man vor jedem Auge einen kleinen und auf den Wangen jederseits einen oder zwei weiße Flecke.
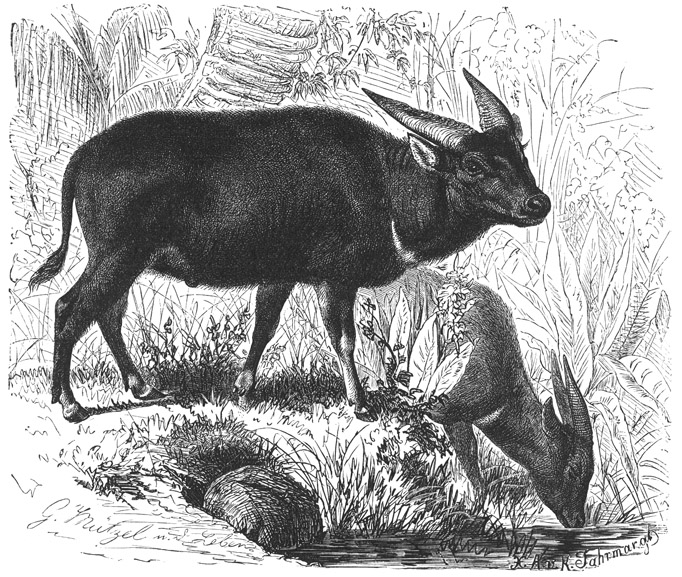
Gemsbüffel oder Anoa ( Bos depressicornis). 1/16 natürl. Größe.
Ueber das Freileben des Gemsbüffels ist noch heutigen Tages so gut als nichts bekannt, selbst die neueren Reisenden, Wallace z.+B., gedenken des Thieres nur nebenbei. Seine Heimat scheint auf Celebes beschränkt zu sein und hier die Höhe der Gebirge den Aufenthalt zu bilden. Gefangene sind neuerdings wiederholt nach Europa gekommen, die ersten meines Wissens nach Rotterdam, wo ich sie in dem dortigen Thiergarten vor nunmehr fast zehn Jahren zum erstenmale gesehen habe; später gelangten andere Stücke nach Amsterdam, London und Berlin. Unser Gemsbüffel macht vollständig den Eindruck eines kleinen Rindes, ist träge und bewegungsunlustig nach Art seiner Verwandtschaft, steht stundenlang auf einer und derselben Stelle, entweder mit Fressen, oder mit Wiederkäuen beschäftigt, und scheint sich um die Außenwelt wenig oder nicht zu kümmern. Sein gewöhnlicher Gang ist ein langsamer Schritt; doch entschließt er sich dann und wann auch zu einigen plumpen Sprüngen, ganz nach Rinderart. Wie andere Büffel zeichnet er sich durch Schweigsamkeit aus; denn nur selten vernimmt man einen Laut von ihm, und dann auch bloß ein kurzes Blöken, welches man eher ein Gestöhn nennen möchte. Seine Verwandtschaft mit den Büffeln beweist er durch seine Vorliebe für das Wasser und Feuchtigkeit überhaupt: er trinkt viel und in langen Zügen, nur beim Einathmen für Augenblicke inne haltend, wirft im engeren Raume gern sein Wassergefäß um, in der Absicht, sich eine feuchte Fläche zu verschaffen, auf welcher er sich dann mit Behagen umherwälzt, und geht, wenn er es haben kann, mit Wollust in das Wasser, um sich zu baden und zu kühlen. Hinsichtlich der Nahrung bekundet er dieselbe Genügsamkeit wie seine nächsten Verwandten, und gleich diesen scheint er Sumpf- oder Wasserpflanzen mit Vorliebe zu genießen. Die Losung setzt er in breiten Fladen ab und bestätigt auch dadurch unverkennbar seine Zusammengehörigkeit mit der Rinderfamilie. Von dem Wärter läßt er sich mit stumpfer Gleichgültigkeit behandeln, streicheln und reinigen, ohne sich zur Wehre zu sehen; anderen Thieren, beispielsweise Antilopen, gegenüber zeigt er sich jedoch keineswegs freundschaftlich, und während der Brunstzeit wird er sehr bösartig. Gerade im Thiergarten von Amsterdam, woselbst man mehrmals Gemsbüffel gezüchtet hat, verlor man das erste Weibchen durch das brünstige Männchen, welches der noch widerwilligen Kuh einen tödtlichen Hornstoß beibrachte.
An die Anoa schließen sich die Büffel ( Bubalus) an: plump gebaute Rinder mit schwerem, ungefälligem Leibe, verhältnismäßig kurzen, kräftigen und dicken Beinen und ziemlich langem, an der Spitze gequastetem Schwanze, kurzem Halse, breitem, an der niederen Stirne stark gewölbtem Kopfe, unschöner Schnauze und großer, nackter Muffel, blöden und düster blickenden Augen, seitlich abstehenden, verschieden gestalteten, meist aber großen, breiten, zuweilen innen und am Rande mit Haarkämmen und Büscheln bekleideten Ohren, an den hintersten Ecken des Schädels eingesetzten, an der Wurzel meist unverhältnismäßig verdickten, unregelmäßig geringelten, gewulsteten oder wenigstens mit höckerartigen Auswüchsen versehenen Hörnern, welche sich zuerst nach unten und hinten, sodann nach außen und zuletzt nach oben, unter Umständen auch wieder etwas nach vorn wenden, oder in einem sanften Bogen nach unten und in einer schwachen Krümmung nach außen kehren, sowie endlich auffallend dünnem Haarkleide, welches bei älteren Thieren auch fast vollständig fehlen kann.
Unter den hierher gehörigen Arten steht der Kafferbüffel ( Bos caffer , Bubalus caffer, Bos und Bubalus brachyceros und pumilus, Bubalis reclinis, planiceros, centralis und aequinoctialis), das stärkste und wildeste, durch sein eigenthümliches Gehörn besonders ausgezeichnete Mitglied der Sippschaft, unzweifelhaft obenan. Er ist gedrungener gebaut als andere Büffel, der Kopf verhältnismäßig klein und keineswegs plump, vielmehr wohlgeformt, nur in der Stirngegend schmal, längs des Nasenrückens sanft gebogen, am Maule etwas verbreitert, das Auge, welches dunkelbraune Iris und quergestellten Stern hat, mittelgroß, die erhabene, richtiger wulstig vorgebuchtete Augenbrauengegend der Länge nach mehrfach gefaltet, die Gegend vor dem vorderen Augenwinkel wegen einer grubenartigen Vertiefung auffallend, das Ohr sehr groß, sein oberer Rand aufgestülpt, in eine nach unten hängende Spitze ausgezogen, der untere Rand mit zwei, den inneren, stark hervortretenden Leisten entsprechenden Biegungen ausgeschweift, an beiden Rändern rundum und ebenso auf den Leisten mit dicht stehenden, langen Haaren bekleidet, die Muffel sehr groß, den ganzen Raum zwischen den Nasenlöchern und die Mitte der Oberlippe einnehmend, der Hals ziemlich dick, lang aber stark, der Leib am Widerriste wenig erhöht, so daß nur ein flacher Buckel sich bemerklich macht, auf dem Rücken gerade oder etwas eingesenkt, in der Kreuzgegend ein wenig erhaben und nach der Schwanzwurzel zu steil abfallend, der Bauch voll und gesenkt, der Schwanz lang und dünn, mit einer die Hälfte der Länge einnehmenden starken und reichen Quaste geziert. Das von der Wurzel an seit- und hinterwärts, sodann auf- und rückwärts, mit der Spitze merklich nach innen gebogene, bei alten Stieren an der Wurzel außerordentlich verbreiterte, abgeflachte und mit dicken Runzeln bedeckte Gehörn überlagert die ganze Stirn, so daß nur in der Mitte ein schmaler Streifen frei bleibt, behält auch im weiteren Verlaufe seine abgeplattete Form bei, indem es vorder- und hinterseits leistenartig vorspringt, und rundet sich erst gegen die Spitze hin. Mit Ausnahme des Ohres und der Schwanzspitze ist die Behaarung ungemein dünn, so daß einzelne Stellen fast nackt erscheinen und man eigentlich nur an Kopf und Beinen von einem Haarkleide sprechen kann. Die Färbung des Thieres wird daher weniger durch das schwarze, an der Spitze etwas lichtere Haar als vielmehr durch die dunkel bräunlichgraue Haut hervorgebracht. Die Kühe sind in der Regel etwas stärker und die Kälber ebenso dicht behaart wie andere glattfellige Rinder; im übrigen unterscheiden sich jene nur durch das etwas schwächere, dem der Stiere jedoch noch immer sehr ähnliche, zwar ebenfalls starke, aber doch verhältnismäßig schlankere Gehörn, welches auch auf der Stirn nicht so nahe zusammenzutreten pflegt, sondern hier einen von oben nach unten sich verbreiternden, in der Mitte eingetieften Streifen frei läßt.

Kafferbüffel ( Bos caffer). 1/25 natürl. Größe.
Das Verbreitungsgebiet des Kafferbüffels umfaßt noch heutigen Tages nahezu ganz Süd- und Mittelafrika. Innerhalb der Ansiedelungen am Vorgebirge der Guten Hoffnung ist er gegenwärtig so gut als vollständig ausgerottet und auch im Südosten von Natal bis zum Sambesi in das Innere zurückgedrängt worden; von hier ab aber tritt er an geeigneten Orten, d. h. namentlich in Sumpfgegenden und in Ermangelung derselben wenigstens in feuchten Waldungen, noch in großer Anzahl auf, nach Norden hin bis etwa zum 17. Grade der Breite vordringend. Da ich auf meinen Reisen in Nordostafrika die Sumpflandschaften des Weißen Nils und des Atbara nicht besuchte, traf ich nur ein einziges Mal mit ihm zusammen, wurde aber von den Eingeborenen berichtet, daß er oft in zahlreicher Menge auch am Asrakh sich zeige. Nach Heuglin liebt er die Ebene mehr als das Gebirge und wählt sich zu seinem ständigen Aufenthalte stets eine Gegend, in welcher es an Wasser nicht fehlt; denn dieses oder doch wenigstens Schlamm scheint für sein Wohlbefinden Bedingung zu sein. Demungeachtet tritt er im Urwalde wie in lichten Buschgehölzen, in großen Rohrwaldungen wie in der baumlosen Steppe fast mit gleicher Häufigkeit auf. Im Quellgebiete das Atbara begegnete ihm der eben genannte Forscher zumeist in Bambusdickichten, in den Sumpflandschaften des Abiadt an wenig zugänglichen Stellen des dichten Röhrichts, vorzüglich in der Nähe von Wasserlöchern und von Termitenbauen, welche seine Farbe tragen und, von fern gesehen, sogar zuweilen an Gestalt ihm zu gleichen scheinen. Von dem einmal gewählten Stande läßt sich die Herde nicht so leicht vertreiben; Schweinfurth wenigstens beobachtete, daß eine und dieselbe Gesellschaft innerhalb zweier Monate sich nicht von der Stelle bewegt hatte. Den Wald durchwandert ein solcher Trupp auf den Pfaden, welche Elefanten und Nashörner hergestellt haben, oder bahnt sich eigene durch das Dickicht, da es, wie Heuglin hervorhebt, für das kraftvolle Thier Bodenhindernisse sozusagen gar nicht gibt, und es mit gleicher Schnelligkeit an den Wänden der steilsten Schluchten hinabstürzt wie durch das dichteste Gelaube des Waldes bricht oder watend durch den tiefsten Sumpf sich wälzt und wie alle Glieder seiner Sippschaft breite Gewässer mit größter Leichtigkeit durchschwimmt.
Seiner Natur nach ein geselliges Wesen, bildet der Kafferbüffel mit anderen seiner Art regelmäßig Genossenschaften, gemeiniglich Herden von vierzig bis sechzig, nach Cummings Versicherung unter Umständen aber auch solche von sechs- bis achthundert Stücken. Die Kühe leben immer, die Stiere bis gegen die Brunstzeit untereinander in Frieden, kämpfen dann wüthend um die Oberherrschaft in Sachen der Liebe und vertreiben hierdurch, laut Drayson, nicht allzu selten einen alten, griesgrämigen, sämmtliche übrigen männlichen Glieder der Herde belästigenden Bullen aus ihrer Mitte, welcher sich fortan die düstersten und zurückgelegensten Orte aussucht und hier, über sein Geschick und den Undank der Welt brütend, seine Tage dahinbringt, fast jedem anderen Geschöpf grollend und Mensch und Thier gefährdend. Die Geburt der Kälber fällt ebenso, wie die Brunstzeit, in verschiedene Monate des Jahres, je nachdem in diesem oder jenem Theile Afrikas der Frühling früher oder später eintritt.
Während der heißen Stunden des Tages liegt der Kafferbüffel still und regungslos, ruhend, schlafend und dazwischen träumerisch wiederkäuend, auf einer und derselben Stelle, am liebsten in einer Wasserlache oder in einem Schlammloche, weshalb er auch nur ausnahmsweise anders als mit Schlamm bedeckt erscheint. In Ermangelung einer derartigen, seinen Wünschen am besten entsprechenden Lagerstätte wählt er die schattigste Stelle eines Waldes, ein Dickicht oder selbst eine Schlucht, um sich hier ungestörter Ruhe zu erfreuen. In den späteren Nachmittagsstunden oder gegen Abend erhebt er sich und äst sich von jetzt ab in Unterbrechungen bis zum frühen Morgen, nicht aber in behaglicher Gemächlichkeit, wie andere Rinder, sondern in Absätzen, als ob er immer dieselbe Tücke fürchte, welche er selbst anderen Geschöpfen gegenüber an den Tag legt. Laut Heuglin weidet er Gras und Blätter mit unruhiger Hast ab, wehrt die lästigen Fliegen, läßt oft sein dumpfes Grunzen hören, windet mit der stets feuchten, dicken Muffel, richtet die breiten, mit stattlichem Haarkranze gezierten Ohren auf, peitscht mit dem flockigem Schweife unmuthig die Weichen und stürzt plötzlich, ohne irgend eine bemerkbare Veranlassung, in das dichteste Dorngebüsch. Scheinbar ewig grollend und jeder Anwandlung eines heiteren Gedankens vollkommen unzugänglich, grimmig, böswillig und tückisch, trägt er den durch die ungeheuren Hörner theilweise verdeckten, breiten und massigen Kopf halb geneigt, wie stets zum Angriffe bereit, und das große, blauschwarze Auge leuchtet wild unter den mächtigen Hörnern hervor, so daß er bei jedem, auch dem unbefangensten Beobachter den Eindruck ungebändigter Wuth, sinnlosen Grimmes und vorbedachter Hinterlist hervorrufen muß. Nach Ansicht aller Eingeborenen Ostsudâns, welche ich befragte, und nach durchaus übereinstimmenden Berichten sämmtlicher Reisenden, Jäger und Forscher, welche mit ihm zusammentrafen, straft er dieses Aussehen nicht Lügen. »Die Kafferbüffel«, sagt schon der alte Kolbe, »sind höchst gefährliche Thiere. Wenn man sie durch Vorhalten rother Farben, durch Schießen oder heftiges Verfolgen erzürnt, ist man seines Lebens nicht sicher; sie fangen an heftig zu brüllen und zu stampfen, fürchten nichts mehr und verschonen nichts, und wenn ihnen auch noch so viele gewaffnete Menschen entgegenständen. Sie springen in der Wuth durch Feuer und Wasser und alles, was ihnen vorkommt. Einer verfolgte einmal einen jungen Mann, welcher eine rothe Jacke trug, ins Meer und schwamm ihm nach. Der Jüngling konnte aber gut schwimmen und tauchen, und der Stier verlor ihn aus dem Gesichte; dennoch schwamm er quer durch den Hafen fort, anderthalb Stunden weit, bis er vom Schiffe aus durch einen Kanonenschuß getödtet wurde.« Einmal erregt und in Wuth gebracht, kennen diese Büffel kein Hindernis mehr, stürzen im unaufhaltsamen Sturme sinnlos in gerader Richtung dahin und überrennen, was ihnen in den Weg kommt, nicht allein Thiere, sondern auch Umzäunungen und Häuser. »Als es Nacht geworden war«, erzählt Schweinfurth, »und ich es mir eben bequem gemacht hatte, ereignete sich ein im Verlaufe meiner Reise wiederholt vorgekommener Zwischenfall. Ein Dröhnen erschütterte den Erdboden, als ob ein Erdbeben heranzöge, und das ganze ziemlich ausgedehnte Lager schien in Verwirrung zu gerathen; denn von allen Seiten ertönten Geschrei und Flintenschlüsse. Eine ungewöhnlich große Büffelherde war wieder einmal auf ihrem nächtlichen Wechsel mit einem Theile des Lagers zusammengestoßen und stürmte nun in wilder Flucht nach allen Richtungen durch die Gebüsche. Mehrere Hütten waren dabei umgestürzt und die im Schlafe dabei überraschten Insassen einer nicht geringen Gefahr des Zertretenwerdens ausgesetzt.« Ohne eigentlich scheu zu sein, ergreifen die Thiere doch vor dem sich nähernden Menschen regelmäßig die Flucht und meiden, namentlich wenn öfter auf sie gejagt wurde, die Nähe ihres furchtbarsten Feindes so viel als möglich, stellen sich aber, in die Enge getrieben und gereizt, diesem ohne alles Bedenken zur Wehre und achten dann in blinder Wuth weder die Lanze, noch die sie schwer verletzende Kugel. Der verwundete Büffel flieht, wie Heuglin bemerkt, falls er seinen Gegner nicht sofort annimmt, niemals weit, birgt sich bald in hohem Grase und lauert dort arglistig auf das Herannahen der Verfolger, um sich blitzschnell auf sie zu stürzen. Wenden sich seine Feinde zur Flucht, oder verbergen sie sich in einem Verstecke, so folgt er schnaubend nach und sucht sie durch die Witterung ausfindig zu machen. Auch Sparrmann versichert, daß der Kafferbüffel hinter Bäumen sich verstecke und dort lauere, bis man ihm nahe komme, um im geeigneten Augenblicke plötzlich hervorzuschießen und einen fast unfehlbaren Angriff zu machen. Geradezu furchtbar werden die von den Herden abgetriebenen alten Einsiedler. »Wie bekannt«, sagt Drayson, »ist es die Sitte aller Thiere, vor dem Menschen zu fliehen, falls dieser sie nicht verwundet oder nicht zu einer unpassenden Stunde sich ihnen anfdrängt; jene alten Einsiedler aber warten wahrhaftig nicht auf solche Entschuldigungen, sondern kommen aus freien Stücken dem Jäger halbwegs entgegen und suchen Zerwürfnisse mit ihm.« Gelingt es dem wüthenden Geschöpfe, den ins Auge gefaßten Feind zu erreichen, so fällt ihm dieser regelmäßig zum Opfer. Das Haupt zum Boden gesenkt, das tückische Auge fest auf den Gegenstand seiner Wuth gerichtet, rennt es auf diesen zu, bohrt ihm die Hörner in den Leib, wirft ihn in die Luft und tritt ihn zusammen; denn nicht zufrieden damit, daß es ein Thier oder einen Menschen getödtet, zerstampft es ihn auch noch mit den Hufen und zerreißt ihn mit den Hörnern; ja, es kommt, laut Sparrmann, vor, daß der Büffel, nachdem er schon von seinem Opfer abgelassen und eine Strecke fortgegangen ist, von neuem zurückkehrt, um nochmals an jenem seine Wuth auszulassen. Ein einzelner, zu Fuße gehender Jäger ist in solchen Fällen meist verloren; selbst der Reiter kann sich nur dann retten, wenn er ein gutes Pferd unter sich hat und eine Anhöhe erreicht, auf welche ihm der schwerfällige Gegner nicht so leicht folgen kann. Daß sich der letztere ebensowenig scheut, eine Jagdgesellschaft anzugreifen, geht aus nachstehender Erzählung Schweinfurths hervor. »Der vierzehnte Januar brachte den ersten Unglückstag, den ich selbst heraufbeschworen. In der Frühe war zu uns eine andere Barke gestoßen, und die Leute wollten zusammen sich vergnügen und Halt machen. Wir waren aber an einer für mich sehr langweiligen Stelle, und so zwang ich sie, weiter zu fahren, um an einer kleinen anziehenden Insel ans Land steigen zu können. Der Ausflug, welchen ich von zwei meiner Leute begleitet, antrat, sollte für den einen der beiden verhängnisvoll werden. Mahammed Amin, so hieß dieser, wurde an meiner Seite von einem wilden Büffel überrannt, dem ich nicht das geringste Leid zuzufügen beabsichtigte, dem aber der Unglückliche im hohen Grase gar zu nahe gekommen war. Der Büffel hielt jedenfalls sein Mittagsschläfchen und gerieth durch diese Störung in die äußerste Wuth: aufspringen und den Störenfried in die Lüfte wirbeln, war für ihn das Werk eines Augenblickes. Da lag er nun, mein treuer Begleiter, über und über mit Blut bedeckt, vor ihm mit hoch erhobenem Schweife der Büffel, in drohender Haltung, bereit, sein Opfer zu zerstampfen. Zum Glück war indeß seine Aufmerksamkeit durch die zwei anderen Männer gefesselt, welche sprachlos vor Staunen als Zeugen dastanden. Ich statte kein Gewehr in der Hand, mein schöner Hinterlader hing vorläufig noch am linken Horne des Büffels: Mahammed hatte ihn getragen; mein anderer Begleiter, welcher meine Büchse trug, hatte gleich angelegt, aber der Hahn knackte vergebens, Mal auf Mal versagte das Gewehr. Man stelle sich vor, daß die Zeit nicht erlaubte, ihm zuzurufen: »die Sicherheit ist vor«; es galt den Augenblick. Da griff der Mann nach einem kleinem Handbeile, welches ganz aus Eisen bestand, und schleuderte es unverzagt dem Büffel an den Kopf auf eine Entfernung von kaum zwanzig Schritten. Da war denn die Beute dem Feinde entrissen. Mit einem wilden Satze warf sich der Büffel seitwärts ins Röhricht, unter gewaltigem Rauschen der Halme dahinsausend, brüllend und den Boden erschütternd. Nach rechts und links sah man ihn unter Grunzen und Brüllen die gewaltigsten Sätze machen, und da wir in seinem Gefolge eine ganze Herde vermutheten, griffen wir zunächst zu den Gewehren und eilten einem nahen Baume zu; doch es wurde alles still, und unsere nächste Sorge wandte sich jetzt dem Unglücklichen zu. Mahammeds Kopf lag wie angenagelt am Boden, da seine Ohren von scharfen Schilfhalmen durchbohrt waren, aber eine flüchtige Untersuchung überzeugte uns sofort davon, daß die Verletzungen nicht tödtlich sein konnten. Das Büffelhorn hatte gerade den Mund getroffen, und außer vier Zähnen im Oberkiefer und einen Knochensplitter hatte er keine weiteren Verluste zu beklagen, war auch in drei Wochen wieder hergestellt.« Derartige Zusammenstöße sind in allen Ländern Afrikas, in denen Kafferbüffel leben, etwas gewöhnliches, und fast in jedem Dorfe findet man Leute, welche einen ihrer Angehörigen durch Büffel verloren haben; denn in den meisten Fällen enden solche Begegnungen minder glücklich als der von Schweinfurth uns geschilderte.
Aus vorstehendem läßt sich entnehmen, daß die Jagd auf Kafferbüffel unter allen Umständen ein gefährliches Unternehmen bleibt. Die Haut des Thieres ist stark genug, um allein schon einer Kugel bedeutenden Widerstand entgegenzusetzen, und wenn diese wirklich eingedrungen, bleibt sie in vielen Fällen auf den Knochen sitzen, wird von letzteren sogar, wie von der Decken erfuhr, förmlich zerschnitten oder zertheilt. Demgemäß stürzt der Büffel in den meisten Fällen nicht unter dem ersten Schusse zusammen und behält dann noch Zeit genug, seinem Angreifer entgegenzutreten. Alte Büffel geberden sich, auch wenn sie tödtlich verwundet wurden, als hätten sie nur einen leichten Streifschuß empfangen, laufen mit der Kugel in den edelsten Eingeweiden noch weit und verenden erst nach längerer Zeit. Aus diesem Grunde ist der Jäger stets gefährdet. »Ich kenne«, erzählt Drayson, »einen Kaffer, welcher an sich selbst des Büffels Kraft und List erfuhr und das Andenken an dieselben für sein Leben trug. Er jagte eines Tages im Walde und kam auf einen alten Einsiedler, welchen er verwundete. Der Bulle brach durch, aber der Kaffer, glaubend, daß er sein Wild tödtlich verwundet hatte, folgte ihm auf seinem Wege, ohne irgend welche Vorsichtsmaßregeln zu beobachten. Der Büffel ist böswillig, wenn ihm kein Leids geschieht, aber er ist rasend, wenn er verwundet wurde, und deshalb muß man sich einem solchen mit der größten Vorsicht nahen. Unser Kaffer hatte ungefähr hundert Schritte des Waldes durchschlüpft und durchkrochen und untersuchte eben sorgfältig die Fährte seines verwundeten Wildes: da hörte er plötzlich ein Geräusch dicht neben sich, und ehe er sich noch fortbewegen konnte, fühlte er sich fliegend in der Luft, infolge eines furchtbaren Stoßes, den ihm der Büffel gegeben hatte. Glücklicherweise fiel er auf die Zweige eng verschlungener Bäume eines Dickichts und wurde hierdurch gerettet; denn der Büffel wäre keineswegs mit seiner Arbeit zufrieden gestellt gewesen, sondern würde ihm unzweifelhaft noch den Garaus gemacht haben. Nachdem er sich überzeugt hatte, daß sein Opfer unnahbar war, verließ er es und trollte in den Wald. Der Kaffer, welcher zwei oder drei Rippen gebrochen hatte, schleppte sich mühsam nach Hause und gab von diesem Tage das Büffelschießen für immer auf. Wie es schien, hatte das lästige Geschöpf sich bloß zurückgezogen, um seinen Feind im Walde wieder zu erwarten und von neuem anzufallen.«
Aehnliche Geschichten erzählen alle Reisenden, welche mit diesem grimmigen Vieh zusammenkamen. Am Tschadsee raste ein verwundeter Büffel gegen Eduard Vogels Leute, verletzte einen Mann gefährlich und tödtete zwei Pferde; ein von Baker angeschossener Büffel wurde von der auf das Fleisch begierigen Begleitsmannschaft verfolgt und erst am andern Morgen entkräftet, in tiefem Schlamme liegend, aufgefunden, hatte aber gleichwohl noch Leben genug, um den muthigsten seiner Angreifer mit einem Hornstoße zu durchbohren und zu tödten. Bekanntlich endete auch einer unserer deutschen Afrikareisenden, Baron Harnier, auf ähnliche Weise. Nachdem er einen Büffel verwundet hatte, stürzte sich das Thier auf seinen eingeborenen Begleiter und warf diesen zu Boden. Harnier griff, um den unter den Hörnern des Thieres befindlichen Menschen zu befreien, den Büffel muthig mit dem Kolben seiner Büchse an, zog ihn auf sich und wurde später zu einer unkenntlichen Masse zertrampelt und zerbohrt aufgefunden; denn der Eingeborene, weit entfernt auch seinerseits dem Herrn, welcher sein Leben für ihn eingesetzt hatte, beizustehen, floh vom Platze und überließ unseren braven Landsmann seinem Schicksale. »Ich besuchte«, sagt Baker mit gerechtfertigter Trauer, »das Grab jenes tapfern Preußen, welcher auf diese Art sein so edles Leben für einen so werthlosen Gegenstand, wie es ein feiger und erbärmlicher Eingeborener ist, geopfert hatte.«
Nach Sparrmann schließen, wenn eine Herde angegriffen wird, die alten Büffelkühe einen Kreis um die Kälber, um sie zu schützen. Wie aus nachstehendem Berichte Draysons hervorgeht, stehen sich aber auch alte Büffel gegenseitig bei. »Ein berühmter Jäger in Natal, Namens Kirkmann, erzählte mir, daß er einstmals auf der Büffeljagd einen Bullen verwundet hatte und eben im Begriffe war, ihm den Rest zu geben, als dieser eine laute Wehklage ausstieß. Gewöhnlich geht der Büffel still, und selten hört man einen Ton von ihm, selbst dann nicht, wenn er verwundet ist; dieses Klagen aber war jedenfalls ein Zeichen, und wurde auch so verstanden von der Herde, zu welcher der verwundete gehört hatte. Denn augenblicklich endete diese ihren Rückzug und kam zur Hülfe ihres Gefährten herbei. Kirkmann warf sein Gewehr weg und eilte auf ein Paar Bäume zu, deren unterste Aeste glücklicherweise tief herabgingen. So war er gerettet, als die wüthende Herde ankam und seinen Baum umlagerte. Als sie sahen, daß der Gegenstand ihres Zornes in Sicherheit war, zogen sie sich zurück.«
Der Europäer tritt dem Kafferbüffel ausschließlich mit der Büchse entgegen, der Eingeborene ergreift entweder die Lanze oder richtet eigenthümliche Fallen her, um sein Wild vorher zu fesseln. Im Süden Afrikas, wo die meisten Europäer jagen, der Büffel daher am seltensten geworden ist, vereinigen sich mehrere Jäger zu der gefährlichen Jagd und folgen dem Wilde auf weithin. »Die Fährte des Büffels«, bemerkt Drayson, »ähnelt der des gewöhnlichen Ochsen, nur stehen die Hufe eines alten Bullen weit von einander, während die des jungen sehr geschlossen sind; die Fährte der Büffelkühe ist länger, schmäler und kleiner als die der Stiere. Der Jäger folgt den Thieren, wenn sie nachts in das offene Land gehen. Da sie während der Nacht im Freien wandern und sich über Tages auf ihre Lagerplätze zurückziehen, so kann man ihre Spur außerhalb des Waldes aufnehmen und ihr so weit folgen, bis man durch den Geruch ganz in die Nähe gebracht wird. Kommt der Jäger dem Wilde sehr nahe, was er an der Frische der Fährte beurtheilen muß, so thut er am besten zu warten, bis durch irgend ein Geräusch das Thier seinen Platz verräth; denn die Büffel drehen und wenden sich häufig im Busche, besonders ehe sie sich für den Tag zur Ruhe legen.« Um das Wild womöglich tödtlich zu verwunden, nähert man sich ihm sodann so weit als thunlich und richtet die Kugel entweder auf die niedrige Stirn, oder auf das Blatt. Bricht das Thier nicht unter dem ersten Schusse zusammen, so gibt der Begleiter den seinigen ab und gewährt dadurch dem ersten Zeit, wiederum zu laden und, wenn nöthig, noch einmal zu feuern. Unter Umständen kann übrigens auch der muthigste und mit der Büffeljagd wohlvertraute Jäger durch dieses Wild in nicht geringe Verlegenheit gebracht werden. So wurde Schweinfurth auf einem seiner Märsche durch eine alte Sklavin auf einen Gegenstand aufmerksam gemacht, welcher zwischen dem großen Laube der Anonen wie ein schwarzer Baumstamm erschien. »Während ich«, sagt unser Reisender, »noch nicht wußte, worauf ich anlegen sollte, begann die dunkle Masse plötzlich sich zu bewegen, und zwei breite Hörner wurden sichtbar. In solchen Augenblicken ist der erste Gedanke des Wanderers: losdrücken und schießen; zielen und die Folgen bedenken, das kommt erst hernach. So schoß ich denn instinktmäßig. Aber wie ein schweres Wetter sauste es auch in demselben Augenblicke an mir vorüber, in dicht gedrängter Masse ein Trupp von zwanzig grunzenden Büffeln, die Schwänze hoch in die Luft emporgestreckt, rauschend, krachend, wie ein Felsensturz von Bergeshöhen. Es flimmerte mir vor den Augen; blindlings entlud ich mein Doppelgewehr, die Kugel mußte einschlagen, gleichviel wo, in Fleisch und Knochen der Thiere. Noch einen Moment, und ich erblickte nichts anderes wieder vor mir als große und hellgrüne Blätter; verschwunden waren die Büffel, aber fernhin rollte der Donner ihrer Hufschläge.« Wie uns der treffliche Forscher fernerhin mittheilt, verwenden die Neger des Weißen Flusses mächtige Bogen, deren Sehne durch einen Knebel mit großer Gewalt gespannt wird, um die Jagd auf Kafferbüffel zu erleichtern. »Riemenstricke der stärksten Art werden alsdann in das hohe Gras der Steppenniederung gelegt, da, wo die Büffel ihren Wechsel haben. Man befestigt sie an dem nächsten Baume oder an fest eingetriebenen Pflöcken und bringt am anderen Ende eine Schlinge derart mit dem Bogen in Zusammenhang, daß dies beim Auftreten durch den Rückschlag des Knebels gehoben und an den Beinen des Büffels heraufgestreift wird. Das erschreckte Thier macht einen Satz und ist in demselben Augenblicke gefesselt. Diesen benutzen nun die Jäger, welche auf der Lauer liegen, und stürzen sich mit ihren Lanzen auf die entweder zu Fall gebrachte oder durch den Bogen im hohen Grase mindestens am schnellen Laufen verhinderte Beute.«
Der Nutzen des glücklich erlegten Kafferbüffels ist nicht unbedeutend. Die Haut wird geschätzt und das Wildpret wetteifert, laut Schweinfurth, mit dem Fleische gemästeter Rinder an Güte des Geschmackes; es ist zwar derber und grobfaseriger, ungeachtet des Fettmangels aber sehr saftig und mundend, ganz im Gegensatze zum Fleische der zahmen egyptischen Art, welches selbst dem Kamelfleische noch nachsteht und auch bei den Eingeborenen keinen Werth hat.
Heuglin brachte den ersten lebenden Kafferbüffel nach Europa. »Trotz seines unbändigen Wesens in der Wildnis«, sagt er, »scheint es, daß sich dieses Thier leicht zähmen und dann möglicherweise zu Dienstleistungen vortrefflich verwenden läßt. Ein Büffelkalb, welches ich erhielt, wurde von einer zahmen Kuh angenommen und groß gesäugt und zeichnete sich von Anfang an durch sein aufgewecktes Wesen und drolliges Benehmen vor seinen Verwandten im Hausstande aus. Es kannte jeden, welcher ihm Freundlichkeit erwies, blökte ihm schon von weitem freundlich zu und folgte ihm so lange es konnte; selbst mit meinen Pferden, Kamelen und Antilopen lebte es im besten Einvernehmen, und nur das Erscheinen der Girafen, welche ich in einem benachbarten Hofe hielt, versetzte es in Schrecken.« Ich sah das erwähnte Thier kurz nach seiner Ankunft im Schönbrunner Thiergarten, in der letzten Zeit aber mehrere von Casanova und Reiche eingeführte Stücke in den Thiergärten von Amsterdam und Berlin. Auch sie schienen sich mit ihrem Geschicke nach und nach vollständig ausgesöhnt, beziehentlich bis zu einem gewissen Grade an die Gefangenschaft gewöhnt zu haben, bewegten sich für gewöhnlich gelassen innerhalb ihres Geheges, hatten sich mit dem Wärter einigermaßen befreundet und beachteten die Besucher der Gärten nicht weiter oder doch nur dann, wenn ihnen von dem einen oder anderen irgend ein Leckerbissen gereicht wurde, kamen in solchen Fällen ruhigen und gemessenen Schrittes bis an das Gitter heran und nahmen das ihnen Gebotene gleichmüthig entgegen. Mit ihrem Wärter standen sie auf verhältnismäßig recht gutem Fuße, und namentlich die Kühe gestatteten den ihnen wohlbekannten Leuten freundlichen Verkehr, achteten auf den Ruf, ließen sich berühren und streicheln und bekundeten überhaupt wenig von der Wildheit ihres Geschlechtes, welche auch bei den zahmen Stieren dann und wann durchbricht und dem Wärter jedenfalls eine ebenso freundschaftliche Annäherung verwehrt. Daß ihnen nie zu trauen ist, erfuhr ein Hülfsarbeiter des Berliner Thiergartens zu seinem Verderben. Obwohl wiederholt gewarnt, das Gehege der Thiere allein zu betreten, ließ sich der Unglückliche doch verleiten, einem mit dem nebenstehenden Jak kämpfenden Kafferbüffel sich zu nahen, in der Absicht, beide Thiere zu trennen. Der bereits erregte Büffel ließ in der That von seinem bisherigen Gegner ab, aber nur, um sich sofort auf den Mann zu stürzen. Bevor dieser flüchten konnte, hatte ihn der wüthende Bulle aufgegabelt, in die Luft geworfen, mit den Hörnern wieder aufgefangen und endlich, tödtlich verwundet, auf den Boden geworfen. Die zur Rettung des sterbenden Genossen herbeieilenden Wärter bedrohte das seiner Kraft sich bewußt gewordene Thier mit gleichem Schicksale; sein Uebermuth wurde jedoch durch mit ebensoviel Kraft als Ausdauer gehandhabte schwere Peitschen so gründlich gebrochen, daß er fortan nicht wieder wagte, der Herrschaft des Menschen sich zu widersetzen.
In Amsterdam und London haben die Kafferbüffel sich fortgepflanzt; die in Gefangenschaft geborenen Jungen unterscheiden sich hinsichtlich ihres Wesens aber wenig oder nicht von den unmittelbar aus Afrika eingeführten Stücken. Diese wie jene wachsen ebenso rasch heran wie andere Rinder; das gewaltige Gehörn der Bullen aber entwickelt sich sehr langsam und läßt glauben, daß viele Jahre dazu gehören, bevor es die bezeichnende Gestalt erhält.
Nicht der Kafferbüffel, sondern der noch heutigen Tages in Indien lebende Wildbüffel ist der Stammvater der in den Hausstand übergegangenen und vollständig gezähmten Rinder seines Geschlechtes, welche man schon in den Donautiefländern und in Italien, in viel beträchtlicherer Anzahl aber in Egypten und Indien sieht. Man hat geglaubt, mehrere Arten wilder Büffel annehmen zu dürfen, ist bis jetzt jedoch noch nicht im Stande gewesen, die zum Theil nach dem Gehörne bestimmten Formen unter einander zu vergleichen und dadurch alle Zweifel an der Artverschiedenheit zu widerlegen. So unterscheidet man von dem Wildbüffel Indiens eine zweite Art, den Arni ( Bos Arni, Bubalus Arni), welchen man als den Riesen seiner ganzen Familie ansieht und eine Gesammtlänge von fast 3 Meter bei mehr als 2 Meter Schulterhöhe zuspricht. Ein Paar Hörner, welche man im Britischen Museum aufbewahrt, stehen mit den Spitzen gegen 2 Meter auseinander, sind dreikantig, auf der Oberfläche runzelig, im ersten Drittheile ihrer Länge gerade, nicht nach einwärts gekrümmt und nur mit den Spitzen nach innen und hinten gerichtet. Hauptsächlich auf den Arni bezieht man Angaben der Eingeborenen wie der in Indien lebenden Europäer, welche unseren Wildbüffel nächst dem Tiger als das furchtbarste Thier der indischen Urwälder und seine Jagd als die gefährlichste von allen darstellen. Williamson erzählt, daß ein Arni in blinder Wuth auf einen Jäger losstürzte, welcher sich auf dem Rücken eines Elefanten sicher wähnte, zu seiner großen Verwunderung aber sehen mußte, wie der rasende Büffel den Elefanten auf die Hörner zu nehmen suchte und nur durch eine gut gerichtete Kugel von ihm abgehalten werden konnte. Nächstdem hat man von einem zweiten Wildbüffel gesprochen, welcher sich durch etwas geringere Größe und spärlichere Behaarung unterscheiden, von den Eingeborenen Bain genannt werden und in zahlreichen Herden die waldigen Ufer des Ganges bewohnen, oft in ansehnlichen Gesellschaften im Flusse baden, mit der Strömung treibend, träger Ruhe sich überlassen, gelegentlich untertauchen, Wasserpflanzen mit dem Gehörn vom Grunde losreißen und im Weiterschwimmen gemächlich verzehren, im ganzen den Menschen meiden, Fahrzeugen jedoch oft sehr gefährlich werden soll. Wahrscheinlich handelt es sich hier ebenso, wie bei dem Kafferbüffel, um Altersunterschiede, günstigsten Falles um Spielarten des Wildbüffels, welcher den größten Theil Indiens und Ceilons bewohnt und sein Verbreitungsgebiet vielleicht noch über Hinterindien und Südostasien ausdehnt. Dieses verhältnismäßig gut bekannte Rind unterscheidet sich weder im Leibesbau noch in der Färbung wesentlich von dem gezähmten Büffel und darf daher mit Recht als der Stammvater desselben gelten.
Der Büffel ( Bos bubalus, Bulalus vulgaris) erreicht, einschließlich des 50 bis 60 Centim. langen Schwanzes, bis 2,8 Meter Gesammtlänge bei 1,4 Meter Schulterhöhe. Der Kopf ist kürzer und breiter als beim Rinde, die Stirne groß, der Gesichtstheil kurz, der Hals gedrungen und dick, vorn gefaltet, nicht aber gewammt, der Leib etwas gestreckt, übrigens voll und gerundet, am Widerriste höckerig erhöht, längs des Rückens eingesenkt, am Kreuze hoch und abschüssig, in der Brustgegend schmal, in den Weichen eingezogen, der Schwanz ziemlich kurz; die kräftigen Beine sind verhältnismäßig niedrig und mit langen und breiten, einer bemerkenswerthen Ausdehnung fähigen Hufen beschuht; das kleine Auge hat einen wilden und trotzigen Ausdruck; das seitlich und wagerecht gestellte Ohr ist lang und breit, außen kurz behaart, innen dagegen mit langen Haarbüscheln besetzt. Die langen und starken, an der Wurzel verdickten und verbreiterten, sodann verschmälerten und in stumpfe Spitzen endenden, bis gegen die Mitte stark quergerunzelten, nach der Spitze zu wie aus der Hinterseite aber vollkommen glatten Hörner haben einen unregelmäßig dreieckigen Querschnitt, stehen am Grunde nahe zusammen, wenden sich zuerst seitlich und abwärts, sodann nach rück- und aufwärts und krümmen sich mit den Enden nach oben, ein- und vorwärts. Die spärliche, steife und borstenartige Behaarung verlängert sich nur auf der Stirne, an den Schultern, längs der ganzen Vorderseite des Halses und an der Schwanzquaste ein wenig, wogegen Hinterrücken, Kreuz, Brust und Bauch, Schenkel und der größte Theil der Beine fast völlig kahl erscheinen und deshalb mehr die Färbung der in der Regel dunkel schwarzgrauen oder schwarzen Haut als die der blaugrauen, bald mehr ins Bräunliche oder Rothbraune ziehenden Haare zur Geltung kommen lassen. Weiß gefärbte oder gefleckte Stücke kommen vor, sind jedoch selten. Die Kuh unterscheidet sich nur durch etwas geringere Größe von dem Stiere, von anderen Rindern aber dadurch, daß die vier Zitzen ihres Euters fast in einer Querreihe stehen.
Wie alle Arten seines Geschlechtes ein großer Wasserfreund, findet sich der Wildbüffel nur in sumpfigen Gegenden seines Wohngebietes, entweder in Flußniederungen, oder in unmittelbarer Nähe kleiner, wenn auch bloß zeitweilig wasserhaltiger Seen, oder endlich in der Umgebung seichter Lagunen am Meeresgestade. So fand Haßkarl an der Südküste Bantams mitunter Trupps wilder Büffel, welche sich für gewöhnlich in den Wäldern des inneren Landes aufhalten, von Zeit zu Zeit aber die Küste aufsuchen, um Salzwasser zu lecken. Ausführlicher berichtet Tennent über dieses Thier. »Büffel«, sagt er, »sind in allen Theilen Ceilons häufig; wilde aber sieht man nur in den großen Einöden der nördlichen und östlichen Provinzen der Insel, wo Flüsse, Lagunen und verwilderte Seen, Teiche und Pfützen ihnen ein in jeder Beziehung zusagendes Wohngebiet schaffen. Hier gefällt sich das Thier darin, bis zu dem Kopfe eingetaucht, im Wasser zu liegen oder aber mit Schlamm sich zu umhüllen, um sich gegen die Angriffe der Kerbthiere zu schützen; hier schwelgt es in dem langen Seggengrase, welches die Ränder der Gewässer begrünt. Wenn der Büffel weidet, sieht man oft eine mit Aufsuchen von Zecken und anderen Schmarotzern eifrig beschäftigte Krähe auf seinem Rücken, welcher wegen der Nacktheit des Felles in der Sonne unangenehm schimmert. Bewegt sich das Thier, so legt es sein plumpes Haupt so weit zurück, daß die Nasenlöcher in eine wagerechte Linie mit den Augen und die gewaltigen Hörner auf die Schultern zu liegen kommen.« Seine Bewegungen sind zwar plump, aber kräftig und ausdauernd; namentlich im Schwimmen erweist es sich als Meister. Unter den Sinnen scheinen Geruch und Gehör obenan zu stehen, Gesicht und Gefühl dagegen wenig entwickelt und der Geschmack eben auch nicht besonders ausgebildet zu sein, da es sich mit dem schlechtesten Futter, welches andere Rinder verschmähen, begnügt. Seine Stimme ist ein tief dröhnendes Gebrüll. An blinder Wuth und rasendem Zorn steht es keinem anderen Rinde nach; selbst in der Gefangenschaft verliert es diese Eigenschaften nicht ganz. Wie Stolz berichtet, werden die Büffel in Indien zum Theil alt gefangen. Man umzäunt zu diesem Zwecke einen Platz und setzt vor dem Eingange in zwei nach außen aus einander laufenden Linien Leute auf die Bäume, welche Bündel dürren Reisigs in den Händen halten und fürchterlich zu lärmen beginnen, wenn eine Büffelherde zwischen sie getrieben wird. So gelangen die Thiere in den Pferch, in welchem sie später mit Schlingen umstrickt werden. Nachdem man ihnen die Augen verbunden und die Ohren verstopft hat, führt man sie weg und läßt sie entweder arbeiten, oder gegen Tiger kämpfen.
Der Büffel ist schon vom Hause aus ein furchtbarer Feind dieser gewaltigen Katze und bleibt bei Kämpfen mit ihr fast regelmäßig Sieger. William Rice erzählt, daß zuweilen erwachsene Büffelstiere vom Tiger angefallen werden, sich aber furchtbar wehren und nicht allzu selten dem Raubthiere für alle Zeiten das Handwerk legen. Wenn ein Büffel überfallen wird, eilen ihm die anderen zu Hülfe und jagen dann den Angreifer regelmäßig in die Flucht. Selbst die Hirten, welche zahme Büffel hüten, durchziehen, auf einem ihrer Thiere reitend, ruhig das Dickicht. Rice sah einmal, daß die Büffel einer Herde, als sie das Blut eines angeschossenen Tigers rochen, sofort dessen Spur aufnahmen, diese mit rasender Wuth verfolgten, die Gesträuche dabei umrissen, den Boden aufwühlten, schließlich in förmliche Raserei geriethen und, zum großen Kummer des Hirten, unter einander zu kämpfen begannen. Johnson erzählt, daß ein Tiger den hintersten Mann einer Büffelkarawane angriff. Ein Hirt, welcher Büffel in der Nähe hütete, eilte jenem Manne zu Hülfe und verwundete das Raubthier mit seinem Schwerte. Dieses ließ sofort seine erste Beute los und packte jetzt den Hirten; die Büffel aber stürzten, als sie ihren Herrn in Gefahr sahen, augenblicklich auf den Tiger los, warfen ihn sich einige Male gegenseitig mit den Hörnern zu und mißhandelten ihn bei diesem Spiele derart, daß er todt auf dem Platze blieb.
Das Wesen des Wildbüffels ist, laut Tennent, mürrisch und unsicher, seine Kraft und sein Muth so groß, daß ihn das indische Gedicht als dem Tiger ebenbürtig zur Seite stellt. Derjenige, welcher ihn beim Weiden oder Baden stört, darf niemals wähnen, sicher zu sein. Bei solchen Gelegenheiten bilden die Wildbüffel eine Linie, nehmen eine Vertheidigungsstellung an, wobei sich einige der ältesten Stiere in das Vordertreffen stellen, laufen wüthend im Kreise umher und drängen sich dabei so dicht an einander, daß das Zusammenschlagen ihrer Gehörne ein lautes, klapperndes Geräusch hervorbringt, und rüsten sich so zum Angriffe. Gewöhnlich lassen sie es bei solchen Drohungen bewenden, rennen ein Stück weg, bilden dann eine neue Angriffslinie, sichern und kehren ihre bewehrten Häupter wiederum gegen den Störenfried. Der wirkliche Jäger behelligt sie selten, weil ein so plumpes Geschöpf seiner Geschicklichkeit unwürdig erscheint, und ein leichtfertiges Schlachten der Thiere nicht einmal zu erwünschter Nahrung verhilft.
In denjenigen Gegenden Ceilons, wo die Singalesen Büffel zähmen und zum Reisbau verwenden, haben die Dörfler durch die wilden oft viel auszustehen, weil diese unter die weidenden Herden sich mischen und sie zum Ungehorsam verleiten, ja gar nicht selten sich an die Spitze einer zahmen Herde stellen und alle Anstrengungen der Besitzer, diese gegen Sonnenuntergang heimzutreiben, mit dem entschiedensten Erfolge vereiteln.
Wann und auf welchem Wege der zahme Büffel sich weiter verbreitet hat, wissen wir nicht, nehmen jedoch an, daß er wahrscheinlich im Gefolge der großen Kriegsheere oder wandernden Völker nach Persien kam, woselbst ihn die Begleiter Alexanders des Großen bereits antrafen. Später mögen ihn die Mohammedaner nach Egypten und Syrien verpflanzt haben. Im Jahre 596 unserer Zeitrechnung, unter der Regierung Agilulfs, gelangte er, zu nicht geringem Erstaunen der Europäer, nach Italien. Anfangs scheint er sich sehr langsam verbreitet zu haben; denn der »heilige« Gilibald, welcher zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts Sicilien und Italien durchwanderte, kannte ihn noch nicht und staunte, als er ihn später am Jordan antraf. Gegenwärtig findet er sich außer in Hindostan durch ganz Afganistan, Persien, Armenien, Syrien, Palästina bis zum Kaspischen und Schwarzen Meere hin, in der Türkei, Griechenland und in den Donautiefländern, in Italien und sehr häufig auch in Egypten, nicht aber in Nubien.
Heiße, sumpfige oder wasserreiche Gegenden sagen ihm wie allen seinen Verwandten am meisten zu. Das Nildelta ist für ihn ein Paradies; in den gifthauchenden pontinischen Sümpfen, in den Sumpfgegenden Calabriens, Apuliens, in der Maremma von Toscana, in den unteren Donauländern befindet er sich sehr wohl. In den italienischen Sümpfen ist er der einzige seiner Familie, weil alle übrigen der ungesunden Gegend erliegen, in Unteregypten überall gemein, nächst der Ziege eigentlich das einzige Hausthier, von welchem man Milch und Butter gewinnt. Jedes Dorf im Delta und auch die meisten Ortschaften Oberegyptens haben mitten zwischen den Hütten eine große Lache, welche einzig und allein dazu dient, den Büffeln einen bequemen Badeplatz zu gewähren. Weit öfter als auf der Weide, sieht man diese im Wasser, wenn sie es haben können, so tief versenkt, daß nur der Kopf und ein kleiner Theil des Rückens über den Wasserspiegel hervorragen. Zur Zeit der Nilüberschwemmung beginnt für sie eine Zeit des Genusses. Schwimmend treiben sie sich jetzt auf den überfluteten Feldern umher, fressen das Gras an den Rainen und das harte Riedgras der noch unbebauten Flächen ab, vereinigen sich zu großen Herden, spielen im Wasser mit einander und kommen nur dann nach Hause, wenn die Kühe von der Milch gedrückt werden und gemolken sein wollen. Sehr hübsch sieht es aus, wenn eine Büffelherde über den fast durchschnittlich einen Kilometer breiten Strom setzt. Mehrere der Hirten, meistens Kinder von acht bis zwölf Jahren, sitzen auf dem Rücken und lassen sich sorglos von den treuen Thieren über die furchtbare Tiefe und durch die hochgehenden Wogen schleppen.
Man kann die Meisterschaft im Schwimmen, welche die Büffel zeigen, nicht genug bewundern. Sie gebaren sich, als ob das Wasser ihr eigentliches Element wäre, spielen mit einander, während sie schwimmen, tauchen unter, legen sich auf die Seite, halb auf den Rücken, lassen sich von der Strömung, ohne ein Glied zu rühren, gemächlich treiben und schwimmen auch wieder in schnurgerader Richtung, bloß durch die Strömung abwärts geführt, quer über den Strom. Mindestens sechs bis acht Stunden bringen sie täglich im Wasser zu, besorgen hier, behaglich ausgestreckt, das Wiederkäuen und erscheinen mindestens ebenso selbstzufrieden wie ihre im gleichen Geschäft dahingestreckten Herren Vettern auf dem Lande. Jeder Büffel wird unruhig und sogar bösartig, wenn er geraume Zeit das Wasser entbehren mußte. Mit Schlamm erfüllte Lachen behagen ihm weit weniger als die tiefen Fluten eines gut angelegten Büffelteiches oder die kühlen Wellen des Stromes; deshalb sieht man während der trockenen Zeit in Egypten die satten Büffel oft im plumpen Galopp, zu dem sie sich sonst nur in der höchsten Wuth versteigen, herbeigeeilt kommen und kopfüber in die Fluten des Stromes sich stürzen. In Indien und auch in Italien sind durch diese Wassersehnsucht schon mehrmals Menschen um das Leben gekommen, weil die an Wägen geschirrten Büffel wie besessen dem Strome zurannten, sich und ihr Fahrzeug in den Wellen begrabend.
Auf dem festen Lande erscheint der Büffel entschieden unbeholfener als im Wasser. Sein Gang ist schwerfällig und der Lauf, obgleich ziemlich fördernd, doch nur ein mühseliges Sichfortbewegen. Bei großer Wuth oder, wie bemerkt, bei lebhafter Wassersehnsucht fällt das schwerfällige Thier zuweilen auch in Galopp, falls man die Reihenfolge plumper und ungeschickter Sätze mit diesem Ausdrucke bezeichnen darf. Weiter als hundert oder zweihundert Schritte legt er in dieser Gangart nicht zurück, beginnt vielmehr bald wieder zu traben und läuft kurze Zeit darauf in seiner gewöhnlichen ruhigen Weise fort.
Wenn man zahmen Büffeln zum erstenmal begegnet, erschrickt man förmlich vor ihnen. Der Ausdruck ihres Gesichts deutet auf unbändigen Trotz und auf versteckte Wildheit; in den Augen scheint man Tücke und Niederträchtigkeit lesen zu dürfen. Bald überzeugt man sich, daß man sich täuschen würde, wenn man den Büffel nach dem Aussehen beurtheilen wollte. In Egypten wenigstens ist er ein überaus gutmüthiges Thier, welches jeder Bauer, ohne etwas zu besorgen, der Leitung des schwächsten Kindes anvertraut. Mehr als zwanzigmal habe ich gesehen, wie kleine Mädchen, welche auf mit Klee gefüllten, dem Thiere auf den Sattel geschnallten Netzballen saßen, Büffel vermittels eines Stockes nach Hause trieben, unter Umständen Gräben und Nilarme übersetzend; aber niemals habe ich gehört, daß ein Büffel Unglück angerichtet hätte. Unerschütterliche Gleichgültigkeit gegen alles, was nicht Wasser oder Fressen anlangt, vielleicht mit noch alleiniger Ausnahme des Kalbes, welches eine Büffelkuh vor kurzem geboren hat, kennzeichnen das geistige Wesen des Thieres. Es ergibt sich mit einem geradezu stumpfen Gleichmuthe in das Unvermeidliche, zieht den Pflug oder den Wagen gleichgültig fort, läßt sich nach Hause treiben und wieder auf das Feld geleiten und verlangt nichts anderes als sein gehöriges Wasserbad mehrere Stunden nach einander. Außer zum Lasttragen und zum Reiten beim Uebersetzen des Nils verwendet man übrigens den Büffel wenig zum Feldbau, gewöhnlich bloß dann, wenn es einem Fellah einfällt, mit dem Kamele pflügen zu wollen. Dieses edle Thier erkennt selbstverständlich in einer so gemeinen Arbeit die grenzenloseste Mißachtung seiner Erhabenheit und übernimmt mit allen Zeichen des höchsten Mißmuthes das ihm unendlich verdrießliche Werk. Da ist nun der Büffel der beste Kamerad. Er geht mit denselben ruhigen Schritten seinen Weg fort wie sonst, und ihm ist es vollkommen gleichgültig, ob das Kamel an seiner Seite rast, ob es davoneilen will oder nicht: bedeutsam und gewichtig stemmt er sich dem ärgerlichen Zugkumpan entgegen, so daß dieser wohl oder übel mit ihm die Tagesarbeit verrichten muß.
Eine außerordentliche Tugend des Büffels ist seine wirklich beispiellose Genügsamkeit. Das Kamel, welches als ein Muster aller wenig beanspruchenden Geschöpfe gepriesen wird, der Esel, welcher in der Distel ein gutes Gericht erblickt, erreichen den Büffel nicht; denn dieser verschmäht geradezu saftige, anderen Rindern wohlschmeckende Kräuter und wählt dafür die dürrsten, härtesten und geschmacklosesten Pflanzenstoffe aus. Ein Büffel, welcher sich im Sommer draußen nach eigener Auswahl beköstigte, läßt, wenn ihn im Stalle saftiges Gras, Klee und Kraut vorgeworfen wird, alles liegen und sehnt sich nach einfacherer Kost. Sumpfgräser und Sumpfpflanzen aller Art, junges Röhricht, Schilf und dergleichen, kurz Stoffe, welche jedes andere Geschöpf verschmäht, frißt er mit demselben Behagen, als ob er die leckerste Speise genieße. Und er weiß diese Nahrung zu verwerthen, denn er liefert dafür wohlschmeckende, sehr fette Milch, aus welcher man vortreffliche Butter in reichlicher Menge bereitet. Der Egypter erklärt seinen »Djamús« geradezu für sein nützlichstes Hausthier und hat wirklich nicht Unrecht.
Unangenehm wird der Büffel durch seine Unreinlichkeit. Manchmal sieht er aus wie ein Schwein, welches sich eben in einer Kothlache gesuhlt hat; denn genau so, wie dieser bekannte Dickhäuter sich zu erquicken pflegt, hat er seines Herzens Gelüsten Genüge geleistet. Ob ihm dann der Koth liniendick auf den dünnstehenden Haaren hängt, oder ob diese durch ein stundenlanges Bad im frischen Nile gereinigt, gehörig durchwaschen und gesäubert sind, scheint ihm ebenfalls vollkommen gleichgültig zu sein; wenigstens weiß er auch solche Wechselfälle seines Daseins mit Ruhe und Würde zu ertragen. Dagegen sagt man ihm nach, daß er zu gewissen Zeiten in der rothen Fahne des Propheten einen Gegenstand erblicke, welcher seinen Zorn errege, und zuweilen blindwüthend auf den geheiligten Lappen losstürze. Deshalb betrachten ihn strenggläubige Türken als ein verworfenes Thier, welches die Gesetze des Höchsten in greulicher Weise mißachtet, wogegen die Egypter ihm, eingedenk des Nutzens, den er bringt, solche Uebertretungen einer guten Sitte, ohne weiter nachzugrübeln, verzeihen oder vielleicht glauben, daß die Gnade des Allbarmherzigen selbst an solchem Höllenbrande sich erweisen werde. Auch die Tudas, ein indischer Volksstamm, welcher die Nilgerrihöhen bewohnt und sich in den Glaubenssachen und Sitten wesentlich von den Hindus unterscheidet, denken anders als die Türken. Sie verehren den Büffel fast göttlich, halten zahlreiche Herden von ihm, betrachten ihn als das wichtigste Hausthier und bringen ihren Göttern als das Heiligste Büffelmilch dar, weshalb auch ganze Herden ausschließlich für die Tempel benutzt und in den heiligen Hainen geweidet werden. Nach ihrer Ansicht ist das Büffelkalb der allgemeine Sündenbock, wie nach der sinnbildlichen Redeweise unserer Priester das Lamm als Träger christlicher Sünden erscheint. Beim Tode eines wohlhabenden Mannes schlachtet man einen Büffelstier, damit dieser den biederen Tuda in die andere Welt begleite und auch dort freundlichst dessen Sündenlast auf sich nehme, wogegen das Kalb die Sünden der ganzen Gemeinde weiter trägt. Demungeachtet wird der Büffel von den Tudas während seiner Lebzeiten vielfach benutzt und oft mit schweren Bürden beladen, vielleicht in der guten Absicht, daß er sich hier für die noch schwerere Sündenlast gehörig vorbereiten möge.
Der Büffel ist ein schweigsames Geschöpf. Wenn er in seinem kühlen Wasserbade ruht, thut er das Maul nicht auf, und auch während er weidet oder arbeitet, geht er still und ruhig seines Weges. Nur Kühe, welche säugende Kälber haben, oder Stiere, welche in Wuth versetzt worden sind, lassen ihre Stimme zuweilen ertönen. Sie ist ein höchst unangenehmes und widriges, lautes Gebrüll, ungefähr ein Mittelding zwischen dem bekannten Geschrei unseres Rindes und dem Grunzen des Schweines.
In den nördlicheren Gegenden paart sich der Büffel, wenn er sich selbst überlassen wird, im April und Mai. Zehn Monate nach der Paarung kalbt die Kuh. Das Junge ist ein ungestaltetes Geschöpf, wird aber von der Mutter zärtlich geliebt und bei Gefahr mit dem bekannten Heldenmuthe der Rinder vertheidigt. Im vierten oder fünften Jahre ist es erwachsen; sein Alter bringt es auf etwa achtzehn bis zwanzig Jahre. Mit dem Buckelochsen oder Zebu paart sich der Büffel ohne große Umstände, mit dem zahmen Rinde dagegen ungern und niemals freiwillig. Solche Kreuzung hat bis jetzt auch noch keinen Erfolg gehabt, weil das Junge, dessen Vater der Büffelstier ist, schon im Mutterleibe eine so bedeutende Größe erreichen soll, daß es bei der Geburt entweder getödtet wird, oder aber die Mutter gefährdet.
Der Nutzen des Büffels ist verhältnismäßig größer als der unseres Rindes, weil er so gut als gar keine Pflege beansprucht und sich mit Pflanzen sättigt, welche von allen übrigen Hausthieren verschmäht werden. Für Sumpfgegenden erweist er sich als ein ausgezeichnet nützliches Geschöpf auch zum Bestellen der Feldarbeiten; denn was ihm an Verstand abgeht, ersetzt er durch seine gewaltige Kraft. In Ceilon benutzt man ihn ebensowohl als Last- wie als Zugthier, im ersteren Falle, um schwere Ladungen Salz von der Küste nach dem Innern zu bringen, im letzterem Falle, um Karren auf Wegen fortzuschieben, für welche die schwache Kraft anderer Rinder nicht ausreichen würde. In einer Ortschaft zwischen Batticalva und Trincomalie verwenden ihn die Eingeborenen, laut Tennent, in sinnreicher Weise zur Jagd auf Wassergeflügel, welches in den weiten salzigen Sümpfen und schlammigen Seen massenhaft lebt und an die denselben Aufenthalt mit ihnen theilenden Büffel vollständig gewöhnt ist. Letztere nun werden darauf hin abgerichtet, nach Belieben des Jägers im Sumpfe wie im schlammigen Wasser sich zu bewegen und geben so dem Schützen Gelegenheit, durch sie gedeckt, bis in schußgerechte Nähe des Geflügels anzuschleichen. In ähnlicher Weise bedient man sich in den nördlichen Theilen Indiens der Büffel, um Hirschen sich zu nähern, und ebenso gebraucht man sie endlich zur Nachtjagd auf Wild aller Art von den Hirschen und Wildschweinen an bis zum Leoparden hinauf. Zu diesem Zwecke bindet man dem Thiere eine Glocke an den Hals und einen Kasten oder Korb so auf dem Rücken, daß die Oeffnung nach einer Seite hin gerichtet ist. Dieser Hohlraum dient als Schutz für Fackeln aus Wachs, welche in ihm brennen und ihr Licht nur nach einer Seite hin werfen dürfen, um den Jäger, welcher im Dunkeln geht, desto sicherer zu verbergen. Nach Sonnenuntergang treibt man den so ausgerüsteten Büffel langsam in die Wälder, schreckt durch den Glockenklang das Wild auf, erregt durch das Licht dessen Neugier oder verdutzt es förmlich und kommt so zum Schusse auf die allerverschiedensten Thiere, lockt aber ebenso Nachtschlangen, also gerade die giftigen, herbei.
Das Fleisch des Büffels wird seiner Zähigkeit und des ihm anhaftenden Moschusgeruches halber wenigstens von Europäern nicht gegessen, das der Büffelkälber dagegen soll gut sein, und das Fett an Wohlgeschmack und Zartheit dem Schweinsfette fast gleichstehen. Die dicke, starke Haut liefert treffliches Leder; aus den Hörnern endlich fertigt man dauerhafte Geräthschaften verschiedener Art.
Nur in Indien und vielleicht in Persien noch hat der Büffel Feinde, welche ihm schaden können. Es wird wohl nur selten vorkommen, daß einmal eine Meute Wölfe in den Donautiefländern über einen Büffel herfällt, und dieser muß schon irgendwie abgeschwächt oder abgehetzt sein, wenn die bösen Feinde etwas ausrichten sollen. Aehnlich verhält es sich in Indien, obgleich hier dem zahmen Büffel derselbe Feind entgegentritt, welcher dem wilden Schaden zufügt, der Tiger nämlich. Es ist wohl richtig, daß sich dieses furchtbare Raubthier einen guten Theil seiner Mahlzeiten aus den Büffelherden nimmt, aber ebenso sicher scheint es zu sein, daß eine Büffelherde jeden Tiger in die Flucht schlägt: die Hirten wenigstens betrachten sich, wie bereits angedeutet, nicht im geringsten gefährdet, wenn sie, auf ihren Büffeln reitend, durch Wälder ziehen, in denen Tiger hausen.
Auf den ostindischen und den Sundainseln, namentlich auf Ceilon, Borneo, Sumatra, Java, Timor, den Philippinen und Mariannen lebt ein anderer Schlag des Büffels, theils verwildert, theils als Hausthier, der Karbau, Karbo oder Kerabau ( Bos Kerabau , Bubalus Kerabau), ein Thier, welches erst in der neueren Zeit genauer bekannt geworden ist. In der Größe kommt der Karbau dem Riesen der Sippe vollständig gleich; namentlich die Hörner erreichen eine ungeheuere Länge. Das kurze, steife Haar bekleidet den Leib so spärlich, daß überall die Haut durchschimmert; nur am Halse, aus dem Scheitel und der Vorderseite der Glieder steht es etwas dichter, und zwischen den Hörnern bildet es einen Busch. Die Hautfarbe ist hellbläulich-aschgrau, auf der Innenseite der Schenkel und in der Weichengegend aber röthlich-fleischfarben und an den Füßen fast vollkommen weiß. Die Haare sind der Haut gleich gefärbt. Nach mir gewordenen Mittheilungen Haßkarls und Rosenbergs kommt auf Java auch eine röthliche Spielart vor, welche man als Weißlinge anzusprechen hat, da die rothen Augen ebenfalls vorhanden sind.
In seiner Lebensweise wie in seinen Sitten und Gewohnheiten unterscheidet sich der Karbau nicht im geringsten von dem Büffel, mit welchem er überhaupt so viel Aehnlichkeit hat, daß er sich schließlich als Zuchtrasse desselben oder höchstens als Spielart herausstellen dürfte. Wilde Karbaus gibt es, wie mir Rosenberg schreibt, nirgends mehr, wohl aber verwilderte, welche den Reisenden öfters gefährlich werden, wie auch überhaupt die zahmsten Büffel, welche jedem javanischen Kinde willig folgen, selten mit Europäern sich befreunden. »Obgleich man«, schreibt mir Haßkarl, übereinstimmend mit Rosenberg, »auf Java Karbaus dem kleinsten Kinde anvertraut, ohne irgend welche Tücke des Thieres befürchten zu müssen, sind diese doch für Europäer stets und im höchsten Grade gefährlich. Der inländische Junge kann mit und auf dem Karbau thun, was er will; den Europäer dagegen verfolgt dieser, vielleicht wegen der ihm auffallenden Kleidung des Fremden, erst mit seinen Blicken, dann tatsächlich, indem er mit gesenktem Kopfe auf ihn losstürzt.« Im allgemeinen verwendet man den Karbau ebenso, wie anderen Ortes den Büffel, zu den verschiedensten Dienstleistungen nämlich, hauptsächlich aber als Reitthier. So lange sie nicht im Dienste sind, liegen sie im Wasser. Auf Manila und Java z. B. sieht man überall, wo menschliche Wohnungen sind, Herden solcher Büffel in den Flüssen und Seen bis zum Kopfe im Wasser stehen. In einer Umzäunung von Bambusrohrstäben werden sie gefüttert. Bemerkenswerth ist die Thatsache, daß solche Büffel niemals von den Krokodilen angegriffen werden, welche doch sonst jedes andere Thier, auch Zebustiere und Pferde, ohne weiteres anfallen.
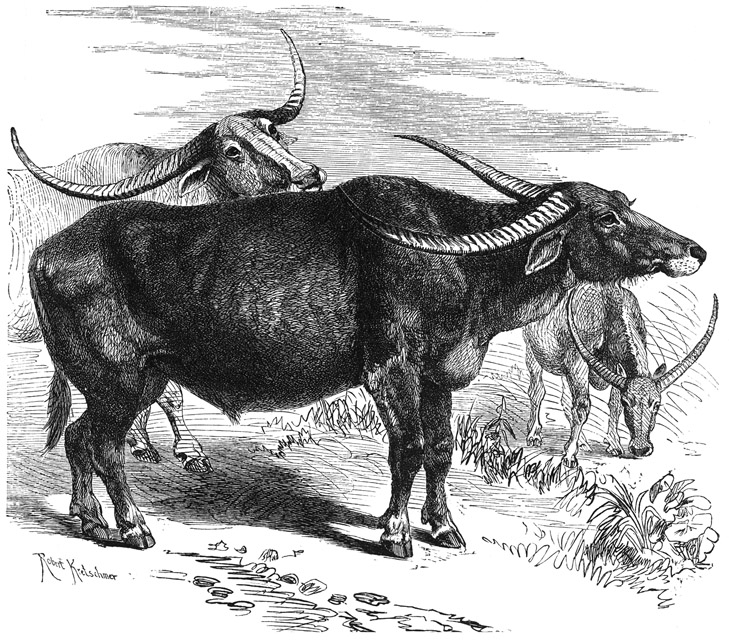
Karbau ( Bos Kerabau). 1/20 natürl. Größe.
Während der Regenzeit sind die Büffel für die Bewohner geradezu unentbehrlich, weil durch sie die einzige Möglichkeit geboten wird, auf den dann unergründlichen Wegen fortzukommen. Man befördert durch sie allerlei Lasten auf einem Schlitten, welcher auf dem feuchten Boden leicht dahingleitet; der Fuhrmann sitzt auf dem Nacken des Thieres und lenkt es nach Belieben. Karbaufleisch wird, laut Haßkarl, auf Java von den Europäern fast nie, von den Inländern dagegen viel gegessen, von diesen sogar Fell und Eingeweide als leckere Bissen verzehrt; Karbauzungen gelten auch auf dem Tische des in Java lebenden Europäers als willkommene Speise. Von den Weißlingen, welche man überhaupt für schwächer hält, genießt man, nach Rosenbergs Versicherung, weder das Fleisch noch die Milch.
In der Neuzeit sind lebende Karbaus öfters nach Europa gelangt, haben sich auch in verschiedenen Thiergärten fortgepflanzt, und ebenso mit gemeinen Büffeln gekreuzt. In ihrem Wesen und Betragen ähneln sie diesen vollständig, haben auch eine ganz ähnliche im Vergleiche zu ihrer gewaltigen Größe jedoch auffallend schwache und ausdrucklose Stimme.