
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die höchste Stelle unter den Vielhufern gebührt den Rüsselthieren ( Proboscidea ), einer Familie der Gesammtheit, welche von Owen zu einer besonderen Ordnung erhoben worden ist und von uns als Unterordnung aufgefaßt werden mag. Von den vielen Arten dieser Familie, welche unsere Erde bevölkerten, sind nur noch zwei oder vielleicht drei auf unsere Zeiten gekommen; aber gerade sie sind es, welche die Jetztwelt so recht ersichtlich mit der Vorwelt verbinden: denn ihrer Familie gehörten die Riesen an, deren wohl erhaltene Leichname das Eis Sibiriens durch hunderttausende von Jahren uns aufbewahrte. Es erleichtert das Verständnis der Abtheilung, wenn wir zunächst einen Blick auf diese ausgestorbenen Arten werfen.
Die Grabstätten der ausgestorbenen Rüsselthiere, insbesondere des Mammont oder Mammuth ( Elephas primigenius), welche ich im Sinne habe, liegen im Lande der Ostjaken, Tungusen, Samojeden und Buräten, in der Nachbarschaft der Flüsse Ob, Jenissei und Lena, zwischen dem 58. Grade nördlicher Breite und dem Eismeere. Beim Aufthauen sandiger Strecken geschieht es, daß Haufen ungeheurer Zähne zum Vorschein kommen, zwischen denen Massen von großen Knochen zerstreut liegen. Manchmal sitzen die Zähne noch fest in den Kiefern; ja, man hat solche gefunden, welche noch mit Fleisch, mit Haut und Haar umgeben, welche noch blutig waren. »Die Einwohner nennen das Thier Mammont und sagen, es sei ungeheuer groß, drei bis vier Meter hoch, habe einen langen und breiten Kopf und Füße wie die des Bären; es lebe und hause unter der Erde, ziehe den gewaltigen Kopf bei seinen unterirdischen Wanderungen bald zurück und strecke ihn bald wieder vor, hierdurch die Wege sich bahnend, welche es mit den Zähnen gebrochen; es suche seine Nahrung im Schlamme, müsse aber sterben, wenn es auf Sandboden gerathe, weil es aus diesem die Füße nicht mehr herausziehen könne, verende auch, so bald es an die Luft komme.« So schreibt Ides, welcher auf einer Gesandtschaftsreise nach China im Jahre 1692 von den Knochenlagern sprechen hörte. Pallas gibt Ende des vorigen Jahrhunderts umständliche Berichte von diesen Knochen; den größten Fund aber machte der Reisende Adams am Ausflusse der Lena. Er hatte erfahren, daß man einen Mammont mit Haut und Haar gefunden habe, begab sich deshalb sofort auf die Wanderung, um diese kostbaren Ueberbleibsel zu retten, verband sich mit dem Häuptling der Tungusen, welcher das Thier entdeckt hatte, und reiste auf Renthierschlitten an Ort und Stelle. Der Tunguse hatte das Thier eigentlich schon im Jahre 1799 aufgefunden, von der Ausbeutung desselben jedoch abgesehen, weil einige alte Leute erzählten, daß ihre Väter auf derselben Halbinsel einmal ein ähnliches Ungeheuer entdeckt hätten, welches das Verderben über die ganze Familie des Entdeckers gebracht habe, indem diese ausgestorben sei. Diese Nachricht erschreckte den Tungusen so, daß er krank wurde; die ungeheuren Stoßzähne des Thieres aber reizten seine Habsucht, und er beschloß, sich derselben zu bemächtigen. Im März 1804 sägte er beide Zähne ab und vertauschte sie gegen Waaren von geringem Werthe.
Als Adams zwei Jahre später seine Untersuchungsreise ausführte, traf er das Thier zwar noch auf derselben Stelle, aber sehr verstümmelt. Die Jakuten hatten das Fleisch abgerissen und ihre Hunde damit gefüttert; Eisbären, Wölfe, Vielfraße und Füchse von dem Vorweltsthiere sich genährt. Nur das Geripp, mit Ausnahme eines Vorderfußes, war noch vorhanden. In dem mit einer trockenen Haut bedeckten Kopfe waren die Augen und das Hirn sowie ein mit borstenartigem Haar bedecktes Ohr noch gut erhalten. An den Füßen konnte man noch die Sohlen erkennen; auch von der Leibeshaut war noch Dreiviertel übrig. Sie erschien dunkelgrau; die Wollhaare auf ihr waren röthlich, die Borsten dazwischen schwarz und dicker als Roßhaare. Die längsten Haare, welche Adams sah, standen auf dem Halse und maßen siebzig Centimeter. Aber auch den übrigen Körper deckte ein dichtes Kleid, ein deutlicher Beweis, daß das Mammont für das Leben in kalten Gegenden ausgerüstet war. Die Stoßzähne dieses vorweltlichen Elefanten sind viel mehr gekrümmt und daher auch weit länger als bei den lebenden: es gibt solche, welche Dreiviertel eines Kreises vorstellen; Adams hat einen gesehen, welcher gegen sieben Meter lang war.
Adams sammelte, was er zusammenbringen konnte. Zehn Leute waren kaum im Stande, die abgeschälte Haut von der Stelle zu bringen; die auf dem Boden zusammengelesenen Haare wogen mehr als siebzehn Kilogramm. Dies alles wurde nach Petersburg geschickt, und wenn auch auf dem langen Wege von zwölfhundert Meilen die kostbaren Schätze so litten, daß an der Haut selbst kein Haar mehr zu sehen ist, so steht doch die Thatsache, Dank der Untersuchung und Bemühung des wackeren Reisenden, unzweifelhaft fest.
Der Fund dieses Thieres hat die Gelehrten lebhaft beschäftigt, insbesondere auch deshalb, weil man sich den plötzlichen Untergang des lebenden in jenen Gegenden nicht gut erklären konnte. Einige schieben die stattgefundene Umwälzung, welche übrigens ebenso durch aufgefundene Pflanzenreste bestätigt wird, einer plötzlich erfolgten Axendrehung der Erde zu; andere sind geneigt, an eine große Sintflut zu glauben, welche Sibirien überschwemmte; andere endlich behaupten, daß das Mammont in einem gemäßigten Gürtel Sibiriens gelebt und sich von Nadelhölzern ernährt habe, sein Leichnam aber durch die Fluten der Flüsse an die heutigen Fundstellen geschwemmt worden seien.
Ungefähr um die gleiche Zeit, in welcher das Mammont auf der Erde lebte, fanden sich auch die Mastodonten oder Zitzenthiere ( Mastodon), von denen bereits zehn bis zwölf Arten in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Indien ausgegraben wurden. Zumal in Amerika hat man viele Ueberbleibsel dieser Thiere entdeckt, und eine Art, das Ohiothier ( Mastodon giganteus), ziemlich vollständig kennen gelernt. Barton erzählt, daß 1761 von Indianern fünf Mammuthsgerippe aufgefunden wurden, an deren Köpfen, nach dem Berichte der Entdecker, »lange Nasen mit einem Maule unter denselben sich befanden«, und Kalm gedenkt eines anderen Gerippes, an welchem man ebenfalls den Rüssel noch unterscheiden konnte. Alle Arten dieser Familie ähnelten unserem Elefanten. Die einen waren kleiner, die anderen größer. Unter den Indianern gehen Sagen über diese Riesen, welche sie »Vater der Ochsen« nennen, von Mund zu Munde. Sie glauben, daß jene zugleich mit Menschen von entsprechender Größe lebten, und daß beide durch Donnerkeile des großen Geistes zerstört wurden. Die längst ausgerotteten Ureinwohner Virginiens erzählten, »daß ›der große Mann‹ mit seinen Blitzen einst die ganze Herde jener furchtbaren Thiere erschlug, weil sie Hirsche, Bisonten und anderes für die Menschen bestimmte Vieh vernichtet, der eine Bulle aber mehrere Donnerkeile mit seinem Kopfe auffing und abschüttelte, bis er zuletzt in die Seite verwundet wurde und in den großen See floh, wo er in Ewigkeit leben wird«. In der Neuzeit hat man in sehr verschiedenen Gegenden Amerikas ähnliche Knochen entdeckt, und somit über die vorzeitliche Verbreitung unserer Ordnung Gewißheit erhalten.
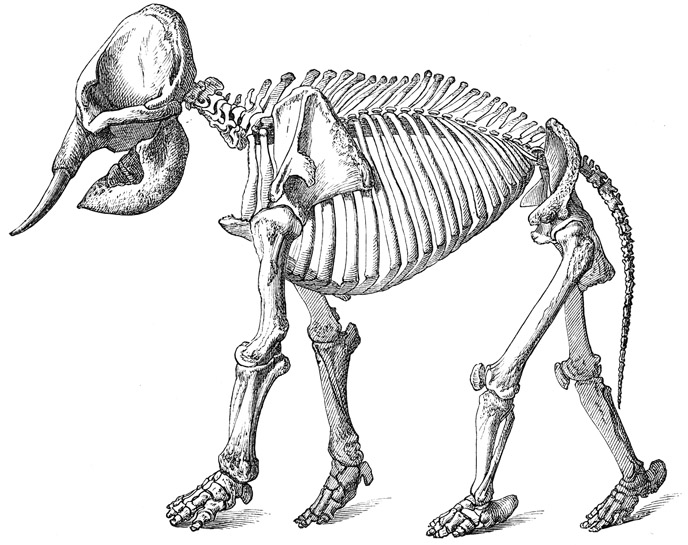
Geripp des Elefanten ( Elephas indicus). (Aus dem Berliner anatomischen Museum)
Unsere Elefanten, die einzigen gegenwärtig noch lebenden Vertreter der gleichnamigen Familie ( Elephantina) oder Unterordnung, kennzeichnen der lange, bewegliche Rüssel und die Zähne, namentlich die Stoßzähne, welche man als umgebildete Schneidezähne betrachtet. Der Rumpf ist kurz und dick, der Hals sehr kurz, der Kopf rund, durch Höhlen in dem oberen Schädelknochen aufgetrieben; die ziemlich hohen, säulenartigen Beine haben entweder fünf oder vorn vier, hinten drei, bis auf die in einer Reihe nebeneinander liegenden Hufe verbundene Zehen und flache hornartige Sohlen.
Das wichtigste Glied des Elefanten ist der Rüssel, eine Verlängerung der Nase, ausgezeichnet durch seine Beweglichkeit, Empfindlichkeit und vor allem durch den fingerartigen Fortsatz an seinem Ende. Er ist zugleich Geruchs-, Tast- und Greifwerkzeug. Ring- und Längsmuskeln, nach Cuvier etwa vierzigtausend einzelne Bündel, setzen ihn zusammen und befähigen ihn nicht allein zu jeder Wendung, sondern auch zur Streckung und Zusammenziehung. Dem Munde ersetzt er die fehlende Oberlippe, dem Thiere selbst ermöglicht er das Leben. Der Leibesbau erlaubt dem Elefanten nicht, den Kopf bis zur Erde herabzubringen, und es würde dem Dickhäuter deshalb schwer werden, sich zu ernähren, würde nicht jenes sonderbare Werkzeug ihm zur Lippe, zum Finger, zur Hand und zum Arme zugleich. Dieser Rüssel heftet sich an der platten Gesichtsfläche des Schädels, auf den Stirnbeinen, dem Oberkiefer, dem Nasenbein und dem Zwischenkiefer an, ist oben gerundet, unten verflacht, und verdünnt sich allmählich von der Wurzel zur Spitze.
Alle übrigen Glieder und selbst die Sinneswerkzeuge des Elefanten erscheinen weniger beachtenswerth. Die Augen sind klein und von blödem, aber gutmüthigem Ausdrucke, die Ohren dagegen sehr groß, Lederlappen vergleichbar. Die Zehen werden so innig von der allgemeinen Körperhaut umschlossen, daß eine Bewegung unter sich unmöglich ist. Jede einzelne wird von einem zwar kleinen, aber starken, breiten und platten, nagelartigen Hufe bedeckt, welcher eben nur die Zehenspitze umhüllt. Nicht selten kommt es vor, daß einer der Hufe fehlt, weil er abgestoßen und durch das schnelle Nachwachsen der übrigen vollends verdrängt wurde. Der mittellange, ziemlich gerundete Schwanz reicht bis an das Beugegelenk und endet mit einem aus sehr dichten, groben, drahtähnlichen Borsten bestehenden Büschel.
Sehr merkwürdig ist das Gebiß. Der Elefant trägt im Oberkiefer zwei außerordentlich entwickelte Stoßzähne, aber weder Schneidezähne, noch Eckzähne, sondern bloß noch einen einzigen gewaltigen Backenzahn in jedem Kiefer. Dieser Zahn besteht aus einer ziemlich bedeutenden Anzahl einzelner Schmelzplatten, welche mit einander verbunden sind. Wenn er sich durch das Kauen soweit abgenutzt hat, daß er nicht vollständig mehr seine Dienste thut, bildet sich hinter ihm ein neuer Zahn, welcher allmählich weiter nach vorn rückt und vor dem Ausfallen des letzten Stummels in Thätigkeit tritt. Man hat beobachtet, daß dieser Zahnwechsel sechsmal vor sich geht und darf deshalb von vierundzwanzig Backenzähnen sprechen, welche das Thier während seines Lebens besitzt. Die Stoßzähne haben ein ununterbrochenes Wachsthum und können daher eine ungeheure Länge, sowie ein Gewicht von fünfundsiebzig bis neunzig Kilogramm erreichen.
Der Elefant ( Elephas indicus ), welchen wir als Urbild seiner Sippe, Familie und Unterordnung zu betrachten pflegen, ist ein mächtiges, plumpes, vierschrötiges Thier mit massigem, breitstirnigem Haupte, kurzem Halse, gewaltigem Leibe und säulenartigen Beinen. Sein Kopf, welcher fast senkrecht gehalten wird, trägt wesentlich dazu bei, den überwältigenden Eindruck, welchen das riesige Thier auf den Beschauer ausübt, zu erhöhen. Gewaltig in seinen Verhältnissen, erscheint derselbe bei aller Einfachheit der Formen reich gegliedert. Er ist hoch, kurz und breit, seine Gesichtslinie fast gerade, der Scheitel gekrönt durch zwei erhabene, auch nach vorn stark sich herauswölbende Kuppeln, welche den höchsten Punkt des Thieres bilden und vorn am Grunde durch eine wulstige Leiste verbunden werden. Letztere setzt sich jederseits in Gestalt eines unter stumpfem Winkel nach den Augenrändern laufenden Grates fort und umschließt dreieckige Vertiefungen, aus denen die Nasenwurzel oder Ansatzstelle des Rüssels deutlich hervortritt. Zwischen den dicken Augenrändern, Jochbeinen, Stirnhügeln und Ohrwurzeln liegen muldenförmige Einsenkungen. Hinter dem Stirnrande, etwas über dem Jochfortsatze des Oberkieferbeines, befindet sich eine von vorn und oben nach hinten und unten gerichtete, etwa fünf Centimeter lange, schmale, durch ihre flachen Ränder fast geschlossene Drüsenöffnung, aus welcher zeitweilig, zumal während der Brunst, eine übelriechende, die Backen dunkel färbende Absonderung aussickert. Hoch oben am Kopfe sitzt das mittelgroße, verschoben viereckige, nach unten in eine etwas verlängerte Spitze ausgezogene Ohr, dessen Oberrand vorn und an der Innenseite umgekrempt ist, und dessen schlaff herabhängende Spitze sich nach hinten biegt. Das kleine geschlitzte, sehr bewegliche, jedoch unschöne Auge liegt ziemlich tief in der Höhle, wird durch dicke, mit starken, schwarzen Wimpern besetzte Lider geschützt und von vielen Hautfalten ringförmig umgeben; sein Stern ist sehr klein und rund, die Iris kaffeebraun, der Augapfel dicht um die Iris herum weißlich, übrigens aber kastanienbräunlich gefärbt. Die faltenreichen Winkel des weit gespaltenen Maules, dessen bewegliche, meist jedoch tief herabhängende Unterlippe in einer langen Spitze hervortritt, liegen, nicht weit unter und hinter dem Auge, in einer tiefen Grube, welche durch die sehr starken Kaumuskeln und die Wurzel der Stoßzähne gebildet wird. Zwischen den Augen, nach oben bis zur Stirn reichend, befindet sich die Ansatzstelle des an der Wurzel halbkugeligen, fast walzenförmigen, weil bis gegen die Spitze hin nur wenig und gleichmäßig an Dicke abnehmenden Rüssels, welcher ausgestreckt bis auf den Boden herabreicht und daher regelmäßig eingerollt getragen werden muß. Sein vorderer Theil ist drehrund, jede seiner Seiten etwas gedrückt, der hintere Theil, welcher jederseits durch eine vorspringende Leiste begrenzt wird, im oberen Viertel der Länge flach, im übrigen Verlaufe mehr und mehr ausgehöhlt, vor dem Ende mit einem dicken, hinten knollig aufgetriebenen Wulstringe umgeben, vorn mit dem ausgezeichneten Greifwerkzeuge, einem deutlich abgesetzten, kegeligen, fingerartigen Haken, ausgerüstet und an dem abgestutzten Ende selbst in Gestalt einer becherförmigen Höhlung eingebuchtet, in deren Tiefe die Nasenlöcher liegen. Die vorderen drei Seiten des ungemein dehnbaren und allseitig beweglichen Rüssels sind mit ringförmigen, dicht neben einander liegenden, nach der Spitze zu noch mehr sich zusammendrängenden und verfeinernden Querfalten bedeckt, welche in den Seitenleisten endigen, wogegen die hintere Seite feine Längsfalten und Querkerben zeigt. Die gewaltigen Stoßzähne treten mit starker Wölbung aus dem Oberkiefer hervor. Der Hals ist kurz, nach dem Kopfe zu gehoben, von diesem deutlich abgesetzt. Der Widerrist macht sich wenig bemerklich, weil die Rückenlinie vom Halse an gleichmäßig bis zu dem ungefähr in der Rückenmitte gelegenen, wenig hinter dem Kopfe zurückbleibenden höchsten Punkte ansteigt, um von hier aus bis zur Wurzel des Schwanzes steil abzufallen. Die Bauchlinie senkt sich von der Brust, welche die beiden Saugwarzen trägt, wenig nach hinten. Der Schwanz ist hoch angesetzt, drehrund und mit Querfalten bedeckt, verjüngt sich wenig nach der Spitze zu und hängt senkrecht bis etwas unter das Knie herab. Die Vorderbeine sind vom Schultergelenke an frei und erscheinen besonders aus dem Grunde merklich höher als die hinteren, weil die Achselhöhlen zwischen dem Oberarme und den Brustknochen erheblich sich eintiefen; ihre von Hautfalten kreisförmig umgebenen Elnbogen treten stark, die Handgelenke schwach hervor; die an der Vorderfläche sehr eingezogene Mittelhand läßt den fünfhufigen, kissenförmigen, nach allen Seiten verbreiterten, glattsohligen Fuß besonders groß erscheinen. Die Hinterbeine stecken fast bis zu den Knieen herab in einer mit den Bauchtheilen verbundenen häutigen Umhüllung; ihre Kniee sind deutlich bemerkbar, indem sich die Beine unmittelbar unter ihnen auffallend verschwächen und erst dann wieder bis zu der sehr tief sitzenden Ferse stetig verstärken; der Fuß verbreitert sich von hier aus rasch nach vorn und hinten, so daß seine Sohle eirund wird. Die Haut ist in bestimmten Richtungen fein gefaltet, in anderen, welche die Falten meist kreuzen, geritzt, weshalb ihre Oberfläche eigentümlich netzartig gerieft erscheint; nur an der Brust verdicken sich diese Falten zu losen, beweglichen, wammenartigen Wülsten. Infolge des gedachten Faltennetzes vermißt man kaum das fast gänzlich fehlende Haarkleid, welches eigentlich nur durch sehr einzeln am Körper, etwas dichter rings um die Augen, an den Lippen, am Unterkiefer, auf dem Kinne und dem Hinterrücken stehende Haare angedeutet und einzig und allein an der Schwanzspitze zu einer zweizeiligen dünnen Quaste entwickelt ist. Die einzelnen Haare haben braune oder schwarze, die der Lippen weißliche, die nackten Hautstellen fahlgraue Färbung, welche jedoch am Rüssel, Unterhalse, der Brust und dem Bauche in Fleischröthlich übergeht und hier durch eine dichte, tropfenartige, dunkle Fleckung gezeichnet wird. Die Hufe sind hornfarben.
Die Maße des Elefanten werden gewöhnlich überschätzt. Es beträgt bei sehr großen Männchen die Gesammtlänge von der Rüssel- bis zur Schwanzspitze ungefähr 7 Meter, wovon etwa 2,25 Meter auf den Rüssel und 1,4 Meter auf den Schwanz kommen, und die Höhe am Widerriste 3,5 bis höchstens 4 Meter; größere Stücke dürften kaum gefunden werden. Das Gewicht soll zwischen drei- und viertausend Kilogramm schwanken.
Als Vaterland des Elefanten haben wir Vorder- und Hinterindien zu bezeichnen. In vielen Gegenden dieser riesigen Reiche bereits ausgerottet, lebt er innerhalb des angegebenen Verbreitungsgebietes noch in allen größeren und zusammenhängenden Waldungen, im Gebirge wie in der Ebene. Ob die auf Ceilon, Sumatra und Borneo hausenden Elefanten mit denen des Festlandes gleichartig sind, wie man bisher ziemlich allgemein angenommen, oder ob sie in der That eine besondere Art ( Elephas sumatranus) bilden, wie der ältere Schlegel, gestützt auf Vergleichungen des Gerippes der festländischen und Inselelefanten, uns versichert, lassen wir einstweilen noch unentschieden.
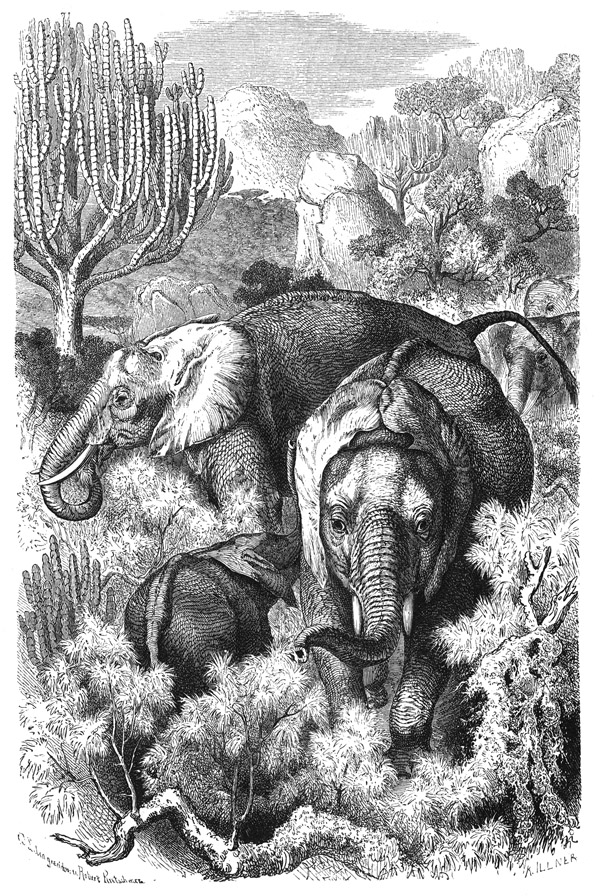
Afrikanischer Elefant.

Indischer Elefant
Dagegen kann es keinem Zweifel unterliegen, daß der Afrika bewohnende Elefant von dem indischen unterschieden werden muß. Derselbe, der Fihl der Araber ( Elephas africanus), amharisch »Zohen«, tigrisch »Harmas«, äthiopisch »Negiê« genannt, von den Denkeli »Decken«, den Somali »Merodeh«, den Gallavölkern »Arbâ«, den Belen »Dsanfa«, den Betschuanen »Ylo« und »Dzo« geheißen, fast in jedem anderen Lande Afrikas also mit einem besonderen Namen belegt, übertrifft seinen indischen Verwandten wahrscheinlich an Größe, steht jedoch insofern hinter ihm zurück, als er auf den Beschauer bei weitem nicht den majestätischen Eindruck ausübt wie die indische Art. Seine Erscheinung ist unschöner, der Leib kürzer, aber höher gestellt als bei dem Verwandten; auch sein flacher Kopf mit dem dünnen Rüssel und den ungeheuren Ohren, seine ausdruckslos geschwungene Rückenlinie, seine schmale Brust und seine häßlichen Beine bilden eine Vereinigung von Merkmalen, welche ihn bestimmt von jenem unterscheiden. Am Kopfe, welcher nur selten erhoben, sondern meist gesenkt und vorgestreckt wird, tritt, von den Nasenbeinen angefangen, die Stirn zurück, bildet eine nur wenig hervortretende Spitze und fällt über die Scheitelbeine nach dem Hinterhaupte wiederum flach ab. Alle Leisten und Gruben des Kopfes sind verflacht; die Augenränder treten wenig hervor, und das Auge füllt seine Höhle fast gänzlich aus; der Unterkiefer ist verhältnismäßig schwach, und die Kaumuskeln machen sich wenig bemerkbar; der Rüssel setzt sich flach an die Stirne an und verschmächtigt sich, ohne eine kräftige Wurzel zu zeigen, bald unverhältnismäßig. Hierdurch gewinnt die Gesichtslinie ein höchst bezeichnendes Ansehen und eine gewisse Aehnlichkeit mit der eines Raubvogels. Die größte Breite des Kopfes liegt zwischen den Jochbeinen, und Stirn und Unterkiefer treten weit zurück, wogegen bei der indischen Art Schläfe, Jochbeine und Kaumuskeln annähernd dieselbe Breite des Kopfes bedingen. Der Rüssel ist vorn rund, seitlich etwas zusammengedrückt und hinten flach, nicht aber eingemuldet, wird von breiten, nach der Spitze zu dichter stehenden und sich verschmälernden Faltenringen umgeben, von denen jeder untere aus dem oberen hervorgewachsen zu sein scheint, und hat, den Ringen entsprechend, stark geschnürte, in der Mitte jedoch sehr erhabene Randleisten, deren Begrenzungslinie deutlich zackig ist. Die Rüsselmündung ist nur schwach umwulstet. Dem sehr breiten, kaum den Namen verdienenden Finger entspricht ein ähnlicher, vorgezogener Theil des Hinterrandes der Mündung; beide können mit ihren Rändern sich fest an einander legen und den Rüssel so verschließen, daß die sichtbar bleibende Oeffnung nur ein quergestellter Schlitz zu sein scheint. Die Nasenscheidewand tritt tief zurück, und die länglichen, aufrechtstehenden Nasenlöcher liegen daher ebenfalls in einer becherförmigen Aushöhlung. Die kurze, rundliche Unterlippe hängt nicht, sondern wird gewöhnlich angezogen. Die Augen sind klein und geschlitzt; die Iris hat hellröthlich gelbbraune Färbung. Hoch oben am Kopfe sitzen auf mächtigen Wurzeln die riesigen Ohren, welche nicht allein den ganzen Hinterkopf überdecken, sondern noch über das Schulterblatt wegreichen. Sie haben fünf Ecken, von denen eine, die untere, in eine lange, weit unter die Kehle reichende Spitze ausgezogen ist, und eine zweite vordere obere den Nacken, welchem sie aufliegt, überragt und von den entsprechenden des anderen Ohres bedeckt wird. Von der ersten Ecke an bis zur dritten, hinter dem Schulterblatts liegenden, ist der Ohrrand nach innen, d. h. der Vorderseite der Ohrmuschel, umgeschlagen, wogegen der übrige Theil des Ohres wie ein Stück steifer, schwachgerollter Pappe oder wie Sohlenleder auf der Schulter liegt. Das ganze Ohr ist ungemein flach, nach hinten, der Schulterform entsprechend, gebogen und zeigt nur dicht vor der Gehöröffnung eine kleine, seichte Mulde zum Auffangen des Schalles; den Gehörgang schützen Knorpel und einige Hautfalten zur Genüge. Vom Kopfe aus erhebt sich der dünne Hals zum Widerriste, welcher zwischen den Ohren liegt; hinter diesen ist der Rücken sattelartig eingesenkt, steigt aber von der Mitte an ziemlich steil empor, die Schulterhöhe merklich überbietend und fällt sodann noch steiler nach dem tief angesetzten, senkrecht herabhängenden, bis zu den Kniekehlen reichenden, dünnen und glatten Schwanze ab. Die Brust liegt hoch zwischen den Vorderbeinen, so daß die Linie des gerundeten, vollen Bauches nach hinten zu erheblich sich senkt. Die Vorderbeine, deren Elnbogen als Spitze etwas hervortreten, verjüngen sich bis zur Mittelhand und gehen sodann, allseitig sich verbreiternd und über die Mittelhand hinausreichend, in die kissenartigen, fast rundsohligen Füße über, welche vier Hufe haben. An den Hinterbeinen, deren Oberschenkel bis ans Knie sich verstärken und länglich viereckige Keulen darstellen, sind die Unterschenkel auffallend dünn, verbreitern sich stark nach der Ferse zu und stehen auf eirundsohligen, vorn und hinten vorgezogenen, plumpen Füßen, welche drei Hufe haben. Die Falten und Risse der netzartig eingerieften Haut zeigen ein gröberes Gepräge als bei dem indischen Elefanten. Mit Ausnahme eines schwachen Haarkammes auf Hals und Widerrist dünnstehender, bis fünfzehn Centimeter langer, schwarzbrauner Haare, welche von Brust und Bauch herabhängen, und einzelner, welche in der Umgebung der Augen und an der Unterlippe sich finden, fehlt die Behaarung gänzlich. Die Färbung der Haut, ein kräftiges Schieferblaugrau, wird durch anhaftenden Schmutz und Staub getrübt und in ein mißfarbenes Fahlbraun umgewandelt.
Bei einem von Kirk in den Sambesiländern erlegten männlichen Fihl betrug die Länge von der Spitze des Rüssels bis zum Scheitel 2,75 Meter, die Länge der gebogenen Linie von hier bis zur Ansatzstelle des Schwanzes 4,2 Meter, die Schwanzlänge 1,3 Meter, die Gesammtlänge also rund 8 Meter, bei 3,14 Meter Schulterhöhe. Und doch hatte jeder Stoßzahn erst ein Gewicht von 15 Kilogramm, das Thier demnach noch keineswegs ein hohes Alter erreicht.
Das Verbreitungsgebiet des Fihl umfaßt noch gegenwärtig ganz Innerafrika, soweit es durch den alljährlich regelmäßig fallenden Regen das Wüstengepräge verloren hat und entweder bewaldet oder doch mit hohen Gräsern bedeckt ist. Ob das Thier jemals in den Atlasländern gelebt hat, wie Wagner zu glauben scheint, dürfte fraglich sein. Im Kaplande ist es erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ausgerottet worden; im Süden wie im Norden Afrikas wird es von Jahr zu Jahr weiter zurück gedrängt, beziehentlich in stetig zunehmenden Gebieten vernichtet; nur im Westen wie im Osten kommt es noch in unmittelbarer Nähe der Küste vor.
Beide Elefantenarten waren den Alten wohlbekannt und wurden schon in früher Zeit oft lebend nach Europa gebracht. »Die alten Egypter«, fügt Dümichen hier ein, »kannten nicht bloß die afrikanische Art, sondern auch den Elefanten des fernen Indien und schätzten beide hoch. Die so werthvollen Stoßzähne dieser Riesen der Thierwelt bildeten zu allen Zeiten des egyptischen Reiches einen Hauptbestandtheil des jährlichen Tributes, welchen die Bewohner »des elenden Kusch« und die noch südlicher wohnenden Neger wie die unter egyptischer Oberhoheit stehenden Völker Asiens an den Pharao zu entrichten hatten. Auf der die Assuâner Kataraktenlandschaft am nördlichen Ende, nach der egyptischen Seite hin, abschließenden Insel, heute Gefíret Assuân genannt, erhob sich zur Zeit des alten Egypten die Metropolis des ersten oberegyptischen Gaues, welche, gleich der Insel, auf welcher sie stand, bei Griechen und Römern den Namen Elephantine führte, was nur eine treue Wiedergabe des Namens ist, den Stadt und Insel bereits im alten Egypten trugen, des Namens »Elefanteninsel, Elfenbeinstadt.« So wurden Insel und Stadt genannt, weil ehedem an jener Stelle, wie heute in dem gegenüber liegenden Assuân, der Stapelplatz war für das aus dem Süden kommende Elfenbein, welches bereits in den ältesten Zeiten des Pharaonenreiches von den in Kunst und Handwerk so geschickten egyptischen Meistern zu allerlei Schmuckgegenständen und verschiedenen Geräthschaften, welche praktischen Zwecken des Lebens dienten, verarbeitet wurden. Der Name des Elefanten wird in der Hieroglyphenschrift durch ein Silbenzeichen gegeben, welches die Aussprache »Ab« hatte; je nach dem hinter dieses Wort nun tretenden Bestimmungsbilde bezeichnet »Ab«, außer dem Elefanten selbst, auch die Stoßzähne desselben, das Elfenbein, und ebenso die Insel oder Stadt des Elfenbeines, Elephantine. Zur Bezeichnung der letzteren tritt in den Inschriften zuweilen sogar mit Fortlassung des Silbenszeichens »Ab« nur das Bild des Elefanten auf. In Bezug auf die Kenntnis, welche die alten Egypter von dem asiatischen Elefanten hatten, ist von besonderer Wichtigkeit eine von Ebers in einem oberegyptischen Grabe, und zwar in Qurnah, auf der Westseite von Theben, aufgefundene Inschrift. Das Grab stammt, wie aus den darin vorkommenden Königsnamen hervorgeht, aus dem siebzehnten Jahrhunderte v. Chr., und der Verstorbene, Namens Amenemheb, welcher die Ehre hatte, den Heldenkönig Thutmosis den Dritten auf seinen asiatischen Kriegszügen zu begleiten, berichtet nur an der Wand seines Grabes über einige hervorragende Erlebnisse aus diesem Feldzuge. So heißt es: »Ich schaute abermals da eine That der Vollkommenheit, ausgeführt von dem Herrscher Egyptens im Lande Ninive, woselbst er auf der Jagd erlegte hundert und zwanzig Elefanten, wegen ihres Elfenbeins«. Ueber die Liebhaberei der egyptischen Könige für gefährliche Jagden wird uns in den Inschriften vielfach Bericht erstattet. Wie bei den alten Egyptern waren auch bei anderen Völkern des Alterthums der Name des Elefanten und die Bezeichnung des Elfenbeins gleichlautend. Erst Herodot meint unter dem Namen »Elephas« wirklich das Thier. Ktesias, der Leibarzt von Artaxerxes von Nemon, war der erste Grieche, welcher einen Elefanten nach eigener Anschauung beschrieb. Er sah einen lebenden in Babylon, wohin derselbe aus Indien gekommen sein mochte; er war es auch, welcher zuerst das Märchen verbreitete, daß der Elefant keine Gelenke in den Beinen habe, weder sich legen noch aufstehen könne und deshalb stehend schlafen müsse. Darius ist geschichtlich der erste, welcher die Elefanten in der Schlacht und zwar gegen Alexander den Großen verwendete. Von den durch letzteren erbeuteten Elefanten bekam Aristoteles einige zu Gesicht und konnte nunmehr das Thier ziemlich genau beschreiben. Von dieser Zeit an kommen die Elefanten oft in der Geschichte vor. Fast dreihundert Jahre nach einander werden sie selbst in Europa in den endlosen Kriegen verwendet, welche die verschiedenen Völker um die Weltherrschaft führen, bis die Römer endlich siegreich aus den Kämpfen hervorgehen. Neben den indischen Elefanten aber wurden auch afrikanische gebraucht, und namentlich die Karthager verstanden es, diese Thiere, welche man später für unzähmbar erklären wollte, zum Kriege abzurichten und in derselben Weise zu verwenden wie die indischen.
Die Römer brauchten ihre Elefanten hauptsächlich zu den Kampfspielen, und schon ihnen sollen wir die Schuld zuzuschreiben haben, daß die Thiere im Norden des Atlas ausgerottet wurden. Wie weit die afrikanischen Elefanten abgerichtet wurden, mag daraus hervorgehen, daß die römischen Schauspieler sie gelehrt hatten, Buchstaben mit einem Griffel zu zeichnen, auf einem schräg gespannten Seile auf- und abzugehen, zu Viert auf einer Sänfte einen Fünften zu tragen, welcher den Kranken vorstellte, nach dem Takte zu tanzen, von einer prächtig besetzten Tafel aus Gold- und Silbergeschirr mit aller Beobachtung der feinen Sitte und des Anstandes zu speisen etc. Soviel Gelegenheit aber auch die Alten hatten, Elefanten im Leben zu beobachten, so wenig zuverlässig sind die Beschreibungen, welche auf uns gekommen sind. Sonderbarerweise haben sich gewisse Märchen und Fabeln hartnäckig erhalten, und eigentlich kennen wir erst seit der allerneuesten Zeit die riesigen Dickhäuter wirklich. Gegenwärtig liegen eine Reihe vortrefflicher Beobachtungen über beide Arten vor, und es läßt sich somit ein eingehendes und richtiges Lebensbild der Thiere zeichnen.
In den angegebenen Ländern findet man den Elefanten in jeder größeren Waldung. Je reicher eine solche an Wasser ist, je mehr sie dadurch zum eigentlichen Urwalde wird, um so häufiger tritt er auf. Allein man würde sich irren, wenn man glauben wollte, daß er einzig und allein in derartigen Wäldern gefunden werde. Es ist behauptet worden, daß der Riese unter den Säugethieren die Kühle und die Höhe scheue, wogegen gewissenhafte Beobachtungen dies aufs bestimmteste widerlegen. Auf Ceilon sind gerade die hügeligen und bergigen Gegenden seine Lieblingsplätze. »In Uvah«, sagt Tennent, »wo die Hochebenen oft mit Reif überzogen sind, finden sich die Elefanten noch in Höhen von mehr als zweitausend Meter über dem Meere in Herden, während der Jäger in den Dschungeln der Tiefe vergeblich nach ihnen suchen wird. Keine Höhe scheint ihnen zu luftig oder zu frostig zu sein, vorausgesetzt nur, daß sie Wasser im Ueberflusse enthalte. Der gewöhnlichen Meinung entgegen, meidet der Elefant das Sonnenlicht so viel als möglich und bringt deshalb den Tag in den dichtesten Gehegen des Waldes zu, während er gerade die kühle, dunkle Nacht zu seinen Ausflügen erwählt. Er ist, wie fast alle Dickhäuter, mehr Nacht- als Tagthier; denn obgleich er bei Tage ab und zu weidet, bildet doch die stille, ruhige Nacht die eigentliche Zeit, in welcher er des Lebens sich freut. Wenn der Wanderer zufällig oder der Jäger aus vorsichtigem Schleichgange bei Tage einer Herde nahe kommt, sieht er sie in der größten Ruhe und Gemüthlichkeit bei einander stehen. Ihre ganze Erscheinung ist geeignet, alle die Erzählungen von ihrer Bosheit, Wildheit und Rachsucht zu widerlegen. Im Schatten des Waldes hat die Herde in den verschiedenartigsten Stellungen sich gelagert und aufgestellt. Einige brechen mit dem Rüssel Blätter und Zweige von den Bäumen, andere fächeln sich mit Blättern, welche sie abbrechen, und einige liegen und schlafen, während die jungen spiellustig unter der Herde umherlaufen: das anmuthigste Bild der Unschuld, wie die Alten das der Friedfertigkeit und des Ernstes sind. Dabei bemerkt man, daß jeder Elefant, wie die zahmen auch thun, in einer sonderbaren Bewegung sich befindet. Einige wiegen ihr Haupt einförmig in einem Kreise oder in Bogen von der rechten zur linken Seite, andere schwingen einen ihrer Füße vor- und rückwärts, andere schlagen ihre Ohren an das Haupt oder bewegen sie hin und her, andere heben oder senken in gleichen Zeiträumen ihre Vorderbeine auf und nieder. Mehrere Reisebeschreiber haben geglaubt, daß die sonderbaren Bewegungen, welche man alle auch an den Gefangenen beobachten kann, nur eine Folge von der langen Seereise wäre: sie haben aber niemals Elefanten in der Wildnis gesehen. Sobald eine Herde von Menschen überrascht wird oder sie auch nur wittert, entflieht die ganze Gesellschaft furchtsam in die Tiefe des Waldes und zwar gewöhnlich auf einen der von ihr gebahnten Pfade.«
Für den Fihl gilt hinsichtlich des Aufenthaltes wie beziehentlich des Auftretens dasselbe. In den Bogosländern habe ich die Losung der Elefanten noch in Höhen von zweitausend Meter unbedingter Höhe gefunden und von den Eingeborenen erfahren, daß in den benachbarten Hamasén die Thiere regelmäßig auf den höchsten Bergen, also bis zu dreitausend Meter über dem Meere, vorkommen. Van der Decken fand bei seiner Besteigung des Kilimandscharo noch in einer Höhe von fast dreitausend Meter über dem Meere Spuren unserer Dickhäuter.
Großes Geschick und unermüdliche Ausdauer beim Besteigen hoher Berge wird auch von gezähmten Elefanten bethätigt. Reisende Thierschausteller führen, wie Wallis mir mittheilt, solche bis zu den am höchsten gelegenen Städten Kolumbiens und Ecuadors hinauf, obgleich sie, um auf die dreitausend Meter über dem Meere gelegenen Hochebenen zu gelangen, Pässe von viertausend Meter unmittelbarer Höhe und darüber übersteigen müssen. Den Chimborassopaß erklimmt selbst der abgehärtet[??]ste Reisende nicht immer ohne Schaden, und doch sind Elefanten über ihn hinweggeführt worden.
Weder im Hoch- oder Mittelgebirge, noch in der Ebene hält der Elefant unter allen Umständen am Walde fest, ändert vielmehr seinen Aufenthalt nicht allein entsprechend der Oertlichkeit, sondern auch gemäß der obwaltenden Umstände. So begegnet man dem Fihl in einem großen, vielleicht im größten Theile Afrikas monatelang nur in der freien Steppe, vorausgesetzt, daß hier Bäume wenigstens nicht gänzlich fehlen, oder aber trifft ihn in Sümpfen an, deren Röhricht die höchste Pflanze der Umgegend ist. Eine Bedingung muß der von ihm gewählte Aufenthaltsort stets erfüllen: an Wasser darf es nicht fehlen. Von einem Regenstrome zum anderen, von diesem Sumpfe oder Pfuhle zum nächsten führen die Wechsel, und jede Lache unterwegs bildet einen Ort der Ruhe, der Erquickung, weil sie stets benutzt wird, die Haut durch Bäder oder wenigstens durch Ueberspritzen zu nässen, zu säubern und von Kerbthieren zu reinigen. »Nicht nur vormittags und mit Einbruch der Dunkelheit«, sagt Heuglin, »am lichten Nachmittage selbst haben wir in einzeln gelegenen Plätzen Elefanten angetroffen, welche dort, oft tief im Wasser stehend oder sogar liegend, beschäftigt waren, letzteres trübe und kothig zu machen und sich damit anzuspritzen.«
So häufig die Elefanten im Inneren Afrikas auch sind, so schwierig ist es zuweilen, ihren augenblicklichen Aufenthalt ausfindig zu machen, da sie ein sehr unstetes Leben führen. In hellen Mondscheinnächten hört man, wie der letztgenannte Berichterstatter ebenfalls bemerkt, einen Trupp scheinbar in nächster Nähe, muß aber schon vor Tagesgrauen zu Stelle sein, wenn man ihn noch antreffen will, weil die Thiere, nachdem sie sich gesättigt haben, in der Regel einen anderen Theil ihres Gebietes aufsuchen und so rasch sich bewegen, daß sie heute hier, morgen zweihundert Kilometer weiter sein können. Bei solchen Ortsveränderungen folgen sie regelmäßig bestimmten Wechseln oder bahnen sich neue, gleichviel ob sie ihren Weg durch Wälder oder Sümpfe, über steile Höhen oder durch enge Schluchten nehmen müssen. Bodenhindernisse scheint es für sie überhaupt nicht zu geben: sie durchschwimmen, wie Heuglin treffend schildert, Ströme und Seen, arbeiten sich ohne Mühe durch den dicksten Urwald, an steilen, steinigen und felsigen Höhen hinan, auf festem Boden oft förmliche Straßen herstellend, weil sie bei ihren Zügen nicht allein geschlossene Gesellschaften bilden, sondern sich auch in lange Reihen zu ordnen pflegen, welche dann verhältnismäßig schmale Wechsel hinterlassen. Solche Straßen bemerkte ich in allen dichteren Waldungen Innerafrikas, welche noch von ihnen bewohnt werden. Die Wege laufen gewöhnlich von der Höhe zum Wasser herab; doch findet man auch Pfade, welche die übrigen durchkreuzen. In allen größeren Urwaldungen zu beiden Seiten des oberen Blauen Nils konnte ich nur auf diesen Wegen in den Urwald eindringen: dort waren die Elefanten geradezu als Straßenbauer anzusehen. Das leitende Mitglied einer Herde geht ruhig durch den Wald, unbekümmert um das Unterholz, welches es unter seinen breiten Füßen zusammentritt, unbekümmert auch um die Aeste, welche von stärkeren Bäumen herabhängen; denn diese werden einfach mit dem Rüssel abgebrochen und bis auf die stärkeren Theile verspeist. Auf freien, sandigen oder auch staubigen Flächen des Waldes scheint die Elefantenherde gewöhnlich Rast zu halten und ein Staubbad zu nehmen, wie die Hühner es thun. Ich beobachtete an solchen Orten tiefe, der Größe des Elefanten entsprechende Kessel, welche wahrscheinlich mit Hülfe der Stoßzähne ausgewühlt worden waren und deutlich zeigten, daß die gewaltigen Thiere hier sich gepaddelt hatten. In der freien Steppe dürften sie, laut Schweinfurth, mit Vorliebe die schmalen Wege begehen, welche der Mensch im Hochgrase gebahnt hat, obgleich sie kaum zur Aufnahme eines Viertheils ihrer Körperbreite ausreichen; im Gebirge dagegen legen sie sich, ebenso wie im Walde, Pfade an, und zwar mit einer Klugheit, welche selbst menschliche Straßenbauer in Erstaunen setzt. Tennent erfuhr von englischen Baumeistern, daß die Elefanten, wenn sie Gebirge überschreiten, stets die günstigsten und tiefsten Sättel auszuwählen und alle Regeln zur Ueberwindung bedeutender Steilungen aufs geschickteste zu benutzen verstehen. Es ist eine bemerkenswerthe Thatsache, daß solche Wege selbst über Gebirge verlaufen, in denen gewöhnliche Pferde unbesiegbare Hindernisse finden würden. Genau das gleiche gilt für die Bogosländer. Hier haben die Elefanten immer die günstigsten Pässe des Gebirges, welche weit und breit zu finden sind, zu ihren Wegen sich ausgesucht und diese mit wunderbarer Klugheit benutzt. Im Mensagebirge durchkreuzen die Elefantenwege nur da das Hauptthal, wo von beiden Seiten her Querthäler einmünden, steigen von jenem aus in diesen so hoch als möglich aufwärts und erheben sich dann im Zickzack vollends bis zum Kamme, von wo aus der Weg in umgekehrter Weise nach unten führt.
Der Elefant ist nur scheinbar plump, in Wirklichkeit sehr geschickt. Für gewöhnlich geht er einen ruhigen, gleichmäßigen Paß, wie das Kamel und die Girafe; dieser ruhige Gang aber kann so beschleunigt werden, daß ein Reiter Mühe hat, dem trabenden Elefanten nachzukommen. Anderseits versteht dieser es, so leise durch den Wald zu schleichen, daß man ihn kaum noch gehen hört. »Anfangs«, sagt Tennent, »stürzt eine wilde Herde mit lautem Geräusche durch das Unterholz; bald aber sinkt der Lärm zur vollständigen Geräuschlosigkeit herab, so daß ein Neuling glauben muß, die flüchtenden Riesen hätten nur wenige Schritte gethan und sich dann ruhig wieder aufgestellt.« Beim Ueberschreiten sehr bedeutender Steilungen wird der Elefant geradezu zum kletternden Thiere. An einem Gefangenen, welchen ich pflegte, habe ich mit wahrem Vergnügen gesehen, wie geschickt er es anfängt, schroffe Gehänge zu überwinden. Er biegt zunächst sehr klug seine Vorderläufe in den Handgelenken ein, erniedrigt also den Vorderleib und bringt den Schwerpunkt nach vorn, dann rutscht er auf den eingeknickten Beinen vorwärts, während er hinten mit gerade ausgestreckten Beinen geht. Bergauf also fördert die Wanderung noch ziemlich gut, bergab dagegen hat das schwere Thier selbstverständlich wegen seines ungeheuren Gewichtes größere Schwierigkeiten zu überwinden. Wollte der Elefant in seiner gewöhnlichen Weise fortgehen, so würde er unbedingt das Gleichgewicht verlieren, nach vorn sich überschlagen und solchen Sturz vielleicht mit seinem Leben bezahlen. Das kluge Geschöpf thut dies jedoch nicht, kniet vielmehr am Rande des Abhanges nieder, so daß seine Brust auf den Boden zu liegen kommt und schiebt nun seine Vorderbeine höchst bedächtig vor sich her, bis sie irgendwo wieder Halt gewonnen haben, zieht hierauf die Hinterbeine nach und gelangt so, gleitend und rutschend, nach und nach in die Tiefe hinab. Zuweilen kommt es übrigens doch vor, daß der Elefant auf seinen nächtlichen Wanderungen einen schweren Fall thut. Im oberen Mensathale sah ich hiervon unverkennbare Spuren. Eine starke Herde war beim Uebergang des Hauptthales längs einer Bergwand hingegangen und dabei auf einen schmalen Weg gerathen, welchen das Regenwasser hier und da unterwaschen hatte. Ein theilweise überragender Stein war von einem Elefanten betreten und dadurch zur Tiefe herabgestürzt worden, hatte aber auch zugleich das schwere Thier aus dem Gleichgewichte gebracht und nach sich gezogen. Dieses mußte einen gewaltigen Burzelbaum geschossen haben; denn Gras und Büsche waren in einer Breite, welche der Länge eines Elefanten etwa entsprach, auf mindestens sechzehn Meter nach unten niedergebrochen und theilweise ausgerissen. Ein stärkeres und dichteres Gebüsch hatte den Rollenden endlich aufgehalten; denn von dort aus führte die Fährte wieder zum Hauptwege empor. Einige Kreuzschmerzen mochte das gute Thier wohl davon getragen haben, ernstlichen Schaden aber hatte es nicht erlitten.
Der alte Glaube, daß der Elefant sich nicht niederlegen könne, wird von jedem, den wir in Thierschaubuden sehen, aufs gründlichste widerlegt. Allerdings schläft unser Dickhäuter nicht immer im Liegen, sondern oft auch im Stehen; wenn er es sich aber bequem machen will, läßt er sich mit derselben Leichtigkeit, mit welcher er sich anderweitig bewegt, nieder oder erhebt sich vom Lager. Nicht minder leicht schwimmt der ungeschlachte Gesell, er wirft sich daher mit wahrer Wollust in das Wasser und versenkt sich nach Belieben in die Tiefe desselben. Falls es ihm gefällt, schwimmt er in gerader Richtung über die breitesten Ströme, und manchmal lagert er sich förmlich unter Wasser, wobei er dann einzig und allein die Spitze seines Rüssels über die Oberfläche emporstreckt.
Die wunderbarsten Bewegungen, deren der Elefant überhaupt fähig ist, führt er mit seinem Rüssel aus. Dieses vorzügliche Werkzeug erscheint ebenso ausgezeichnet wegen seiner gewaltigen Kraft als wegen der Mannigfaltigkeit der Biegungen und Drehungen, deren es fähig ist, oder der Geschicklichkeit, mit welcher es etwas angreifen kann. Mit dem fingerartigen Fortsatze am Ende erfaßt der Elefant die kleinsten Dinge, leichte Silbermünzen oder Papierschnitzel zum Beispiel, mit ihm bricht er aber auch starke Bäume um. Man kann wohl sagen, daß der Rüssel zu jeder Arbeit und in jeder Richtung verwendet werden kann; denn es würde geradezu unmöglich sein, alles aufzuzählen, was das Thier mit seiner langen Nase auszuführen im Stande ist.
Nächst dem Rüssel benutzt der Elefant auch die Zähne zu mancherlei Arbeiten. Er hebt mit ihnen Lasten auf, wälzt Steine um, wühlt Löcher und gebraucht sie endlich wohl auch als Waffen zur Abwehr oder zum Angriffe, schont sie übrigens so viel als möglich; denn in ihnen liegt seine wahre Stärke nicht! Mercer sandte an Tennent die Spitze eines Elefantenzahns von zwölf Centimeter im Durchmesser und zwölf Kilogramm Gewicht, welche im Kampfe von einem anderen Elefanten abgeschlagen worden war. Eingeborene hatten ein eigenthümliches Geräusch gehört, waren dem Schalle nachgegangen und an zwei kämpfende Elefanten gekommen, einen Zahntragenden und ein Weibchen ohne Zahn, welches jenem mit einem Rüsselschlage den halben Zahn abbrach.
Alle höheren Fähigkeiten des Elefanten stehen im Einklange mit den bereits erwähnten Begabungen. Das Gesicht scheint nicht besonders entwickelt zu sein; wenigstens hegen alle Jäger die Meinung, daß das Gesichtsfeld des Thieres ein sehr beschränktes ist. Um so besser aber sind Geruch und Gehör ausgebildet, und Geschmack und Gefühl, wie man an Gefangenen leicht sich überzeugen kann, wenigstens verhältnismäßig fein. Von dem scharfen Gehöre des Thieres wissen alle Jäger zu berichten. Der geringste Laut ist hinreichend, um einen Elefanten aufmerksam zu machen; das Brechen eines kleinen Zweiges genügt, um seine Behaglichkeit zu unterbrechen. Der Geruch ist fast ebenso scharf wie bei den Wiederkäuern: jeder geübte Jäger vermeidet es sorgfältig, weidenden Elefanten mit dem Winde sich zu nähern. Im Rüssel hat auch der Tastsinn seinen bevorzugten Sitz, und zumal der fingerförmige Fortsatz an der Spitze desselben wetteifert an Feinheit der Empfindung mit dem geübten Finger eines Blinden.
Die geistigen Fähigkeiten der Elefanten werden von allen, welche mit den Thieren zu thun haben, in ihrem vollen Werthe anerkannt. Scharfer, überlegender Verstand läßt sich nicht verkennen. Der Blick verräth allerdings wenig von hervorragenden geistigen Eigenschaften, wohl aber nur deshalb, weil das verhältnismäßig kleine Auge der gewaltigen Leibesmasse gegenüber kaum zur Geltung kommt. Jede Beobachtung lehrt bald erkennen, welch ein ausgezeichnet kluges Geschöpf man in dem Elefanten vor sich hat. Wie Heuglin mittheilt, erkennen alle Neger den hohen Verstand des Thieres willig an, und schätzen ihn so hoch, daß sie den Glauben hegen, ursprünglich von diesem Riesen abzustammen, ebenso, wie viele Muselmanen des Sudân in ihm den Urvater des Menschengeschlechtes erblicken wollen und aus diesem Grunde sein Fleisch nicht genießen. Im Umgange mit dem Menschen entwickelt sich der Verstand unseres Dickhäuters zuletzt zu einer wahrhaft bewunderungswürdigen Höhe. Der Elefant steht den klügsten Säugethieren, einem Affen, Hunde oder Pferde, ziemlich gleich. Er überlegt, bevor er handelt, verbessert und vervollkommnet sich mehr und mehr, ist für Lehre empfänglicher als jedes andere Thier und erwirbt sich mit der Zeit einen wahren Schatz von Kenntnissen. Für diese Behauptung ließen sich aus den vielen Geschichten, welche von Elefanten erzählt wurden, die nöthigen Beweise leicht finden. Zwei Belege mögen genügen. Raxava, ein Kaffeepflanzer, erzählte Tennent, daß er mehr als einmal beobachtet habe, wie die wilden Elefanten bei Gewittern plötzlich die Wälder verließen und sich fern von allen Bäumen auf freie Wiesenflächen lagerten, so lange die Blitze leuchteten und der Donner noch rollte! Diese einzige Angabe spricht besser als die ausführlichste Geschichte für einen sehr scharfen Verstand: sie zeigt uns den Elefanten, wie er sich benimmt, wenn er einzig und allein auf sich selbst angewiesen ist. In der Gefangenschaft, im Umgange mit dem Menschen, tritt die hohe Begabung des Thieres noch schärfer hervor. »Eines Abends«, sagt Tennent, »ritt ich in der Nähe von Kandy durch den Wald. Plötzlich stutzte mein Pferd über ein Geräusch, welches aus dem ziemlich dichten Wald herübertönte und in einer Wiederholung von dumpfen, wie › urmf, urmf‹ klingenden Lauten bestand. Dieses Geräusch erklärte sich beim Näherkommen. Es rührte von einem zahmen Elefanten her, welcher eben mit harter Arbeit beschäftigt und ganz auf sich selbst angewiesen, d.+h. ohne Führer war. Er bemühte sich nach Kräften, einen schweren Balken, welchen er über seine Zähne gelegt hatte und wegen des engen Weges nicht gut fortbringen konnte, wegzutragen. Die Enge des Pfades zwang ihn, um überhaupt durchzukommen, sein Haupt beständig bald nach dieser, bald nach jener Seite zu kehren, und diese Anstrengung erpreßte ihm die beschriebenen mißwilligen Töne. Als das kluge Thier uns erblickte, erhob es sein Haupt, besah uns einen Augenblick, warf plötzlich den Balken weg und schob sich rückwärts gegen das Unterholz, um uns den Weg frei zu machen. Mein Pferd zögerte. Der Elefant bemerkte dies, drückte sich noch tiefer in das Dickicht und wiederholte sein »Urmf«, aber entschieden in viel milderem Tone, offenbar in der Absicht, uns zu ermuthigen. Noch zitterte mein Pferd. Ich war viel zu neugierig auf das Beginnen der beiden klugen Geschöpfe, als daß ich mich eingemengt hätte. Der Elefant wich weiter und weiter zurück und wartete ungeduldig auf unseren Vorüberzug. Endlich betrat mein Pferd den Weg, zitternd vor Furcht. Wir kamen vorüber, und augenblicklich trat der Elefant aus dem Dickicht hervor, erhob seine Last von neuem und setzte seinen mühseligen Weg fort wie vorher.«
Der wildlebende Elefant bekundet mehr Einfalt als Klugheit. Seine Geistesfähigkeiten erheben sich kaum zur List, weil die reiche Natur, welche ihn umgibt und ernährt, ihn der Notwendigkeit überhebt, seinen Verstand anzustrengen. Anfänglich will es dem Beobachter scheinen, als wäre er das stumpfsinnigste aller Geschöpfe. Das Gemessene und die Bedachtsamkeit seines Auftretens, die Ruhe und Harmlosigkeit seines Wesens werden verkannt oder unterschätzt, und erst, wenn üble Erfahrungen ihn mißtrauisch gemacht haben, Gefahr und Noth, welche ihm bisher fremd waren, durch den Menschen über ihn verhängt wurden, offenbart er seine herrlichen Geistesgaben. Es ist falsch, wenn von ihm behauptet wird, daß er ein reizbares Thier sei. Sein Wesen ist mild und ruhig. Er lebt mit jedem Geschöpfe in Freundschaft und Frieden. Ungereizt greift er niemals an, weicht im Gegentheile allen Thieren, selbst kleinen, ängstlich aus. »Der ärgste Feind des Elefanten«, sagt Tennent, »ist – die Fliege.« »Eine Maus«, behauptet Cuvier, »entsetzt den zahmen Elefanten, daß er zittert.« Alle die so schön ausgedachten Erzählungen von Kämpfen zwischen Elefant und Nashorn oder Elefant, Löwe und Tiger müssen unerbittlich in das Reich der Fabeln geworfen werden. Jedes Raubthier hütet sich, den Elefanten anzugreifen, und dieser gibt keinem Geschöpfe Veranlassung zum Zorn oder zur Rachsucht. Einzelne Thiere, namentlich einzelne Vögel, leben in besonderer Freundschaft mit ihm. Im Inneren Afrikas folgt seinen Herden regelmäßig ein Wildschwein nach, im Süden des Erdtheils begleiten jene die Madenhacker ( Buphaga africana), in Nordostafrika die kleinen Kuhreiher ( Ardeola bubulcus), in Indien ähnliche gutmüthige Vögel, welche das große Säugethier beständig von Ungeziefer zu reinigen suchen. Insbesondere der Kuhreiher gehört wesentlich zum Bilde des afrikanischen Elefanten. Schwerlich kann man sich einen hübscheren Anblick denken als einen der gewaltigen, dunklen, ruhig dahinschreitenden Riesen, auf welchem ein ganzes Dutzend der anmuthigen, blendend weißen Vögel sitzt oder umherwandelt, der eine ruhend, der andere sich putzend, der dritte alle Falten der Haut untersuchend und hier und dort jagend, ein Kerbthier oder einen Egel, welchen sich der Dickhäuter bei seinem nächtlichen Bade geholt, aufnehmend. Ebenso verträglich und friedlich würde der Elefant auch mit dem Menschen leben, verdiente dieser das Vertrauen des edlen Geschöpfes. Noch heutigen Tages geschieht es, wie Heuglin angibt, im Inneren Afrikas, zumal in Gegenden, wo Elefanten wenig Verfolgung erleiden, daß diese einen Menschen, welcher sich zufällig mitten unter ihnen befindet, kaum zu beachten scheinen, und ebenso trifft man, nach Kirks Versicherung, in Südafrika zuweilen auf zahlreiche Herden, welche bei Annäherung des Menschen nicht entfliehen; die Erfahrung eines Tages aber genügt, um sie für immer mißtrauisch zu machen. Aengstlich meiden sie dann die Nähe des Erzfeindes aller Thiere und seine Niederlassungen, ja sogar die nur zeitweilig von ihm begangenen Pfade, und wandern deshalb Gegenden zu, welche ihnen Sicherheit, Frieden und Ruhe gewähren. »Bei dem hohen Alter, welches sie erreichen«, meint Schweinfurth, »mag es wohl kein bejahrtes Stück mehr geben, welches nicht öfters in seinem Leben von Menschen angegriffen wurde.« Solche Erfahrungen lassen die ängstliche Scheu der Thiere begreiflich erscheinen und erklären es, daß der Elefant sofort flüchtet, wenn er die Nähe seines furchtbaren Feindes auch nur ahnt. Wittert einer Unrath, so hebt er, laut Heuglin, den Rüssel hoch, windet und legt, indem er den Kopf seitlich umbiegt oder hoch aufrichtet, ein Ohr zurück, um sich genau zu überzeugen, woher Gefahr naht, stößt, so bald er diese erkannt, einen Warnungslaut aus, und gibt damit das Zeichen zur Flucht, auf welcher alle Glieder des Rudels ihm folgen.
Jede Elefantenherde ist eine große Familie und umgekehrt, jede Familie bildet ihre eigene Herde. Die Anzahl solcher Gesellschaft kann sehr verschieden sein; denn die Herde kann von zehn, fünfzehn, zwanzig Stück anwachsen bis auf Hunderte. Anderson sah am Ngamisee eine Herde, welche fünfzig, Barth am Tschad eine solche von sechsundneunzig, Wahlberg im Kafferland eine andere von zweihundert Stück. Einzelne Reisende sprechen von vier- und fünf-, ja sogar achthundert Elefanten, welche sie zusammen gesehen haben. So versichert Heuglin, einem Trupp begegnet zu sein, dessen Anzahl seiner Schätzung nach mindestens auf fünfhundert zu veranschlagen war, und ebenso behauptet Kirk, am Sambese einmal eine Herde von achthundert Stück angetroffen zu haben, welche in einer indianischen Reihe sich bewegte und einen über eine englische Meile langen Zug bildete. In den von mir durchreisten Ländern zählen die Herden zehn, zwanzig bis höchstens fünfzig Stück.
Die Familie bildet einen geschlossenen Verband unter sich. Kein anderer Elefant findet Zutritt und derjenige, welcher so unglücklich war, durch irgend welchen Zufall von einer Herde getrennt zu werden, vielleicht übrig zu bleiben oder aus der Gefangenschaft zu entfliehen, ist gezwungen, ein Einsiedlerleben zu führen. Er mag weiden in der Nähe der Herde, dieselben Trink- und Badeplätze besuchen, der Familie nachziehen, wohin sie will: immer muß er in einer gewissen Entfernung sich halten, und niemals wird er in den eigentlichen Familienkreis aufgenommen. Wagt er sich einzudrängen, so gibt es Schläge und Stöße von allen Seiten; selbst das harmloseste Elefantenweibchen schlägt mit seinem Rüssel auf ihn los. Solche Elefanten werden von den Indianern Gundâs, oder, falls sie sich bösartig zeigen, Rogues genannt. Sie sind vorzugsweise gefürchtet. Während die Herde ruhig und still ihres Weges geht, dem Menschen immer ausweicht und nur im äußersten Nothfalle an ihm sich vergreift, während sie sogar sein Besitzthum achtet, kennen die Rogues derartige Rücksichten nicht: das einsame, unnatürliche Leben hat sie erbittert und wüthend gemacht. Auf sie werden in Indien besondere Jagden angestellt, und niemand hat mit einem Rogues Mitleid; man mag ihn nicht einmal in der Gefangenschaft haben. Die Indier, welche wir unbedingt als die größten Elefantenkenner betrachten müssen, versichern, daß jede Familie durch ihre Aehnlichkeit sich auszeichnet, und die Engländer bestätigen, daß einzelne Hindus Familienangehörige einer Herde mit aller Sicherheit erkennen, die Familie mag zerstreut sein, wie sie will. »In einer Herde von einundzwanzig Elefanten«, sagt Tennent, »welche 1844 gefangen wurden, zeigten die Rüssel von allen dieselbe eigenthümliche Gestaltung; denn sie waren lang und von derselben Dicke, anstatt sich nach der Spitze hin zu verdünnen. In einer anderen Herde von fünfunddreißig Stück zeigten alle dieselbe Stellung der Augen, dieselbe Wölbung des Rückens, dieselbe Bildung des Vorderkopfes.« Die Indier wissen, daß die Anzahl einer Herde, abgesehen von der natürlichen Vermehrung, immer gleich bleibt, wenn nicht besondere Unglücksfälle sie heimsuchen, und Jäger, welche den edlen Thieren nachstellten, haben Jahre hindurch stets nur so viele von der Herde gefunden, als ihren tödtlichen Geschossen entronnen waren. In allen Herden überwiegen die Weibchen; in manchen gibt es gar keine männlichen Elefanten, wahrscheinlich, weil sie der größeren Zähne wegen den Nachstellungen bereits zum Opfer gefallen waren. Durchschnittlich kann man annehmen, daß auf einen männlichen sechs bis acht weibliche Elefanten kommen.
Inwieweit diese Angaben auch für den afrikanischen Elefanten gelten dürfen, lasse ich unentschieden. Kirk und Heuglin melden übereinstimmend, daß die männlichen und weiblichen Thiere besondere Rudel bilden, welche sich nur während der Paarzeit gesellen, und daß man auch in Afrika Einsiedler bemerkt, deren Wesen nie zu trauen ist, weil sie gelegentlich, ohne herausgefordert zu sein, einen Menschen angreifen sollen.
Der klügste Elefant pflegt der Herde vorzustehen. Sein Amt ist, die Herde zu führen, auf alle Gefahren zu achten, die Gegend zu untersuchen, kurz für die Sicherheit derselben Sorge zu tragen. Alle wilden Elefanten sind, wie bemerkt, im höchsten Grade scheu und vorsichtig; der Leitelefant aber zeigt diese Eigenschaften gleichsam verzehnfacht. Sein Amt ist ein sehr mühevolles: er ist sozusagen ununterbrochen in Thätigkeit. Aber dafür lohnt ihn auch der unbedingteste Gehorsam seiner Untergebenen. Widerspruch gegen seine Anordnungen kommt niemals vor; er geht voran, und alle übrigen folgen ihm rücksichtslos nach und sei es in das Verderben. »In der Höhe der dürren Jahreszeit«, erzählt Major Skinner, »trocknen bekanntlich alle Ströme aus, und die Teiche und Lachen ebenso. Die indischen Thiere leiden dann des Wassers wegen bittere Noth, und sammeln sich massenhaft um diejenigen Teiche und Tümpel, welche das ihnen so nothwendige Element am längsten behalten. In der Nähe eines solchen Teiches hatte ich einmal Gelegenheit, die erstaunliche Vorsicht der Elefanten zu beobachten. An der einen Seite des Pfuhles und hart an seinem Ufer begann ein dichter Urwald, auf der anderen umgab ihn offenes Land. Es war eine jener prachtvollen, klaren Mondlichtnächte, die fast ebenso hell sind als unser nordische Tag, in welcher ich beschloß, die Elefanten zu beobachten. Die Oertlichkeit war meinem Zwecke günstig. Ein gewaltiger Baum, dessen Zweige über den Teich weg hingen, bot mir ein sicheres Unterkommen in seiner Höhe. Ich begab mich bei Zeiten an meinen Platz und achtete mit der gespanntesten Aufmerksamkeit auf alles, was vorging. Die Elefanten waren keine fünfhundert Schritte von mir entfernt; aber doch mußte ich zwei volle Stunden warten, bevor ich einen von ihnen zu sehen bekam. Endlich schlüpfte, etwa drei hundert Schritte vom Teiche entfernt, ein großer Elefant aus dem dunkeln Walde, ging mit höchster Vorsicht beiläufig zweihundert Schritte vor und stand dann still, um zu lauschen. Er war so ruhig gekommen, daß nicht das leiseste Geräusch gehört werden konnte, und blieb mehrere Minuten stehen, bewegungslos wie ein Felsblock. Dann erst rückte er in drei Absätzen weiter und weiter vor, zwischen jedem Vorrücken mehrere Minuten lang anhaltend und die mächtigen Ohren nach vorwärts öffnend, um auch das leiseste Geräusch aufzufangen. So bewegte er sich langsam bis an das Wasserbecken. Er dachte nicht daran, seinen Durst zu löschen, obgleich er dem Wasser so nahe stand, daß seine gewaltige Gestalt in ihm sich widerspiegelte. Minutenlang verweilte er lauschend, ohne ein Glied zu rühren. Dann drehte er sich vorsichtig und leise um und ging nach derselben Stelle des Waldes zurück, von woher er gekommen war. Nach einer kleinen Weile zeigte er sich wieder nebst fünf anderen, mit denen er wiederum ebenso vorsichtig, aber weniger lautlos als früher, auf das Wasser losging. Die fünf wurden als Wächter aufgestellt. Er kehrte in den Wald zurück und erschien nochmals, umgeben von der ganzen aus etwa achtzig bis hundert Stück bestehenden Herde und führte diese über die Blöße mit solcher Stille, daß ich trotz der Nähe die Thiere nur sich bewegen sah, nicht aber auch bewegen hörte. In der Mitte der Blöße blieb die Herde stehen. Der Leitelefant ging von neuem vor, verkehrte mit den Wächtern, untersuchte alles, überzeugte sich von der vollständigen Sicherheit, kehrte zurück und gab nun Befehl zum Vorrücken. In demselben Augenblick stürzte die Herde gegen das Wasser los und warf sich ohne jede Scheu und ohne an Gefahr zu denken, mit aller Wollust in die Fluten. Von ihrer Schüchternheit und Furchtsamkeit war keine Spur zu bemerken. Alle vertrauten ihrem Führer so vollkommen, daß sie sich um nichts mehr zu kümmern schienen. Nachdem die verschmachteten Thiere den Teich eingenommen hatten und als auch der letzte, der Leitelefant, eingetreten war, überließen sie sich gleichsam frohlockend der Wonne, ihren Durst zu stillen sowie der Wohlthat des Badens. Niemals hatte ich solche Menge von thierischem Leben in einem so engen Raume gesehen. Es wollte mir erscheinen, als tränken die Elefanten den ganzen Teich trocken. Ich beobachtete sie mit der größten Theilnahme, bis sie sich mit Trinken und Baden Genüge gethan hatten. Dann versuchte ich, welche Wirkung ein unbedeutendes Geräusch auf sie ausüben würde. Nur einen kleinen Zweig brauchte ich zu brechen, und die ganze feste Masse kam augenblicklich in Aufruhr und floh dahin wie eine Herde aufgescheuchten Wildes in toller Hast und Eile.«
Mit ähnlicher Vorsicht gehen die Elefanten auf Nahrung aus, geben sich aber, falls sie sich erst von ihrer Sicherheit überzeugt haben, um so behaglicher der Mahlzeit hin. Der Reichthum ihrer Waldungen ist so groß, daß sie eigentlich niemals Mangel leiden; sie erscheinen auch, weil sie beständig auf Oertlichkeiten leben, in denen es Nahrung in Hülle und Fülle gibt, weder gefräßig noch begierig. Sie brechen Zweige von den Bäumen, gleichsam als geschähe es zu ihrem Vergnügen, fächeln sich mit ihnen, vertreiben die so gehaßten Fliegen und verzehren sie dann allgemach, nachdem sie dieselben einigermaßen zusammengebrochen haben. Wenn aber auch gemächlich und behaglich, still und geräuschlos geht solche Mahlzeit nicht von statten, verursacht vielmehr, wie Heuglin malerisch schildert, einen wahren Höllenlärm. Das Knicken der Zweige, das Krachen der oft mit vereinigten Kräften niedergebrochenen Aeste oder Stämme, das Kauen, Athmen, Misten, das dumpfe Rollen der Luft in den Eingeweiden, das Patschen der schweren Füße im Moraste, das Ueberspritzen des Leibes mittels des Rüssels, das Klatschen der mächtigen Ohren, welche oft wie Sonnenschirme ausgebreitet werden, das Reiben der massigen Leiber an dicken Baumstämmen und das dazwischen gellende tiefe, schmetternde Brüllen der Thiere vereinigt sich zu einem ohrbetäubenden Ganzen. Entsprechend solchem Lärm ist die jeder Beschreibung spottende Verwüstung, welche eine Elefantenherde im Walde anrichtet. »Was der mächtige Fuß nicht tief in den Boden tritt«, sagt unser Gewährsmann, »wird umgeworfen, der stärkste Baum entwurzelt, sein Geäst herabgebrochen; das Unterholz liegt wild durch einander, als hätte es ein rasender Wirbelwind niedergerissen; Stämme, welche den Stürmen von mehr als einem Jahrhundert getrotzt, sind abgeknickt wie ein Rohr.« Aeste von mehr als Armstärke werden von den Elefanten ohne Bedenken verschlungen: in der 50 Centim. langen und 12 Centim. dicken, 6 Kilogramm schweren wurstartigen Losung fand ich Aststücke von 10 bis 12 Centim. Länge und 4 bis 5 Centim. Dicke im Durchmesser. Niedrige Zweige, zumal solche, welche in Mundhöhe stehen, schieben sie mit dem Rüssel bündel- oder buschweise ins Maul und beißen oder richtiger quetschen sie dann mit den Zähnen ab. Sehr starke Aeste schälen sie ganz oder theilweise, lassen aber das Holz liegen. In jeder Gegend gibt es Lieblingsbäume der Elefanten, welche vor allen anderen heimgesucht werden: in Mittelafrika heißt ein Baum geradezu »Elefantenbaum«, weil er vor allen übrigen besucht, beweidet und verwüstet wird. Er ist dornig, aber die Dornen sind weich und deshalb kein Hindernis für den Gaumen des Elefanten, welcher den härteren Stacheln der Mimosenzweige nicht gewachsen zu sein scheint. Nächst diesem Elefantenbaume brandschatzt der Fihl übrigens noch viele andere, einzelne fast nur wegen der Früchte, welche er durch Schütteln gewinnt und mit dem Rüssel zusammenliest, letztere der Zweige und Schale halber. Baumzweige werden von beiden Elefanten unter allen Umständen Gräsern vorgezogen, letztere jedoch auch nicht verschmäht. Kommt eine Elefantenherde auf einen mit saftigem Grase bewachsenen Platz, so weidet sie davon, packt mit dem Rüssel einen Busch, reißt ihn sammt den Wurzeln aus dem Boden, klopft diese Wurzeln gegen einen Baum, um sie von der ihnen anhängenden Erde zu befreien, und steckt sich dann einen nach dem anderen in den Schlund. Auf den nächtlichen Weidegängen wird wohl auch ab und zu einmal ein Feld besucht, und dann freilich thut die Herde in ihm großen Schaden. Aber schon das einfachste Scheusal oder die leichteste Umzäunung genügt, um unsere Dickhäuter von den Feldern abzuhalten. Die Indier lassen zwischen ihren Pflanzungen breite Wege für die zur Tränke gehenden Elefanten und umzäunen die Felder mit leichten Rohrstäben; ein einziger Schlag mit dem gewaltigen Rüssel würde eine ganze Wand dieser Pfähle niederwerfen, aber niemals kommt es vor, daß die Elefantenherde die Umzäunung durchbricht; nur die Gondahs thun dies zuweilen. Dieselbe Herde geht aber sofort auf die Felder, wenn die Thüre dazu geöffnet ist. Nach der Ernte des Reises zum Beispiel überlassen die Indier den Elefanten das leere Stroh und halten deshalb die Umhegungen nicht mehr verschlossen. Sobald dies geschieht, dringen die Thiere ein und fressen alles übriggebliebene auf. Einen ähnlichen Beweis von Klugheit liefern, falls die Erzählungen der Eingeborenen auf Wahrheit beruhen, auch die afrikanischen Elefanten. Nach Heuglin gewordenen Mittheilungen sollen sie die Zeit, in welcher vom Flachlande her nach den Gebirgen von Habesch Getreide befördert wird, genau kennen, plötzlich erscheinen, die Kamele der Karawane erschrecken, die von diesen würdigen Thieren unter solchen Umständen regelmäßig abgeworfenen Fruchtballen öffnen und sich an den so erbeuteten Schätzen gütlich thun. Ich meine, daß diese Erzählung ebenso wenig begründet ist wie die Versicherung der Sudâner, daß der Fihl, und zwar aus edlem Gerechtigkeitssinne, niemals in die durch Schutzbriefe versicherten Felder einfalle. »Elefanten«, sagte mir ein Schëich am Blauen Flusse, »werden dir nichts zu leide thun, wenn du sie in Frieden läßt, wie sie mir und meinen Vorfahren nie etwas gethan haben. Wenn die Zeit der Ernte herankommt, hänge ich an hohen Stangen Schutzbriefe auf, und diese genügen den gerechten Thieren; denn sie achten das Wort des Gottgesandten Mahammed – über welchem der Friede des Allbarmherzigen walten möge! sie fürchten die Strafe, welche den Gotteslästerer ereilen wird: sie sind eben gerechte Thiere!« Jedenfalls hindert diese Gerechtigkeitsliebe die Elefanten nicht, dann und wann ein Feld zu plündern und Büschelmais oder Kafferhirse zu fressen, gleichviel ob die Aehren reif sind oder nicht; ihr Edelmuth hält sie nicht einmal ab, gelegentlich die riesigen Kürbisse, welche auf den Hütten der im Walde wohnenden Neger reifen, abzupflücken oder das Dach einer solchen Hütte abzudecken, um nachzusehen, ob Getreide im Innern des Raumes aufgespeichert worden sei.
In den Gebirgen von Habesch zwingt der Wechsel der Jahreszeiten die Elefanten zu regelmäßigen Wanderungen. Im Bogoslande ziehen sie auf ziemlich streng eingehaltenen Wegen alljährlich zweimal auf und nieder, also viermal an einem Orte vorüber, so bei der Ortschaft Mensa. Wassermangel treibt sie in die tiefsten Flußthäler hinab; der Frühling, d. i. die Regenzeit, welche gerade im Gebirge reiches Leben hervorzaubert, lockt sie wieder zur ergiebigen und unbehelligten Weide empor. Sie ziehen von den Gebirgskämmen bis in das Flußbett des Ain-Saba thalwärts und von dort aus wieder nach ihren ersten Weideplätzen hinauf. Alle Wanderungen geschehen selbstverständlich nur des Nachts.
Wie die Nahrung, führt der Elefant auch seine Getränke mit Hülfe des Rüssels zum Munde: er saugt beide Röhren desselben voll und spritzt sich den Inhalt dann in das Maul. Sobald eine Herde an das Wasser kommt, ist dies ihr wichtigstes Geschäft, und erst wenn der Durst gestillt ist, denken die Thiere daran, in derselben Art und Weise auch ihren Körper zu nässen. Der Rüssel ist übrigens nicht bloß zum Aufsaugen des Wassers, sondern auch zur Aufnahme von Sand und Staub geeignet. Diese Stoffe werden angewendet, um die so lästigen Kerbthiere zu verscheuchen.
Wie leicht erklärlich, ist die Vermehrung unserer Landriesen eine geringe. Man erkennt den Zustand des brünstigen Elefanten zunächst daran, daß zwei Drüsen neben den Ohren eine übelriechende Flüssigkeit in reichlicher Menge ausschwitzen. Das Thier selbst ist sehr erregt; sogar das gezähmte wird oft furchtbar wild gegen seine Treiber, welche es sonst vortrefflich behandelt. Früher glaubte man, daß die Elefanten im Freien, fern von allem menschlichen Treiben, sich paarten, und wollte deshalb von einer großen Schamhaftigkeit des Thieres reden; Corse aber beobachtete, daß zwei frisch gefangene Elefanten vor einer Menge Zuschauer sich begatteten. Vorher erwiesen sie sich mit ihren Rüsseln Liebkosungen; dann paarten sie sich in sechszehn Stunden viermal ganz nach Art der Pferde. Die Brunstzeit ist nicht bestimmt. Das eine Mal zeigte sie sich im Februar, das andere Mal im April, ein drittes Mal im Juni, ein viertes Mal im September und ein fünftes Mal im Oktober. Aufgeregt sind die paarungslustigen Thiere immer, und die kleinste Veranlassung kann sie in Zorn bringen. Drei Monate nach der Paarung bemerkte Corse die ersten Anzeichen der Trächtigkeit des Weibchens. Nach einer Tragzeit von zwanzig Monaten und achtzehn Tagen warf es ein Junges, welches sofort nach seiner Geburt zu saugen anfing. Die Mutter stand dabei, das Junge legte den Rüssel zurück und ergriff das Euter mit seinem Maule. Fast alle Beobachter stimmen darin überein, daß die Liebe der Mutter zu ihrem eigenen Kinde nicht besonders groß ist; dagegen bemerkte man, daß sich alle weiblichen Elefanten eines jungen mit gleicher Zärtlichkeit annehmen. Die wilden sollen sämmtlichen Kleinen ohne Ausnahme ihr Euter bieten. Letztere, welche bei der Geburt etwa 90 Centim. hoch sind, nehmen rasch an Größe zu und sind bereits nach Ablauf des ersten Jahres 1,2, ein Jahr später 1,4, zu Ende des dritten Jahres 1,5 Meter hoch geworden. Sie erscheinen vom Anfange an verhältnismäßig weniger plump als andere junge Thiere, sogar als niedliche und drollige Geschöpfe, halten sich in der ersten Zeit ihres Lebens vorzugsweise unter dem Leibe und zwischen den Beinen ihrer Mutter auf und verlassen diesen sicheren Platz auch dann nicht, wenn letztere einen rascheren Gang einschlägt. Wie es scheint, stehen sie mehrere Jahre, jedenfalls bis zur Geburt eines Geschwifters, unter Obhut der Alten, welche sie bald zum Fressen anleitet und ihnen nötigenfalls durch Abbrechen von Aesten oder Bäumen ihr Lieblingsfutter, laubige Zweige, verschafft.
Ein Elefant wächst zwanzig bis vierundzwanzig Jahre, ist aber wahrscheinlich schon im sechzehnten Jahre zur Fortpflanzung geeignet. Der erste Zahnwechsel findet im zweiten, der zweite im sechsten, der dritte im nennten Lebensjahre statt. Später dauern seine Zähne länger aus. Das Alter, welches das Thier überhaupt erreichen kann, wird sehr verschieden angegeben. Tennent spricht von Elefanten, welche über hundert Jahre in der Gefangenschaft gelebt haben sollen, stellt jedoch vorher eine beglaubigte Todtenliste von denen auf, welche durch die Regierung verwendet wurden, aus welcher hervorgeht, daß von hundertundachtunddreißig Gefangenen nach Ablauf von zwanzig Jahren nur ein einziger noch lebte. Andere Beobachter nehmen an, daß wilde Elefanten hundertundfünfzig Jahre alt werden können.
Der Elefant zählt leider ebenfalls zu denjenigen Thieren, welche ihrem Untergange entgegengehen. Man jagt die edlen Geschöpfe nicht, um wegen des von ihnen verübten Schadens sich zu rächen, sondern des kostbaren Elfenbeins halber und hat deshalb von jeher einen Vernichtungskrieg gegen sie geführt. Der Schaden, welchen die Vielhufer anrichten, ließe sich ertragen, obgleich diese zuweilen durch sonderbare Gelüste unangenehm werden. So zogen sie den indischen Straßenbaumeistern wiederholt die Merkpfähle aus dem Boden, welche die Leute mühsam zur Bezeichnung der anzulegenden Straßen gesetzt hatten, und andere fielen hartnäckig immer und immer wieder in eine und dieselbe Pflanzung ein, so daß der Besitzer genöthigt war, die berüchtigtsten Jäger zu sich zu erbitten. Wenn ich die Jäger, anstatt berühmt, berüchtigt nenne, habe ich leider guten Grund dazu. Die meisten von ihnen betragen sich der Jagd, welche sie betreiben, vollkommen unwürdig. Es sind hauptsächlich Engländer, welche der Elefantenjagd obliegen, und dies sagt genug. Ich will einen von ihnen, den oft genannten Gordon Cumming, seine Art und Weise, Elefanten zu erlegen, selbst schildern lassen. »Am 31. August erblickte ich den größten und höchsten Elefanten, welchen ich jemals gesehen. Er stand, mit der Seite sich mir zuwendend, in einer Entfernung von ungefähr anderthalbhundert Schritten vor mir. Ich machte Halt, schoß in die Schulter und bekam ihn durch diesen einzigen Schuß in meine Gewalt. Die Kugel hatte ihn hoch in das Schulterbatt getroffen und auf der Stelle gelähmt. Ich beschloß, eine kurze Zeit der Betrachtung dieses stattlichen Elefanten zu widmen, ehe ich ihm vollends den Rest gab. Es war in der That ein gewaltiger Anblick, den er mir bot. Ich fühlte mich als Herr der grenzenlosen Wälder, welche eine unaussprechlich edle und ansprechende Jagd ermöglichen. Nachdem ich den Elefanten eine Zeitlang bewundert, beschloß ich, einige Versuche anzustellen, um die verwundbarsten Punkte des Thieres kennen zu lernen. Ich näherte mich ihm auf ganz kurze Entfernung und feuerte mehrere Kugeln auf verschiedene Theile seines ungeheuren Schädels ab. Bei jedem Schusse neigte er gleichsam grüßend seinen Kopf nieder und berührte dann mit dem Rüssel seltsam und eigenthümlich sanft die Wunde. Ich war verwundert und wurde wirklich von Mitleid ergriffen, als ich sah, daß das edle Thier sein Schicksal, seine Leiden mit so würdevoller Fassung ertrug, und beschloß, der Sache so schnell als möglich ein Ende zu machen. Deshalb eröffnete ich nun das Feuer auf ihn an einer geeigneteren Stelle. Ich gab ihm nach einander sechs Schüsse aus meiner Doppelbüchse hinter die Schulter, welche zuletzt tödtlich sein mußten, im Anfänge aber keine unmittelbare Wirkung zur Folge zu haben schienen. Hierauf feuerte ich drei Kugeln aus dem holländischen Sechspfünder auf dieselbe Stelle. Jetzt rannen ihm große Thränen aus den Augen; er öffnete diese langsam und schloß sie wieder. Sein gewaltiger Leib zitterte krampfhaft; er neigte sich auf die Seite und verendete.«
Nun entschuldigt sich zwar der Mann damit, daß er diese Versuche bloß angestellt habe, um künftighin die Leiden anderer Elefanten abzukürzen: wir aber können diese Entschuldigung unmöglich gelten lassen, weil ein Elefantenjäger im voraus wissen muß, wohin er seine Geschosse zu richten hat. Auch gibt Gordon Cumming in seinem Buche so unzählige Beweise eines wilden und zwecklosen Blutdurstes, daß wir jene Entschuldigung sicherlich nur als ein Anerkenntnis seiner Roheit ansehen können. Wie unendlich hoch stand jener Elefant über dem Menschen, wie erbärmlich, wie niederträchtig zeigte sich der elende, heimtückische Feind dem herrlichen Geschöpfe gegenüber! Bei Gelegenheit einer anderen Elefantenjagd erzählt der Biedermann, daß er einem großen männlichen Thiere fünfunddreißig Schüsse gab, bevor es verendete. Die Jäger in Indien verfahren nicht besser: Tennent läßt dies deutlich genug merken. Sie sind ebenso schamlos, wie unsere Großen früher es waren, wenn sie Hunderte von edlen Thieren in einen engen Raum zusammentreiben ließen und sie dann von einem hohen Sitze aus niedermeuchelten. Die prahlenden Elefantenjäger Indiens haben einen guten Theil ihrer Beute in den Corrals oder Fangplätzen, welche wir bald kennen lernen werden, erlegt. Sie haben die in einem engen Raume eingepferchten Thiere kaltblütig niedergeschossen und dann verfaulen lassen, aus dem einfachen Grunde, um in ihr schändliches Jagdregister einige Zahlen mehr eintragen zu können. Sie haben Alte und Junge zusammengeschossen, ohne die Leichname nützen zu können. Zu solchen Scheuslichkeiten sind von den sogenannten gebildeten Völkern wahrhaftig nur Engländer fähig!
Grausam und unbarmherzig betreiben auch die Eingeborenen Innerafrikas die Jagd auf dieses edle Wild. Sie jagen noch heute, wie vor undenklichen Zeiten gejagt wurde. Schon Strabo erwähnt, daß die unfern Saba, also in den Steppen des Atbaragebietes, wohnenden »Elephantophagen« den riesigen Dickhäutern die Achillessehne mit dem Schwerte zerhauen, um sich ihrer zu bemächtigen; die Nomaden, welche die genannten Steppen durchziehen, verfahren noch heutigen Tages genau ebenso. Nackt auf dem Pferde sitzend, um möglichst wenig behindert zu sein, verfolgen sie die Elefanten einer Herde, versuchen diese zu sprengen, jagen, so schnell ihre Rosse laufen können, hinter dem auserkorenen Stücke her, gleichviel, ob dasselbe bergauf oder bergab, durch Schluchten, Wälder, Dornengestrüppe oder durch das Hochgras der Steppe seinen Weg nehme, ermüden es, greifen es mit der Lanze an und lenken es dadurch ab von dem Genossen, welcher die lähmenden Streiche ausführt. Baker, welcher längere Zeit in Gesellschaft dieser Leute jagte, vermeint, nicht Worte finden zu können, um die Gewandtheit und den Muth der Schwertjäger zu schildern. Ein von ihm auf einen Elefanten abgegebener Schuß hatte keine andere Wirkung gehabt, als das Thier in gesteigerter Eile zum Dickichte zu treiben. »In demselben Augenblicke aber«, so erzählt er, »sprengten, wettlaufenden Windhunden vergleichbar, die Schwertjäger über die sandige Fläche, schnitten dem Elefanten den Rückzug ab, wandten sich gegen ihn und traten ihm mit dem Schwerte in der Hand entgegen. Sofort nahm das wüthende Thier den Feind an, welcher nunmehr ebenso tapfer als thöricht zu Werke ging. Anstatt den Elefanten durch einen vor ihm flüchtenden Reiter zu beschäftigen, wie es sonst die Gewohnheit ist, sprangen alle Schwertjäger in einem Augenblicke vom Pferde und griffen das riesige Thier zu Fuße und im tiefen Sande an. Vom Standpunkte des Jägers kann es kein prachtvolleres und ohne Noth gefährlicheres Schauspiel geben als solches Gefecht, welches mit jedem Gladiatorenkampfe zu wetteifern vermocht haben würde. Der Elefant war in höchster Wuth und schien zu wissen, daß die Jäger auf seine Rückseite zu gelangen suchten, vermied daher mit großer Gewandtheit, sich eine Blöße zu geben, indem er sich mit äußerster Geschwindigkeit wie auf einem Zapfen drehte und einem seiner Angreifer nach dem anderen mit gesenktem Kopfe entgegentrat, gleichzeitig vor Wuth schreiend und mit dem Rüssel Wolken von Staub emporschleudernd. Die Schwertjäger wichen mit affenartiger Behendigkeit aus, obwohl die Tiefe des Sandes für den Elefanten günstig, für sie aber so hinderlich war, daß sie den Angriffen des Thieres nur mit der höchsten Anstrengung zu entgehen vermochten. Bloß dem entschlossenen Muthe aller drei war es zu danken, daß sie einander abwechselnd retteten, indem sie, sobald der Elefant einen von ihnen angriff, selbander von der Seite hervorsprangen und dadurch ihren Gegner zwangen, gegen sie kehrt zu machen.« So treiben sie ihr Spiel, bis es einem von ihnen gelingt, mit einem Schwerthiebe die Achillessehne des Elefanten zu durchhauen, bringen diesen dadurch zu Falle und tödten ihn nunmehr ohne Mühe mit weiteren Schwertstreichen.
Die Neger des oberen Nilgebietes legen, wie Heuglin und Schweinfurth uns schildern, auf den zur Tränke führenden Wechseln tiefe Gruben an, welche sich nach unten kegelförmig verengen und zuweilen noch mit starken, spitzigen Pfählen versehen werden, bedecken sie oben sehr sorgfältig, damit sie der vorsichtige Elefant womöglich nicht bemerke, werfen auch, um der Straße den Anschein größter Sicherheit zu verleihen, gesammelte Losung auf die dünne Decke, welche die Grube trügerisch verbirgt, wie vorher auf den Wechsel, welchen sie durch Verhaue zu einem fast unvermeidlichen umzugestalten suchen. Wo die Gegend es gestattet, hebt man in engen Thälern solche Gruben aus und treibt sodann die Elefanten aus einem weiten Umkreise zusammen, so daß sie ihren Weg durch das gefährliche Thal nehmen und in die Fallgruben, welche sie in der Eile der Flucht leicht übersehen, stürzen müssen. Ein anderes Verfahren besteht darin, an begangenen Wechseln auf Bäumen, deren Laub als Lieblingsnahrung der Thiere bekannt ist, anzustehen und dem unten vorübergehenden Elefanten eine meterlange, breite, scharfgeschliffene, am Ende des kurzen Schaftes mit einem Klumpen aus Thon beschwerte Lanze zwischen die Schultern zu schleudern. Die erdige Masse fällt bei der ersten Bewegung des verwundeten Wildes ab, die eingedrungene Lanze wühlt sich durch Reiben und die schwingende Bewegung des schweren Schaftes tiefer in die Wunde ein und bewirkt bald das Verenden des Schlachtopfers, dessen Sterbebett binnen kurzem durch die in hoher Luft kreisenden Geier angezeigt wird. Im Westen Afrikas flechten die Neger, laut Du Chaillu, Schlingpflanzen netzartig zusammen, jagen dann die Elefanten nach den so eingezäunten Stellen des Waldes hin, verfolgen sie und schleudern, wenn die Thiere unschlüssig vor den verschlungenen Ranken stehen bleiben, Hunderte von Lanzen in den Leib der stärksten und größten, bis sie zusammenbrechen. Die Niamniam schonen einzelne mit vier bis fünf Meter hohem Grase bewachsene Stellen der Steppe vor dem vernichtenden Feuer, bis sich Elefanten zeigen, rufen durch weittönende, in jedem Dorfe wiederholte Schläge ihrer Kriegs- und Lärmtrommeln binnen wenigen Stunden tausende von Jägern zusammen, umstellen Geviertmeilen und mehr, treiben die Elefanten in den Deckung versprechenden Grashorst, zünden diesen an und scheuchen die geängstigten Thiere, welche irgendwo durchzubrechen versuchen, mittels Lanzenstichen und Feuerbränden wieder in das Grasdickicht, in welchem ihnen die lodernde Flamme, der erstickende Rauch oder ein Gnadenstoß mit der Lanze unmittelbar Verderben und Tod bereiten. Herzerschütternd ist das Benehmen und Gebaren der edlen Geschöpfe in ihrer Todesnoth. Heuglin erfuhr von den Schwarzen, daß die der tückischen Fallgrube glücklich entronnenen Elefanten sich nach Kräften bemühen, um einen in die Tiefe gestürzten Genossen zu befreien, indem sie mit ihren Stoßzähnen die Erde um die Grube aufwühlen und letztere nach und nach auszufüllen versuchen, ja selbst den Rüssel zu Hülfe nehmen, und dem Gefangenen bei seinen Bestrebungen, zu entrinnen, Unterstützung gewähren; Schweinfurth schildert nach eigenen Wahrnehmungen, wie die von den Flammen bedrohten edlen Thiere, wenn ihnen ein Entweichen nicht mehr möglich scheint, um die Jungen sich scharen, dieselben mit Gras bedecken, mit ihren Rüsseln Wasser auf sie pumpen, um wenigstens sie zu retten, bis die treuen Eltern endlich, selbst von Rauch und Hitze betäubt, infolge erlittener Brandwunden ohnmächtig zusammenbrechen und dem grausamsten Schicksale erliegen.
Elefantenjäger von Fach gehen ihrem Wilde im freien Walde nach und erlegen es, um das Elfenbein zu gewinnen. Eingeborene, welche die Gewehre tragen, spüren die Elefanten aus. Der Jäger nähert sich so weit als möglich und feuert aus weitläufiger Büchse eine Kugel unmittelbar hinter dem Ohr in den Schädel. Gute Schützen brauchen selten noch den zweiten Lauf ihres Gewehres, und oft schon haben einzelne Jäger mit jedem Laufe der Büchse einen Elefanten erlegt. Die Gefahr ist nicht so groß, als sie scheinen mag. Allerdings kommt es vor, daß gereizte Elefanten auf ihre Verderber sich stürzen, und einzelne von diesen haben auch wirklich ihr Leben unter den Fußtritten der Waldriesen ausgehaucht; drei Viertheile aber von denen, welche angegriffen wurden, konnten sich noch retten, selbst wenn sie sozusagen schon zwischen den Füßen lagen. Die Furchtsamkeit des Dickhäuters siegt bald wieder über seine Erregung, und nur höchst selten geschieht es, daß ein verwundeter Elefant seinen Feind so weit verfolgt, wie nach Tennents Bericht einmal ein Rogues einen Indier, welcher bereits die Stadt erreicht hatte, aber auf dem Basare noch von dem wüthenden Elefanten eingeholt und zerstampft wurde. Auch in Afrika kommt selten ein Unglück vor, obgleich die dort wirkenden Elefantenjäger meist erbärmliche Schützen sind und der gereizte Fihl durchaus nicht unterschätzt werden darf. Rasch und entschieden, jedes Hindernis verachtend, stürzt sich, laut Heuglin, das wüthend gewordene Geschöpf zuweilen auf seinen Angreifer, verfolgt diesen jedoch selten weit, sondern begnügt sich, ihn in die Flucht geschlagen zu haben und Herr des Feldes geblieben zu sein. Ungeachtet solcher Mäßigung vermeidet jedermann so viel als möglich, es bis zu einem Angriffe seitens des Elefanten kommen zu lassen; denn dieser macht, wenn er wirklich in Zorn geräth, auch abgesehen von der Masse, unter welcher der Boden dröhnt, einen unauslöschlichen Eindruck auf den Menschen. Den Rüssel hochgehoben, die riesigen Ohren etwas gelüftet, den kurzen, borstigen Schweif in Kreisen schwingend, stürzt er sich wild brausend auf seinen Feind; sein Vordertheil scheint zu wachsen, jedenfalls viel mächtiger und höher zu sein als je; an seinem Hintergestelle treten die langen Hautfalten schlotternd heraus; die gewaltige Masse schiebt sich rasch und unaufhaltsam vor; Schnauben des Zornes wechselt mit Wuthschreien, von denen ein Ohr, welches solche Laute niemals vernommen, keine Vorstellung gewinnen kann. Wenn unter solchen Umständen der erboste Riese seinen Gegner erreicht, ist dieser verloren, gerechter Rache unrettbar verfallen.
Weit anziehender und menschlicher als alle Jagd ist die Art und Weise, wilde Elefanten lebend in seine Gewalt zu bekommen, um sie zu zähmen. Hier gilt es, sehr kluge Thiere doch noch zu überlisten, Wildlinge dem Dienste des Menschen zu unterwerfen. Die Indier sind gegenwärtig die Meister in dieser Kunst. Unter ihnen gibt es eine förmliche Zunft von Elefantenfängern, in welcher das Gewerbe vom Vater auf den Sohn forterbt. Die Kunstfertigkeit, List, Vorsicht und Kühnheit, mit welcher diese Leute zu Werke gehen, sind wahrhaft bewunderungswürdig. Ihrer zwei gehen in den Wald hinaus und fangen einen Elefanten aus seiner Familie heraus!
Die besten Elefantenfänger auf Ceilon, Panikis genannt, bewohnen die maurischen Dörfer im Norden und Nordwesten der Insel und stehen schon seit mehreren hundert Jahren in hohem Ansehen. Nach vererbter Gewohnheit folgen sie der Fährte eines Elefanten, wie ein guter Hund der Spur eines Hirsches folgt, bestimmen im voraus an gerechten und vollkommenen Jägerzeichen, wie stark die Herde, wie hoch die größten und wie niedrig die kleinsten Elefanten sind; für europäische Augen unmerkliche Spuren bilden für sie deutlich geschriebene Blätter eines ihnen verständlichen Buches. Ihr Muth steht mit ihrer Klugheit im Einklange; sie verstehen es, den Elefanten zu leiten, wie sie wollen, setzen ihn in Angst, in Wuth, wie es ihnen eben erwünscht ist. Ihre einzige Waffe besteht in einer festen und dehnbaren Schlinge aus Hirsch- oder Büffelhaut, welche sie, wenn sie allein zum Fange ausziehen, dem von ihnen bestimmten Elefanten um den Fuß werfen. Dies geschieht, indem sie ihm unhörbaren Schrittes auf seinem Wege folgen und im günstigen Augenblicke ihn fesseln oder selbst, wenn er ruhig steht, ihm die Schlinge zwischen beiden Beinen festlegen. Wie sie es anstellen, unbemerkt an das furchtsame Thier heranzukommen, ist und bleibt ein Räthsel. Und während der eine die Schlinge um den Fuß legt, befestigt sie der andere bereits an einem Baume; und sollte kein solcher in der Nähe sein, so erzürnt der eine den Elefanten und lockt ihn nach einer Baumgruppe hin, um deren stärksten Stamm dann der andere den Strick anbindet und dadurch die Verfolgung endet.
Der gefangene Elefant ist rasend; aber die Fänger wissen ihm zu begegnen. Sie kennen ihn genau und zähmen ihn in verhältnismäßig kurzer Zeit. Zuerst gebrauchen sie hellbrennendes Feuer, Rauch und andere Mittel, um ihn zu schrecken; hierauf lassen sie ihn hungern und dursten, gönnen ihm keine Ruhe, ängstigen und matten ihn ab; sodann ändern sie ihr Betragen und erweisen ihm nur liebes und gutes. So gelingt es ihnen nach wenig Monaten, ihren anfangs tobenden Zögling zu einem ihrem Willen unterwürfigen Geschöpfe umzuwandeln. Ein Europäer ist, weil er alles verderben würde, nicht im Stande, diesen Leuten auf derartigen Zügen zu folgen, muß sich also mit Hörensagen begnügen, kann dafür aber um so eher an den großartigen Treiben theilnehmen, welche unter Umständen Hunderte von Elefanten auf einmal in die Gewalt des Menschen bringen. Einen solchen Elefantenfang hat Tennent in so anziehender und ausführlicher Weise beschrieben, daß ich nichts besseres thun kann, als seine Erzählung, wenn auch theilweise im Auszuge, so doch möglichst mit seinen eigenen Worten, hier wiederzugeben.
»An einer kühlen und angenehmen Stelle des Waldes fanden wir die luftigen Wohnungen, welche für uns in der Nähe des Corral (Fangraumes) hergestellt worden waren. Man hatte Hütten aus Zweigen erbaut und mit Palmblättern und Gras bedeckt; man hatte einen hübschen Saal zum Speisezimmer errichtet, Küchen, Ställe erbaut und nach besten Kräften für unsere Bequemlichkeit gesorgt. Dies alles war von den Eingeborenen im Laufe weniger Tage ausgeführt worden.
»Früher wurde die mit der Elefantenjagd nothwendig verbundene Arbeit zwangsweise von den Eingeborenen verrichtet; denn dies gehörte mit zu den Frohndiensten, welche das Volk seinen Herrschern zu leisten hatte. Die Holländer und Portugiesen verlangten diese Dienste, ebenso die britische Regierung, bis die Frohnen im Jahre 1832 abgeschafft wurden. Es wurden damals fünfzehnhundert bis zweitausend Männer unter der Leitung eines Oberen beschäftigt. Sie hatten den Corral zu bauen, die Elefanten zusammenzutreiben, die Kette von Wachfeuern und Wächtern zu unterhalten und überhaupt alle mühsamen Verrichtungen des Fanges auszuführen. Seit der Abschaffung der Frohnen ist es nicht schwer gewesen, die freiwillige Mitwirkung der Eingeborenen bei diesen Unternehmungen zu erlangen. Die Regierung bezahlt denjenigen Theil der Vorbereitungen, welcher wirkliche Kosten mit sich bringt: die geschickte Arbeit, welche auf die Errichtung des Corral und seines Zubehörs verwendet wird, die Anschaffung von Speeren, Seilen, Waffen, Flöten, Trommeln, Schießgewehren und andere nothwendige Erfordernisse.
»Zum Fange wählt man die Zeit des Jahres, welche dem Anbau der Reisfelder am wenigsten Eintrag thut, die Zeit zwischen der Aussaat und der Ernte. Das Volk selbst hat, ganz abgesehen von der Aufregung und dem Genusse der Jagd, seinen eigenen Vortheil dabei, die Anzahl der Elefanten zu vermindern, da diese ihren Gärten und ihren aufwachsenden Ernten ernsten Schaden zufügen. Auch die Priester ermuthigen zu dieser Jagd, weil die Elefanten einen heiligen Baum, dessen Blätter sie außerordentlich lieben, oft vernichten, und jene außerdem wünschen, auf leichte Weise Elefanten zum Tempeldienste zu erhalten. Die Häuptlinge endlich suchen ihren Stolz darin, die Menge ihrer Untergebenen im Felde zur Schau zu stellen wie auch die Leistungen der zahmen Elefanten, welche sie für das Jagdgeschäft darleihen, zu zeigen. Eine große Anzahl von Bauern findet willkommene Arbeit auf viele Wochen; denn sie haben die Pfähle zu pflanzen, Pfade durch das Sumpfrohr auszuhauen und die Treiber abzulösen, von denen die Elefanten umringt und herangetrieben werden sollen.
«Zur Jagd selbst wählt man einen Platz, welcher an einer alten und viel betretenen, zur Weide oder zur Tränke führenden Straße der Thiere liegt; namentlich die Nähe eines Stromes ist unerläßlich, nicht nur, um den Elefanten den nöthigen Wasservorrath zu bieten, während man sie der Umzäunung zu nähern sucht, sondern auch, um ihnen nach dem Fange während des Zähmungsverfahrens eine Gelegenheit zum Baden und zum Abkühlen verschaffen zu können. Bei der Errichtung des Corral vermeidet man es sorgfältig, die Bäume oder das Unterholz innerhalb des eingeschlossenen Raumes, insbesondere auf der Seite, von welcher die Elefanten kommen sollen, zu vernichten, da es ein wesentliches Erfordernis ist, ihnen die Einpfählung soviel als möglich durch das dichte Laub zu verbergen.
»Die zum Baue verwendeten Stämme, welche 20 bis 25 Centim. im Durchmesser haben, bringt man etwa einen Meter tief in die Erde, so daß noch vier bis fünf Meter über dem Boden sich erheben. Zwischen jedem Paar Pfählen bleibt Raum genug, daß ein Mann hindurchschlüpfen kann. An diese so aufgerichteten Säulen befestigt man mit biegsamen Schlingpflanzen oder mit Rohr Querbalken, und das Ganze wird dann noch durch Gabeln gestützt, welche die Querbalken halten und verhindern, daß das Pfahlwerk durch einen Anprall der wilden Elefanten nach außen gedrängt werde. Der also eingeschlossene Platz, welchen ich im Sinne habe, war ungefähr anderthalbhundert Meter lang und halb so breit. An dem einen Ende hatte man einen Eingang offen gelassen, welcher jeden Augenblick durch Schiebebalken verschlossen werden konnte, und von jeder Ecke des Endes, wo die Elefanten herkommen sollten, zogen sich ebenfalls, sorgfältig von Bäumen verdeckt, zwei Linien derselben starken Einzäunung auf beiden Seiten hin. Wäre die Herde nicht durch den offen gelassenen Eingang hereingekommen, sondern rechts oder links abgeschweift, so würde sie hier ein Hindernis gefunden und sich genöthigt gesehen haben, die alte Richtung nach dem Eingange zu wieder einzuschlagen. Endlich waren auf einer Gruppe von Bäumen für die Gesellschaft des Statthalters Schaubühnen errichtet worden, welche die ganze Einfassung übersehen ließen, so daß man das Verfahren vom ersten Eintreten der Herde in die Einfassung bis zum Herausführen der gefangenen Elefanten bequem beobachten konnte.
»Es scheint kaum nöthig zu bemerken, daß das eben beschriebene Pfahlwerk, so stark es auch ist, blutwenig nützen würde, wenn ein Elefant mit aller Kraft sich darauf stürzen wollte, und es sind auch wirklich manche Unfälle vorgekommen, indem die Herden durchbrachen. Man verläßt sich aber nicht sowohl auf den Widerstand der Einpfählung als auf die Schüchternheit der Gefangenen, welche ihre eigene Kraft nicht kennen oder nicht verwenden wollen, ebenso aber auch auf die Kühnheit und List der Fänger.
»Wenn der Corral fertig ist, beginnen die Treiber ihr Werk. Sie haben oft einen Umfang von vielen Meilen zu umstellen, damit die Anzahl der Elefanten ansehnlich genug werde, und die anzuwendende Vorsicht verlangt viel Geduld. In keinem Falle darf man die Elefanten beunruhigen; sonst möchten sie leicht die entgegengesetzte Richtung einschlagen. Die Thiere sind äußerst friedlich und wünschen nur in Stille und Sicherheit zu weiden; vor der geringsten Störung weichen sie zurück: dies muß man nun so benutzen, daß man sie gerade nur so viel beunruhigt, daß sie langsam in der gewünschten Richtung vorgehen. Auf diese Weise werden verschiedene Herden zusammen und Tag für Tag langsam weiter vorwärts dem Corral zugetrieben. Wird ihr Argwohn rege, zeigen sie Unruhe und Befürchtung, so ergreift man schärfere Maßregeln, um ihr Entkommen zu verhindern. Alle zehn Schritte wird rings um den Plan, in welchem man sie schon gesammelt hat, ein Feuer angezündet und Tag und Nacht unterhalten. Die Treiber steigen bis auf zwei- bis dreitausend; es werden Fußwege durch die Dschungeln hergestellt, um die ganze Linie in steter Verbindung zu erhalten. Die Führer üben eine ununterbrochene Aufsicht, damit ein jeder Treiber auf seinem Posten und aufmerksam ist; denn Nachlässigkeit an irgend einer Stelle der Linie könnte die ganze Herde entkommen lassen und in einem Augenblicke die mühevolle Arbeit von Wochen vernichten. Auf diese Weise wird jeder Versuch der Elefanten, rückwärts durchzubrechen, sogleich abgewiesen und, wo immer ein solcher droht, augenblicklich eine hinreichende Menge versammelt, um sie zurückzuscheuchen. Endlich werden die Thiere so dicht an die Einzäunung getrieben, daß sich der Treibergürtel an beiden Flügeln an das Ende des Corral anlehnt. Das Ganze bildet nun einen Umkreis von ziemlich einer Stunde, und man wartet nun bloß noch auf das Zeichen zum Schlußtreiben.
»Diese Vorbereitungen hatten zwei volle Monate in Anspruch genommen und waren eben vollendet, als wir ankamen und unseren Platz auf der oben erwähnten Schaubühne einnahmen, von welcher wir den Eingang zum Corral übersehen konnten. Dicht neben uns im Schatten lagerte eine Gruppe zahmer Elefanten, welche aus den Tempeln und von den Fürsten gesandt worden waren, um beim Fange der wilden zu helfen. Drei verschiedene Herden, zusammen vierzig bis fünfzig Elefanten, waren umzingelt und lagen im Dschungel unweit der Einpfählung verborgen. Jeder Laut wurde vermieden; man sprach nur flüsternd, und das Stillschweigen unter der ungeheuren Menge der Treiber war so streng, daß man hin und wieder die Zweige rascheln hörte, wenn einer der Elefanten die Blätter abstreifte.
»Plötzlich wurde das Zeichen gegeben und die Stille des Waldes von den Rufen der Wachen, dem Rasseln der Trommeln und dem Knattern der Gewehre unterbrochen. Man begann an dem entferntesten Punkte und trieb so die Elefanten immer näher, dem Eingange des Corral zu. Die Treiber entlang der Linie waren nur so lange still, bis die Herde an ihnen vorüber war: dann stimmten auch sie in das allgemeine Geschrei der anderen hinter ihnen nach Herzenslust ein. So wuchs das Getöse mit jedem Schritte der Herde. Diese suchte wiederholt die Linie zu durchbrechen, wurde aber durch Kreischen, Trommeln und Kleingewehrfeuer immer wieder zurückgeschlagen.
»Endlich zeigte das Knacken der Zweige und das Prasseln des Unterholzes die Näherkunft der Elefanten an. Ihr Führer brach aus dem Dschungel heraus und stürzte wild vorwärts bis auf dreißig Ellen Entfernung vom Eingange des Corral. Die ganze Herde folgte ihm: noch einen Augenblick, und alle wären in die offene Thür hineingestürzt, als sie plötzlich rechts umschwenkten und, trotz der Jäger und Treiber, ihrem früheren Platz im Dschungel wieder zueilten. Der oberste der Treiberaufseher kam hervor und erklärte ihren Durchbruch dadurch, daß ein wildes Schwein plötzlich von seinem Lager aufgestanden und dem Leitthiere der Herde über den Weg gelaufen sei. Er fügte hinzu, daß bei dem aufgeregten Zustande der Herde es der Wunsch der Jäger wäre, ihre letzte Anstrengung bis zum Abend zu verschieben, wo ihnen die Dunkelheit, die Feuer und die Fackeln um so mächtigere Gehülfen sein würden.
»Nach Sonnenuntergang wurde der Schauplatz außerordentlich fesselnd. Die niedrigen Feuer, welche im Sonnenlichte offenbar nur gedampft hatten, glühten wieder düster roth in der Dunkelheit und warfen ihren Schein über die Gruppen. Wirbelnd stieg der Rauch durch das reiche Laubwerk der Bäume. Die Scharen der Zuschauer beobachteten tiefe Stille. Kein Laut war hörbar als das Summen der Kerbthiere. Auf einmal brach wiederum das Rasseln einer Trommel und gleich darauf Gewehrfeuer durch die Stille. Dies war das Zeichen für den erneuten Angriff. Rufend und lärmend betraten die Jäger den Kreis. Trockene Blätter und Reiser wurden auf die Wachtfeuer geworfen, bis sie emporloderten und ringsum eine Flammenlinie bildeten; nur nach dem Corral zu wußte man aufs sorgfältigste die Dunkelheit zu bewahren. Dorthin begaben sich, durch das Getöse und das Gellen ihrer Verfolger hinter sich erschreckt, die Elefanten. Sie näherten sich mit rasender Eile, das Unterholz niedertretend und die trockenen Zweige zerknickend. Das leitende Thier erschien dem Corral gegenüber, hielt einen Augenblick inne, starrte wild um sich, stürzte dann über Hals und Kopf durch das offene Thor, und die ganze Herde folgte ihm nach. Der gesammte Umfang des Corral, welcher bis zu diesem Augenblicke in tiefste Dunkelheit gehüllt gewesen war, strahlte nun wie durch Zauberei plötzlich von tausend Lichtern wieder. Denn in dem Augenblicke, als die Elefanten eingetreten waren, rannte jeder Jäger mit einer Fackel herbei, welche er am nächsten Wachtfeuer angezündet hatte.
»Zuerst stürmten die Elefanten bis zum äußersten Ende der Einpfählung, stießen hier auf Widerstand, prallten zurück, um das Thor zu erreichen, und fanden dasselbe verschlossen. Ihr Schrecken war entsetzlich. Sie eilten mit reißend schnellen Schritten rings im Corral umher, sahen ihn aber nunmehr von Feuer umringt. Sie versuchten das Pfahlwerk zu durchbrechen, wurden jedoch mit Speeren und Fackeln zurückgetrieben: überall, wo sie sich näherten, kam ihnen Geschrei und Gewehrfeuer entgegen. Jetzt sammelten sie sich in eine einzige Gruppe, standen einen Augenblick in offenbarer Bestürzung still und traten dann in einer anderen Richtung auf, als ob ihnen plötzlich eine Stelle eingefallen wäre, welche sie vorher übersehen gehabt hätten. Immer wieder abgewiesen, kehrten sie langsam zu ihrem einsamen Ruheplatze inmitten des Corral zurück.
»Die Theilnahme an diesem außerordentlichen Schauspiele beschränkte sich nicht auf die Zuschauer, sondern erstreckte sich auch auf die außen aufgestellten zahmen Elefanten. Schon bei der ersten Annäherung der fliehenden Herde legten sie Achtsamkeit an den Tag; zwei besonders, welche vorn angebunden waren, bekundeten die höchste Aufregung, und als endlich die Herde in den Corral hineingebraust war, riß einer von diesen beiden sich los und stürzte den wilden nach, wobei er einen ziemlich ansehnlichen Baum, welcher ihm im Wege stand, umbrach.
»Länger als eine Stunde durchtrabten die Elefanten den Corral und griffen mit unermüdlicher Kraft die Pfähle an. Nach jedem fehlgeschlagenen Versuche trompeteten und kreischten sie vor Wuth. Wieder und wieder strebten sie, das Thor zu erstürmen, als ob sie wüßten, daß es einen Ausgang bieten müsse, da es ja doch zum Eingange gedient hatte; aber betäubt und verwirrt wichen sie immer zurück. Nach und nach wurden ihre Anstrengungen matter; nur einzelne Thiere noch rannten hier- und dorthin, kehrten jedoch bald bekümmert zu ihren Genossen zurück. Endlich bildete die ganze Herde, verdutzt und erschöpft, eine einzige Gruppe mit den Jungen in der Mitte, und so standen sie regungslos unter den düsteren Schatten der Bäume, mitten in dem Corral.
»Es wurden nun Anstalten getroffen, während der Nacht Wache zu halten. Die Anzahl der Wächter rund um die Einfriedigung wurde verstärkt und den Feuern frische Nahrung gegeben, damit sie bis Sonnenaufgang hoch emporflammten.
»Ursprünglich waren von den Treibern draußen drei Herden umstellt worden; aber mit eigenthümlicher Vorausahnung hatten die drei einander sich fern gehalten. Als das Schlußtreiben stattfand, war nur eine Herde in den Corral gekommen, weil die anderen beiden sich noch zurückhielten. Da nun das Thor augenblicklich hinter der ersten Abtheilung geschlossen werden mußte, so waren die beiden anderen natürlich ausgesperrt und blieben noch im Dschungel verborgen. Um ihr Entkommen zu hindern, wurden die Wachen an ihre früheren Plätze zurückbefehligt und die Feuer neu genährt. Nachdem so alle Vorsichtsmaßregeln getroffen waren, kehrten wir zurück, um die Nacht in unseren Häusern am Flusse zu verbringen. Diese waren nur etwa dreißig Schritte vom Corral entfernt, und so wurden wir in unserem ersten Schlafe oft von dem Lärm der Menge geweckt, welche im Walde lagerte, dann und wann auch von dem Geschrei, welches die Elefanten von einem plötzlichen Angriff auf die Einfriedigung zurückscheuchte. Bei Tagesanbruch aber fanden wir am Corral alles still und wachsam. Als die Sonne aufging, ließ man die Feuer ersterben. Die abgelösten Wächter schliefen nahe der großen Einzäunung; ringsum aber waren Männer und Knaben mit Speeren oder langen Ruthen aufgestellt, während die Elefanten drinnen in einer dicht gedrängten Gruppe zusammenstanden, nicht mehr ungestüm und stürmisch, sondern erschöpft, ruhig, gänzlich gebrochen durch Furcht und vor Erstaunen über alles, was um sie herum vorgegangen war. Nur ihrer neun waren bis jetzt gefangen worden, darunter zwei sehr große und zwei kleine, höchstens ein Paar Monate alte. Einer der großen war ein »Landstreicher«, welcher in keiner Verbindung mit der übrigen Herde stand, daher auch nicht in deren Kreis aufgenommen wurde, sondern nur in ihrer Nähe sich aufstellte.
»Draußen schickte man sich an, die zahmen Elefanten in den Corral zu führen, damit diese die Gefangenen fesseln möchten. Die hierzu erforderlichen Schlingen waren bereit. Behutsam zog man die Stämme weg, welche den Eingang geschlossen, und zwei abgerichtete Elefanten gingen leise hinein, jeder von seinem Führer und einem Diener geritten und mit einem starken Halsbande versehen, von welchem herab auf beiden Seiten Stricke aus Antilopenhaut mit einer Schlinge hingen. Zugleich mit ihnen und hinter ihnen verborgen, kam der Führer der Schlingenmänner hereingekrochen, begierig, die Ehre sich zu sichern, den ersten Elefanten fest zu machen. Es war ein behender, kleiner Mann, ungefähr siebzig Jahre alt, welcher sich in solchen Diensten bereits zwei silberne Spangen als Ehrenzeichen erworben hatte. Er wurde von einem wegen seines Muthes und seiner Geschicklichkeit gleich berühmten Sohne begleitet. Zwei der zehn gezähmten Elefanten waren das Eigenthum eines nahen Tempels, vier gehörten benachbarten Häuptlingen; die übrigen waren aus den Ställen der Regierung, so auch die beiden, welche jetzt den Corral betraten. Von den ersten beiden war einer erst das Jahr vorher gefangen worden und dennoch jetzt schon zum Fange anderer tauglich. Einer von den letzteren war von ungemeinem Alter und bereits im Dienste der holländischen und der englischen Regierung seit mehr denn einem Jahrhundert. Der andere, Namens Siribeddi, war etwa fünfzig Jahre alt und durch sanftes und gelehriges Wesen ausgezeichnet. Siribeddi war eine vollendete Sirene und ein solcher Fang ganz und gar nach ihrem Geschmacke. Geräuschlos betrat sie den Corral und ging mit schlauem Blick, aber anscheinend sehr gleichgültig, langsam vorwärts. Gemüthlich schlenderte sie in der Richtung nach den Gefangenen hin und blieb hin und wieder stehen, um ein wenig Gras oder einige Blätter im Vorbeigehen zu pflücken. Als sie den eingeschlossenen wilden Elefanten sich näherte, kamen diese ihr entgegen, und ihr Anführer strich sie sanft mit seinem Rüssel über den Kopf, wandte sich dann um und ging langsam zu seinen niedergeschlagenen Gefährten zurück. Siribeddi folgte ihm mit demselben gleichgültigen Schritte und stellte sich dicht hinter ihm auf, so daß der alte Mann unter ihr hinkriechen und seine Schlinge um den Hinterfuß des wilden Elefanten gleiten lassen konnte. Derselbe bemerkte augenblicklich seine Gefahr, schüttelte das Seil ab und wandte sich zum Angriffe gegen den Mann. Dieser würde auch seine Keckheit schwer gebüßt haben, hätte nicht Siribeddi ihn mit ihrem Rüssel beschützt und den Angreifer in die Mitte der Herde getrieben. Der Alte war nur leicht verwundet und verließ den Corral, während sein Sohn Raughanie seine Stelle einnahm. Die Herde stellte sich wieder in einen Kreis, die Köpfe nach der Mitte gerichtet. Zwei zahme Elefanten drängten sich keck zwischen sie und zwar so, daß sie das größte Männchen zwischen sich nahmen. Dieses leistete keinen Widerstand, zeigte aber doch sein Unbehagen dadurch an, daß es fortwährend einen Fuß um den anderen hob. Raughanie kroch jetzt herbei, hielt die Schleife, deren anderes Ende an das Halsband Siribeddi's befestigt war, mit beiden Händen offen und lauerte nun den Augenblick ab, in welchem der wilde Elefant seinen Hinterfuß erhob; endlich gelang es ihm, die Schlinge über das Bein zu bringen, er zog sie an und floh rückwärts. Die beiden zahmen Elefanten wichen augenblicklich zurück. Siribeddi spannte das Seil zur vollen Länge an, und während sie den Gefangenen von der Herde abzog, stellte sich der andere zwischen sie und die Herde, um jede Einmischung zu verhindern.
»Nun aber war der Gefangene an einem Baume zu fesseln und mußte deswegen dreißig oder vierzig Meter weit rückwärts gezogen werden, während er doch wüthend widerstand, unablässig voll Entsetzen brüllte, nach allen Seiten sprang und die kleineren Bäume wie Schilf zertrat. Siribeddi zog ihn stetig nach sich und wand das Seil, welches sie fortwährend in voller Spannung erhielt, um den geeigneten Baum. Schließlich schritt sie behutsam über das Seil hinweg, um es ein zweites Mal um den Stamm zu wickeln, wobei sie erklärlicherweise zwischen dem Baume und dem Elefanten durchzugehen hatte. Es war ihr aber nicht möglich gewesen, den Gefangenen dicht an den Baum zu fesseln, was doch nöthig war. Der zweite zahme, welcher die Schwierigkeit bemerkte, kam ihr zu Hülfe, und Schulter an Schulter, Kopf an Kopf drängte er den Gefangenen rückwärts, während Siribeddi bei jedem seiner Schritte das schlaff gewordene Seil anzog, bis er richtig am Fuße des Baumes fest stand. Dann wurde er von dem Fänger festgemacht, hierauf eine zweite Schlinge um das andere Hinterbein gelegt und so wie die erste am Baume befestigt. Endlich wurden beide Beine mit geschmeidigeren Stricken zusammengefesselt, um Wunden und Eiterung möglichst zu verhüten.
»Wiederum stellten sich nun die beiden Fängerelefanten wie zuvor neben den Wildling, so daß Raughanie unter ihrem Leibe hervor seine Schlingen auch um dessen beide Vorderfüße befestigen konnte. Nachdem er dann auch diese Seile an einen hervorstehenden Baum gebunden hatte, war der Fang vollständig, und die zahmen Elefanten wie die Wärter verließen ihr Opfer, um es mit einem anderen Gliede der Herde zu versuchen. Solange die beiden zahmen neben ihm gestanden hatten, blieb der Gefangene verhältnismäßig ruhig und fast widerstandlos stehen; in dem Augenblicke, als sie weggingen und er ganz allein gelassen war, begann er die erstaunlichsten Anstrengungen, um sich frei zu machen und wieder zu seinen Gefährten zu kommen. Er befühlte die Stricke mit seinem Rüssel und versuchte die unzähligen Knoten aufzuknüpfen; er zog nach hinten, um seine Vorderfüße zu befreien; er lehnte sich vorwärts, um die Hinterbeine los zu bekommen, so daß jeder Ast des großen Baumes erzitterte; er kreischte in seiner Angst und erhob den Rüssel hoch in die Luft; er legte sich seitwärts mit dem Kopfe auf den Boden und preßte seinen zusammengebogenen Rüssel, als ob er ihn in die Erde stoßen wollte; er sprang plötzlich wieder auf und erhob sich auf Kopf und Vorderbeinen frei in die Höhe. Dieses traurige Schauspiel währte mehrere Stunden. Er hielt mitunter, offenbar vor sich hinbrütend, inne, erneuerte dann plötzlich die Anstrengungen, gab sie aber zuletzt hoffnungslos auf und stand nun vollkommen regungslos, ein Bild der Erschöpfung und Verzweiflung. Unterdessen stellte sich Raughanie vor der Schaubühne des Statthalters auf, um die gewohnte Belohnung für das Fesseln des ersten Elefanten in Empfang zu nehmen. Ein Platzregen von Rupien belohnte ihn, und aufs neue ging er an sein gefährliches Amt.
»Die Herde stand in einer gedrängten Masse mürrisch und unruhig. Mitunter trieb den einen oder den anderen die Ungeduld, ein paar Schritte zu thun und Umschau zu halten; dann folgten die anderen, erst langsam, hierauf schneller, und zuletzt stürmte die ganze Herde wüthend zum erneuten Angriffe auf das Pfahlwerk. Diese erfolglosen Anläufe waren ebenso großartig wie erheiternd: die Anstrengung der riesigen Kraft ihrer gewaltigen Glieder, gepaart mit dem fast lächerlichen Wackeln ihres schwerfälligen Schrittes und der Wuth ihrer anscheinend unwiderstehlichen Angriffe verwandelte sich einen Augenblick später in einen furchtsamen Rückzug. Sie stürzten wie toll längs der Einfriedigung hinunter, den Rücken gekrümmt, den Schwanz gestelzt, die Ohren ausgebreitet, den Rüssel hoch über den Kopf erhoben, schrillend, trompetend und kreischend: und blieben, obgleich ein Schritt mehr das Pfahlwerk zu Trümmern zerschmettert haben würde, plötzlich vor einigen weißen Stäbchen stehen, welche ihnen durch das Gitter entgegengestreckt wurden! Und wenn sie dann das verhöhnende Geschrei der Menge draußen vernahmen, verschwanden sie, vollständig aus der Fassung gebracht, durchkreisten den Corral ein- oder ein paarmal und gingen wieder langsam an ihren Standplatz im Schatten. Die Wächter, welche namentlich aus Knaben und jungen Männern bestanden, legten aber auch wirklich eine erstaunliche Ausdauer und Unermüdlichkeit an den Tag. Immer wieder stürzten sie nach dem Punkte hin, welcher von den Elefanten bedroht schien, und hielten den Rüsseln ihre Stäbe entgegen, wobei ihr ununterbrochenes Geschrei: »Huub, Huub« ertönte und die Thiere unabänderlich in die Flucht trieb.
»Das zweite von der Herde getrennte Opfer, ein weiblicher Elefant, wurde auf dieselbe Weise festgemacht wie das erste. Als dieses Thier die Schlinge an dem Vorderfuße fühlte, ergriff es sie mit seinem Rüssel, und es gelang ihm, sie in den Mund zu bringen, wo sie sich schleunigst getrennt haben würde, hätte nicht ein zahmer Elefant seinen Fuß auf das Seil gesetzt und so die Schlinge niedergedrückt und seinen Kinnladen entrissen. Die Fänger wählten nun immer zunächst dasjenige Thier, welches bei den nachfolgenden Angriffen auf die Einpfählung die Führerschaft übernommen hatte, und der Fang eines jeden erforderte durchschnittlich nicht mehr als dreiviertel Stunden.
»Höchst merkwürdig war, daß die wilden Elefanten keinen Versuch wagten, die Leiter, welche auf den zahmen Thieren ritten, anzugreifen oder herunterzuziehen. Diese ritten gerade mitten in die Herde hinein, aber kein Elefant machte auch nur Miene, sie zu belästigen.« Major Skinner sagt: »Es scheint mir, daß man in einem Corral vollständig vor den Angriffen der wilden gesichert ist, sobald man auf einem zahmen Elefanten sitzt. Ich sah einst den alten Häuptling Mollegadde in eine Herde von Wildlingen hineinreiten, und zwar auf einem so kleinen Elefanten, daß der Kopf des Häuptlings in gleicher Höhe mit dem Rücken der wilden Thiere war. Ich war sehr besorgt um den Mann, dieser aber blieb ohne alle Belästigung.«
»Da der Herde,« fährt Tennent fort, »alle ihre Führer nach einander weggefangen wurden, so wuchs die Aufregung der anderen immer mehr. Wie groß aber auch ihre Theilnahme für die verlorenen Gefährten sein mochte: sie wagten doch nicht, zu den Bäumen zu folgen, an denen diese angebunden waren. Wenn sie an ihnen vorüberkamen, blieben sie manchmal stehen, umschlangen einander mit dem Rüssel, leckten sich an Hals und Gliedern und legten die rührendste Trauer über ihre Gefangenschaft an den Tag, machten aber keinen Versuch, die fesselnden Seile zu lösen. Die Verschiedenheit des Wesens der einzelnen Thiere bekundete sich deutlich in ihrem Benehmen. Einige ergaben sich mit verhältnismäßig geringem Widerstande, andere warfen sich in ihrer Wuth mit solcher Gewalt zu Boden, daß jedes andere schwächere Thier dabei den Tod gefunden haben würde. Sie ließen ihren Zorn an jedem Baume, an jeder Pflanze aus, welche sie erreichen konnten. War sie klein genug, um niedergerissen zu werden, so machten sie dieselbe mit ihrem Rüssel dem Boden gleich, streiften die Blätter und Zweige ab und streuten diese wild nach allen Seiten über ihre Köpfe hin. Einige gaben keinen Laut von sich, während andere wüthend trompeteten und brüllten, dann wohl ein kurzes, krampfhaftes Gekreisch ausstießen und zuletzt erschöpft und hoffnungslos nur noch dumpf und kläglich stöhnten. Manche blieben nach einigen heftigen Versuchen regungslos auf dem Boden liegen, und nur die Thränen, welche unaufhörlich aus ihren Augen flossen, sprachen aus, was sie duldeten; andere machten in der Kraft ihrer Wuth die erstaunlichsten Windungen und Verrenkungen, und uns, die wir bei dem unbehülflichen Körper des Elefanten unbedingt an Steifheit denken, erschienen die Stellungen, in welche sie sich drängten, geradezu unglaublich. Ich sah einen liegen, welcher die Wangen gegen die Erde drückte und die Vorderfüße vor sich hingestreckt hatte, während der Körper so herumgebogen war, daß die Hinterfüße nach der entgegengesetzten Seite hinausragten.
»Es war höchst wunderbar, daß ihre Rüssel, welche sie doch gewaltig nach allen Seiten schleuderten, nicht verletzt wurden. Einer wand den seinigen so, daß er einem gekrümmten riesigen Wurme ähnlich sah, zog ihn mit rastloser Schnelligkeit ein und stieß ihn aus, legte ihn, wie eine Uhrfeder, zusammen und schoß ihn dann plötzlich wieder in voller Länge vor; ein anderer, welcher sonst ganz regungslos dalag, schlug langsam den Boden mit der Spitze seines Rüssels, wie ein Mann in Verzweiflung wohl mit der flachen Hand auf sein Knie schlägt. Die Empfindlichkeit ihres Fußes war bei so plumpen Verhältnissen und einer solchen Dicke der Haut äußerst auffallend. Die Fänger konnten sie jeden Augenblick dazu zwingen, den Fuß zu heben, sobald sie nur mit einem Blatte oder Zweige kitzelten. Die Anlegung der Schlinge bemerkte das Thier augenblicklich, und wenn es dieselbe mit dem Rüssel erreichen konnte, näherte es den anderen Fuß, um sie womöglich abzustreifen.
»Eins war fast bei allen zu bemerken: sie zertrampelten den Boden mit ihren Vorderfüßen, nahmen mit einer Wendung des Rüssels die trockene Erde oder den Sand auf und bestreuten sich damit geschickt über und über. Dann führten sie die Spitze des Rüssels in den Mund und entnahmen diesem Wasser, welches sie über ihren Rücken ausgossen; dies wiederholten sie so oft, bis der Staub gewöhnlich durchnäßt war. Ich verwunderte mich über die Menge Wasser, welche sie dazu verwendeten; denn sie bekleideten sich förmlich mit einem dünnen Schlammmantel und hatten nun doch seit vierundzwanzig Stunden keinen Zugang zur Tränke gehabt, waren außerdem auch von Kampf und Schrecken erschöpft. Man kann sich danach denken, welchen Vorrath von Feuchtigkeit der an seinen Magen angefügte Behälter auffassen kann.
»Wirklich bewundernswerth war das Benehmen der zahmen Elefanten. Sie bewiesen das vollkommenste Verständnis jeder Bewegung, des erstrebten Zieles und der Mittel, es zu erreichen. Offenbar bereitete ihnen der Fang Vergnügen. Es war keine böse Stimmung, kein Uebelwollen in ihnen: sie schienen die ganze Sache als einen angenehmen Zeitvertreib zu betrachten. Ebenso merkwürdig wie ihre Klugheit war aber auch ihre Vorsicht, Uebereilung oder Verwirrung war niemals zu bemerken. Nie verwickelten sie sich in die Seile, nie kamen sie den gefesselten in den Weg, und mitten in den heftigsten Kämpfen, wenn sie über die gefangenen wegzusteigen hatten, traten sie weder auf diese, noch fügten sie ihnen das geringste Leid zu, suchten vielmehr aus freien Stücken jede Schwierigkeit oder Gefahr für dieselben zu beseitigen. Mehr als einmal, wenn ein wilder seinen Rüssel ausstreckte, um das Seil aufzufangen, welches um sein Bein gewickelt werden sollte, schob Siribeddi den Rüssel schnell bei Seite. Ein Elefant, welcher schon an einem Fuße gefesselt war, setzte den anderen immer weislich fest auf den Boden, so oft man versuchte, die Schlinge darum zu legen. Da lauerte Siribeddi die Gelegenheit ab, als jener den Fuß wieder erhob, schob geschwind ihr eigenes Bein darunter und hielt es in die Höhe, bis die Schlinge angelegt und zugezogen war. Es schien fast, als ob die zahmen mit der Furcht der wilden ihr Spiel trieben und ihren Widerstand verspotteten. Drängten die wilden sich rückwärts, so schoben sie dieselben vorwärts; wollten jene erzürnt eine andere Richtung einschlagen, so trieben die zahmen sie zurück. Warfen sie sich nieder, so stemmte sich ein zahmer mit Kopf und Schulter dagegen und zwang sie wieder in die Höhe. War es aber nöthig, sie niederzuhalten, so kniete er auf sie und hielt sie nieder, bis die Seile fest gemacht waren. Nur der Fänger, welcher besonders gute Dienste leistete, und vor dem sich die wilde Herde ganz vorzüglich zu fürchten schien, hatte Stoßzähne, brauchte sie aber durchaus nicht zum Verwunden, sondern bahnte sich mit ihnen zwischen zwei Elefanten, wo er den Kopf nicht hätte hineinbringen können, einen Weg und benutzte seine Zähne außerdem, die Gefallenen oder Widerspenstigen mit größerer Bequemlicheit aufzuheben. Mehrere Male, als die Vermittelung der anderen zahmen Elefanten nicht genügte, um einen wilden zur Ordnung zu bringen, schien die bloße Annäherung dieses Stoßzahnträgers Furcht einzuflößen und Unterwürfigkeit zu erzwingen.
»Vielleicht wurde der Muth und die Geschicklichkeit der Menschen durch die überraschenden Eigenschaften der zahmen Elefanten in den Schatten gestellt. Gewiß besaßen die ersteren ein schnelles Auge, welches die geringste Bewegung des Elefanten erlauerte, und großes Geschick, die Schlingen überzuwerfen und rasch zu befestigen; jedoch genossen sie dabei stets den Schutz der zahmen Elefanten, ohne welchen auch die kühnsten und geschicktesten Jäger in einem Corral nichts ausrichten würden.
»Von den beiden jungen Elefanten war der eine etwa zehn Monate alt, der andere etwas älter. Der kleinere mit seinem kolbigen Kopfe und wolligen, braunen Haaren war die belustigendste und anziehendste Taschenausgabe eines Elefanten, welche man sich denken kann. Bei jedem Angriffe auf die Einfriedigung trabten beide Jungen der Herde nach. Standen die anderen ruhig, so liefen sie den älteren zwischen den Beinen umher. Als die Mutter des jüngsten gefangen wurde, hielt sich das kleine Geschöpf neben ihr, bis sie dicht an den verhängnisvollen Baum gezogen worden war. Anfangs waren die Fänger von seinem Aerger mehr belustigt; bald aber fanden sie, daß es durchaus nicht zugab, wie seiner Mutter die zweite Schlinge angelegt werden sollte. Es lief herbei, griff nach dem Seile, stieß und schlug die Männer mit seinem Rüssel und mußte endlich zur Herde zurückgetrieben werden. Langsam, fortwährend brüllend und bei jedem Schritte sich umsehend, zog es sich zurück, gesellte sich sodann zu dem größten Weibchen, welches noch unter der Herde war, und stellte sich zwischen dessen Vorderfüße, während dieses es mit seinem Rüssel liebkoste und ihm zuzureden schien. Hier blieb es stöhnend und wehklagend, bis die Fänger seine gefesselte Mutter sich selbst überlassen hatten. Dann kehrte es augenblicklich zu dieser zurück. Da es aber wieder störend auftrat und jeden Vorbeigehenden angriff, wurde es endlich nebst dem anderen Jungen an einen nahen Baum gebunden. Letzteres hatte sich übrigens beim Fange seiner Mutter ganz ebenso benommen. Die beiden Jungen waren die lustigsten der ganzen Gesellschaft. Ihr Geschrei nahm kein Ende, und jeden, welcher in ihre Nähe kam, suchten sie zu packen. Ihre Wendungen erregten wegen der Geschmeidigkeit ihres Körpers besonderes Erstaunen. Das Belustigendste war, daß die kleinen Burschen mitten in all ihrer Noth und Betrübnis doch alles Eßbare, was ihnen vorgeworfen wurde, schleunigst ergriffen und dann gleichzeitig brüllten und fraßen.
»Unter den letzten, welche eingefangen wurden, befand sich auch der Landstreicher. Obgleich er viel wilder war als die anderen, verband er sich doch nicht mit ihnen zum Angriffe gegen die Einfriedigung, da sie ihn einmüthig von sich trieben und ihn nicht in ihren Kreis aufnahmen. Als er neben einem seiner Unglücksgefährten vorbeigeschleppt wurde, stürzte er auf ihn zu und suchte ihn mit seinen Zähnen zu durchbohren. Dies war auch das einzige Beispiel von Böswilligkeit, welches sich während dieses Vorfalls im Corral zeigte. Als er überwältigt war, zeigte er sich erst lärmend und ungestüm, legte sich aber bald friedlich nieder, ein Zeichen, wie die Jäger sagten, daß sein Ende nahe war. Etwa zwölf Stunden lang deckte er sich noch ununterbrochen mit Staub, wie die anderen, und befeuchtete diesen mit Wasser aus seinem Rüssel; endlich aber lag er erschöpft da und starb so ruhig, daß der Eintritt des Todes nur durch das Heer von schwarzen Fliegen bemerklich wurde, von welchem sein Körper fast augenblicklich bedeckt wurde, obschon wenige Minuten vorher nicht eine sichtbar gewesen. Der Leichnam wurde losgebunden, und zwei zahme Elefanten zogen ihn hinaus.
»Als endlich sämmtliche Elefanten gefesselt waren, vernahm man aus der Entfernung die Töne einer Flöte. Sie wirkten wundersam auf mehr als einen. Die Thiere wandten den Kopf nach der Richtung, woher die Musik kam, und spannten ihre breiten Ohren: der klägliche Laut besänftigte sie offenbar. Nur die Jungen brüllten noch nach Freiheit, stampften mit den Füßen, bliesen Staubwolken über ihre Schultern, schwangen ihre kleinen Rüssel hoch empor und griffen jeden an, den sie erreichen konnten.
»Anfangs verschmähten die älteren Thiere jedes angebotene Futter, traten es unter die Füße und wandten sich verächtlich ab. Einige konnten, als sie ruhiger wurden, der Versuchung eines saftigen Bäumchens nicht mehr widerstehen, sondern rollten ihn unter den Füßen, bis sie die zarten Zweige abgelöst hatten, hoben sie dann wieder mit ihrem Rüssel auf und kauten sie sorglos.
»Wenn die Klugheit, die Ruhe und Gelehrigkeit der Lockthiere lebhaftes Erstaunen erregte, so mußte man anderseits auch das würdige Benehmen der Gefangenen bewundern. Ihr Betragen stand durchaus im Widerspruche mit den Schilderungen mancher Jäger, welche sie als falsch, wild und rachsüchtig darstellen. Wenn die Thiere von den Waffen ihrer Verfolger gequält werden, wenden sie freilich ihre Stärke und ihre Klugheit dazu an, daß sie zu entkommen oder zu vergelten suchen; hier im Corral aber zeugte jede ihrer Bewegungen von Unschuld und Schüchternheit. Nach einem Kampfe, in welchem sie keine Neigung zur Gewaltthätigkeit oder Rache sehen ließen, unterwarfen sie sich endlich mit der Ruhe der Verzweiflung. Erbarmend war ihre Stellung, rührend ihr Schmerz, zum Herzen gehend ihr dumpfes Stöhnen. Wären sie mit unnöthiger Quälerei gefangen worden, oder wären sie einer übeln Behandlung entgegengegangen, es wäre geradezu unerträglich gewesen.
»In ähnlicher Weise wie die erste Herde wurden dann auch die anderen nach und nach eingetrieben, bald mit vollerem, bald mit geringerem Erfolge. Der Eintritt der neuen Gäste in den Corral beunruhigte natürlich die bereits gefangenen nicht wenig. Die zweite Herde kam nun aber bei Tageslicht hinein, und ihre Angriffe waren daher noch viel entschiedener als die der ersten. Sie wurde von einem weiblichen Elefanten, welcher ziemlich neun Fuß hoch war, angeführt, und dieses muthige Thier konnte bei einem Angriffe auf die Umfriedigung, da alle weißen Stäbe nichts mehr halfen, nur dadurch zurückgetrieben werden, daß ihm ein Jäger eine lodernde Fackel an den Kopf warf. Um die bereits gefangenen kümmerten sich die später gekommenen nicht, stürzten vielmehr öfters wie toll über deren Körper dahin. Die oben erwähnte weibliche Führerin wurde zuerst erkoren. Als sie die Schlinge am Hinterfüße hatte, zeigte es sich, daß sie für Siribeddi zu stark war. Da diese fühlte, daß ihre Kraft nicht hinreichte, die widerstrebende Beute an den bestimmten Ort zu bringen, so kniete sie nieder, um ihr Ziehen durch das volle Gewicht ihres Körpers zu verstärken. Der Stoßzähner aber, welcher wohl sah, wie sauer sie sich es werden ließ, stellte sich vor die Gefangene und trieb sie Schritt für Schritt rückwärts, bis sie glücklich an den Baum gebracht und festgebunden worden war.
»Die letzte Arbeit bestand darin, die Seile, welche die Beine der Gefangenen fesselten, ein wenig zu lockern; dann führte man jeden zum Flusse. Zwei zahme mit starken Halsbändern traten ihm zur Seite; dem Neugefangenen legte man ein gleich starkes Halsband aus Kokosnußfäden an, band dann alle drei zusammen, wobei der zahme Elefant mitunter seinen Rüssel brauchte, um den Arm seines Reiters vor dem Rüssel des Gefangenen zu schützen, weil dieser sich das Seil natürlich nicht gern um den Hals legen ließ. Nachdem dies geschehen war, wurden die Schlingen von seinen Beinen abgenommen und er zum Flusse geleitet, wo er sich baden durfte, ein Genuß, welchen alle begierig ergriffen. Dann wurde jeder an einen Baum im Walde festgebunden und ihm seine Wärter zugewiesen, welche ihn reichlich mit seinem Lieblingsfutter versorgten.
»Die Zähmung des Elefanten ist ziemlich einfach. Nach etwa drei Tagen beginnt er ordentlich zu fressen und bekommt dann in der Regel einen zahmen zum Gesellschafter. Zwei Männer streicheln ihm den Rücken und reden ihm in sanften Tönen zu. Anfangs ist er wüthend und schlägt mit seinem Rüssel nach allen Seiten; vorn aber stehen andere Männer, welche alle seine Schläge mit der Spitze ihrer Eisenstangen auffangen, bis das Vorderende des Rüssels so wund wird, daß das Thier ihn endlich einzieht und dann selten wieder zum Angriffe benutzt. So lernt er zuerst die Macht des Menschen fürchten. Später helfen die zahmen Elefanten seine Erziehung weiter führen. In etwa drei Wochen bringt man das Thier so weit, daß es sich im Wasser niederlegt, sobald die Spitze der eisernen Ruthe, welche ihn vorher öfters am Rücken verwundet hatte, ihm droht.
»Sehr schwierig ist es, die Wunden zu heilen, welche auch die weichsten Seile an den Beinen hervorbringen. Diese Wunden eitern oft viele Monate lang, und manchmal vergehen Jahre, ehe der Elefant bei einer Berührung der Füße ruhig bleibt.
»Während ihre Größe keinen besonderen Einfluß auf die Dauer ihrer Abrichtung zu haben scheint, sind die Männchen gewöhnlich minder leicht zu behandeln als die Weibchen. Die, welche anfangs die heftigsten und widerspenstigsten sind, werden am schnellsten und wirksamsten gezähmt und bleiben gewöhnlich gehorsam unterworfen; die mürrischen oder tückischen aber langsamer, und es ist ihnen selten zu trauen. Ueberhaupt darf man einem gefangenen Elefanten nie mit unbegrenztem Vertrauen begegnen. Auch die zahmsten und sanftesten bekommen mitunter Anfälle von Halsstarrigkeit, und selbst nach jahrelangem Gehorsam macht sich ihre Reizbarkeit und Rachsucht bemerklich.
»Im allgemeinen kann die Gegenwart der zahmen Elefanten nach zwei Monaten entbehrt und der eingefangene vom Kornak allein geritten werden; nach drei bis vier Monaten läßt er sich zur Arbeit verwenden; nur darf man ihn nicht zeitig dazu bringen, da es oft vorgekommen ist, daß ein werthvolles Thier beim ersten Mal Anschirren sich niedergelegt hat und, wie die Einwohner sagen, »am gebrochenen Herzen gestorben ist«, jedenfalls verendet ist, ohne daß irgend eine Ursache nachgewiesen werden konnte. Gewöhnlich läßt man den Elefanten Lasten tragen oder in Gemeinschaft mit einem zahmen einen Wagen ziehen. Am schätzbarsten wird er durch Herbeischaffung schwerer Baustoffe, Balken oder Steine, wobei er Einsicht und Geschick in hohem Grade beweist und stundenlang ohne irgend einen Wink seines Aufsehers arbeitet; indeß läßt sein Eifer nach, wenn er sich unbeobachtet glaubt.«
Wie Melchior mittheilt, schätzt und werthet man in Indien männliche Elefanten aus dem Grunde höher als weibliche, weil letztere, wegen der ihnen mangelnden Stoßzähne, nur zum Ziehen, erstere dagegen auch zum Heben und Fortstoßen schwerer Lasten gebraucht werden können. Außerdem schwankt der Preis je nach der Erziehung, welche das Thier genossen, beziehentlich nach der Leistungsfähigkeit, welche es erlangt hat. Weibliche Arbeitselefanten kosten dem entsprechend oft nicht mehr als 600 Mark, wogegen man für männliche, arbeitstüchtige Thiere, je nach Umständen das doppelte dieser Summe und darüber bezahlt. Daß letztere, einmal gezähmt, bösartiger sein sollen als weibliche, bestreitet man in Indien, meiner Ansicht nach jedoch mit Unrecht.
Was man von der Vorliebe des Elefanten für eine einmal angenommene Ordnung der Zeit oder seiner Arbeitsweise oft behauptet hat, ist nach Tennents Beobachtungen ungenau. Er zeigt sich auch in dieser Beziehung so gefügig wie etwa ein Pferd. Sein Gehorsam gegen seinen Treiber gründet sich sowohl auf Furcht als auf Liebe, und obschon er dem einen oft sehr zugethan ist, gewöhnt er sich doch auch leicht an einen anderen, falls dieser ihn ebenso freundlich behandelt wie der frühere. Die Stimme des Führers reicht hin, ihn bei seinen Verrichtungen zu leiten. Wenn zwei eine gemeinsame Arbeit verrichten sollen, lassen sich ihre Bewegungen leicht durch eine Art Gesang in Einklang bringen. Die schwerste Probe seines Gehorsams legt der Elefant ab, wenn er auf Geheiß seines Wärters die ekelhaften Arzneien der Elefantenärzte verschluckt, oder wenn er schmerzvolle wundärztliche Verrichtungen an sich vornehmen lassen muß.
Als Lastthier muß der Elefant zart behandelt sein; denn seine Haut ist äußerst empfindlich und Eiterungen in hohem Grade ausgesetzt. Ebenso bekommt er leicht böse Füße und ist dann monatelang nicht zu gebrauchen. Auch von Augenentzündungen wird er häufig heimgesucht, und gerade in dieser Beziehung leisten die Elefantenärzte wirklich so viel, daß sie seit den Zeiten der alten Griechen berühmt geworden sind. An der Viehseuche leiden wilde und zahme Elefanten gleich stark.
Von zweihundertundvierzig Elefanten, welche der Regierung von Ceilon gehörten und zwischen 1831 bis 1856 starben, war bei hundertundachtunddreißig die Dauer ihrer Gefangenschaft aufgezeichnet worden. Im ersten Jahre derselben starben zweiundsiebzig (neunundzwanzig männliche und dreiundvierzig weibliche), zwischen dem ersten und zweiten Jahre fünf männliche und neun weibliche. Die längste Dauer der Gefangenschaft zeigte sich bei einem Weibchen, welches fast zwanzig Jahre aushielt. Von zweiundsiebzig, welche im ersten Jahre ihres Dienstes starben, verendeten fünfunddreißig innerhalb der ersten sechs Monate ihrer Gefangenschaft, darunter viele in unerklärlicher Weise, indem sie sich plötzlich hinlegten und verschieden. Regelmäßiges Baden scheint ihnen sehr zuträglich zu sein; ebenso ist es gut für sie, wenn sie mit den Füßen im Wasser oder in feuchter Erde stehen.
Die alte Angabe, daß der Elefant ein Alter von zwei- bis dreihundert Jahren erreiche, wird durch einzelne Beispiele auf Ceilon allerdings bestätigt, wo einzelne in der Gefangenschaft länger als hundertundvierzig Jahre zugebracht haben. Indeß glaubt man jetzt, daß ihre eigentliche Lebensdauer etwa siebzig Jahre betrage. Der Glaube au ihr fast unbegrenztes Alter kommt jedenfalls daher, daß der Leichnam selten oder nie in den Wäldern gefunden wird. Nur nach einer verheerenden Seuche finden sich solche vor. Ein Europäer, welcher sechsunddreißig Jahre lang ununterbrochen in dem Dschungel gelebt und die Elefanten fleißig beobachtet hat, pflegte oft seine Verwunderung auszusprechen, daß er, der doch viele tausende lebendiger Elefanten gesehen, noch nie das Geripp eines einzigen todten gefunden habe, ausgenommen solche, welche durch eine Krankheit gefallen waren. Diese Bemerkung gilt übrigens nur von den Elefanten auf Ceilon; denn in Afrika werden die Gebeine der in den Waldungen gestorbenen Elefanten häufig gefunden. Der Eingeborene in Ceilon glaubt, daß jeder Elefantentrupp seine Todten begrabe. Außerdem behauptet er auch, daß der Elefant, welcher seinen Tod herannahen fühle, stets ein einsames Thal zu seinem Sterbeplatze erwähle, welches zwischen den Bergen östlich von Adams Peak liegt und einen klaren See umschließt.
Fragt man, ob es zweckmäßig ist, einen Marstall von Elefanten z. B. auf Ceilon zu halten, so muß die Antwort lauten: daß sie allerdings in den noch unbebauten Landtheilen von Nutzen sind, wo Wälder nur durch rauhe Pfade durchschnitten werden und Flüsse zu durchkreuzen sind, daß aber in Gegenden, wo Ochsen und Pferde zum Zuge angewendet werden können, ihre kostbare Verwendung sehr eingeschränkt, wenn nicht gänzlich entbehrt werden darf.
Gegenüber den regelrechten Fanganstalten der Indier und deren verständnisvoller, auf die sorgsamste Beobachtung begründeter Behandlungsweise des Elefanten, verfahren die afrikanischen Stämme, welche sich mit dem Fange des Fihl befassen, unendlich roh und ungeschickt. So viel mir bekannt, betreiben nur die Nomadenstämme der zwischen dem oberen Nile und dem Rothen Meere sich ausdehnenden Steppen, also der Atbaraländer, einen mehr oder weniger regelmäßigern Fang, seitdem der nunmehr verstorbene Thierhändler Casanova sie hierzu angeregt und eine Verbindung mit ihnen angebahnt hat, welche von anderen Händlern noch gegenwärtig unterhalten wird. Casanova brachte anfangs der sechziger Jahre zuerst einige, später fast alljährlich viele lebende afrikanische Elefanten nach Europa, woselbst sie seit Jahrhunderten nicht gesehen worden waren. Marno, welcher Casanova auf einer seiner Reisen nach Kassala (der am Sudit, einem Zuflusse des Atbara, gelegenen Hauptstadt des Steppenlandes Taka) begleitete, berichtet, daß die Steppenbewohner einzig und allein auf Säuglinge jagen und auch diese nur erbeuten, indem sie deren Mütter in der oben geschilderten Weise verfolgen und tödten. Wahrend die kühnsten Jäger sich mit den alten beschäftigen, versuchen andere des Jungen sich zu bemächtigen, werfen ihm Schlingen über, reißen es zu Boden und fesseln es sodann an allen Vieren. Die Jäger selbst kehren von ihren wilden Ritten durch dornige Dickichte zerkratzt und zerschunden, die Pferde krumm und lahm nach dem Dorfe zurück, und beide bedürfen nach jeder Jagd längerer Erholung. Nach Marno's Versicherung verursachen selbst die jüngsten Elefanten oft bedeutende Schwierigkeiten, ebensowohl durch ihr Widerstreben bei und nach dem Fange selbst, wie durch die mit der Ernährung und Fortschaffung verbundene Mühwaltung. Daß ein junger Elefant dem Jäger, welcher etwas von seinem eigenen Schweiße an die Rüsselspitze des kleinen Dickhäuters gebracht hat, beständig nachfolgen soll, wie Heuglin behauptet, scheint man in den Atbaraländern nicht zu wissen, braucht hier vielmehr stets Gewalt. Mehrere Männer sind erforderlich, um die kleinen Wildlinge auf kurzen Märschen bis zum Aufenthaltsorte des Händlers zu geleiten, und eine stetig mitwandernde Ziegenherde ist nöthig, sie unterwegs mit Milch zu versorgen. Infolge der rohen Behandlung, welche sie erlitten, bekunden die jungen Thiere einen glühenden Haß gegen alle Eingeborenen, erheben ihre mächtigen Ohren, sobald sie einen solchen gewahren, schreien und werden wild und ungebärdig, falls ein solcher sich naht, wogegen sie mit dem Europäer um so eher sich befreunden, je sanfter und liebevoller dieser mit ihnen verkehrt. Anfänglich versuchen sie auch ihn zu stoßen oder mit dem Rüssel zu schlagen, gewöhnen sich jedoch verhältnismäßig erstaunlich schnell an jeden verständigen Pfleger und werden dann zu wirklich liebenswürdigen Geschöpfen, deren gutmüthig drolliges Wesen jedes Herz gewinnen muß. Verdiente oder doch für nothwendig erachtete Schläge fruchten zwar, machen sie jedoch ängstlich und furchtsam, erschweren deshalb auch ihre Zähmung mehr, als sie dieselbe fördern. Bei harter Behandlung vergießen sie Thränen wie ein gequälter Mensch. Nicht wenige verenden in den ersten Tagen ihrer Gefangenschaft infolge der rohen Behandlung, der Beschwerden des Weges, der ungewohnten Nahrung und endlich der Wunden, welche die Fesseln verursachen, in manchen Fällen auch ohne erklärliche Ursache, wahrscheinlich aus Kummer über den Verlust ihrer Mutter und ihrer Freiheit. Schweinfurth schildert das Betragen eines jungen Elefanten dieser Art, welcher in der üblichen Weise erbeutet und ihm geschenkt worden war: »Einen rührenden Anblick gewährte die vererbte Wohlerzogenheit des jungen Elefantenkindes. Bei jeder Pfütze und bei jedem Brunnen, welchen der Weg berührte, pflegte es den Rüssel voll Wasser zu pumpen, um sich vom Staube der Wanderung oder vom Schmutze des sumpfigen Pfades zu säubern. Indem es sich des Rüssels gleich eines Wasserschlauches bediente, begann es alsdann immer wieder von neuem, sich den Körper zu berieseln und zu bespritzen«. Ungeachtet der ihm gewordenen Sorgfalt und Pflege, erlag auch dieser Elefant nach wenigen Tagen den Folgen des anstrengenden Marsches. »Es hatte für mich«, sagt Schweinfurth, »etwas unendlich wehmuthvolles, das bereits riesige und doch noch so hülflose Geschöpf unter schweren Athemzügen verenden zu sehen. Wer das Auge des Elefanten beobachtet, wird finden, daß trotz seiner Kleinheit, und bei aller Kurzsichtigkeit, welche diesen Thieren angeboren ist, doch ein so seelenvoller Blick von demselben ausgeht, wie bei keinem zweiten Vierfüßler.«
Casanova's Gefangene wurden, wie Marno fernerhin mittheilt, unter schattigen Bäumen aufgestellt oder durch aufgespannte Matten gegen die Hitze geschützt, bekamen dreimal täglich ein Gemisch von Milch und Wasser, die größeren nur Wasser zu trinken und außer Durrahmehlbrei junge Durrahkolben und Zweige verschiedener Bäume zu fressen. Beim Trinken bekundeten auch sie, daß Wasser ihnen durchaus unentbehrlich ist. Sie tranken nicht allein eine erhebliche Menge desselben, sondern verbrauchten stets auch einen ansehnlichen Theil davon, um sich zu überspritzen und die ihnen ersichtlich sehr schmerzlichen Wunden zu kühlen.
Auf der Reise von Kassala nach Suakim, welche mehrere Wochen in Anspruch nahm, wurden die größten und verständigsten unter den jungen Elefanten von je drei Männern geleitet, derart, daß ein Mann das Thier führte und zwei die an den Hinterbeinen befestigten Stricke hielten, um ein etwaiges Entrinnen zu verhindern. Hieran dachten die folgsamen Geschöpfe jedoch nicht, liefen vielmehr, wie Schafe ihrem Hirten, dem Führer nach, so lange sie nicht erschreckt wurden. Noch immer hatten sie ihre Abneigung gegen die Araber nicht aufgegeben, griffen auch einmal einen dieser Leute an und würden ihn wahrscheinlich übel zugerichtet haben, wäre dem Bedrohten nicht rechtzeitig ein Europäer zu Hülfe geeilt. Diesem gegenüber zeigte sich das soeben in Wuth gerathene Thier zahm und gehorsam wie immer. Weit mehr Unannehmlichkeiten verursachten die jüngeren Genossen der leitenden Elefanten. Sie hatten sich vom Anfange an gewöhnt, in dicht gedrängtem Haufen neben einander zu gehen, stießen und drückten sich infolge dessen, schrien, wollten sich auch auf dem Lagerplatze, wo sie, um das Verwickeln ihrer Fesseln zu verhüten, einzeln angebunden werden mußten, nicht trennen, ergriffen ärgerlich die Flucht und zerrten dann nicht allein ihre Führer durch Dick und Dünn, Gestrüpp und Dornen, sondern verleiteten auch die übrigen zur Flucht, da einer dem anderen nachzulaufen pflegte. Mehrmals rissen einzelne sich los, liefen jedoch niemals davon, sondern blieben stets in der Nähe ihrer Schicksalsgenossen. Ein kleines Weibchen, welches ohne alle Fesseln umherlaufen durfte, ging naschend von einem Kameraden zum anderen, wurde auch von den kleineren geduldet, von den größeren dagegen stets vertrieben, weil diese futterneidischer waren als jene. Nur mit einem größeren Weibchen hatte es innige Freundschaft geschlossen, fraß und trank mit ihm und hielt sich fast beständig in seiner Nähe auf, schlief auch stets dicht an seiner Seite. Fast alle kleinen hatten die Gewohnheit, an den Ohren ihrer Nachbarn oder an den Kleidern und Händen ihrer Führer zu saugen. Gewöhnlich wurde täglich morgens und abends je fünf bis sieben Stunden lang weiter gezogen und dazwischen gerastet, die langnasige Herde gefüttert, getränkt, mit Wasser begossen und, nachdem Leute und Thiere geruht und geschlafen, die Wanderung fortgesetzt. An heißen Tagen fächelten sich die Elefanten während des Gehens mit den großen Ohren Kühlung zu und bespritzten sich mit dem früher getrunkenen Wasser, welches sie vom Magen aus in das Maul stießen und dann mittels des Rüssels hervorholten. Letzterer war in beständiger Bewegung: spritzten die Thiere nicht Wasser, so bestreuten sie sich mit Sand oder hüllten sich in dicke Staubwolken ein. Durch die Hitze litten sie fast ebenso wie durch die weiten Wege über dürren und steinigen Boden, infolge deren ihre dicken Sohlen sehr angegriffen wurden. Viele Mühe verursachte das Ein- und Ausladen in und aus Booten, Schiffen und Güterwagen auf den Eisenbahnen; doch gewöhnten sie sich, so erschreckt sie anfänglich sich zeigten, in kürzester Frist auch an diese ihnen vollkommen neuen Verhältnisse.
Aus Marno's Mittheilungen wie aus den von mir und anderen in Thiergärten gesammelten Beobachtungen geht hervor, daß auch der Fihl wie sein indischer Verwandter gezähmt und in seiner an geeigneten Nutzthieren so armen Heimat gewiß mit großem Vortheile dem Menschen dienstbar gemacht werden könnte. Ob er ebensoviel leisten würde, wie der indische Elefant, steht dahin; die Angaben der Alten sprechen dagegen, und der Eindruck, welchen das Thier auf den Beobachter macht, straft jene Angaben nicht Lügen. Wie Plinius, Livius, Strabo und andere römische Schriftsteller berichten, waren die indischen Elefanten den afrikanischen an Stärke und Muth entschieden überlegen: in der von Ptolemäus Philopator im Jahre 217 v. Chr. gegen Antiochus geschlagenen Schlacht von Raphia zogen, wie Hartmann hervorhebt, die dreiundsiebzig afrikanischen Elefanten des egyptischen Königs gegen die hundertundzwei des syrischen Gegners in kläglicher Weise den Kürzeren. Doch wissen wir auch, durch die Römer sowohl wie durch unsere Thierbändiger, daß der Fihl jeder für ihn überhaupt möglichen Abrichtung fähig ist. Allerdings vermissen wir an ihm den Ausdruck der geistigen Vollkommenheit, welcher den indischen Verwandten in so hohem Grade auszeichnet, würden ihm jedoch entschieden Unrecht thun, wenn wir deshalb folgern wollten, daß er der Erziehung und Abrichtung unfähig wäre. Er dürfte nicht so erstaunliches wie sein Verwandter, sicherlich aber noch immer außerordentlich viel leisten, wollte man ihn nur in derselben Weise behandeln, wie die Indier mit der in ihrer Heimat lebenden Art verkehren. Einstweilen denkt noch niemand daran, die für Mittelafrika geradezu unschätzbaren Kräfte des Fihls auszunutzen; denn die wenigen hier lebenden Europäer sind zu gewinnsüchtig, die Eingeborenen zu roh, als daß die viele Zeit und Geduld erfordernde Zähmung der edlen Thiere überhaupt versucht worden sein sollte.
In unseren Thiergärten hält sich der afrikanische Elefant ebenso gut wie der indische, auch unter Umständen, welche seinen natürlichen Bedürfnissen wenig entsprechen: so beispielsweise da, wo ihm ein größerer Raum zu freier Bewegung oder ein hinreichend weites und tiefes Badebecken fehlt, und er genöthigt wird, durch Hin- und Hergehen oder Aufheben und Niederlassen der Beine für erstere, durch zeitweiliges Ueberspritzen mit Hülfe des Rüssels für die ihm so nothwendige Suhle Ersatz sich zu verschaffen. In der Regel höchst gutmüthig und folgsam, kann der eine wie der andere zuweilen doch alle Rücksichten gegen den sonst warm geliebten Wärter vergessen und dann sehr gefährlich werden. Die Brunstzeit erregt ihn stets im hohen Grade und macht äußerste Vorsicht des ihn bedienenden Mannes zur gebieterischen Nothwendigkeit. Nach den bisher gesammelten Erfahrungen sind Männchen stets mehr zu fürchten als Weibchen, obgleich auch sie sehr zornig und angriffslustig werden können. Freundliche Behandlung erkennt jeder Elefant und erweist sich derselben gegenüber dankbar; Unfreundlichkeit und Ungerechtigkeit vergibt er in den meisten, aber keineswegs in allen Fällen. Gleichwohl richtet er nur selten Unglück an und ist deshalb weniger zu fürchten als jeder bösartige Wiederkäuer, als jeder Wildstier, jeder größere Hirsch, jede stärkere Antilope. Seine vortrefflichen Sinne, sein scharfer Verstand, sein mildes Wesen machen sich jedem Beobachter in ersichtlicher Weise bemerkbar. Er lernt spielend leicht und »arbeitet« willig und gern, bildet deshalb auch eines der hervorragendsten Zugthiere jeder Thierbude, wie er bald zum erklärten Lieblinge der Besucher eines Thiergartens wird. Die Menge der Nahrung, deren er bedarf, ist sehr bedeutend: laut Schmidt erhält der im Frankfurter Thiergarten lebende, etwa fünfzehn Jahre alte Elefant täglich acht Kilogramm Weizenkleie, fünf Kilogramm Brod, achtzehn Kilogramm Heu und einen Tag um den anderen je drei Kilogramm gekochten Reis, abgesehen von den ihm seitens der Besucher zugesteckten Leckerbissen, in Gestalt von Weiß- und Schwarzbrod, Rüben, Obst und ähnlichen Dingen. Dasselbe Thier leert, je nach der Jahreszeit, täglich vier bis achtzehn mit Wasser gefüllte Stalleimer. Paarweise zusammenlebende Elefanten begatten sich nicht selten, jedoch, soweit bisher beobachtet werden konnte, ohne Erfolg. Mancherlei Krankheiten und ebenso zufällige Unfälle raffen unsere Gefangenen oft plötzlich weg: ersteren stehen die Thierärzte meist rathlos gegenüber, letztere sind in den seltensten Fällen zu vermeiden. Mit gewöhnlichen Arzneigaben richtet man, wie folgendes Beispiel beweist, bei den kranken Riesen wenig aus. Einem Elefanten, welcher an Verstopfung litt, wurden im Laufe von zehn Tagen eingegeben: vier Pfund Aloe, ein Pfund fünf Unzen Kalomel, fünf Pfund Ricinusöl, zwölf Pfund Butter und fünf Pfund Leinöl, worauf endlich die erwünschte Wirkung eintrat. Unter die Unfälle zähle ich nicht, wenn man, wie in einem deutschen Thiergarten geschehen, einen liegenden Elefanten aufrichten will und ihn dabei erhängt, wohl aber, wenn ein Elefant an einer von ihm selbst aufgenommenen Rübe erstickt, oder wenn ein Thierhändler, wie dies Hagenbeck erfahren mußte, drei junge Elefanten dadurch verliert, daß die Ratten ihnen die Fußsohlen bei lebendigem Leibe abgenagt haben.
Elefantenfleisch hat den Geschmack von Ochsenfleisch, ist aber viel zäher und grobfaseriger; Elefantenfett ist von graulichweißer Farbe etwas grobkörnig und rauh, und dabei so leicht gerinnbar, daß es schon bei 20° Reaumur zu einer ziemlich festen Masse verdickt. So berichtet Heuglin, welcher ersteres frisch und im getrockneten Zustande genossen und schmackhaft gefunden hat. Das Stück eines Vorderfußes lieferte, nachdem es vierundzwanzig Stunden lang über dem Feuer gestanden hatte, wohlschmeckende Fleischbrühe in Menge und außerdem schmackhaftes Fleisch. Tennent rühmt die Zunge, Corse läßt dem in Asche gebratenen Rüssel Gerechtigkeit widerfahren. Die Neger schneiden alle Muskeln in lange Streifen, trocknen diese an der Sonne oder über dem Feuer und zerreiben sie vor der Verwendung zu einem groben Pulver, welches ihren einfachen Gerichten beigemischt wird. Bei den Jagden, welche die Niamniam anstellen, vernichtet man zuweilen so viele Elefanten, daß der Fleischbedarf mehrerer Dörfer auf Monate gedeckt ist. »Oft«, sagt Schweinfurth, »sah ich Leute, welche ich mit einem großen Bündel Brennholz ihren Hütten zuzuschreiten glaubte: sie trugen ihren Antheil an Elefantenfleisch, welches, in lange Striemen geschnitten und über dem Feuer gedörrt, ganz das Ansehen von Holz und Reisig angenommen hatte.«
Von dem Elfenbein, welches wir gegenwärtig bei uns verarbeiten, stammt ein guter Theil aus Afrika, kaum weniger aus Sibirien, von den vorweltlichen Arten nämlich, und der geringste Theil endlich aus Indien. Die Negerländer im oberen Nilgebiete führen alljährlich eine bedeutende Menge des kostbaren und von Jahr zu Jahr im Preise steigenden Stoffes aus; die größte Handelsstadt des inneren Afrika, Chartum, die Hauptstadt Kordafâns, Obëid, und die Hafenstadt Massaua am Rothen Meere sind zur Zeit wichtige Stapelplätze für dieses, den höchsten Gewinn bringende Erzeugnis des inneren Afrika. Der gesammte Elfenbeinhandel von Chartum befindet sich, laut Schweinfurth, in den Händen von sechs größeren Kaufleuten, denen noch ein Dutzend kleinerer Händler sich anschließen. Seit Jahren hat daselbst die Elfenbeinausfuhr einen Betrag von fünfmalhunderttausend Maria-Theresien-Thalern oder zwei Millionen Mark nicht überschritten, und diese Summe wurde, bei der empfindlichen Abnahme der Zähne in allen den Wasserstraßen des oberen Nillaufes zunächst gelegenen Gebieten, in der letzten Zeit nur dadurch erschwungen, daß die Handelsleute von Jahr zu Jahr nach immer weiter entlegeneren Gegenden des Inneren vordrangen. An der Quelle selbst zahlt man noch heute höchstens den zwanzigsten Theil des Preises, welchen das Elfenbein in Europa erzielt; schon in Chartum dagegen werthet man es ziemlich hoch. Von Massaua aus wird vornehmlich das in Abessinien und in den Barkaländern erbeutete Elfenbein verschifft, und zwar zunächst nach Indien, weshalb auch die von dort kommende Menge größer ist als sie sein könnte, wenn nur die Zähne des indischen Elefanten in den Handel kämen. Sehr bedeutende Geschäfte werden alljährlich in Berbera gemacht, jenem eigenthümlichen Marktplatze, Aden gegenüber, welcher nur zeitweilig von Kaufleuten besucht und bewohnt wird, sonst aber wüst ist. In den letzten Jahren hat sich auch Sansibar zum Stapelplatze für Elfenbein aufgeschwungen, und in der Neuzeit beginnt die Verfolgung des Elefanten seiner Zähne wegen längs der ganzen Westküste. Noch durchziehen zahlreiche Herden der stattlichen Thiere die Wälder Afrikas; aber mehr und mehr lichtet sie der verfolgende Mensch. Wie im Norden und Süden, steht ihnen auch in den Küstenländern des Ostens und Westens und selbst im Inneren von Afrika das Schicksal bevor: ausgestrichen zu werden in der Liste der Lebendigen. In den oberen Nilländern, wo der Elfenbeinhandel seit Jahrzehnten betrieben wird, sind sie bereits vollständig ausgerottet worden, »und nicht schwer wäre es«, sagt Schweinfurth, »in Abständen von fünf zu fünf Jahren die entsprechenden Zonen quer durch das ganze Gebiet des Gazellenstromes zu zeichnen, innerhalb welcher diese Thiere vor der Massenverfolgung theils sich zurückgezogen haben, theils gänzlich verschwunden sind.«
Als die den Rüsselthieren zunächst stehende Unterordnung betrachten wir die Gruppe der Unpaarhufer ( Anisodactyla oder Perisodactyla), welcher Owen auch die Einhufer einreiht, während wir sie auf die beiden jetzt lebenden Familien der Tapire und Nashörner beschränken.
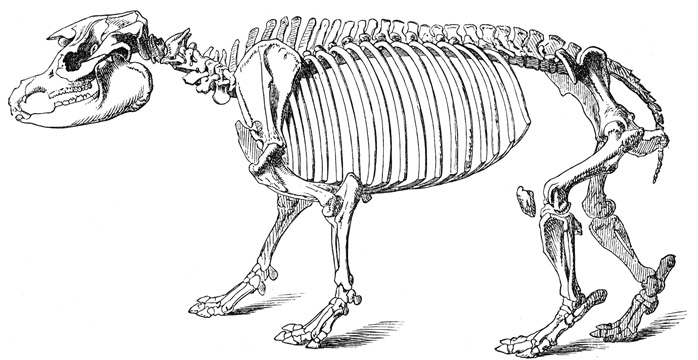
Geripp des Tapir. (Aus dem Berliner anatomischen Museum)
Die Tapire ( Tapirina), verhältnismäßig kleine, plump gebaute Thiere, welche zwischen den Elefanten und Schweinen ungefähr mitteninne zu stehen scheinen, kennzeichnen sich durch noch immer wohlgebildeten Leib, mit verlängertem, schmächtigem Kopfe, schlankem Halse, kurzem, stummelhaften Schwanze und mittelhohen, kräftigen Beinen. Die aufrecht stehenden Ohren sind kurz und ziemlich breit, die schief liegenden Augen dagegen klein. Die Oberlippe verlängert sich rüsselförmig und hängt weit über die Unterlippe herab. Die kräftigen Füße haben vorn vier, hinten drei Zehen. Das starke Fell liegt überall glatt auf. Die Behaarung ist kurz, aber dicht, bei den amerikanischen Arten von der Mitte des Hauptes an bis zum Widerriste mähnenartig verlängert. Das Gebiß besteht aus sechs Schneidezähnen und einem Eckzahne in jedem Kiefer, sieben Backenzähnen in der oberen und sechs in der unteren Kinnlade. Das Geripp, welches mit dem anderer Dickhäuter entschiedene Ähnlichkeit hat, zeichnet sich durch verhältnismäßig leichte Formen aus. Die Wirbelsäule besteht, außer den Halswirbeln, aus achtzehn rippentragenden, fünf rippenlosen, sieben Kreuzbein- und zwölf Schwanzwirbeln; den Brustkorb bilden acht Rippenpaare, die übrigen sind sogenannte falsche Rippen. Am Schädel überwiegt der lange, schmale Antlitztheil den sehr zusammengedrückten Hirnkasten beträchtlich; die frei hervorragenden Nasenbeine sind hoch hinaufgerückt; der breite, starke Jochbogen beugt sich tief nach vorn herab; die großen Augenhöhlen öffnen sich weit in die tiefen Schläfengruben.
Von den meist amerikanischen Arten der Familie ist uns wenigstens eine schon seit längerer Zeit bekannt, während die übrigen Arten erst in der Neuzeit entdeckt, beschrieben und bezüglich unterschieden wurden. Auffallenderweise ist der amerikanische Tapir zuerst in den Büchern der Wissenschaft verzeichnet worden, wogegen wir von dem indischen erst zu Anfange dieses Jahrhunderts sicheres erfahren haben. Bekannt war auch er schon seit langer Zeit, aber freilich nicht uns, sondern nur den Chinesen, deren Lehr- und Schulbücher ihn erwähnen. Es bekundet sich hinsichtlich der Tapire dasselbe Verhältnis, welches wir fast regelmäßig beobachten können, wenn eine Familie in der Alten und in der Neuen Welt vertreten ist: die altweltlichen Arten sind edler gestaltete, falls man so sagen darf, vollkommenere Thiere als die in der Neuen Welt lebenden.
Der Schabrackentapir, wie ich ihn nennen will, in seiner Heimat Maiba, Kuda-Ayer, Tennu, Me, Kudayer, Ayer, Babi-Alu, Saladang, Gindal etc. benamset ( Tapirus indicus, T. sumatranus, malayanus und bicolor, Rhinochoerus indicus und sumatranus), zeichnet sich vor seinen Verwandten aus durch beträchtlichere Größe, den verhältnismäßig schlankeren Leibesbau, den im Antlitztheile mehr verschmächtigten, im Schädeltheile aber mehr gewölbten Kopf, durch den stärkeren, längeren Rüssel und die kräftigeren Füße, den Mangel der Mähne und endlich durch die Färbung. Besonders wichtig für die Kennzeichnung des Thieres scheint mir der Bau des Rüssels zu sein. Während dieser bei den amerikanischen Tapiren deutlich von der Schnauze sich absetzt und röhrenförmig gerundet erscheint, geht die obere Schnauzenhälfte des Schabrackentapirs unmerklich in den Rüssel über, welcher einen ähnlichen Querschnitt hat wie der Elefantenrüssel, d. h. auf der Oberseite gerundet, auf der Unterseite hingegen gerade abgeschnitten ist. Außerdem zeigt dieser Rüssel viel deutlicher als der seiner amerikanischen Verwandten den fingerförmigen Fortsatz, – wiederum eine Andeutung an den Elefantenrüssel.
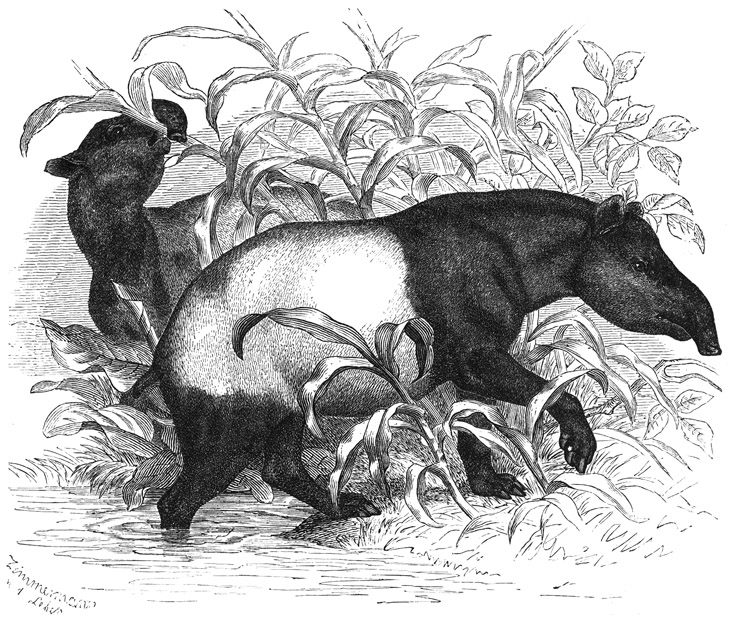
Schabrackentapir ( Tapirus indicus). 1/18 natürl. Größe.
Sehr bezeichnend ist die Färbung des höchst gleichmäßigen Haarkleides. Ein reines Tiefschwarz darf als Grundfärbung angesehen werden; von ihr hebt sich, scharf abgegrenzt, die graulichweiße Schabracke lebhaft ab. Kopf, Hals und Vordertheil des Leibes bis hinter die Schulterblätter, nebst den Beinen, ein breiter Streifen, welcher längs der Brust- und Bauchmitte verläuft, die Hinterbeine, einschließlich der Oberschenkel, sowie endlich der Schwanz sind tief schwarz, alles übrige hingegen ist graulich weiß. Die Ohren sind an der Spitze licht gerändert. Schwarz wie Weiß schillern oder glänzen in eigentümlicher, mit Worten kaum zu beschreibenden Weise. Das einzelne Haar ist von der Wurzel bis zur Spitze gleich gefärbt. Die Klauen sind dunkelhornfarben, die Iris ist dunkelviolett, der runde Augenstern schwarz. Genaue Maße des alten Männchens finde ich nirgends angegeben; bei einem von mir gepflegten erwachsenen Weibchen dagegen betrug die gesammte Länge, den 8 Centim. messenden Schwanzstummel inbegriffen, 2,5 Meter, bei 1 Meter Schulter- und 1,05 Meter Kreuzhöhe, die Länge des Kopfes von der Rüsselspitze an bis hart hinter das Ohr 63 Centim., die Länge des zusammengezogenen Rüssels 7 Centim., des ausgestreckten dagegen 16 Centim.
Auffallenderweise wurde, trotz unseres lebhaften Verkehrs mit Indien und Südasien überhaupt erst im Jahre 1819 und zwar durch Cuvier etwas bestimmtes über den Schabrackentapir bekannt. Cuvier hatte kurz vorher ausgesprochen, daß in unserer Zeit ein großes Säugethier schwerlich noch entdeckt werden dürfte, und erfuhr durch Diard, einen seiner Schüler, den schlagendsten Beweis des Gegentheils. Diard sandte zunächst nur eine Abbildung der Maiba nach Europa und begleitete dieselbe mit den Worten: »Als ich den Tapir, dessen Abbildung ich übermittle, zum erstenmale zu Barakpoore sah, wunderte ich mich, daß ein so großes Thier noch nicht entdeckt worden; ja, ich wunderte mich darüber noch mehr, als ich in der Asiatischen Gesellschaft den Kopf eines ähnlichen Thieres fand, welchen am 29. April des Jahres 1806 der Statthalter Farquhar eingeschickt hatte, mit der Bemerkung, daß dieser Tapir in den Wäldern der Halbinsel ebenso gemein sei wie Nashorn und Elefant.« Diard hatte Unrecht, wenn er annahm, daß wirklich niemand etwas von dem Schabrackentapir wisse; denn nicht bloß die Chinesen, sondern auch europäische Forscher hatten das Thier lange vor Diard beschrieben. Was die braven Chinesen anlangt, so muß freilich bemerkt werden, daß ihre Sippen- und Artbeschreibung einiges zu wünschen übrig läßt. In dem sehr alten Wörterbuche »Eul-Ya« wird das Wort Me, der Name unseres Thieres, auf einen weißen Panther gedeutet, jedoch hinzugefügt, daß der Me auch einem Bären gleiche, aber einen kleinen Kopf und kurze Füße habe; die Haut sei weiß und schwarz gefleckt, halte auch sehr gut die Nässe ab. Aus einem zweiten Wörterbuche, »Chuen-Wen« betitelt, erfahren wir dagegen, daß der Me zwar einem Bären gleicht, aber gelblich aussieht, auch nur im Lande Lhu vorkommt. Ungleich vollständiger und genauer schildert das »Pen-thsaokana-mou«, ein Buch, das etwa der Raff'schen Naturgeschichte entspricht, unseren Vielhufer: »Der Me«, so belehrt es uns, »gleicht einem Bären. Sein Kopf ist klein und seine Beine sind niedrig. Das kurze, glänzende Haar ist schwarz und weiß gefleckt, obwohl einige sagen, daß das Thier gelblich weiß, und andere, daß es graulich weiß von Farbe sei. Es hat einen Elefantenrüssel, Nashornaugen, einen Kuhschwanz und Füße wie ein Tiger.« Außerdem finden sich in chinesischen und japanesischen Werken mehrfach Abbildungen des Schabrackentapirs, zumal in Büchern, geschrieben, gedruckt und gebunden zur Freude und Belehrung der Kindlein. Diese Abbildungen behandeln den Me als ein entschieden bekanntes, gewöhnliches Säugethier.
Abgesehen von chinesischer Wissenschaft, ist die Entdeckungsgeschichte des Schabrackentapirs folgende: Lange bevor Diard an Cuvier schrieb, im Jahre 1772 bereits, hatte der Engländer Wahlfeldt des zweifarbigen Tapirs in einem Berichte über Sumatra Erwähnung gethan. Er hielt das Thier für ein Flußpferd und beschrieb es als solches, legte aber eine Zeichnung bei, welche unseren Dickhäuter nicht verkennen läßt. Um dieselbe Zeit veröffentlichte Marsden, damaliger Sekretär der Residentschaft von Bengalen, eine Geschichte von Sumatra und in ihr bestimmte Angaben über den Tapir. Im Jahre 1805 erhielt Raffles Nachricht von der Maiba; wenig später fand ihn der Major Farquhar in der Umgebung von Malakka auf, theilte auch der Asiatischen Gesellschaft bereits im Jahre 1816 seine Beschreibung und Abbildung mit. In demselben Jahre gelangte der Tapir lebend in die Thiersammlung zu Barakpoore bei Kalkutta, und hier war es, wo Diard ihn kennen lernte. Die Ehre der Entdeckung dieses Dickhäuters gebührt also den Engländern, nicht den Franzosen.
Im Jahre 1820 trafen der erste Balg, ein Geripp und verschiedene Eingeweide des bis dahin noch immer sehr wenig bekannten Geschöpfes in Europa ein. Seitdem haben wir manches vom Schabrackentapir erfahren, ohne uns jedoch rühmen zu können, über ihn vollständig unterrichtet zu sein. Ueber das Freileben mangelt noch jede Kunde, und auch die Beobachtungen über das Gefangenleben sind keineswegs als erschöpfende zu bezeichnen.
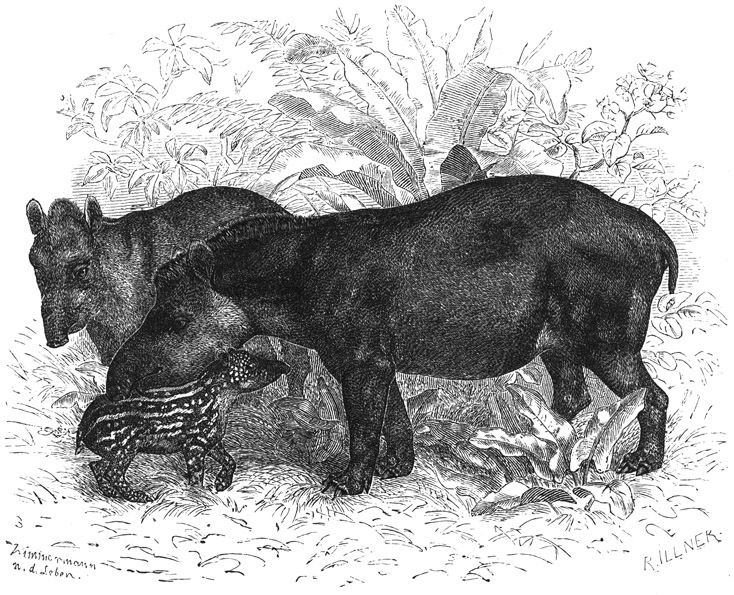
Tapir (Tapirus terrestris). 1/16 natürl. Größe.
Eine kurze Nackenmähne und ein einfarbiges Haarkleid kennzeichnen den Tapir, in Brasilien Anta oder Danta, in Giana Maipars, Meripuri und Tapirete genannt (Tapirus terrestris, T. americanus, suillus und Anta, Hippopotamus terrestris). Er ist diejenige Art seiner Familie, mit welcher wir am frühesten bekannt wurden. Die Reisenden sprachen schon wenige Jahre nach Entdeckung der Westhälfte von einem großen Thiere, welches sie für ein Nilpferd hielten, und die heimischen Forscher verliehen diesem Thier deshalb auch den Namen Hippopotamus terrestris. Erst der hochverdiente Marcgrav von Liebstad gibt um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts eine ausführlichere Beschreibung nebst Abbildung. Spätere Reisende und Forscher vervollständigten die erste Schilderung, und gegenwärtig sind wir über wenige Dickhäuter besser unterrichtet als eben über diesen Tapir. Wenn man die Unterschiede festhält, welche ich bei Beschreibung des indischen Verwandten hervorgehoben habe, ist es nicht schwer, den Tapir zu erkennen. Ein ziemlich gleichmäßiges Haarkleid, welches sich nur von der Mitte des Oberkopfes längs des Nackens bis zu den Schultern steifmähnig, jedoch nicht bedeutend verlängert, bedeckt den Leib. Die Färbung desselben ist ein schwärzliches Graubraun, welches an den Seiten des Kopfes, besonders aber am Halse und an der Brust, etwas sich lichtet; Füße und Schwanz, die Mittellinie des Rückens und der Nacken pflegen dunkler gefärbt zu sein; die Ohren sind weißlichgrau gesäumt. Verschiedene Abweichungen kommen vor; es gibt fahle, graue, gelbliche, bräunliche Spielarten. Bei den jungen Thieren zeigt nur der Rücken die Grundfärbung der Alten; die Oberseite des Kopfes ist dicht mit weißen, kreisförmigen Flecken besetzt, und längs jeder Seite des Leibes verlaufen vier ununterbrochene Punktreihen von lichter Färbung, welche sich auch über die Glieder erstrecken. Mit zunehmendem Alter verlängern sich diese Flecken streifenförmig, und nach Ende des zweiten Jahres verschwinden sie gänzlich. Nach Tschudi's Messungen kann der Tapir bis 2 Meter Länge und 1,7 Meter Höhe erreichen. Auffallenderweise kommen diese Maße nicht dem männlichen, sondern dem weiblichen Thiere zu, welches regelmäßig größer zu sein pflegt.
Nach den neueren Untersuchungen scheint sich das Vaterland des Tapirs auf den Süden und Osten Südamerikas zu beschränken, und er im Norden und Westen der Südhälfte sowie in der Mitte Amerikas durch ihm zwar innig verwandte, jedoch wohl unterschiedene Arten ersetzt zu werden, auf welche wir nicht näher eingehen wollen.
Einer Lebensbeschreibung der Tapire müssen wir die Mittheilungen zu Grunde legen, welche wir von Azara, Rengger, Prinz von Wied, Tschudi, Schomburgk und anderen über die amerikanischen Arten erhalten haben; denn über das Leben des Schabrackentapirs fehlen ausführliche Berichte. Alle Arten sind sich übrigens so ähnlich, daß man sich wohl kaum eines Fehlers schuldig macht, wenn man das Leben und Treiben des einen vorzugsweise berücksichtigt.
Alle Tapire halten sich im Walde auf und vermeiden ängstlich Blößen oder offene Stellen desselben. Sie sind es daher auch, welche dem vordringenden Menschen am ersten weichen und vor ihm tiefer in die Wälder sich zurückziehen, während, wie Hensel von Südamerika sagt, die übrige Thierwelt der Wendekreise im Gegentheile nach den urbar gemachten Stellen des Waldes sich hindrängt. In den Dickichten der südamerikanischen Waldungen treten die Tapire regelmäßige Pfade aus, welche sich von den Wegen der Indianer schwer unterscheiden lassen und den Ungeübten leicht verlocken, ihnen zu seinem Schaden zu folgen. Diese Wildbahnen benutzen die Thiere, so lange sie nicht gestört werden; geängstigt dagegen brechen sie ohne irgendwie bemerkliche Anstrengung durch das verschlungenste Dickicht.
Die Tapire sind Dämmerungsthiere. »Wir haben«, sagt Tschudi, »monatelang die dichten Urwälder, in denen Scharen von Tapiren leben, durchstrichen, ohne je einen im Laufe des Tages zu sehen. Sie scheinen sich dann nur im dichten Gebüsch, an den kühlen, schattigen Plätzen aufzuhalten, am liebsten in der Nähe von stehendem Wasser, in welchem sie gern sich wälzen.« In gänzlich ungestörten und sehr dunkeln Wäldern hingegen streifen sie, wie Prinz von Wied versichert, auch bei Tage umher, und diese Angabe findet Unterstützung in der Beobachtung des Betragens der Gefangenen, welche ebenfalls nicht selten in den Tagesstunden sich erheben und eine Zeitlang in ihrem Gehege umherlaufen. Im Sonnenscheine freilich bewegen sie sich höchst ungern, und während der eigentlichen Mittagsstunden suchen sie stets im Schatten des Dickichts Schutz gegen die erschlaffende Hitze und noch mehr gegen die sie im hohen Grade peinigenden Mücken. »Wenn man«, sagt der Prinz, »am frühen Morgen oder am Abend leise und ohne Geräusch die Flüsse beschifft, bekommt man häufig Tapire zu sehen, wie sie sich baden, um sich zu kühlen, oder um sich vor den Stechfliegen zu schützen. Wirklich weiß kein Thier besser gegen diese lästigen Gäste sich zu schützen als der Tapir; denn eine jede Schlammpfütze, ein jeder Bach oder Teich wird von ihm aus dieser Ursache aufgesucht und benutzt. Daher findet man auch oft seine Haut mit Erde und Schlamm bedeckt, wenn er erlegt wird.« Tschudi behauptet, daß die Farbenabänderung, welche man so häufig bemerkt, von dieser Gewohnheit des Thieres herrühre, da sie auf weiter nichts beruhe als auf der größeren oder geringeren Menge von Erde, welche ihm beim Wälzen im Schlamme und Sande die Haut verunreinige. Gegen Abend gehen die Tapire ihrer Nahrung nach, und wahrscheinlich sind sie während der Nacht fortwährend in Bewegung. Sie bekunden in ihrer Lebensweise Aehnlichkeit mit unserem Wildschweine, halten sich jedoch nicht in so starken Rudeln wie dieses, sondern leben, nach Art des Nashorns, mehr einzeln. Namentlich die Männchen sollen ein einsiedlerisches Leben führen und bloß zur Paarungszeit zu dem Weibchen sich gesellen. Familien trifft man höchst selten an, und Gesellschaften von mehr als drei Stücken sind bis jetzt nur da beobachtet worden, wo eine besonders gute, fette Weide zufällig verschiedene Tapire vereinigt hat. Doch bemerkt Tschudi, daß sie haufenweise an die Ufer der Flüsse kommen, um hier zu trinken und sich zu baden.
In ihren Bewegungen erinnern die Tapire an die Schweine. Der Gang ist langsam und bedächtig: ein Bein wird gemächlich vor das andere gesetzt, der Kopf dabei zur Erde herabgebogen, und nur der beständig sich hin- und herdrehende, schnüffelnde Rüssel sowie die fortwährend spielenden Ohren beleben die sonst äußerst träge erscheinende Gestalt. So geht der Tapir ruhig seines Weges dahin. Der geringste Verdacht aber macht ihn stutzen; Rüssel und Ohren drehen und bewegen sich kurze Zeit fieberisch schnell, und plötzlich fällt das Thier in eilige Flucht. Es beugt den Kopf tief zur Erde herab und stürzt in gerader Richtung blindlings vorwärts, durch das Dickicht ebenso rasch wie durch Sumpf oder Wasser. »Begegnet man«, sagt der Prinz, »zufällig einem solchen Thiere im Walde, so pflegt es heftig zu erschrecken und schnell mit großem Geräusche zu entfliehen. Auf eine kurze Entfernung ist es ziemlich flüchtig; doch kann es einem raschen Hunde nicht entgehen und pflegt bald vor diesem sich zu stellen.« Der Tapir ist ein vortrefflicher Schwimmer und ein noch vorzüglicherer Taucher, welcher ohne Besinnen über die breitesten Flüsse setzt, solches auch nicht allein auf der Flucht, sondern bei jeder Gelegenheit thut. Dies ist früher bezweifelt worden; alle neueren Beobachter aber stimmen darin vollständig überein, und der Prinz behauptet geradezu, daß die Aeußerung eines Reisenden, welcher sagt, der Tapir gehe nur selten und bloß auf der Flucht ins Wasser, hinlänglich zeige, daß sie aus einer mit der Natur dieser Thiere völlig unbekannten Quelle geflossen sei. Wahrscheinlich läuft der Tapir, wie das Flußpferd, auch längere Zeit auf dem Grunde der Gewässer hin; wenigstens beobachtete man dies an dem gefangenen Schabrackentapir zu Barakpoore, welchen man oft in dieser Weise sein Wasserbecken durchschreiten sah, während er hier niemals wirklich schwamm. Die Wasserbecken, welche den von mir gepflegten und sonst gesehenen Gefangenen zur Verfügung standen, waren nicht tief genug, als daß ich diese immerhin auffällige Angabe durch eigene Beobachtung prüfen konnte.
Unter den Sinnen des Tapirs stehen Geruch und Gehör entschieden obenan und wahrscheinlich auf gleicher Stufe; das Gesicht hingegen ist schwach. Ueber den Geschmack ist schwer ein Urtheil zu fällen; doch habe ich an Gefangenen beobachtet, daß sie zwischen den Nahrungsmitteln sehr scharf zu unterscheiden wissen und besondere Leckerbissen wohl zu würdigen verstehen. Das Gefühl bekundet sich als Tastsinn und als Empfindung. Der Rüssel ist ein sehr feines Tastwerkzeug und findet als solches vielfache Verwendung. Gefühl beweist der Tapir nicht bloß durch seine Furcht vor den Sonnenstrahlen und Mücken, sondern auch durch Kundgeben einer ersichtlichen Behaglichkeit, wenn seine Dickhaut an irgend einer Stelle des Leibes gekraut wird. Meine Gefangenen legten sich, wenn sie gebürstet oder abgerieben wurden, sofort nieder und zeigten sich dabei willig wie ein Kind, ließen sich nach allen Seiten hin drehen und wenden, ja auch zum Aufstehen bringen, je nachdem man die Bürste an dieser oder jener Stelle des Leibes in Anwendung brachte.
Die Stimme ist ein eigenthümliches, schrillendes Pfeifen, welches, wie Azara sagt, in gar keinem Verhältnisse zu dem großen Körper des Thieres steht. Derselbe Naturforscher behauptet, daß man es von dem freilebenden Tapir nur während der Paarungszeit vernehme, und Schomburgk glaubt, daß es bloß von jungen Thieren ausgestoßen werde. Beides ist falsch; Gefangene wenigstens lassen dieses Pfeifen auch außer der Brunstzeit vernehmen, und zwar der Schabrackentapir ebenso gut wie der amerikanische. Von dem erstgenannten hört man, wenn man ihn stört, noch ein ärgerliches Schnauben, welches mit Worten nicht beschrieben werden kann.
Alle Tapire scheinen gutmüthige, furchtsame und friedliche Gesellen zu sein, welche nur im höchsten Nothfalle von ihren Waffen Gebrauch machen. Sie fliehen vor jedem Feinde, auch von dem kleinsten Hunde, am ängstlichsten aber vor dem Menschen, dessen Uebermacht sie wohl erkannt haben. Dies geht schon daraus hervor, daß sie in der Nähe von Pflanzungen viel vorsichtiger und scheuer sind als im unbetretenen Walde. Doch erleidet diese Regel Ausnahmen. Unter Umständen stellen sie sich zur Wehre und sind dann immerhin beachtenswerthe Gegner. Sie stürzen sich blindwüthend auf ihren Feind, versuchen ihn umzurennen und gebrauchen auch wohl die Zähne nach Art unserer Bache. In dieser Weise vertheidigen die Mütter ihre Jungen, wenn sie diese vom Jäger bedroht sehen. Sie setzen sich dann ohne Bedenken jeder Gefahr aus und achten keine Verwundung. Im übrigen ist die geistige Begabung der Tapire freilich gering, obwohl die Thiere auf den ersten Anblick hin noch viel stumpfsinniger erscheinen, als sie wirklich sind. Wer längere Zeit gefangene Tapire behandelt hat, erkennt, daß sie immer noch hoch über Nashorn und Nilpferd und ungefähr mit dem Schweine auf gleicher Höhe stehen. »Ein jung eingefangener Tapir«, sagt Rengger, »gewöhnt sich nach wenigen Tagen seiner Gefangenschaft an den Menschen und dessen Wohnort, den er alsdann nicht mehr verläßt. Allmählich lernt er seinen Wärter von anderen Leuten unterscheiden, sucht ihn auf und folgt ihm auf kleine Entfernungen nach; wird ihm aber der Weg zu lang, so kehrt er allein nach der Wohnung zurück. Er wird unruhig, wenn sein Wärter ihm lange fehlt und sucht diesen, falls er dies kann, überall auf. Uebrigens läßt er sich von jedermann berühren und streicheln. Mit der Zeit verändert er seine Lebensart insofern, als er den größten Theil der Nacht schlafend zubringt; auch lernt er, wie das Schwein, nach und nach jegliche Nahrung des Menschen genießen und frißt nicht nur alle Arten von Früchten und Gemüsen, sondern auch gekochtes, an der Sonne getrocknetes Fleisch, verschlingt Stückchen von Leder, Lumpen und dergleichen, wahrscheinlich aus Liebe zu dem salzigen Geschmack, welchen altes Leder und Lumpen besitzen. Wenn er frei umherlaufen kann, sucht er das Wasser selbst auf und bleibt oft halbe Tage hindurch in einer Pfütze liegen, falls diese von Bäumen beschattet wird. Es scheint überhaupt, als bedürfe er das Wasser mehr zum Baden als zum Trinken.« Die von mir gepflegten Gefangenen haben Renggers Beobachtungen bestätigt. Beide Arten waren höchst gutmüthige Geschöpfe. Sie waren ganz zahm, friedlich gesinnt gegen jedes Thier, höchst verträglich unter sich und ihren Bekannten zugethan. Wenn ich zu ihnen ging, kamen sie herbei und beschnupperten mir Gesicht und Hände, wobei sie die wunderbare Beweglichkeit ihres Rüssels bethätigten. Andere Thiere, welche zufällig in ihre Nähe kamen, wurden neugierig dumm längere Zeit beschnüffelt. Die Anta hatte mit einem neben ihm stehenden Wasserschweine sogar innige Freundschaft geschlossen und leckte es zuweilen minutenlang äußerst zärtlich. Beider Trägheit ist sehr groß; sie schlafen viel, zumal an heißen Sommertagen, und ruhen auch des Nachts mehrere Stunden. Am lebendigsten sind sie gegen Sonnenuntergang; dann können sie zuweilen ausgelassen lustig sein, in dem ihnen gewährten Raume auf- und niederjagen und sich mit Wollust im Wasser umhertummeln. In letzterem pflegen sie auch, so lange sie sich frei bewegen können, ihre Losung abzusetzen. Ihre Stimme lassen sie nur höchst selten vernehmen; manchmal schweigen sie monatelang. Auf den Ruf folgen sie nicht, überhaupt thun sie nur das, was ihnen eben behagt, und es kostet ihnen immer eine gewisse Ueberwindung, bevor sie sich aus ihrer Trägheit aufraffen.
Bei geeigneter Pflege halten Tapire auch bei uns jahrelang in der Gefangenschaft aus. Ein warmer Stall ist ihnen Bedürfnis; namentlich im Winter muß man sie gegen die Unbill des Wetters bestmöglichst zu schützen suchen. In den meisten Fallen verenden sie an Lungenkrankheiten, welche sie, wie alle Thiere der Wendekreisländer, in dem kalten Europa leicht heimzusuchen pflegen. Zur Fortpflanzung hat man sie bei uns noch nicht gebracht, wie es scheint, in ihrer Heimat aber auch nicht; wenigstens finde ich hierüber nirgends eine Angabe. Es wird behauptet, daß man daran gedacht habe, den Schabrackentapir in seinem Vaterlande zum Hausthiere zu gewinnen, weniger seines Fleisches halber, als um ihn zum Lasttragen und bezüglich zum Ziehen zu verwenden. Die Absicht mag gut gemeint sein, dürfte sich aber schwerlich ausführen lassen; denn so groß ist die Gelehrigkeit des Tapirs denn doch nicht, daß er als arbeitender Haussklave wesentliche Dienste leisten könne. Namentlich als Zugthier dürfte er nicht eben besonders Glück machen. So hübsch es auch aussehen würde, mit einem Paar Schabrackentapiren durch die Straßen indischer Städte zu fahren, so wenig möchte diese Beförderungsweise unseren neuzeitlichen Reiseeinrichtungen entsprechen: einen gefangenen Tapir zum Traben zu bringen, hat größere Schwierigkeiten als jene Leute, welche solchen Gedanken zuerst aussprachen, glauben mochten.
Die freilebenden Tapire nähren sich nur von Pflanzen und namentlich von Baumblättern. In Brasilien bevorzugen sie die jungen Palmenblätter; nicht selten aber fallen sie auch in die Pflanzungen ein und beweisen dann, daß ihnen Zuckerrohr, Mango, Melonen und andere Gemüse ebenfalls behagen. In den Kakaopflanzungen richten sie, wie Tschudi versichert, manchmal in einer Nacht durch Niedertreten der zarten Pflanzen und das Abfressen der jungen Blätter einen Schaden von vielen tausend Mark an. Im freien, großen Walde leben sie oft monatelang von den abgefallenen Baumfrüchten oder in den Brüchen von den saftigen Sumpf- und Wasserpflanzen. Besonders erpicht sind sie auf Salz; es ist ihnen, wie den Wiederkäuern, Bedürfnis. »In allen tiefliegenden Ländern Paraguays«, sagt Rengger, »wo das Erdreich schwefelsaures und salzsaures Natron enthält, findet man die Tapire in Menge. Sie belecken hier die mit Salz geschwängerte Erde.« Auch die Gefangenen zeigen eine große Vorliebe für Salz. Im übrigen nehmen diese alles an, was Schweine fressen, erkennen aber dankbar jede schmackhafte Gabe, welche ihnen gereicht wird. Baumblätter und Früchte, Zwieback und Zucker gehören zu ihren besonderen Leckerbissen.
Die Brunst der freilebenden Tapire fällt in die Monate, welche der Regenzeit vorausgehen. Etwa vier Monate später wirft das Weibchen ein kleines, niedliches Junges, welches nach Art der Wildschweine gestreift ist. Beim Schabrackentapir ist das Jugendkleid schwarz, oben fahl, unten weiß gefleckt und gestreift, bei der Anta die Grundfarbe ein helles Grau, die Flecken und Streifenzeichnung aber in ähnlicher Weise darüber verbreitet. Vom vierten Monate an beginnt die Färbung sich zu ändern, und im sechsten Monate zeigen die Jungen die Färbung der Alten.
Alle Tapirarten werden von den Menschen eifrig verfolgt, weil man ihr Fleisch und Fell benutzt. Von amerikanischen Forschern erfahren wir, daß das Fell seiner Dicke und Stärke wegen geschätzt wird. Man gerbt es und schneidet meterlange, dicke Riemen aus ihm, welche abgerundet, durch wiederholtes Einreiben mit heißem Fett geschmeidig gemacht und sodann zu Peitschen oder Zügeln verwendet werden. Von den argentinischen Freistaaten aus sollen alljährlich eine Menge solcher Zügel in den Handel kommen. Für Schuhe ist, nach Tschudi, das Fell zu spröde, wenn das Wetter trocken, und zu schwammig, wenn die Witterung feucht ist. Klauen, Haaren und anderen Theilen des Tapirs werden Heilkräfte zugeschrieben; auf der Ostküste aber ist das gemeine Volk, wie Rengger mittheilt, weit entfernt, die Wirkung dieser Mittel an sich selbst zu versuchen, begnügt sich vielmehr, sie anderen Kranken anzupreisen. Dagegen werden die Klauen, nach Tschudi's Versicherung, von den Indianern, als Vorkehrmittel gegen die Fallsucht, an einem Faden um den Hals getragen oder, geröstet und zu feinem Pulver gerieben, auch innerlich eingegeben. Dasselbe Mittel nimmt in der indianischen Heilkunde einen hohen Rang ein; denn es wird auch gegen Lungenschwindsucht angewandt, dann aber mit der Leber des Stinkthieres in Kakao abgekocht. Endlich sollen die Hufe als Tonwerkzeuge nach Art der Kastagnetten verwandt werden.
Eine Jagd aus dem Stegreife schildert Schomburgk. »Eben bogen wir um eine der Krümmungen, als wir zu unserer großen Freude einen Tapir mit seinem Jungen auf einer der vielen Sandbänke am Wassersaume herumwaden sahen; kaum aber war das Wort »Maipuri« den Lippen unserer Indianer entflohen, als wir auch von beiden Thieren bemerkt wurden, welche die Flucht ergriffen und in dem dichten Pflanzendickicht am Ufer verschwanden. Ebenso schnell, wie sie dorthin geeilt, waren wir dem Ufer zugerudert, so daß wir ziemlich gleichzeitig an dieses sprangen und ihnen mit Flinten, Pfeil und Bogen nacheilten. Sowie wir die waldige Umzäunung durchbrachen, bemerkten wir, daß sich die beiden Flüchtlinge in den zwei Meter hohen Schneidegräsern und Rohr, welches eine unübersehbare Fläche bedeckte, zu verbergen suchten. Unsere Meute befand sich in dem etwas zurückgebliebenen dritten Boote, und verdutzt standen wir Europäer vor der gewaltigen Wand, vor der wir von früheren Erfahrungen her heiligen Respekt bekommen hatten. Unsere Indianer aber konnte sie nicht abhalten, und wie die Schlangen verschwanden sie zwischen den gefährlichen Gräsern. Zwei kurz aufeinander fallende Schüsse und das triumphirende Aufjauchzen der Jäger verkündeten ihr Glück. Alles drängte jetzt der Richtung zu; wir erhielten dadurch einen weniger gefährlichen Weg, und bald fanden wir die beiden glücklichen Jäger, sich auf ihre Gewehre stützend, vor dem eben verendeten alten Tapir stehen. Pureka's Kugel hatte, wie sich bei dem Zerlegen herausstellte, die Lunge des Thieres durchbohrt. Es war ein Weibchen von ungewöhnlicher Größe. Noch umstanden wir in dichtem Kreise die willkommene Beute, als uns das wilde Durchbrechen des Grases und Rohres die Ankunft der Hunde bekundete, welche gierig den Schweiß des Tapirs aufleckten. Jetzt begann die Jagd aus das Junge, dessen Spur unsere trefflichen Hunde bald aufgefunden hatten. Sobald das geängstigte Thier sich entdeckt sah, ließ es einen durchdringenden, pfeifenden Ton hören; noch aber konnten wir nichts sehen, bis uns die pfeifenden, gellenden Töne verriethen, daß das Thier dem Saume des hohen Rohres, dem offenen Felde zugetrieben würde, weshalb wir so schnell als möglich nach einer nahen Erhöhung eilten, um die Jagd anzusehen. Kaum waren wir dort angekommen, als das Thier aus dem Rohre hervorbrach, hinter ihm die klaffende Meute und unsere dreißig Indianer, welche im Laufen mit den Hunden gleichen Schritt hielten, und in deren Jauchzen und Jubeln das Hundegebell und Angstgeschrei des Tapirs fast erstarb. Es war ein eigenthümliches Schauspiel, eine Jagd, wie ich sie noch nie gesehen! Die Kräfte des gehetzten Wildes ermatteten sichtbar, und bald hatte es unser trefflicher Jagdhund gestellt, worauf es die Indianer, nach einem harten, aber vergeblichen Widerstande, mit gebundenen Füßen, unter betäubendem Jubel und noch wilderem Hundegebell nach dem Fahrzeuge trugen. Es hatte die Größe eines fast ausgewachsenen Schweines.
»Jetzt galt es, den alten Tapir nach der Sandbank zu bringen, was uns erst mit Aufwendung der Gesammtkräfte gelang, indem wir dem Riesen ein langes Seil an die Hinterfüße befestigten und ihn so unter Jubel und Jauchzen dahinschleppten. Bald war das große Thier von vielen rührigen Händen zerlegt. Ein Theil des Fleisches wurde geräuchert, der andere gekocht. Das Fleisch fanden wir ungemein wohlschmeckend: es hatte nicht allein in Bezug auf den Geschmack, sondern auch in seinem Aussehen viel Ähnlichkeit mit dem Rindfleische. Als wir das Thier ausweideten, fingen die Indianer sorgfältig das Blut auf, mischten klein geschnittene Fleischstücke darunter und füllten die Masse in die Därme. Sie kochten diese Würste aber nicht, sondern räucherten sie. Ich kostete die Wurst einmal und nicht wieder.«
Die Ansiedler jagen den Tapir regelmäßig, entweder mit Hunden, welche ihn aus dem Walde ins Freie und den Reitern zutreiben, oder indem sie in der Nähe seiner Wechsel auf ihn anstehen, oder endlich, indem sie ihn im Wasser verfolgen. Hierüber gibt Prinz von Wied Auskunft. »Die Brasilianer«, sagt er, »betreiben die Jagd des Tapirs so unzweckmäßig als möglich. Um ein so großes Thier zu erlegen, bedienen sie sich nicht der Kugeln, sondern schießen es mit Schrot, gewöhnlich, wenn sie es schwimmend in den Flüssen am frühen Morgen oder gegen Abend überraschen. Der Tapir sucht durch dieses Mittel seinen Verfolgern im Wasser zu entrinnen. Allein die Brasilianer rudern mit ihren Böten äußerst schnell heran und pflegen das Thier einzuschließen. Dieses taucht dann sehr geschickt und häufig unter, selbst unter den Booten hindurch, bleibt lange unter Wasser und kommt bloß zuweilen mit dem Kopfe an die Oberfläche, um Luft zu schöpfen. Dann zielen sogleich alle Rohre nach diesem Theile, besonders nach der Ohrgegend, und ein Tapir erhält auf diese Art zwölf bis zwanzig Schüsse, bevor er getödtet wird. Häufig entkommt er dennoch, wenn nicht ein Jagdhund bei der Hand ist. Mit einer Kugel würde man das ermüdete Thier in einer kleinen Entfernung sehr sicher erlegen können; allein die Brasilianer bedienen sich niemals dieses Geschosses, weil sie im vorkommenden Fall mit ihren groben, schweren Schroten ebensowohl einen Tapir als ein Wildhuhn erlegen können.«
Die Wilden suchen den Tapir nach seiner Fährte auf, umstellen ihn, nachdem sie seinen Aufenthalt erspäht, und treiben ihn dann den Schützen zu. Azara sagt, daß dieses Wild einen starken Schuß vertrüge und selbst dann, wenn ihm eine Kugel durch das Herz gedrungen wäre, noch mehrere hundert Schritte zurücklege, bevor es stürze.
In Paraguay durchstechen die Jäger einem lebendig gefangenen jungen Tapir, welcher zu groß ist, als daß sie ihn aufs Pferd nehmen könnten, von einem der Nasenlöcher aus den Obertheil des Rüssels und ziehen einen Lederriemen durch die Oeffnung, um ihn mit sich zu führen. Jede zerrende Bewegung verursacht dem Thiere heftigen Schmerz, und es folgt deshalb zuletzt seinem Führer ohne Widerstreben.
Schlimmere Feinde noch, als die Menschen es sind, mögen die Tapire in den großen Katzen haben, welche mit ihnen dieselbe Heimat bewohnen. Daß die amerikanischen Arten vom Jaguar hart verfolgt werden, versichern alle Reisenden; das Gleiche wird wohl vom Schabrackentapir hinsichtlich des Tigers anzunehmen sein. Es wird erzählt, daß der Tapir, wenn der Jaguar ihm auf den Nacken springe, so eiligst als möglich in das verschlungenste Dickicht sich stürze, um den bösen Feind von sich abzustreifen, und daß er, da seine Haut die Krallen des Raubthieres kaum durchdringen lasse, oft auch glücklich davon käme. Die Angabe dürfte nicht so unglaublich sein als sie scheint; Schomburgk versichert wenigstens, daß er viele Tapire erlegt habe, welche bedeutende, von ihrem Zusammentreffen mit den Katzen herrührende Narben an sich trugen.
Von der Gemeinsamkeit der Merkmale, welche berechtigt, Tapire und Nashörner innerhalb einer und derselben Unterordnung zu vereinigen, wird bei einer rein äußerlichen Betrachtung und Vergleichung beider Thiere wenig ersichtlich; es bedarf vielmehr der Zergliederung, um die verhältnismäßig nahe Verwandtschaft der von ihnen vertretenen Familien zu erkennen.
Die Nashörner ( Nasicornia) sind plump gebaute, ungeschlachte Dickhäuter von ziemlich bedeutender Größe, ausgezeichnet durch auffallend gestreckten Kopf, dessen vorderer Gesichtstheil ein Horn oder zwei hinter einander stehende Hörner trägt, kurzen Hals, kräftigen, in eine panzerartige Haut gehüllten, fast gänzlich oder größtentheils unbehaarten Leib, kurzen Schwanz und kurze, stämmige, jedoch keineswegs plumpe Beine, deren Füße vorn wie hinten drei mit Hufen umkleidete Zehen haben. Jeder einzelne Leibestheil erscheint, auch wenn man ihn mit dem entsprechenden anderer Dickhäuter vergleicht, eigenthümlich und absonderlich. Der Kopf ist schmal und sehr gestreckt, zumal der Antlitztheil ungewöhnlich verlängert und vorgezogen, der Schädeltheil dagegen von vorn nach hinten stark zusammengedrückt, so daß die Stirn ungemein steil abfällt und zwischen ihr und dem merklich erhöhten Nasentheile ein in der Mitte tief eingebuchteter, seitlich scharf gewölbter Sattel entsteht; der Winkel des Unterkiefers deutlich hervortretend, dieser im übrigen mit mehr oder minder starker Wölbung gegen das Maul zu aufwärts steigend; das Maul unverhältnismäßig klein, die Oberlippe in ihrer Mitte in Gestalt eines finger- oder rüsselartigen Fortsatzes vorgezogen, die Unterlippe gerundet oder vorn gerade abgeschnitten; das länglich eiförmige, hinten spaltartige Nasenloch fast wagerecht gestellt und von dem anderen durch einen weiten Zwischenraum getrennt; das Auge auffallend klein, sein länglich runder Stern quer gestellt, sein oberes Lid dicht, aber kurz bewimpert; das nicht ungewöhnlich gestaltete Ohr eher groß als klein, sein äußerer Rand gerundet, sein innerer Rand bis zur Hälfte der Länge umgestülpt. Der kurze, stets faltige Hals übertrifft den Kopf an Dicke und geht ohne merklichen Absatz in den massigen Leib über, welcher sich ebenso durch die schneidige, in der Mitte eingesenkte Rückenfirste und den allseitig gerundeten und hängenden Bauch wie dadurch auszeichnet, daß der Widerrist das Kreuz an Höhe um etwas überragt; der kurze Schwanz ist entweder gegen die Spitze hin seitlich stark zusammengedrückt und dann bis zu seinem Ende beinahe gleich breit, oder gestreckt kegelförmig. Die Beine, welche sehr starke und breite Schultern und Oberschenkel, aber ziemlich schmächtige Oberarme und Unterschenkel sowie noch mehr verdünnte Hand- und Fußwurzeln haben, krümmen sich wie bei einem Dachshunde von außen nach innen und strecken sich erst von der Handwurzel oder Ferse an senkrecht nach unten; die Füße verbreitern sich vorn wie hinten gleichmäßig zu dem Fußballen, dessen Sohlenfläche rundlich eiförmig ist; unter den nicht unzierlichen Hufen ist der mittlere etwa doppelt so breit als die beiden seitlichen. Die stets sehr dicke, bei den meisten Arten panzerartige Haut schließt sich dem Leibe entweder bis auf wenige und nicht stark hervortretende Falten an, oder zerfällt in mehrere durch tiefe Falten bestimmt getrennte Schilder, welche einzig und allein durch jene Falten eine gewisse Beweglichkeit erlangen, indem sie sich an den mit dünnerer und schmiegsamerer Haut ausgekleideten Faltenfurchen übereinander wegschieben lassen. Tiefe Runzeln umgeben Auge und Maul und ermöglichen das Oeffnen oder Schließen der Lider und eine unerwartete Schmiegsamkeit der obschon fast hornigen, doch sehr beweglichen Lippen. Netzartige Riefen durchkreuzen sich auf der Haut, begaben sie mit einer bemerkbaren Zeichnung und buckelartigen Erhebungen von sehr regelmäßiger Gestalt und verleihen ihr, zumal den Schildern, einen ebenso absonderlichen wie gefälligen Schmuck. Die Behaarung beschränkt sich auf eine mehr oder weniger lange Umsäumung der Ohren und der breitgedrückten Schwanzspitze sowie bei einzelnen Arten auf einige Stellen des Rückens, woselbst dann spärlich dicke und kurze Borsten stehen. Die Hörner, Gebilde der Oberhaut, bestehen aus gleichlaufenden, äußerst feinen, runden oder kantigen, innen hohlen Fasern von Hornmasse und ruhen mit ihrer breiten, rundlichen Wurzelfläche auf der dicken Haut, welche den vorderen Theil des Gesichtes bekleidet. Nicht selten, obschon immer nur bei einzelnen Stücken, zeigt die Oberhaut an verschiedenen Stellen, zumeist aber am Kopfe, hornartige, bis zu mehreren Centimetern sich erhebende Wucherungen.
Plumpe und kräftige Formen kennzeichnen auch das Geripp. Der Schädel erscheint sehr lang und viel niedriger als bei den übrigen Dickhäutern; die Stirnbeine nehmen den vierten oder dritten Theil der Schädellänge ein und verbinden sich unmittelbar mit den breiten und starken Nasenbeinen, welche die Nasenhöhle überwölben oder von einer mittleren Scheidewand noch gestützt werden. Da, wo das Horn ruht, ist dieser Knochen uneben, rauh, höckerig und wird dies umsomehr, je größer die Hörner sind. Der Zwischenkiefer ist bloß bei den Arten, welche bleibende Schneidezähne haben, ansehnlich; bei jenen dagegen, welche diese Zähne in frühester Jugend verlieren, verkümmert. Die Wirbelsäule wird von starken, mit langen Dornen besetzten Wirbelkörpern gebildet; achtzehn bis zwanzig von ihnen tragen stark gekrümmte, dicke und breite Rippen; das Zwerchfell setzt sich aber schon am vierzehnten bis siebzehnten Wirbel an. Bereits in früher Jugend verwachsen die fünf Wirbel, welche das Kreuzbein bilden, zu einem Ganzen. Der Schwanz besteht aus zweiundzwanzig bis dreiundzwanzig Wirbeln. An allen übrigen Knochen ist ihre Stärke und Plumpheit das auffallendste. Dem Gebisse fehlen regelmäßig die Eckzähne und gewöhnlich auch die vier Schneidezähne in beiden Kiefern; letztere sind in der Jugend zwar vorhanden, fallen aber so bald aus, daß man sie nur bei sehr jungen Stücken wahrnimmt. Das übrige Gebiß besteht aus sieben Backenzähnen in jedem Kiefer, von denen jeder einzelne aus mehreren Hügeln und Pfeilern zusammengeschmolzen zu sein scheint, und deren Kauflächen sich mit der Zeit so abnutzen, daß verschiedenartige Zeichnungen entstehen.
Auch die Weichtheile verdienen mit einigen Worten beschrieben zu werden. Die Haut der Oberlippe ist sehr dünn, gefäß- und nervenreich, die Zunge groß und empfindlich. Die Speiseröhre hat eine Weite von 8 Centim. und eine Länge von 1,6 Meter; der Magen ist einfach länglich, im Längsdurchmesser 1,3 Meter und im größten Querdurchmesser 60 Centim.; die kleinen Gedärme messen 15 bis 18 Meter; der Blinddarm ist 1 Meter, der Dickdarm 6 bis 8 Meter, der Mastdarm 1 bis 1,6 Meter lang. Unter den Sinneswerkzeugen fallen die Augen durch ihre geringe Größe auf.
Die Nashörner, welche gegenwärtig Südasien, die Sundainseln und alle Gleichenländer Afrikas bewohnen, und deren Verbreitung insofern bemerkenswerth ist, als in Asien das Festland sowohl wie jede einzelne der drei großen Sundainseln bestimmte, wohl unterschiedene Arten beherbergt, wogegen in Afrika wahrscheinlich nur zwei Arten leben, waren in der Vorzeit weiter verbreitet und kamen ebenso im südlichen Deutschland, in Frankreich und England wie in Rußland und Sibirien vor. Unter den bis jetzt bekannt gewordenen ausgestorbenen Arten verdient namentlich eine der Erwähnung: das zweihörnige Vorweltsnashorn mit knöcherner Nasenscheidewand ( Rhinoceros trichorhinus) nämlich, weil es nicht bloß in einzelnen Knochen, sondern mit Haut und Haaren bis auf unsere Tage gekommen ist. Im nördlichen Asien vom Don an bis zur Behringsstraße gibt es keinen Fluß im ebenen Lande, an dessen Ufer nicht Knochen von vorweltlichen Thieren, namentlich solcher von Elefanten, Büffeln und Nashörnern, gefunden würden; auch habe ich schon erwähnt, daß man hier alljährlich beim Aufthauen Massen von vorweltlichem Elfenbein gewinnt und damit einen sehr bedeutenden Handel treibt. »Als ich«, so berichtet Pallas, »im März 1772 nach Jakutzk kam, zeigte mir der Statthalter des östlichen Sibirien den Vorder- und Hinterfuß eines Nashorns, welcher noch mit Haut überzogen war. Das Thier wurde im sandigen Ufer eines Flusses gefunden. Den Rumpf und die Füße ließ man liegen.« Nun bemühte sich Pallas, mehr zu erfahren, und brachte zunächst den Kopf und den Fuß nach Petersburg. Später hat Brandt die Reste untersucht, und so erfahren wir, daß dieses vorweltliche Nashorn, welches während der Schwemmzeit das mittlere und nördlichere Europa und den Norden Asiens bewohnte, neben dem Mammuth einer der gemeinsten Dickhäuter unseres Welttheils war. Außer in Sibirien fand man seine Knochen auch noch in Rußland, Polen, Deutschland, England und Frankreich und zwar an manchen Orten in erstaunlicher Menge. Das hauptsächlichste Artkennzeichen dieses Thieres besteht darin, daß die bei allen anderen Nashörnern knorpelige Nasenscheidewand bei ihm verknöchert ist, wahrscheinlich bedingt durch die auffallende Verlängerung der Nasenbeine. Ebenso weicht das Thier hinsichtlich seines Kleides von den anderen Nashörnern ab. Die getrocknete Haut hat eine schmutzig gelbliche Farbe und keine Falten, ist aber dick, an den Lippen gekörnelt und überall mit netzförmigen, rundlichen Poren dicht besetzt. Die Haare, straffe Grannen und weiches Wollhaar, stehen in den Poren büschelförmig beisammen; im übrigen ähnelt das Thier den jetzt lebenden so außerordentlich, daß es höchstens einer anderen Untersippe zugezählt werden kann. Seine Nahrung scheint in Nadeln und jungen Trieben der Kiefern bestanden zu haben; doch ist darüber nichts sicheres bekannt.
Unsere Kenntnis der jetzt lebenden Arten ist zwar in der neuesten Zeit wesentlich bereichert worden, darf aber keineswegs als befriedigend bezeichnet werden. Streng genommen kennen wir bloß diejenigen Arten wirklich, welche neuerdings lebend in unsere Thiergärten gelangt sind und von kundigen Forschern untereinander verglichen werden konnten. Gray hat im Jahre 1867 die Familie einer neuen Durchsicht und Bearbeitung unterzogen und dadurch, mit Recht oder mit Unrecht bleibe dahingestellt, mancherlei Zweifel und Widersprüche hervorgerufen; gleichwohl darf seine Auffassung einstweilen als maßgebend erachtet werden und somit unter zweckmäßiger Beschränkung auch uns als Leitfaden dienen.
Nach Gebiß und Faltung unterscheidet Gray drei Hauptgruppen der Familie und theilt jene wiederum in verschiedene Sippen, denen wir den zweifelhaften Rang von Untersippen zusprechen dürfen. Zu der ersten Gruppe rechnet er alle Arten mit schildartig getheilter, zur zweiten die mit glatter Haut, zur dritten das erwähnte Vorweltsnashorn.
Ein Horn und wohlentwickelte Hals- und Lendenfalten, welche mit den übrigen den harnischartig abgetheilten Hautpanzer begrenzen und schildartige Flächen umgeben, ein Schneidezahn in jeder Ober-, zwei in jeder Unterkieferhälfte sowie vier Lück- und drei Backenzähne jederseits oben und unten, also vierunddreißig Zähne, kennzeichnen nach dieser Auffassung die Panzernashörner ( Rhinoceros), vertreten durch zwei wohlbekannte und mehrere nur auf dem Schädel begründete, noch gegenwärtig lebende wie ausgestorbene Arten.
Das Nashorn oder Einhorn, gewöhnlich indisches Nashorn genannt ( Rhinoceros unicornis, Rhinoceros indicus, asiaticus und inermis), erreicht, einschließlich des 60 Centim. langen Schwanzes, 3,75 Meter Gesammtlänge, 1,7 Meter Schulterhöhe und etwa 2000 Kilogramm an Gewicht. Sehr kräftig und plump gebaut, zeichnet es sich vor seinen Verwandten aus durch den verhältnismäßig kurzen, breiten und dicken Kopf und die nur ihm eigene Abgrenzung der Schilder. Der Sattel zwischen der sehr steil abfallenden Stirne und dem bis 55 Centim. hohen, kräftigen, mit der Spitze mäßig zurückgebogenem Horne ist tief, aber kurz, die Unterkinnlade flach gewölbt, das Ohr lang und schmal, an seinem Rande bürstenartig mit kurzen Haaren bekleidet, das Maul groß, die Unterlippe breit und eckig, der rüsselförmige Fortsatz der Oberlippe kurz, der bis zur Kniekehle herabreichende, in der tiefen Afterfalte gewöhnlich größtentheils versteckte, beziehentlich sie deckende Schwanz an der Spitze von beiden Seiten her abgeplattet und hier ringsum zeilig behaart. Die großen, vorn gewölbten, unten scharf abgeschnittenen Hufe lassen die langgestreckte, herzförmig gestaltete, kahle, schwielige, harte Sohle zum größeren Theile frei. Die Geschlechtstheile sind sehr groß, die männlichen höchst sonderbar gebildet; das Euter des Weibchens enthält nur ein einziges Zitzenpaar. Eine ungewöhnlich starke Haut, welche viel härter und trockener als beim Elefanten ist und auf einer dicken Schicht lockeren Zellgewebes liegt, so daß sie sich leicht hin- und herschieben läßt, deckt den Körper und bildet einen in Schilde getheilten, hornartigen Panzer, welcher durch mehrere regelmäßig verlaufende, tiefe, bereits bei neugeborenen Thieren vorhandene Falten unterbrochen wird. An den Rändern dieser Falten ist die Haut wulstig aufgeworfen, in ihrer Mitte aber sehr verdünnt und weich, während sie sich sonst wie ein dickes Bret anfühlt. Hinter dem Kopfe zieht sich die erste starke Falte senkrecht am Halse herab, unten eine Querwamme bildend; hinter ihr steigt, von ihr schief nach oben und rückwärts, eine zweite Falte auf, welche anfangs sehr tief ist, gegen den Widerrist hin sich aber verflacht und verschwindet. Sie sendet unterhalb ihrer Mitte eine dritte Falte ab, welche sich schief vorwärts am Halse hinaufzieht. Hinter dem Widerriste zeigt sich eine vierte tiefe Falte, welche über den Rücken weg und beiderseits in einer bogenförmigen Krümmung hinter der Schulter hinabläuft, sich unten quer über das Vorderbein hinwegzieht und vorn um dasselbe herumschlingt. Eine fünfte Falte beginnt am Kreuze, steigt schief und vorwärts an den Schenkeln hinab, wendet sich in den Weichen um, richtet sich nach vorn und verschwindet dort, sendet aber vorher einen Zweig ab, welcher anfangs den Vorderrand des Hinterbeines umgibt, sodann sich wagerecht über das Schienbein zieht und zum After hinaufsteigt, von wo aus eine starke Wulst wagerecht über die Schenkel verläuft. Durch die beiden vom Rücken abwärts gerichteten Falten wird die Haut in drei breite Gürtel geschieden, von denen der erste auf Hals und Schultern, der zweite zwischen diesen und den Lenden und der dritte auf dem Hintertheile liegt; durch die Querfalten werden diese Gürtel, mit Ausnahme des mittleren, den Leib deckenden, in Schilde getheilt, und es bildet sich somit ein Schild im Nacken, eins auf jeder Schulter, eins auf dem Kreuze und eins auf jedem Schenkel. Die bis auf die angegebenen Stellen nackte Haut ist überall mit unregelmäßigen, rundlichen, mehr oder weniger glatten, hornartigen Warzenschilderchen bedeckt, welche auf der Außenseite der Beine so dicht zusammentreten, daß diese aussehen, als ob sie mit einem schuppigen Panzerhemde bekleidet wären, wogegen Bauch- und Innenseite der Beine durch mannigfach sich durchkreuzende Furchen in kleine Felder getheilt sind. Um die Schnauze ziehen sich Querrunzeln. Bei jungen Thieren brechen einzelne harte, dicke, borstenartige Haare hier und da hervor. Die Färbung ist verschieden, bei alten Thieren einförmig dunkelgraubraun, mehr oder minder ins Röthliche oder ins Bläuliche spielend. In der Tiefe der Falten ist die Haut blaßröthlich oder bräunlich fleischfarben. Staub, Schlamm und andere Einwirkungen von außen lassen das Kleid dunkler erscheinen, als es ist. Junge Thiere sind viel heller als alte.

Nashorn.
Wie schon aus der von Albrecht Dürer herrührenden und von Geßner wiedergegebenen, ersten bekannten Abbildung des Nashorns hervorgeht, finden sich bei einzelnen alten Nashörnern Hautwucherungen an verschiedenen Stellen des Leibes, welche mit dem auf der Nase sitzenden Horne eine größere oder geringere Aehnlichkeit haben. Zuweilen häufen sich diese Wucherungen in auffallender Weise. So lebt seit nunmehr sechzehn Jahren ein etwa achtzehn Jahre altes Nashorn im Thiergarten zu Antwerpen, bei welchem die Hauthörner sehr bemerklich sind. Veränderlich in Größe und Gestalt, gleichen sie sich doch darin, daß sie aus einer vollständig verhornten Hautmasse bestehen. Wie Mützel mir mittheilt, zeigte das Thier in diesem Jahre (1875) auf dem Kopfe wie auf allen bedeutenderen Erhebungen der Falten solche Hautwucherungen in ziemlicher Anzahl. Diejenigen, welche auf den Augenbrauenwülsten saßen, hatten nur Haselnußgröße, während alle übrigen viel augenfälliger waren. So trug das Thier auf den sehr stark hervorragenden Jochbeinen jederseits drei bis vier 2,5 bis 7 Centim. starke, abgeschliffene Hörner, auf jedem der von einer mächtigen, vor den Ohren liegenden Hautfalte bedeckten Scheitelhügel dagegen eine hornartige Wucherung und auf der obersten Krümmung der Kehlfalte ein ebenso dickes, mindestens 12 Centim. langes Horn, welches mit den daneben aufgewucherten Gebilden eine Pyramide darstellte. Die ganze Gruppe richtete sich nach hinten und war wie die meisten übrigen auf der vorderen Fläche abgeschliffen. Zwischen den Stirn- oder Scheitelhügeln bemerkte man ähnliche Wucherungen von Haselnußgröße, welche eine durch Abfallen eines derartigen Horngebildes entstandene Narbe von 4 Centim. Durchmesser umgaben. Von der Mitte des Halses erhoben sich fünf senkrechte Hörner, von denen das mittelste 8 Centim. an Höhe erreicht hatte. Aehnliche Gebilde fanden sich endlich auf der Höhe der Kreuzbeinfalte und am oberen Theile des Schwanzes. Die einen wie die anderen sind durchaus verschieden von den breiten, faltigen Warzen, welche die großen Seitenflächen des Nashorns bedecken. Ihre seitliche Oberfläche ist längs gerieft; die glatte Schlifffläche hat horngelbliche Färbung. Nach Aussage des Wärters fallen diese Hautwucherungen von Zeit zu Zeit ab, und es entstehen dann Narben, welche denen an der Rosenstelle eines abgeworfenen Hirschgeweihes in gewisser Hinsicht ähneln.
Das Verbreitungsgebiet des Nashorns scheint auf die indische Halbinsel beschränkt zu sein.
Der einzige bis jetzt nach Anschauung des lebenden Thieres bekannte Sippschaftsverwandte des Nashorns ist das Waranashorn, Wara der Javaner, Javanashorn der europäischen Händler ( Rhinoceros sondaicus, Rhinoceros javanicus und javanus), eine der kleinsten Arten der Familie, welche, bei 1,4 Meter Schulterhöhe, einschließlich des 50 Centim. langen Schwanzes, etwa 3 Meter an Länge erreicht. Abgesehen von der geringeren Größe, unterscheidet sich die Wara durch den gestreckteren, vor der Stirne nicht so tief eingebuchteten Kopf, das kürzere, höchstens bis 25 Centim. an Länge erreichende Horn, den längeren rüsselförmigen Fortsatz der Oberlippe, die Anordnung der Schilde und die Gestalt der Hautbuckel von dem Nashorn. Das Nackenschild der Wara trennt sich schärfer und reicht, nach unten hin in eine stumpfe Spitze auslaufend, bis zum unteren Drittheil der Halshöhe, also viel weiter herab, ist dagegen merklich schmäler oder minder lang als beim Nashorn und läßt auf dem Widerriste so viel Raum, daß die bei dem Nashorn durch das Nackenschild getrennten Schulterschilde in einander übergehen können und demgemäß einen einzigen, von einem Elnbogen zum anderen sich erstreckenden, unten breiten, nach oben sich verschmälernden Gürtel bilden. Die Hautbuckel sind viel kleiner als beim Nashorn, fünf- oder mehrseitig, mosaikartig dicht nebeneinander gestellt und in der Mitte vertieft, tragen auch hier je eine oder mehrere kurze, schwarze Borsten, welche zwar an den Seiten von älteren Thieren regelmäßig abgerieben werden, auf dem Rücken aber gemeiniglich zur Geltung kommen und die Haut hier mit einem schwachen, wie angeflogenen Haarkleide bedecken. Die Färbung des Thieres ist ein schmutziges Graubraun.
So weit unsere Kenntnis reicht, findet sich die Wara ausschließlich auf Java.
Halbpanzernashörner möchte ich die Arten nennen, welche Gray in einer besonderen Sippe ( Ceratorhinus) vereinigt. Ihre Merkmale liegen in dem von der Stirn an sanft abfallenden, langgestreckten Kopfe, aus dessen Nasen- und Gesichtstheil hintereinander zwei verhältnismäßig kurze Hörner stehen, den breiten, rundlichen Ohren, der zugerundeten Unterlippe und den unvollständigen Hals- und Lendenfalten, welche die Panzerhaut in Gürtel, nicht aber in Schilder theilen. Das Gebiß ist ebenso zusammengesetzt wie das der Arten der vorhergehenden Gruppe. Man kennt zwei lebende Halbpanzernashörner und rechnet eine ausgestorbene Art hinzu.
Das Badak- oder Halbpanzernashorn, Badak der Bewohner der Sundainseln, Sumatranashorn der europäischen Händler ( Rhinoceros sumatranus, Rhinoceros sumatrnsis und Crossii, Ceratorhinus sumatranus), steht an Größe wenig oder nicht hinter dem indischen Nashorn zurück, ist aber, nach Mützels Befund, schlanker gebaut und hochbeiniger als dieses, macht auch wegen der schwächer entwickelten Falten einen minder schwerfälligen Eindruck. An dem mäßig langen Kopfe treten die Stirnhügel weniger hervor, und die Augen erscheinen deshalb nicht so tiefliegend wie bei dem Verwandten. Den vorderen Theil des Maules deckt eine halbkugelige hornige Panzerkappe, welche die Nasenlöcher fast verbirgt und nur dem untersten Lippenrande Beweglichkeit gestattet. Die ausgestreckte Unterlippe nimmt eine rundlöffelige Gestalt an. Die mittelgroßen Ohren tragen an der Innenfläche des Außenrandes einen dicken Haarbusch, am inneren Ohrrande einen dichtstehenden wimperartigen Besatz von röthlicher Färbung. Die Halsfalten unterscheiden sich kaum von denen des indischen Verwandten, die Hautabtheilung jedoch, welche die Schulter bedeckt, fällt, auf der Mitte des Oberarmes eine Falte bildend, mit ihrem unteren Rande tief herab; eine zweite, aus der Halsgrube entspringende Falte verläuft unter und hinter dem Elnbogen und hängt zusammen mit einer dritten, welche hinter dem Widerriste das Rückgrat überschreitet; die Falte, welche den Leib gegen die Schenkel zu begrenzt, reicht kaum über die Leistengegend hinauf und ist auf dem Hüftkamme vollständig abgeflacht; die Falten der Hinterschenkel zeigen in ihrer Anlage zwar große Aehnlichkeit mit den entsprechenden des indischen Nashorns, sind jedoch so schwach, daß sie, mit Ausnahme der über den Fersen liegenden, nur als angedeutet bezeichnet werden dürfen. Der mittellange Schwanz ist gegen das Ende hin mit einer dünnen Quaste geziert. Nur an wenigen Stellen finden sich auf der im allgemeinen glatten Haut kaum bemerkbare rosettenartige Knoten. Die über den ganzen Leib sehr vereinzelt verbreiteten schweinsborstenartigen schwarzbraunen Haare stehen im Nacken und an den Bauchseiten am dichtesten. Hinsichtlich der Färbung weicht das Halbpanzernashorn wenig von den Verwandten ab: ein schwer zu beschreibendes Graubraun ist die Grundfarbe; Stirnhügel, Augengegend und Nasenkappe sehen dunkelbraun aus.
Das Halbpanzernashorn bewohnt ausschließlich Sumatra, wird aber in Hinterindien und auf der Halbinsel von Malakka durch des neuerdings von Sclater unterschiedene Rauohrnashorn ( Rhinoceros lasiotis ) vertreten.
Achtundzwanzig Zähne, und zwar vier Lück- und drei Mahlzähne jederseits, oben wie unten, bilden das Gebiß der afrikanischen Nashörner, welche Gray ebenfalls in Untersippen zerfällt. Ihre glatte, gleichförmige und haarlose Haut ist nur an der Verbindungsstelle von Hals und Leib deutlich gefaltet und weder in Schilde noch in Gürtel getheilt; die Bewaffnung besteht aus zwei schlanken, hintereinander stehenden Hörnern. Bei den Spitznashörnern ( Rhinaster), welche die eine Untersippe der Abtheilung bilden, ist der Kopf verhältnismäßig kurz, der Antlitztheil seitlich stark gewölbt, die Nase gerundet, die Oberlippe mit einem rüsselförmigen Fortsatze versehen, die Unterlippe spitz gerundet, der Schwanz nicht seitlich zusammengedrückt, sondern fast vollkommen rund und kegelförmig zugespitzt.

Doppelnashorn ( Rhinoceros bicornis). 1/30 natürl. Größe.
Der bekannteste Vertreter der Gruppe und Abtheilung ist das Doppelnashorn, von den Betschuanen Borele, von den Arabern Anasa und Fertit, Amharisch Awaris, Tigrenisch Aris, von den Somalis Wuil, von anderen Eingeborenen Gedangik, Tschal, Gargadân und von den Boers am Vorgebirge der Guten Hoffnung Schwarznashorn genannt ( Rhinoceros bicornis, Rhinoceros africanus, Brucei und niger, Rhinaster bicornis), welches ich nach einem fast erwachsenen Weibchen des Berliner Thiergartens beschreibe. Der Kopf mag kürzer sein als bei anderen afrikanischen Nashörnern, ist aber verhältnismäßig länger als bei den Panzernashörnern, der hintere Theil desselben stark vortretend, der Gesichtstheil von der Stirne an sattelförmig sanft eingebuchtet, der Unterkiefer merklich nach aufwärts gebogen, das Maul klein, der rüsselförmige Fortsatz der Oberlippe deutlich, aber nicht auffallend entwickelt, die Unterlippe stumpf gerundet, jede Lippe mit tiefen, weit ausgedehnten, vielfach sich verzweigenden Runzelfalten bedeckt, das ringsum von Runzeln umgebene Auge sehr klein, sein Stern eirund, das Ohr, um dessen Wurzel herum ebenfalls einige Runzelfalten verlaufen, kurz und breit, nur an der Wurzel des umgestülpten Innenrandes mit sehr kurzen, aber dicken Haaren bekleidet, das erste Horn mit eirunder Wurzelfläche aufgesetzt, auch im ferneren Verlaufe seitlich zusammengedrückt, nach vorn und oben gewölbt, mit der Spitze etwas zurückgekrümmt, das zweite, meist kürzere Horn am Grunde vorn und hinten flach gekielt, wodurch der Querschnitt die Gestalt eines verschobenen länglichen Vierecks mit abgerundeten Ecken erhält, fast gerade empor oder ein wenig nach vorn gerichtet. Der kurze und dicke, den Kopf an Umfang merklich übertreffende Hals erhebt sich nach dem Widerriste zu und trägt eine durch zwei ziemlich tiefe Falten von dem Kopfe und den Schultern getrennte Querwamme; der Leib ist sehr gestreckt, seine Nacken- und die in der Mitte etwas eingesenkte Rückenfirste schneidig, der Kreuztheil verbreitert und, obwohl die Hüftknochen deutlich erkennbar zu sein pflegen, gerundet; der Schwanz hängt schlaff herab; die ebenfalls stark einwärts gekrümmten Beine erscheinen höher als bei den Panzernashörnern, sind durchaus nicht unförmlich dick, im Handtheile sogar zierlich gebaut und haben wohlgestaltete Ballen mit Hufen, welche von dem allgemeinen Gepräge nicht abweichen. Außer den erwähnten beiden Halsfalten bemerkt man noch eine kurze hinter dem Schultertheile des Vorderbeines und eine längere vor der Einlenkungsstelle des Hinterbeines, in der Schenkelfuge; im übrigen ist die dicke und haarlose Haut bis auf die angegebenen Runzeln gleichmäßig glatt und zeigt erst bei genauer Besichtigung unendlich viele sich kreuzende und sonstwie durchschneidende Riefen, zwischen denen sich kleine vielgestaltige Felder bilden. Die Färbung ist ein schmutziges Rothbraun. Vollkommen ausgewachsene Männchen sollen bei 1,6 Meter Schulterhöhe, einschließlich des etwa 60 Centim. messenden Schwanzes, eine Gesammtlänge von 4 Meter erreichen.
Das Verbreitungsgebiet des Doppelnashorns erstreckt sich noch heutigen Tages über ganz Mittelafrika, vom 18. Grade nördlicher bis zum 24. Grade südlicher Breite und steigt vom Meeresgestade bis zu 2600 Meter unbedingter Höhe empor.
Erfahrene Jäger glauben von dem Doppelnashorn den Keitloa der Betschuanen unterscheiden zu dürfen. A. Smith sah sich veranlaßt, das in Frage stehende Thier unter seinem Landesnamen ( Rhinoceros Keitloa ) als selbständige Art aufzuführen; Schinz benannte es ebenfalls ( Rhinoceros Camperi), und Gray, welcher das von Smith beschriebene Stück untersuchen konnte, hält die vermeintliche Art aufrecht. So viel ich ergründen konnte, wird als wesentliches Unterscheidungsmerkmal die Beschaffenheit der Hörner angenommen, welche von denen des Doppelnashorns dadurch sich unterscheiden sollen, daß das hintere länger ist als das vordere. Auf so wenig bedeutsame Merkmale läßt sich aber eine Art nicht begründen, und deshalb wird es kein Fehler sein, wenn ich einstweilen den Keitloa höchstens als sehr altes Doppelnashorn ansehe. Hinsichtlich ihrer Verbreitung, ihres Wesens und Gebarens unterscheiden sich beide nicht.
Dagegen kann es keinem Zweifel unterliegen, daß das Stumpfnashorn von dem Doppelnashorn artlich getrennt werden muß; nur fragt es sich sehr, ob Gray wirklich berechtigt war, es zum Vertreter einer besonderen Untersippe, der Stumpfnashörner ( Ceratotherium), zu erheben. Aus der Kennzeichnung dieser Gruppe ersehe ich, daß die Merkmale derselben zu suchen sind: in dem verlängerten, nach hinten ausgezogeuen, im Gesichtstheile platten Kopfe, der breiten, eckigen Schnauze, der runden, an die der Rinder erinnernden Oberlippe ohne rüsselförmigen Fortsatz, den in der Länge sehr verschiedenen Hörnern und einem deutlichen Höcker auf den Schultern, worauf man, meiner Ansicht nach, wohl eine Art, nicht aber eine Sippe oder Untersippe begründen darf.
Das Stumpfnashorn, Monuhu, Kobâba und Tschikori der Eingeborenen Südafrikas, Weißnashorn der Boers am Vorgebirge der Guten Hoffnung ( Rhinoceros simus, Rhinoceros camus, Oswellii und Burchelli, Ceratotherium simum), wird, einschließlich des 60 Centim. messenden Schwanzes, reichlich 5 Meter lang und übertrifft somit alle Familienverwandten an Größe. Als bezeichnende Merkmale der Arten werden, außer den bereits mitgetheilten, folgende angegeben: der Kopf ist so außerordentlich lang, daß er fast ein Drittheil der Gesammtlänge einnimmt, das vordere meterlange Horn in der Regel sanft nach vorwärts gebogen, das hintere kurz und stummelhaft, das Ohr ziemlich lang und spitzig, der Hals kurz, der Leib sehr dick, die Haut durch zwei vom Nacken auf die Brust laufende Furchen gezeichnet, die vorherrschende Färbung derselben ein bis zu Lichtgrau verblassendes Lichtgelb oder Blaßgraubraun, welches auf Schultern und Schenkeln sowie am Unterleibe zu dunkeln pflegt. Wesentlicher noch als durch die angegebenen unterscheidet sich das Stumpfnashorn durch die ihm eigenthümliche Bildung des Schädels und die Verminderung der Rückenwirbel, welche von zwanzig auf achtzehn gesunken sind.
Sein Verbreitungsgebiet soll auf die südliche Hälfte Afrikas beschränkt sein; es dürfte jedoch auch diesseit des Gleichers, in den südlich von Habesch gelegenen Steppen, gefunden werden.
Das von Gray wegen seines langen, vorwärts gerichteten Hornes unterschiedene Kobâbanashorn ( Rhinoceros Oswellii) ist unzweifelhaft das von Wagner aufgestellte Kapuzennashorn ( Rhinoceros cucullatus) und wahrscheinlich mit dem Stumpfnashorn gleichartig.
Die Alten haben das Nashorn sehr wohl gekannt. Auf den altegyptischen Denkmälern kommt es, laut Dümichen, als erklärendes Bild hinter dem Worte »Ab« vor. »Die Zeichnung stellt außer Zweifel, daß nur dieses Thier dort gemeint sein kann, und führte es wohl wegen seiner an die Stoßzähne erinnernden, ebenfalls nach oben gebogenen Hörner bei den alten Egyptern denselben Namen wie der Elefant.« Für mich steht fest, daß es das Einhorn der Bibel ist, von welchem Hiob sagt: »Meinest du, das Einhorn werde dir dienen und werde bleiben an deiner Krippe? Kannst du ihm dein Joch anknüpfen, die Furchen zu machen, daß es hinter dir brache in Gründen? Magst du dich darauf verlassen, da es so stark ist, und wirst es dir lassen arbeiten? Magst du ihm trauen, daß es deinen Samen dir wiederbringe und in deine Scheunen sammle?« Der Urtext nennt dieses Thier Rêm und schreibt ihm bald ein Horn, bald zwei Hörner zu. Die Römer, welche das einhörnige ebensowohl wie das doppelhörnige kannten, ließen beide auf ihren Kampfplätzen arbeiten. Nach Plinius brachte Pompejus neben dem Luchs aus Gallien und dem Pavian aus Aethiopien das erste einhörnige Nashorn im Jahre 61 v. Chr. zu den Spielen nach Rom. »Das Nashorn«, erzählt Plinius, »ist der geborene Feind des Elefanten. Es wetzt das Horn an einem Steine und zielt im Kampfe vorzüglich nach dem Bauche, wohl wissend, daß er weicher ist, und so erlegt es den Elefanten.« Dem fügt er hinzu, daß man schon bei Meroe Nashörner finde, und dies ist ganz richtig; denn dort gibt es deren heutzutage noch. »In der Stadt Aduleton, dem größten Handelsplatze der Troglodyten und Aethiopier, fünf Tagereisen zu Schiffe von Ptolemais, werden Elfenbein, Hörner des Nashorns, Leder vom Flußpferde und andere derartige Handelsgegenstände verkauft.« Der erste, welcher von diesen Thieren spricht, ist Agatharchides; auf ihn folgt Strabo, welcher in Alexandrien ein Nashorn gesehen hat. Pausanias führt es unter dem Namen »äthiopischer Ochse« auf. Martial besingt beide Arten:
»Auf dem geräumigen Plan, o Cäsar, führet das Nashorn
Solcherlei Kämpfe dir aus, als es sie nimmer verhieß.
Wie in erbittertem Rasen erglühete stürmend das Unthier!
Wie gewaltig durchs Horn, welchem ein Ball war der Stier!«
sagt er Von dem einhörnigen und
»Während bekümmerte Hetzer zum Kampfe aufreizten das Nashorn
Und lange sammelnd den Zorn dieses gewaltigen Thieres,
Schwindet dem Volke die Hoffnung des Kampfes vor großer Erwartung,
Aber dem Unthier kehrt wieder die eigene Wuth;
Denn es erhebt mit doppeltem Horn den gewaltigen Bären,
Leicht, wie die Doggen der Stier wirft zu den Sternen empor.«
von dem zweihörnigen.
Die arabischen Schriftsteller sprechen schon sehr frühzeitig von beiden Arten und unterscheiden die indischen und afrikanischen; in ihren Märchen kommen sie nicht selten als zauberhafte Wesen vor. Marco Polo, der bekannte und für die Thierkunde so wichtige Schriftsteller, ist der erste, welcher nach langer Zeit, während man nichts von Nashörnern vernimmt, das Stillschweigen bricht. Er hat es auf seiner Reise im dreizehnten Jahrhundert in Indien und zwar auf Sumatra wieder gesehen. »Sie haben dort«, sagt er, »viel Elefanten und ›Löwenhörner‹, welche zwar gleiche Füße haben, aber viel kleiner sind als jene und in der Behaarung dem Büffel ähneln. Sie tragen ein Horn mitten auf der Stirne, thun damit aber niemandem etwas. Wenn sie jemanden angreifen wollen, werfen sie ihn vielmehr mit den Knien nieder und stoßen dann mit der Zunge, die mit einigen langen Stacheln besetzt ist, auf ihn los. Ihren Kopf, welcher dem des Wildschweins ähnelt, tragen sie immer gegen die Erde gekehrt. Sie halten sich gern im Schlamme auf und sind überhaupt rohes, garstiges Vieh.« Im Jahre 1513 erhielt Emanuel von Portugal aus Ostindien ein lebendes Nashorn. Sein Ruf erfüllte alle Länder. Albrecht Dürer gab den erwähnten Holzschnitt heraus, welchen er nach einer schlechten, ihm aus Lissabon zugekommenen Abbildung angefertigt hatte. Derselbe stellt ein Thier dar, welches aussieht, als ob es mit Schabracken bekleidet wäre und Panzerschuppen an den Füßen trage, zeigt auch ein kleines Horn auf der Schulter. Fast zweihundert Jahre lang war jener Holzschnitt des berühmten Meisters das einzige Bild, welches man von dem Nashorn besaß; kein Wunder daher, daß ihn auch der alte Geßner verwendete. Erst Chardin, welcher in Ispahan ein Nashorn sah, hat zu Anfange des vorigen Jahrhunderts eine bessere Abbildung gegeben. Die Lebensschilderung hatte Bontius um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts berichtigt. Von nun an beschreiben alle naturkundigen Reisenden die eine und andere Art, mit besonderer Ausführlichkeit aber die südafrikanischen Nashörner, so daß es gegenwärtig leichter ist, ein allgemeines Lebensbild der Thiere zu entwerfen, als die verschiedenen Arten selbst zu kennzeichnen.
Im großen und ganzen ähneln sich alle Nashörner in ihrer Lebensweise, in ihrem Wesen, in ihren Eigenschaften, Bewegungen und in ihrer Nahrung; doch scheint immerhin jede Art ihre Eigenthümlichkeiten zu haben. Unter den asiatischen Arten z. B. gilt das Nashorn als ein außerordentlich bösartiges Geschöpf; das Waranashorn wird schon als viel gutmüthiger und das auf Sumatra lebende als harmlos geschildert. Aehnlich verhält es sich mit den afrikanischen. Das Doppelnashorn wird trotz seiner geringen Größe als das wüthendste aller afrikanischen Thiere, das Stumpfnashorn dagegen als ein wirklich harmloses Wesen bezeichnet. Etwas wahres wird wohl an dieser Auffassung, die volle Wahrheit aber die sein, daß jedes Nashorn beim ersten Zusammentreffen mit dem Menschen, und so lange es nicht gereizt wurde, als gutmüthig, durch böse Erfahrungen gewitzigt oder erzürnt, aber als bösartig sich erweist. Im allgemeinen werden die riesenhaften Dickhäuter überall mehr gefürchtet als der Elefant. Die Araber des Sudan sind geneigt, in ihnen, wie im Nilpferde, Zaubergestalten zu erblicken: sie glauben, daß irgend ein böswilliger Hexenkünstler die Gestalt dieser Thiere annehmen könne, und versuchen ihre Ansicht damit zu begründen, daß Nashörner wie Nilpferde in ihrer blinden Wuth keine Grenzen kennen. »Der Elefant«, so sagen sie, »ist ein gerechtes Thier, welches das Wort des Gottgesandten Mahammed (über welchem der Friede des Allbarmherzigen sei) in Ehren hält und Schutzbriefe und andere erlaubte Mittel der Abwehr wohl achtet; Nilpferde und Nashörner aber kümmern sich nicht im geringsten um alle Amulete, welche unsere Geistlichen schreiben, um die Felder zu bewahren, und beweisen hierdurch, daß ihnen das Wort des Wahrheitsprechenden und Allmächtigen vollkommen gleichgültig ist. Sie sind verbannt und verworfen vom Anfange an. Nicht der Herr, der Allerschaffende, hat sie geschaffen, sondern der Teufel, der Allverderbende, und deshalb ist es den Gläubigen nicht gerathen, mit derartigen Wesen sich einzulassen, wie wohl die Heiden und christlichen Ungläubigen zu thun pflegen. Der Muselman gehe ihnen ruhig und still aus dem Wege, damit er seine Seele nicht beschmutze oder Schaden an ihr nehme und verworfen werde am Tage des Herrn.«
Ein möglichst wasserreiches Gebiet: Sumpfgegenden, Flüsse, welche auf weithin ihr Bett überfluten, Seen mit umbuschten, schlammigen Ufern, in deren Nähe grasreiche Weideplätze sich befinden, Waldungen mit Bächen und ähnliche Oertlichkeiten bilden die bevorzugten Aufenthaltsorte der Nashörner. So massigen und wohlgepanzerten Thieren gegenüber eröffnet selbst das verschlungenste Dickicht sein anderen Geschöpfen unnahbares Innere, erweisen sich auch die furchtbarsten Dornen machtlos. Daher begegnen wir fast sämmtlichen Arten in besonderer Häufigkeit in Wäldern, und zwar vom Meeresstrande an bis zu dreitausend Meter unbedingter Höhe empor, einzelnen von ihnen in der Höhe noch regelmäßiger und häufiger als in der Tiefe. So findet sich z. B., laut Junghuhn, das Waranashorn auch in den in unserem Werke bereits wiederholt erwähnten Allangallang-Wildnissen, welche vom Seestrande an Ebenen und Berge Javas bis zu dreitausend Meter Meereshöhe bedecken, weit regelmäßiger und zahlreicher aber in den höher gelegenen Urwäldern, in denen viele kleine grasumbuschte Seen, Sümpfe und Wasserbecken zerstreut liegen; es ersteigt sogar die höchsten Berge der Insel und nimmt über Gipfel von dreitausend Meter unbedingter Höhe seinen Pfad. Auch das Doppelnashorn, ein Bewohner der von den dornigsten Mimosen gebildeten Dickichte Innerafrikas, welcher diese ihm Sicherheit und Ruhe gewährenden Plätze nur verläßt, um in der freieren Steppe zu weiden, wird, wie Heuglin mittheilt, in Westabessinien nicht allzu selten noch in Höhen von dritthalbtausend Meter über dem Meere angetroffen. Entsprechend der Bildung seiner Lippen, welche ein Grasen nach Art der Rinder erleichtert, meidet dagegen das Stumpfnashorn den geschlossenen Wald und nimmt lieber in der offenen Steppe seinen Stand. Unbedingtes Erfordernis für die Wahl des Aufenthaltsortes unserer Thiere ist Wasser. Täglich einmal besucht wohl jedes Nashorn ein Gewässer, um hier zu trinken und im Schlamme sich zu wälzen. Ein Schlammbad ist allen auf dem Lande lebenden Dickhäutern geradezu Bedürfnis; denn so sehr auch ihr Fell ihren Namen bethätigt, so empfindlich zeigt es sich. Zumal im Sommer peinigen Fliegen, Bremsen und Mücken alle größeren Säugethiere in wirklich unglaublicher Weise, und nur durch Auflegen einer dicken Schlammlage verschaffen sich diese einigermaßen Schutz und Frieden. Ehe sie noch auf Nahrung ausgehen, eilen die Nashörner zu den weichen Ufern der Seen, Lachen und Flüsse, wühlen mit dem Horne ein Loch und wälzen und drehen sich in diesem, bis Rücken und Schultern, Seiten und Unterleib mit Schlamm bedeckt sind. Das Wälzen im Schlamme thut ihnen so wohl, daß sie dabei laut knurren und grunzen und sich von dem behaglichen Bade sogar hinreißen lassen, die ihnen sonst eigene Wachsamkeit zu vernachlässigen. Gegen die bösen Fliegen und Mücken schützt die Schlammdecke jedoch immer nur kurze Zeit, weil sie zunächst an den Beinen, dann auf den Schultern und an den Schenkeln abspringt und diese Theile nun den Stichen der Fliegen bloßstellt, ohne daß sich das Nashorn dagegen zu schützen vermöchte. Gepeinigt von seinen Quälgeistern, rennt es, seiner Trägheit vergessend, eilig den Bäumen zu, um dort sich zu reiben und die Qual für einige Augenblicke zu verringern.
Die Nashörner sind mehr bei Nacht als bei Tage thätig. Große Hitze ist ihnen sehr zuwider; deshalb schlafen sie um diese Zeit an irgend einem schattigen Orte, halb auf der Seite, halb auf dem Bauche liegend, den Kopf vorgestreckt und ebenfalls aufgelegt, oder stehen träge in einem stillen Theile des Waldes, wo sie durch die Kronen größerer Bäume gegen die Sonnenstrahlen geschützt sind. Solche Schlafplätze scheinen in der Regel wieder aufgesucht zu werden, weil man auf ihnen fast immer ungewöhnlich große Düngerhaufen der Thiere selbst bemerken kann. Und da nun auch diese bestäubende, gegen die Fliegen schützende Decke benutzt wird und beim Wälzen zur Unterlage dient, gewinnt es den Anschein, als ob die Nashörner absichtlich ihre Losung an bestimmten Stellen abzusetzen suchten. Alle Berichterstatter stimmen darin überein, daß der Schlaf der Thiere ein sehr gesunder ist. Mehrere von ihnen konnten ruhenden Nashörnern ohne besondere Vorsicht sich nähern: diese glichen fühllosen Felsblöcken und rührten sich nicht. Gordon Cumming erzählt, daß selbst die besten Freunde des Nashorns, mehrere kleine Vögel nämlich, welche stets mit ihm ziehen, vergeblich bemüht waren, ein Doppelnashorn, welches er erlegen wollte, zu wecken, und bereits die ältesten Berichterstatter erwähnen, daß gerade während der Mittagshitze das sonst vorsichtige Geschöpf am meisten beschlichen und getödtet würde. Gewöhnlich vernimmt man das dröhnende Schnarchen des schlafenden Nashorns auf eine gute Strecke hin und wird dadurch selbst dann aufmerksam gemacht, wenn man das versteckt liegende Thier nicht sieht. Doch kommt es auch vor, daß der Athem leise ein- und ausgeht, und man plötzlich vor einem der Riesen steht, ohne von dessen Vorhandensein eine Ahnung gehabt zu haben. So berichtet Sparrmann, daß zwei seiner Hottentotten dicht an einem schlafenden Nashorn vorbeigingen und dieses erst bemerkten, als sie bereits einige Schritte vorüber waren. Sie drehten sich sofort herum, setzten ihm ihre Gewehre dicht auf den Kopf und schossen beide mit Kugeln geladenen Läufe ab. Das Thier bewegte sich noch: sie luden ruhig wieder und erlegten es durch die nächsten Schüsse.
Mit Anbruch der Nacht, in vielen Gegenden aber auch schon in den Nachmittagsstunden, erhebt sich das plumpe Geschöpf, nimmt ein Schlammbad, reckt und dehnt sich dort behaglich und geht nun auf Weide aus. An den Quellen und Lachen erscheint es, in Afrika wenigstens, am häufigsten zwischen der dritten und sechsten Stunde der Nacht, und immer verweilt es dann mehrere Stunden an diesen so beliebten Orten. Später gilt es ihm allerdings ziemlich gleich, wohin es sich wendet. Es äst sich ebensowohl in den dichten, anderen Thieren kaum zugänglichen Wäldern wie auf offenen Ebenen, im Wasser nicht weniger als in dem Röhricht der Sümpfe, auf den Bergen ebenso gut wie in dem Thale. Selbst durch das verschlungenste Dickicht bahnt es sich mit der größten Leichtigkeit einen Weg. Die Zweige und dünneren Stämme müssen der in Bewegung gesetzten Masse weichen oder werden von ihr niedergebrochen, und nur um größere Stämme zu umgehen, beschreibt es eine kleine Biegung. Wo es mit Elefanten zusammenlebt, nimmt es gewöhnlich deren Wege an; doch verursacht es ihm keine Schwierigkeit, selbst solche zu bahnen. In den Dschungeln Indiens sieht man von ihm herrührende lange, schnurgerade Wege, auf denen alle Pflanzen seitlich niedergebrochen sind, während der Boden niedergestampft ist; im Inneren Afrikas gewahrt man ähnliche Gangstraßen, welche man als solche des Nashorns erkennt, wenn die Bäume rechts und links niedergebrochen sind, wogegen die von Elefanten herrührenden dadurch sich auszeichnen, daß die niederen hindernden Stämme ausgerissen, entlaubt und dann auf die Seite geworfen wurden. Nicht selten findet man in den indischen Gebirgsgegenden wohl ausgetretene Wege, welche über felsige oder steinige Abhänge von einem Walde zum anderen führen und durch das beständige Traben auf der gleichen Stelle förmlich in das Gestein eingegraben wurden, so daß schließlich tiefe Hohlwege entstehen. »Auf Java«, schreibt mir Haßkarl, »fand ich solche Wege noch auf Höhen von dreitausend Meter über dem Meere, ebenso wie in den feuchten Niederungen der Südküsten der Insel. Unter allen Umständen kann man, diesen Wegen folgend, mit Sicherheit darauf rechnen, schließlich zu einer Quelle oder Wasserlache zu gelangen. Hier und da ist ein Baumstamm quer über den oft mehr als einen halben Meter tief ausgetretenen Weg gestürzt, so daß das Nashorn nur mit Mühe darunter weglaufen kann; gleichwohl nimmt es nach wie vor den altgewohnten Wechsel an, denn man findet den unteren Theil des Stammes abgerieben, ja förmlich polirt.« Auch Heuglin hebt hervor, daß das Doppelnashorn regelmäßig seinen Wechsel einhält, nicht wie der Elefant ein umherschweifendes Leben führt, vielmehr seine Standorte nur selten, höchstens durch die Dürre gezwungen, verändert, und Mohr erzählt, ebenso wie Junghuhn und Haßkarl, von breit ausgetretenen Wegen der letztgenannten Art, welche auf den steilen Höhenzügen und Bergen südlich vom Sambesi, selbst auf den schroffsten Kuppen und Gipfeln zu bemerken waren und zuweilen als Fußpfade benutzt werden konnten. Ein Begehen dieser Gangstraßen ist immer gefährlich, laut Haßkarl, selbst auf Java, wo man die im ganzen durchaus friedliche Wara keineswegs fürchtet und sich gleichwohl sehr in Acht nimmt, ihr im dichten Walde, welcher kein Ausweichen gestattet, unbewaffnet, beziehentlich nicht auf ein Nashorn gerüstet, auf derartigen Pfaden entgegenzutreten.
Hinsichtlich seiner Nahrung steht das Nashorn zum Elefanten in einem ähnlichen Verhältnisse wie der Esel zum Pferde. Am liebsten frißt es Baumzweige und harte Stauden aller Art, Disteln, Ginster, Sträucher, Schilfarten, Steppengras und dergleichen. In Afrika besteht seine Hauptnahrung aus den dornigen Mimosen, zumal aus den niederen, buschigen, deren eine Art, ihrer krummen, sich an alles anhakenden Dornen halber von den Jägern so bezeichnend »Wart ein Bischen« genannt wird. Während der Regenzeit verläßt es die Wälder und zieht sich da, wo Feldbau in der Nähe seines Aufenthaltes betrieben wird, nach dem angebauten Lande. Hier richtet es gewöhnlich unglaubliche Verwüstungen an; denn ehe der Magen von 1,5 Meter Länge und 75 Centim. Querdurchmesser gefüllt werden kann, muß eine bedeutende Menge von Kraut vernichtet sein. Bei den in der Gefangenschaft lebenden Nashörnern hat man die tägliche Nahrung gewogen und gefunden, daß das Thier mindestens fünfundzwanzig Kilogramm zu sich nimmt. Im freien Zustande frißt es wahrscheinlich noch mehr. Aber freilich ist es auch kein Kostverächter. Nicht bloß die dürren Zweige und Schößlinge, nicht bloß die starrenden Theike der Mimosen und andere stachligen Gewächse der Wendekreisländer, sondern auch Aeste von 3 bis 5 Centim. Durchmesser würgt es hinab. Die Nahrung wird mit dem breiten Maule abgepflückt oder mittels des handartigen Fortsatzes abgebrochen. An einem gefangenen indischen Nashorn beobachtete ich, daß es mit seiner Lippenspitze sehr kleine Stücke, Zuckerbrocken z. B., geschickt einklemmen und dann durch Umbiegen derselben auf die weit vorragende Zunge bringen kann. Alle Nahrung, welche das Thier aufnimmt, zerkaut es sogleich, aber in rohester Weise; denn seine Speiseröhre ist weit genug, um auch großen Stücken den Durchgang zu gestatten. Das indische Nashorn kann die rüsselartige Ausbuchtung der Oberlippe bis auf etwa 15 Centim. verlängern und damit einen dicken Grasbusch erfassen, ausreißen, und in das Maul schieben. Ob das Gras rein ist oder ob etwas Erde an den Wurzeln hängt, scheint gleichgültig zu sein. Es schlägt allerdings erst den ausgerissenen Busch einmal gegen den Boden, um den größten Theil der erdigen Stoffe abzuschütteln, schiebt ihn dann aber mit Seelenruhe in den weiten Rachen und würgt ihn ohne Schlingbeschwerden hinab. Sehr gern frißt es auch Wurzeln, deren es sich mit Leichtigkeit bemächtigt. Bei guter Laune gefällt es sich, schon seines Vergnügens halber, darin, einen kleinen Baum oder Strauch aus dem Boden zu wühlen, und fegt zu diesem Zwecke mit dem gewaltigen Horne so lange unter den Wurzeln herum, bis es schließlich den Strauch erfassen und herausheben kann, worauf durch andere Schläge die Wurzeln losgebrochen und endlich verzehrt werden. Dabei hat man jedoch bemerkt, daß die verschiedenen Arten auch eine verschiedene Auswahl ihrer Nahrung zu treffen pflegen. Das Nashorn scheint Baumzweige zu bevorzugen; das Waranashorn dagegen erklimmt, laut Junghuhn, die Gebirge Javas hauptsächlich mehrerer Grasarten halber, welche im Inneren der Waldungen auf verhältnismäßig trockenen Plätzen wachsen, lebt beispielsweise auf dem Slamat fast ausschließlich von einer wohlriechenden Grasart ( Ataxia Horsfieldii), welche die Abhänge dieses Berges zwischen anderthalb- bis zweitausend Meter unbedingter Höhe bedeckt; das Doppelnashorn hält sich wiederum mit Vorliebe an Bäume, zumal Mimosen, deren Rinde es abschält und deren Gezweige es verbeißt, »als ob sie mit einer Schere verschnitten wären«; das Stumpfnashorn endlich weidet, ganz im Einklange mit der Bildung seiner Lippen, ausschließlich auf grasigen Ebenen. Ein Euphorbienstrauch, welcher hier wächst, soll ihm ebenfalls zur Nahrung dienen und keinerlei Magenbeschwerden verursachen, das Doppelnashorn aber vergiften. Bambus- und Schilfblätter wie Getreide jeder Art gewähren allen Arten zeitweilig willkommene Speise. Dem entsprechend hat die Losung ein verschiedenes Aussehen und unterscheidet sich zuweilen von der des Elefanten ebenso, als sie ihr in anderen Fällen ähnelt. Haßkarl fand in den fünf bis sieben Centimeter im Durchmesser haltenden Klumpen der Losung des Waranashorns oft Ueberreste von fingerdicken Aesten, Heuglin dagegen in der des Doppelnashorns immer nur fein zerkaute Pflanzenfasern. Bloß das eine scheint allen Nashörnern gemeinsam zu sein, daß sie ihre Losung an bestimmten Stellen absetzen und nach und nach Haufen von bedeutendem Umfange aufthürmen.
Das Wesen der Nashörner hat wenig anziehendes. Sie fressen entweder oder schlafen; um die übrige Welt bekümmern sie sich kaum. Im Gegensatze zu dem Elefanten leben sie nicht in Herden, sondern meist einzeln oder höchstens in kleinen Trupps von vier bis zehn Stück. Unter solcher Gesellschaft herrscht wenig Zusammenhang: jedes einzelne lebt in der Regel für sich und thut, was ihm beliebt. Gleichwohl kann man nicht behaupten, daß eins das andere mit stumpfer Gleichgültigkeit betrachte; es bilden sich vielmehr, ganz abgesehen von einer Nashornmutter und ihrem Kinde, nicht selten Freundschafts-, um nicht zu sagen Eheverhältnisse zwischen den verschiedenen Geschlechtern aus, welche sehr inniger Art sein können und vielleicht nur mit dem Tode endigen. In der Freiheit begegnet man öfters Paaren, welche alles gemeinschaftlich thun, und an gefangenen und an einander gewöhnten Nashörnern beiderlei Geschlechtes kann man eine wahrhaft zärtliche Liebe wahrnehmen. Schwerfällig wie der Leib erscheint auch das geistige Wesen, aber weder der eine noch das andere ist es wirklich. Für gewöhnlich schreitet ein Nashorn gewichtig und etwas plump dahin, und wenn es sich niederlegt oder wälzt, thut es dies anscheinend so ungeschickt als möglich; alle Bewegungen aber sehen unbeholfener aus, als sie thatsächlich sind. Behende Wendungen und Biegungen kann ein Nashorn freilich nicht ausführen, und auf den Bergen springt es auch nicht mit der Leichtigkeit einer Gemse umher; in ebenen Gegenden aber eilt es, wenn es einmal in Bewegung gekommen ist, sehr rasch davon. Es geht nicht, wie die anderen schweren Dickhäuter, durch fast gleichzeitiges Bewegen der Beine einer Seite, sondern schreitet mit den sich gegenüberstehenden Vorder- und Hinterbeinen ans. Beim Laufen hält es den Kopf gewöhnlich niedrig und gerade vor sich hin, in der Wuth aber schaukelt es ihn wiegend hin und her und reißt mit dem Horne tiefe und weite Furchen auf. Wenn es sehr erzürnt ist, springt es auch von einer Seite zur anderen und hebt dann den stumpfen Schwanz in die Höhe. Es kann einen sehr geschwinden und ausdauernden Trab laufen und selbst berittenen Jägern gefährlich werden, zumal in buschreichen Gegenden, wo Mann und Pferd nicht so leicht auszuweichen vermögen, während jenes alle ihm im Wege stehenden Bäume niedertritt. Das Schwimmen übt jedes Nashorn, hält sich jedoch mehr an der Oberfläche und taucht nicht ohne Noth unter. Einzelne Berichterstatter wollen jedoch beobachtet haben, daß es in Sümpfen oder Flüssen bis zum Grunde hinabtauche, dort mit dem Horne die Wurzeln und Ranken der Wasserpflanzen aushebe und mit sich emporbringe, um sie oben zu verzehren.
Unter den Sinnen der Nashörner steht das Gehör obenan, dann folgt der Geruch, und auf diesen das Gefühl. Das Gesicht ist sehr wenig ausgebildet. Es wird allgemein behauptet, daß ein Nashorn immer nur gerade nach vorn sehen könne und Menschen, welche von der Seite zu ihm hinschlichen, nicht wahrzunehmen vermöge. Ich bezweifle diese Angaben, weil ich das Gegentheil an zahmen bemerkt habe. In der Wuth folgt das Nashorn dem Geruche ebenso wie dem Gehöre; denn es nimmt die Fährte des Feindes auf und spürt dieser nach, ohne das Auge zu brauchen. Das Gehör muß sehr fein sein; denn das Thier vernimmt das leiseste Geräusch auf weite Entfernungen. Aber auch der Geschmack ist durchaus nicht zu leugnen; wenigstens beobachtete ich bei zahmen, daß ihnen Zucker ein höchst erwünschter Gegenstand war und mit besonderem Wohlgefallen von ihnen verzehrt wurde. Die Stimme besteht in einem dumpfen Grunzen, welches bei größerer Wuth in ein tönendes Blasen oder Pfeifen übergehen soll. In der Freiheit mag man dieses Pfeifen oft vernehmen; denn jedes Nashorn ist leicht in Wuth zu versetzen, und seine Gleichgültigkeit gegen alles, was nicht Futter heißt, kann sich sehr bald in das Gegentheil umwandeln. Raffles beobachtete, daß das Waranashorn vor einem einzigen Hunde die Flucht ergriff, und andere Reisende sahen, daß es, nachdem es sie bloß gewittert, eiligst davonging; allein dieses Betragen ändert sich, wenn das Thier gereizt wird. Es achtet dann weder die Anzahl noch die Wehrhaftigkeit seiner Feinde, sondern stürzt blindlings in gerader Linie auf den Gegenstand seines Zornes los. Ob dann eine Gesellschaft bewaffneter Leute dem rasenden Vieh entgegensteht, oder ob der Gegenstand seiner Wuth ein völlig harmloser und unbedeutender ist, scheint von ihm nicht in Betracht gezogen zu werden. Rothe Farben sollen ihm, wie dem Ochsen, zuwider sein; wenigstens hat man es Anfälle auf schreiend gekleidete Menschen ausführen sehen, welche ihm nicht das geringste zu Leide gethan haben. Seine Wuth übersteigt alle Grenzen. Es rächt sich nicht bloß an dem, welcher es wirklich gereizt hat, sondern an allem und jedem, was ihm vorkommt; selbst Steine und Bäume müssen seinen Zorn entgelten, und wenn es gar nichts findet, reißt es wenigstens zwei bis drei Meter lange, halbkreisförmige Furchen in die Erde. Glücklicherweise ist es nicht so schwer, einem in voller Wuth dahin rennenden Nashorne zu entgehen. Der geübte Jäger läßt es bis auf etwa zehn oder fünfzehn Schritte herankommen und springt dann zur Seite; der tobende Gesell rennt an ihm vorüber, verliert die Witterung, welche er bisher hatte, und stürzt nun auf gut Glück vorwärts, vielleicht an einem anderen unschuldigen Gegenstande seinen Ingrimm auslassend. Man kennt, wie Lichtenstein erzählt, Beispiele, daß ein Nashorn bei Nacht einem Wagen oder einem davor gespannten Ochsen in die Seite gefallen ist und mit unbegreiflicher Kraft alles mit sich fortgeschleppt und zertrümmert hat. Für den gerade im Zuge begriffenen Reisenden ist ein Nashorn von allen Thieren das gefährlichste, weil es nicht selten ohne alle Ursache auf die Leute losrennt und in sinnloser Wuth gänzlich Unschuldige umbringt. Zumal das Doppelnashorn wird wegen seines ungeheuern Grimmes sehr gefürchtet. Manchmal arbeitet eins dieser Thiere stundenlang mit seinem Horne an einem Busche und wühlt schnaubend an ihm herum, bis es ihn mit sammt seinen Wurzeln aus der Erde gehoben hat; dann legt es sich vielleicht ruhig nieder, ohne weiter an die eben zerstörte Pflanze zu denken. Das Stumpfnashorn ist viel sanfter und harmloser als sein dunklerer Verwandter, steht ihm an Schnelligkeit bei weitem nach und greift, selbst wenn es verwundet worden ist, selten den Menschen an.
Die außerordentliche Reizbarkeit der Nashörner verdunkelt den wahren Ausdruck ihres geistigen Wesens und erschwert in hohem Grade eine richtige Beurtheilung und gerechte Würdigung ihres Verstandes. Ich wage meinem verehrten Freunde Westerman nicht zu widersprechen, wenn er das Nashorn als den geistig am wenigsten entwickelten aller großen Vielhufer erklärt, muß jedoch hierbei an den hohen Verstand der Elefanten, an die nicht zu unterschätzende geistige Begabung der Tapire und Schweine erinnern, um nicht die Meinung hervorzurufen, als erachte ich die Nashörner als geistlose, dumme Geschöpfe. Solche sind sie gewiß nicht. Sie stehen den aufgeführten Verwandten in geistiger Hinsicht nach, übertreffen aber sicherlich sämmtliche Nager und wahrscheinlich auch die meisten Wiederkäuer in dieser Beziehung. Im Zorne vergißt auch der Elefant seine Klugheit, das Schwein seine Vorsicht, der Hirsch seine Scheu; im Zorne handelt der listige Affe thöricht, sogar der weise Mensch oft unbedacht: das zornige Nashorn also ist nicht maßgebend für die Beurtheilung seiner geistigen Fähigkeiten. Ungeachtet aller bisher mitgetheilten Beobachtungen kennt man das freilebende Thier noch viel zu wenig, als daß man im Stande wäre, ein einigermaßen zutreffendes Urtheil zu fällen; man hat es aber auch kaum wirklich beobachtet, sondern bei der Begegnung entweder angegriffen oder geflohen. Die wenig entwickelte Hirnkapsel seines Schädels, sein kleines Gehirn, welches sich zu der Leibesmasse verhält wie 1:164, spricht allerdings nicht für eine hohe geistige Entwickelung, und seine leibliche Trägheit scheint die Annahme auch einer geistigen Schwerfälligkeit zu rechtfertigen; es fragt sich jedoch, ob die eine wie die andere Folgerung richtig ist. Gefangene Nashörner bekunden zwar ebenfalls wenig geistige Begabung, keineswegs aber eine so auffallende Verstandesarmut wie viele andere Mitglieder ihrer Klasse, beispielsweise alle Beutelthiere und die meisten Nager. Viel eher und bestimmter als diese und jene lernen sie ihre Wärter kennen, fügen sie sich in die ihnen auferlegten Verhältnisse, gewöhnen sie sich an eine gegen ihre frühere wesentlich veränderte Lebensweise; sie lassen sich daher keineswegs schwierig behandeln. Wahrscheinlich würden sie noch ganz andere Beweise ihres Verstandes liefern, wollte man sich überhaupt Mühe geben, mit ihnen zu verkehren, ihren Geist zu wecken und zu bilden, anstatt einfach für ihre unabweislichsten Bedürfnisse zu sorgen und sie im übrigen anzustaunen oder gleichgültig sich selbst zu überlassen.
Ueber die Fortpflanzung des Nashorns fehlen zur Zeit noch erschöpfende Berichte. Von der indischen Art weiß man, daß die Paarung in die Monate November und December fällt, und da nun der Wurf im April oder Mai erfolgt, hat man die Tragzeit auf siebzehn bis achtzehn Monate angeschlagen, aber wahrscheinlich ebenso wie bei dem Flußpferde erheblich geirrt. Der Paarung gehen zuweilen gewaltige Kämpfe unter den Männchen voraus. So sah Anderson vier männliche Nashörner im wüthendsten Kampfe, erlegte zwei und fand, daß sie mit Wunden bedeckt und infolge deren nicht im Stande waren, sich satt zu fressen. Mitten im Dickichte des Waldes bringt das Nashorn sein einziges Junge zur Welt: ein kleines, plumpes Vieh, von der Größe eines stattlichen Hundes, welches mit offenen Augen zur Welt kommt. Seine röthliche Haut ist noch faltenlos, der Keim zum Horne aber schon vorhanden. Durch einen Zufall ist unsere Kunde über die ersten Tage des Kindeslebens eines Nashorns in der neuesten Zeit nicht unwesentlich bereichert worden. Am 7. December 1872 traf, wie Bartlett berichtet, das Dampfschiff Orchis, von Singapore kommend, mit einem alten weiblichen Badaknashorn am Bord, in den Victoria-Docks zu London ein. Das Thier war vor etwas mehr als sieben Monaten gefangen und, nach Aussage der Fänger, kurz vorher belegt worden. Am Tage seiner Ankunft, gegen sieben Uhr abends, vernahm der Wärter zu seiner Ueberraschung ein schwaches Quieken, welches aus dem Behälter des Nashorns zu kommen schien. Bei Besichtigung des Thieres ergab sich, daß es soeben ein Junges geworfen hatte und gerade beschäftigt war, die Nabelschnur, mittels welcher letzteres noch an ihm hing, zu zerbeißen. Zur Verwunderung des Wärters zeigte sich die bisher sehr ungeberdige Alte ruhig und sanft, erlaubte ihm sogar, nachdem er sie angerufen hatte, in den Verschlag zu treten, sie zu melken und ihr später das Junge an das Euter zu legen. In der Meinung, daß Ruhe und Stille der ermatteten und erschöpften Mutter willkommen sein werde, verließ er hierauf den Versandkäfig und deckte ihn sorgfältig mit Segeltuch zu. Das Junge schien jedoch nicht gewillt, in dieser Weise sich einsperren zu lassen; denn bald darauf lustwandelte es, trotz Dunkelheit und Regen, auf dem Decke des Schiffes umher, aber freilich nicht lange, weil infolge der Kälte und Nässe binnen kurzem die zarten Glieder ihm den Dienst versagten. Tüchtig gerieben und in wollene Decken gehüllt, erholte es sich zwar wieder, litt aber ersichtlich unter der Unwirtlichkeit des ihm feindlichen Klimas. Als Bartlett am anderen Morgen an Bord kam, war man eben beschäftigt, Mutter und Kind zu landen. Auf seinen Rath trennte man beide, um zu verhüten, daß die Alte beim Verkrahnen und Umladen des Behälters das Kleine erdrücke oder beschädige. Kaum aber stand der schwere Versandkäfig glücklich auf dem Wagen, als die Mutter so unruhig wurde, daß man sich genöthigt sah, ihr das Kind zurückzugeben. Der Wärter begab sich ebenfalls in den Käfig und verblieb hier während der ziemlich langen Fahrt von den Docks bis zu den Ställen des betreffenden Händlers und Besitzers. Hier verging eine geraume Zeit, bevor man die Alte abgeladen und im Stalle eingepfercht hatte, und man hielt es für gerathen, das Junge einstweilen in dem Geschäftszimmer unterzubringen, hatte jedoch seine liebe Noth mit ihm, um unerlaubten kindischen Gelüsten zu steuern. Sobald man die Mutter glücklich eingestellt hatte, gab man ihr das Junge zurück. Dasselbe begann auch sofort zu saugen, verließ, nachdem es sein Bedürfnis befriedigt hatte, die Alte, wandte sich einem dunklen Winkel zu und legte sich hier zur Ruhe nieder, ganz, wie viele Wiederkäuer zu thun pflegen, welche von ihren Müttern so lange versteckt werden, als diese ihrer Nahrung nachgehen. Besonders auffallend fand Bartlett die merkwürdige Friedfertigkeit der Alten. Während diese vor der Geburt des Jungen stets geneigt war, ihren Wärter und jeden anderen, welcher ihr sich näherte, anzugreifen, erlaubte sie jetzt dem Pfleger, in den Raum zu treten und sie zu melken, als wäre sie die zahmste Kuh, gestattete auch später, als sie sich bereits im Stalle befand, anderen, ihr fremden Leuten, zu ihr zu kommen, und nahm ihr gespendete Liebkosungen mit derselben Widerstandslosigkeit entgegen wie irgend ein von vielen Leuten verwöhntes und verhätscheltes Mitglied der vierbeinigen Bewohnerschaft eines Thiergartens. Nach Bartletts Meinung befand sie sich in einem Zustande von Geistesabwesenheit oder vielleicht in einem solchen der Erschöpfung; möglicherweise auch nahm sie Rücksichten auf ihr Kind und zeigte deshalb ein so vollständig verändertes Betragen; denn sie ließ sich Mißhandlungen oder Behelligungen gefallen, welche sie sonst sicherlich zurückgewiesen haben würde und wenige Tage später auch thatsächlich auf das kräftigste abwehrte.
Das junge Badaknashorn erinnerte wegen seines mageren Leibes, der langen Glieder und der Art und Weise, wie es den großen, gestreckten Kopf bewegte, an einen jungen Esel oder an ein verhungertes Ferkel. Sein vorderes Horn war bereits vorhanden und etwa 2 Centim. hoch, sein hinteres noch nicht sichtbar, dessen Stelle aber durch einen nackten Fleck angedeutet, sein beinahe schwarzhäutiger Leib dicht mit kurzem, krausem, schwarzem Haar bekleidet, das Ohr innen wie außen dichter, der Schwanz an der Spitze bürstenartig behaart. Besonders merkwürdig erschien die Beschaffenheit der Hufe, welche unter der weichen Sohle lagen und somit das Thier nöthigten, auf der Vorder- oder Außenseite der Hufe zu gehen. Seine Länge betrug ungefähr 1 Meter, die Schulterhöhe 60 Centim., das Gewicht 25 Kilogramm.
Leider lebte das Thierchen nicht lange. Laut Noll, welcher nach Hagenbecks Mittheilungen über das freudige Ereignis berichtet, wurde es zwar von der Alten treulich gepflegt und über Tags sieben- bis achtmal, des Nachts drei- bis viermal genährt, gedieh auch zusehends und wuchs merkwürdig schnell, lag aber bereits am Morgen des 10. December todt im Stalle, wahrscheinlich erdrückt von der eigenen Mutter, welche sich, als man ihr jetzt das Junge wegnahm, überaus wüthend geberdete.
Auch von freilebenden Nashörnern hat man erkundet, daß die Mutter warme Liebe für ihr Junges zeigt, es fast durch zwei Jahre säugt, während dieser Zeit mit der größten Sorgfalt bewacht und bei Gefahr mit beispiellosem Grimme gegen jeden Feind und jeden Angriff vertheidigt. Bontius erzählt, daß ein Europäer auf einem seiner Ritte ein indisches Nashorn mit seinem Jungen entdeckte. Als das Thier die Menschen erblickte, stand es auf und zog mit seinem Kinde langsam weiter in den Wald. Das Junge wollte nicht recht fort, da stieß es die Alte mit der Schnauze vorwärts. Nun fiel es einem Jäger ein, dem Thiere nachzureiten und ihm mit seinem Säbel einige Hiebe auf den Hinteren zu geben. Die Haut war zu dick, als daß er hätte durchdringen können; die Hiebe hinterließen nur einige weiße Streifen. Geduldig ertrug das alte Nashorn alle Mißhandlungen, bis sein Junges im Gesträuche verborgen war; dann wendete es sich plötzlich mit ungeheurem Grunzen und Zähneknirschen gegen den Reiter, stürzte auf ihn los und zerriß ihm mit dem ersten Streiche einen Stiefel in Fetzen. Es würde um ihn geschehen gewesen sein, wäre das Pferd nicht klüger gewesen als sein Leiter. Dieses sprang zurück und floh aus allen Kräften, das Nashorn aber jagte ihm nach, Bäume und alles, was ihm hinderlich war, krachend niederschmetternd. Als das Pferd zu den Begleitern des Weißen zurückkam, ging das Nashorn auf diese los; sie aber fanden glücklicherweise zwei nebeneinander stehende Bäume, hinter welche sie sich flüchteten. Das Nashorn, blind gemacht durch seine Wuth, wollte schlechterdings zwischen den Bäumen hindurch und gerieth in förmliche Raserei, als es sah, daß diese seinen Angriffen widerstanden. Die Stämme zitterten wie Rohr unter den Streichen und Stößen, welche das erboste Vieh führte; doch widerstanden sie, und die Leute gewannen Zeit, ihm einige Schüsse aus den Kopf zu geben, welche es fällten.
Wie lange das junge Nashorn bei seiner Mutter bleibt, weiß man nicht; ebensowenig kennt man das Verhältnis zwischen dem Vater und dem Kinde. Das Wachsthum des letzteren schreitet in den ersten Monaten rasch vor sich. Ein Nashorn, welches am dritten Tage etwa 60 Centim. hoch und 1,1 Meter lang war, wächst in einem Monate 13 Centim. in die Höhe, 15 Centim. in die Länge und ebensoviel im Umfange. Nach dreizehn Monaten hat es bereits eine Höhe von 1,2, eine Länge von 2 und einen Umfang von 2,1 Meter erreicht. Die Haut ist in den ersten Monaten von dunkelröthlicher Farbe und erhält später eine dunkle Schattirung auf hellerem Grunde. Bei den bezüglichen Arten ist bis zum vierzehnten Monate kaum eine Andeutung der Falten vorhanden; dann aber bilden sich diese so rasch aus, daß binnen wenigen Monaten kein Unterschied zwischen den Alten und Jungen vorhanden ist. Uebrigens gehört mindestens ein achtjähriges Wachsthum dazu, bevor das Nashorn eine Mittelgröße erreicht hat, und erst nach zurückgelegtem dreizehnten Jahre nehmen gefangene nicht mehr an Größe und Umfang zu. Das Horn biegt sich durch das ewige Wetzen mehr nach hinten. Manche, zumal gefangene Nashörner haben die Gewohnheit, so viel mit ihm zu schleifen, daß es bis auf einen kleinen Stummel verkleinert wird. Gänzlich abgestoßene Hörner ersetzen sich wieder, verletzte nehmen zuweilen eine von der gewöhnlichen sehr verschiedene Gestalt an, woraus hervorgeht, daß man nicht berechtigt ist, auf die Hörner allein Arten zu begründen.
Man hat in alter Zeit viel von den Freundschaften und Feindschaften der Nashörner gefabelt. Namentlich der Elefant sollte aufs eifrigste von ihnen bekämpft werden und regelmäßig unterliegen müssen. Diese schon von Plinius herrührenden Geschichten werden von dem einen und anderen Reisebeschreiber gelegentlich aufgewärmt, sind jedoch sicherlich als Fabeln anzusehen. Daß ein gereiztes Nashorn sogar einen Elefanten angreifen kann, mag glaublich erscheinen; in solchem Falle aber weiß ein solcher sich auch zu wehren und bietet sich nicht ohne weiteres zur Zielscheibe für die Hornstöße des Gegners dar. Richtigeres erzählt man von der Freundschaft unseres Thieres mit schwächeren Geschöpfen. Anderson, Gordon Cumming und andere fanden fast regelmäßig auf dem Doppel- wie auf dem Stumpfnashorn einen dienstwilligen Vogel, den Madenhacker, welcher den Riesen während des ganzen Tages treu begleitet und gewissermaßen Wächterdienste bei ihm verrichtet. »Die Nashornvögel (Madenhacker)«, sagt Cumming, »sind fortwährende Begleiter des Nilpferdes und der beiden Arten des Nashorns. Sie nähren sich von dem Ungeziefer, von welchem diese Thiere wimmeln, und halten sich deshalb immer in unmittelbarer Nähe der Dickhäuter oder auf ihrem Leibe selbst aus. Oft haben diese stets wachsamen Vögel mich bei meiner vorsichtigsten Annäherung in meinen Erwartungen getäuscht und meine Mühe vereitelt. Sie sind die besten Freunde, welche das Nashorn hat, und verfehlen selten, es aus seinem tiefsten Schlafe aufzuwecken. Der alte Dickbauch versteht auch ihre Warnung vollkommen, springt auf seine Füße, sieht sich nach allen Richtungen um und ergreift dann jedesmal die Flucht. Ich habe oft zu Pferde ein Nashorn gejagt, welches mich viele Meilen weit lockte und eine Menge Kugeln empfing, ehe es stürzte. Auch während solcher Hatze blieben diese Vögel fortwährend bei ihrem Brodherrn. Sie saßen ihm auf dem Rücken und den Seiten, und als eine Kugel in die Schulter des Nashorns einschlug, flatterten sie ungefähr zwei Meter in die Höhe, einen gellenden Schrei ausstoßend, und nahmen dann wieder ihren früheren Platz ein. Zuweilen traf es sich, daß die unteren Zweige der Bäume, unter welchen das Nashorn dahinrannte, die Vögel wegfegten; aber sie fanden allemal ihren Platz wieder. Ich habe Nashörner geschossen, wenn sie um Mitternacht an den Quellen tranken; die Vögel aber, welche glauben mochten, daß das erlegte Nashorn schliefe, blieben bis zum Morgen bei ihm, und wenn ich mich näherte, bemerkte ich, daß sie, ehe sie fortflogen, alles mögliche aufboten, um das vermeintlich schlafende Nährthier aufzuwecken.« Wir haben keinen Grund, an der buchstäblichen Wahrheit dieser Mittheilung zu zweifeln, da wir ähnliche Freundschaften zwischen den Vögeln und den Säugethieren oft genug finden können. Zudem habe ich selbst in Habesch die Madenhacker wenigstens auf Pferden und Rindern beobachten können. Selbstverständlich finden die Vögel Anerkennung für solche treue Begleitung, und auch das stumpfeste Säugethier muß die Wohlthaten erkennen, welche sie ihm durch Auflesen der es peinigenden Kerfe bereiten. Ob aber bei Annäherung des Menschen die Vögel ihr Weidethier geradezu in das Ohr picken, um es aufzuwecken, will ich gern dahin gestellt sein lassen; ich glaube eher, daß schon die allgemeine Ursache, welche sie kundgeben, wenn sich ihnen etwas verdächtiges zeigt, hinreichend ist, um das Nashorn aufmerksam zu machen. Daß besonders vorsichtige Vögel von anderen Thieren als Vorposten und Warner anerkannt und beachtet werden, wissen wir bestimmt.
Außer dem Menschen dürfte das Nashorn nicht viele Feinde haben. Löwen und Tiger meiden das Thier, weil sie wissen, daß ihre Klauen doch zu schwach sind, um dessen dicke Panzerhaut zu zerreißen. Der Prankenschlag des Löwen, welcher einen Stier im Nu zu Boden wirft, dürfte dem Nashorn gegenüber als zu schwach sich erweisen; denn dieses ist infolge der Kämpfe mit seines Gleichen noch ganz andere Schläge gewohnt. Weibliche Nashörner, welche Junge haben, lassen Tiger oder Löwen nicht leicht in ihre Nähe kommen, weil dem kleinen, noch weichlichen Nashorne ein so großes Raubthier wohl gefährlich werden mag. »Als ich einmal aus der Stadt an einem Flusse spazieren ging«, sagt Bontius, »um die lieblichen Pflanzen zu betrachten, fand ich am Ufer ein junges, noch lebendiges und jämmerlich heulendes Nashorn liegen, dem die Hinterbacken abgebissen waren, ohne Zweifel von einem Tiger. Was man von seiner Freundschaft mit dem Tiger sagt, scheint mir nur eine Heuchelei zu sein; denn wenn auch beide Thiere nebeneinander hergehen, so sehen sie einander mit schiefen Augen an, grunzen und blöken die Zähne, was sicher kein Zeichen von Freundschaft ist.«
Das Nashorn fürchtet andere kleine Thiere weit mehr als die großen Räuber und hat namentlich in einigen Bremsen und in den Mücken schlimme Feinde, gegen welche es kaum etwas unternehmen kann. Ihrethalber wälzt es sich so gerne im Schlamme, und infolge ihrer Stiche, welche es recht wohl fühlen mag, reibt es sich oft an den Stämmen, bis böse Geschwüre und Grinde entstehen, in denen dann wieder neue Kerbthiere sich ansiedeln. Auch mit dem Schlamme kommen eine Menge von Wasserthieren, namentlich Egel, an das Nashorn, welche ebenfalls unangenehm werden müssen und nur in den kleinen gefiederten Freunden des Thieres mächtige Gegner finden können.
Der Mensch ist wohl überall der gefährlichste Feind des Nashornes. Alle Völkerschaften, in deren Gebiete eine Art dieser plumpen Geschöpfe sich findet, stellen ihm mit dem größtem Eifer nach, und auch die europäischen Jäger betreiben seine Jagd mit wahrer Leidenschaft. Man hat gefabelt, daß die Panzerhaut für Kugeln undurchdringlich wäre; doch haben schon frühere Reisende bezeugt, daß selbst eine Lanze oder ein kräftig geschleuderter Pfeil sie durchbohrt. Die Jagd ist gefährlich, weil der gewaltige Riese auf den rechten Fleck getroffen werden muß, wenn er der ersten Kugel erliegen soll. Verwundet nimmt er augenblicklich den Kampf mit dem Menschen auf und kann dann überaus furchtbar werden. Die eingeborenen Jäger suchen das Nashorn während des Schlafes unter dem Winde zu beschleichen und werfen ihm ihre Lanze in den Leib oder setzen ihm die Mündung des Gewehrlaufs fast auf den Rumpf, um den Kugeln ihre volle Kraft zu sichern. Die Abessinier gebrauchen Wurfspieße, schleudern davon aber manchmal fünfzig bis sechzig auf ein Nashorn. Wenn es etwas erschöpft vom Blutverluste ist, wagt sich einer der Kühnsten an das Thier heran und versucht, mit dem scharfen Schwerte die Achillessehne durchzuhauen, um das Thier zu lähmen und zu fernerem Widerstande unfähig zu machen. In Indien zieht man mit Elefanten zur Jagd hinaus; aber selbst diese werden zuweilen von dem wüthenden Thiere gefährdet. »Als das Nashorn aufgejagt war«, sagte Borri, »ging es ohne anscheinliche Furcht vor der Menge der Menschen auf seine Feinde los, und als diese bei seiner Annäherung rechts und links auseinander prallten, lief es ganz gerade durch die aus ihnen gebildete Reihe, an deren Ende es auf den Statthalter traf, welcher auf einem Elefanten saß. Das Nashorn lief sogleich hinter diesem her und suchte ihn durch sein Horn zu verwunden, während der Elefant seinerseits alle Kraft aufbot, das angreifende Nashorn mit dem Rüssel zu fassen. Der Statthalter nahm endlich die Gelegenheit wahr und schoß ihm eine Kugel an die rechte Stelle.«
Auf die afrikanischen Arten wird im offenen, freien Felde Jagd gemacht. Der Jäger schleicht sich durch das Gebüsch heran und schießt aus geringer Entfernung. Fehlt er, so stürzt das Thier wüthend nach dem Orte hin, von welchem der Schuß fiel, und spürt und äugt nach dem Feinde umher. Sobald es denselben sieht oder wittert, senkt es den Kopf, drückt die Augen zu und rennt, mit der ganzen Länge des Horns die Erde streifend, vorwärts. Dann ist es noch ein leichtes, ihm auszuweichen. Geübte Nashornjäger haben stundenlang einem auf sie eindringenden Nashorn Stand gehalten, indem sie stets zur Seite sprangen, wenn das Nashorn auf sie losrannte, und es an sich vorbeirasen ließen, bis sie, nachdem es sich ausgetobt, es doch noch erlegten. Anderson ist mehrmals durch verwundete Nashörner in Todesgefahr gekommen. Eins derselben stürzte sich wüthend auf ihn, warf ihn nieder, glücklicherweise ohne ihn mit dem Horne zu treffen, schleuderte ihn aber ein gutes Stück mit seinen Hinterfüßen weg. Kaum war es an ihm vorüber gestürmt, als es sich schon herumdrehte und einen zweiten Angriff wagte, welcher dem Manne eine schwere Wunde in den Schenkel einbrachte. Damit war glücklicherweise seine Rache erfüllt: es eilte in ein benachbartes Dickicht, und Anderson konnte gerettet werden.
»Als ich einst auf der Rückkehr von einer Elefantenjagd begriffen war«, erzählte Oswell dem eben genannten, »bemerkte ich ein großes Stumpfnashorn in kurzer Entfernung vor mir. Ich ritt ein vortreffliches Jagdpferd, das beste und flotteste, welches ich jemals während meiner Jagdzüge besessen habe; doch war es eine Gewohnheit von mir, niemals ein Nashorn zu Pferde zu verfolgen, einfach deshalb, weil man sich dem stumpfsinnigen Vieh weit leichter zu Fuß als zu Pferde nähern kann. Bei dieser Gelegenheit jedoch schien es, als ob das Schicksal dazwischen treten wolle. Meinen Nachreitern mich zuwendend, rief ich aus: ›Beim Himmel, der Bursche hat ein gutes, feines Horn; ich will ihm einen Schuß geben‹. Mit diesen Worten gab ich meinem Pferde die Sporen, war in kurzer Zeit neben dem ungeheuren Thiere und sandte ihm einen Augenblick später eine Kugel in seinen Leib, doch, wie sich zeigte, nicht mit tödtlicher Wirkung. Das Nashorn, anstatt, wie gewöhnlich, die Flucht zu ergreifen, blieb zu meiner größten Verwunderung sofort stehen, drehte sich rasch herum und kam, nachdem es mich ein oder zwei Augenblicke neugierig angesehen hatte, langsam auf mich los. Ich dachte noch gar nicht an die Flucht, dem ungeachtet versuchte ich, mein Pferd wegzulenken. Aber dieses Geschöpf, gewöhnlich so gelehrig und lenksam, welchem der kleinste Druck des Zügels genug war, verweigerte jetzt ganz entschieden, mir zu gehorchen. Als es zuletzt noch folgte, war es zu spät; denn das Nashorn war bereits so nahe zu uns gekommen, daß ich wohl einsah, ein Zusammentreffen mußte unvermeidlich sein. Und in der That, einen Augenblick später bemerkte ich, wie das Scheusal seinen Kopf senkte, und indem es denselben rasch nach oben warf, stieß es sein Horn mit solcher Kraft zwischen die Rippen meines Pferdes, daß es durch den ganzen Leib, durch den Sattel selber hindurch fuhr, und ich die scharfe Spitze in meinem Beine fühlte. Die Kraft des Stoßes war so furchtbar, daß mein Pferd einen wirklichen Burzelbaum in der Luft schoß und dann langsam nach rückwärts zurückfiel. Was mich anlangt, so wurde ich mit Gewalt gegen den Boden geschleudert, und kaum lag ich hier, als ich auch schon das Horn des wüthenden Thieres neben mir erblickte. Doch mochte es seine Wuth gekühlt und seine Rache erfüllt haben. Es ging plötzlich mit leichtem Galopp von dem Schauplatze seiner Thaten ab. Meine Nachreiter waren inzwischen näher gekommen. Ich eilte zu einem hin, riß ihn vom Pferde herab, sprang selbst in den Sattel und eilte, ohne Hut, das Gesicht von Blut strömend, rasch dem sich zurückziehenden Thiere nach, welches ich zu meiner großen Genugthuung wenig Minuten später leblos zu meinen Füßen hingestreckt sah.«
Auch Gordon Cumming berichtet, daß ein weißes, sonst als gutmüthig betrachtetes Nashorn, als es in die Enge getrieben worden war, wüthend zum Angriffe sich herumdrehte und ihn gefährdete. Von einem Doppelnashorn erzählt er, daß dasselbe, noch ehe er ihm Leides gethan, plötzlich auf ihn zukam und ihn lange Zeit um einen Busch herumjagte. »Wäre es ebenso flink als häßlich gewesen, so hätten meine Wanderungen wahrscheinlich ihre Beendigung erreicht. Aber meine überlegene Behendigkeit gab mir den Vortheil. Nachdem es mich eine Zeitlang durch den Busch angeschnaubt, stieß es plötzlich einen lauten Schrei aus, machte Kehrt und ließ mich als Meister des Feldes zurück.«
Levaillant beschreibt in sehr lebhafter Weise eine Jagd auf das zweihörnige Nashorn. »Man beobachtete ein Paar dieser Thiere, welche ruhig in einem Mimosenwalde nebeneinander standen, die Nase gegen den Wind gerichtet und von Zeit zu Zeit hinter sich sehend, um zu sichern. Ein Eingeborener bat sich aus, die Thiere zu beschleichen. Die übrigen Jäger vertheilten sich, und ein Hottentotte nahm die Hunde unter seine Obhut. Der Eingeborene zog sich nackt aus und kroch mit der Flinte auf dem Rücken höchst langsam und vorsichtig wie eine Schlange auf dem Boden fort, hielt augenblicklich still, sobald sich die Nashörner umsahen, und glich dann täuschend einem Steinbrocken. Sein Kriechen dauerte fast eine Stunde. Endlich kam er bis zu einem, etwa zweihundert Schritte von den Thieren entfernten Busche, stand auf und sah sich um, ob seine Kameraden alle auf ihren Posten wären, legte an und verwundete das Männchen, welches im Augenblicke des Schusses einen fürchterlichen Schrei ausstieß und mit dem Weibchen wüthend auf ihn zukam. Er legte sich unbeweglich auf den Boden, die Nashörner eilten an ihm vorbei und stürzten auf die übrigen Jäger los. Jetzt befreite man die Hunde und feuerte von allen Seiten auf sie. Sie schlugen fürchterlich gegen die Hunde los, zogen mit ihren Hörnern tiefe Furchen in den Boden und schleuderten die Erde nach allen Seiten weg. Die Jäger rückten näher, die Wuth der Thiere steigerte sich fortwährend: sie boten einen wirklich entsetzlichen Anblick dar. Da plötzlich stellte sich das Männchen gegen die Hunde, und das Weibchen flüchtete, zur großen Freude der Jäger, welche es nicht gern mit zwei derartigen Ungeheuern aufnehmen wollten. Das Männchen kehrte endlich auch zurück, lief aber auf einen Busch zu, in welchem drei Jäger standen, und diese sandten ihm aus einer Entfernung von dreißig Schritt tödtliche Schüsse zu. Es schlug aber noch so heftig um sich, daß die Steine nach allen Seiten flogen und weder Menschen noch Hunde sich zu nähern wagten. Levaillant wollte aus Mitleid ihm den Rest geben, wurde aber von den Wilden abgehalten, weil sie einen sehr großen Werth auf das Blut legen und es getrocknet gegen allerlei Krankheiten gebrauchen, namentlich gegen Verstopfung. Als es endlich todt war, liefen sie hurtig heran, schnitten ihm die Blase aus und füllten sie mit Blut an.
Aehnlich wie die vorstehend gegebenen Mittheilungen lauten alle Berichte über das Zusammentreffen mit Nashörnern und ihr Betragen und Gebaren während der Jagd. Bald entfliehen sie furchtsam vor dem sich nahenden Menschen, bald setzen sie sich muthig zur Wehre; bald lassen sie sich hetzen, bald hetzen sie den Jäger. Wo sie öfters beunruhigt worden sind, warten sie den Angriff nicht erst ab, sondern gehen sofort ihrerseits zu Feindseligkeiten über; in Gegenden, wo der Mensch ihnen als fremdes Wesen erscheint, lassen sie denselben entweder mit staunender Verwunderung an sich heran kommen, oder stehen von weitem. In die Enge getrieben und erzürnt, wehren sie sich tapfer ihrer Haut. Das allgemeine Urtheil erkennt in ihnen muthige, wehrhafte, streitlustige und ausdauernde Thiere, welche, einmal erregt, nicht so leicht nachlassen, vielmehr hartnäckig und mit Todesverachtung kämpfen, überhaupt ein ritterliches Wesen bekunden.
Schwieriger als die Jagd ist der Fang. Das Waranashorn erbeutet man, wie Haßkarl mir mittheilt, hauptsächlich seines Hornes wegen, welches man für fünfundzwanzig bis dreißig Gulden an die Chinesen verkaufen kann. Um es zu fangen, tieft man auf seinen Pfaden enge Gruben aus, versieht sie mit spitzigen Pfählen, bestimmt, das schwere Thier beim Herabfallen zu spießen, und deckt sie oben sorgfältig mit Zweigen zu. Das Nashorn nimmt, wie gewohnt, seinen Wechsel an, stürzt in die Grube, und ist, auch wenn es nicht an den spitzigen Pfählen sich verletzte, in der Regel außer Stande, sich herauszuhelfen und zu befreien. Erwachsene Thiere tödtet man ohne weiteres, weil man sie lebend nicht fortzuschaffen weiß, jüngere dagegen sucht man zu fesseln und in bewohnte Gegenden zu treiben, wo man sie zu verwerthen hofft. In Afrika erlangt man die jungen Doppelnashörner, welche gegenwärtig auf unseren Thiermarkt gebracht werden, dadurch, daß man während der Fortpflanzungszeit zur Jagd auszieht, alte Weibchen mit ihrem Kinde zu erkunden sucht, erstere tödtet und sich des letzteren dann mit leichter Mühe bemächtigt. Zuweilen spielt der Zufall seine Vermittlerrolle, so bei Erbeutung des ersten Rauhohrnashornes, über dessen Fang eine in Kalkutta erscheinende Zeitung berichtet. Officiere, welche im nördlichsten Theile des Meerbusens von Bengalen bemüht waren, Elefanten für das englische Heer aufzutreiben, erfuhren durch Eingeborene, daß ein Nashorn in den Triebsand gerathen, unfähig, sich herauszuhelfen, von mehr als zweihundert Männern mittels umgelegten Stricken aufs Land befördert und zwischen zwei Bäumen fest gebunden worden sei, woselbst es sich noch und zwar im besten Wohlsein befinde, so daß man es nicht loszubinden wage. Auf diese Nachricht hin brachen Hauptmann Hood und ein Herr Wickes mit acht Elefanten nach dem sechzehn Stunden entfernten Fangplatze auf, um das Thier zu holen. Bei Ankunft an Ort und Stelle fanden sie ein weibliches Nashorn von etwa 2,6 Meter Länge und 1,3 Meter Schulterhöhe mit noch wenig entwickelten Hörnern vor, ließen es mit Stricken zwischen Elefanten festbinden und führten es unter mancherlei Mühsalen, aber auch unter lebhafter Betheiligung des Volkes nach Tschittagong. Hier wurde es auf einen umzäunten Platze eingestellt, allmählich gezähmt und einige Jahre später nach Kalkutta gebracht, von wo es schließlich nach England gelangte.
Selbstverständlich vollzog sich das alles nicht ohne mancherlei Schwierig- und Fährlichkeiten. Zuerst weigerten sich die Elefanten, beim Fesseln des gefangenen Wildlings thätig zu sein, und als man ihre Bedenken beschwichtigt, und das Nashorn glücklich mittels einer um seinen Hinterfuß gelegten Schlinge mit dem einen Elefanten zusammengekoppelt hatte, genügte ein Aufschreien des furchterweckenden Geschöpfes, um die klugen, aber furchtsamen Rüsselträger von neuem in Schreck zu setzen. Endlich hatte man unser Nashorn doch zwischen zwei Elefanten befestigt, und der Marsch konnte beginnen; aus dem Wege aber waren zwei größere Flüsse zu überschreiten, von denen nur einer mit einem passenden Fährboote überschifft werden konnte: es blieb also nichts anderes übrig, als » Begum«, das Nashorn, zwischen den beiden Leitelefanten durch den breiten Songu schwimmen, beziehentlich schleppen zu lassen, da jenes sich geberdete, als ob es nicht schwimmen könne. Nicht wenig belästigte jetzt und später die Neugierde des sich herandrängenden Volkes, welches manchmal in meilenlangem Aufzuge vor und hinter dem Ungeheuer dahinschritt. Als man Begum später nach Kalkutta brachte, verbot die Behörde den Weg durch die Dörfer; man war also genöthigt, das Thier auf Umwegen seinem Ziele zuzuführen: der Wärter, an welchem sich das Nashorn nach und nach gewöhnt hatte, schritt, nachts mit der Laterne in der Hand, singend voraus, und Begum folgte gutwillig nach. Größere Schwierigkeiten verursachte die Verladung auf den kleinen Küstendampfer, auf welchem das Thier nach Kalkutta reiste, nicht geringere sein letzter Versand nach Europa, in einem der Größe und Stärke des Nashorns entsprechenden ungefügigen Käfige aus dem eisenfesten Tiekholze. Bei der Zähmung selbst ging man mit dem allen Indiern eigenen Verständnisse zu Werke. Durch sanfte Behandlung brach man den Trotz, durch Darreichung von Leckerbissen, namentlich Pisangblättern und Mangozweigen, erwarb man sich nach und nach die Zuneigung und Freundschaft des Wildlings.
Aus diesen Angaben und anderen Berichten geht hervor, daß alle Nashornarten, die eine früher, die andere später, gebändigt werden können und trotz ihres reizbaren Wesens verhältnismäßig leicht zahm werden, wenn man sie sanft und freundlich behandelt. Bei denen, welche sich auf Schiffen befanden, bemerkte man eine stumpfe Gleichgültigkeit, welche nicht einmal nach wiederholten Neckereien dem sonst auflodernden Zorne Platz machte, ganz im Einklange mit der bekannten Thatsache, daß alle Thiere, welche das weite Meer um sich sehen, wahrscheinlich im Gefühle ihrer zeitweiligen Schwäche, ausnehmend mild und fromm sich zeigen. Aber wir haben auch andere Belege dafür, daß gefangene Nashörner auffallend zahm wurden. Horsfield rühmt das Badaknashorn als ein sehr gutmüthiges Geschöpf. Ein Junges benahm sich im hohen Grade liebenswürdig, widerstrebte nicht, als man es in einem großen Karren fortschaffte, und zeigte sich, nachdem es seinen Bestimmungsort erreicht hatte, umgänglich wie zuvor. Man hatte ihm in dem Schloßhofe von Sura Kerta einen Platz eingeräumt und diesen durch einen tiefen Graben von ungefähr einem Meter abgegrenzt; hier blieb es mehrere Jahre, ohne daran zu denken, seine Grenze zu überschreiten. Es schien sich mit seiner Lage vollkommen ausgesöhnt zu haben, gerieth auch niemals in Zorn, trotzdem es bei seiner ersten Ankunft auf alle Weise geneckt wurde, weil die zahlreiche Bevölkerung der Stadt sich mit dem Fremden aus dem Walde irgend welchen Spaß machen wollte. Baumzweige, Schlingpflanzen der verschiedensten Art, Strauchwerk etc. wurde ihm in reichlicher Menge vorgeworfen; es zog aber den Pisang allem vor, und die zahlreichen Besucher, welche diese Neigung bald auskundschafteten, sorgten nun redlich dafür, daß es diese Lieblingsnahrung in Masse erhielt. Es erlaubte, daß man es berührte und von allen Seiten besah; ja, die kecken unter den Beschauern wagten es zuweilen, auf seinem Rücken zu reiten. Wasser war ihm Bedürfnis: wenn es nicht mit Fressen beschäftigt war oder durch die Eingeborenen aufgestört wurde, legte es sich regelmäßig in tiefe Löcher, welche es sich ausgegraben hatte. Als es nach verhältnismäßig sehr kurzer Zeit erwachsen war, genügte der schmale Graben nicht mehr, es abzuschließen. Da geschah es nicht selten, daß es in den Häusern der Eingeborenen Besuche abstattete und in den Pflanzungen, welche die Gebäude regelmäßig umgeben, oft recht bedeutende Zerstörungen sich zu Schulden kommen ließ. Die Eingeborenen, welche das Thier nicht kannten, wurden natürlich bei seinem Erscheinen in die peinlichste Furcht versetzt, die beherzteren aber trieben es ohne Umstände wieder nach seinem Behälter zurück. Als die Ausflüge in der Nachbarschaft immer häufiger und die Verwüstungen, welche es in den Gärten anrichtete, immer toller wurden, war man genöthigt, es nach einem benachbarten Dorfe zu treiben, und dort fand es schmählicher Weise sein Ende in einem kleinen Flüßchen.
Auch in unseren Thiergärten zeigen sich die meisten Nashörner gutmüthig und zahm, lassen sich berühren, hin und her treiben und sonstwie behandeln, ohne sich zur Wehre zu setzen, und gewinnen nach und nach eine entschiedene Zuneigung zu jedem Wärter, welcher verständig mit ihnen umgeht. Nur ein Fall ist bekannt, daß ein Nashorn zwei Leute, welche es wahrscheinlich gereizt haben mochten, angriff und tödtete. Das indische Nashorn im Thiergarten von Antwerpen war so gutmüthig, daß es Herrn Kretschmer, den Zeichner vieler Abbildungen dieses Werkes, gestattete, zu ihm in den Behälter zu gehen, als es sich darum handelte, es von allen Seiten bildlich darstellen zu können. Man ließ es täglich auf einen umzäumten Platz vor seinem Stalle, und dort konnte der Wärter mit ihm beginnen, was er wollte. Eine einfache Peitsche genügte, ihm einen heilsamen Schrecken einzujagen: es setzte sich augenblicklich in Galopp, wenn der Wärter klatschte. Viele Beschauer mochten es oft gefüttert haben, denn so bald jemand sich nahte, kam es sofort herbei, streckte seine plumpe Schnauze durch das Gitter, verlängerte die Oberlippe so weit es konnte und stieß ein dumpfes, aber leises Brüllen aus, in der Absicht, einige Naschereien zu erhalten. Wenn es eine Leckerei erhalten hatte, drückte es die Augen behaglich zu und zermalmte die erbettelte Speise mit einem einzigen Bisse. Ein Paar Nashörner aus Indien, welches gegenwärtig im Berliner Thiergarten gepflegt wird, zeigt sich ebenso lenksam und leutselig, ein ebendaselbst lebendes Doppelnashorn dagegen unfreundlich und eigenwillig, so daß es, nicht mit Unrecht, von den Wärtern gefürchtet wird. Während jene bei gutem Wetter täglich in dem äußeren Gehege ihres Stalles sich ergehen und stundenlang in dem geräumigen Badebecken behaglich liegen, ist dieses weder durch Güte noch durch Gewalt dazu zu bringen, den inneren Raum zu verlassen, und muß mittels einer Spritze gebadet werden. Keiner seiner Wärter wagt es, in seinen Stall zu treten, keiner es zu berühren, weil es jedes derartiges Entgegenkommen schnöde zurückweist und selbst seinen wohlbekannten Pfleger gelegentlich bedroht. Mit Strenge ist bei so gearteten Nashörnern nichts auszurichten; denn ihre Störrigkeit und Eigenwilligkeit übersteigt alle Begriffe. Selbst sonst folgsame Thiere geben hiervon zuweilen Beweise: so versagte, wie Bartlett gelegentlich mittheilt, auch Begum in Kalkutta einmal den Gehorsam, legte sich trotzig inmitten der Straße nieder und war durch kein Mittel zu bewegen, aufzustehen; Hunderte von Eimern Wasser wurden über ihr ausgeschüttet: sie blieb liegen, als ob sie ein Klotz wäre, und mußte schließlich nach dem Stalle geschleift werden. Sanfte Worte, freundliches Zureden, Anbieten und Darreichen von Leckerbissen, kurz, Mittel der Güte, fruchten unter solchen Umständen weit mehr als die Peitsche, welche sonst auch bei Nashörnern als nützliches und nothwendiges Werkzeug der Erziehung sich erweist.
Das Leben der gefangenen Nashörner fließt einförmig dahin. Wie in der Freiheit sind sie eigentlich nur in den Früh- und Abendstunden sowie während eines Theiles der Nacht vollkommen munter und so rege, als ihnen der Raum gestattet. Die Mittagsstunden bringen sie schlafend zu, nachdem sie vorher, falls dies ihnen möglich, ein Bad genommen haben. Beim Ruhen legen sie sich bald auf den Bauch und die zusammengebogenen Beine, bald auf die Seite, wälzen sich auch gern im Sande und bewegen dabei die schwere Masse ihres Leibes leichter, als man annehmen möchte. Beim Schlafen werden der Kopf und der lang ausgestreckte Hals auf den Boden gelegt und die Augen geschlossen, die Ohren dagegen auch in tiefster Ruhe noch bewegt; beim Baden verweilen sie stundenlang im Wasser, tauchen, falls das ihnen angewiesene Becken es erlaubt, bis zur Rückenfirste ins Wasser, strecken den Kopf vor und schließen die Augen ebenfalls. Wie sehr ein Begießen oder Benetzen ihrer dicken Haut ihnen Bedürfnis ist, sieht man an denen, welche nicht baden können oder wollen und deshalb täglich mittels einer Spritze eingenäßt werden: sie drängen sich, so lange der Wärter die Spritze handhabt, an das Gitter, drehen und wenden sich, legen sich nieder und auf den Rücken, wälzen sich auf dem benetzten Boden und geben überhaupt ihr hohes Behagen auf jede Weise zu erkennen, lassen auch währenddem unfriedliche Gedanken nicht aufkommen. Lauwarmes Wasser ist ihnen lieber als kaltes; doch baden sie noch bei vierzehn Grad Luft- und Wasserwärme, ohne Unbehaglichkeit zu bekunden. An die Beschaffenheit des Futters stellen sie, obwohl sie den Unterschied zwischen besserer und minder guter Nahrung zu würdigen wissen, geringe Ansprüche, verlangen aber ziemlich viel, etwa 20 Kilogramm Heu, 3 Kilogramm Hafer oder sonstiges Getreide und 15 Kilogramm Rüben täglich. Baumzweige mit Blättern und saftiges Kleeheu zählen unter ihre Leckerbissen; Weißbrod und Zucker schmeicheln ihrem Gaumen in unverkennbarer Weise; gewöhnliches Stroh oder Sumpfgräser werden übrigens auch nicht verschmäht. Bei regelmäßiger Pflege halten sie selbst in unserem Klima lange aus: man kennt Beispiele, daß sie zwanzig, dreißig, in Indien sogar fünfundvierzig Jahre in der Gefangenschaft lebten, und spricht ihnen daher, wohl nicht mit Unrecht, eine Lebensdauer von mindestens achtzig oder selbst hundert Jahren zu.
So viel mir bekannt, hat man noch niemals die Freude gehabt, gefangene Nashörner zur Fortpflanzung schreiten zu sehen; es liegt jedoch, meiner Ansicht nach, kein Grund vor, die Möglichkeit der Vermehrung gefangener Thiere dieses Geschlechts in Abrede zu stellen. Nur wenige Thiergärten vermochten bis jetzt, irgend eine Art der Familie paarweise zu erwerben, und wenn das wirklich der Fall war, fehlte es meist an genügenden Einrichtungen, um die Thiere zur Paarung zu treiben. Das bereits erwähnte Paar des Berliner Thiergartens läßt Nachzucht erhoffen. Den Thieren wohnt, wie schon Noll sehr richtig bemerkt hat, eine wahrhaft rührende Zuneigung gegen einander inne. Legt sich das eine nieder, so streckt sich auch das andere daneben hin, oft so, daß sein Kopf auf dem Leibe des Genossen ruht; steht das erste auf, so erhebt sich auch das zweite; geht dieses im Käfige auf und ab, so thut es auch jenes; beginnt das Männchen zu fressen, so verspürt auch das Weibchen das Bedürfnis, etwas zu sich zu nehmen; ruft letzteres, so antwortet ersteres und umgekehrt. Das Männchen hat schon wiederholt allerlei Paarungsgelüste gezeigt, bis jetzt aber williges Entgegenkommen noch nicht gefunden. Oft reibt es seinen Kopf an den Seiten des Weibchens, beschnüffelt es, versucht aufzusteigen; das Weibchen aber wich bisher stets aus und ließ sich selbst durch Hornstöße und Bisse seitens des ungestümen und keineswegs ungelenken Bewerbers zur Nachgiebigkeit nicht bewegen, wahrscheinlich einzig und allein deshalb, weil es das rechte Alter noch nicht erlangt hat.
Aller Nutzen, welchen das Nashorn gewähren kann, wiegt den Schaden, den es während seines Freilebens anrichtet, nicht entfernt auf. In Gegenden, wo ein regelmäßiger Anbau des Bodens stattfindet, läßt es sich nicht dulden; es ist so recht eigentlich nur für die Wildnis geschaffen. Von dem erlegten Thiere weiß man fast alle Theile zu verwenden. Nicht bloß das Blut, sondern auch das Horn steht in hohem Ansehen wegen seiner geheimnisvollen Kraft. Im Morgenlande sieht man in den Häusern der Vornehmen allerlei Becher und Trinkgeräthe, welche aus dem Horne des Thieres gedreht sind. Man schreibt diesen Gefäßen die Eigenschaft zu, aufzubrausen, wenn eine irgendwie giftige Flüssigkeit in sie geschüttet wird, und glaubt somit ein sicheres Mittel zu haben, vor Vergiftungen sich zu schützen. Die Türken der höheren Klassen führen beständig ein Täßchen von Rhinoceroshorn bei sich, und lassen es in allen zweifelhaften Fällen mit Kaffee füllen. Gar nicht selten kommt es vor, daß ein Türke, welcher einen anderen besucht, von dem er sich eben nicht viel gutes versieht, in dessen Gegenwart durch seinen Diener das Horntäßchen mit dem Kaffee füllen läßt, welcher als Freundschaftstrank jedem Ankommenden gereicht wird, und es scheint fast, als nähme der Wirt eine so beispiellose Ungezogenheit gar nicht übel. Noch häufiger wird das Horn zu den Griffen der kostbaren Säbel verwendet. Wenn es gut gewählt und geglättet ist, zeigt es eine unbeschreiblich schöne, sanft röthlichgelbe Farbe, welche mit Recht als ein besonderer Schmuck der Waffe betrachtet wird. Aus der Haut verfertigen sich die Eingeborenen gewöhnlich Schilde, Panzer, Schüsseln und andere Geräthschaften. Das Fleisch wird gegessen, das Fett hoch geachtet, obwohl Europäer das eine wie das andere als schlecht bezeichnen. Hier und da benutzt man, und sicherlich nicht ohne Erfolg, das Fett zu Salben der verschiedensten Art, wie auch das Mark der Knochen hier und da als Heilmittel gilt.
In wilden, steinigen Gebirgen Afrikas und Westasiens bemerkt man an vielen Orten ein reges Leben. Kaninchengroße Thiere, welche auf einer Felsplatte oder auf einem Blocke sich sonnten, huschen, erschreckt durch die Ankunft eines Menschen, rasch an den Wänden dahin, verschwinden in einer der unzähligen Klüfte und schauen dann neugierig und harmlos, wie sie sind, auf die ungewöhnliche Erscheinung herab. Dies sind Klippschliefer, die kleinsten und zierlichsten aller jetzt lebenden Vielhufer.
Hinsichtlich der Stellung dieser niedlichen Felsenbewohner innerhalb ihrer Klasse sind die Ansichten der Forscher von jeher weit auseinander gegangen. Pallas erklärte sie, ihrer äußeren Erscheinung und Lebensweise Rechnung tragend, als Nager; Oken glaubte in ihnen Verwandte der Beutelthiere erkennen zu dürfen; Cuvier reihte sie den Vielhufern ein. Neuerdings macht man, Huxley's Vorgange folgend, ihnen auch diese Stellung streitig und erhebt sie zu Vertretern einer besonderen Ordnung. Wir betrachten sie, ob mit Recht oder Unrecht bleibe dahingestellt, als zu der Gruppe der Vielhufer gehörige Thiere und räumen ihnen den Rang einer Unterordnung ein, welcher wir den von Illiger gegebenen Namen Platthufer ( Lamnungia) belassen. Diese Unterordnung umfaßt nur eine einzige Familie ( Hyracina) und eine einzige Sippe ( Hyrax).
Die Merkmale der Klippschliefer oder Klippdachse sind folgende: der Leib ist gestreckt und walzig, der Kopf verhältnismäßig groß und plump, nach der Schnauze hin zugespitzt, zumal seitlich stark verschmälert, die Oberlippe gespalten, die Nasenkuppe klein, das Auge klein, aber vortretend, das im Pelze fast versteckte Ohr kurz, breit und rund, der Hals kurz und gedrungen, der Schwanz ein kaum bemerkbarer Stummel; die Beine sind mittelhoch und ziemlich schwach, die zarten Füße gestreckt und vorn in vier, hinten in drei, bis an die Endglieder mit Haut verbundene Zehen getheilt, welche, mit Ausnahme der hinteren inneren, Platte, hufartige Nägel tragen, wogegen die hintere innere Zehe von einem krallenartigen Nagel umhüllt wird; die nackten Sohlen zeigen mehrere, durch tiefe Spalten getrennte, ungemein schmiegsame Schwielenpolster. Eine weiche und dichte, nur aus Grannen bestehende Behaarung bekleidet Leib und Glieder; diese Grannen sind an der Wurzel gewellt und ersetzen daher auch die fehlenden Wollhaare.
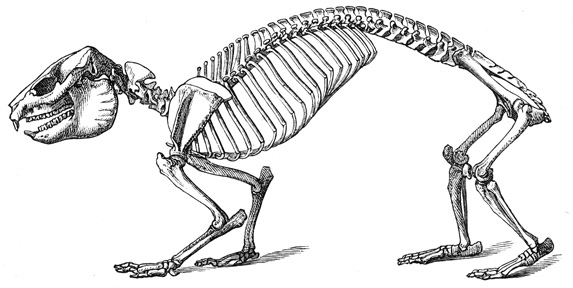
Geripp des Klippschliefers. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
Hinsichtlich des inneren Baues ist, laut Carus, das nachstehende zu bemerken. Der Schädel spitzt sich nach vorn zu und hat ein sehr flaches Dach; der Jochbogen wird vom Jochbeine gebildet, dessen nach oben verlaufender Fortsatz mit dem des Stirnbeines sich verbindet, so daß Schläfen- und Augenhöhle durch eine fast vollständige Knochenbrücke getrennt werden; die an ihren äußeren Rändern umgebogenen Nasenbeine stoßen an die Zwischenkiefer und oben und hinten an den Oberkiefer; der in der Mitte vollständig verwachsene Unterkiefer ist am Ende sehr breit. Ein- oder zweiundzwanzig Rippen-, acht oder neun Lenden-, fünf bis sieben Kreuzbein- und fünf bis zehn Schwanzwirbel setzen mit denen des Halses die Wirbelsäule zusammen. Die übrigen Knochen sind gestreckt, Elnbogenröhre und Wadenbein stark entwickelt und von der Armspindel und dem Schienbeine getrennt. Das Gebiß ist sehr eigentümlich. Von den Schneidezähnen fallen die seitlichen aus, so daß oben und unten nur je zwei, durch eine Lücke getrennte, verbleiben; jene sind dreikantig, fast halbkreisförmig gebogen und infolge der Abnutzung an der Spitze zugeschärft, diese gerade und fast wagerecht in weit nach hinten reichende Zahnhöhlen eingebettet; Eckzähne fehlen gänzlich, und es findet sich daher zwischen den Schneide- und den sieben, von vorn nach hinten an Größe zunehmenden, in vier Lück- und drei Mahlzähne zerfallenden Backenzähnen eine Lücke. Auch die Weichtheile verdienen Beachtung. Der Magen wird durch eine Scheidewand in zwei Abtheilungen getrennt; der anfangs sehr dünne Dickdarm erweitert sich in der Mitte seiner Länge und trägt hier jederseits einen kurzen zipfelförmigen Anhang; die mehrlappige Leber hat keine Gallenblase; die Gebärmutter ist zweihörnig; die Hoden liegen im Inneren des Leibes, dicht hinter den Nieren.
Schon in uralter Zeit werden die Klippschliefer als wohlbekannte Thiere erwähnt. Die in Syrien und Palästina lebende Art scheint unter dem biblischen Namen » Saphan« verstanden worden zu sein, welches Wort Luther mit »Kaninchen« übersetzt. Die Schrift sagt, daß der Saphan gesellig lebe, seine Wohnung in Felsen habe und sich durch Schwäche auszeichne, diese aber durch Schlauheit ersetze: »Die hohen Berge sind der Gemsen Zuflucht und die Steinklüfte die der Kaninchen.« »Kaninchen, ein schwaches Volk, dennoch legt es sein Haus in den Felsen.« Moses setzt die Saphane unter die wiederkäuenden Thiere mit getheilten Zehen, welche von den Juden nicht gegessen werden dürfen, und hierin ist es wohl begründet, daß noch heutigen Tages in Habesch weder die Christen noch die Mohammedaner Klippschlieferfleisch essen. An anderen Orten und namentlich im Steinigten Arabien erblicken die Beduinen in solchem Wildpret nichts verachtenswerthes und stellen ihm deshalb eifrig nach. In Syrien benamt man sie noch heutigen Tages Rhanem Israel oder »Schafe der Israeliten«. Sonst sind sie in Arabien unter dem Namen » Wabbr« bekannt; die griechischen Klosterbrüder am Sinai nennen sie Choerogryllion; in Dongola heißen sie » Keka« oder » Koko« und in Habesch » Aschkoko«.
Es ist ziemlich gleichgültig, welche Art von den bis jetzt bekannten Klippschliefern wir uns zur Betrachtung erwählen, weil in ihrer Lebensweise alle übereinkommen. Nur weil ich auf meinem Jagdausfluge nach Habesch Gelegenheit hatte, den dort vorkommenden Aschkoko ( Hyrax abyssinicus) kennen zu lernen, habe ich dessen Beschreibung hier aufgenommen. Die Länge des Thieres beträgt 25 bis höchstens 30 Centim.; der Pelz besteht aus ziemlich langen, an der Wurzel gewellten, übrigens schlichten und feinen Haaren, welche am Grunde graubraun, in der Mitte fahlgrau und vor der lichten Spitze dunkelbraun aussehen, so daß die Gesammtfärbung zu einem heller und dunkler gesprenkelten Fahlgrau wird. Die Unterseite ist lichter, fahlgelblich, ein Mundwinkelstreifen gelblichweiß, ein Fleck auf dem Rücken braun, das Ohr außen fahlgrau, innen hellfahl, das Auge tief dunkelbraun, die Nasenkuppe schwarz. Abänderungen der Färbung scheinen ziemlich häufig vorzukommen.
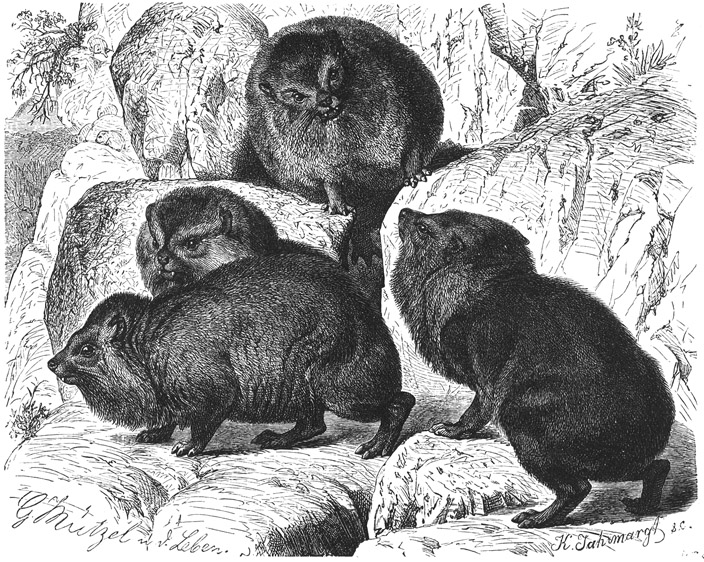
Aschkoko ( Hyrax abyssinicus). ¼ natürl. Größe.
Die Klippschliefer dürfen als bezeichnende Thiere der Wüsten- und Steppengebirge aufgefaßt werden. In verschiedenen, jedoch keineswegs leicht zu bestimmenden Arten bewohnen sie alle Gebirge Syriens, Palästinas und Arabiens, vielleicht auch Persiens, der gesammten Nilländer, Mittel- und Südafrikas, und zwar die Hochgebirge bis zu zwei- oder dreitausend Meter unbedingter Höhe nicht minder zahlreich als die inselartig aus den Ebenen emporragenden Kuppen und Kegel, welche den Steppenländern Nordostafrikas ein so eigenthümliches Gepräge verleihen.
Je zerklüfteter die Felswände sind, um so häufiger trifft man sie an. Wer ruhig durch die Thäler schreitet, sieht sie reihenweise auf den Felsengesimsen sitzen oder noch öfter liegen; denn sie sind ein behagliches, faules Volk, welches sich gern von der warmen Sonne bescheinen läßt. Eine rasche Bewegung oder ein lautes Geräusch verscheucht sie augenblicklich: die ganze Gesellschaft bekommt Leben; alles rennt und flüchtet mit Nagergewandtheit dahin, und ist fast im Nu verschwunden. In der Nähe der Dörfer, wo man sie ebenfalls, oft fast unmittelbar neben den Häusern, antrifft, scheuen sie sich kaum vor den Eingeborenen und treiben in seiner Gegenwart dreist ihr Wesen, gerade, als wüßten sie, daß hier niemand daran denkt, sie zu verfolgen; vor fremdartig gekleideten oder gefärbten Menschen aber ziehen sie sich augenblicklich in ihre Felsspalten zurück. Weit größere Furcht als der Mensch flößt ihnen der Hund oder ein anderes Thier ein. Wenn sie sich auch vor ihm in ihren Ritzen wohl geborgen haben, vernimmt man dennoch ihr eigenthümliches, zitternd hervorgestoßenes gellendes Geschrei, welches mit dem kleiner Affen die größte Aehnlichkeit hat. Die Abessinier glauben, daß der schlimmste Feind der Klippschliefer, der Leopard, an den Felswänden dahinschleicht, wenn diese gegen Abend oder in der Nacht ihre Stimmen vernehmen lassen; denn ungestört soll man sie nach Sonnenuntergang niemals schreien hören. Auch Vögel können ihnen das größte Entsetzen verursachen. Eine zufällig vorüberfliegende Krähe, selbst eine Schwalbe ist im Stande, sie nach ihrer sicheren Burg zurück zu jagen.
Um so auffallender ist es, daß die furchtsamen Schwächlinge mit Thieren in Freundschaft leben, welche unzweifelhaft weit gefährlicher und blutdürstiger sind als selbst die raubgierigsten Adler. »Schon öfter war es mir aufgefallen«, erzählt Heuglin, »in und auf den von Klippschliefern bewohnten Felsen gleichzeitig und, wie es schien, im besten Einvernehmen miteinander lebend, eine Manguste ( Herpestes Zebra) und eine Dornechse (wohl Stellio cyanogaster) zu finden. Nähert man sich einem solchen Felsen, so erblickt man zuerst einzeln oder gruppenweise vertheilt die munteren und possirlichen Klippdächse, auf Spitzen und Absätzen gemüthlich sich sonnend oder mit den zierlichen Pfötchen den Bart kratzend; dazwischen sitzt oder läuft eine behende Manguste, und an dem steilen Gestein klettern oft fußlange Dornechsen. Wird der Feind der Gesellschaft von dem auf dem erhabensten Punkte des Felsbaues als Schildwache aufgestellten Klippdachse bemerkt, so richtet sich dieser auf und verwendet keinen Blick mehr von dem fremden Gegenstande: aller Augen wenden sich nach und nach dahin; dann erfolgt plötzlich ein gellender Pfiff der Wache, und im Nu ist die ganze Gesellschaft in den Spalten des Gesteins verschwunden. Untersucht man letzteres genauer, namentlich mit stöbernden Hunden, so findet man Klippdachse und Eidechsen vollständig in die tiefsten Ritzen zurückgezogen, die Manguste dagegen setzt sich in Vertheidigungsstand und kläfft nicht selten zornig die Hunde an. Zieht man sich nun an einen möglichst gedeckten Ort in der Nähe zurück, so erscheint nach der betreffenden Richtung hin, vorsichtig aus einer Spalte guckend, der Kopf einer Dornechse; sie findet es zwar noch nicht ganz sicher, kriecht aber langsam, den Körper fest an das Gestein drückend, mit erhobenem Kopfe und Halse etwas weiter vorwärts, und bald folgen ihr in ähnlicher Weise, fortwährend nach der verdächtigen Stelle schauend, mehrere andere Eidechsen, zuweilen eine Bewegung mit dem Oberkörper machend und einen schnarrenden Ton von sich gebend. Nach geraumer Zeit wird ein Theil vom Kopfe einer Manguste sichtbar; das Thier entschlüpft nur langsam und vorsichtig der schützenden Spalte, schnüffelt gegen den Wind und erhebt sich endlich auf die Hinterbeine, um bessere Rundschau halten zu können. Zuletzt kommt ein Klippdachskopf um den anderen zum Vorscheine, aber alle immer noch sehr aufmerksam die gefährliche Richtung nach dem Versteck des Jägers beobachtend, und erst wenn die Eidechsen wieder angefangen haben, ihre Jagd auf Kerbthiere zu betreiben, ist Furcht und Vorsicht verschwunden und die allgemeine Ruhe hergestellt.«
Ungern nur verlassen die Klippschliefer ihren Felsen. Wenn das Gras, welches zwischen den Blöcken hervorsproßte, abgeweidet ist, steigen sie allerdings in die Tiefe herab; dann aber stehen immer Wachen auf den vorragendsten Felsspitzen, und ein Warnungszeichen von diesen ist hinreichend, die eiligste Flucht der ganzen Gesellschaft zu veranlassen.
Hinsichtlich ihrer Bewegungen und ihres Wesens erscheinen die Klippschliefer gewissermaßen als Mittelglieder zwischen den plumpen Vielhufern und den behenden Nagern. Wenn sie auf ebenem Boden dahinlaufen, ist ihr Gang verhältnismäßig schwerfällig: sie bewegen die Beine mit jener bekannten Ruhe der Dickhäuter oder besser, sie schleichen nur dicht an der Erde weg, als ob sie fürchteten, gesehen zu werden. Nach einigen wenigen Schritten stehen sie still und sichern; hierauf geht es in derselben Art weiter. Anders ist es, wenn sie erschreckt werden. Dann springen sie in kurzen Sätzen dahin, immer so eilig als möglich dem Felsen zu, und hier nun zeigen sie sich in ihrer vollen Beweglichkeit. Sie klettern meisterhaft. Die Sohlen ihrer Füße sind vortrefflich geeignet, hierin sie zu unterstützen. Der Ballen ist weich, aber dennoch rauh, und deshalb gewährt jeder Tritt die bei schneller Bewegung auf geneigten Flächen unbedingt nothwendige Sicherheit. Mich haben die Klippschliefer lebhaft an die Eidechsen mit Klebefingern, die sogenannten Gekos, erinnert. Obwohl sie nicht, wie diese beweglichen Thiere, an der unteren Seite wagerechter Flächen hingehen können, geben sie ihnen doch im übrigen nicht das geringste nach. Sie laufen aufwärts oder kopfunterst an fast senkrechten Flächen mit derselben Sicherheit dahin, als ob sie auf ebenem Boden gingen, kleben sich an halsbrechenden Stellen förmlich an den Felsen an, steigen in Winkeln oder Ritzen äußerst behend auf und nieder, halten sich auch an jeder beliebigen Stelle fest, indem sie sich mit dem Rücken an die eine Wand der Ritze, mit den Beinen aber an die andere stemmen. Dabei sind sie geübte und gewandte Springer. Auf Sätze von drei bis fünf Meter Höhe kommt es ihnen nicht an; man sieht sie selbst an acht bis zehn Meter hohen, senkrechten, ja überhängenden Wänden nach Art der Katzen herabgleiten, indem sie etwa Dreiviertel der Höhe an der Wand herunterlaufen und dann, plötzlich von ihr abspringend, mit aller Sicherheit auf einem neuen Steine fußen.
Wie mir, erschien auch Schweinfurth die unerreichte Beweglichkeit und Kletterfertigkeit der Klippschliefer im höchsten Grade befremdlich, bis ein Zufall ihm das bis dahin unerklärte Räthsel löste. Von einem eingebornen Jäger darauf aufmerksam gemacht, daß ein angeschossener Klippschliefer im Todeskampfe so innig an den glatten Felsen sich klammere, als wäre er festgewachsen, erfuhr er die Thatsächlichkeit dieser Behauptung, als er einen von ihm verwundeten Aschkoko von der Felsenplatte abheben wollte und auf einen so bedeutenden Widerstand stieß, daß eine merkliche Kraftanstrengung dazu gehörte, denselben zu überwinden. Genaue Untersuchung der wie Kautschuk spann- oder federkräftigen Sohlen überzeugte unseren, wie immer scharf beobachtenden Forscher, daß der Klippschliefer im Stande ist, durch beliebige Einziehung und Ausdehnung der mittleren Spalte seiner Sohlenpolster an die glatte Oberfläche sich ansaugen zu können. Mit Recht hebt Schweinfurth hervor, daß eine derartige Befähigung, wie sie bei Kriechthieren und Lurchen vorkommt, bei Säugethieren und Warmblütern überhaupt geradezu unerhört ist.
Das Betragen der Klippschliefer deutet auf große Sanftmuth, ja fast Einfalt, verbunden mit unglaublicher Aengstlichkeit und Furchtsamkeit. Sie sind höchst gesellig; denn man sieht sie fast niemals einzeln oder darf, wenn dies wirklich der Fall sein sollte, bestimmt darauf rechnen, daß die übrigen Glieder der Gesellschaft eben nicht zur Stelle sind. An dem einmal gewählten Wohnplatze halten sie treulich fest, derselbe mag so groß oder so klein sein, als er will. Zuweilen genügt ihnen ein einzelner großer Felsblock; man sieht sie höchstens heute auf dieser, morgen auf jener Seite desselben. Bei gutem Wetter lagern sie sich reihenweise in der faulsten Stellung auf passende Steine, die Vorderfüße eingezogen, die Hinteren weit ausgestreckt, wie Kaninchen manchmal zu thun pflegen. Einige Wachen bleiben aber auch dann ausgestellt.
Es scheint, daß die Klippschliefer keine Kostverächter sind und unglaublich viel verzehren. Ihre an würzigen Gebirgs- und Alpenpflanzen reiche Heimat läßt sie wohl niemals Mangel leiden. Ich sah sie wiederholt am Fuße der Felsen weiden und zwar ganz in der Weise, wie Wiederkäuer zu thun pflegen. Sie beißen die Gräser mit ihren Zähnen ab und bewegen die Kinnladen so, wie die Zweihufer thun, wenn sie wiederkauen. Einige Forscher haben geglaubt, daß sie wirklich die eingenommenen Speisen nochmals durchkauen; ich habe aber hiervon bei allen denen – bei den ruhenden wenigstens – welche ich sehr genau beobachten konnte, niemals etwas bemerkt. Wie es scheint, trinken sie nicht oder nur sehr wenig. Zwei Orte in der Nähe des Bogosdorfes Mensa, welche von Klippschliefern bewohnt sind, liegen in einer auf bedeutende Strecken hin vollkommen wasserlosen Ebene, welche die furchtsamen Thiere sicherlich nicht zu überschreiten wagen. Zur Zeit, als ich sie beobachtete, regnete es freilich noch wiederholt, und sie bekamen hierdurch Gelegenheit zum Trinken; allein die Bewohner des Dorfes versicherten mich, daß jene Klippschliefer auch während der Zeit der Dürre ihre Wohnsitze nicht verlassen. Dann gibt es nirgends einen Tropfen Wasser, und höchstens der Nachtthau, mit welchem bekanntlich viele Thiere sich begnügen, bleibt noch zur Erfrischung übrig.
Weil das Weibchen sechs Zitzen hat, glaubte man früher, daß die Klippschliefer eine ziemliche Anzahl von Jungen zur Welt bringen. Ich bezweifelte von jeher die Richtigkeit dieser Ansicht. Unter den zahlreichen Gesellschaften, welche ich sah, gab es so außerordentlich wenig Junge, daß man hätte annehmen müssen, es befänden sich unter der ganzen Menge nur zwei oder drei fortpflanzungsfähige Weibchen, und dies war doch entschieden nicht der Fall. Auch habe ich niemals beobachtet, daß eine Alte von mehreren Kleinen umringt gewesen wäre. Aus diesem Grunde glaubte ich annehmen zu dürfen, daß jedes Weibchen nur ein Junges wirft, bin jedoch durch Schweinfurth belehrt worden, daß es deren zwei, und zwar in einem sehr entwickelten Zustande zur Welt bringt. Diese Angabe stimmt überein mit einer Mittheilung Reads, welcher im Kaplande mehrmals beobachtete, daß zwei Junge der Alten folgten.
Die Jagd der Klippdachse verursacht keine Schwierigkeiten, falls man die ängstlichen Geschöpfe nicht bereits wiederholt verfolgt hat. Es gelingt dem Jäger gewöhnlich, eine der in geeigneter Entfernung sitzenden Wachen herabzudonnern. Nach einigen Schüssen wird die Herde freilich sehr ängstlich, flieht schon von weitem jeden Menschen und zeigt sich nur in den höchsten Spalten des Felsens. Unglaublich groß ist die Lebenszähigkeit der kleinen Gesellen; selbst sehr stark verwundete wissen noch eine Ritze zu erreichen, und dann ist gewöhnlich jedes weitere Nachsuchen vergebens.
Nur in Arabien und am Vorgebirge der Guten Hoffnung werden Klippschliefer ihres wie Kaninchenfleisch schmeckenden Wildprets halber gefangen. Auf der Halbinsel des Sinai tiefen die Beduinen eine Grube ab, füttern sie mit Steinplatten aus und richten einen steinernen Falldeckel mit Stellpflöcken her. Ein Tamariskenzweig, welcher als Lockspeise dient, hebt, sobald er bewegt, bezüglich angefressen wird, die Stellpflöcke aus; der Deckel schlägt nieder, und das unkluge Gebirgskind sitzt in einem Kerker, dessen Wände seinen schwach bekrallten, zum Graben unfähigen Pfoten unbesieglichen Widerstand leisten. Auf diese Weise bekam Ehrenberg während seines Aufenthalts im Steinigten Arabien sieben Stück lebendig in seine Gewalt. Die Kaffern fangen, wie Kolbe berichtet, Klippdachse mit den Händen (?). Ein Gastfreund jenes alten guten Beobachters besaß einen neunjährigen Sklaven, welcher das Vieh hütete und dabei die Steinberge oft bestieg. Dieser brachte zuweilen so viel von seinem Lieblingswilde nach Hause, daß er es kaum tragen konnte und allgemeine Verwunderung erregte, weil man die zum Fange so behender Geschöpfe nothwendige Geschicklichkeit sich nicht erklären konnte. Später richtete der Knabe einen Hund ab, welcher ihn beim Fangen unterstützte. Tellereisen, vor die Ausgänge mancher besonders beliebten Spalten gelegt, würden wohl auch gute Dienste leisten.
Mehrere Reisende erzählten von Gefangenen, welche sie besaßen. Graf Mellin vergleicht einen von ihm gezähmten Klippschliefer mit einem Bären, welcher nicht größer als ein Kaninchen ist. Er nennt ihn ein vollkommen wehrloses Wesen, welches sich weder durch eine schnelle Flucht retten, noch durch seine Zähne oder Klauen vertheidigen kann. Ich stimme dieser Angabe, nach dem, was ich an verwundeten (angeschossenen) Klippschliefern beobachtete, vollkommen bei; Ehrenberg dagegen versichert, daß der »Wabbr« sehr bissig wäre. Mellins Gefangener biß sich zwar manchmal knurrend mit einem kleinen Schoßhündchen herum, konnte diesem aber nichts anhaben. Wenn man ihn in den Hof brachte, wählte er sogleich einen finsteren Winkel desselben aus, am liebsten einen Haufen Mauersteine, zwischen denen er ein Versteck suchte. Das Fenster war sein Lieblingsaufenthalt, obgleich er hier oft großes Leid auszuhalten hatte; denn, wenn nur eine Krähe oder eine Taube vorbeiflog, gerieth er in Angst und lief eilend seinem Kasten zu, um dort sich zu verstecken. Niemals nagte er an den Sprossen seines Käfigs oder an dem Bande, woran er befestigt worden war. Manchmal sprang er auf die Tische und benahm sich hier so vorsichtig, daß er nichts umwarf, auch wenn der ganze Tisch voll Geschirr war. Brod, Obst, Kartoffeln und andere, rohe wie gekochte Gemüse fraß er gern; Haselnüsse, welche man ihm aufschlagen mußte, schienen eine besondere Leckerei für ihn zu bilden. Stets hielt er sich sehr reinlich. Harn und Losung setzte er immer an demselben Orte ab, und verscharrte beides wie die Katzen. Wenn man ihm Sand gab, wälzte er sich in demselben herum, wie Hühner zu thun pflegen. So lange man ihn angebunden hielt, war er träge und schläfrig; sobald er freigelassen wurde, sprang er den ganzen Tag im Zimmer umher, von einem Ort zum anderen, besonders gern auf den warmen Ofen, wo er behaglich sich hinstreckte. Sein Gehör war sehr leise: er konnte sowohl die Stimme, als auch den Gang von denjenigen unterscheiden, zu welchen er besondere Neigung hatte. Den Ruf seines Herrn beantwortete er mit einem leisen Pfeifen, kam dann herbei und ließ sich in den Schoß nehmen und streicheln. Read berichtet ähnliches von einem aus dem Kaplande stammenden Klippschliefer. Das Thierchen war mit seinem Geschwister aufgezogen und infolge dessen ungemein zahm und anhänglich geworden, besuchte seinen Gebieter im Bette und schmiegte sich dicht an denselben, um sich an der Wärme zu erquicken, verkroch sich auch zu gleichem Zwecke unter der Weste seines Pflegers, nachdem es bis zur Brusthöhe behend an ihm emporgeklettert war. Sein Geschwister, welches nach England gebracht worden war, suchte ebenfalls gern die Gesellschaft seines Wirtes, war jedoch rastlos, ungemein neugierig und furchtsam. Jeder Gegenstand des Zimmers wurde genau untersucht, jeder eintretende Mensch beschnüffelt und beklettert; das geringste Geräusch aber scheuchte das Thierchen sofort in sein Versteck. Engere Haft machte es verdrießlich und bissig, ihm gewährte Freiheit, welche es niemals mißbrauchte, munter und lebendig. Mit Sonnenuntergang kroch es in seinen Schlafraum, knusperte jedoch zuweilen noch an etwas genießbaren herum und stieß auch inmitten der Nacht, wohl durch Träume beängstigt, schwache Schreie aus. Beim Fressen zeigte es sich wählerisch und lecker, nahm, wenn es sein konnte, bald von dieser, bald von jener Pflanze einige Blättchen, leckte gierig ihm gereichtes Salz und trank leckend und saugend von dem ihm vorgesetzten Wasser. Unterwegs hatte man es mit gequetschtem Mais, Brod, rohen Kartoffeln und Zwiebeln gefüttert, in England fraß es von den verschiedensten Pflanzenstoffen. Gegen die Kälte zeigte es sich so empfindlich, daß es schon, wenn man eine Kerze unmittelbar neben das Gitter seines Käfigs stellte, herbeikam und sich drehte und wendete, um jedem Theil seines Leibes die geringe Wärmeausstrahlung zukommen zu lassen. Diese Frostigkeit erklärt es wahrscheinlich, daß so wenige von den aus unseren Thiermarkt gelangenden Klippschliefern längere Zeit bei uns zu Lande aushalten und von ihnen bis jetzt nur ein einziges Pärchen Junge gebracht hat. So anspruchslos die Gefangenen im allgemeinen sind, Wärme gehört zu ihren unabweislichen Bedürfnissen, und sie gehen ein, wenn sie derselben entbehren müssen.
Die Beduinen des Steinigten Arabien lieben, wie bemerkt, das Fleisch der Klippschliefer in hohem Grade. Gefangene tödten sie sofort, weiden sie, wie die anderweitig mit dem Gewehr erlegten, an Ort und Stelle aus und füllen die Leibeshöhlen mit wohlriechenden Alpenkräutern an, ebensowohl um das Fleisch schmackhafter zu machen, als um es länger vor der Verwesung zu bewahren. Eine sonstige Benutzung des Thieres kennen diese Leute nicht, wohl aber die Kapbewohner, welche auch anderes vom Klippschliefer zu verwenden wissen. Noch heutigen Tages kommt die immer mit Harn gemischte Losung, welche von holländischen Ansiedlern »Dassenpiß« oder Dachsharn genannt wird, unter dem Namen Hyraceum in den Handel, und selbst in Europa gibt es Aerzte, welche bei gewissen Nervenkrankheiten den »Dachsharn« als Arzneimittel verordnen. Schade nur, daß es auch mit diesem Mittel geht, wie mit vielen anderen, welche aus dem Thierreiche stammen: seine Wirkung beruht eben auf der Einbildung. Für den Fall aber, daß mit dem Hyraceum wirklich ein Geschäft zu machen ist, will ich meinen Lesern mittheilen, daß man auf fast allen Felsen der Bogosländer von jenem Arzneimittel so viel einsammeln kann, als man will. Die Klippschliefer leisten, dank ihrer gesegneten Freßlust, wirklich erstaunliches in Erzeugung ihrer Losung, und deshalb liegt diese in verhältnismäßig sehr großen Haufen auf allen Steinen, wo die Thiere sich umhergetrieben haben, und scheffelweise in gewissen Felsenspalten aufgespeichert.
Die letzte Unterordnung endlich umfaßt die Vielhufer im engsten Sinne oder schweinsähnlicher Dickhäuter ( Choeromorpha), welche Owen mit den Wiederkäuern zu einer besonderen Ordnung ( Artiodactyla) vereinigt, wogegen wir sie auf die beiden Familien der Schweine und Flußpferde beschränken.
Die Borstenthiere oder Schweine ( Setigera oder Suina) erscheinen, verglichen mit den schweren, massigen Gestalten ihrer Ordnung, als zierlich gebaute Dickhäuter. Ihr Rumpf ist seitlich zusammengedrückt, der Kopf fast kegelförmig mit vorn abgestumpfter Spitze, der Schwanz dünn, lang und geringelt, die lang gestreckte Schnauze vorn in eine Rüsselscheibe verbreitert, in welcher die Nasenlöcher liegen; die Ohren sind mäßig groß, gewöhnlich aufrechtstehend, die Augen schief geschlitzt und verhältnismäßig klein; die Beine schlank und dünn, ihre Zehen paarig gestellt, die mittleren, welche den Körper tragen, wesentlich größer als die äußeren. Ein mehr oder minder dichtes Borstenkleid umhüllt den Leib. Beim Weibchen liegen in zwei Reihen zahlreiche Zitzen am Bauche. Das Geripp zeigt zierliche und leichte Formen. Dreizehn bis vierzehn Wirbel tragen Rippen, fünf bis sechs sind rippenlos, vier bis sechs bilden das Kreuzbein, neun bis zwanzig den Schwanz. Am elften Wirbel sitzt das Zwerchfell. Die Rippen sind schmal und abgerundet. Bei sämmtlichen Schweinen sind alle drei Zahnarten in der oberen und unteren Reihe vorhanden. Die Anzahl der Schneidezähne schwankt zwischen zwei und drei in jeder Kieferhälfte; doch fallen im Alter nicht selten diese Zähne aus. Immer sind Eckzähne vorhanden und zwar von sehr bezeichnender Gestalt: dreikantig, stark, gekrümmt und nach oben gebogen. Die übrigen Zähne, deren Anzahl wechselt, sind einfach zusammengedrückt, die Mahlzähne breit und mit vielen Höckern besetzt. Unter den Muskeln fallen die auf, welche die Lippen bewegen; namentlich die der Oberlippe sind sehr stark und verleihen dem Rüssel Kraft zum Wühlen. Außerdem besitzen die Schweine bedeutend entwickelte Speicheldrüsen, einen rundlichen Magen mit großem Blindsack und einen Darmschlauch, welcher etwa zehnmal länger ist als der Leib des Thieres. Unter der Haut bildet sich bei reichlicher Nahrung eine Specklage, deren Dicke bis zu mehreren Centimetern ansteigen kann.
Mit Ausnahme von Neuholland bewohnen die Borstenthiere fast alle Länder der übrigen Erdtheile. Große feuchte, sumpfige Wälder in bergigen oder ebenen Gegenden, Dickichte, Gestrüppe, mit hohem Grase bedeckte, feuchte Flächen und Felder bilden ihren Aufenthalt. Alle lieben die Nähe des Wassers oder mit anderen Worten Sümpfe, Lachen und die Ufer der Flüsse und Seen, wühlen sich hier im Schlamme oder Moraste ein Lager aus und liegen in diesen, oft halb im Wasser, während der Zeit ihrer Ruhe; einzelne Arten suchen auch in großen Löchern unter Baumwurzeln Schutz. Die meisten sind gesellige Thiere; doch erreichen die Rudel, welche sie bilden, selten eine bedeutende Stärke. Ihre Lebensweise ist eine nächtliche; denn auch an Orten, wo sie keine Gefahr zu befürchten brauchen, beginnen sie erst mit Anbruch der Dämmerung ihr Treiben. Sie sind keineswegs so plump und unbeholfen als sie erscheinen, ihre Bewegungen vielmehr verhältnismäßig leicht. Ihr Gang ist ziemlich rasch, ihr Lauf schnell, ihr Galopp eine Reihe eigenthümlicher Sätze, von denen jeder mit einem ausdrucksvollen Grunzen begleitet wird. Alle schwimmen vortrefflich, setzen sogar über Meeresarme, um von einer Insel zu der anderen zu gelangen. Auch die Sinne der Schweine, namentlich Geruch und Gehör, sind gut ausgebildet: sie wittern und vernehmen ausgezeichnet. Das kleine und blöde Auge dagegen scheint nicht besonders scharf zu sehen, und Geschmack und Gefühl ebensowenig entwickelt zu sein. Vorsichtig und scheu, fliehen sie zwar in der Regel vor jeder Gefahr, stellen sich aber, sobald sie bedrängt werden, tapfer zur Wehre, greifen sogar oft ohne alle Umstände ihre Gegner an. Dabei suchen sie diese umzurennen und mit ihren scharfen Hauern zu verletzen, und sie verstehen diese furchtbaren Waffen mit so großem Geschick und so bedeutender Kraft zu gebrauchen, daß sie sehr gefährlich werden können. Alle Keuler vertheidigen ihre Bachen und diese ihre Frischlinge mit vieler Aufopferung. Ungelehrig und störrisch, erscheinen sie nicht zu höherer Zähmung geeignet, wie überhaupt ihre Eigenschaften nicht eben ansprechend genannt werden dürfen. Die Stimme ist ein sonderbares Grunzen, welches viel Behäbigkeit und Selbstzufriedenheit oder Gemüthlichkeit ausdrückt. Von alten Keulern vernimmt man auch ein tiefes Brummen.
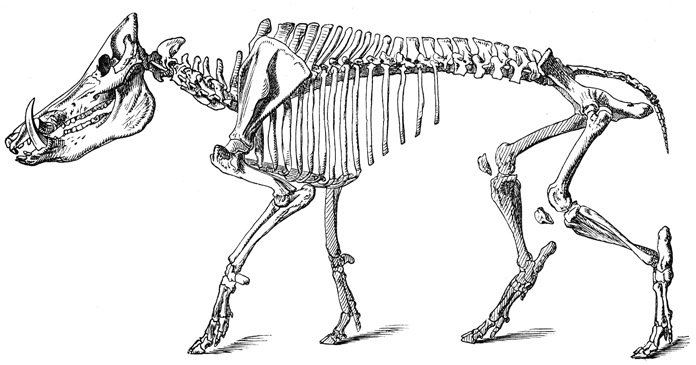
Geripp des Wildschweins. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
Die Schweine sind Allesfresser in des Wortes vollster Bedeutung. Was nur irgend genießbar ist, erscheint ihnen recht. Wenige von ihnen ernähren sich ausschließlich von Pflanzenstoffen, Wurzeln, Kräutern, Feld- und Baumfrüchten, Zwiebeln, Pilzen etc., die übrigen verzehren nebenbei auch Kerbthiere und deren Larven, Schnecken, Würmer, Lurche, Mäuse, ja selbst Fische, und mit Vorliebe Aas. Ihre Gefräßigkeit ist so bekannt, daß darüber nichts gesagt zu werden braucht: in ihr gehen eigentlich alle übrigen Eigenschaften unter, mit alleiniger Ausnahme der beispiellosen Unreinlichkeit, welche ihnen die Mißachtung des Menschen eingetragen hat.
Nur bei den wenigsten Arten wirft die Bache ein einziges oder eine kleine Schar von Ferkeln; die übrigen bringen viele Junge zur Welt, zuweilen mehr als irgend ein anderes Säugethier, bis vierundzwanzig nämlich. Die Frischlinge sind allerliebste, lustige, bewegliche Geschöpfe, welche jedermann entzücken würden, wenn sie nicht die Unreinlichkeit der Alten vom ersten Tage ihres Lebens an zeigten. Sie wachsen überraschend schnell und sind bereits nach Jahresfrist fortpflanzungsfähig, weshalb auch alle ihnen besonders zusagenden Länder von ihnen wimmeln, und sie selbst da, wo sie in keiner Weise geschont werden, kaum ausgerottet werden können.
Ihre außerordentliche Vermehrungsfähigkeit und Gleichgültigkeit gegen veränderte Umstände eignen sie in hohem Grade für den Hausstand. Wenige Thiere lassen sich so leicht zähmen, wenige verwildern aber auch so leicht wieder wie sie. Ein junges Wildschwein gewöhnt sich ohne weiteres an die engste Gefangenschaft, an den schmutzigsten Stall, ein in diesem geborenes Hausschwein wird schon nach wenigen Jahren, welche es in der Freiheit verlebte, zu einem wilden und bösartigen Thiere, welches von seinen Ahnen kaum sich unterscheidet und in der Regel schon beim ersten Wurfe Junge bringt, welche echten Wildschweinen vollständig gleichen.
Alle Wildschweine fügen dem gebildeten, ackerbautreibenden Menschen so großen Schaden zu, daß sie sich nicht mit dem Anbau des Bodens vertragen. Sie werden deshalb überall aufs eifrigste verfolgt, wo der Mensch zur Herrschaft gelangt. Ihre Jagd gilt als eins der edelsten Vergnügen und hat auch außerordentlich viel anziehendes, weil es sich hier um Geschöpfe handelt, welche ihr Leben unter Umständen sehr theuer zu verkaufen wissen.
Der Mensch ist übrigens nur in den nördlichen Gegenden der schlimmste Feind der wildlebenden Schweine. In den Ländern unterhalb der Wendekreise stellen die großen Katzen- und Hundearten den dort wohnenden Arten eifrig nach und richten oft arge Verwüstungen unter ihren Herden an. Füchse, kleinere Katzen und Raubvögel wagen sich bloß an Frischlinge und immer nur mit großer Vorsicht, weil, wie bemerkt, die Mutter ihre Kinderschar kräftig zu vertheidigen weiß.
Alle Schweine der Erde ähneln sich in ihrem Leibesbau und Wesen. Die geringen Unterschiede, welche sich feststellen lassen, beruhen auf der größeren Schlankheit oder Plumpheit des Baues, der Anzahl der Zähne und der Bildung der Hauzähne. Gray hat neuerdings eine Uebersicht aller im Britischen Museum vertretenen und ihm sonstwie bekannten Arten gegeben und sich berechtigt geglaubt, drei Familien, die der Schweine, der Nabelschweine und der Warzenschweine, aufstellen zu dürfen, obgleich diese Abtheilungen sich so nahe stehen, daß sie kaum als Unterfamilien anzusehen sind. Die Merkmale der ersten dieser Gruppen ( Suina) sind: drei Schneidezähne, ein dreieckiger, nach oben gebogener Eckzahn, vier Lück- und drei Backenzähne in jeder Kieferhälfte, also im ganzen vierundvierzig Zähne, welche jedoch auch bis auf vierzig herabsinken können, längerer, selten fehlender Schwanz, vier Zehen an jedem Fuße und zehn, mindestens acht Zitzen am Bauche des Weibchens.
Eiförmige, behaarte Ohren und mittellanger, am Ende buschiger Schwanz kennzeichnen die Schweine im engsten Sinne ( Sus), welche unser Wildschwein ( Sus scrofa , Sus aper und fasciatus) würdig vertritt. Dieses starke, kräftige und wehrhafte Thier erreicht bei reichlich 2 Meter Gesammt- oder 1,8 Meter Leibes- und 25 Centim. Schwanzlänge, 95 Centim. Schulterhöhe und 150 bis 200 Kilogramm an Gewicht, ändert jedoch nach Aufenthalt, Jahreszeit und Nahrung in Größe und Gewicht bedeutend ab. Die in sumpfigen Gegenden wohnenden Wildschweine sind regelmäßig größer als die in trockenen Wäldern lebenden; die auf den Inseln des Mittelmeeres hausenden kommen nie den festländischen gleich. In seiner Gestalt ähnelt das Wildschwein seinem gezähmten Abkömmling; nur ist der Leib kürzer, gedrungener; die Läufe sind stärker, der Kopf ist etwas länger und schmächtiger; das Gehör steht mehr aufgerichtet und ist etwas länger und spitziger; auch die Gewehre oder Hauer werden größer und schärfer als bei dem zahmen Schweine. Die Färbung ist verschieden, wird jedoch im allgemeinen durch den Jägernamen »Schwarzwild« bezeichnet; denn graue, rostfarbene, weiße und gefleckte Wildschweine sind selten. Die Jungen haben auf grauröthlichem Grunde gelbliche Streifen, welche sich ziemlich gerade von vorn nach hinten ziehen, bereits in den ersten Monaten des Lebens aber sich verlieren. Das Haarkleid besteht aus steifen, langen und spitzigen, an der Spitze häufig gespaltenen Borsten; dazwischen mengt sich je nach der Jahreszeit mehr oder weniger kurzes, feines Wollhaar ein. Am Unterhalse und Hinterbauche sind die Borsten nach vorwärts, an den übrigen Theilen des Körpers nach rückwärts gerichtet; auf dem Rücken bilden sich eine Art von Kamm oder Mähne. Schwarz oder rußbraun ist ihre gewöhnliche Färbung, die Spitzen aber sind gelblich, grau und röthlich, und hierdurch wird der allgemeine Ton etwas lichter. Die Ohren sind schwarzbraun, der Schwanz, der Rüssel und die untere Hälfte der Beine und Klauen schwarz; am Vordertheile des Gesichts ist das Borstenhaar gewöhnlich gesprenkelt. Rostfarbene und weißgefleckte oder halbschwarze und halbweiße Schweine, welche hier und da vorkommen, hält man für Abkömmlinge verwilderter Hausschweine, welche vormals ausgesetzt wurden, um die Wildart zu vermehren.
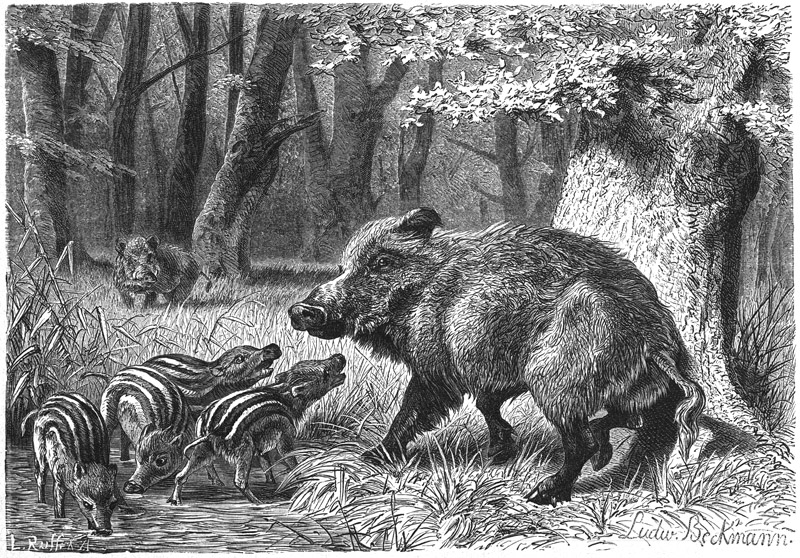
Wildschwein.
Der Waidmann nennt unser Thier Sau, das männliche Wildschwein, wenn es erwachsen ist, Schwein, das weibliche Bache. Junge Thiere bis zum zweiten Jahre heißen Frischlinge; später bezeichnet man die Weibchen als zweijährige, starke und grobe Bachen, das Schwein aber als zweijährigen Bacher oder Keuler, dann als dreijährigen Keuler, vom vierten Jahre an als angehendes, vom fünften Jahre als hauendes oder gutes, vom siebenten Jahre an als Haupt- und grobes Schwein. Den Rüssel nennt man Gebreche, die Hauzähne Gewehre, die der Bache Hacken, das gewöhnliche Haar Borste, das längere auf dem Rücken Feder, die dicke Haut auf den Schulterblättern Schild, den Schwanz Pürzel oder Federlein. Das Schwein liegt in einem Revier, gräbt sich in das Lager oder in den Kessel ein, stellt sich dem Hunde, wird von diesem gedeckt oder festgemacht, streitet mit den Hunden, schlägt sie, schlägt sich los (geht durch). Die Bache frischt oder setzt Junge. Die einzelne Sau hat ein Lager, das Rudel einen Kessel. Der durchwühlte Erdboden heißt Gebräche etc.
Früher fast über ganz Europa verbreitet und in der Mitte wie im Süden dieses Erdtheils gleich häufig auftretend, ist das Wildschwein gegenwärtig, ebenso zur Freude aller Land- und Forstwirte wie zum Kummer aller Jäger, in mehreren Ländern und in vielen Gegenden gänzlich ausgerottet worden, oder lebt doch nur noch als gehegtes Jagdthier in Wildparks. Sein Verbreitungsgebiet reicht nicht über den fünfundfünfzigsten Grad der Breite hinaus: es kommt also in allen nördlich der Ostsee gelegenen Ländern, wenigstens gegenwärtig, nicht mehr vor. In Deutschland lebt es immer noch in größerer Anzahl, als dem Landwirte lieb ist, in vollständiger Wildheit, hat sich sogar in den letzten Jahren so vermehrt, daß seine Hege- und Schonzeit aufgehoben werden mußte, und eigentlich jedermann die Erlaubnis hat, es auf eigenem Grund und Boden jederzeit zu tödten und nach Belieben zu verwerthen. Soviel mir bekannt, findet es sich noch heutigen Tages in allen größeren Waldungen Südwest-, West- Nord- und Ostdeutschlands oder im Elsaß und in den Rheinlanden, in Hessen, Nassau, Hannover, Pommern, Ost- und Westpreußen, auch hier und da in Brandenburg und Oberschlesien, im Königreiche Sachsen und in Thüringen, ist also eigentlich nur in den waldarmen Ebenen und auf einigen unserer kleinen Mittelgebirge gänzlich vertilgt worden. Häufiger noch als in Deutschland lebt es in einzelnen Gebirgswäldern Frankreichs und Belgiens und ebenso in Polen, Galizien, Ungarn, den Donautiefländern, Südrußland, auf der Balkan- und Iberischen Halbinsel. In Asien verbreitet es sich vom Kaukasus an bis zum Amur und vom fünfundfünfzigsten Breitengrade an bis zum Nordabhange des Himalaya, ist wahrscheinlich auch mit dem in Kleinasien, Syrien und Palästina lebenden, von Gray Sus lybicus genannten Wildschweine gleichartig, tritt aber nur auf ihm zusagenden Oertlichkeiten auf, fehlt z. B. den Hochsteppen gänzlich, steigt jedoch im Thianschangebirge bis über die Waldgrenze oder bis zu 3300 Meter unbedingter Höhe empor; in Afrika bewohnt es alle geeigneten Oertlichkeiten des ganzen Nordrandes dieses Erdtheils. Erst jenseit der angegebenen Verbreitungsgrenzen wird es durch andere, theilweise noch näher zu untersuchende, also noch nicht endgültig festgestellte Arten und zwar, laut Gray, im festländischen Indien durch das Mähnenschwein (Sus cristatus), auf den Andamanen durch das Andamanenschwein (Sus andamanensis), auf Borneo durch das Bartschwein (Sus barbatus), das Bindenschwein (Sus vittatus) und das Pustelschwein (Sus verrucosus), von denen ersteres auch auf Java, Amboina und Banka, letzteres auch auf Java und Ceram vorkommt, auf Celebes durch das Celebesschwein (Sus celebensis), auf Timor durch das Timorschwein (Sus timorensis), in Japan und auf Formosa durch das Weißbartschwein (Sus leucomystax), im Inneren Nordostafrikas endlich durch das Sennârschwein (Sus sennarensis) vertreten.
Feuchte und sumpfige Gegenden bilden unter allen Umständen den Aufenthaltsort des Wildschweins, gleichviel, ob hier ausgedehnte Waldungen sich finden oder die Gegend bloß mit Sumpfgräsern bestanden ist. In Europa und Asien wohnt das Thier vorzugsweise in feuchten Dickichten großer Waldungen, in Afrika dagegen bricht es sich sein Lager mitten im Sumpfe oder in ausgedehnten Feldern. An vielen Orten Egyptens hausen die Wildschweine jahraus jahrein in Zuckerrohrfeldern, ohne diese jemals zu verlassen, fressen die Rohrstengel, suhlen sich in dem Wasser, welches über die Felder geleitet wird und befinden sich hier so wohl, daß sie durch keine Anstrengungen zu vertreiben sind. Im Delta lagern sie sich auf den feuchten, mit Riedgrase bestandenen Stellen und an den unteregyptischen Strandseen in dem Röhrichte der ausgedehnten Brüche. Auch in Asien verlassen sie hier und da die Waldungen, um im Hochgrase an fließenden und stehenden Gewässern wenigstens zeitweilig Stand zu nehmen. Inmitten seines Gebietes bricht sich das Schwein eine Vertiefung, gerade groß genug, um seinen Leib aufzunehmen. Wenn es sein kann, füttert es dieses Lager mit Moos, trockenem Grase und Gelaube aus und legt sich hier so bequem als möglich nieder. Das Rudel bereitet sich an ähnlichen Orten den Kessel, pflegt sich aber so in ihm einzuschieben, daß aller Köpfe nach der Mitte hin gerichtet sind. Der Wärme wegen benutzen die wilden Sauen im Winter gern zusammengerechte Streu- oder Schilfhaufen anstatt der Lager und Kessel, um sich darunter einzuschieben, und der Jäger, welcher solche Orte besucht, kann dann das sonderbare Schauspiel genießen, daß der Haufen, dem man sich, ohne etwas zu ahnen, näherte, mit einem Male beweglich zu werden anfängt und ein ganzes Rudel Sauen aussendet. Das Schwein und jede andere starke Sau sucht fast täglich das Lager wieder auf; das Rudel dagegen nimmt seinen Kessel gewöhnlich nur im Winter wieder an, weil dann alle Sauen ihr Gebreche so viel als möglich schonen. Im Sommer brechen sie sich täglich einen neuen Kessel aus, und gerade hierdurch werden sie oft sehr schädlich.
Als sehr gesellige Thiere halten sich bis zur Fortpflanzungszeit immer mehrere Bachen und schwache Keuler zusammen, und nur die groben Schweine leben als Einsiedler für sich. Bei Tage liegen die Rudel still und faul im Kessel; gegen Abend erheben sie sich, um nach Fraß auszugehen. Zuerst gehen sie, wie der Waidmann sagt, im Holze und auf den Wiesen ins Gebräche, d. h. stoßen wühlend den Boden auf, oder sie laufen einer Suhle zu, in welcher sie sich ein halbes Stündchen wälzen. Solche Abkühlung scheint ihnen unentbehrlich zu sein; denn sie laufen oft meilenweit nach dem Bade. Erst wenn alles ruhig wird, nehmen sie die Felder an, und wo sie sich nunmehr festgesetzt haben, lassen sie sich so leicht nicht vertreiben. Wenn das Getreide Körner bekommt, hält es sehr schwer, sie aus dem Felde zu scheuchen und sich vor Schaden zu hüten. Sie fressen weit weniger, als sie sonst durch oft wiederholtes Wälzen verwüsten, machen oft genug große Flächen vollkommen der Erde gleich und werden gerade deshalb außerordentlich schädlich. Im Walde und auf den Wiesen sucht das Schwarzwild Erdmast, Trüffeln, Kerbthierlarven, Gewürm oder im Herbste und im Winter abgefallene Eicheln, Bücheln, Haselnüsse, Kastanien, Kartoffeln, Rüben und alle Hülsenfrüchte. Mit Ausnahme der Gerste auf dem Halme, frißt es überhaupt alle denkbaren Pflanzen und verschiedene thierische Stoffe, sogar gestorbenes Vieh, gefallenes Wild und Leichen, auch solche von seines Gleichen, wird sogar unter Umständen förmlich zum Raubthiere. Erfahrene Waidmänner verdächtigen das Wildschwein, junge, noch unbehülfliche Wildkälber mörderisch anzufallen oder ebenso verwundetem Edel-, Dam- und Rehwilde auf der Rothfährte zu folgen und nicht von ihm abzulassen, bis es die gewitterte Beute erlangt und getödtet hat, worauf es, neidisch und streitsüchtig gegen- und untereinander, tapfer schmausen soll, so daß der Jäger am nächsten Morgen kaum mehr als die Knochen findet.
In Asien gestaltet sich das Leben des Schwarzwildes, den hier oder dort obwaltenden Umständen entsprechend, verschiedenartig und demgemäß auch abweichend von seinem Treiben in Europa. Schon Pallas erwähnt, daß die Wildschweine Dauriens kaum das Hausschwein an Größe übertreffen und ein sehr dunkles und zähes Wildpret liefern. Dasselbe gilt, laut Radde, für das Schwarzwild des Sajan-, Apfel- und Chingangebirges, das Gegentheil für das, welches das Burejagebirge bewohnt. Hier bieten ihm Eichen- und Zirbelbestände, deren Früchte eine außerordentliche Größe erreichen, sowie die ungemein häufigen Lilien und Päonien so günstige Bedingungen zu seinem Leben, daß es nicht allein sehr zahlreich auftritt, sondern auch eine ungewöhnliche Größe erlangt. Während des Sommers äst es sich fast ausschließlich von den Zwiebeln der Lilien, während des Winters von den abgefallenen Eicheln und Zirbelnüssen, tritt daher auch Wanderungen an, in der Absicht, die gereifte Ernte einzuheimsen. Im Sommer nimmt es mit Vorliebe in den schattigsten Thälern Stand, und zumal die alten Keuler, welche abgesondert vom Rudel leben, verlassen solche Wohnsitze jetzt selten oder nicht. Infolge der Sicherheit, deren die Wildschweine hier, in den menschenarmen Gegenden, bis zum Wachwerden ihres Hauptfeindes, des Tigers, sich erfreuen, treiben sie sich keineswegs ausschließlich zur Nachtzeit, sondern auch bei Tage umher, erscheinen schon um die Mittagszeit an den Pfützen, welche sich hier und da auf den Gebirgshöhen finden, oder legen sich, in Ermangelung solcher, in die Quellen der Bäche, um sich zu suhlen, verweilen behaglich im Bade, bis gegen drei Uhr nachmittags die lästigen Mücken zu schwärmen beginnen, erheben sich sodann, scheuern sich, und zwar an Eichenstämmen lieber als an solchen der harzigen Nadelbäume, und ziehen hierauf zur Mast. Mit Beginn der Reife der Eicheln und Zirbelnüsse treten sie Wanderungen an, um zu erkunden, wo diese Früchte am besten gediehen sind, nehmen an geeigneten Orten Stand auf schmalen Gebirgsverflachungen, welche zwischen je zwei kleinen Seitenthälern zum Hauptthale vortreten, graben sich hier gemeinschaftlich in einen Kessel ein und verlassen diesen nicht eher, als bis sie durch irgendwelche Störung vertrieben werden.
In seinen Eigenschaften ähnelt das Hausschwein in vieler Hinsicht noch seinem Urahn, und man kann deshalb leicht von jenem auf dieses schließen. Selbstverständlich ist das Wildschwein ein viel vollendeteres und muthigeres Geschöpf als unser durch die Knechtschaft verdorbenes Stallthier. Alle Bewegungen des Wildschweins sind, wenn auch etwas plump und ungeschickt, so doch rasch und ungestüm. Der Lauf ist ziemlich schnell und richtet sich am liebsten geradeaus; namentlich der Keuler liebt es nicht, scharfe Wendungen auszuführen. In erstaunenerregender Weise durchbrechen Wildschweine Dickichte; ihr spitziger Kopf und der schmale Leib scheinen ganz dazu zu passen, mit Gewalt durch Dickungen, welche anderen Geschöpfen geradezu undurchdringlich sind, einen Weg zu bahnen. Das schmale Gebreche schiebt sich hinein, der Leib muß dann folgen, und so gehts weiter mit Blitzesschnelle. In den Rohrwaldungen der egyptischen Strandseen oder in den Zuckerrohrfeldern Mittelegyptens habe ich Wildschweine oft dahin wandeln sehen. Sie trollen mit derselben Geschwindigkeit durch die dichtesten Stellen, als wenn sie auf geebnetem Pfade dahin gingen. Auch im Sumpfe und im See selbst verstehen sie vortrefflich sich zu bewegen. Sie schwimmen ausgezeichnet, selbst über sehr breite Wasserflächen, setzen unter Umständen sogar von einer Insel im Meere zur anderen über. Bei dem Schwimmen kommt ihnen ihr Bau ebenfalls gut zu statten. Der fischähnliche, fettreiche Leib hält sich ohne weitere Anstrengung im Wasser schwebend, und so genügt eine geringe Bewegung der immerhin noch hinlänglich breiten Schalen, um ihn rasch vorwärts zu treiben. Man hat beobachtet, daß Schweine eine Strecke von sechs bis sieben Kilometer mit Leichtigkeit durchschwimmen.
Alle Wildschweine sind vorsichtig und aufmerksam, obwohl nicht gerade scheu, weil sie auf ihre eigene Kraft und ihre furchtbaren Waffen vertrauen können. Sie vernehmen und wittern sehr scharf, äugen aber schlecht. Keine andere Wildart kommt auf den anstehenden Jäger, wenn er sich ruhig verhält und unter dem Winde steht, so weit heran wie das Wildschwein; und keinem anderen größeren Thiere kann man sich, wenn es ruht und man zu schleichen versteht, so weit nähern. In Egypten ist es mehrere Male vorgekommen, daß ich beim Beschleichen von Sumpf- und Wasservögeln bis auf fünf Schritte an Wildschweine kam, welche dann erst, freilich zu ihrer Rettung zu spät, meine Ankunft zu bemerken schienen. Der Geschmack kann nicht schlecht genannt werden, denn wenn das Schwein viel Fraß hat, gibt es immer dem besten den Vorzug; auch Empfindung ist ihm nicht abzusprechen. Sein geistiges Wesen ist nicht so stumpf, als man gewöhnlich annimmt. So lange nicht sein rasender Zorn entfacht wurde, und dieser es seine gewöhnliche Vorsicht vergessen ließ, benimmt es sich weder unklug noch ungeschickt, vielmehr regelmäßig den Umständen entsprechend, bekundet nicht selten auch bemerkenswerthe List und zuweilen berechnenden Verstand. Sein Wesen ist ein absonderliches Gemisch von behäbiger Ruhe, harmloser Gutmüthigkeit und ungewöhnlicher Reizbarkeit. Unerzürnt thut selbst das stärkste Schwein keinem Menschen etwas zu Leide; nur dem Hunde widersetzt es sich stets und versucht, ihm gefährlich zu werden. Aber alle Sauen und namentlich die groben Schweine vertragen keine Beleidigung, nicht einmal eine Neckerei. Wenn der Mensch seinen Gang ruhig fortsetzt, bekümmert sich das Wildschwein nicht um ihn oder entfernt sich flüchtig; reizt man das Thier aber, so nimmt es den bewaffneten Mann ohne weiteres an und geht, in Wuth gerathen, gleichsam blind auf seinen Gegner los. Dietrich aus dem Winckell erzählt, daß er als unerfahrener Jüngling einem Schweine, welches sonst ein ganz gemüthlicher Gesell war, im Vorbeireiten mit seiner Peitsche eins versetzte, dann aber reiten mußte, was er konnte, um ihm zu entkommen. »Vor verwundeten Sauen«, sagt er, »hat selbst der Jäger Ursache, auf seiner Hut zu sein. Unglaublich schnell kommt das Schwein gefahren, wenn es einen Menschen oder ein Thier annimmt. Mit seinen Gewehren versetzt es kräftige, gefährliche Schläge; aber selten hält es sich auf, und noch weniger kehrt es sich wieder um. Verliert man in solchen Fällen die Besinnung nicht, läßt man das Schwein ganz nahe heran und springt dann schnell hinter einen Baum oder, wenn dies nicht möglich ist, nur auf die Seite: so fährt es, weil es nicht gewandt ist, vorbei. Wer aber zu diesen Rettungsmitteln weder Zeit noch Gelegenheit hat, dem bleibt noch das auf die Erde werfen übrig; denn der kämpfende Keuler kann immer nur nach oben, nie aber nach unten schlagen.« Die Bache wird nicht so leicht zornig wie das Schwein, gibt diesem aber an Muth wenig nach. Zwar kann sie mit ihren Haken durch Schläge keine argen Verwundungen beibringen, wird aber, wenn sie einen Menschen annimmt, deshalb noch gefährlicher als das Schwein, weil sie bei dem Gegenstände ihrer Wuth stehen bleibt, mit den Läufen auf ihm herum tritt und beißend ganze Stücke Fleisch losreißt. Hier also führt das Niederwerfen nicht zur Rettung, und dem Jäger bleibt, wenn er kein Schießgewehr hat, nur noch sein Hirschfänger übrig, auf welchen er, insofern er Kraft und Geschicklichkeit genug besitzt, die Bache auflaufen lassen muß. Selbst schwächere Sauen, ja sogar jährige Frischlinge, nehmen, wenn sie sehr in die Enge getrieben werden, zuweilen den Menschen an, ohne ihm jedoch Schaden zufügen zu können. Bei Gefahr leisten sich die Wildschweine gegenseitig Hülfe, und namentlich junge werden mit unerschütterlichem Muthe von den älteren vertheidigt. Bachen, welche noch kleine Frischlinge führen, gehören zu den gefährlichsten aller Thiere und lassen in der Verfolgung eines Kindesräubers nicht ab, bis dieser überwunden ist oder ihnen wenigstens die Jungen zurückgegeben hat.
Wenn man die Gewehre eines hauenden oder groben Schweins betrachtet, begreift man, daß diese Waffen furchtbar wirken können. Bei allen Schweinen zeichnen sich die Keuler durch ihre Gewehre vor den Bachen aus. Schon im zweiten Jahre erheben sich die Hauer aus dem Ober- und Unterkiefer, immer nach oben strebend. Beim dreijährigen Keuler verlängert sich das Untergewehr um vieles mehr als das obere, wächst schräg aufwärts und krümmt sich nach oben. Das obere krümmt sich gleich von dem Kiefer ab nach auswärts, ist aber kaum halb so lang als jenes. Beide Hauzähne sind weiß und glänzend, auch äußerst scharf und spitzig, und werden mit zunehmendem Alter durch beständiges Gegeneinanderreiben immer schärfer und spitziger. Je älter das Schwein wird, desto stärker krümmen sich, bei immer zunehmender Länge und Stärke, beide Gewehre. Beim Hauptschweine biegt sich das untere fast über dem Gebreche zusammen; dann bleibt ihm nur das weiter nach außen und aufwärtsstehende Obergewehr zum Streiten übrig. Die Schläge, welche das Thier mit diesen scharfen Zähnen ausführt, sind im höchsten Grade gefährlich und können tödtlich verletzen. Das anrennende Schwein setzt mit viel Geschick sein Gewehr unten in die Beine oder den Leib seines Feindes ein und reißt unter raschem Auf- und Zurückwerfen des Kopfes lange Wunden, welche tief genug sind, um an den Schenkeln eines Mannes durch alle Muskellagen bis auf den Knochen zu reichen oder alle Bauchdecken zu durchschneiden und die Eingeweide zu zerreißen. Letzteres geschieht gewöhnlich den angreifenden Hunden. Starke Keuler springen auch an größeren Thieren in die Höhe und versetzen diesen furchtbare Schläge, reißen beispielsweise Pferden Brust und Bauch auf. Sehr alte Hauptschweine sind wegen ihrer stark nach innen gekrümmten unteren Gewehre weniger gefährlich als sechs- und siebenjährige.
Die Stimme des Wildschweins ähnelt der unseres zahmen Schweines in jeder Hinsicht. Bei ruhigem Gange vernimmt man das bekannte Grunzen, welches einen gewissen Grad von Gemächlichkeit ausdrückt; im Schmerz hört man von Frischlingen, jährigen Keulern und Bachen ein lautes Kreischen oder ›Klagen‹, wie der Jäger sagt. Das Hauptschwein dagegen gibt selbst bei den schmerzlichsten Verwundungen nicht einen Laut von sich. Seine Stimme ist tiefer als die der Bachen und artet zuweilen in grollendes Brummen aus. Dies vernahm ich namentlich, wenn Hauptschweine zum Fraße gingen und in der Nähe unserer Versteckplätze Gefahr witterten.
Gegen Ende November beginnt die Brunstzeit der Wildschweine. Sie währt etwa vier bis fünf, vielleicht auch sechs Wochen. Wenn Bachen, wie es zuweilen vorkommt, zweimal in einem Jahre brunsten und frischen, sind es wahrscheinlich solche, welche von zahmen Schweinen abstammen und in irgend einem Forste ausgesetzt wurden; eigentlich wilde brunsten nur einmal im Jahre. Sobald die Brunstzeit herannaht, nähern sich die bisher einsiedlerisch lebenden Hauptschweine dem Rudel, vertreiben die schwächeren Keuler und laufen mit den Bachen umher, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Unter Gleichstarken kommt es zu heftigen und langdauernden Kämpfen. Die Schläge, welche sich die wackeren Streiter beibringen, sind aber selten tödtlich, weil sie fast alle auf die Gewehre und die undurchdringlichen Schilder fallen. Bei Kämpen von gleicher Stärke bleibt natürlich der Erfolg des Streites unentschieden, und sie dulden sich dann zuletzt neben einander, obgleich selbstverständlich mit dem größten Widerstreben. »Verlassen und traurig«, sagt Dietrich aus dem Winckell, »müssen während der Brunstzeit die vertriebenen, zu geringzähligen, nur aus ihres Gleichen bestehenden Rudel vereinigt, miteinander umherschweifen und wohl oder übel ihre Liebesbegierde unterdrücken, bis jene Alleinherrscher gesättigt und entnervt, ihnen freiwillig das Feld räumen und in die Einsamkeit zurückziehen. Doch bleibt auch diesem oder jenem rüstigen unter der männlichen Jugend noch ein Blümchen zu pflücken übrig, welches ihn für das vorher entbehrte schadlos hält.« Sonderbar sind die Liebkosungen, welche die brünstigen Keuler und Schweine der Bache zukommen lassen: sie stoßen diese nämlich unaufhörlich an alle Theile des Leibes mit ihrem Gebreche und oft in recht unzarter Weise. Allein die keineswegs spröden Schönen verstehen den Werth solcher Liebkosungen zu schätzen und nehmen sie günstig auf. Selbst während des Beschlages, welcher höchst schwerfällig vor sich geht, erhält, wie unser eben genannter Gewährsmann sagt, die Geliebte noch absonderliche Beweise der Zärtlichkeit; denn vor lauter Entzücken beißt sie der Liebhaber so kräftig in den Hals, daß entweder ein großer Theil von Gefühllosigkeit oder ein Uebermaß von wonnevollen Gefühlen auf ihrer Seite dazu gehört, so etwas ohne irgend ein Zeichen des Unbehagens zu ertragen. Achtzehn bis zwanzig Wochen nach der Brunst setzt die schwächere Bache vier bis sechs, die stärkere elf bis zwölf Frischlinge. Sie hat sich vorher im einsamen Dickichte ein mit Moos, Nadeln oder Laub ausgefüttertes Lager bereitet und hält die von ihr zärtlich geliebten Kleinen während der ersten vierzehn Tage sorgsam versteckt in diesem Lager, verläßt sie auch nur selten und bloß auf kurze Zeit, um sich Fraß zu suchen. Dann führt sie das Rudel aus, bricht ihm vor, und die netten, munteren Thierchen wissen schon recht hübsch ihr Gebreche anzuwenden. Oft finden sich mehrere Bachen mit ihren Frischlingen zusammen und führen die junge Gesellschaft gemeinsam an. Dann kommt es auch vor, daß, wenn eine Bache zufällig ihr Leben verliert, die anderen die Führung der Verwaisten annehmen.
Ein Rudel dieser jungen, schön gezeichneten Thiere bietet einen höchst erfreulichen Anblick; denn die noch kleinen Frischlinge sind allerliebste Geschöpfe. Ihr Kleid steht ihnen vortrefflich, und die Munterkeit und Beweglichkeit der Jugend bilden einen vollendeten Gegensatz zu der Trägheit und Langweiligkeit des Alters. Ernsthaft gehen die Bachen ihren Frischlingen voran, und diese laufen quiekend und grunzend hinter ihnen drein, ohne Unterlaß sich zerstreuend und wieder sammelnd, hier ein wenig verweilend und brechend, einen plumpen Scherz versuchend, und dann wieder sich sammelnd und nach der Alten hindrängend, sie umlagernd und zum Stillstehen zwingend, das Gesäuge fordernd und hierauf wieder lustig weiter trollend: so geht es während der ganzen Nacht fort; ja, selbst bei Tage kann es die unruhige Gesellschaft im Kessel auch kaum aushalten und dreht und bewegt sich dort ohne Ende. »Nichts«, sagt Winckell, »übersteigt den Muth und die Unerschrockenheit, womit eine rechte oder eine Pflegemutter ihre Familie im Nothfalle vertheidigt. Beim ersten Ausbruche des klagenden Lautes eines Frischlings eilt die Bache pfeilschnell heran. Keine Gefahr scheuend, geht sie blind auf jeden Feind los, und wäre es auch ein Mensch, der ihr ein Kind rauben wollte. Ein Mann, welcher einst beim Spazierenreiten ganz junge Frischlinge fand, wollte einen davon mit nach Hause nehmen. Kaum begann dieser, den er aufheben und aufs Pferd bringen wollte, zu klagen, als die Bache heranstürzte, ihn, so sehr er sich auch zu entfernen eilte, unaufhörlich verfolgte, wüthend am Pferde in die Höhe sprang und mit offenem Gebreche ihm nach den Füßen fuhr. Endlich warf er den Frischling herunter. Behutsam nahm die zärtliche Alte ihr gerettetes Kind ins Gebreche und trug es zur übrigen Familie zurück.«
Mit achtzehn bis neunzehn Monaten ist das Wildschwein fortpflanzungsfähig, mit fünf bis sechs Jahren vollständig ausgewachsen; das Lebensalter, welches es erreichen kann, schätzt man auf zwanzig bis dreißig Jahre. Ein zahmes Schwein wird niemals so alt; denn der Mangel an Freiheit und an zusagendem Fraße verkürzen ihm sein Leben. Die Wildschweine sind wohl nur wenigen Krankheiten ausgesetzt. Bloß außerordentlich strenge Kälte mit tiefem Schnee, welcher ihnen das Brechen und das Auffinden der Nahrung unmöglich macht, oder, wenn er eine Rinde hat, auch die Haut an den Läufen verletzt, werden Ursache, daß in nahrungsarmen Gegenden manchmal viele von ihnen fallen. Wolf und Luchs, auch wohl der schlaue Fuchs, welcher wenigstens einen kleinen Frischling wegzufangen wagt, sind bei uns zu Lande die Hauptfeinde des Wildschweins; in den südlicheren Gegenden stellen die größeren Katzen, zumal der Tiger, mit Eifer dem fetten Wildpret nach. Der größte Feind des Thieres ist aber wiederum der Mensch; denn die Jagd des Wildschweines hat seit allen Zeiten als ein ritterliches, hoch geachtetes Vergnügen gegolten, und jeder echte Jäger setzt noch heutzutage gern sein Leben ein, wenn es gilt, einem Wildschweine in der uralten Jagdweise gegenüberzutreten. Gegenwärtig ist die Jagd bei uns freilich mehr zu einer Spielerei geworden, nicht aber mehr ein Kampf mit den wüthenden und gefährlichen Keulern oder Ebern, und von ritterlichem Streiten zwischen den Jägern und ihrem Wild bei der jetzigen Jagdweise keine Rede mehr. Zu alten Zeiten war es freilich anders, zumal damals, als noch die Armbrust und die »Schweinsfeder« oder das »Fangeisen« die gebräuchlichen Jagdwaffen waren. Die Schweinsfeder, ein Spieß mit breiter, zweischneidiger Stahlspitze und 8 Centim. langen Haken am Ende des 30 Centim. langen Eisens, wurde benutzt, um das zornige Wildschwein beim Anrennen auf den Jäger abzufangen. Man stellte sich dem Schweine entgegen, indem man mit der rechten Hand das Ende des hölzernen Stieles fest an den Leib andrückte, mit der linken aber dem Eisen die Richtung zu geben versuchte. Sobald nun das blindwüthende Thier heranschoß, richtete man das Eisen so, daß die Spitze ihm auf den Unterhals oberhalb des Brustbeins zu stehen kam, und der Stoß des anrennenden Schweines war dann auch regelmäßig so heftig, daß die ganze Spitze bis zu den Haken, welche das weitere Eindringen verhinderten, dem Wildschweine in die Brust fuhr, bei richtigem Gebrauche der Waffe ihm das Herz durchbohrend. Schwächere Sauen ließ man nur auf den Hirschfänger anlaufen, indem man diesen, das Heft mit der rechten Hand gefaßt, über dem rechten, etwas gebogenen Knie ansetzte und den Körper auf den linken, hinterwärts angesetzten Fuß stützte. Um die Sauen zu reizen, rief man ihnen die Worte » Huß Sau!« zu, worauf sie blind auf den mörderischen Stahl einrannten.
In südlicheren Ländern wird solche Jagd noch vielfach ausgeübt, wenn auch mit einigen Abänderungen. Die Beduinen der Sahara und die indischen Jäger betreiben ihre Jagd zu Pferde und stoßen dem anrennenden Schweine von oben herab scharfe Lanzen durch den Leib. Nach falschen Stößen suchen sie, dank ihrer Geschicklichkeit im Reiten, vor dem wüthend auf sie eindringenden Feinde das Weite, kehren aber augenblicklich um, verfolgen das Wild ihrerseits wieder und bringen ihm anderweitige Stöße bei, bis es erliegt. In Egypten zogen wir mit Büchse und Hirschfänger bewaffnet zur Wildschweinjagd aus. In den Zuckerrohrfeldern war nicht an Jagd zu denken; denn keine Macht der Erde hätte, ohne das ganze Feld zu zerstören, die hier so wohl geborgenen Wildschweine austreiben mögen. Wir suchten sie daher an günstigeren Orten auf und konnten, bei der Häufigkeit der Thiere, einer lohnenden Jagd gewiß sein. Ich selbst erlegte an einem Nachmittage ohne Treiber auf einfachen Birschgängen durch das Röhricht fünf Sauen, darunter zwei grobe Schweine, und ein anderes Mal bei einem Treiben über eine mit Riedgras bedeckte Ebene im Delta deren drei. Da hieß es freilich richtig zielen; denn die verwundeten nahmen uns sofort mit rasender Wuth an, und sie waren Schweine, stark genug, um uns im schlimmen Falle die Jagd hart büßen zu lassen. Gleichwohl kam es niemals zum Gebrauche des Hirschfängers. Die Schweine standen gewöhnlich so nahe vor uns auf, daß ein Fehlschuß kaum möglich war, und nur bei einem einzigen Hauptschweine, welches einer meiner Gefährten leicht verwundet hatte, würde die Sache bedenklich geworden sein, wenn ich dem Thiere nicht noch hart vor dem Anrennen auf meinen Gefährten eine Kugel auf die rechte Stelle gesetzt hätte.
Gegen die Hunde vertheidigt sich das Wildschwein mit nachhaltiger Wuth. Man brauchte in früheren Zeiten zur Saujagd die sogenannten Saufinder und Hetzhunde, muthige, starke und flüchtige Thiere, welche in halbwildem Zustande gehalten und nur auf Schwarzwild gebraucht wurden. Die Saufinder mußten das Wild suchen, die Hetzhunde deckten es. Ehe es zum Packen kam, d.h. ehe die Hunde sich am Gehör ihrer Feinde festbissen, wurde manchem Hunde der Leib aufgerissen oder er wenigstens schwer geschlagen. Auf beiden Seiten wehrte man sich mit gleicher Tapferkeit, und wenn acht bis neun der starken und wehrhaften Hunde über das Schwein herfielen, mußte es sich ergeben. Das von den Hunden angegriffene Schwein suchte sich klugerweise den Rücken zu decken und setzte sich zu diesem Zwecke gewöhnlich an einen Baumstamm oder ins Gebüsch, nach vorn hin wüthend um sich hauend. Die ersten Hunde waren am schlimmsten daran. Hatte aber einmal einer dieser trefflichen Jagdgehülfen sich am Schweine festgebissen, so war er nicht wieder loszubringen: er hätte sich eher Hunderte von Schritten weit schleifen lassen. So wurde das Wildschwein festgehalten, bis der Jäger herbeikam, um es abzufangen. Die Hunde wurden, wie Kobell bemerkt, beim Verfolgen der Sau oft so wüthend, daß sich ein reitender Jäger in Acht nehmen mußte, zwischen sie und die Sau zu kommen, weil sie zuweilen das Pferd packten, niederrissen und Roß und Reiter fürchterlich bissen.
Das Fleisch des Schwarzwildes wird mit Recht sehr geschätzt, weil es neben dem Geschmacke des Schweinefleisches den des echten Wildprets hat. Kopf und Keulen gelten für besondere Leckerbissen. Auch die Würste, welche man aus Wildschweinfleisch bereitet, sind vortrefflich. An den egyptischen Seen, wo die Schweine in gewaltigen Rudeln hausen, beschäftigten sich manchmal europäische Fleischer monatelang mit der Jagd des von den Mohammedanern mißachteten, »unreinen« Wildes, und bereiteten aus dem Fleische der erlegten Thiere bloß Würste, welche sie dann mit sehr gutem Gewinn verkauften. Während der Brunstzeit ist das Fleisch des Keulers ungenießbar. Die Haut wird ebenfalls verwendet, und die Borsten sind sehr gesucht. Aber so groß auch der Nutzen sein mag: den Schaden, welchen das Thier anrichtet, kann er niemals aufwiegen.
Nicht allein unser Wildschwein, sondern auch mehrere seiner indischen, malaiischen und hinterasiatischen Verwandten scheinen bereits seit uralter Zeit in den Hausstand übergegangen zu sein. Nach Ansicht Juliens, eines ausgezeichneten Kenners von China, züchtete man bereits um das Jahr 4900 vor unserer Zeitrechnung im Himmlischen Reiche Hausschweine; nach Rütimeyers Untersuchungen der Pfahlbauten gab es in der Schweiz schon zwei verschiedene Rassen des nutzbaren Hausthieres. »Das Schwein«, so schreibt mir Dümichen, »obgleich zu den typhonischen (der bösen Gottheit Typhon geweiheten) Thieren gehörig, wurde sicher von den alten Egyptern als Hausthier gehalten. Die Inschriften sprechen von ihm, und herdenweise wie einzeln wird es abgebildet. Doch scheint man es nur gehalten zu haben zum Zwecke des Opferns an einzelnen Festen des Jahres.« In der Bibel wird seiner oft gedacht; die Odyssee spricht von ihm wie von einem allgemeinen bekannten Pfleglinge des Menschen.
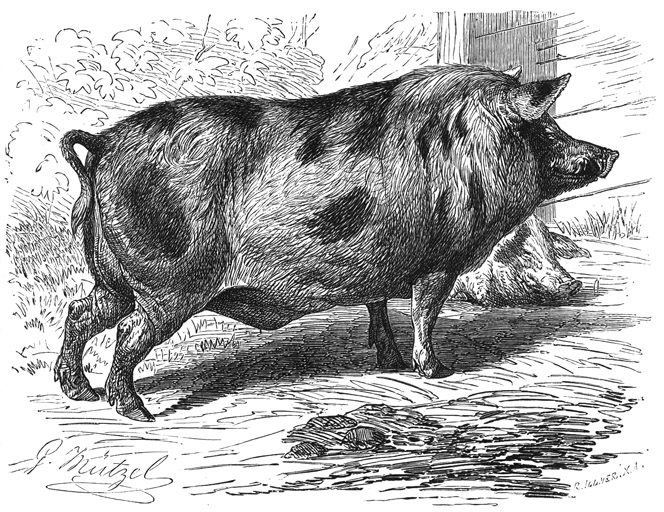
Berkshireschwein. 1/16 natürl. Größe.
Seit jenen Zeiten sind unzählige Rassen entstanden und vergangen, und noch gegenwärtig entstehen neue und verschwinden ältere, je nach Bedürfnis oder Laune und Zufall. Fitzinger wie Nathusius nehmen an, daß alle jetzt lebenden Rassen auf zwei verschiedene Formen oder Arten zurückgeführt werden können: auf unser Wildschwein und auf eine südasiatische Art (Sus cristatus) nämlich; dies schließt jedoch nicht aus, daß auch andere indisch-malaiisch-chinesische Arten an der Erzeugung betheiligt sein können. So groß die Verschiedenheit unter diesen Rassen sein mag, sie wie das Entstehen und Vergehen der unter Einwirkung des Menschen erzeugten Formen erklären sich durch selbständig oder gezwungen geübte Zuchtwahl wie durch die wechselreichen Verhältnisse, unter denen die Hausschweine leben. Schweine, welche wühlen können, behalten, laut Nathusius, ihren gestreckten Rüssel auch als gefangene Thiere, bekommen aber einen kürzeren, wenn sie von Jugend an im Stalle gehalten werden. Dieses eine Beispiel zeigt, wie leicht es möglich ist, durch eine bestimmte Behandlungsweise wichtige Merkmale eines Thieres abzuändern, und es bedarf deshalb nur noch des Hinweises auf die Bedeutung und Wirkung der mit Sachverständnis ausgeführten Kreuzungen, um es erklärlich erscheinen zu lassen, daß wir gegenwärtig Hausschweine besitzen, welche von ihrer Stammart wesentlich sich unterscheiden. Künstliche Erzeugnisse des Menschen sind sie alle, die gegenwärtig beliebten oder angestaunten Rassen: das stämmige Berkshire- wie das fettleibige Harrisson- oder das quappliche Zwergschwein; ein Kunsterzeugnis auch ist das Maskenschwein, in welchem die Laune japanesischer Züchter ihren Ausdruck gefunden hat. Wir überlassen es anderen, sie und alle übrigen Rassen zu schildern, und werfen noch flüchtig einen Blick auf Lebensweise und Eigenschaften des Thieres.
Heutzutage ist das Hausschwein über den größten Theil der Erde verbreitet. So weit nach Norden hin Landbau betrieben wird, lebt es als Hausthier, in den südlichen Ländern mehr im Freien. Da eigentlich nur sumpfige Gegenden ihm zusagen, verändert es sich, wenn man es ins Gebirge bringt. Je höher es hinaufsteigt, um so mehr nimmt es das Gepräge des Bergthieres an.
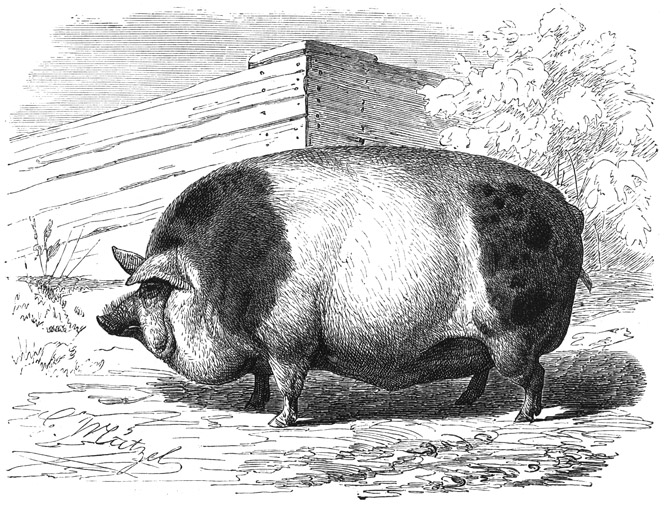
Harrissonschwein. 1/18 natürl. Größe.
Der Leib wird kleiner und gedrungener, der Kopf kürzer und weniger spitzig, die Stirne breiter; der Hals verkürzt sich und nimmt an Dicke zu, der Hintertheil wird mehr abgerundet, und die Läufe kräftigen sich. Damit geht Hand in Hand, daß solche Bergschweine wenig Fett ansetzen, dafür aber zarteres und feineres Fleisch bekommen, und daß sie an Fruchtbarkeit verlieren. Klima, Bodenverhältnis, Zucht und Kreuzung haben nun auch einen gewissen Einfluß auf die Färbung, und daher kommt es, daß in gewissen Gegenden die, in anderen jene Färbung vorherrscht. So sieht man in Spanien fast nur schwarze Schweine, während solche bekanntlich bei uns im Norden selten sind.
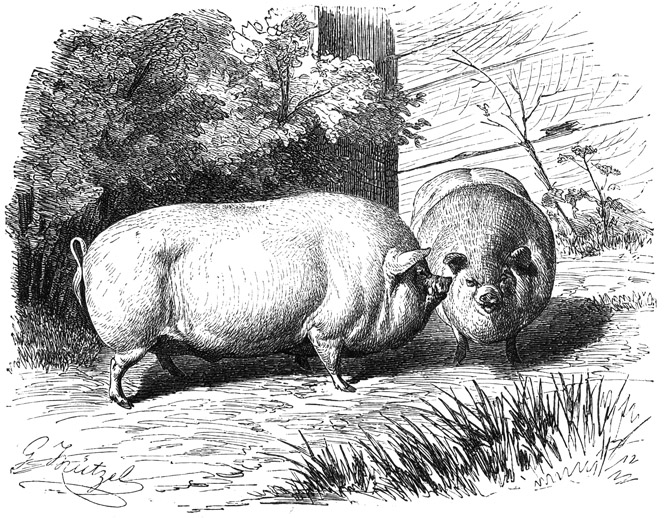
Zwergschwein, 1/12 natürl. Größe.
Man hält und mästet die Schweine entweder in den Ställen, oder treibt sie während eines großen Theils des Jahres im Freien umher. Die eingepferchten Thiere werden größer und fetter, sind aber schwächer und mehr Krankheiten ausgesetzt als diejenigen, welche den größten Theil des Lebens im Freien zubringen; sie sind gewöhnlich etwas hochbeiniger und magerer, dabei aber viel kräftiger, selbständiger und muthiger als jene. Nicht bloß in Amerika betreibt man solche Waldzucht, wie man sagen könnte, sondern auch in den meisten Provinzen Rußlands, in den Donautiefländern, in Griechenland, Italien, Südfrankreich und Spanien. In Skandinavien laufen die Schweine, wenigstens während des ganzen Sommers, nach ihrem Belieben umher, jedes mit einem kleinen, dreieckigen Holzkummet um den Hals, welches ihnen das Eindringen in die umhegten Grundstücke verwehrt, sie im übrigen aber nicht hindert. Wenn man durch Norwegen reist, sieht man die Schweine mit größter Behaglichkeit und Gemächlichkeit längs der Landstraßen dahinlaufen und hier sich allerlei Abfälle aufsuchen und andere Nahrung erwerben. Im südlichen Ungarn, Kroatien, Slavonien, Bosnien, Serbien, in der Türkei und in Spanien überläßt man sie das ganze Jahr hindurch sich selbst und trägt nur insofern Sorge um sie, daß sie sich nicht verlaufen. Sie nutzen dann die Wälder aus und finden, namentlich in den Eichwaldungen, höchst geeignete Futterplätze und Mastorte. In Spanien steigen sie bis hoch in die Gebirge hinauf: in der Sierra Nevada z. B. bis zu 2500 Meter über dem Meere, und nutzen dort Oertlichkeiten aus, auf denen andere Thiere nicht viel finden würden. Das freie Leben hat alle ihre leiblichen und geistigen Fähigkeiten sehr entwickelt. Sie laufen gewandt, klettern gut und sorgen selbst für ihre Sicherheit. Wie muthig sie sein können, habe ich bereits bei Beschreibung des Wolfes (Bd. I, S. 532) erwähnt. Bei der sogenannten halbwilden Zucht läßt man die Schweine während des Sommers im Freien, bringt sie aber im Winter in die Ställe.
Mit Unrecht hat man geglaubt, daß dem Schweine zu seinem Wohlbefinden Koth und Schmutz unentbehrlich sei. Die neueren Erfahrungen haben erwiesen, daß auch dieses Hausthier bei reinlicher Haltung weit besser gedeiht, als wenn es beständig im Schmutze liegt; deshalb pferchen jetzt die gebildeten Thierzüchter ihre Schweine nicht mehr in die greulichen Gefängnisse ein, welche man Schweineställe nennt, weisen ihnen vielmehr weite, luftige Räume an, welche leicht gereinigt werden können und erziehen hier viel gesündere und kräftigere Hausschweine als in den kleinen unreinlichen Koben. Am besten ist es, wenn der Boden des Stalles mit großen Steinplatten ausgelegt wird.
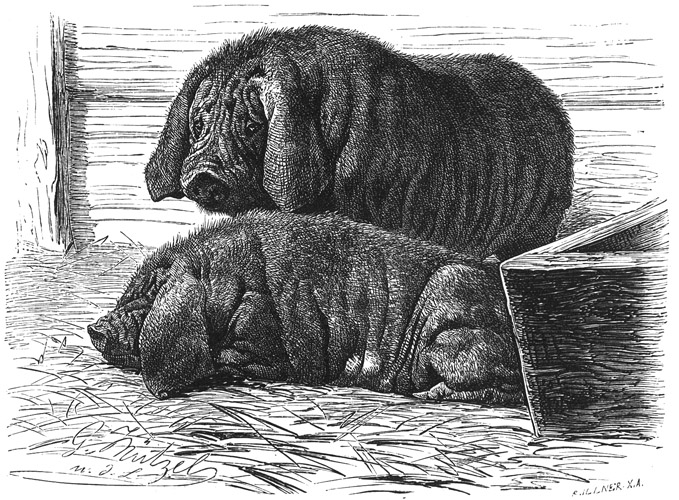
Maskenschwein, 1/16 natürl. Größe.
Das Hausschwein ist gefräßig, widerspenstig, ungeschickt und zeigt wenig Anhänglichkeit an den Menschen. Doch gibt es Ausnahmen. Hausschweine, welche von Jugend auf mehr in der Familie des Menschen als für sich allein gelebt haben, wie dies auf dem Lande nicht selten geschieht, üben ihre geistigen Kräfte, und sind dann weit verständiger als andere ihrer Art. Ein Förster erzählte mir, daß er eine Zeitlang ein kleines, sogenanntes chinesisches Schweinchen besessen habe, welches ihm wie ein Hündchen auf dem Fuße nachlief, auf den Namen hörte, sogleich herbeikam, wenn es gerufen wurde, auf der Treppe mit ihm emporstieg, sich im Zimmer ganz gut betrug, Befehle und mancherlei Kunststücke ausführte. Es war gewöhnt worden, im Walde Morcheln zu suchen, und stand diesem Geschäfte mit großem Eifer vor. Als Ludwig XI. krank war, wurden von seinen Hofleuten alle nur erdenklichen Mittel hervorgesucht, um die trüben Gedanken, welche den König beherrschten, zu zerstreuen. Die meisten Versuche waren fruchtlos, einer aber brachte den trübsinnigen König doch zum Lachen. Ein erfindsamer Kopf verfiel darauf, Ferkel nach dem Tone eines Dudelsackes zum Tanzen und Springen abzurichten. Er bekleidete die Thiere vom Kopfe bis zum Scheitel und ließ sie einherstolziren in schön ausgeputzten Leibröcken, Beinkleidern mit Hut, Schärpe und Degen, kurz mit allen Anhängseln, welche die Stellung eines vornehmen Mannes erfordert. Sie waren sehr gut abgerichtet, sprangen und tanzten nach Befehl, verbeugten sich artig und betrugen sich musterhaft folgsam. Nur eins war ihnen unmöglich: der aufrechte Gang nämlich. So wie sie sich auf zwei Pfoten aufgerichtet hatten, fielen sie sofort unter Grunzen nieder und die ganze Gesellschaft schrie dann ihr: »Honn, honn, honn« auf eine so närrische Weise, daß der König des Lachens sich nicht enthalten konnte.
Andere abgerichtete Schweine hat man auf der Messe von St. Germain und auf dem Theater Astley zu Paris gesehen. In London stellte man ein gelehrtes Schwein aus. Man zeigte es in einem Saale, in welchem viele Menschen sich versammelten. Zwei Alphabete großer Buchstaben auf Karten lagen auf dem Boden. Einer aus der Gesellschaft wurde gebeten, ein Wort zu sagen. Der Herr und Besitzer des Schweines wiederholte es seinem Zöglinge, und dieser hob sofort die zu dem Worte nöthigen Buchstaben mit den Zähnen auf und legte sie in die gehörige Ordnung. Auch die Zeit verstand das Thier anzugeben, wenn man ihm eine Uhr vorhielt etc. Ein anderer Engländer hatte ein Schwein zur Jagd abgerichtet. Slud, wie das Thier genannt wurde, war ein warmer Freund von der Jagd und gesellte sich augenblicklich zu jedem Jäger. Er eignete sich für alle Arten der Jagd, mit Ausnahme der auf Hasen, welche er nicht zu beachten schien. Obgleich er sich mit den Hunden gut vertrug, waren diese doch so ärgerlich über solchen Jagdgenossen, daß sie ihre Dienste zu thun verweigerten, wenn das Schwein irgend ein Wild vor ihnen aufgespürt hatte, und schließlich konnte man die Rüden nicht mehr mitnehmen, sondern mußte Slud allein gebrauchen. Seine Nase war so fein, daß er einen Vogel schon in einer Entfernung von vierzig Schritten wahrnahm. Wenn derselbe sich erhob und wegflog, ging er gewöhnlich zu dem Platze, wo jener gesessen hatte, und wühlte dort die Erde auf, um den Jägern diesen Ort gehörig anzuzeigen. Lief aber der Vogel weg, ohne sich zu erheben, so folgte ihm Slud langsam nach und stellte ihn, ganz nach Art eines guten Vorstehhundes. Man gebrauchte Slud mehrere Jahre, mußte ihn aber zuletzt tödten, weil er die Schafe nicht leiden konnte und unter den Herden Schrecken verursachte. Andere Schweine hat man abgerichtet, einen Wagen zu ziehen. Ein Bauer in der Nähe der Marktstadt St. Alban kam oft mit seinen vier Schweinen gefahren, jagte in einem sonderbaren Galopp ein- oder zweimal um den Marktplatz herum, fütterte sein Gespann und kehrte einige Stunden später wieder nach Hause zurück. Ein anderer Bauer wettete, daß er auf seinem Schweine in einer Stunde von seinem Hause vier Meilen weit nach Norfolk reiten wollte und gewann die Wette.
Diese Geschichten beweisen, daß das Schwein der Abrichtung fähig ist, oder, was dasselbe, daß seine geistigen Fähigkeiten nicht unterschätzt werden dürfen. Hensel hat gewiß recht, wenn er sagt, daß die Fähigkeiten dieses Hausthieres aus Mangel an Beobachtung zu wenig gewürdigt werden, geht aber unzweifelhaft zu weit, wenn er den Verstand des Schweines höher als den des Pferdes schätzt. Ein von ihm mitgetheilter Beleg für seine Behauptung verdient hier wiedergegeben zu werden. »Die Bauern eines Dorfes«, so erzählt er, »hatten gemeinschaftlich einen Zuchteber, welcher bei einem unter ihnen eingestellt war. Zuweilen wandelte diesen Eber die Lust an, den Sauen im Dorfe einen Besuch abzustatten, namentlich, wenn er eine derselben längere Zeit vermißt hatte. Er begab sich dann in das betreffende Gehöft, eilte in schnellem Trabe nach den Schweineställen, blieb vor diesen stehen, hob den Kopf hoch in die Höhe, ergriff den langen keilförmigen Riegel, welcher gewöhnlich zwei Thüren zugleich auf die bekannte Weise schloß, mit den Zähnen und zog ihn stets nach der richtigen Seite hin heraus, so daß die Thüren sich öffneten, und die Sauen den Stall verlassen konnten.« Ich stimme Hensel vollkommen bei, wenn er sagt, daß man jeden Zug von Verstand bei dem in der Erziehung so vernachlässigten Hausschweine nicht hoch genug anschlagen kann, möchte aber doch an die geistigen Großthaten des Hundes und Pferdes, welche jedermann erfahren hat, erinnern, um vor einem ungerechten Urtheile über die Fähigkeiten der letztgenannten Hausthiere bewahrt zu bleiben.
Sonderbar ist die Thatsache, daß Schweine stets einen gewissen Abscheu gegen Hunde bekunden. Zahme wie wilde Schweine machen sich kein Gewissen daraus, unter Umständen Aas zu fressen, niemals aber gehen sie Hundefleisch an. »In dem bei Koburg gelegenen Saugarten«, sagt Lenz, »werden den Wildschweinen oft todte Pferde vorgeworfen, welche sie ohne Umstände gierig auffressen; wird aber ein todter Hund hingelegt, so genießen sie keinen Bissen davon. Viele ungarische Schweineherden werden ohne Hunde von den Hirten gelenkt und zerreißen jeden Hund, welcher unter sie kommt. Im Jahre 1848 hatte einer meiner Verwandten auf der dem Baron Sina gehörigen Pusta Alfó Besnyö bei Erczin einen Hund, den er los sein, aber nicht gern selbst tödten wollte. Da erbot sich der Schweinehirt, die Hinrichtung zu übernehmen, band den Hund an einem Stricke fest und führte ihn zu seiner Herde. Diese überfiel ihn sogleich mit lautem und grimmigem Grunzen, riß und biß ihn nieder, bearbeitete ihn, bis er wie eine Wurst aussah, fraß aber keinen Bissen davon. Nun wurden die Schweine weggetrieben; als sie aber nach einer Stunde wiederkamen, fielen sie nochmals mit gleicher Wuth über den Hund her, fraßen jedoch wieder nichts von ihm.« Die eben mitgetheilte Thatsache erklärt sich vielleicht am richtigsten durch die zwischen Schwein und Wolf bestehende Feindschaft, von welcher ich oben gesprochen habe. Es handelt sich in solchen Fällen wahrscheinlich um Ausübung der Rache, welche Isegrim durch allerlei Uebelthaten in dem zwar friedlichen, aber leicht erregbaren Herzen der Borstenträger heraufbeschwor.
Im allgemeinen zeigt sich das zahme Schwein als vollständiger Allesfresser. Es gibt wirklich kaum einen Nahrungsstoff, welchen dieses Thier verschmäht. Einige Pflanzen werden von ihm nicht berührt, und scharfe Gewürze können ihm den Tod bringen: im übrigen verzehrt es alles, was der Mensch genießt, und noch hundert andere Dinge mehr. Es wählt seine Nahrung ebenso gern aus dem Pflanzen-, wie aus dem Thierreiche. Auf Brach- und Stoppeläckern wird es sehr nützlich, weil es hier Mäuse, Engerlinge, Schnecken, Regenwürmer, Heuschrecken, Schmetterlingspuppen und allerlei Unkraut vertilgt, sich dabei vortrefflich mästet und auch noch den Boden aufwühlt.
Während man bei den Hausschweinen möglichst darauf hält, daß sie sich nicht bewegen, muß man den zur Zucht bestimmten Spielraum gönnen. Nothwendig ist auch, daß sie reine und warme Ställe bekommen. Die Paarung findet gewöhnlich zweimal im Jahre statt, anfangs April oder im September. Nach sechzehn bis achtzehn Wochen oder hundertundfünfzehn bis achtzehn Tagen wirft das Hausschwein vier bis sechs, zuweilen auch zwölf bis fünfzehn, und in seltenen Fällen zwanzig bis vierundzwanzig Junge. Die Mutter bekundet für diese wenig Sorgfalt, bereitet sich oft nicht einmal ein Lager vor dem Ferkeln. Nicht selten kommt es vor, daß sie, wenn ihr die zahlreiche Kinderschar lästig wird, einige von den Kleinen auffrißt, gewöhnlich dann, wenn sie dieselben vorher erdrückt hat. Manche Mutterschweine muß man bewachen und sie schon lange Zeit vor dem Werfen von thierischer Nahrung abhalten. Die Jungen guter Mütter läßt man vier Wochen saugen, ohne sich weiter um sie zu bekümmern. Dann nimmt man sie weg und füttert sie mit leichten Nahrungsstoffen groß. Das Wachsthum geht sehr rasch vor sich, und bereits mit dem achten Monate ist das Schwein fortpflanzungsfähig.
Ueber die Benutzung des geschlachteten Thieres brauche ich hier nichts zu sagen; denn jedermann weiß, daß eigentlich kein Theil des ganzen Schweines verloren geht.
An die bis jetzt erwähnten Schweine schließen sich die Stummelschwanzschweine ( Porcula) an, zwei in Nepal und auf Neuguinea lebende Arten der ersten Hauptgruppe und die kleinsten aller bekannten Schweine, über deren Lebensweise wir jedoch noch nicht unterrichtet sind; auf sie folgen, als nächste Verwandte von jenen, die Höckerschweine ( Potamochoerus), unzweifelhaft die schönsten Mitglieder der Gesammtheit, deren Merkmale in einem zwischen Auge und Nase gelegenen knochigen Höcker, dem verlängerten Gesichtstheile, mäßig langen und fein gebauten Rüssel, den großen, schmalen, scharf zugespitzten und mit einem Haarbüschel gezierten Ohren, dem mittellangen, bebuschten Schwanze und den vier Zitzen des Weibchens zu suchen sind. Das Gebiß weicht durch geringfügige Eigenthümlichkeiten, namentlich dadurch von dem der Schweine ab, daß nur sechs Backenzähne in jedem Kiefer vorhanden sind.
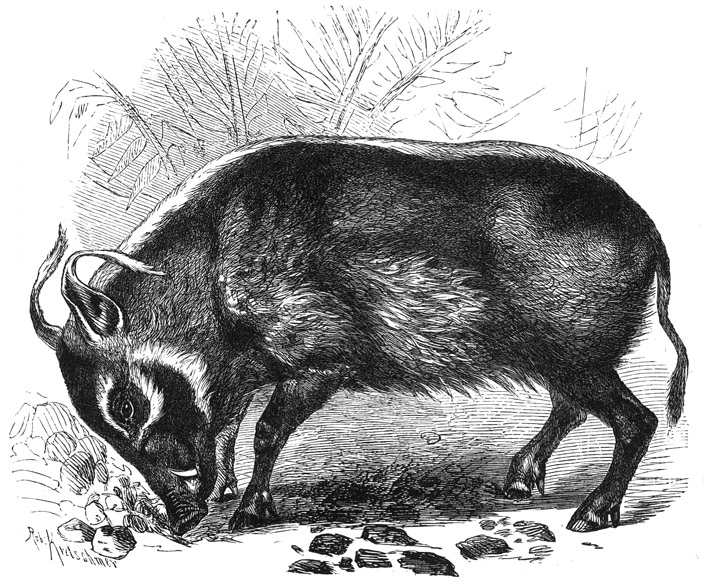
Pinselschwein ( Potamochoerus porcus). 1/8 natürl. Größe.
Schon seit Mitte des siebzehnten Jahrhunderts kennt man das Pinselschwein ( Potamochoerus porcus, Sus guineensis, porcus, penicillatus und pictus, Potamochoerus penicillatus und albifrons, Choiropotamus pictus etc.), das schönste aller Schweine. Das Thier steht dem Wildschweine an Größe merklich nach, erreicht jedoch, vollkommen ausgewachsen, einschließlich des 25 Centim. langen Schwanzes, immerhin noch 1,5 bis 1,6 Meter an Länge, bei 55 bis 60 Centim. Schulterhöhe. Die Haut ist mit kurzen und weichen, ziemlich dicht stehenden und straff anliegenden Borstenhaaren bekleidet, welche an den Kopfseiten, am Unterkiefer und Unterhalse etwas sich verlängern, auf dem Rückgrate eine kurze und schwache Mähne bilden und unter dem Auge zu einem Busche, auf der Wange zu einem starken Backenbarte, an der Spitze des übrigens fast kahlen Schwanzes endlich zu einer buschigen Quaste sich entwickeln. Ein schönes und lebhaftes, ins Gelbliche spielendes Braunroth oder ein dunkles Rothgelb, die vorherrschende Färbung, erstreckt sich über Nacken, Hinterhals, Rücken und Seiten; Stirn, Scheitel und Ohren sowie die Beine sind schwarz, die Rückenmähne, ein Saum des Ohrrandes, der Ohrpinsel, die Brauengegend, ein Strich unter dem Auge und Backenbart weiß oder gelblich weiß, Schnauze und Untertheile graulich, letztere fast weißgrau. Die Jungen, welche das gestreifte Kleid aller Wildschweine tragen, sind überaus lebhaft und zierlich gezeichnete Thierchen.
Eine zweite Art der Sippe, das Busch- oder Larvenschwein ( Potamochoerus africanus, Sus africanus, larvatus, hoiropotamus und choiropotamus, Phacochoerus larvatus und hoiropotamus, Potamochoerus larvatus und Choiropotamus africanus), Vertreter des Pinselschweines in Süd- und Mittelafrika, ist etwas größer, bis auf eine liegende Nackenmähne und einen ziemlich starken Backenbart gleichmäßig behaart und sein Bart wie die Mähne weißlich grau, das Gesicht fahlgrau, der übrige Leib röthlich graubraun gefärbt.
Ueber das Freileben des Pinselschweines, welches die Küstenländer Westafrikas, namentlich Guinea und die Gebiete des Kamarunflusses bewohnt, scheint noch jede Kunde zu fehlen, obgleich das Thier schon zu Marcgrave's Zeiten, Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, den Europäern bekannt war, auch gefangen und lebend ausgeführt wurde, da es Marcgrave nicht in Westafrika, sondern in Brasilien zu sehen bekam. Im Jahre 1852 erhielt der Thiergarten im Regentspark zu London das erste lebende Pinselschwein, und seitdem sind mehrere in Europa eingeführt worden; sie zählen jedoch heutigen Tages noch in allen Thiergärten zu den Seltenheiten. Ich habe sie öfters gesehen, zeitweilig auch beobachten können, nicht aber gefunden, daß sie in ihrem Wesen und Gebaren von unserem Wildschweine und seinen nächsten Verwandten abgewichen wären. Nach meinen Beobachtungen und den mir gewordenen Mittheilungen darf man sie als verhältnismäßig sanftmüthige Schweine bezeichnen. Zwar bekunden auch sie die Reizbarkeit ihres Geschlechtes und lassen sich selbst von ihrem Wärter, mit welchem sie sich bald auf freundschaftlichen Fuß zu stellen pflegen, keinerlei Unbill gefallen, bethätigen aber doch nicht die Bosheit und Tücke der viel kleineren Pekaris. Ein gegen die Kälte wohl geschützter Stall und ein sonniger Platz vor demselben, welcher das Wühlen nicht verhindert oder erschwert, ein reichliches Strohlager, auf oder in welchem sie, bis zur Hälfte sich eingrabend und theilweise zudeckend, ungestört der Ruhe pflegen können, sowie endlich ein in gebührender Weise beschickter Freßtrog versetzt sie früher oder später gewiß in jene behäbige Stimmung, welche gut gepflegte Schweine in ersichtlicher Weise auszudrücken wissen. Gibt man sich, nach Erfüllung solcher Bedürfnisse, viel mit ihnen ab, so gewinnt man bald ihre Zuneigung und kann sie ebenso leicht wie jung aufgezogene Wild-, ja fast wie Hausschweine behandeln. Ihr Blick hat nichts bedrohliches, vielmehr etwas entschieden freundliches, und ihr Gebaren straft solchen Eindruck nicht Lügen. Unserem Klima widerstehen sie, wie alle Wildschweine, verhältnismäßig leicht, halten daher auch, falls man sie gegen strengere Winterkälte schützt, recht gut aus und würden zu großen Hoffnungen berechtigen, wollten sie ihre Jungen besser pflegen, als diejenigen Mütter, welche in Gefangenschaft frischten, bisher gethan haben. Ein männliches und weibliches Pinselschwein des Londoner Thiergartens paarten sich ohne Umstände, und das Weibchen brachte vier Jahre nach einander je drei bis vier Junge zur Welt, fraß aber dieselben, bis auf einen Wurf, regelmäßig auf. Dies geschah keineswegs immer in den ersten Tagen nach der Geburt, wie Hausschweine bekanntlich nicht selten zu thun pflegen, sondern auch in späterer Zeit, so daß die kleinen niedlichen Frischlinge im Laufe der ersten Wochen ihres Lebens nach und nach verschwanden. Die glücklich groß gewordenen Ferkel waren, ebenso wie die in anderen Thiergärten lebenden Pinselschweine, weiblichen Geschlechts, und so endete die Zucht der Thiere, als der Eber jenes Paares starb.
Auf Celebes, Sulla-Mangoli und Buru lebt ein sehr eigenthümliches Schwein. Es ist viel schlanker und hochbeiniger als alle übrigen, und durch seinen kräftigen, kurzen, schmalen Rüssel, die kleinen wimperlosen Augen, die kleinen, schmalen und spitzigen Ohren, den ziemlich kurzen, mit einer Quaste verzierten Schwanz und das dünne Haarkleid, besonders aber durch einen förmlichen Hörnerschmuck ausgezeichnet; seine Zähne nämlich wachsen zu solcher auffallenden Länge empor, und die oberen krümmen sich so sonderbar, daß man sie recht wohl mit Hörnern vergleichen kann. Die Europäer haben den ursprünglichen Landesnamen Babi-Rusa, welcher soviel als Eber und Hirsch bedeutet, ohne weiteres aufgenommen und übersetzt, weil er das betreffende Schwein treffend bezeichnet. Durch seine Zähne unterscheidet sich der Babirusa von allen übrigen Mitgliedern seiner Familie und gilt mit Recht als Vertreter einer eigenen Sippe ( Porcus oder Babirusa).

Hischeber ( Porcus Babyrusa). 1/8 natürl. Größe.
Der Hirscheber ( Porcus Babyrusa, Sus Babirusa, Aper orientalis, Babirusa. alfurus) ist ein Thier von bedeutender Größe. Neuere Jäger behaupten, einzelne Eber gesehen zu haben, welche ebenso groß wie ein mittlerer Esel waren. Durchschnittlich mag die Körperlänge des erwachsenen Thieres 1,1 Meter, die Schwanzlänge 20 Centim., die Höhe am Widerriste und Kreuze 80 Centim. betragen. Der Leib ist gestreckt, rund und voll, seitlich jedoch nur wenig zusammengedrückt, der Rücken schwach gewölbt, der Hals kurz und dick, der Kopf verhältnismäßig klein, lang gestreckt, auf der Stirne schwach gewölbt, mit einem stark zugespitzten, die Unterlippe überragenden, kräftigen, beweglichen Rüssel, welcher an seiner Spitze ebenso wie bei den Schweinen abgestutzt ist und auch die nackte, knorpelige Wühlscheibe mit ihren schwieligen Rändern und den sie durchbohrenden Nasenlöchern zeigt; die Beine sind kräftig, aber gestreckt, die vorderen wie die hinteren vierzehig, die Vorderzehen höchstens etwas weiter von einander abstehend als bei den übrigen Schweinen; der Schwanz ist dünn und wird hängend getragen. Die Eckzähne des Oberkiefers, welche beim Männchen äußerst lang, dünn und spitzig, auf der Vorderseite gerundet, seitlich zusammengedrückt, hinten stumpfschneidig nach aufwärts und zugleich nach rückwärts gerichtet sind, so daß sie mit höherem Alter zuweilen in die Haut der Stirn eindringen, durchbohren die Rüsseldecke und krümmen sich halbkreisförmig oder noch mehr nach hinten; die kürzeren und dickeren Gewehre des Unterkiefers richten sich mehr gerade nach aufwärts. Beim Weibchen sind die Eckzähne sehr kurz, und die oberen, welche ebenso wie bei dem Männchen die Schnauze durchbohren, ragen kaum einen Centimeter über sie empor. Vier Vorderzähne in den Oberkiefern, sechs in den Unterkiefern und fünf Backenzähne jederseits oben und unten bilden das übrige Gebiß. Beim Weibchen finden sich nur zwei Zitzen, welche in der Weichengegend liegen. Das Haarkleid besteht aus einzelnen, ziemlich kurzen Borsten, welche längs des Rückgrats und zwischen den vielen Hautrunzeln sowie am Ende des Schwanzes, wo sie eine kleine Quaste bilden, dichter stehen. Die Haut ist dick, hart, rauh, vielfach gerunzelt und im Gesichte, um die Ohren und am Halse tief gefaltet. Ein schmutziges Aschgrau auf der Außen- und Oberseite und Rostroth an der Innenseite der Beine ist die allgemeine Färbung; über die Mittellinie zieht ein heller, bräunlichgelber Streifen, gebildet durch Spitzen der Borstenhaare. Die Ohren sind schwärzlich.
Es scheint, daß der Hirscheber schon den Alten bekannt gewesen ist; wenigstens haben sich die Sprachforscher bemüht, einige unverständliche Namen auf ihn zu deuten. Schädel des Babirusa kannte man schon seit mehreren hundert Jahren, Bälge aber kamen, wie noch heute, von jeher selten nach Europa; die Abbildungen waren Zerrbilder und die Naturgeschichte des Thieres eine Zusammenreihung der abgeschmacktesten Fabeln. Seitdem einige lebende Hirscheber nach Europa gelangt und hier beobachtet worden sind, hat man Abbildung und Beschreibung möglichst zu berichtigen gesucht, obwohl letzterer, was das Wildleben anlangt, immer noch mancherlei Fabeln anhaften mögen.
Außer Celebes, welches als das eigentliche Vaterland des Babirusa angesehen werden muß, findet er sich nur noch auf den oben angegebenen Inseln, während er auf den übrigen Molukken, den großen westlichen Sundainseln und ebenso auf dem hinterindischen Festlande zu fehlen scheint. Möglich ist, daß er auch in Neuguinea und Neuirland vorkommt; wenigstens fanden einige Reisende dort seine unverkennbaren Hauzähne in den Händen der Eingeborenen. Auf Celebes und im Innern Burus ist er häufig. Seine Lebensweise ist die anderer Schweine. Sumpfige Wälder, Rohrgebüsche, Brüche und Seen, auf denen viele Wasserpflanzen wachsen, sind seine Lieblingsorte. Hier rudelt er sich zu größeren oder kleineren Gesellschaften, schläft bei Tage und geht nachts auf Fraß aus, alles genießbare annehmend. Der Gang ist ein rascher Trab, der Lauf leichter als bei dem Wildschweine, selbstverständlich aber nicht mit der köstlichen Bewegung der Hirsche zu vergleichen, wie man früher behaupten wollte. Um die auffallend gebildeten Eckzähne des Ebers zu erklären, hat man gefabelt, daß er sich damit manchmal an niedere Aeste hänge, theils um seinen Kopf zu stützen, theils aber, um sich gemächlich hin und her zu schaukeln! Begründet ist, daß der Babirusa, als vortrefflicher Schwimmer, nicht bloß in den süßen Gewässern alle Nahrungsplätze besucht, sondern auch dreist über Meeresarme setzt, um von einer Insel zur anderen zu gelangen.
Unter den Sinnen des Thieres sind Geruch und Gehör am besten entwickelt. Die Stimme ist ein langes, schwaches Grunzen. Die geistigen Eigenschaften ähneln denen anderer Schweine. Der Hirscheber weicht dem Menschen aus, so lange es geht, setzt sich aber unvermeidlichen Angriffen mit der Tapferkeit aller Eber zur Wehr, und seine unteren Eckzähne sind so tüchtige Waffen, daß sie auch dem muthigsten Manne ein gewisses Bedenken einzuflößen vermögen. Ein Seeofficier, welcher mehrere Male mit dem Babirusa zusammen gekommen war, sprach nur mit der größten Achtung von ihm, schien jedoch aus seinem Zusammentreffen mit ihm nicht gern viel erzählen zu wollen. Die Eingeborenen sollen ihn mit Lanzen erlegen und manchmal Treibjagden veranstalten, bei denen die Babirusas ihr Heil in der Flucht zu suchen pflegen.
Die Sau soll, im Monat Februar etwa, ein oder zwei Frischlinge werfen, kleine, nette Thierchen von 15 bis 20 Centim. Länge, welche von der Mutter warm geliebt und vertheidigt werden. Weiter weiß man nichts über die Fortpflanzung. Fängt man solche Junge frühzeitig ein, so nehmen sie nach und nach einen gewissen Grad von Zahmheit an, gewöhnen sich an den Menschen, folgen ihm unter Umständen und bezeugen ihm ihre Dankbarkeit durch Schütteln der Ohren und des Schwanzes. Bei den Rajas findet man zuweilen einen lebenden Babirusa, weil auch die Eingeborenen ihn als ein ganz absonderliches Geschöpf betrachten und seiner Sehenswürdigkeit wegen in der Gefangenschaft halten. Doch geschieht dies noch immer selten, und man verlangt hohe Preise für gezähmte Schweine dieser Art.
Markus, der holländische Statthalter der Molukken, schenkte den französischen Naturforschern Quoy und Gaimard, welche ihn bei ihrer Erdumsegelung besuchten, ein Paar Hirscheber, und das Schiff machte ihretwegen einen Umweg von mehr als fünfzig Meilen. Dieses Paar war das erste, welches man lebend nach Europa brachte. Beide Thiere wurden ziemlich zahm. Das Weibchen zeigte sich wilder als das Männchen, kam, als man ersteres messen wollte, von hinten herbei und biß in die Kleider der Leute. Gegen die Kälte erwiesen sich die gefangenen Babirusas außerordentlich empfindlich, zitterten fortwährend, krochen zusammen und verbargen sich selbst im Sommer unter Stroh. Im März warf das Weibchen ein dunkelbraunes Junges, und von Stunde an war es sehr reizbar und böse, erlaubte niemandem, den Frischling zu berühren, zerriß den Wärtern die Kleider und biß heftig um sich. Leider hielten sich die Thiere nicht lange. Das kalte Klima wurde ihnen verderblich. An die Nahrung der übrigen Schweine gewöhnten sie sich leicht; Kartoffeln und Mehl in Wasser schien ihnen sehr zu behagen. Das Junge, ein Männchen, wuchs schnell und hatte binnen wenigen Wochen eine bedeutende Höhe erreicht. Es starb, ehe es zwei Jahre alt geworden war. Die oberen Eckzähne waren noch nicht durch die Haut der Schnauze gedrungen. Später, immer aber als große Seltenheit, gelangten andere lebende Hirscheber in den Thiergarten zu London, woselbst sie mehr oder minder gut aushielten.
Die Merkmale der Nabelschweine, für welche Gray eine besondere Familie ( Dicotylina) bildet, liegen in dem Gebiß, welches aus achtunddreißig Zähnen, und zwar vier oberen und sechs unteren Schneide-, den Hau- und ober- und unterseits in jedem Kiefer je sechs Backenzähnen besteht, auch dadurch sich auszeichnet, daß die Hauzähne sich weder nach aufwärts krümmen, noch die Oberlippe durchbohren, sowie ferner in der gedrungenen Gestalt, dem kurzen Kopfe und kurzem, schmächtigem Rüssel, den ziemlich kleinen und schmalen, stumpf zugespitzten Ohren, dem Fehlen der Außenzehe des Hinterfußes, welcher demgemäß nur in drei Hufe getheilt ist, dem verkümmerten Schwanze, einer auf dem Hintertheile des Rückens ausmündenden Drüse und den zwei oder drei Zitzenpaaren des Weibchens.
Das Nabelschwein oder der Pekari, Wagansu, Tagasu, Taytétu, Apuya, Peraka, Pakira, Pakylie etc. der Eingeborenen ( Dicotyles torquatus, Sus Tajacu und torquatus, Dicotyles Tajacu und minor, Notophorus torquatus), ein kleines Schwein von höchstens 95 Centim. Länge, bei 2 Centim. Schwanzlänge und 35 bis 40 Centim. Schulterhöhe, hat einen kurzen Kopf und eine stumpfe Schnauze, ist sonst aber verhältnismäßig schlank gebaut. Die langen und dichtstehenden Borsten erscheinen am Grunde dunkelbraun, sind hierauf falb und schwarz geringelt und an der Spitze endlich wieder schwarzbraun gefärbt. Zwischen den Ohren und auf der Mittellinie des Rückens verlängern sie sich, ohne jedoch einen starken Kamm zu bilden. Die allgemeine Färbung des Thieres ist ein schwärzliches Braun, welches auf den Seiten ins Gelblichbraune übergeht und mit Weiß sich vermischt. Der Bauch ist braun, die Vorderbrust weiß, eine von der Schultergegend nach vorn und unten verlaufende, ziemlich breite Binde endlich gelblichweiß. Aus der Rückendrüse sondert sich zu allen Zeiten eine durchdringend riechende Flüssigkeit ab, welche den Eignern aber sehr zu behagen scheint, weil sie sich gegenseitig mit ihren Schnauzen an den Rückendrüsen reiben.
Die zweite Art der Gruppe, das Bisamschwein, Tagnicati, Taititu, Kairuni, Poinka, Ipuré etc. der Eingeborenen ( Dicotyles labiatus, Sus labiatus und albirostris, Dicotyles albirostris), ist merklich größer, einschließlich des 5 Centim. messenden Schwanzstummels 1,1 Meter lang und an der Schulter 40 bis 45 Centim. hoch, von dem Verwandten durch einen großen weißen Fleck am Unterkiefer auch in der Färbung auffallend unterschieden. Die übrigen Borsten, welche dick, eckig und hart sind, dünn stehen und nur ein lockeres, am Hinterkopfe und längs des Rückens mehr oder weniger verlängertes Kleid bilden, haben graulich schwarze Färbung und in ihrer Mitte eine röthlichgelbe Binde, welche jedoch kaum zur Wirkung gelangt; die Gesammtfärbung ist daher ein am ganzen Leibe ziemlich gleichmäßiges Grauschwarz, von welchem der lichte Wangenfleck lebhaft absticht.
In allen waldreichen Gegenden Südamerikas, bis gegen tausend Meter über dem Meere, sind die Nabel- wie die Bisamschweine gewöhnliche Erscheinungen. In zahlreichen, zuweilen Hunderte zählenden Trupps, unter Leitung der stärksten Eber ihrer Art, durchziehen die Bisamschweine, in schwächeren, aus zehn bis fünfzehn Stück bestehenden Rudeln ihre Verwandten, die Pekaris, die Wälder, täglich den Aufenthaltsort ändernd und eigentlich immer auf der Wanderschaft begriffen. Nach Renggers Versicherung kann man ihnen tagelang folgen, ohne sie zu sehen. »Bei ihren Zügen«, sagt dieser Forscher, »hält sie weder das offene Feld, welches sie sonst nur selten besuchen, noch das Wasser auf. Kommen sie zu einem Felde, so durchschneiden sie dasselbe im vollen Laufe; stoßen sie auf einen Fluß oder Strom, so stehen sie keinen Augenblick an, ihn zu überschwimmen. Ich sah sie über den Paraguayfluß setzen an einer Stelle, wo er mehr als eine halbe Stunde breit war. Das Rudel selbst zieht in dichtem Gedränge, die männlichen Thiere voran, jedes Mutterschwein mit seinen Jungen hinter sich. Man erkennt es schon von weitem durch das Gehör, und zwar nicht bloß wegen der dumpfen, rauhen Laute, welche die Thiere von sich geben, sondern noch mehr, weil sie ungestüm das Gebüsch auf ihrem Wege zerknicken.«

Nabelschwein ( Dicotyles torquatus). 1/9 natürl. Größe.
Bonpland wurde einmal von seinem indianischen Führer beim Pflanzensuchen gebeten, sich hinter einem Baume zu verstecken, weil der Begleiter befürchtete, daß unser Forscher von einem Rudel dieser Schweine zu Boden geworfen werden möchte. Die Eingeborenen versicherten Humboldt, daß sich selbst der Jaguar im Walde scheue, unter ein Rudel Pekaris zu gerathen, und sich, um nicht erdrückt zu werden, vor ihnen regelmäßig hinter einen Baum flüchte.
Die Nabelschweine gehen bei Tage und bei Nacht ihrem Fraße nach, und der Mangel an geeigneter Nahrung ist es wohl auch, welcher sie zu größeren Wanderungen zwingt. Baumfrüchte aller Art und Wurzeln bilden ihre Aesung. Ihr Gebiß ist so kräftig, daß sie, laut Schomburgk, mit der größten Leichtigkeit selbst die härtesten Palmensamen zu öffnen vermögen. In bewohnten Gegenden brechen sie häufig in die Pflanzungen ein und zerstören die Felder. Neben pflanzlicher Nahrung sollen sie auch Schlangen, Eidechsen, Würmer und Larven fressen.
In ihren Bewegungen und ihrem Wesen ähneln sie unseren Wildschweinen, zeigen aber weder die Gefräßigkeit, noch die Unreinlichkeit derselben, fressen nie mehr, als sie bedürfen, und suchen bloß während der größten Hitze, und auch dann nur Pfützen auf, um sich in ihnen zu suhlen. Bei Tage verbergen sie sich gern in hohlen Stämmen oder zwischen losen Wurzeln großer Bäume; wenn sie gejagt werden, flüchten sie sich stets nach solchen Schlupfwinkeln. Ihre Sinne sind schwach, ihre geistigen Fähigkeiten gering. Gehör und Geruch scheinen am besten ausgebildet zu sein. Das Gesicht ist schlecht. Von scharfem Verstand hat man wenig bei ihnen bemerkt; dagegen bethätigen sie die Rachelust ihres Geschlechts in unbeschränkter Weise.
Mehrere Reisende haben Wunderdinge von der Kühnheit der Pekaris erzählt. »Beständig wüthend, höchst jähzornig«, sagt Wood, »ist der Pekari einer der beachtenswerthesten Gegner, welchen es für den Menschen oder für ein Raubthier gibt; denn Furcht ist ein Gefühl, welches jenes Geschöpf nicht kennt, vielleicht weil sein Verstand auf einer zu niederen Stufe steht und es unfähig ist, eine Gefahr zu begreifen. So harmlos das Bisamschwein, mit anderen Mitgliedern seiner Familie verglichen, auch ist, so unbedeutend seine Bewaffnung erscheint, so gut weiß es die äußerst scharfen Zähne zu benutzen. Es scheint, daß kein einziges Thier im Stande ist, dem vereinigten Angriff der Pekaris zu widerstehen. Selbst der Jaguar wird gezwungen, den Kampf aufzugeben, und muß flüchten, sobald ihn eine Herde Pekaris umringt und angreift.« Schomburgk, dessen Mittheilungen im allgemeinen durchaus verläßlich sind, unterstützt derartige Behauptungen. »Als wir«, so erzählt er, »eine der waldigen Oasen durchschritten, hörte ich in der Ferne ein eigenthümliches Getöse, welches ganz dem Gelärm galoppirender Pferde zu vergleichen war und uns immer näher zu kommen schien. Mit dem Ausrufe: Poinka! spannten die Indianer ihre Flinten und Bogen und erwarteten die Annäherung der Lärmmacher, welche sich auch bald als eine unzählbare Herde von Bisamschweinen erwiesen. Sobald diese uns erblickten, hielten sie einen Augenblick in ihrer wilden Eile an, stießen dann ein dem Grunzen unserer Schweine ähnelndes Geschrei aus und schickten sich nun zur Flucht an. Unter schrecklichem Zähneklappern und Knirschen stürzte das Heer an uns vorüber. Erstaunt und gefesselt durch diese merkwürdige Unterbrechung unserer so lautlosen Reise, hatte ich im ersten Augenblicke selbst unter sie zu schießen vergessen und wollte, da ich keinen Schuß von meinen Begleitern hatte fallen hören, eben das versäumte nachholen, als mir der zunächst stehende Indianer das Gewehr wegzog. Dies vermehrte mein Staunen noch mehr; bald aber sollte sich mir das Räthsel lösen. Als die Hauptmasse der Herde an uns vorüber war, und die Nachzügler sich näherten, wurden Gewehre und Bogen in Thätigkeit gesetzt, so daß wir vier Stück in unsere Gewalt bekamen. Merkwürdigerweise verhielten sich unsere Hunde bei diesem Vorübermarsche ebenso ruhig wie wir und hatten sich auf die Erde niedergelegt. Die Indianer erzählten mir jetzt, daß es meist mit der größten Gefahr verbunden sei, in die Mitte einer solchen Herde zu schießen, indem sich die Thiere dann nach allen Richtungen hin zerstreuten und auf einer solchen Flucht jeden, ihnen in den Weg kommenden lebendigen Gegenstand niederrissen und mit ihren Hauern vernichteten. Hamlet, welcher während des Vorüberzuges der erzürnten Menge zitternd und bebend neben mir gestanden, bekräftigte diese Aussage durch die Versicherung, daß sein Vater auf diese Weise ums Leben gekommen sei, da er an einer Wunde, welche er von einem Kairuni erhalten, nachdem er in die Mitte einer solchen flüchtigen Herde geschossen, habe sterben müssen. Werde dagegen unter die Nachzügler geschossen, so setze die Hauptmasse ihren Lauf unbekümmert fort.« Wie Schomburgk an einer anderen Stelle seines Werkes mittheilt, wird die Jagd der Nabelschweine von den Indianern mehr als jede andere betrieben, weil sie stets am ergiebigsten ausfällt. Die Hunde, welche man dabei verwendet, sind besonders darauf abgerichtet, und dies ist um so nothwendiger, als beide Bisamschweinarten eine unauslöschliche Feindschaft gegen jene hegen. »Die Abrichtung der Hunde besteht darin, daß sie beim Zusammentreffen mit einer Herde dieser Thiere ein Stück von den Nachzüglern abdrängen und so lange zu umstellen suchen müssen, bis der Jäger herankommt und es niederschießt. Sowie das eine erlegt ist, eilen die Hunde der Herde wieder nach und drängen ein zweites, drittes und viertes Stück ab. Begegnet der Jäger Bisamschweinen, ohne daß er die Hunde bei sich hat, so sucht er an die Herde sich anzuschleichen, ersteigt einen Baum und ahmt das Gebell eines Hundes nach. Kaum haben die Thiere den Ton gehört, so stürzen sie mit aufgesträubten Borsten auf den Baum zu, von welchem die Stimme ihres Erbfeindes erschallt, und umzingeln ihn unter wildem Grunzen und Zähneknirschen. Ist der Jäger mit Bogen und Pfeil bewaffnet, so kann er mehrere erlegen, bevor die Herde die Flucht ergreift; hat er jedoch eine Flinte, so verscheucht jene schon der Knall des ersten Schusses. Der Jäger springt dann schnell vom Baume und sucht den flüchtigen zuvorzukommen, um dasselbe Verfahren von neuem zu beginnen. Noch wüthend von der Störung, stürzen sie abermals auf den Baum zu, doch nur, um wieder eins aus ihrer Mitte zu verlieren. Dann und wann nimmt solche Jagd allerdings einen unglücklichen Ausgang; wenigstens war dies der Fall bei einem Arawak, welcher ebenfalls einer Herde ohne Hunde begegnet war und durch Nachahmung des Gebelles die wüthenden Schweine unter dem Baume versammelt hatte. Als er eben sein Gewehr abschießen will, bricht der Ast, auf welchem er sitzt; beim Herabfallen ergreift er glücklicherweise noch einen der untersten, an dem er nun herabhängt; seine Füße können aber von der erbosten Schar erreicht und zerfleischt werden. Die Schmerzen steigern seine Kräfte, und es gelingt ihm, sich auf den Ast emporzuschwingen. Jetzt läßt das wilde Heer seine Wuth an dem herabgefallenen Gewehre aus, dessen Kolben es vollständig zerbeißt, bis es endlich seinen Weg fortsetzt. Unter unsäglichen Schmerzen und Anstrengungen gelingt es dem unglücklichen Waidmanne, kriechend seine Niederlassung zu erreichen. Sind die Hunde zu hitzig und dringen sie in die Mitte der Herde ein, so wartet ihrer fast immer sicherer Tod, da sie meist mit aufgerissenem Bauche auf dem Schlachtfelde liegen bleiben. Ein gleiches Schicksal soll auch dem Puma und Jaguar werden, wenn sie in die Herde einbrechen; beide aber scheinen die Gefahr zu kennen und folgen daher den Scharen gewöhnlich in der Ferne, um die Nachzügler zu überfallen. Lauten Jubel erregt es jedesmal unter einer Jagdgesellschaft, wenn es gelingt, eine Bisamschweinherde in einen Fluß zu treiben. Obschon der Pekari schwimmt, bewegt er sich doch nur langsam und unbeholfen im Wasser und wird somit eine leichte Beute seiner Verfolger. Sobald die Thiere in das Wasser treten, springen ihnen die Indianer mit einem starken Prügel nach und schlagen sie ein-, höchstens zweimal auf den Rüssel; der zweite Schlag tödtet sie sicher. Ruhig lassen sie dann das erlegte Stück schwimmen, um noch einigen den tödtlichen Schlag beizubringen, und erst wenn dies nicht mehr möglich, fischen sie die Todten auf.« In Woods Naturgeschichte findet man noch folgende Münchhausiade angegeben: Wenn der Jäger ausgekundschaftet hat, daß ein Rudel Pekaris in einen hohlen Baum gekrochen ist und dort der Ruhe pflegt, nähert er sich und erschießt den Wachposten, welcher regelmäßig ausgestellt wird. Sobald die Schildwache getödtet ist, wird sie durch eine andere ersetzt; der Jäger erlegt auch diese, und so kann er die ganze Familie nach und nach umbringen!
Humboldt und Rengger wissen nichts von solchen Geschichten. »Die Bisamschweine«, sagt letzterer, »werden theils ihres Fleisches wegen, theils auch des Schadens halber, den sie in den Pflanzungen anrichten, häufig gejagt. Man sucht sie gewöhnlich mit Hunden in den Wäldern auf und tödtet sie mit Schüssen oder Lanzenstichen. Es ist lange nicht so gefährlich, wie man gesagt hat, Trupps dieser Thiere anzugreifen. Wohl mag hier und da ein unbesonnener Jäger einige Wunden davongetragen haben, wenn er sich allein und zu Fuße einem starken Rudel entgegenstellte; jagt man sie aber mit Hunden, und greift man sie nur von der Seite oder von hinten an, so ist für den Jäger keine Gefahr vorhanden, da sie so schnell als möglich davoneilen und sich höchstens gegen schwache Hunde vertheidigen. Fallen sie oft in eine Pflanzung ein, so gräbt man auf der Seite, wo sie dieselbe zu verlassen pflegen, eine breite, bis drei Meter tiefe Grube, wartet, bis sie erscheinen, und jagt sie dann mit Hunden und unter Geschrei auf die Grube zu, welche, wenn das Rudel stark ist, zuweilen bis zur Hälfte mit ihnen angefüllt wird. Ich sah auf einem Landgute neunundzwanzig Stück in ein Loch herabstürzen und darin durch die Lanzen der Jäger ihren Tod finden. Diejenigen, welche sich in den Urwäldern unter Baumwurzeln verborgen haben, treibt man mit Rauch heraus. Wir tödteten einmal fünfzehn Stück auf diese Weise. Die Indianer fangen die Bisamschweine in Schlingen.«
Die Sau wirft gewöhnlich ein einziges, in seltenen Fällen zwei Junge, welche vielleicht schon am ersten Tage, sicherlich aber sehr kurz nach ihrer Geburt, der Mutter überall hin folgen und, anstatt zu grunzen, fast wie Ziegen schreien. Sie lassen sich ohne Mühe zähmen und werden, wenn man sie gut behandelt, zu eigentlichen Hausthieren. »Der Pekari«, sagt Humboldt, »den man im Hause aufzieht, wird so zahm wie unser Schwein und Reh, und sein sanftes Wesen erinnert an die anatomisch nachgewiesene Aehnlichkeit seines Baues mit dem der Wiederkäuer.« Ihr Hang zur Freiheit verschwindet, wie Rengger versichert, gänzlich, und an dessen Stelle tritt die größte Anhänglichkeit an den neuen Wohnort und an die dortigen Hausthiere und Menschen. »Der Pekari entfernt sich, wenn er allein ist, nie lange von der Wohnung. Er verträgt sich gut mit den übrigen Hausthieren und spielt zuweilen mit ihnen; besonders aber ist er den Menschen zugethan, unter denen er lebt. Er weilt häufig gern in ihrer Nähe, fischt sie auf, wenn er sie einige Zeit lang nicht gesehen hat, drückt beim Wiedersehen durch Entgegenspringen und Schreien seine Freude aus, hört auf ihre Stimme, wenn er sie rufen hört, und begleitet sie tagelang in Wald und Feld. Fremde, welche sich der Wohnung seines Herrn nähern, kündigt er durch Grunzen und Sträuben seiner Haare an. Auf fremde Hunde, falls diese nicht zu groß sind, geht er sogleich los, greift sie an und versetzt ihnen zuweilen mit den Eckzähnen tüchtige Wunden, welche er nicht nach Art des Wildschweines durch Stoßen, sondern durch eigentliches Beißen beibringt.« Schomburgk und Wallis bestätigen und erweitern diese Angaben. »Gezähmte Pekaris«, so schreibt mir letzterer, »fand ich sehr zuthunlich, auch gegen den eintretenden Fremden, welchen sie freilich zunächst neugierig beschnüffeln. Durch Knurren geben sie ihre Freundschaftsversicherungen zu erkennen und legen sich vor den Füßen nieder, um geliebkost zu werden.« Nach Schomburgk läßt sich der Pekari weit schwerer zähmen als der Taititu, welcher seinem Herrn wie ein Hund auf Schritt und Tritt folgt, jedoch nach jedem beißt, welcher seine Gunst verscherzt oder sie nicht zu erwerben verstanden hat. Unter allen gezähmten Hausthieren der indianischen Niederlassungen bekundeten sie bei Schomburgks Erscheinen die größte Bestürzung, zugleich aber auch einen hohen Grad von Zorn, indem sie ihre Rückenborsten sträubten und ein eigenthümliches Schnaufen ausstießen, wie sie es jedesmal hören lassen, wenn sie einen fremden Gegenstand erblicken. Es vergingen immer mehrere Tage, bevor sie sich an die Fremdlinge gewöhnt hatten. Ihre angeborene Feindschaft gegen die Hunde legen sie auch in der Gefangenschaft nicht ab. »Vertrugen sie sich schon nicht mit den in dem Dorfe befindlichen Hunden«, versichert unser Gewährsmann, »und bissen sie, sobald diese in ihre Nähe kamen, auf sie ein, so ließen sie ihre Wuth und Feindschaft an den unserigen in verdoppeltem Maße aus.«
Nach Europa kommen lebende Pekaris in erheblicher, lebende Bisamschweine in geringerer Anzahl. Beide ertragen unser Klima verhältnismäßig gut, haben sich auch wiederholt bei uns fortgepflanzt. Man erhält sie bei gewöhnlichem Schweinefutter mehrere Jahre. Von ihrer Freundschaft zu dem Menschen habe ich bisher noch nichts bemerken können. Alle Gefangenen, welche ich sah oder pflegte, waren bissige, jähzornige Geschöpfe, welche sich auch dem Wärter gegenüber sehr rauflustig zeigten. Es mag sein, daß die meisten Bisamschweine unterwegs nicht besonders gut behandelt und deshalb gereizt worden sind; die eigentliche Ursache ihres unwirschen Gebarens aber liegt tiefer, in ihrem Wesen selbst, begründet. Bei ihnen gewährter Freiheit mögen sie sich liebenswürdig zeigen, im engeren Gewahrsam erweisen sie sich im Gegentheile als widerwärtige, weil aufbrausende, boshafte, rachsüchtige und tückische Geschöpfe, welche alle erfahrenen Wärter weit mehr fürchten als die großen und starken Familiengenossen.
Das Fell der Nabelschweine wird hauptsächlich zu Säcken und Riemen benutzt, das Fleisch hingegen von dem ärmeren Volke gegessen. Es hat einen angenehmen Geschmack, welcher aber mit dem des Schweinefleisches keine Aehnlichkeit hat. Auch findet sich anstatt des Speckes nur eine dünne Lage von Fett. Ist das Bisamschwein vor seinem Tode lange gehetzt worden, so nimmt das Fleisch den Geruch der Rückendrüse an, falls man diese nicht bald herausschneidet; sonst aber kann man, außer der Brunstzeit wenigstens, das getödtete Thier in seiner Haut erkalten lassen, ohne daß sich dieser Geruch im Fleische wahrnehmen läßt.
Afrika beherbergt außer den Höckerschweinen noch wahre Ungeheuer derselben Familie, die Warzenschweine ( Pacochoerus), nach Gray's Auffassung Vertreter einer besonderen Familie ( Pacochoerina). Sie sind die plumpesten und häßlichsten aller bekannten Borstenthiere, gedrungen gebaut und niedrig gestellt, ausgezeichnet vor allem durch den unschönen Kopf und das eigenthümliche Gebiß. Ihr Leib ist walzig, also nicht seitlich verschmächtigt, sondern allseitig gerundet, in der Rückenmitte eingesenkt, der Hals kurz, der Kopf massig, auf der breiten Stirne niedrig, im Rüsseltheile überall merklich, vorn an der Oberlippe unverhältnismäßig verbreitert, an den Seiten verunziert durch drei warzige Auswüchse, von denen je ein mehrere Centimeter hoher, zugespitzter, beweglicher, bald nach oben gerichteter, bald hängender unter dem Auge, ein anderer kleinerer, aufgerichteter seitlich vorn auf dem Vorderkiefer stehen, und der dritte, an der Wurzel sehr lange, vom Unterkiefer an beginnend, längs desselben bis gegen die Mundspalte hin sich erstreckt. Die kleinen Augen treten wie beim Nilpferde vor und werden unten von einer großen halbmondförmigen Falte umgeben, welche sich mit Thränengruben vergleichen läßt, vielleicht auch eine Drüse bezeichnet; die Ohren sind spitzig; die Rüsselscheibe verbreitert sich und bildet ein von oben nach unten zusammengedrücktes Eirund. Die niederen, verhältnismäßig zierlichen Beine haben vorn und hinten vier Hufe und vorn auf dem Fesselgelenke eine breite Schwiele; der lange peitschenförmige Schwanz trägt eine starke Quaste. Die Haut ist mit Ausnahme eines Backenbartes und einer Rückenmähne nur mit sehr kurzen, meist ganz einzeln stehenden Borsten bekleidet. Das Gebiß besteht ursprünglich aus sechs Schneidezähnen im oberen und unteren Kiefer, riesigen, sehr starken, mehr oder weniger ausgeschweiften, am Ende abgestumpften, vorn und hinten der Länge nach gefurchten Hauern, welche sich wie bei den Schweinen nur nach oben kehren, und sechs Backenzähne in jeder Reihe, oben wie unten. Es finden sich demgemäß vierzig Zähne, von denen jedoch nicht allein die Lückzähne, sondern auch die Schneidezähne größtentheils auszufallen pflegen. Da dies nun nicht immer übereinstimmend zu geschehen pflegt, glaubte Gray berechtigt zu sein, die von anderen Forschern unterschiedenen zwei Arten der Gruppe vereinigen zu dürfen; eine Vergleichung des süd- und mittelafrikanischen Warzenschweines stellt es jedoch außer Zweifel, daß beide Thiere, so nahe sie sich auch stehen mögen, als von einander verschiedene, wohlbegründete Arten betrachtet werden müssen.
Das Warzenschwein, von Buffon »Emgalo«, von den Abessiniern »Haroja« oder »Araja«, von den Somalen »Dosar«, von den Arabern wie alle Wildschweine »Halûf« genannt ( Pacochoerus africanus, Pacochoerus oder Phascochoerus Aelianis, incisivus, barbatus und Haroja, Sus africanus, Porcus silvestris etc.), erreicht einschließlich des 45 Centim. langen Schwanzes 1,9 Meter Gesammtlänge bei 70 Centim. Schulterhöhe und kennzeichnet sich auch äußerlich durch den sehr gestreckten, breiten, in der Mitte gebuchteten Rüssel, dessen obere Längslinie einen flachen, nach unten gekehrten Bogen bildet, also eingesenkt ist, die aufrecht stehenden Warzen und die seitlich nicht sehr stark ausgebogenen Hauer, im übrigen Gebisse aber dadurch, daß die zwei Schneidezähne des Ober- und die sechs Schneidezähne des Unterkiefers nicht regelmäßig ausfallen. Die Behaarung der Seiten und der Untertheile des Leibes ist selbst in der kalten Jahreszeit kurz und dünn, in den warmen Monaten, und zumal nach der Härung so spärlich, daß dann eigentlich nur die graulich-schieferfarbene Haut zur Geltung kommt, und die weichen, dünnen Borstenhaare, welche dieselbe bedecken, ihr höchstens einen lichteren Schimmer verleihen. Dagegen erreicht eine auf der Stirn beginnende, bis zum Kreuze fortlaufende, auf dem Rücken sich verbreiternde, aus dicken, wenig biegsamen, schwarzen, braunspitzigen Haaren gebildete Mähne eine so bedeutende Länge, daß sie seitlich bis zum Bauche herabfüllt. Starke Borsten umgeben auch das dicht bewimperte Auge, und ähnliche am Unterkiefer bilden einen sehr bemerklichen Backenbart. Die Schwanzquaste endlich besteht aus einem ziemlich langen Busche.
Der Verbreitungskreis des Warzenschweines erstreckt sich über ganz Mittelafrika, von den Küstenländern des Rothen und Indischen Meeres an bis zum Grünen Vorgebirge.
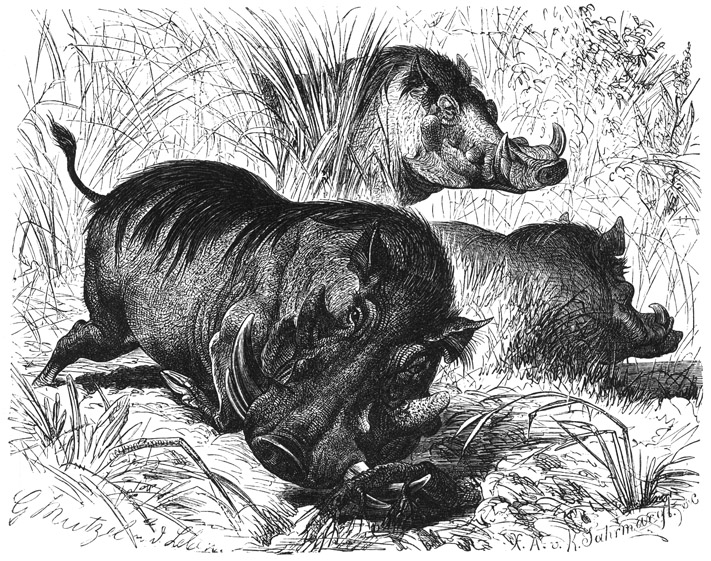
Warzenschwein ( Phacochoerus africanus). 1/12 natürl. Größe.
Im südlichen Theile Afrikas wird das Thier durch den oft mit ihm verwechselten Hartläufer der Ansiedler am Kap, zu Deutsch »Schnellläufer«, den »Kolobe« der Betschuanen ( Pacochoerus aethiopicus, Pacochoerus oder Phascochoerus edentatus, typicus und Pallasii, Sus aethiopicus und Angalla, Aper aethiopicus etc.), vertreten. In Gestalt, Größe und Färbung dem Verwandten sehr nahe stehend, unterscheidet sich diese Art doch bestimmt durch den bedeutend kürzeren, längs der Gesichtslinie nach oben gewölbten, also schwach ramsnasigen Kopf, die sehr verlängerten und hängenden Augenwarzen, die viel stärker seitlich ausgebogenen Hauer und, wenigstens im Alter, durch das gänzliche Fehlen der Schneidezähne in beiden Kiefern. Auch die Behaarung ist eine andere, die Mähne etwas breiter und kürzer, der vordere Theil derselben zu einem zwischen den Ohren sich erhebenden Haarwirbel umgewandelt, von welchem aus die Haare nach allen Seiten herabfallen, der Backenbart etwas schwächer, die Bekleidung der Seiten dagegen stärker und dichter als bei dem Verwandten.
Bis jetzt sind uns nur ziemlich dürftige Nachrichten über Betragen und Lebensweise der Warzenschweine zugekommen. Auch Heuglin und Schweinfurth fertigen die nördliche Art, mit welcher sie oft zusammengetroffen sind, sehr kurz ab. Ihr begegnet man in Habesch vom Gestade des Rothen Meeres bis zu 3000 Meter unbedingter Höhe, am Weißen Nile hingegen in allen dichten, buschreichen Gegenden, in Feldern, im Röhricht oder in fast undurchdringlichen Bambushorsten, welche letztere besonders aus dem Grunde aufgesucht werden, weil die weichen, spargelartigen Sprossen des Bambus eine erwünschte Aesung bieten. In Habesch trifft man schon wenige Meilen von der Küste sehr häufig auf die unverkennbaren Spuren dieses Thieres; doch habe ich nur ein einziges und auch dieses bloß flüchtig gesehen, eigene Beobachtungen also nicht sammeln können. Nach Heuglin schlägt sich das Warzenschwein wie die meisten übrigen Arten seiner Familie in Rudel von wechselnder Stärke, welche vom Abend bis zum Morgen nach Aesung umherziehen; den Tag verbringt es im Lager, am liebsten da, wo es sich in den Sumpf oder selbst in das Wasser einbetten kann. Die Aesung besteht, nach Rüppell, aus Wurzeln, und die Bedeutung seiner riesenmäßigen Gewehre wird hierdurch klar. Um Aesung zu nehmen, fällt das Thier auf seine Handbeugen, rutscht, mit den Hinterläufen nachstemmend, auf den dicken Schwielen, welche jene bedecken, vorwärts und wühlt nun, mehr die Gewehre als die Rüsselscheibe benutzend, tiefe Furchen aus, um zu seiner Lieblingsnahrung, Pflanzenwurzeln und Knollen, zu gelangen. Nebenbei äst es sich, ebenso wie andere Wildschweine, allerdings auch von thierischen Stoffen aller Art, insbesondere von Larven, Puppen, Käfern, Würmern und dergleichen, verzehrt Kriechthiere, vielleicht auch Lurche, und geht selbst Aas an.
Ueber den Hartläufer berichtet Sparmann annähernd dasselbe. »Man nennt«, so erzählt er, »diese Thiere Waldschweine. Sie leben in Erdhöhlen und sind gefährlich, indem sie wie ein Pfeil auf die Menschen losschießen und mit ihren langen Hauern einem den Bauch aufreißen. Man findet sie herdenweise beisammen, und auf der Flucht nimmt jedes ein Junges in den Rachen. Dies sieht höchst sonderbar aus. In Kamdebo vermischen sie sich mit Hausschweinen und zeugen fruchtbare Junge.« Spätere Berichterstatter stimmen Sparmann bei: »Ich wählte mir«, erzählt Gordon Cumming, »einen alten Eber zu meiner Beute, und drängte ihn vom Rudel weg. Nachdem ich zehn Meilen scharf hinter ihm her geritten war, begannen wir mit einander an einem ziemlich geneigten Gehänge hinabzureiten, und hier beschloß ich, mich mit ihm einzulassen. Als ich mich gegen ihn kehrte, hielt er augenblicklich in seinem Laufe inne und schaute mit den boshaftesten Augen mir entgegen. Der ganze Rachen schäumte vor Wuth. Ich hätte ihn leicht zusammenschießen können, wenn ich gewollt hätte, nahm mir aber vor, nicht eher zu feuern, als bis die Richtung seines Laufes wieder meinem Wagen zugewandt wäre. Er überraschte mich durch die Entschlossenheit, mit welcher er mir Stand hielt. Ich wurde hitzig und ging auf ihn los. Zu meinem nicht geringen Erstaunen wich er nicht im geringsten von seinem Wege ab, sondern trollte schließlich wie ein mir folgender Hund hinter meinem Pferde drein. Dies machte mich mißtrauisch; denn ich sah ein, daß der alte, listige Bursche nach irgend einem Schlupfwinkel sich zurückwende. Ich beschloß also abzusteigen und ihn zu tödten. Aber gerade als ich diesen Entschluß gefaßt hatte, fand ich mich in einem wahren Wirrsale von gewaltigen Höhlen, den Wohnungen der Erdschweine. Angesichts einer von ihnen stellte sich der Eber auf und verschwand, das Hintertheil zuerst einschiebend, vor meinen Augen mit ziemlicher Schnelligkeit, und ich sah ihn nicht wieder«. Nach den Beobachtungen von Smith ist das Warzenschwein ebenso furchtlos als boshaft. Es weicht dem Angriffe selten durch die Flucht aus, sondern stellt sich und nimmt gern den Kampf auf. Sein Lager schlägt es immer in Höhlen, unter Baumwurzeln oder unter Felsblöcken auf; in ihm wagen es bloß die geübtesten Jäger anzugreifen, weil es plötzlich hervorstürzt, mit größter Schnelligkeit rechts und links Wunden austheilt und bis zu seinem Tode den Kampf grimmig fortsetzt. Gerade ihrer Schwierigkeit wegen gewährt die Jagd den Eingeborenen hohes Vergnügen.
Heuglin urtheilt anders. »Trotz ihres ungeheueren Gewerfes und wirklich kräftigen Baues sind diese Schweine nicht sehr reizbaren Wesens und vertheidigen sich, selbst angeschossen, selten in dem Maße wie die europäische Art. Das Wildpret ist minder schmackhaft als das des europäischen Wildschweines, und sein Genuß verursacht nicht selten Durchfall und Unterleibsbeschwerden; weniger ist dies der Fall, wenn es vorher getrocknet und gesalzen worden ist.« Auch Schweinfurth bemerkt, daß er sich von der Ungenießbarkeit des Warzenschweinefleisches überzeugt habe; die Abessinier, Christen wie Mohammedaner, urtheilen also gewiß richtig, wenn sie ihre Haroja als unrein ansehen und von dem Genusse ihres Fleisches abstehen.
Im Jahre 1775 kam das erste lebende Warzenschwein nach Europa, und zwar vom Kap aus. Man hielt es geraume Zeit im Thiergarten von Haag und glaubte in ihm ein sehr gutmüthiges Thier zu besitzen; eines Tages jedoch brach seine Wildheit aus: es stürzte sich grimmig auf seinen Wärter und brachte diesem mit seinen furchtbaren Hauern eine tödtliche Wunde bei. Einer Bache des Hausschweines, welche ihm in der Hoffnung beigegeben worden war, daß es sich mit derselben paaren werde, riß es den Bauch auf. Hinsichtlich seiner Nahrung unterschied es sich nicht von anderen Schweinen. Es fraß Getreide aller Art, Mais, Buchweizen, Rüben, grüne Wurzeln und sehr gern Brod. In der Neuzeit sind beide Arten in verschiedene Thiergärten gelangt; ich habe die eine oder die andere im Regentspark, in Antwerpen, Amsterdam und Berlin gesehen, einzelne auch längere Zeit beobachten können. Beide stimmen hinsichtlich ihres Betragens vollständig überein. Sie unterscheiden sich in ihrem Gebaren, nicht aber in ihrem Wesen von anderen Schweinen. Entsprechend ihres Höhlenlebens suchen sie sich auch in der Gefangenschaft zu verbergen, ziehen sich gern in den dunkelsten Winkel ihrer Koben zurück und vergraben sich so tief in ihrem Strohlager, daß sie manchmal gänzlich bedeckt werden. Beim Fressen und Wühlen fallen sie regelmäßig auf die Handgelenke und rutschen in der von Rüppell beschriebenen Weise so leicht und so ausdauernd auf dem Boden fort, daß man diese absonderliche Bewegung als eine ihnen durchaus natürliche erkennen muß. Ich will nicht in Abrede stellen, daß sie sich zähmen lassen; ein wirkliches Freundschaftsverhältnis aber gehen sie mit ihren Pflegern nicht ein. Sie nehmen ihnen erwiesene Wohlthaten gleichgültig, mindestens danklos entgegen, bekunden in keiner Weise Anhänglichkeit gegen den Wärter, sehen in diesem höchstens ein Wesen, welches das ersehnte Futter bringt und deshalb unter Umständen willkommen ist. Wagt es der letztere, die Oberherrlichkeit des Menschen ihnen gegenüber geltend zu machen, so reizt er ihren leicht entzündbaren Zorn, erregt sie aufs höchste und erweckt trotzigen Widerstand. Unter solchen Umständen flößt ihnen die empfindlich gehandhabte Peitsche oder der Knüppel heilsame Furcht ein, bringt sie jedoch keineswegs zum Nachdenken und zur Erkenntnis, sondern bändigt sie höchstens für den Augenblick. Am nächsten Tage treiben sie es genau ebenso wie früher. Die Bachen sind milderer Art als die Keuler, welche namentlich während der Brunstzeit geradezu gefährlich werden können, aber ebensowenig verläßlich und demnach zu freundschaftlichem Verkehre ebensowenig geeignet wie diese. Ueber Fortpflanzung gefangener Warzenschweine habe ich bis jetzt noch nichts vernommen, wüßte indeß keinen Grund anzugeben, weshalb die Thiere nicht auch hier zu Lande sich paaren und Junge erzeugen sollten.