
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die neue ›Judith‹ hat deutlich gezeigt, wie hoch das Deutsche Theater alle andern berliner Theater überragt, aber nicht, wie hoch es selber ragt. Nach ›Don Carlos‹ und ›Der Widerspenstigen Zähmung‹ kommt dieser Vorstellung nur die Bedeutung eines Nebenwerkes zu. Aber selbst wenn sie das Verständnis für Hebbel in ungeahnter Weise auszubreiten fähig wäre: der Dichter, zu dessen Popularisierung neuerdings so viel geschieht, wird dennoch niemals populär werden. Dazu ist er weder borniert noch genial, weder gläubig noch ungläubig genug. Er steht zwischen den Zeiten, zwischen den Stilen, zwischen den Weltanschauungen, »fremd und daheim hier oben, so da unten fremd und daheim«. Er hat zu wenig Interesse an der primitiven Judith der Bibel und zersetzt seine modernere Gestalt zu sehr mit der eigenen Unnaivität, als daß die Überzeugungskraft des Lebens von ihr ausgehen könnte. Er gleicht selbst ein bischen dieser seiner Judith, die weder Jungfrau noch Weib ist und von ihrer Unjungfräulichkeit das Ahnungsvermögen, von ihrer Unweiblichkeit den Mangel an realer Greifbarkeit hat. Bei Judith wie bei Holofernes besteht ein Zwiespalt zwischen Seele und Körper. Es wächst das Riesenmaß der Leiber weit über Irdisches hinaus, wie es sich für alttestamentarische Helden gehört. Aber diese Helden fühlen mit den Nerven des neunzehnten Jahrhunderts und denken mit dem Kopfe Hegels. Shaw würde für solchen Anachronismus die einheitliche Kunstform finden, und wenn es die entschlossene Auflösung jeder Kunstform wäre. Der sechsundzwanzigjährige Hebbel hat naturgemäß nicht die Überlegenheit, die letzten Konsequenzen zu ziehen. Er sieht da noch pure Tragik, wo sich von einem höhern Standpunkt Tragikomik, von dem höchsten wie von dem niedrigsten Standpunkt pure Komik sehen ließe. Man muß Nestroy heißen, um den Fall Judith mit einem Faungekicher zum besten zu geben. Aber gerade auch das allerklarste Auge und der allerreinste Sinn könnte hier in shakespearehafter Ruhe die Komödie des Uterus erblicken. Ihr Leitmotiv wäre das Wort des Holofernes: »Um mich vor dir zu schützen, brauch ich dir blos ein Kind zu machen.« Hebbels pathetischeres Leitmotiv lautet: »Das Weib ist in den engsten Kreis gebannt; wenn die Blumenzwiebel ihr Glas zersprengt, geht sie aus.« Das ist das Geschick seiner Judith, auf das sich die Menge nicht einlassen will.
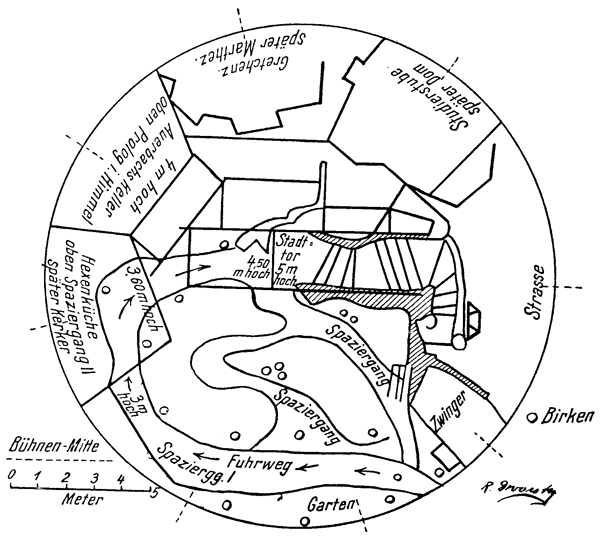
Grundriß der Faust-Einrichtung auf der Drehbühne des Deutschen Theaters.
Gezeichnet vom Maschinerie-Inspektor Dworsky
Erläuterung zu dem umstehenden Grundriß der Faust-Einrichtung
Bei der Faust-Einrichtung des Deutschen Theaters ist die Drehbühne nicht mit in ihrer ganzen Fläche, sondern auch in der Höhe ausgenutzt worden. So beginnt gleich der Prolog im Himmel auf einem Schauplatz, der auf dem festen Gewölbe von Auerbachs Keller, vier Meter über der Bühne, aufgebaut ist. Für die zweite Szene wird die Bühne dann um eine Viertelwendung gedreht: das Studierzimmer steht fertig da. Eine weitere Drehung der Bühne (um eine Hälfte) bringt die dritte Szene: ›Spaziergang‹ an die Rampe. Dieser Teil vor dem Tor ist auf hügeligem Terrain aufgebaut, das von ebener Erde in der durch Pfeile angedeuteten Richtung immer höher ansteigt, bis an dem Stadttor die Höhe von fünf Metern erreicht ist. Hinter dem Stadttor, dem Zuschauer verborgen, geht die Eisenkonstruktion (die durchweg eine Tragfähigkeit für etwa sechzig Menschen hat) noch bis zur Höhe von sechseinhalb Metern, das heißt: bis zu dem Gipfel des Berges, auf dem später die Walpurgisnacht sich abspielt. Die Eisenkonstruktion schafft, sobald sie die (auf der Zeichnung angegebene) Höhe von drei Metern erreicht, größere Hohlräume, die als Hexenküche (später Kerker) und als Auerbachs Keller eingerichtet werden. Anderseits wird in dem winklig-malerischen Straßenbild die Höhe der hinter dem Stadttor bis zu sechseinhalb Metern hinaufgeführten Eisenkonstruktion durch zahlreiche kleine Steinstufen erreicht.
Vor Beginn der Vorstellung sind fertig aufgebaut: Prolog im Himmel, Studierzimmer, Spaziergang, Gretchens Zimmer, Zwinger, Straße. In der ersten Pause wird auf dem Terrain des Spaziergangs der Garten, in der Hexenküche der Kerker, desgleichen Dom und Marthe-Zimmer an Stelle der Studierstube (oder des Gretchenzimmers) eingebaut. Es bleibt dann in der zweiten Pause nur übrig, die Dekorationen von Straße, Gretchenzimmer, Dom, Zwinger fortzuschaffen und das für die Walpurgisnacht fertig aufgebaute Terrain durch plastische Felsen und Bäume zu ergänzen.
Warum nicht? Weil Judiths Tat und Wesen übermotiviert sind, statt auf ein paar faßbare Grundlinien gebracht zu sein. Es geschieht vom Dichter so viel, sie zu erklären, daß sich bei dem gröbern Betrachter unwillkürlich ein Mißtrauen gegen die Naturnotwendigkeit dieses Gebildes regt. Organismen zeugen selbstverständlicher von und für sich. Der dritte Akt ist das Gegenbeispiel zu den Szenen der Judith und des Holofernes. Er wirkt auf dem Theater genau so zuverlässig immer, wie sie niemals wirken. Denn er ist, mit allen seinen Reden, doch gestaltet. Hier ist, ohne einen kleinlichen naturalistischen Zug, das frappanteste Bild gelungen, weil ja für die Atmosphäre der Zeit und den Geist Alt-Israels gerade nichts charakteristischer ist als diese spintisierenden Debatten, diese epigrammatischen Sentenzen, diese langatmigen Reflexionen. Es ist lehrreich, daß die ausgedehntesten Reden, wenn sie nur dem Gehirn des Redners entspringen, nicht imstande sind, den Gang des Dramas aufzuhalten. Wo Bethuliens Bürger noch so gemächlich sprechen, gehts wie im Sturmlauf vorwärts. Wo mit Judiths Zunge Hebbel spricht, fühlt sich die Menge durch Schwerfälligkeit gelangweilt.
Wir andern sind auch da unausgesetzt gefesselt. »O, hier ist ein Wirbel!« sagt Judith von sich selbst. Es wäre schöner, wenn sie darüber weniger deutlich Bescheid wüßte; aber es ist immer noch besser, daß sie selber, als daß irgend eine Art Räsonneur uns darüber Bescheid gibt. Um an diesem Wirbel nicht nur eine geistige, sondern auch eine künstlerische Freude zu haben, brauchen wir blos die umgekehrte Arbeit zu leisten, wie bei Ibsen. Dort müssen wir zwischen den Zeilen, hier müssen wir über die Zeilen hinweglesen können. Alle magischen und fatalistischen, mysteriösen und mystischen, visionären und somnambulischen Elemente reichen nämlich nicht aus, Judiths Charakter den Schein der Unbewußtheit zu geben. Sie treibt die raffinierteste Autopsychologie. Sie schwankt wie ein Schiff auf den Wellen und legt sich und uns über jede Schwankung Rechenschaft ab. Sie verachtet ihr Volk um seiner Jämmerlichkeit und bemitleidet es um seines Jammers willen. Sie ist von religiösem Fanatismus wie besessen und hadert doch mit ihrem Gott. Bald fühlt sie sich berufen und bald der hohen Sendung unwert. Sie schaudert vor den Männern und sehnt sich brünstig nach dem Manne. Von Holofernes ist sie zugleich entsetzt und hingerissen. Geschlechts- und Vaterlandsliebe, Ehrgeiz und Wollust kämpfen einen wilden Kampf in ihr. Sie will ihn morden, weil er sie in der Trunkenheit geschändet hat. Sie kann ihn doch nicht morden, weil sie trotzdem den Mann anbeten muß, der sie bewältigt hat. Sie muß ihn aber morden, weil sie ihm auch das zweite Mal, amens libidine, nicht widerstehen würde, und weil ihr davor graut. Sie mordet ihn, um in einen neuen Taumel der gegensätzlichsten Sensationen zu fallen. Sie prahlt mit ihrer Tapferkeit – denn sie erschlug den Holofernes – und sie verabscheut sich um ihrer Feigheit willen – denn sie erschlug ihn, als er schlief. Ihr Volk ist frei, doch, ach, die Welt ist leer. Sie will dem Holofernes keinen Sohn gebären, und wenn das nicht das letzte Wort der Dichtung wäre, so würde sie sich im nächsten Augenblick selig preisen, daß sie ersehen ist, den Halbgott fortzupflanzen. O, hier ist ein Wirbel, der uns mit seiner wie auf Eis gestellten Glut bald anfröstelt und bald erhitzt.
Was Reinhardt und seine Leute mit der Tragödie gemacht haben, wird weder Liebe noch Haß zum Sieden bringen. Es ist, als Ganzes, die beste aller berliner, aber bei weitem nicht die beste aller möglichen ›Judith‹-Aufführungen. Worin sie, dank einer stilsichern, geschmacksverfeinerten und eindringenden Regie, über die Vorgänger hinauskommt, ist: Übersichtlichkeit, die nicht Pedanterie; Einfachheit, die nicht Armut; Farbigkeit, die nicht Grellheit; Kontrastfreudigkeit, die nicht Schematismus wird. Was fehlt, weil es den Schauspielern fehlt, ist: Wildheit, Sturm, Überlebensgröße. Man sieht abwechselnd das Zelt (warum nicht, wie bei Hebbel, auch das Lager?) des Holofernes und im eingeschlossenen Bethulien das Gemach der Judith und den Platz am Tor. Dort ist heidnische Üppigkeit und bildhafter Zeremonienpomp, der freilich weniger langsam abgewickelt werden sollte. Hier ist Hungersnot. Plumpes Mauerwerk, kyklopisch aufgewälzt, wie Mephisto sagen würde, grenzt den Platz nach hinten; eine niedere Wand, die ein technischer Behelf ist und in keiner Wirklichkeit vorhanden sein muß, grenzt ihn nach vorne ab. Dazwischen schiebt sich, zu ebener Erde, unterhalb der ebenen Erde und darüber, die verzweifelte Judenheit, Männlein und Weiblein aller Altersstufen, bald aufgepeitscht und bald phlegmatisch, hin und her. Es ist Reinhardts Stärke, solch ein Gewimmel abzustufen und es zu individualisieren, es mit Affekten zu erfüllen und davon zu befreien. Hier gibt es brütende Schwüle vor dem Gewitter und eine Entfesselung der Elemente, die nach musikalischen Gesetzen vor sich geht. Nicht in ungestümem Durcheinander, sondern chorartig, in gemessenen Abständen, mit Ritardando und Accelerando, setzt sich der Wunsch, Assad zu steinigen, und hin zu Daniel zu gelangen, in die Tat um. Die Abstraktion ›Volksseele‹ gewinnt einen runden, riesigen Körper, der zugleich voller Leben, zugleich voller Rhythmus ist. Aber wenn Daniel bei Schildkraut, Samuel bei Pagay und Ephraim bei Hartau ist, so kommen innerhalb dieses Massenschicksals auch die Einzelschicksale zur rechten Geltung. Es ist, selbstverständlich, falsch, die Bethulier jüdeln zu lassen; aber es ist von bezwingender nationaler Echtheit, wie Hartau mit den Händen spricht, die Fingerspitzen aneinanderlegt und seine schwarzen Locken trägt. Pagay wirkt wie ein Gemälde von Israels, und Schildkraut weiß, ohne deshalb aus der Bescheidenheit der Natur in ein gefährlich nahe liegendes Virtuosentum zu verfallen, daß der Ausbruch seines Stummen der Gipfel des ganzen Aktes ist. Soll man vor dieser Fülle der Gesichte, vorüberhuschender und einprägsam verweilender Gesichte, zum Bagatellenrichter werden? Etwa rügen, daß Judith in einem andern Kleid zu Holofernes zieht als bei ihm eintrifft? Daß in seinem abendlichen Zelt, in dem der Judith die unverschämte Helligkeit der Lichter Grund zur Klage gibt, nicht Licht, nicht Kienspan und nicht Fackel zu erspähen ist? Dies und andres mehr ist so unwichtig, daß es gar nicht erwähnt werden dürfte, wenn es nicht für die Aufführung charakteristisch wäre, daß man dergleichen überhaupt bemerkt. Es zeugt wider Judith und Holofernes und ihre künstlerische Bannkraft.
Man kann Wegener und die Durieux nicht höher schätzen, als ich es tue: aber diesen Gestalten reichen sie nur bis an die Hüften. Was ist Holofernes, sobald er kein Dämon ist, sobald sich seine haarspalterischen und doch brausenden Satzungetüme nicht aus einem vor Genialität verrückt gewordenen Gehirn erwühlen? Ein unmöglicher Bramarbas. Aber was ist er, wenn sein Größenwahnsinn auf eine vernünftige Basis gestellt, sein angemaßtes Übermenschentum menschlich erklärt und sein Blutdurst durch Anfälle von Wohlwollen gemildert wird? Wegener spürt, daß er mit seinem Naturell dem philosophisch rasenden Despoten nicht gewachsen ist, und unterschlägt die Raserei. Auch wo er sie, im Weinrausch, zu erzwingen sucht, bleibts eine sorgsam überlegte Raserei. Er gibt ein krasses Beispiel, daß der denkende Schauspieler nicht immer noch eins so viel wert ist, sondern manchmal halb so viel wert sein kann. Holofernes braucht nicht so auszusehen, wie Judith ihn in ihrer Ekstase sieht, und Wegeners großverzerrte, phantastisch-furiose Mongolenfratze ist an sich kein schlechter Einfall. Aber darf der halbgottartige Gebieter fühlen lassen, was es ihn für Anstrengungen kostet, den Trabanten Gegenstand der Anbetung zu sein? Diese selbstverständliche Anbetungswürdigkeit, wo sie nicht eingeboren ist, zu mimen, geht vielleicht über die Kunst eines Schauspielers. Nur daß ich nicht recht weiß, warum man ohne Not den Holofernes einem Künstler abverlangt, dem er nicht eingeboren ist. Oder mußte ›Judith‹ unbedingt gegeben werden?
Doch wohl nicht, da auch die Durieux nicht mehr als eine halbe Judith ist. So schreiten keine irdischen Weiber, hieß es von den Judiths der Vergangenheit. Die Durieux hat das Verdienst, die Gestalt den Heroinen entrissen und sie zum ersten Mal vollkommen vermenschlicht zu haben. Nur daß damit ebenso vollständig der heroische Unterton, die heimliche Musik eines weltgeschichtlichen Geschehens verloren gegangen ist, die einfach darum mitschwingen muß, weil Judiths Tat ja wirklich keine Privatangelegenheit ist, sondern der Befreiung eines ganzen Volkes dient. Die Durieux mordet den Rächer ihres Halbmagdtums, nicht den Bedroher Israels. Wenn sie unter die Juden tritt, wird sie von ihnen übertönt, und man weiß sofort, was ihrer Leistung mangelt. Aber es ist nicht blos die physische Kraft. Man möchte ihr einen Tropfen Sehertum in ihr Blut gießen, das, alles in allem, nur die erotischen Anforderungen der Rolle erfüllt. Sie freilich mit einer kostbaren Differenzierungsgabe, die den ›Wirbel‹ des vierten Aktes bis in seine letzten Feinheiten versteht, und mehr: mit einem Paroxysmus der Leidenschaft, der die Qual dieses Wirbels auch überträgt. Aber weder vorher noch nachher ist die Judith der Durieux Hebbels Judith; und so hat auch Reinhardts ›Judith‹ noch nicht Hebbels ›Judith‹ werden können.