
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In diesem Abschnitt hören wir von Schneezahn und Schlitzohr und von ihrer neuen Herde, von einem dummwütigen Nashorn und von einem großen Gaur, der die Streifenkatze besiegt. Dann aber hören wir von einem Leoparden, der von Toomai und Appa getäuscht wird und in die Grube fällt und von dem Schrecken, den die Elefanten in der Siedlung machen. Wir hören auch von Pudmi, dem alten Rogue, und von dem Geheimnis des fremden Freundes. Dann hören wir, wie der Maharadscha Radha bewundert, wie Radha nach der heiligen Stadt kommt und ein Reitelefant wird. So kommt auch Mali zum Maharadscha und Ghautal auch.
Jahre vergingen, viele Jahre. –
Schneezahn hatte sich einer großen Elefantenherde angeschlossen, und Schlitzohr, die alte erfahrene Kuh, war ihm gefolgt. Als wieder die Zeit des großen Elefantentanzes kam, und die Dschungelriesen oben in den Hills einen neuen großen Tanzplatz festtrampelten, forderte Schneezahn den Sultan der Herde zum Kampf heraus und besiegte ihn nach langem, gefährlichem Ringen. So kam es, daß Schneezahn endlich doch Sultan einer größeren Herde wurde und Schlitzohr zur Leitelefantin machte. Wie immer zog man zur Trockenzeit in die Niederungen und in der Regenzeit nach den Hügeln. Die Elefanten richteten in den Pflanzungen der Menschen große Verheerungen an, denn Schneezahns Art war böse und gewalttätig. Darum liefen viele Klagen bei der Regierung ein und auch bei dem greisen Sir Charles, den man um Hilfe bat. Wieder schickte die Regierung große Mengen von Spähern und Spürern in das Dschungel; denn man hatte beschlossen, die Elefantenherde einzufangen.
Einmal hörten die Elefanten schrecklichen Lärm. Sie standen am Fuße der Hügel und rupften sich Zweige von den Bäumen, als unverhofft das Schnauben, Grunzen und Prasseln im Elefantengrase ertönte. Sie warfen die Rüssel hoch und nahmen Wind, um sich von der Art des Lärmes zu überzeugen und festzustellen, ob Gefahr vorhanden. Da knatterte auch schon das Elefantengras dicht vor ihnen, und ein großes Nashorn fuhr schnaubend mitten unter sie. Zuerst erschraken die Elefanten und stoben nach allen Seiten auseinander, dann aber wurde Schneezahn zornig und raste trompetend hinter dem Nashorn her. Am Abhang des Hügels holte er das sinnlos zornige Tier ein, das sich ihm mit wütendem Grunzen entgegenwarf. Das Nashorn stieß von unten her nach dem Leib des Elefanten, der aber wich aus und bohrte ihm von der Seite die Stoßzähne in den Rücken. Nun quiekte das Nashorn wie ein erschrecktes Schwein und setzte seine Flucht fort. Stolz kehrte der Sieger zu seiner Herde zurück. Schlitzohr hatte lange darüber nachgedacht, was wohl das Nashorn in Schrecken versetzt haben könnte. Ohne sich um den Kampf zu kümmern, nahm die alte erfahrene Elefantin immer von neuem Wind und zog langsam nach der Stelle hin, von der aus das Nashorn gekommen war. Es war eine kleine Lichtung im Dschungel, wo Schlitzohr erschreckt halt machte; denn eine große Menge brauner Menschen bewegte sich drüben am Rande des Dschungels und zog in Richtung auf die Hügel. Da kehrte die alte Elefantin geräuschlos um, lief nach der Herde zurück, gab den Warnungsruf und rannte in großer Eile in die Schlucht des Hügellandes hinein, die stampfende, schnaubende Herde folgte ihr. »Das Zweibein ist auf Jagdwegen!« Nun wußten alle Elefanten um die Gefahr und flüchteten in das weite Hinterland der waldigen Hügel.
Breithorn, der alte mächtige Gaurbulle, der sich im kleinen Sumpfsee gebadet hatte, um seinen Körper mit Schlamm zu bedecken gegen die Stechfliegen und Hautbremsen, hatte das Fortdonnern der Elefanten vernommen und war erschreckt ans Ufer gegangen. Jetzt zog er Wind ein und stellte scharfe Zweibeinwitterung fest. Er fürchtete sich im Grunde nicht allzusehr vor Menschen, denn er war streitbaren Gemüts. Daß aber das Nashorn mit allen Zeichen des Schreckens an ihm vorbei gerast war und die Elefanten sogar fortpolterten, stimmte ihn bedenklich, und er beschloß, diesmal das Feld zu räumen, da anscheinend große Gefahr vorlag. Er schob sich ganz langsam und trotz seiner Größe und Schwere geräuschlos durch das Dschungel, von Zeit zu Zeit rückwärts sichernd und Wind in die Nüstern nehmend.
Schmettertatze, eine noch junge, aber sehr starke Tigerin, hatte die halbe Nacht und den ganzen Morgen vergeblich auf Hirsche gejagt und auf Schweine gelauert. Sie war sehr hungrig; denn im Busch warteten ihre zwei Jungen auf Nahrung, und eine säugende Mutter braucht mehr als ein Tiger, der nur für eigene Rechnung jagt. Als die Tigerin den Gaur erblickte und bemerkte, daß die ganze Aufmerksamkeit des Bullen nach rückwärts gerichtet war, glaubte sie einen Handstreich wagen zu dürfen, trotzdem auch der stärkste Tiger im allgemeinen den streitbaren Gaur meidet. Sie war gierig, die Tigerin und zornig zugleich. Dennoch empfand sie etwas wie Furcht, als sie sich vom Boden abschnellte und dem Gaur ins Genick sprang. Es ist aber ein altes Gesetz bei den Tieren der Wildnis und auch bei den Menschen: Wer sich fürchtet, verliert. Der Gaur schnaubte wild, schüttelte sich, spreizte die dicken stämmigen Läufe, machte mitsamt seiner Last einen hohen Bocksprung und raste mit seiner fauchenden Reiterin durch den Busch. Er erreichte einen mächtigen alten Rotholzbaum, machte den Rücken rund und preßte seine Feindin gegen den Stamm. Der Griff der Tigerin lockerte sich, ein kreischendes, gequältes Mauzen tönte, ein furchtbarer Angst- und Schmerzenslaut! Dann knirschten und krachten Knochen, und die gestreifte Katze fiel zuckend zur Erde. Der verwundete Gaur schnaubte vor Wut. Er stieß mit den großen, langen Hörnern nach dem Leib der Tigerin, er spießte sie auf, warf sie in die Höhe, schmetterte sie wieder gegen den Baum und zertrat sie endlich auf dem harten Wurzelboden. Dann zog er, aus vielen Wunden blutend, langsam den Hügeln zu. Jedes Tier der Wildnis hat seinen Balsam im Blut. Der Gaur mußte viele Wochen Schmerzen dulden, doch das Fell eines Büffels ist am Genick stark und fest, und selbst des Tigers Zahn kommt nicht leicht ins pulsende Leben, wenn er nicht zufällig die großen Adern an den Halsseiten trifft. Die Wunden schwärten und eiterten, denn giftig ist der Biß des Tigers, giftig sein Krallenriß. Faule Fleischreste von früherem Raube sind fast stets zwischen den Zähnen und in den Rillen der Krallen. Auch sammeln sich Fliegen auf den Wunden und Schmutz von schlammigen Tümpeln. Dennoch hielt Breithorn, der Gaur, aus, aber mächtige Narben, tiefe Risse blieben in seiner Haut.
Sir Francis, der mit Toomai und Appa an der Spitze des kleinen Späherzuges ging, hörte das Nashorn schnauben und die Elefanten stampfen und auch das Wutgrunzen und Blasen des Büffels und den Todesschrei der Tigerin. »Ei«, sagte er zu Appa: »Heute ist ja großer Kampftag im Dschungel, wie mir scheint«, und er ging auf der Büffelfährte weiter, um zu sehen, was wohl geschehen sei. Es dauerte auch nicht lange, bis der Kampfplatz erreicht war. Auf den großen Brettwurzeln am Boden lag der zerstoßene, zerrissene Leib der starken Tigerin. »Das hat der Gaur gemacht«, meinte Toomai. »Er wird sehr zornig sein, darum ist es gut, wenn wir wieder fortgehen; denn der Gaur und der Wasserbüffel sind stärker als der Tiger und fürchten selbst Elefanten und Nashorn nicht.« Der Engländer schnitt sich ein paar Krallen ab zum Andenken, und Toomai, Appa und Machua taten desgleichen; denn die Krallen des Tigers sind ein gutes Amulett und schützen vor Krankheit und Gefahr. Dann gingen die Späher weiter und zogen in die Hills hinein, immer den Elefantenfährten nach, die wie ein breiter Pfad durch Gras und Buschwerk gestampft waren.
Am Abend erreichten die Männer Toomais und Appas kleine Siedlung im Busch. Sie kletterten die steilen Leitern zu den Pfahlbauten hinauf und begaben sich zur Ruhe. In der Nacht erhob sich ein ängstliches Geschrei der Haustiere. »Es ist wieder ein Tiger in der Fenz, oder ein Getüpfelter«, meinte Machua. Es war aber dunkel draußen, denn es stand kein Mond am Himmel, und nur einzelne Sterne blinkten durch die Wolken. Als die Männer am anderen Tage nach dem Ziegenstall kamen, fanden sie drei Ziegen Toomais tot. Die vierte aber war vom Leoparden fortgeschleppt und außerhalb der Fenz in Stücke gerissen. »Er ist ein grausamer Töter, der Getüpfelte«, sagte Machua, »er ist schlimmer, als der Gestreifte; denn er tötet nicht nur zum Fraß, er mordet auch zum Vergnügen.« Die Männer hielten Rat ab, und es wurde beschlossen, daß der weiße Sahib auf einem Baum beim Eingang des Zaunes lauern sollte, denn man konnte denken, daß der Leopard in der nächsten Nacht wiederkommen würde oder schon am Abend, überall wurde die Fenz geschlossen, in der Zaunlücke aber legte man eine große, mit Bambusstangen verdeckte Grube an, auf die Bambusstangen kamen Farne, Moos, feine Zweige und Blätter, über die Grube hängte man dann eine Puppe aus Stroh, die ganz die Form eines Mannes hatte. Als Sir Francis nach dem Sinn dieser Puppe fragte, meinte Toomai, sie stelle einen Zauber dar. Doch der alte Appa lächelte und sagte: »Man nennt die Puppe einen Zauber, und früher dachte man auch, sie halte den Leoparden und den Tiger ab. Jetzt braucht man diesen Zauber zu anderen Dingen: man täuscht den Leoparden, und du wirst sehen, Sahib, wie gut solch eine Puppe ist! Der Leopard ist zornig, wenn man auf ihn schießt, und mutiger als jeder Tiger. Auch springt er höher als der Gestreifte und klettert gut auf Bäume. Darum bist du oben auf dem Baume nicht sicher vor seiner Rache. Wenn aber der Getüpfelte den Zauber sieht, so denkt er, die Puppe sei ein Mann, und dieser habe auf ihn geschossen. Du wirst sehen, wie gut es ist, eine solche Puppe aufzuhängen.«
Schon früh am Abend saß Sir Francis auf seinem luftigen Sitz, ein paar Stangen, die Machua und Toomai zwischen zwei große Äste gebunden hatten. Es war ein schöner kühler Abend, so kühl, wie er in Indien überhaupt sein kann, und es gab auch wenig Moskitos. Es war sehr still im Busch, und selbst die Affen machten wenig Geräusch in den Wipfeln. Nur einige Atzeln und Stare zwitscherten und krächzten, und ein kleiner Schwarm Sittiche schwirrte durch das Geäst der Rotholzbäume und klammerte sich drollig kletternd an die Stengel und Ranken der Lianen. Es war noch nicht dunkel, als plötzlich vor der Fenz ein Leopard erschien, ein prächtiges, besonders starkes Stück. Er kam an die Stellen, an denen früher Durchlässe im Zaun gewesen waren, und scharrte unwillig mit den Pranken, mied es aber, über den dornigen, hohen Wall zu klettern. So kam er in die Nähe der Grube, neben der der Jäger auf seinem Hochsitz hockte. Da krachte auch schon Sir Francis Schrotflinte, und der Hagel fuhr der großen Katze in die Rippen. Kreischend und wutfauchend fuhr der Leopard auf die Puppe los! Er krallte sich an die Lumpen, er biß in Lappen und Stroh, er gröhlte. Die Puppe tanzte, schwankte hin und her am dünnen Strick, drehte sich wirbelnd. Da gab es plötzlich einen knackenden Ton, der halbdurchschnittene, schwache Strick riß, und die Puppe fiel mitsamt dem Leoparden in die Tiefe! Blätter rascheln, knistern, ein dumpfer Fall – Leopard und Zauber waren tief unten in der Grube. Jetzt hielt es Sir Francis nicht mehr auf seinem Hochsitz aus. Eilig kletterte er herunter und lief zur Grube. Da sah er unten im ungewissen Grau einen dunklen Schatten und zwei grünlich phosphoreszierende Lichter. Er zielte und schoß. Die Lichter unten erloschen. Da kamen auch schon Machua und Toomai mit Fackeln, und der alte Appa mit einem langen Seil. Machua ließ sich in die Grube herunter, band den toten Leoparden an den Strick und zog ihn samt der Puppe nach oben. »Siehst du nun, o Sahib, wozu solch Zauber gut ist?« fragte Appa lachend. »Wäre nicht die Puppe dort gewesen, so hätte der Getüpfelte dich da oben auf dem Baum besucht, und wer weiß, ob du ihn mit dem zweiten Schuß getroffen hättest, denn solch Panther ist schnell.«
So lernte Sir Francis eine neue Art zu jagen kennen.
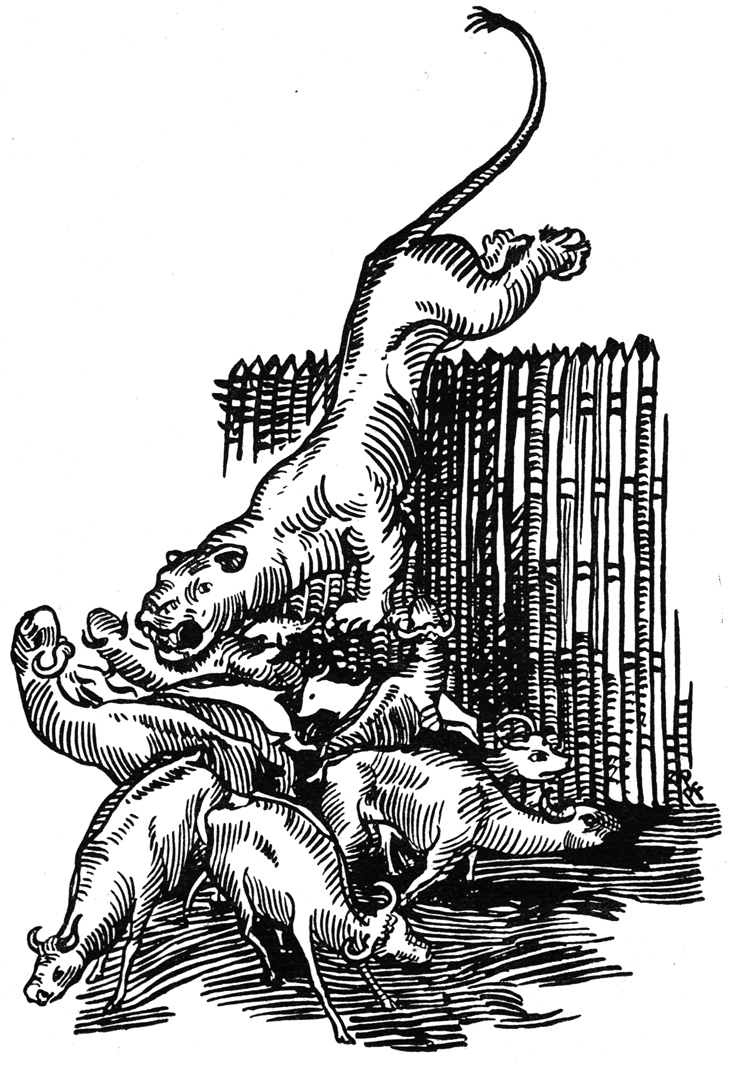
Als die Trockenheit schon auf der Höhe war, zog Schneezahn mit seiner Herde in die Niederung. Er war vorsichtig geworden, denn überall witterte sein Rüssel Menschengeruch. Aber er war auch zornig auf die Zweibeine, die überall und immer seinem Pfade folgten. So hatte die Herde eines Abends ein Hindudorf am Rande des Dschungels erreicht und brach trampelnd und rupfend in die Pflanzungen ein. Im Dorf hörte man Schreien, Schreckschüsse donnerten und Fackeln lohten auf. Da packte Schneezahn großer Groll. Er warf den Rüssel auf, trompetete und donnerte wutschnaubend gegen das Dorf vor. Die ganze Herde polterte hinter ihm her. Dunkle Gestalten huschten aus den Hütten, sprangen herab, liefen schreiend in den Busch. Die Fackeln verloschen. Die Elefanten rissen mit den Rüsseln an Pfählen und Stangen, sie stemmten sich mit Schultern und Stirn gegen Balken, sie drückten rückwärts schreitend die Wände krachend ein! Schilfdächer rauschten nieder, es klirrte und prasselte, es krachte und polterte, schwere Säulenfüße zertraten berstendes Gerät, mächtige Rüssel schleuderten Hausrat und Dachsparren wirbelnd durch die Luft. In wenigen Augenblicken war das Dorf dem Erdboden gleichgemacht. Die wütenden Elefanten zogen trompetend ins Dschungel zurück. »Sie wollen uns jagen,« triumphierte Schneezahn, »jetzt haben wir sie!« Nur die alte Elefantin Schlitzohr war nachdenklich und ängstlich, denn sie wußte wohl, daß die Zweibeine jetzt um so hartnäckiger der Herde folgen würden; denn nichts ist dem Menschen teurer als sein Besitz.
*
Pudmi, der Alte, lebte nach wie vor in seinem Tempel und hütete das Heiligtum der Götter. Er hörte Elefanten stampfen auf ihrem Wechsel, er begegnete ihnen in heller Mondnacht, aber er schloß sich ihnen nicht an. Einsam ist der Rogue.
*
Der alte Oberst Hutchison hatte in jungen Jahren in Indien gedient, war dann gegen den tollen Mahdi gezogen, tief im Sudan. Hatte als alter Kapitän schon die Kämpfe gegen die Massai mitgemacht, und dann ein Lancer-Regiment im Hindulande befehligt. Jetzt war Sir Herbert Hutchison längst pensionierter Oberst und beschäftigte sich mit der Jagd und ähnlichen angenehmen Dingen. Gewöhnlich lebte er in seinem Bungalow in der Nähe der Farm seines Freundes Charles Bridgeman, den er häufig besuchte. Mitunter fuhr der Alte auch an die See zum Hafen, um sich die Schiffe anzusehen und ihre Passagiere. Er traf dort mitunter Bekannte, die Indien verlassen wollten oder aus England kamen. Dort saß er still, seinen Whisky und Soda trinkend, auf der Veranda des Klubs und beobachtete die Offiziere, Matrosen und Reisenden, die sich, während man die Bunker ihres Schiffes füllte, in den Kaffeehäusern herumtrieben. Bunt genug ist das Leben ja mitunter an diesem großen Handelsplatz; die Hafenstadt hat der Gelegenheiten gar viele für den Ortskundigen und für den Mann, der es nicht vergaß, Geld in seinen Beutel zu tun. Angefangen von guten Kaffeehäusern, Restaurants und Klubs bis zu Spelunken übelster Art, von der Bajadere bis zum Pariamädchen, von Flötenhäusern für Matrosen bis zu geheimen Lasterhöhlen jeglicher Art. Dort traf auch Sir Francis eines Tages wieder mit dem alten Oberst, der ihm einst auf der Jagd den Tiger weggeschossen hatte, zusammen. Der Oberst hatte wie immer einen roten Fes auf dem schlohweißen Haupthaar, eine Angewohnheit, die er aus dem Sudan mitgebracht hatte. Sein verrunzeltes, verwittertes Gesicht war ein echtes, altes Soldatengesicht mit kurzgeschnittenem weißen Schnurrbart und grauen, jugendlich blitzenden Augen unter dichten, schwarzen Brauen. Sir Hutchison bot Francis die Hand, lächelte freundlich und sagte in seiner stillen Art: »Guten Abend, mein Lieber, ich wartete auf Sie!« – »Ich wußte nicht, daß Sie auch Hellseher sind, Oberst,« erwiderte Francis, aber ich bin nun mal hier und ... wollen wieder nach dem Oberlande auf Elefantenfang, nicht wahr? Da käme ich gern mit.« »Wahrhaftig, Oberst, Sie sind Hellseher, zum mindesten aber Gedankenleser«, meinte Francis lachend. »Muß schon morgen vormittag wieder fort.« »Freut mich. Sie getroffen zu haben, Kolonel, so wird mir die Zeit auch ohne Bajaderen und ähnlichen Unsinn nicht lang werden.« »Freut mich, ist schmeichelhaft für mich alten Herrn, daß Sie meine Gesellschaft der der hübschen Nauchgirls und Dancinggirls vorziehen. Wir wollen zusammen einen dicken Kaffee trinken und dann zu mir hinüber ins Hotel gehen.«
Nach dem Kaffee ließen sie sich noch ein paar eiskalte, sehr gute »White horse« mit Sodawasser geben, da es noch – wenigstens nach Meinung des Colonel – zu früh war und gingen dann ins Hotel. Nachdem sie gespeist hatten, begaben sie sich aus die Veranda und sahen sich das Gewimmel am Hafen im Scheine der vielen elektrischen Lampen an. Plötzlich wandte der Oberst seinem Freunde das Gesicht zu: »Halten Sie etwas von besonderen Begegnungen – wie soll ich sagen – von der Bedeutung gewisser Personen, denen wir öfter im Leben begegnen, und von gewissen Gefühlen, die wir nicht anders bezeichnen können als Ahnungen?«
»Ich bin weder Spiritist, noch glaube ich an Kartenlegerei und ähnliche Dinge,« erwiderte Francis, »aber ich gebe zu, daß es Gefühle gibt, die wir Ahnungen oder Vorahnungen nennen und die wir vorläufig uns noch nicht erklären können. Schon die alten nüchternen Römer waren nicht frei von solchen Ahnungen. Es gibt eben Dinge zwischen Himmel und Erde, von der sich unsere Schulweisheit nichts träumen läßt, wie irgendein deutscher Dichter gesagt hat ...«
»Die Menschen klammern sich an das, was sie hatten«, meinte der Oberst. »Haben sie im Kriege oder durch Krankheiten und Alter viele Angehörige verloren, so wollen sie sie wieder haben, und sei es als Geister. Das ist überall dasselbe in der Welt, überall gibt es Aberglauben und besonders in Ländern mit religiös eingestellter Bevölkerung. Hier in Indien glaubt man an Seelenwanderung, und in anderen Ländern an ein Leben nach dem Tode als Geist oder Gespenst oder als Palmenengel. Die Form wechselt, der Glaube ist im Grunde genommen derselbe. Wo fängt der Aberglaube an, wo hört der Glaube auf? Beide gehen ineinander über, denn wir Menschen sind eben unvollkommen. ... Aber es soll nicht plumper Aberglaube sein, von dem ich Ihnen heute erzählen will, kein Hokuspokus, kein Bericht von Fakirkunststücken, sondern eine Reihe von Erlebnissen, die ich hatte, und in denen immer eine bestimmte Person eine Rolle spielte, eine mir äußerst sympathische Erscheinung, ein Herr, den ich nicht kenne, und den ich nie gesprochen habe, der mir aber immer, wenn ich ihn ansah, wie ein alter Freund vorkam ...«
»Kein zweites Gesicht«, fuhr der Oberst fort. »Der Herr, den ich so oft gesehen habe, hat keine Ähnlichkeit mit irgendeinem meiner Bekannten. Ich glaube nicht an Seelenwanderung und meine auch nicht, daß der Herr eine Gestalt aus einem früheren Leben ist, die sich in meinem Unterbewußtsein eingegraben hat, nein, meine Erscheinung ist etwas anderes. Sie ist auch keine Ausgeburt überhitzter Phantasie, sie ist tatsächlich vorhanden und dennoch rätselhaft, rätselhafter als die merkwürdigsten Dinge, die ich sonst in Indien und anderen Ländern sah. Sie läßt mich jedesmal erschrecken, aber fast freudig, sie löst in mir eine Art Glücksgefühl aus, eine Zufriedenheit, Sicherheit ... Merkwürdig, so oft ich diesem Mann begegnete – es glückte mir niemals, ihn zu sprechen, ihn kennenzulernen. Und ich habe stets Sehnsucht nach diesem Menschen mit den großen dunklen Augen, wenn ich an ihn denke.«
»Beschreiben Sie ihn näher«, bat Francis.
»Er ist groß und schlank, eine sehr elegante Erscheinung. Gewöhnlich ist er schwarzgekleidet, aber ich sah ihn schon in britischer Uniform. Er hat einen dunklen Teint, trägt einen gepflegten kleinen Spitzbart – den sogenannten »Henry Quatre«. Sein Gesichtsausdruck ist schwermütig, aber ungemein sympathisch, freundlich und gut; große Klugheit, ja Weisheit spricht aus seinen Augen. Er ist dunkelhaarig, aber nicht schwarz, der Schnitt seines Gesichtes ist scharf und edel. Er sieht etwa aus wie ein alter spanischer Grande oder wie ein Edelmann aus der Zeit der Medici, vielleicht auch so wie manche Gesichter, die Tizian festhielt oder Velasquez. So könnte auch wohl irgendein alter Orsini ausgesehen haben.«
»Sie schwärmen, Colonel!«
Der Oberst lächelte matt. »Ja, ich schwärme. Lächerlich, so ein alter Soldat; nicht wahr? Aber wenn Sie es nicht ermüdet, will ich Ihnen die Geschichte erzählen. Wissen Sie, weshalb ich hier geblieben bin an dieser großen Verkehrsstraße? Weshalb ich nicht nach England zurückgegangen bin? Weil ich den Mann zweimal in Indien sah und weil ich weiß, daß er wieder hierher kommt. Ich weiß es, merkwürdig, nicht wahr? Ich werde meinem unbekannten Freunde hier begegnen, zum mindesten nicht weit von hier. Vielleicht besucht er mich in meinem Bungalow. – – – Ich habe das sichere Gefühl.«
Der Oberst trank aus seinem Glase, zündete sich eine neue Zigarette an und fuhr fort:
»Vor 30 Jahren etwa sah ich ihn zuerst. Er sah damals genau so aus wie vor 4 Jahren, als ich ihn zuletzt traf. Nur die Kleidung war anders. Übrigens möchte ich noch etwas sehr Merkwürdiges berichten. Sie kennen doch meinen alten Diener Bill? Nun – Bill war zweimal in meiner unmittelbaren Nähe, als ich dem Mann begegnete, hat ihn aber niemals gesehen! Ich begreife das nicht. ...«
»Erzählen Sie, Colonel,« bat Sir Francis, »die Sache ist fabelhaft interessant.«
»Das erste Mal sah ich meinen Freund in Madras. Ich war damals junger Offizier und lebenslustig wie nur einer der Leutnants in Indien. Wir hatten ein gutes Diner hinter uns, und einer meiner Kameraden machte den Vorschlag, zu den Bajaderen zu gehen, die in einem bestimmten Stadtviertel zu sehen waren. Nun – wir fuhren hin, gerieten in ein Eingeborenenviertel und kamen auch in ein solches Haus. Wir waren reichlich angetrunken und müssen uns auch wohl nicht korrekt aufgeführt haben – kurz – es gab irgendwelchen Streit mit irgendwelchem Kerl. Einer meiner Kameraden versetzte so einem braunen Nigger einen Fußtritt und warf ihn vor die Tür. Wir hatten die Waffen abgelegt, nur ich führte meinen Revolver bei mir. Plötzlich ertönte Geschrei, mit wüstem Lärm drang eine mit Messern und Haudolchen bewaffnete Menge ins Haus! Ein gräßliches Handgemenge entstand. Ich sah, wie der eine meiner Kameraden mit durchstoßener Kehle zu Boden fiel, wie ein zweiter erstochen wurde, schoß, mich mit dem Rücken gegen die Hauswand stemmend, drei der Angreifer nieder, sah blitzende Waffen, hörte wüstes Gebrüll ... Da stand neben mir ein Herr in schwarzem Rock, er erhob die Hand vor mir wie zur Abwehr – die Angreifer stutzten ... Im nächsten Augenblick drangen englische Soldaten ein. Es war ein Streifpikett, das den Lärm und die Schüsse gehört hatte und uns zu Hilfe geeilt war. Bajonette blitzten, ein Schuß krachte. Als ich wieder Herr meiner selbst war, sah ich mich nach dem Fremden um, um ihm für sein tatkräftiges Eingreifen zu danken, doch so viel ich auch suchte – der Mann war fort. Keiner der Soldaten hatte ihn gesehen. Ich forschte in den nächsten Tagen nach dem Fremden; niemand kannte ihn.
Zum zweiten Male sah ich meinen Freund im Sudan während des Mahdistenaufstandes. Die große Entscheidung war noch nicht gefallen, überall gab es Kämpfe. Meine kleine Truppe war eines Tages in einer verlassenen Ortschaft gänzlich eingeschlossen. Wir hatten wenig Lebensmittel, Hilfe war noch fern, Munition und Trinkwasser gingen zu Ende. Wir bereiteten uns auf den Tod vor. Als am fünften Morgen die staubige Sonnenscheibe düster über dem Horizont aufglühte, sahen wir die Mahdisten zum Hauptangriff schreiten, überall knallten ihre Flinten, überall sah man ihre weißen Burnusse ... Mit Gebrüll griffen sie an, es waren Hunderte. Schon übersprangen die ersten die Mauer, schon sah ich ihre blitzenden, weißen Zahnreihen, ihre wutverzerrten Gesichter, das bläuliche Weiß ihrer rollenden Augen ... Da stand neben mir jener Mann! Er trug britische Kapitänsuniform. Die Mahdisten wichen vor ihm zurück wie vor einem Gespenst.
Plötzlich kamen ganz unverhofft mit lautem Hurra meine indischen Lanzenreiter. Unsere Soldaten faßten wieder Mut. Das Gefecht war gewonnen. 40 tote Mahdisten lagen auf der Walstatt, der Rest entfloh vor den tapferen Lancers. Als ich mich nach dem Fremden umsah, um mich ihm vorzustellen und ihm zu danken, war von ihm nichts mehr zu entdecken. Er war verschwunden, als hätte ihn der Boden verschlungen ...
Das dritte Mal begegnete ich dem Unbekannten während eines Kampfes gegen aufständische Massai. Ich war am linken Bein verwundet und blieb in der Durststeppe liegen. Keine Kleinigkeit, Sir! Die Pfeile schwirrten wie Bremsen. Vor und hinter mir lagen unsere braven Tommies, indische Boys, weiße und afrikanische Reiter – mehr oder minder tot ...
Als es dämmerte, leuchteten nur noch einzelne Schüsse der Unsrigen auf. Jetzt endlich schlichen Ärzte und Sanitäter herbei, um uns zu helfen. Es war Zeit, wahrhaftig! Da stand plötzlich – jener Herr vor mir. Er war in gelbes Khaki gekleidet, ganz wie wir. Er hatte einen hellen Tropenhelm auf mit – schwarzem Schleierband. Er stellte sich zwischen mich und die Pfeilschützen, die wieder nähergekommen waren, er winkte mir beruhigend mit seiner langen, feinen Hand zu, er nickte freundlich ... Als ich ihn anreden wollte, brachte ich die ausgedörrten Lippen nicht auseinander. Plötzlich umfing mich tiefe Nacht ... aber ich hörte noch das Hurra der wieder anstürmenden britischen Soldaten.
Ich habe am nächsten Tage die Sanitäter gefragt, den Arzt – niemand von ihnen hatte den Fremden gesehen. Die Massai aber waren vor seiner Erscheinung geflohen! Was ist das? Sehen die Eingeborenen mehr als Europäer? Ich habe auch von Hunden gehört, die Gespenster sehen ...« Der Oberst schwieg eine Weile, der Diener brachte neuen Whisky und Soda und entfernte sich geräuschlos, wie er gekommen war. Ein großer Dampfer tutete im Hafen, Passagiere ergossen sich in die hellen Straßen.
»Trinken wir,« meinte der Oberst, »dann erzählt es sich leichter. Ich habe heute das Bedürfnis, alles zu erzählen.« Der Colonel goß ein, trank Francis zu. – Nebenan schnarchte ein alter, dicker Herr in seinem Liegestuhl.
Das vierte Mal begegnete mir der Fremde auf einer Reise in Nordindien. Ich hatte Urlaub und bummelte mit meinem Freunde Harry Campbell-Hardy durch die Kolonie. So waren wir im Zuge nach Calkutta. Wir saßen im Speisewagen, es ist mir so, als ob ich's gestern erlebt hätte ... plötzlich krachte es fürchterlich! – Der Wagen wurde zusammengepreßt, man hörte Angstrufe, Schmerzensschreie, das Knirschen zerreißenden Eisens, das Splittern von Holz. Hardy, der mir gegenübersaß, lag mit dem Kopf auf dem Tisch. Ein roter Strom floß über das weiße Gedeck! Ich sah, daß ein großer Splitter des zertrümmerten Fensters ihm die Halsseite aufgeschnitten hatte! Der Wagen neigte sich abwärts, blieb in schiefer Lage hängen ... Ich sah tief unter uns einen reißenden Gebirgsfluß, ein paar umgeschlagene, abgestürzte Wagen, die zertrümmerte Lokomotive! Da stand neben mir jener Herr. Er war schwarzgekleidet, seine Miene war sehr ernst. Er zeigte mit der Hand nach der offenen Tür des Wagens – ich sprang auf den Bahndamm, blickte mich nach dem Fremden um ... Er war fort. Als ich später nachfragte, wollte ihn niemand gesehen haben; auch mein alter Diener Bill nicht.
Jahre waren vergangen, da befand ich mich einmal auf einer Mittelmeerreise. Im Golfe du Lyon bekamen wir plötzlich einen orkanartigen Sturm. Die See war außerordentlich hoch, und die Brecher gingen ständig über Bord. Unsere Boote wurden weggeschlagen, alles an Deck kam in Unordnung, und zwei Matrosen wurden über die Reeling gespült. Da vorn eine Luke eingeschlagen wurde und das Schiff immer mehr Wasser übernahm, wurde die Lage schließlich sehr bedrohlich. Die paar Passagiere waren seekrank und lagen apathisch in ihren Kojen. Ich war neben dem Kapitän auf der Brücke. Am Abend lag das Schiff ganz tief mit dem Bug im Wasser, und der Kapitän rechnete damit, daß wir den Morgen nicht erleben würden.
In der höchsten Not erschien ein großer britischer Panzerkreuzer, der auf unsere SOS-Rufe herbeigeeilt war. Es gelang, die Passagiere zu retten und auch die Mannschaft bis auf die paar armen über Bord gegangenen Kerle. Ich war mit dem Kapitän noch immer auf der Brücke. Der Mann wollte natürlich sein Schiff nur als Letzter verlassen. Neben uns stand, gleichfalls angeseilt, mein treuer Diener.
Da sehe ich plötzlich eine dunkle Gestalt neben uns. Auch der Kapitän bemerkt sie, winkt, ruft etwas. Es ist der Fremde ... Er berührt die Schulter des Kapitäns ... Eine ungeheure Sturzwelle erhebt sich wie eine große, gläserne Wand, schlägt nieder ...
Der Platz, auf dem der Kapitän gestanden hatte, war leer! Hilfreiche Matrosen bargen erst meinen Diener und dann mich. Der Fremde war verschwunden. Ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehen. Ob er ertrunken ist?«
»Er ist nicht ertrunken«, sagte Francis leise. Ihn fror trotz der indischen Hitze.
Nach einiger Zeit, die die Herren schweigend verbrachten, erschien in europäischer Tracht, doch mit einem Turban nach indischer Sitte auf dem schönen dunklen Kopf, einer der benachbarten indischen Fürsten. Er begrüßte den ihm bekannten Obersten und auch Francis, ließ sich in einem der Korbsessel nieder und zündete sich mit der umständlichen Ruhe und Langsamkeit des Orientalen eine Zigarette an.
»Mister Bridgeman, ich war heute unten am Hafen,« sagte der Maharadscha, »dort arbeiten Ihre Elefanten, nicht wahr?«
Der Engländer nickte bejahend. »Die Elefanten meines Vaters, Hoheit«, bestätigte Francis. »Gut, gut«, sagte der Inder. »Es ist unter den Elefanten einer mit schönen, weißen Zähnen und hellen, fast weißen Flecken aus den Ohren. Er hat einen guten Mahout.« Bridgeman lächelte. »Ja, das ist Radha, Hoheit. Hat er Ihnen gefallen?«
»Seinetwegen bin ich hier, denn eigentlich wollte ich heute abend heimreisen, aber ich hoffte. Sie hier zu finden, Mister Bridgeman. Sie kennen unsere indische Passion? Sie wissen, daß weiße Elefanten oder solche Tiere, die weiße Zeichen tragen, für uns besondere Bedeutung haben? Würden Sie, Mister Bridgeman, mir den Elefanten verkaufen?«
»Das Verkaufen von Elefanten ist nicht meine Sache, Hoheit«, meinte der Engländer mit verbindlichem Lächeln. »Aber ich glaube, daß mein Vater nichts dagegen einzuwenden hätte, wenn ich in seinem Namen Ihnen den Elefanten schenke. Es kommt mir nur auf das Bewußtsein an, Euer Hoheit einen Dienst erwiesen zu haben.« Der Inder schüttelte Francis die Hand. »Seien Sie meiner Dankbarkeit versichert«, sagte der Fürst. Es war ihm sichtlich unangenehm, beschenkt worden zu sein. Sein Stolz lehnte sich dagegen auf. »Es wird mir eine Freude sein, Ihnen ein Gegengeschenk machen zu dürfen«, sprach der Fürst nach einer Weile. Damit war die Unterredung beendet, der Inder verbeugte sich, grüßte auf orientalische Art und verließ den Raum.
So kam Radha als Reitelefant des Maharadscha an dessen Hof, er kam in die heilige Stadt am Ganges und trug eine Haudah auf dem Rücken. Er hatte goldene Reifen um die weißen, blitzenden Stoßzähne, er trug eine Kette mit Edelsteinen über der Stirn, wenn er vor Festzügen durch die Straßen ging und wenn sich der Fürst dem Volke zeigte. Es waren aber zwei Männer, die mit ihm gekommen waren und die seiner warteten und pflegten: Ghautal, der Alte, und Mali, sein Sohn.