
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Grimmig fiel der Winter von neuem ein.
Schnee häufte sich auf Schnee.
Eisig blies der Wind.
Beinahe glühend brannte der Frost.
Selten schritt Er durch das Revier.
Sehr selten knallte die Feuerhand; sie galt jedesmal einem Raubzeug.
Denn das ganze Wild hatte Schonzeit.
Und irgendwie wußten es nun alle, daß keine Gefahr zu scheuen war.
Vertraut zeigten sich die Rehe jetzt auch am hellen Tag.
Zuversichtlich hoppelten die Hasen umher oder lagen beruhigt in ihren Schneebetten.
Gelassen steckten die Fasane im tiefen Schnee, besuchten, so oft sie wollten, unbeirrt die Futterstellen.
Die Rehe wagten sich dreister an das Heu.
Der Hunger trieb sie, die Unmöglichkeit, Eßbares zu finden.
Selbst Hasen kamen herbei und naschten, soviel sie konnten.
Das Hochwild war kaum zu sehen.
Die Könige schämten sich sehr, weil sie die Kronen verloren hatten.
Sie hielten sich so versteckt, als sei ihnen irgendeine Schandtat vorzuwerfen.
Ihr Wesen war nun ohne Stolz. Traf man mit ihnen zusammen, benahmen sie sich schüchtern und friedfertig.
Des Nachts schlichen sie lautlos durch den Wald.
Die Könige miteinander.
Vom Kampf um Nebenbuhlerschaft war nichts mehr in ihrem Gedächtnis. Friedlich gingen sie zusammen.
Getrennt von ihnen gingen die Königinnen, wunschlos. Manche einzeln, nur in Begleitung ihres Kindes. Andere im Rudel.
Könige und Königinnen schälten die Rinde jüngerer wie mittlerer Bäume.
Es war schon arg, welchen Schaden sie damit anrichteten. Mancher Baum konnte die Wunde nicht überstehen. Er verdorrte und stand kahl da, wenn die anderen wieder grünten.
Doch die königlichen Herrschaften kümmerten sich wenig darum.
Bambi blieb unsichtbar.
Den ganzen Winter ließ er sich nicht blicken.
Auch er hatte seine Krone verloren.
Zwar trug er das Haupt immer noch stolz erhoben; doch vielleicht gebot ihm eben dieser Stolz, die Seinen und die anderen alle zu meiden, solange er entkrönt umherging.
Hin und wieder erfror ein Hase, oder ein Reh lag steif und kalt im Schnee.
Dann stiegen die Krähen nieder, und binnen zwei oder drei Tagen blieb von dem Gefallenen nichts mehr übrig.
Zuweilen erwachte das Eichhörnchen aus seinem Winterschlaf, turnte durch die Wipfel, suchte seine Vorräte, konnte sie nicht finden, schlüpfte wieder in seine enge Stube und schlummerte weiter.
Ihm ersetzte der Schlafzustand teilweise die Nahrung.
Nach und nach wurden alle Waldbewohner von einem unheimlichen Empfinden ergriffen.
Keiner wußte warum, doch jeder fühlte die drückende Beklommenheit.
Nichts geschah.
Die Fasane blieben verschont; die Hasen lagen ungestört in ihren Betten, oder sie spielten verliebt miteinander. Sie spürten nichts vom allgemeinen Bangen.
Auf einmal gaben sie diese heiteren Spiele auf; verkrochen sich geängstigt.
Man wußte nicht, vor wem und worüber diese Angst entstand; allein man hatte sie, mehr und mehr, konnte nicht hindern, daß sie von Tag zu Tag wuchs.
Das wohltuende Sichersein der Schonzeit war unterbrochen.
»Können wir nie zur Ruhe kommen?« redete Faline traurig.
Geno sagte nichts; er zitterte nur immerzu.
»Ich wollte, der Vater wäre bei uns!« rief Gurri. Sie wehrte sich nach Kräften gegen das Bangen, das ihr ankroch. Vergebens! Sie wurde kleinlaut, stimmte der Mutter bei: »Wirklich, man brauchte dringend eine Weile Ruhe ... man möchte sich doch erholen ...«
»Die Kälte und das knappe Essen wäre arg genug«, sagte Faline.
»Uebergenug ...«, wimmerte Geno.
»Kälte und wenig Essen stören mich nicht ...«, erklärte Gurri, »... hätten wir nur Ruhe, ich würde mich trotzdem erholen!«
Es war zum erstenmal, daß Gurri verzagte.
Dadurch kam Geno, kam selbst Faline noch mehr herunter. Gurris ermunternder Zuspruch fehlte ihnen. Jetzt spürten sie, wie sehr er sie gestützt hatte, wie wenig sie Gurris Verzagen ertrugen.
Dennoch, Gurri hatte recht. Sie alle mit ihrem Zittern hatten recht.
Das unbestimmte, dumpfe Angstgefühl, das sie alle zusammen drückte, schlug zu offenem Grauen empor.
Irgendwo, in einem verborgenen Waldwinkel, lag ein großes Reh zerrissen auf der blutüberströmten Erde. Das war ein völlig beispielloses Verbrechen!
Dieses Reh mußte nach langem Flüchten, zu Tod erschöpft, dem Verfolger erlegen sein. Furchtbar war sein Ende gewesen.
Elstern, Häher und Krähen verbreiteten die Schreckensnachricht.
Aber ... der Verfolger ... der Mörder ... wer war das ...?
Kein Fuchs, kein Marder, auch keiner von der Art des Fremden, den Er vom Baum geholt hatte, keiner! Sie hätten sich mit kleinerer Beute begnügt.
Niemand kannte den Verbrecher, niemand hatte ihn gesehen.
Gerade dadurch stieg das Entsetzen aufs höchste.
Jedoch der Missetäter weilte fern.
Er wohnte im Dorf, gehörte dem Bürgermeister, hieß Nero und war ein stämmiger Wolfshund.
Sein Herr lag krank darnieder; Nero blieb ohne Aufsicht, hatte sich allein davongemacht, hatte Streifzüge unternommen. Erst weithin über die Felder und ganz harmlos. Dort gab es auch nichts Lebendiges, um ihn von seiner Bravheit weg in Versuchung zu locken.
Im Schnee kugelte er sich, fraß vom Schnee, spielte damit, bis er endlich erfrischt und zugleich angenehm müde heimlief.
Später, weil ihm das Umherlaufen gefiel, dehnten sich seine Ausflüge immer weiter. So gelangte er in den Wald, den er noch nicht kannte, denn sein Herr hatte ihn nie mit Nero betreten.
Hier bot sich ihm eine Fülle neuer Eindrücke.
Die unterschiedlichsten Witterungen wehten ihm um die Nase und regten ihn an.
Doch er wußte noch nichts damit anzufangen.
Während einiger Tage zog er stundenlang durch den Wald. Immer neugieriger, immer angeregter, bisher freilich harmlos und ohne feindselige Absicht.
Kein lebendiges Wesen kreuzte seinen Weg, kam ihm zu Gesicht. Nur vielen Spuren folgte er planlos tändelnd.
Aber seine Gegenwart erfüllte alle Geschöpfe des Waldes mit Schrecken. Wenn sie ihn auch nicht sahen, wurden sie trotzdem von panischer Angst gepackt. Vielleicht nur noch stärker, weil sie ihn nicht sahen und deshalb gar nicht wußten, vor wem sie solche Furcht empfanden.
Es war wirklich so, daß sie seine Gefährlichkeit errieten, noch bevor er selbst sich seines leidenschaftlichen Trachtens bewußt werden konnte.
Das alte Reh, das er getötet hatte, entzündete in ihm die Mordgier.
Ganz zufällig kam er in die Nähe der Geltgeiß, die sehr schreckhaft war, aufsprang und flüchtete.
Nero verstand das als Herausforderung und rannte ihr nach. Eine Weile hatte er keinen andern Gedanken, als die Davoneilende einzuholen. Er wußte nicht genau, wer da vor ihm rannte, glaubte, es wäre ein Hund, freute sich, einen Kameraden zu finden.
Die Luft wehte von der Alten ihm entgegen, brachte ihm mit dem Geruch die Ueberzeugung, keinen seinesgleichen vor sich zu haben, sondern etwas in anderem, in neuem Sinne Wünschenswertes.
Jetzt erwachte die Jagdlust; ein Gefühl, das ihn während der drei Jahre seines Daseins nie beunruhigt hatte, das aber nun schnell zum Rausch wurde, zum Fieber und ihn mit sich fortriß. Alle Hemmungen, die der Drill ihm beigebracht hatte, fielen von ihm ab.
Wenn andere Hunde ein Wild verfolgten, besonders ein größeres Stück, gaben sie immer Laut, bellten, jafften, heulten in pfeifenden Tönen.
Nero aber stammte von den Wölfen, ein später Erbe.
Mochte die Reihe seiner Vorfahren noch so lang sein, noch so undeutlich im Hintergrund der Zeiten verschwimmen, Neros Blut hatte etwas vom Wolf behalten.
Wölfe jedoch bleiben stumm, wenn sie jagen.
Und Nero hetzte das alte Reh, ohne einen Laut zu geben.
Immer wütender drang Wildheit in ihm hervor.
Die arme Unglückliche rannte, was sie konnte.
Das reizte Nero nur zu hitzigerem Grimm. Er blieb hartnäckig hinter ihr, kam ihr näher und näher.
Sie wurde müde, wurde schwach, ihr stockte der Atem.
Nero blieb frisch, blieb in seiner Verbitterung bei Kräften.
Als er die Geiß endlich erreichte, fiel er sie so stürmisch an, daß beide in den Schnee rollten.
Das Reh schlug mit den Läufen wie toll um sich; wollte sein Angstgeschrei erheben, doch rasch hatte der Wolfsbiß ihm die Kehle zerfetzt.
Stumm, wie diese Jagd verlaufen war, vollzog sich ihr Schluß.
Nero schnitt die Weichteile der Toten an, fraß gierig von dem warmen zuckenden Fleisch, kostete zum erstenmal die Wonne des Erbeutens.
Satt bettete er sich in den Schnee. An wärmere Lager gewöhnt, schlief er nicht, döste nur vor sich hin, weniger vom hetzenden Rennen als von der üppigen Mahlzeit ermattet.
Der Rausch, der ihn umnebelt hatte, verflog. Keine Spur blieb zurück.
Nun war er wieder der brave Nero, der gehorsame Hund seines strengen Herrn.
Mit Abscheu, mit Reue sah er den hingestreckten, blutig zerstörten Leib der Getöteten. Sie war erledigt.
Er begriff nicht recht, warum er das getan, doch er hatte die unabweisbare Empfindung, etwas Arges verbrochen zu haben.
Jämmerliche Angst vor Prügel stellte sich ein.
Vorsichtig, mit hängenden Ohren, den Schweif zwischen die Hinterbeine gezogen, machte er sich davon, kroch ein Stück fort, begann zu traben, immer schneller, bis er den Wald verlassen hatte.
Von dem Entsetzen, das seine Tat verbreitete, machte er sich keine Vorstellung.
Aufs freie Feld gelangt, wurde er endlich furchtbefreit. Man hatte ihn nicht ertappt.
Mit den Mienen und Gebärden eines Unschuldigen kam er heim.
Hätte sein Herr oder sonst jemand im Hause ihn beobachtet, man würde an dieser auffallend zur Schau getragenen Harmlosigkeit das böse Gewissen bald deutlich gewahrt haben.
Nero erfreute sich eines tiefen Schlafes, den wildes Träumen nur genußreicher machte.
Erwacht, lebte er das bequeme, unschädliche Dasein, das er gewohnt war. Er wollte sich Bewegung schaffen. Da sein Herr ihn nicht spazieren führte und ihn niemand hinderte, lief er wie früher über die Felder.
Das ging zwei, drei Tage; dann gelangte er unversehens in die Nähe des Waldes.
Jetzt sprang plötzlich der Wolfstrieb in ihm auf. Der Rausch packte ihn wieder, zu verfolgen, zu hetzen, zu erbeuten. Mächtiger als das erste Mal fühlte er nun gieriges Begehren, suchte leidenschaftlicher, noch ehe er Lebendiges wahrnahm, solch ein Ziel.
Lautlos fegte er durch Büsche und Blößen, über Wiesen und Schläge. Der Schnee staubte wirbelnd empor, wo Nero lief. Er witterte, suchte und fand.
Lautlos machte er sich an die Verfolgung der Rehgeiß, die er ein wenig abseits von ihren Kindern sah.
Es war Rolla.
Sie hinkte noch, konnte nicht so rasch entweichen, konnte einen Dauerlauf nicht aushalten, gab sich verloren; doch sie rannte um ihr Leben. Der Wolfshund hinterdrein.
Boso und Lana hatten die Todesgefahr der Mutter gewahrt, liefen klagend zu Faline, zu Geno und Gurri.
»Der neue Feind! Der furchtbare Feind! Er mordet die Mutter!« jammerten sie.
»Wir können nichts tun ...«, sagte Geno.
»Tröstet euch, Kinder«, meinte Faline, »... ihr seid schon groß ... ihr werdet ohne Mutter ...«
Lana weinte: »Ohne Mutter! Ohne unsere gute Mutter ...!«
»Ihr bleibt bei mir«, versprach Faline, »in meiner Obhut ...«
»Du bist nicht unsere Mutter ...!« Boso war verzweifelt.
»Etwas müßten wir unternehmen!« rief Gurri.
»Unternehmen ... was denn?« widersetzten sich Geno und Faline.
»Rasch!« drängte Lana, »sie hinkt! Sie kann nicht lange flüchten!«
»Sie stirbt ...!« ächzte Boso.
»Wahrscheinlich ist sie jetzt schon tot!« sprach Geno und erregte damit Bestürzung.
Inzwischen raffte die angstgepeinigte Rolla ihre letzten Kräfte zusammen; sie verwünschte die wundgeschossene Keule, die ihr jede Behendigkeit raubte.
Sie hielt das Sterben für unabwendbar, wollte nur ein bißchen noch leben, nur ein paar Minuten die Qual des Erwürgtwerdens, diese unbekannte, gräßlich gefürchtete Qual, hinausschieben. Nur kurze Frist!
Der heiße Atem des Verfolgers hechelte näher und näher, hauchte sie jetzt drohend an. Rolla erinnerte sich der Kinder.
Die Verzweiflung gab ihr einen tollen Einfall. Gelang ihr das, war sie vielleicht gerettet. Vielleicht!
Plötzlich machte sie kehrt.
Heftig stieß sie mit dem Wolfshund zusammen, der überrascht einknickte. Niederfallend schnappte er nach ihr.
Mit einem jähen Satz überflog sie ihn.
Der Sprung tat ihr in der Keule sehr weh.
Sie sauste ins Dickicht, noch ehe Nero sich emporgerappelt hatte.
Unerwartet kam sie zu Faline, kam zu all den Kindern.
Die jubelten: »Gerettet! Mutter!«
Total erschöpft, von brennenden Schmerzen gefoltert, sank Rolla in den Schnee.
»Er kommt!« wollte sie rufen, war jedoch keines Wortes fähig.
Da stürmte Nero auch schon herein.
Weil nun Geno augenblicklich und als erster flüchtete, nahm der Hund dessen Verfolgung auf, ohne der andern zu achten, die entsetzt auseinanderstoben.
Rolla blieb völlig ausgepumpt und apathisch liegen.
Glücklicherweise war die Schneedecke nicht tief, also vermochte Geno seine ganze jugendliche Schnelligkeit zu brauchen.
Hatte ihm die voreilige Flucht das Gejagtwerden zugezogen, so brachte sie ihm die Gunst, daß zunächst zwischen ihm und Nero ein Abstand blieb.
Geno fand sich zum erstenmal direkt und einzeln angegriffen. Zum erstenmal war er der Todesdrohung preisgegeben und allein.
Ihm blieb keine Möglichkeit, zu bangen oder zu beben. Ihm blieb jetzt nichts anderes übrig als zu rennen!
Flammende, angstbeflügelte Sucht, sich zu retten, trieb ihn vorwärts, als trage ihn der Wind dahin.
»Mein armer Geno!« schluchzte Faline, »mein geliebter Sohn!«
Gurri, zu ihr gesellt, erging sich in Beschwichtigungsversuchen.
»Rolla ist schuld, wenn mein Kind getötet wird!« Faline blieb untröstlich, »nur Rolla ist schuld! Wäre sie wo anders hingelaufen statt zu uns!«
»Er wird Geno nicht erwischen«, beteuerte Gurri, »der böse Feind wird ihn nicht einholen!«
»Ich wollte, du hättest recht!« wimmerte Faline.
Sie erhob bittere Anklagen.
»Diese Rolla! Nur Gutes haben wir ihnen erwiesen! Nur Gutes! Und das ist der Dank!«
Gurri redete ihr zu: »Tante Rolla kann wirklich nichts dafür!«
»Kann nichts dafür?« unterbrach Faline, »wer denn als sie?«
»Niemand von uns kann dafür! Es ist unser Schicksal!«
»Rolla kann dafür!« beharrte Faline.
»Tante Rolla ist fertig gewesen«, entschuldigte Gurri.
»Sie hätte sich opfern müssen«, sagte Faline hart, »eine Mutter muß sich opfern.«
»Sie wäre ja auch das Opfer gewesen«, verteidigte Gurri, »aber ...«
»Aber ...!« Faline geriet immer mehr in eifernden Zorn, »aber statt dessen kommt sie hierher zu uns ... statt dessen opfert sie meinen Geno ... was macht sie sich denn da draus!«
»Sag das nicht, Mutter! Wenn Geno was passiert, wird Tante Rolla ihn wie ihr eigenes Kind betrauern.«
»Ihr Trauern nützt mir gar nichts«, wimmerte Faline, »mein Geno ist so unwissend ...! Er hat noch nichts erlebt ...! Ich sehe ihn niemals wieder!«
»Du siehst ihn gewiß noch heute, Mutter!« Gurri schlug ihrer eigenen Bangigkeit zum Trotz einen zuversichtlichen Ton an: »Heil und gesund wird er sein, Mutter! Du wirst dich überzeugen, ich behalte wieder recht!«
Unterdessen fuhr Geno dahin.
Nero keuchte. Aus Gier, aus Leidenschaft, keineswegs aus beginnender Müdigkeit.
Im Gegenteil, seine Raserei nach Beute wuchs und damit seine Kraft.
Er war ein starker, gut genährter, voll erwachsener Hund, dieser Nero.
Geno war ein Kind und mangelhaft verköstigt.
Nero hatte die Wohltat der warmen Stube für sich.
Geno kannte die Strapaze des Frierens, die ihn noch nicht abhärten konnte.
Also erlahmte Geno ziemlich bald; sein Tempo ließ bedenklich nach, und er wäre als Opfer gefallen, wenn nicht ...
Ja, wenn nicht!
Bambi trat dazwischen!
Die äußerste Gefahr, in der sein Sohn schwebte, ließ ihn das kahle Haupt, ließ ihn die Scheu, den Stolz vergessen.
Er warf sich ins Mittel.
Der Listenreiche ahmte die Fasanhenne nach, die sich flügelkrank stellt, wenn der Fuchs ihre Kücken bedroht. Sie flattert unbeholfen auf, fällt scheinbar zu Boden, flattert wieder und wieder, bis sie den Fuchs weit fort von ihrer Brut gelockt und dieser die Möglichkeit gegeben hat, sich zu verstecken. Dann steigt sie hoch empor und streicht ab. Sie hat gewonnen.
Aehnliche Mittel wendete nun der Vielerfahrene an.
Er tat so, als wäre er schwer krank, als könnte er nicht von der Stelle.
Kaum hatte ihn Nero erblickt, stürmte er auf die vermeintlich leichte Beute los.
Und Geno entrann.
Bambi zog den Wolfshund durch etliche geschickt unbeholfene Kreuz- und Quersprünge hinter sich her.
Ganz nah ließ er ihn kommen, wollte genau wissen, daß der Feind es aufgegeben hatte, Geno zu hetzen, und daß Geno entschwunden war.
Im letzten Moment, wenn Nero schon dachte, nun wäre die Beute sein, bewahrte sich Bambi mit einem Wischer zur Seite vor dem geifernden Rachen.
Auf einmal begann er zu rennen, zu rasen, wie im Wald einzig Bambi laufen konnte.
Verblüfft sauste ihm Nero nach.
Doch Bambi zeigte sich flinker.
Schnurstracks eilte er seinem sicheren Schlupfwinkel entgegen, jener von Baumstämmen und Reisig hochgedeckten Grube.
Darin hatte Bambi früher an der Seite des alten Fürsten, hatte er später allein oft und oft gelegen.
Er kannte den Zugang, schlüpfte hinein und war weg, als hätte ihn die Erde verschlungen.
Die Erde hatte ihn auch wirklich verschlungen.
Genarrt umkreiste der Hund diese Wirrnis, in die es ihm nicht möglich war einzudringen. Er witterte den Entschwundenen, spürte dessen Nähe, wurde aufs höchste davon gereizt.
Jetzt geriet er in die stille Wut, die, gepaart mit hartnäckiger Geduld, den Wölfen eigen ist. Er setzte sich auf seine Keulen und wartete. Nicht weichen, nicht wanken. Warten, warten!

Der Begehrte mußte sichtbar werden.
Mußte!
Er ruhte sich zugleich aus; kam jedoch zu keinem gelassenen Atem. Die Zunge hing ihm immer noch ein wenig heraus, denn seine Erregtheit wurde nicht geringer.
Bambi lag in sicherer Hut, wußte den Verfolger draußen und war dessen zufrieden.
So vermochte der Abscheuliche niemand anders zu bedrohen.
Stunden später, die Dämmerung schleierte bereits, trat ein junger Hirsch aus der Dickung. Er ging nach dem Brauch als erster, als Vorposten. Die andern, stärkeren sollten folgen, wenn nichts Verdächtiges sich zeigte.
Sorglos waren die Hirsche zu dieser Jahreszeit; wohl bewußt, daß sie geschont würden. Nur gehemmt durch ihre entkrönten Häupter und durch die Scham, die sie darüber empfanden.
Allein das Verdächtige zeigte sich sofort, erwies sich als das Gefährliche, als das Furchtbare.
Nero glaubte, den Erwarteten zu sehen, sprang auf und rannte seitlich der Beute entgegen, die sich so harmlos darbot.
Der junge Hirsch erschrak, setzte in hohen Fluchten weg.
Die andern, nicht minder erschreckt, aber rechtzeitig gewarnt, verließen das Dickicht gar nicht, wendeten sich schleunigst um, preschten mit lautem Aesteknacken davon.
Jetzt hob das Jagen von neuem an.
Der Wolfshund hetzte, der Hirsch pfeilte dahin; gelangte über eine Wiese, an deren Saum er sich dem Gegner stellte.
Mit den Vorderläufen schlug er nach ihm, voll zorniger Angst. Und er schlug zu, wo er nur konnte.
Zweimal sprang Nero dem Hirsch an die Kehle, mußte zweimal, getroffen, von ihm ablassen.
Er schäumte vor schmerzentzündeter Wut.
Als der Hirsch sich wegdrehte, um zu entwischen, fuhr ihm Nero zum drittenmal an die Gurgel, und jetzt biß er sich fest.
Umsonst versuchte der Hirsch den Angreifer abzuschütteln. Blut quoll ihm stromweise herunter. Immer tiefer gruben Neros Zähne in die Wunde. Die Schlagader zerbarst, dem Hirsch schwindelte es vor den Augen. Er leistete keinen Widerstand mehr.
Nero riß ihn zu Boden.
Das Zucken, das langsame Verzappeln des Sterbenden bereitete dem Wolfshund Siegerfreuden.
Viele waren ihm heute entflohen, hatten ihn getäuscht; wurden aber jetzt zu einer einzigen Gestalt, zu seinem Opfer.
Er wühlte im warmen Leib des Getöteten, hatte den Taumel wieder, dessen Wonne ihn betäubte, empfand wieder und diesmal noch stärker die große, beglückende, aber einschläfernde Sattheit, die das lebenswarme Fleisch ihm verursachte.
Noch weit peinlicher, noch weit mehr ernüchtert als beim ersten Male erwachte er aber dann aus seinem Blutrausch, erschrak heute noch mehr als nach dem ersten Raub vor sich selbst.
Dunkelheit verhüllte den Rückzug aus dem Wald.
Furchtsames Schuldbewußtsein trieb ihn heimwärts.
Zu Hause spielte er mit verdoppeltem Eifer die Komödie der Harmlosigkeit, spielte sie eben deshalb so aufdringlich, daß die Leute, Hausfrau, Magd und Knecht, ihn fragten: »Nero, was hast du getan?« Und: »Was hast du angestellt, Nero?«
Demütig kroch er sogleich auf dem Bauch, leistete derart das Bekenntnis seiner Schuld und harrte der Strafe.
Allein niemand wußte, was der Hund eigentlich verbrochen, keiner ahnte das Maß seiner Schuld. Die Strafe unterblieb.
Statt ihrer schmeichelten sie, liebkosten Nero.
»Ja ... du bist brav ...«, hörte er, »... braver Hund!«
Geliebte, erlösende Worte.
Behaglich dehnte er sich auf seiner Matratze. Schön war dieses Leben!
Den Wald jedoch durchzog kaltes Schaudern.
Ermordet lag der junge Hirsch frei am Rande der Wiese.
Wer in die Nähe oder gar vorbei kam, stob entsetzt davon und trug die Trauernachricht weiter.
Man gewärtigte weitere Verbrechen während dieser Nacht.
Jeder bangte, getötet zu werden.
Faline wagte nicht einen Schritt.
Sie jammerte um Geno, den sie für umgebracht hielt; klagte immer wieder Rolla an, die sie dafür verantwortlich machte.
Gurri blieb bei der Mutter, erschöpfte sich in hoffnungsvollen Reden, doch sie selbst hegte kaum noch Hoffnung.
Faline war keinem Ermuntern zugänglich, also schwieg Gurri.
Traurig hörte sie der Mutter zu, die fortwährend von Geno wie von einem Verstorbenen sprach.
»Er ist so anmutig gewesen ...«
»Ein echter kleiner Prinz ...«
»Wie stattlich waren an seiner Stirn die Rosenstöcke, wie ungewöhnlich stark ... und eine stolze Krone hätten sie getragen! Er glich ganz dem Vater!«
»Er war klug, mein Geno, klug und sehr vorsichtig ... ihm mußte man ein langes Leben zutrauen ...«
»Vom Vater geführt, hätte Geno auch lange gelebt, wäre gleich dem Vater fürstlich und weise geworden ... wenn nicht diese Rolla ...«
Eintönig redete Faline immer dasselbe, schloß immer damit, Rolla zu beschuldigen.
Gurri schwieg.
Das Herz tat ihr um den Bruder weh, der nun nie wieder an ihrer Seite weilen würde, der so gütig gewesen und den sie so innig geliebt hatte, was sie jetzt erst wirklich begriff.
Doch der harten Verurteilung Rollas schloß sie sich nicht an.
Sie hatte Tante Rolla gern, mutete ihr keine tadelnswürdige Absicht zu, war überzeugt, Tante Rolla konnte nichts für den Zwischenfall und werde sich wegen Genos Schicksal selber am meisten Vorwürfe machen.
Rolla lag noch immer am selben Fleck, an dem sie zusammengebrochen.
Sie litt arg durch ihre verletzte Keule, deren Muskel und Sehnen längst nicht geheilt und jetzt neuerdings zerrissen waren.
Der Schreck, der sie jählings erfaßt hatte, die Furcht, während sie gehetzt wurde, der übermäßige Kraftaufwand, dies alles schaffte solche Ermüdung, daß Rolla sich immer elender fühlte.
Sie kämpfte gegen den Schlaf, denn sie bebte vor einem wiederholten Ueberfall; sie bangte um ihre Kinder.
Wirre Bilder schwebten um ihren Sinn; sie träumte schon, als sie noch zu wachen glaubte; doch der ohnmachtähnliche Schlaf, der endlich ihr Bewußtsein niederschlug, tilgte jeden Traum hinweg.
Geno war nach dem Dazwischentreten Bambis weitergelaufen. Er glaubte noch keineswegs an seine Rettung. Die Angst mehrte sich im selben Maß, in welchem die Schnelligkeit sich minderte.
Zunächst vermochte er überhaupt nicht zu denken. Es dauerte eine Weile, ehe er wahrnahm, daß er nicht mehr gehetzt wurde.
Nun wagte er mit dem Rennen eines Verfolgten nachzulassen. Nun ging er allmählich langsamer und langsamer. Sein angestrengter Körper erholte sich, er schöpfte ruhiger Atem.
Freilich fühlte sich Geno immer noch bedroht, war immer noch ein Flüchtling. Jedes leise Geräusch machte ihn zusammenzucken, vor dem Hoppeln eines Hasen, dem entfernten Schritt von Rehen fiel er in Galopp; nur kurz, bis ihm klar wurde, das sei ungefährlich.
Weithin streifte er durch den Wald; fand überall Schrecken und Furcht, brachte selber überall Furcht und Schrecken mit.
Doch nichts ereignete sich während dieser Nacht, weder Angriff noch Ueberfall. Keine Wolfsgestalt wurde sichtbar. Denn Nero lag ja daheim und schlummerte friedlich.
Der blutige Leib des Hirsches aber, den er zerrissen, verbreitete wie ein stummer Klageschrei andauerndes Entsetzen.
Bei Tagesgrauen erwachten die Vögel, sahen den Hingestreckten und beeilten sich, mit verspäteten Warnungsrufen säumiger, nun doppelt eifriger Wächter die Kunde umherzutragen, die ja die meisten schon wußten.
Zahlreiche Krähen, die einander laut riefen, flatterten heran, ließen sich zu dem Erkalteten nieder und begannen ihr häßliches Mahl.
Geno, ziemlich ruhig geworden, gestand sich nun seine Rettung, die er freilich nicht völlig begriff, der er übrigens noch nicht restlos traute.
Sein Schlafbedürfnis, sein Hunger wichen der Sehnsucht nach der Mutter.
Er suchte Faline und Gurri, kehrte schließlich zu dem Platz zurück, von dem aus er gejagt worden war.
Behutsam ging er, ganz leise; fühlte, ihm könne am gleichen Ort nicht zum zweitenmal Gleiches widerfahren. Trotzdem wendete er größte Vorsicht an.
Eine vertraute Stimme klang an seine Lauscher. Nicht die seiner Mutter, aber wohlbekannt: »Geno! Geno!«
Rolla, die eben aus der Tiefe ihres Schlafes auftauchte, rief ihn.
Erstaunt stand er da.
»Geno«, sprach Rolla, »du bist's? Und allein?«
»Allein!« antwortete Geno.
»Wo ist die Mutter? Wo ist Gurri?«
»Wer weiß, wo sie sind!« erwiderte Geno, »ich weiß es nicht, möchte es brennend gern wissen ...«
»Was ich erlebt habe ...!« seufzte Rolla.
»Und ich!« fügte Geno geringschätzig hinzu.
Rolla erhob sich schwerfällig. »Ach! Mir tut die Keule weh! Nicht mehr gar so sehr! Aber im ganzen ist mir, als wäre ich zerbrochen ...«
»Kannst du nicht gehen?« fragte Geno ohne innigere Teilnahme.
»Doch! Gehen ... langsam gehen kann ich ...« Rolla taumelte ein wenig, »... nur laufen würde ich nicht können ... nein, das wäre ich nicht imstande ...«
Sie sah Geno in die Augen: »Auch du hast Schweres mitgemacht?«
Geno straffte sich: »Sehr Schweres, Tante!«
»Sag mir, Geno, was ist dir geschehen, du Armer?«
»Erst muß ich die Mutter und Gurri finden ... früher ... du entschuldigst, Tante ... früher hab ich keine Ruhe, zu sprechen ...«
»Ich bin um Boso und Lana in Sorge ... wie grausam fällt diese Sorge jetzt über mich her! Du hast recht, Geno! Du bist klug und gut! Bevor wir nicht alle finden, gibt es für uns keine Ruhe ...! Komm, wir wollen sie zusammen suchen ...«
Sie machten sich auf den Weg, schritten lange und langsam umher. Rolla war stark behindert; sie hinkte schwer.
Das Eichhörnchen wirbelte über ihnen durch die Wipfel: »Habt ihr schon gehört?«
Die Geschichte vom ermordeten Hirsch wirkte furchtbar.
»Wissen Sie, wo meine Mutter ist? Und meine Schwester?« Geno fragte beklommenen Herzens.
»Und meine Kinder?« erkundigte sich Rolla zaghaft.
Das Eichhörnchen gab nur Geno Bescheid: »Ja! Dort, neben der alten Esche, im Hartriegelbusch sind beide miteinander und ganz gesund!«
Geno wollte fortlaufen, aber Rolla bat: »Warte ... nur eine Sekunde!« Zum Eichhörnchen flehte sie: »Und meine Kinder ... meine Kinder?«
»Ich muß mich nach ihnen umschauen!« war die Antwort.
Feierlich erschien Rolla mit Geno bei der Esche. Sie wollte sagen: »Da bringe ich dir deinen Sohn!«
Doch Gurri stürmte aus dem Hartriegelbusch. »Geno! Geno! Haben wir dich wieder!« jauchzte sie.
Faline brach hervor, stammelte erschüttert: »Mein Sohn ... du lebst!«
»Frisch und gesund!« jubelte Gurri.
Sie küßten ihn zärtlich. Faline weinte Freudentränen; Gurri war fröhlich, also lachte sie; Gurri war klug.
»Wüßte ich nur meine Kinder so frisch und so gesund ...«, düsterte Rolla.
Doch sie wurde von Faline keines Wortes gewürdigt.
»Erzähle, Geno«, verlangte Gurri, »erzähle!«
»Ja, wir wollen hören, was du erlitten hast, wie du dich retten konntest«, sagte Faline.
»Auch ich bin neugierig«, fügte Rolla hinzu, »obwohl du vielleicht warten solltest, bis meine Kinder ...«
Faline tat, als wäre außer ihr, Gurri und Geno niemand zugegen. Sie unterbrach Rolla: »Sprich nur, mein Sohn!«
Geno holte zu seinem Bericht aus, allein kaum hatte er damit angefangen, kamen Boso und Lana, geführt vom Eichhörnchen, das über ihnen durchs Gezweig hastete und frohlockte: »Nun sind ja alle wieder beisammen!«
Rolla tauschte Küsse des Wiedersehens mit ihren Kindern.
»Wie fühlst du dich, Mutter?«
»Du hast dich erholt?«
Beide erkundigten sich lebhaft.
»Von mir ist nichts zu sagen«, meinte Rolla, »aber ihr, meine Kleinen, wie ist es euch ergangen?«
Faline war der Ansicht, jetzt dürfe einzig ihr Sohn in Betracht kommen und jedes andere Reden wäre unstatthaft, wäre unerlaubt zudringlich. Deshalb forderte sie scharf: »Erzähle, Geno! Wir sind gestört worden!«
Geno, ein wenig verlegen durch den Ton der Mutter, fing von seiner Bedrängnis an.
Jetzt wurde ihm auf einmal ganz klar, wer sein Retter gewesen.
Der Vater. Natürlich war das einzig der Vater.
Kein anderer als er hätte sich seiner angenommen!
Er schwankte, ob er den Vater erwähnen dürfte, ob er ihn nicht verschweigen sollte, doch Gurri überrumpelte ihn mit der Frage: »Was hat den Wüterich von dir abgelenkt?«
Ihm entfuhr die Wahrheit: »Der Vater!«
Denn kein Geschöpf des Waldes verstand sich aufs Lügen. Sie konnten etwas geheimhalten, konnten schweigen; die Lüge blieb ihnen allen fremd.
Genos Mitteilung erregte Aufsehen.
»Oh! Bambi!« flüsterte Faline.
»Unser Vater!« schwärmte Gurri.
Begeisterung regte sich in Mutter und Tochter; begeistert schilderte Geno, was Bambi für ihn getan.
Keiner zweifelte an Bambis Entkommen.
Gurri rückte der Mutter zur Seite: »Stell dich nicht so kalt gegen Tante Rolla«, ganz heimlich, den andern unhörbar, klang ihr inständiges Bitten, »sei freundlich mit ihr; sie ist ja krank.«
Faline fiel es ebenso schwer, sich mit Rolla zu versöhnen, wie ihrer Tochter zu widerstehen.
»Später vielleicht«, sagte sie, »jetzt kann ich nicht ... später ...«
Sie ging einfach fort.
Gurri gelangte nicht dazu, einige liebe Worte an Rolla zu richten, denn Geno und Boso verzankten sich.
»Mein Bester«, begann Boso, »ich habe viel mehr erlebt als du!« Das war nun freilich hochmütig gesprochen.
»Mehr? Du willst mehr erlebt haben?« Geno war gereizt. Im ersten Augenblick fiel ihm keine andere Antwort ein.
»Viel mehr!« wiederholte Boso, »ich wäre bald gestorben!«
Jetzt fuhr Geno auf, voll Aerger, weil sein Abenteuer mißachtet wurde: »Du bist ganz dumm in irgend etwas hineingetappt ...! Du kannst dich wohl kaum mit mir vergleichen!«
»Eben das habe ich gemeint«, erwiderte Boso spitz, »ein Vergleich zwischen deinem kleinen Erlebnis und meinen gefährlichen Todesnöten ...«
Geno ließ ihn nicht vollenden. »Ich spreche nie mehr mit dir!« warf er geringschätzig hin und lief der Mutter nach.
»Du hast den Vergleich vorgebracht, du!« sagte Gurri ernst, »das hättest du nicht sollen, Boso! Jetzt nicht! Das wird dir noch leid tun!«
Sie sprang fort, folgte der Mutter und dem Bruder.
Zurückgeblieben, meinte Rolla traurig: »Du bist zwar im Recht, mein Sohn, aber ...«
»Aber mir tut es jetzt schon leid!« fügte Lana rasch hinzu, »wir wären alle so glücklich gewesen.«
Noch am selben Tag hatte der Jäger den toten Hirsch gefunden. Betroffen zerbrach er sich den Kopf: Wer kann das angerichtet haben?
Es währte nicht lange, bis er im zerwühlten Schnee die Fußspur eines Hundes entdeckte.
Sorgfältig ging er diesen Spuren nach, sah, wie arg der Hund etliche Stücke gehetzt hatte; er fand auch die Reste der zerrissenen Rehgeiß.
»Na, der hat tüchtig gewirtschaftet!«
Welcher Hund mochte das sein?
Ein großer, starker Hund war es ohne Zweifel.
Der Jäger dachte ganz methodisch nach.
Die lange Hetzspur sprach deutlich genug. Und der Jäger hatte keinen Laut gehört.
Also ein Wolfshund!
Einzig der Bürgermeister besaß einen solchen.
Peinlich!
Aber peinlich oder nicht, der Hund mußte weg! Da half nur eine Schrotladung! Die sollte ihm werden!
So begab sich der Jäger auf die Lauer.
Ziemlich nah vom Waldeseingang paßte er Nero ab.
Er wartete drei ganze Tage.
Kein Nero erschien.
Am vierten Tag trollte er heran. Doch der Wind strich ihm entgegen, brachte ihm die Witterung des Jägers. Wie gescheucht kehrte Nero um, eilte ins Dorf zurück.
Zwei Tage zeigte er sich nicht. Alles Warten blieb umsonst.
Endlich am siebenten Tag kam Nero, fiebernd vor Jagdeifer, von keinem Lüftchen gewarnt, und drang ins Buschwerk.
Ganz feine Schrotkörner hatte der Jäger in Patronen geladen. Er war darauf verfallen, den kostbaren Hund, den der Bürgermeister liebte, nicht umzulegen, sondern ihn bloß zu schrecken, ihm einen Denkzettel zu geben und ihm das Waldlaufen abzugewöhnen.

Als er ihm den Schuß aufs Fell brannte, knickte Nero mit einem jammernden Winselschrei zusammen, raffte sich dann aber ganz wirr wieder auf, denn kein Schrotkorn war ihm tiefer ins Fleisch gedrungen.
Mit eingeklemmtem Schweif, mit schmerzhaft und furchtsam gebogenen Läufen zog er humpelnd, kroch er fast bäuchlings über das Feld dem Dorf zu.
Lächelnd blickte ihm der Jäger nach.
Dann besuchte er sofort den Bürgermeister und setzte ihm den Fall auseinander.
Der Bürgermeister zeigte Verständnis. »Hätten Sie ihn nur gleich erschossen! Er hätt's verdient, der Sakerloter!«
Nero lag in der Ecke, kläglich zusammengekauert und zitternd.
»Wer schießt denn so einen schönen Hund gleich tot?« erwiderte der Jäger. »Das tu ich jedenfalls nicht!«
»Jedenfalls danke ich Ihnen vielmals«, schloß der Bürgermeister, »das Ganze ist eben passiert, weil ich krank war.«
Damit war die Sache erledigt.
Im Wald herrschte nun wirklich voller Frieden.
Kein Eindringling störte mehr das stille Leben der Geschöpfe, und die gewohnten Zwischenfälle gingen wie sonst vorüber, wurden rasch vergessen.
Rollas Wunden heilten nach und nach; sie hinkte kaum merkbar, bewegte sich schneller.
Doch sie und ihre Kinder mieden Faline, Geno und Gurri.
Bambi blieb unsichtbar.
Die Kälte wurde gelinder; der Himmel blaute, und die Sonne wärmte ein wenig.
Eines Morgens standen überall Schneeglöckchen mit nickenden Kelchen.
»Sieh doch, Mutter«, freute sich Gurri, »das sind Blüten ... echte Blüten!«
»Ja, mein Kind«, lächelte Faline, »es fängt an zu blühen!«
»Man kann sie gar nicht zählen«, stellte Geno fest.
»Vorboten sind sie«, sprach Faline.
»Vorboten?« Geno war mißtrauisch, »von was? Vorboten hab ich nicht gern!«
»Die darfst du begrüßen, mein Sohn; sie künden Gutes!«
»Daß die schwere Zeit vorbeigeht?« lachte Gurri.
»Sie ist im Schwinden!« bestätigte Faline heiter.
»Und alles wird wieder grün?«
»Alles, mein Sohn!«
»Das kann ich gar nicht fassen!« zweifelte Geno.
»Man vermag das Unglück nicht zu fassen, und man macht sich vom Glück keine Vorstellung«, sprach Faline, »man muß beides erleben, Böses wie Gutes.«
»Ueberleben!« warf Gurri fröhlich ein, »überleben ist das Wichtigste!«
»Und man lernt«, sprach Faline weiter, »daß man eins mit dem andern, mit dem Unglück das Glück zu bezahlen hat.«
Das Eichhörnchen Perri erwachte aus seinem Winterschlaf, denn der Frost schwand langsam dahin.
Faline und ihre Kinder merkten es kaum, aber der Schnee wurde ein weicher Brei; die Erde war naß, man ging wie auf Sumpfboden und glaubte einzusinken.
Geno und Gurri liefen kaum mehr über die Wiese; dort quoll das Wasser unter jedem Tritt gurgelnd hervor.
»Das ist ja schlimmer als der Winter«, äußerte Geno unzufrieden.
Doch die Mutter beruhigte ihn: »Wart' nur, es wird bald schön!«
»Wann?« murrte er.
»Bald!«
»Hab doch Geduld«, redete ihm Gurri zu, »wenn mir Gutes versprochen wird, bin ich gleich froh gelaunt.«
»Meinetwegen, ich will Geduld haben«, erwiderte Geno, »nur fröhlich kann ich nicht sein; das wäre zu viel verlangt, wenn ich in diesem Schlamm und dieser Nässe herumwaten muß.«
Unmutig kam das Eichhörnchen gesprungen: »Hätte ich doch was zu essen! Mich hungert schrecklich!«
»Wissen Sie nicht, daß es schön wird?« fragte Gurri.
»Freilich weiß ich das! Leider werde ich davon nicht satt!«
»Sie müssen sich auf das Kommende freuen«, riet ihm Gurri, »frohes Erwarten macht schon zur Hälfte satt. Können Sie sich nicht einstweilen damit begnügen?«
»Ich hatte Vorräte gesammelt«, Perri saß traurig und nachdenklich da, »reiche Vorräte ... und jetzt finde ich sie gar nicht!«
»Suchen Sie! Suchen Sie!« ermunterte Gurri, »besinnen Sie sich! Sie werden schon draufkommen, wo Ihr Vorrat liegt!«
»Sie sollen recht behalten!« Perri huschte davon.
»Ich wünsche Ihnen, daß ich recht behalte!« lachte Gurri hintendrein.
Der Himmel umzog sich mit fahlgrauen Wolken.
»Es wird schön ...«, spottete Geno.
Rauschend fiel der Regen nieder, dicht, eintönig, andauernd.
Geno bemerkte kurz: »Es wird immer schöner ...«
Die Rehe trieften nur so vor Nässe.
»Du glaubst nicht, daß es schön wird?« Gurri neckte den Bruder.
»Glaubst du vielleicht daran?« Geno machte ein verdrossenes Gesicht.
»Ja!« rief Gurri, »ich glaube daran! Ich fühle, es wird herrlich!«
»Närrin!«
»Laß mich eine Närrin sein!«
Faline sprach: »Gurri fügt sich in das Unabwendbare; füg auch du dich, mein Sohn!«
»Ich füge mich ja. Was kann ich anderes tun?«
»Du sollst dich wie Gurri zufriedengeben. Heiter sein. Sie hat es nicht besser als du!«
Geno richtete sich auf. »Jeder duldet nach seiner Weise. Rede mir nicht von Zufriedenheit, rede mir nicht von Heitersein. Unter solchen Umständen ist nur ein Dummer zufrieden und heiter!!« – »Dann bin ich eben dumm!« Gurri lachte.
»Das habe ich nicht gemeint!« entschuldigte sich Geno eifrig, »wirklich nicht!« Er bewunderte die Schwester immer noch, und er liebte sie zu sehr, um sie zu beleidigen.
Als der Sturm losbrach, der jetzt bis zur Raserei entfesselt über den Wald herstürzte, verjagte er den Regen.
Geno ertrug die neue Plage stumm.
Die Sturmgewalt war ungeheuer. Gleich einem Rudel scheu gewordener Rosse brauste der Wind dahin.
Am Himmel jagten die Wolken wie verfolgte Flüchtlinge.
Tief und ächzend neigten sich die stärksten Bäume.
Mit schmerzlichem Schrei brachen dicke Zweige und krachten zu Boden.
Der Schmächtige wäre beinahe entwurzelt worden; beinahe wäre sein Stamm mitten entzweigesplittert.
»Danke mir«, sagte die hohe Eiche, »mein Schutz hat dich bewahrt.«
»Meine gesunde Art ist das!« antwortete der Schmächtige, »nicht dein Schutz!«
Da packte ihn der Orkan von neuem, schüttelte ihn, bog ihn so arg, daß er bald sein Leben eingebüßt hätte.
»Ich rette dich immer wieder!« bemerkte die hohe Eiche.
Erbittert rief der andere: »Dir bin ich keinen Dank schuldig! Ich halte mich allein aufrecht! Ich allein!«
»Danke mir also nicht. Ich schütze dich trotzdem und verzichte auf deinen Dank!«
»Oh du Heimtückischer!« zeterte der Schmächtige, »du möchtest ja nur leugnen, wie viele gute Kräfte in mir lebendig sind, wie mächtig ich sein könnte, wenn du nicht ...«
Der Sturm riß ihm das übrige weg, erstickte jedes Gespräch und betäubte die alten, die großen wie die kleinen Bäume, alle miteinander, unter seiner Gewalt.
Er war hartnäckiger, dieser Sturm, als der Regen. Auch kühl war er; doch niemand fror, denn ab und zu wehte ein lauer Hauch wie zärtliches Versprechen in diesem Sausen.
Unter dem Riesenatem des Sturmes wurde der Schnee weggefegt, wurde die Erde so trocken, daß nur geringe Feuchtigkeit zurückblieb.
Den Rehen stob die Winterwolle in ganzen Büscheln vom Leib.
Ueber Nacht schlief der Sturmwind ein, als wäre er des langen Tobens müde und habe sich zur Ruhe bequemt.
Eine freundliche Sonne, die sogleich angenehm wärmte, stieg am wolkenlosen Firmament empor.
Erwacht, flatterten die Fasane von ihren Schlummerbäumen; ihr berstendes Gocken, selbst das Knattern ihrer Fittiche klang heller als sonst.
Mit einem Zwitscherruf flog die Amsel zur höchsten Spitze der hohen Eiche und schaute umher; dann begann sie schüchtern ihr Lied zu probieren. Es gelang ihr noch nicht völlig. Dennoch blieb sie dort oben sitzen, wo sie immer wieder eine kleine bescheidene Strophe sang.
Heftig trommelte der Specht; man hörte ihn weit in der Runde.
Geschwätziges Schakern der Elstern erscholl, dazwischen kreischte der Häher; man wußte nur niemals, ob er sich ärgerte oder vergnügt war.
Durch das Buschwerk wisperten die Meisen.
Jauchzender Falkenruf drang aus der Luft hernieder und wurde von den krächzenden Stimmen der Krähen übertönt.
Alle waren beschäftigt, Nester zu bauen oder noch verwendbare Nester auszubessern, eine emsige Arbeit.
»Nun mußt du zugeben, daß es herrlich ist«, forderte Gurri von ihrem Bruder.
»Es war höchste Zeit«, antwortete der, »höchste Zeit! Endlich! Länger hätt' ich's nicht ausgehalten!«
»Falsch!« korrigierte Gurri, »du hättest ausgehalten, mein Lieber. Du hast die ganze harte Zeit durchgemacht ...«
»Schwer genug!«
»Weil du's schwer genommen hast! Man sagt oft, das halte ich nicht aus und erträgt es doch; ja man weiß bei sich, daß man es ertragen wird und muß. Man weiß gar nicht, wieviel man aushalten kann!«
»Richtig!« sagte Faline, »das Schicksal möge uns nie so viel aufladen, wie wir ertragen können.« Sie wechselte den ernsten Ton, in dem sie gesprochen hatte: »Kinder, genießen wir die gute Zeit! Kommt auf die Wiese!«
»Jetzt? Am hellen Tag?« Geno staunte, »... und die Gefahr?«
»Wenn ich die Wiese vorschlage«, entgegnete die Mutter, »darfst du ohne Sorge sein! Das Schönste an dieser schönen Zeit ist ja, daß es keine Gefahr gibt. Nein, mein ängstlicher Sohn, Er tut uns nichts zuleid. Denn Er sucht uns jetzt nicht!«
»Geno!« rief Gurri, »Geno! Wahrhaftig, dir wächst eine Krone! Sieh nur, Mutter, sieh!«
Stolz hob Geno das Haupt.
»Na«, meinte Faline, die ihn wohlgefällig betrachtete, »einstweilen ist das nur ein Krönlein, nur der Anfang eines Krönleins. Aber in Anbetracht deiner Jugend, Geno, darf man sich wundern, wie früh dieser Anfang kommt und wie kräftig er ist.«
Zwei dünne Zacken waren an Genos Haupt sichtbar, klein, von Bast umhüllt, wirklich erst im Beginn des Entstehens, doch gut und deutlich wahrzunehmen.
Faline ließ den Blick nicht von ihrem Sohn. »Du siehst deinem Vater ähnlich«, sprach sie träumerisch.
»Genau so!« Sie seufzte leicht: »Oh, Jugendzeit! ... als er so jung war wie du, hat er genau so ausgesehen!«
Geno konnte sein Haupt nicht noch stolzer emporrecken. Aehnlichkeit mit dem Vater – Schmeichelhafteres war nicht zu denken.
»Vorwärts, gekrönter Bruder«, lockte Gurri, »zur Wiese!«
Alle drei rannten fröhlich hinaus.
Draußen aber stand Rolla mit Boso und Lana.
»Das ist doch deine Wiese, Gurri«, flüsterte Geno, sogleich verdrossen.
»Ach was!« erwiderte sie, »heute mag die Wiese allen gehören! Und du, Geno, solltest dich mit Boso versöhnen!«
»Er hat mich beleidigt!«
»Das ist längst vorbei!«
»Nichts ist vorbei«, trotzte Geno.
»Sei wieder gut«, bat Gurri, »mir zulieb!«
Sie lief den anderen entgegen.
»Wir haben uns lange nicht gesehen! Zum Gruß!« rief sie freundlich.
»Zum Gruß«, antworteten Boso und Lana, etwas fremd und nicht ohne Scheu.
Rolla schwieg.
»Tante Rolla, zum Gruß!« beharrte Gurri, »kennst du mich nicht mehr?«
»Gewiß kenne ich dich«, Rollas Wesen hatte etwas Gezwungenes, »aber deine Mutter scheint mich nicht zu kennen. Sie geht einfach an mir vorüber.«
»Oh, sie meint es nicht schlimm!« versicherte Gurri, »sie ist nur von dem wunderbaren Tag ...« Sie brach ab und rief: »Mutter! Tante Rolla ist da! Schau doch!«
Der zaudernden Faline sprang sie munter entgegen: »Komm doch und zeig dich nett, Mutter, ich bitte dich!«
Faline schritt heran. »Zum Gruß, Rolla ...« »Zum Gruß ...«
Doch es klang ohne die alte Herzlichkeit, und die beiden standen sich stumm gegenüber, bis Faline fragte: »Bist du jetzt ganz gesund?«
»Danke, soweit bin ich gesund. Nur hinke ich zuweilen noch ein wenig.«
Geno hatte seine Mutter mit Rolla sprechen sehen; er kam deshalb sorglos herzu, als Gurri ihn rief.
Während er sich näherte, rühmte sie ihn: »Mein Bruder hat schon eine Krone, den Anfang einer Krone. Ihr könnt sie sehen, von weitem sehen!«
Boso schaute gar nicht hin, und Lana bemerkte bloß: »Die ist ja kaum der Rede wert ...«
»Dein Bruder hat überhaupt nichts als den Platz, auf dem vielleicht einmal die Krone wachsen wird. Vielleicht!«
Diese Feststellung erregte bei Boso keineswegs Entzücken. Gurri hatte sich dazu hinreißen lassen, weil sie fühlte, daß man ihren Bruder nicht würdigte.
Als Geno sich zu der Gruppe fand, war Gurri wieder ganz friedlich. »Ihr sollt euch jetzt miteinander aussöhnen, ihr zwei!«
Boso erklärte: »Wenn er mich darum bittet ...«
»Ich dich bitten?« unterbrach ihn Geno, »du bist es, der sich entschuldigen muß, und ich würde dir dann verzeihen.«
»Verzeihen?« Boso lächelte spöttisch, »... weil ich mehr erlebt habe ... das willst du mir verzeihen?«
Geno blieb ruhig. »Jetzt geht es nicht mehr darum, wer mehr erlebt hat, du oder ich ...« Er bezwang sich.
Heftig fuhr Boso los: »Darum geht es! Darum allein! Ich war dem Tod nahe!«
Gelassen sagte Geno: »Auch ich ...«
Immer heftiger wurde Boso: »Aber mich hat Er gerettet, verstehst du? Er! Dich nur dein Vater! Was ist Er und was ist dagegen dein Vater? Soviel wie nichts!«
Bevor Geno noch antworten konnte, mengte sich Faline ein: »Du bist frech! Eine solche Sprache über Bambi verbiete ich dir!«
Nun meldete sich Rolla: »Du wirst begreifen, wenn Boso sich ungebührlich ausdrückt; er ist im Recht!«
»Sicherlich bin ich im Recht!« Boso rief das erbittert, »nicht wir, sondern ihr seid es, die um Versöhnung betteln! Das ist der beste Beweis!«
»Nie habe ich gebettelt«, Geno sprach noch immer ruhig, doch seine Stimme bebte erregt.
»Du hast mich mißverstanden, Boso«, Gurri behielt ihren freundlichen Ton, »ganz mißverstanden! Meine Absicht war gut!«
»Warum hast du dich überhaupt mit diesem Burschen eingelassen?« Falines Aerger stieg beträchtlich, »du weißt, wie hochnäsig, wie dreist er ist!«
»Mäßige dich, Faline!« drohte Rolla.
Doch Faline konnte sich nicht mehr zurückhalten. »Ich mich mäßigen? Du erlaubst dir, das zu sagen? Du? Du bist die letzte, die das wagen darf! Lange genug habe ich mich gemäßigt! Jawohl, dir gegenüber gemäßigt! Keinen einzigen Vorwurf hast du von mir gehört; aber jetzt erkläre ich dir, nur du bist schuld, daß Geno in Lebensgefahr kam! Du allein! Du hast den fremden Mörder auf Geno gehetzt und dich selbst in Sicherheit gebracht! Undankbar war dein Betragen, unmütterlich und feig! So! Jetzt weißt du, wie ich von dir denke! Nun kennst du meine Meinung!«
Sprachlos stand Rolla, sprachlos blieben die Kinder nach diesem Ausbruch. Rolla wollte sich zu einer Erwiderung sammeln; sie gelangte nicht dazu.
Faline fühlte sich erleichtert und rief: »Komm, Geno! Komm, Gurri! Geh'n wir! Lassen wir uns den schönen Tag nicht verderben.«
Sie pfeilte davon; die Kinder folgten ihr.
»Die sind wir los!« sagte Boso befriedigt.
»Ich kann nicht anders«, bekannte Lana, »ich schäme mich ...«
»Unbegreiflich«, grübelte Rolla, »daß mir Faline eine schlechte Absicht zumutet. Das verstehe, ich gar nicht ...«
»Kümmere dich nicht darum«, tröstete Boso, »die ganze Familie ist nicht zu ertragen mit ihrem Stolz auf Bambi ...«
»Schweig!« herrschte ihn Rolla an, »du bist eingebildet und dreist! Deine albernen Reden über Bambi können uns allen sehr schaden und dir am meisten!«
Im Buschwerk spazierte Faline mit den Kindern ohne Hast. Keines traute sich, die Mutter anzusprechen, bis sie selbst begann: »Froh bin ich, daß ich dieser Rolla die Meinung gesagt habe.«
Geno fügte hinzu: »Jedenfalls hat Boso gehört, was er verdient. Er ist zu anmaßend ...«
»Auch Rolla hat gehört, was sie verdient!« Faline versuchte zu wirken, »oder zweifelt ihr daran?«
»Ja, Mutter«, bekannte Geno, »ich zweifle, daß Tante Rolla so harte Worte verdient ... sie war eigentlich immer nett ...«
»Und du, Gurri, wie ist es mit dir?«
»Nein, ich zweifle keinen Augenblick. Ich bin überzeugt, du tust Tante Rolla Unrecht! Bitter Unrecht! Sie war krank, sie konnte nicht weiter, hatte sicherlich keine böse Absicht, als sie, müde gehetzt, zufällig bei uns zusammenbrach ...«
»Nun, mein Kind, ich sehe die Sache anders ...«
»Wenn ich schon meine Ansicht äußern darf«, fuhr Gurri fort, »so seid ihr sogar mit Boso zu streng.«
»Zu streng?« widersetzte sich Geno, »was er nur über den Vater gesagt hat ...«
»Freilich! Freilich, das war arg«, gab Gurri zu, »Boso ist keck, er ist anmaßend ... aber was er durchgemacht hat, war kein Spaß ...«
»Das sagst du?« fiel ihr die Mutter ins Wort, »du, die am meisten erlebt, am meisten gelitten hat?«
»Ach, längst vergangene Geschichten!« wehrte Gurri heiter ab, »daran denk ich doch längst nicht mehr ...«
»Vielleicht, Mutter«, ließ sich Geno vernehmen, »vielleicht urteilt Gurri gerade deshalb so mild, weil sie weit Schlimmeres erlitten hat als Boso und ich zusammen.«
»Sei still«, bat ihn Gurri, »mir zu Gefallen redet nicht mehr von dieser Sache.«
»Gut«, stimmte Faline zu, »doch ich bedaure, daß wir zu Boso und Rolla nicht davon gesprochen haben!«
»Und mich freut es!« lächelte Gurri, »ich bedaure nichts als das Zerwürfnis.«
»Warum?« meinte Faline, »diese Trennung werden wir hoffentlich ertragen ...«
Gurri wurde ernst: »Ertragen kann man noch ganz andere Dinge! Aber mir scheint es doch eine Art Unglück, wenn Freunde sich zerstreiten und auseinanderkommen.«
»Man wird schon Ersatz finden!« sagte Faline.
»Man hätte neue Freunde gewonnen«, entgegnete Gurri, »neue, ohne die alten zu verlieren. Verlust bleibt Verlust. Du magst das nehmen, wie du willst.«
»Mit dir mag ich keinen Wortwechsel führen«, Faline schaute die Tochter glücklich an.
Geno schwieg, dachte sich aber etwas Aehnliches.
Ersatz für Boso und Lana fand sich bald. Darin hatte Faline allerdings richtig prophezeit.
Sie gingen nach wie vor zur Wiese hinaus. Gurri bestand darauf mit der wiederholten Erklärung, das sei ihre Wiese, der weder die Mutter noch der Bruder widersprachen.
Ein paarmal trafen sie Rolla und deren Kinder; immer war es wenig angenehm, ihnen zu begegnen.
Beide Familien stellten sich an, als wäre die ändere nicht vorhanden. Doch beiden Teilen wurde es schwer, keine Notiz voneinander zu nehmen, obwohl alle so taten, als wäre das ein selbstverständlicher, ein natürlicher Zustand.
Doch das war nicht selbstverständlich und nicht natürlich. Alle wußten, alle empfanden das, wenngleich sie sich Mühe gaben, nichts merken zu lassen.
Besonders Gurri hatte es nicht leicht. Oft fühlte sie sich versucht, Rolla oder Lana anzureden; oft spürte sie bei Rolla, bei Lana, sogar bei Boso das Bedürfnis, zu sprechen. Aber dazu kam es nie. Stumm vollzog sich der Kampf, der doppelte Kampf um die Wiese und um das Andauern der Fremdheit. Denn Feindschaft konnte man es kaum noch nennen.
Faline behauptete mit den Kindern ihr Recht an der Wiese. Eigentlich siegte Gurri durch ihre Hartnäckigkeit. Rolla und die Ihren blieben fort, kamen nicht wieder.
»Ich möchte wissen, wo sie sind«, äußerte Gurri nach einer Reihe von Nächten und Tagen.
»Hast du wirklich keinen andern Gedanken im Sinn?« gab Faline lässig zurück. »Mir ist das gleich!«
»Hoffentlich ist ihnen nichts zugestoßen ...« Gurri wurde ängstlich.
»Jetzt passiert niemandem von uns etwas«, beruhigte die Mutter.
Geno schwieg. Ihn erregte das undeutliche Bewußtsein, er wäre die Ursache der Streitigkeiten. Dessen entschlug er sich zuweilen, und zuweilen hatte er Anwandlungen leiser Reue.
Eines Morgens erschienen auf der Wiese zwei fremde Rehe. Zwei Kinder, so jung wie Geno und Gurri. Beider Stirnen zeigten die schwachen Ansätze künftiger Kronen.
Schüchtern kamen sie daher, zögerten furchtsam bei jedem Schritt, hoben anmutig und scheu die zarten Läufe, und ihr Betragen verriet, sie hielten dieses Unternehmen für ein kühnes Wagnis, waren jedoch getrieben von ratloser Sehnsucht nach Kameraden.
Gurri sprang ihnen entgegen und bot freundlichst den Gruß.
Geno folgte mit Faline.
»Wie heißt du?« fragte Gurri den einen.
»Nello ...« flüsterte der.
»Und du?« stellte Geno den andern.
Mühsam brachte der hervor: »M...m...m...Mem...bo ...« Er stotterte.
»Membo ...«, wiederholte Geno, »ist das so recht?«
»Re...re...recht!« bestätigte Membo.
Gurri lachte. Nun lachten alle zusammen.
Doch als Faline fragte: »Seid ihr allein?« wurden die zwei fremden Kinder ganz ernst.
»Wir sind allein ...« sagte Nello.
Faline forschte weiter: »Wo ist denn eure Mutter?«
Membo stotterte sehr: »Wi...wi...wi...wir ha...ha...haben ke...ke...kei...ne m...mehr!«
»Unsere Mutter«, ergänzte Nello trübselig, »ist im großen Schrecken von der Feuerhand erschlagen worden ...«
»Arme Kinder!« rief Faline, »so lange schon seid ihr verwaist! Wollt ihr bei mir bleiben?«
»Oh, wie gern!« antwortete Nello rasch.
Membo druckste: »D... das ... das ...!« Er konnte vor Rührung nicht sprechen.
»Ihr seid Brüder?« redete Faline gütig.
»Brü...Brü...der...der ...«, nickte Membo.
»Nun, liebe Kinder«, erklärte Faline, »nehmt ihr mich als Mutter?«
»Dankbar! Unendlich dankbar!« rief Nello erschüttert.
»Vo...vo...von He...He...Her...Herzen ...«, schloß sich Membo an.
»Dann sind hier eure Geschwister, Geno und Gurri«, fuhr Faline fort.
Begeistert und angestrengt ließ sich Membo vernehmen:
»D...d...die Ki...Ki...Kin...der vo...vo...von Bam...Bam...bi!«
Nello schaute selig drein: »Du bist die berühmte Gurri?«
Sie lachte: »Die Gurri bin ich! Das ›berühmt‹ laß weg!«
Membo wendete sich zu Geno: »D...d...du h...h...hast ein ge...ge...fähr...fähr...lich...lich...es ...«
»Ein gefährliches Abenteuer hast du erlebt!« half Nello dem Bruder, »zum Gruß, Geno! Du bist der prächtigste unter uns Jungen! Kein Wunder! Du bist ja der Sohn von Bambi!«
Geno sagte aufgeräumt zu Gurri: »Das hätte Boso hören sollen!«
Die Freundschaft war geschlossen und wurde innig.
Nello und Membo hatten nicht die geringste Scheu mehr. Sie bestürmten Faline enthusiastisch mit dem Namen Mutter. Dieses Wort, so lange von ihnen nicht ausgesprochen, bereitete ihnen nun, da sie es gebrauchen durften, unerschöpfliche Wonne.
Sie zeigten sich gehorsam und bescheiden.
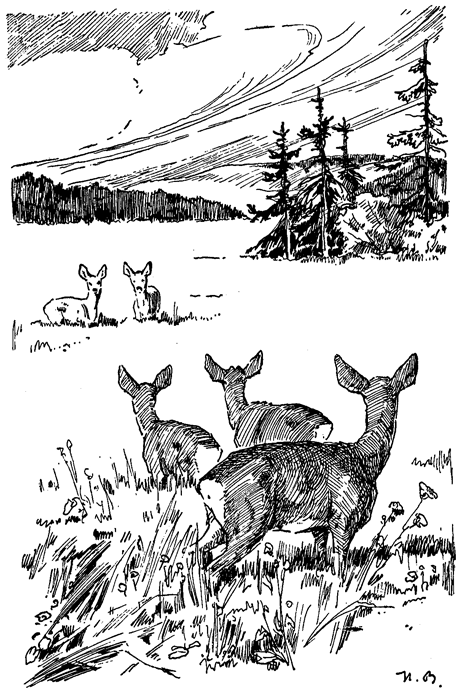
Nello gab sich munter, doch er war wortkarger als sein stotternder Bruder, der immerzu plauderte.
»Wa...wa...was für ei...ei...ein Glü...Glück, bei... bei euch zu...zu sei...sein!« beteuerte er treuherzig.
Oder er brach ohne Anlaß in das Geständnis aus: »Mu...Mu...Mut...ter ... du...du...du bi...bi...bist wu...wu...wun...der...bar ...!«
An Gurri richtete er weitläufige Liebeserklärungen, die sie geduldig anhörte. Und Geno huldigte er geradezu.
Nello stand ihm bei, half ihm, wenn Membo zu arg an einem Satz herumwürgte, und teilte beständig dessen Ansichten wie dessen Empfindungen.
Geno war von der neuen Kameradschaft entzückt. Das Lob, das er empfing, tat ihm wohl; die hohe Stellung, die ihm von den Brüdern unter der Jugend zuerkannt wurde, machte ihn stolz, doch glaubte er daran, und damit gewann er mehr Glauben an sich selbst.
»Hat Membo immer so gestottert?« erkundigte er sich bei Nello, »ich meine, immer so wie jetzt?«
»Das stört wohl sehr?« Nello war besorgt.
»Aber gar nicht!« versicherte Geno, »wirklich kein bißchen! Im Gegenteil, Gurri und ich finden, daß das Stottern Membo nur noch liebenswerter und netter macht ...«
»Früher«, erzählte Nello, »früher ist es nicht so schlimm gewesen. Membo hat freilich von klein auf schwer gesprochen. Aber seit dem großen Schrecken stottert er sehr. Davon kann er sich nicht erholen.«
»Da ist gar nichts Entsetzliches!« widersprach Geno fest.
Die vier Kinder vertrugen sich so glänzend, daß Gurri den einstigen Gefährten kaum noch einen Gedanken widmete.
Sie spielten miteinander, sie schliefen zusammen, dicht an Faline geschmiegt, die der Familienzuwachs mehr und mehr beglückte.
»Ich hab's ja gesagt«, sprach sie zu Geno, »ich hab's gewußt, daß sich Ersatz finden wird.«
Geno erwiderte: »Das ist schon mehr als ein Ersatz!«
Faline stimmte zu: »Und besser als bloßer Ersatz!«
Auf der Wiese rannten sie zu viert um die Wette.
So ungeschickt Membo im Reden war, so behend war er im Laufen. Ihn konnte keiner einholen.
Gelegentlich eines solchen Rennens sagte Nello, der mit Gurri zurückblieb: »Jetzt erst, da wir bei euch sind, wird es uns ganz klar, wie schlimm die Zeit des Alleinseins gewesen ist.«
Gurri entgegnete: »Schade, daß ihr nicht früher gekommen seid!!«
»Uns hat der Mut gefehlt ...«
»Wieso gehört denn dazu Mut?«
»Ach, du ahnst nicht, wie oft wir versucht haben, uns anzuschließen, und wie oft wir wenig freundlich behandelt wurden ...«
»Unverständlich!«
»Ja, für euch! Ihr, die ihr Bambi zum Vater habt, könnt das nicht begreifen! Je länger wir allein waren und je öfter es uns mißlungen ist, Freunde zu finden, desto mehr ist Membo ins Stottern geraten ...«
»Der liebe Membo«, sagte Gurri, »dann dürfen wir, wenn er sich wohl fühlt, vielleicht sogar hoffen, daß sein Zustand sich wieder bessert! ...«
Als sie eines Abends hinaustraten, ragte die Wiese voll hellgrüner, länglicher Grasblätter, die mit einer gewissen Keckheit aufrecht standen. Lauch, der über Tag aufgeschossen war.
»Frische Nahrung!« jubelte Gurri.
»Nach so langer Zeit frisches Wachstum!« lobte Geno.
Sie kosteten sogleich davon.
»Scharf, aber gut!« urteilte Nello.
»Ein bißchen Schärfe geniert mich nicht ...«, meinte Gurri.
»Hauptsache ist die Frische!« erklärte Geno.
Da warnte Faline: »Hütet euch, Kinder! Das Zeug verlockt euch! Ich verstehe das ... aber es ist ungesund! Ihr werdet krank davon! Eßt nur ganz wenig ... am besten, ihr eßt gar nichts!«
»Nur noch einen Bissen ...« Geno bat enttäuscht um diese Gunst.
»Einen Bissen, meinetwegen!« erlaubte die Mutter, »aber ja nicht mehr!«
Nello und Membo hatten sofort zu essen aufgehört.
Gurri naschte noch ein Blättchen, dann existierte der Lauch nicht mehr für die Kinder.
Bei ihrer Heimkehr zur gewohnten Schlummerstätte fanden sie Perri, das Eichhörnchen, schon wach.
Perri saß an den Stamm der Buche gelehnt. Die Fahne, buschig, unternehmend hochgepflanzt, daß sie über das kleine, kluge Köpfchen hinausschaute. Und so knackte Perri vergnügt eine Haselnuß.
»Denken Sie nur!« rief das Eichhörnchen lustig, »denken Sie nur, ich habe meine Vorräte gefunden!«
»Wie gut für Sie!« antwortete Gurri.
»Ob das gut ist!« Perri war glücklich, »jetzt bin ich schon satt und werde lange genug zu essen haben! Es war Zeit, denn ich wäre beinahe elend verhungert!«
»Wir freuen uns alle!« Gurri führte die Unterhaltung.
»Ich weiß freilich nicht«, plauderte Perri, »ob diese Vorräte wirklich mir gehören.«
»Dann begehen Sie ja ein Unrecht, wenn Sie davon essen!« ermahnte Geno.
»Mein junger Prinz, Sie verlangen gar zuviel!«
»Gar nichts verlange ich!« sprach Geno, »ich meine nur, man sollte doch ein Gewissen haben. Auch wir müssen oft hungern.«
Perri wurde ordentlich überlegen: »Wenn Sie mit knurrendem Magen vor aufgehäuften Speisen stehen, werden Sie sich dann darum kümmern, wem die üppige Mahlzeit gehört?«
»Darauf möchte ich lieber nicht antworten ...« Geno war verlegen.
»Nun sehen Sie«, Perri richtete sich auf, legte beide Vorderpfoten an die weiße Brust und lachte, »Sie können sich das eine merken: Wer hungrig ist, hat kein Gewissen!«
Geno gab seinen Standpunkt noch nicht verloren. »Damit rechtfertigen Sie alle Räuber und Mörder!«
»Keine Spur!« erwiderte Perri, »ich rechtfertige sie keineswegs ... ich begreife sie nur!«
»Und die Opfer?« fragte Geno.
»Die Angst und Empörung der Verfolgten begreife ich ebenso«, erklärte Perri, »ich bin selber oft in Gefahr gewesen ...«
Sie nahm eine neue Haselnuß und knackte sie behaglich auf.
Membo ließ sich hören: »So... so spri...spri...spricht je...je...je...jemand, d...d...der si...si...sich i...i...in Si...Si...Si...Sicher...heit be...be...fin...det u...und k...k...kei...ne ... Sor...Sor...Sorgen ha...hat!« Erschöpft schwieg er.
Gurri lobte den Stotterer: »Das ist richtig! Du bist brav.«
Gerufen von Faline gingen sie schlafen.
Indessen schmauste das Eichhörnchen ungestört weiter.
* * *