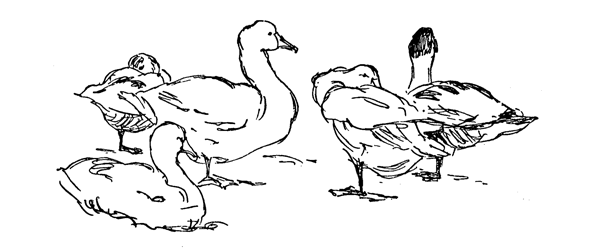|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Iß Gans Martini,
Wurst in Festo Nicolai
In Blasie Lemper,
Hering Oculi mei Semper ...«
Alter Spruch.
Ihr Charakterbild schwankt in der Geschichte. Bald hält man sie für weise und hilfreich, bald für dumm und boshaft. Ihr Fleisch erfreut, ihr Fett heilt, ihre Federn hüllen die müden Menschenknochen sänftiglich ein.
Schon die alten Ägypter liebten sie; man braucht nur die köstlichen »Gänse von Mêdûm«, eine uralte Malerei im Museum zu Kairo, zu betrachten, um dies zu fühlen, aber auch die Häufigkeit, mit der sie als Schriftzeichen angewendet wurden, spricht für ihre Popularität. Man sagt, daß Rhadamantys von Lykien nicht bei den Göttern schwören ließ, sondern bei den Gänsen, und zur Zeit Cäsars sollen sie in England gleichfalls Eideshelfer gewesen sein. Jedenfalls hat sich das Gänslein einen starken Platz im Kultus wie in der Kultur erworben. Ich gedenke der Kapitolsretterinnen zur Zeit des Manlius; der Martinsgans, die aus den heidnischen Herbstopfern sich in die christliche Mythologie rettete; des englischen Weihnachtsbratens, der bis zur Königin Elisabeth zurückgeht und auf die Meldung des Sieges über die Armada Philipps II. – bei welcher Gelegenheit er patriotisch-symbolisch erklärt wurde.
Natürlich gibt es noch besondere geographische Finessen. Die Römer schätzten die Watschelkinder der Pikardie so hoch, daß stets ganze Trupps der Weißfedern nach Italien unterwegs waren. Heutzutage ist es der Oderbruch, der als besondere Heimat der Gans gilt, und Pommern-Mecklenburg. Vor dem Kriege kamen alljährlich auch ungeheure Schwärme schmutziger und zerraufter Gänse aus Galizien und Südrußland in jammervoll niedrigen Holzkäfigen über die Grenze: aber sie ließen sich mit den deutschen nicht vergleichen, selbst nicht, wenn sie eine Weile deutsche Haferkultur genossen hatten. Ich sah einmal, wie eine solche, Tausende von Exemplaren umfassende starke Herde umgeladen werden sollte. Willig und geduldig, wenn auch unter regem Geschnatter zog die Schar über die Bahnhofsrampe. Es war ein grauer Herbsttag. Da flog hoch über den Wolken ein Dreieck wilder Gänse mit rauhem Schrei vorüber und entfesselte in den milden Hausgänsebrüsten vergeßne Schauer. Weit spannten sich die von der Reise zerfederten Flügel, die Hälse streckten und die Schnäbel sperrten sich, und unter markerschütterndem Geschnatter drängte die Schar nach dem Walde; im Handumdrehen waren alle Steige überflutet, und eine wilde Jagd der Bahnbeamten nach dem rebellischen Getier begann ...
Die Edelgans jedoch muß aus dem Elsaß stammen; sie, deren Leber vor Stolz – und Nudelung zu ungeahnter Schönheit schwillt und in einer schwarzäugigen Pastete ruhmreich begraben wird. Was zu ihrem Lobe zu Leyer und Tintenfaß gesungen worden ist, würde ein ganzes Lexikon füllen. Grimod de la Reynière nennt sie die Königin der Genüsse; ein großer Magenarzt meiner Bekanntschaft: die »Männerwürgende« frei nach Homer. Die Homerischen Helden waren zu derbe Genießer, um von einem so kleinen Tierdetail viel Aufhebens zu machen, aber von Penelopeia erfahren wir doch, daß sie auch eine Herde Gänse ihr Eigen nannte.
Und damit haben wir das Gebiet der Gans in der Literatur betreten. Zunächst spielt sie im deutschen Märchen eine große Rolle. Da ist die Gans mit den goldenen Eiern, ein Abbild treuen Bürgerfleißes, deren Gaben mit dem Tode durch gierige Kommunistenhand dahin waren. Da ist Hans im Glück, dem durch Tausch das liebe Tierchen anheimfällt, da ist Hauffs Gans Mimi, die dem armen Zwerg Nase das Kräutlein Augentrost suchen hilft. Da ist »Grane, die Schlaue«, die in den »Königskindern« von Humperdinck das Krönlein hütet. Da sind die zahllosen Schutzbefohlenen der armen barfüßigen Gänsemädel, die nachher des Königs Sohn heiraten. Aber auch die neuere Literatur hat sie gewürdigt. In lebendem Zustande Tschechow in seiner rührenden Novelle von Herrn Ivanow, dem dressierten Gänserich, in dessen Todesnacht der Schauer des Unfaßbaren alle stumme Kreatur überfliegt. In gebratenem Zustande ist mir vor allem das große Gänsefressen im »Assomoir« von Zola unvergeßlich: »Gervaise trug die Gans mit steifen Armen, ihr Gesicht war in Schweiß gebadet und strahlte von einem breiten sprachlosen Lächeln ... Als die Gans auf dem Tische stand, nahm man sie noch nicht gleich in Angriff. Das ehrfurchtsvolle Erstaunen und die Überraschung hatten der ganzen Gesellschaft die Sprache geraubt. Man zeigte sie einander mit Augenzwinkern und leisem Kopfnicken. Heiliger Himmel! War das eine Dame! Waren das Hüften! Und welch' ein Bauch! ...« Schließlich bekommt der Stadtsergeant, weil er im Waffenhandwerk erfahren ist, den ehrenvollen Auftrag, die Dicke zu tranchieren. Und dann »fiel man wütend über die Gans her«. Es ist wahrlich eine homerische Schlacht mit Messer und Gabel, die der große Naturalist beschreibt. Ein anderes, halb wehmütiges Mahl schildert Fedor von Zobeltitz in seinem Roman »Die Glücksfalle«. Da bringt der alte Clown seinen ebenso alten Gänserich als Hochzeitsbraten mit, und Tränen laufen ihm über das Fratzengesicht, während er sich doch das knusprige Fleisch gut schmecken läßt. Ein gar sonderbares und nicht näher anzudeutendes Amt gibt Rabelais in seinem »Gargantua« den jungen Gänschen. Begnügen wir uns zu sagen, daß sie flaumig sind und weich – – –
Schon die allerältesten Kochbücher geben Rezepte für die Bereitung der Gans. Apicius kennt mehrere Arten der Zubereitung, die sich aber nicht wesentlich von der anderer Geflügel unterscheiden. Ein französisches geschriebenes Kochbuch aus dem 14. Jahrhundert meint, die Vögel seien gut im Sommer wie im Winter, doch solle man sie mit heißem Pfeffer und Salz bestreuen und mit Mostrich essen, während Taillevent in seinem »Viandier« sie so wenig schätzt, daß er sie auf keinem seiner Banketts, wo es sogar Adler, Reiher und Schwäne gibt, nennt. Doch kennt er eine Art der Bereitung, die wohl des Erwähnens wert ist. Er nennt sie merkwürdigerweise Oyes à la Traïson – auf verratene Art. Ein am Spieß gebratenes Tier soll mit Speck, allerhand Gewürzen und Zucker in einen irdenen Topf getan, Geflügelleber und Brotschnitte dazu geworfen und das Ganze mit Senf gedämpft werden. Das muß ungefähr wie ein Senfpflaster geschmeckt haben. Aber die Franzosen der eisernen Zeit liebten so etwas. In englischen Kochbüchern aus dem 14. und 15. Jahrhundert spielt die Gans schon eine bedeutende Rolle. »Take Gees and smyte hem on pecys«, heißt es dort, »wirf sie in einen Topf, halb mit Wein, halb mit Wasser gefüllt und tue eine gute Menge Zwiebeln und Kräuter dazu.« Oder »Fülle sie mit einer Farce (cawdel) von geriebenem Knoblauch, Saffran und in Kuhmilch geweichtem Brot.« Ein mittelalterliches deutsches Kochbuch aber rät zu einer »Gense, di niht alt si«, die man des Kleins berauben und dann in Wasser auf einem Dreifuß sieden und mit süßer Milch, Eigelb, Knoblauch, Saffran und Kondiment (Gewürz) »erwallen« lassen solle. Ein Klosterkochbuch von vor 300 Jahren kennt eine »Saltze« aus Wein, Essig, Knoblauch und Muskat oder auch aus Kirschen mit Weißbrot und Wein. Diese Saltze sollte man durch ein Sieb streichen und der am Spieß gebratenen Gans beigeben.
Die Renaissance der französischen Kochkunst vor und nach der Revolution wandte sich hochnäsig von dem Martinsvogel ab. Die Carême, Vatel und wie die Köche jener Zeit alle heißen, erklärten sie für keinen Braten einer vornehmen Tafel würdig. Nur die Leber ließ man gelten, besonders seit Close, der Mundkoch des Marschall von Contades bei dessen Aufenthalt im Elsaß im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, sich das dortige treffliche Material zu nutze machte und die köstliche Pastete »de foie gras« erfand, die später durch Sieur Doyen auf den Gipfel der Vollkommenheit geführt wurde. Desselben Doyen, dessen Nachkommen auch heute noch an der Spitze der Gänseleberfabrikation Straßburgs stehen.
Die moderne Zeit hat die Gans mehr und mehr dem Naturzustand des Gebratenseins zurückgegeben. Freilich nicht so, wie es die grausamen Gastronomen des Mittelalters machten, die eine Gans lebendig gerupft ans Feuer brachten und es für einen guten Trick hielten, wenn das arme Tier erst unter dem Tranchiermesser seinen letzten Seufzer tat. Schon lassen viele gutherzige Hausfrauen ihre Gänse nicht mehr »pflücken« und verbieten das »Nudeln«, jenes Vollstopfen der regungslos im kleinen Käfig gehaltenen Tiere mit Kraftfutter, das zu der erwünschten Hypertrophie der Leber führt. Aber die Anzahl der verkauften Pasteten hat trotzdem nicht abgenommen, und mancher, der eine derartige Tierquälerei in seinem Hause nicht dulden würde, ißt selig seine Leberpastete, um die »da hinten fern in der Türkei« – oder dem Elsaß – etliche Gänse den grausen Märtyrertod erlitten.
Unter den zahllosen Rezepten, eine Gänseleber zu bereiten, kenne ich drei besonders originelle: nämlich sie mit Mandeln gespickt zu braten, kleine Beignets daraus zu machen in feinem Backteig, oder sie in Papilloten in der Asche zu rösten.
Aber die Gans, deren Kielen so viele Meisterwerke entströmt sind, hat nicht viele Dichter gefunden, um sie zu feiern. Sie befeuert die Phantasie anscheinend nicht so wie der Schwan oder das Pferd. Sie ist vielleicht nicht hervorragend begabt – obwohl sie ihre Jungen trefflich schützt und sich wohl dressieren läßt. Keinesfalls aber verdient sie den häßlichen Grabspruch aus der »Ecole de Salerne«:
»L'oie est un oiseau stupide,
Qui doit être sans cesse dans un endroit humide
Il le faut abreuver, l'axiome est certain,
Vive elle veut de l'eau; morte elle veut du vin.«