
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
1. Das Alpengebäude. – 2. Alpenstraßen. – 3. Über den Splügen nach Chiavinna. – 4. Die Tallandschaft des Engadins. – 5. Das Appenzell und seine Landsgemeinde. – 6. Der Vierwaldstätter See und das Rütli. – 7. Über und durch den St. Gotthard. – 8. Ein Bergsturz im Kanton Schwyz. – 9. Von Interlaken zur Jungfrau. – 10. Durchs Wallis zum Genfer See. – 11. Die Eroberung des Montblancs.

Quellen: A. v. Berlepsch, Die Alpen. 5. Aufl. Jena 1885, H. Costenoble: Prof. Dr. Frech, Das Antlitz der Hochgebirge. Aus der Natur, 1906, I; J. Blaas, Struktur und Relief in den Alpen. Ztschr. d. D.-Ö. Alpenvereins, 1904. S. 1. »Die Alpen sind das bekannteste und besuchteste Hochgebirge der Erde, und doch nur wenige Menschen kennen die wirkliche und volle Majestät des Alpengebäudes. Sie entschleiert sich da am allerwenigsten, wo die breiten Heerstraßen über Joche und Bergsättel laufen oder wo das kleinliche Treiben des alltäglichen Verkehrslebens an die Fußschemel dieses Schöpfungswunders sich herangewagt hat. In die Geheimnisse der verborgenen Gebirgswelt mußt du hineindringen, in die Einsamkeit der scheinbar verschlossenen Schluchten und Taltiefen, wo der Kulturtrieb des Menschen ermattet, über Urweltgetrümmer mußt du klimmen, durch Gletschergeklüft und Eiswüsten in das Tempelheiligtum eingehen, welches sich dort vor deinem erbangenden Blicke frei und kühn in den Äther emporwölbt. Da wird sie dir entgegentreten, die unbeschreiblich hohe Pracht der Alpenwelt in ihrer ganzen Herrlichkeit und Größe, da wird's mit Geisterstimmen mächtig dich umrauschen, und überwältigt wirst du niedersinken vor diesem verkörperten Gottesgedanken. Und hast du dich dann aufgerafft von dem ersten gewaltigen Eindrucke, hast du im Anschauen der riesigen Massen das Herz dir ausgeweitet und empfänglich gemacht für noch größere und herrlichere Offenbarungen, dann richte kühn eine Frage an jene Gebilde unvordenklicher Zeiten, dann forsche, welche Hand sie emporgehoben hat aus der Tiefe ewiger Nacht in das Reich des Lichts, dann schlage die Geschichte ihrer Schöpfungstage in den Felsenblättern dieser versteinerten Weltchronik nach und erforsche den Zweck ihres Daseins, und die großen toten Massen werden sich beleben, es wird sich dir ein Blick erschließen in den unendlichen Kreislauf der Ewigkeit.«
Je älter die Erde wird, desto mehr runzelt sich ihre Haut. Diese Runzeln aber sind gewaltige, berghohe Falten, landgroße Schuppen und Schilder. Sie erhoben sich aus dem Meere und boten den abtragenden Kräften neue Angriffspunkte. Nicht alle abgesetzten Schichten konnten dem Schub bei der Zusammenziehung in demselben Maße folgen; denn einige waren spröde und zerbrachen und zersplitterten, einige waren schmiegsam und falteten sich. Unter riesenmäßigem Drucke wurden selbst spröde Massen mehr oder weniger gefüge. In Hohlräume zwischen Schichten verschiedener Spannung drängten sich aus der Tiefe glutflüssige Massen: Porphyre und Granite. Die Falten wälzten sich nordwärts, sie überschoben sich: drei solcher überschobener Decken hat die neuere erdgeschichtliche Forschung festgestellt – aber alle diese Vorgänge sind für das Antlitz der heutigen Alpen nicht so bestimmend gewesen als das diluviale Gletschereis, das mit all seinen Kräften noch heute in der Gipfel- und Kammregion in Resten wirksam ist. Penck und Brückner, die den Eiszeitspuren der Alpen wissenschaftlich folgten, erkannten, welch tiefgehende Wirkung der Gletscher auf die Landschaft ausgeübt. Sie stellten fest, daß die Landschaft sogar ein Werk der Vereisung sei. Wo der Gebirgswelt die Vergletscherung fehlt, da gehen ihr auch die landschaftlichen Reize verloren. Wie anders erscheinen die Gebiete, welche einst vergletschert gewesen! Es zeigen sich Seitentäler, die in Form von Stufentälern gleich mächtigen Kanälen in das Haupttal münden und stets am Ausgang sich in eine wilde Klamm verengen. Sie hat das Wasser in die vor diese Stufentäler geschobenen Riegel genagt. Das häufige Auftreten dieser Riegelbildung aber läßt an den Abschluß großer Seebecken denken. Es finden sich wohl auch noch Spuren von solchen, aber sie sind abgelassen oder durch aufgehäufte Kiesmassen verschüttet. Alle Beobachtungen lehren uns, daß nicht rinnendes Wasser, auch nicht Schollenbewegungen, sondern nur der Gletscher diese Seebecken geschaffen haben kann. Die Becken sind aus dem Untergrund durch den sich bewegenden und verschiebenden Gletscher hervorgegangen, aber meist sind die Gletscher seit der Eiszeit verschwunden. Nur dort, wo das fließende Wasser gering war, oder in den unteren Alpentälern sind die letzten Reste der Kette von Seen im Alpengebiet als das Ende der vertiefenden Gletscher zu finden. Wenn wir die voreiszeitliche Landschaft wieder aufbauen, so ergibt sich, daß das Alpengebiet vor seiner Vergletscherung eine »reife« eintönige Tallandschaft, ähnlich der des Felsengebirges, darstellte.
Die Ausfurchung der Täler durch fließende Gewässer, die seit dem Emportauchen der ersten Faltengewölbe bis zu unseren Tagen zerstörend und verfrachtend arbeiten, kommt erst in zweiter Linie in Rechnung.
Die Zentralalpen sind am höchsten und stärksten emporgefaltet, sie sind daher am meisten von der Zerstörung erfaßt und bis auf das härteste Grundgestein, bis auf Glimmerschiefer und Gneise, und bis auf die tiefsten Schichtgesteine entblößt – ihre Formenwelt ist deshalb wild und kühn, besonders, weil sie zumeist über die Schneegrenze emporragen. Dort arbeitet der Spaltenfrost des Nachts in den Gesteinsfugen und bildet frischbrüchige Steilwände; dort lockert die senkrecht anprallende Sonnenglut des Tages das Gestein und füllt die Risse mit Schmelzwasser. So entstehen in den Felsregionen der Hochalpen die Kare, jene kessel- oder nischenförmigen Hohlräume unter den zackigen Graten – mit ihren senkrechten Wänden, über die nach jedem Schneefall Staublawinen herabfegen und jede Unebenheit wegreißen. Am Boden der Nischen lagern sich dann die Schneemassen zu Halden, bilden sich zu Firnmassen um – und geraten schließlich ins Gleiten und werden Gletscher, die aus der Hochregion als Eisströme ins Reich der Matten und Wälder hinabfließen. Die Lawinen sind die Wildbäche, die Gletscher die Ströme der Fels- und Firnregion.
Die Kare mit ihren frostverwitterten Steilhängen und ihren schnee- oder seeerfüllten Böden sind für die Hochalpen, für die Gebiete über der heutigen oder früheren Schneegrenze die typische Oberflächenform, wie Dünen für Wüsten und Klippen für Steilküsten. Wo sie vorkommen, kann man auf einstige Vereisung des Gebirges schließen. In den Ostalpen treten sie oberhalb 2100 m auf – sie werden mit dem Sinken der Schneegrenze gegen Westen häufiger und sind dann meist mit Firn erfüllt.
Der Anblick solcher Fels- und Firnlandschaften in den höchsten Alpenregionen ist eigentümlich genug: die weichen Schnee- und Firnformen, seien es nun Firnmulden, Gletscherströme, Schneeflecke, stechen nach Form und Farbe von den zackigen, schroffen Felsengraten, -wänden, -zinnen ab. Überwiegt der Firn, der sich als nachgiebige Masse in jede irgendwie geschützte Stelle schmiegt, so schauen die schwarzen Felsen wie aus den Löchern eines zerrissenen weißen Gewandes hervor. Scharf heben sich im reinen Höhenlicht ihre Schattenbilder darauf ab, oft durch die Neigung und Wölbung des Schneefeldes zu seltsamen, blauen Figuren verzerrt.
Geschwollen wälzt sich die verfirnte Schneemasse als Gletscher in langen Tälern hinab, in der Mitte rascher als an den moränenbesetzten Ufern »fließend«, daher mit Querspalten in sanfter Kurvenform die Spannungen lösend – oder wo sich das Gletscherbett plötzlich weitet, in Längsspalten klaffend sich breiterhin lagernd – und aus dem gähnenden Schmelztor am Ende der Zunge dringen aus blaugebändertem Eispalast milchige Gewässer hervor.
Der Name Gletscher wird in der Regel nur für einen Teil des Gletschers gebraucht, für die Gletscherzunge. Sie ist jedoch durchaus nichts Selbständiges, sondern nur als Abfluß eines großen Beckens zu bezeichnen, das in der Hochregion liegt und Firnmulde genannt wird. Diese Firnmulde, gewöhnlich eine breite, flache Mulde mit scharf abgesetzter Randspalte, ist das Nährgebiet des Gletschers; die Zunge, die übrigens nur ein Drittel der Fläche der Firnmulde umfaßt, stellt sein Zehr- oder Abschmelzgebiet dar. Nach Fläche, Länge und Mächtigkeit zeigen die Alpengletscher außerordentlich große Verschiedenheiten. Der größte Alpengletscher ist der Aletschgletscher mit einem 24 km großen Firn-Eisstrome. Seine Zunge ist 17 km lang. Die Mächtigkeit der großen Alpengletscher dürfen wir auf 300-400 m beziffern, nachdem an einem kleinen Alpengletscher durch Bohrungen 213,5 m Mächtigkeit festgestellt worden sind. Die Nahrung des Gletschers ist der Hochschnee. Die kleinen Schneekristalle, die im Firngebiete niederfallen, machen die ganze Reise durch den Gletscher hindurch, bis sie im Abschmelzgebiete wieder zu Wasser werden. Dabei geht der flimmernde Schnee der Hochregion durch fortgesetzte Schmelzungs- und Gefriervorgänge zunächst in den festeren Firn, d. h. alten Schnee über, der durch Verunreinigungen aller Art eine schmutzig graue Farbe erhält. Aus dem Firn wird allmählich ein Eiszement, das undurchsichtige Firneis, und erst aus diesem entsteht das eigentliche kristallklare Gletschereis, der Baustoff der Gletscherzunge. Die Umbildung des Firneises zu Gletschereis beruht auf einer Umlagerung der Molekel und ist ein Werk der im Eise unausgesetzt tätigen Kristallisationskräfte. Das Gletschereis der Zunge ist durch diese Umbildungsvorgänge schließlich zu einer körnigen Anhäufung von aneinander gefrorenen Eiskristallen geworden. – Der Grundzug des Gletschers ist Bewegung. Der Gletscher fließt wie eine träge, dickflüssige Masse. Jedes Teilchen eines Gletschers rückt im Laufe eines Jahres um ein meßbares Stück abwärts. An den großen Alpengletschern beträgt diese Bewegung durchschnittlich 10-30 cm für den Tag oder 40-100 m fürs Jahr. An einzelnen Ausläufern des grönländischen Binneneises aber hat man 12-20 m Geschwindigkeit für den Tag oder 6 km fürs Jahr gemessen. Bei dem Abwärtsfließen dieser trägen Eismasse entstehen bei starker Gefällzunahme Spannungen im Eise. Die Auslösungen solcher Spannungen im Gletscherinnern werden durch die Spalten bezeichnet. So entstehen schon im Firngebiet die gewaltigen Klüfte und Firnabstürze und weiter unten im Zungengebiete die großartigen Eisbrüche und Eisfälle mit den seltsamen Eistürmen der Seracs. – Auch in bezug auf den Einfluß, den der Gletscher auf seinen Untergrund und seine Umrahmung ausübt, tritt große Ähnlichkeit zwischen dem fließenden Gletscher und dem fließenden Wasser hervor. Der Gletscher wirkt gleichfalls zerstörend, verfrachtend und wieder aufbauend. Allerdings ist nicht das Gletschereis der eigentliche Zerstörer, sondern der vom Gletscher mitgeführte und am Boden hingeschleifte Geröllschutt, die Grundmoräne. Je nach Lage und Anordnung benennt man die vom Gletscher mitgeführten Gesteinsmassen mit verschiedenen Namen, z. B. Rand-, Ufer-, Seiten-, Mittel- und Innenmoränen. Bei Stillstand oder Rückgang des Gletschers bleibt der Schutt liegen. Die abgelagerten Moränen sind die steinernen Zeugen des Gletscherrückganges.
(Nach Reishauer.)
* * *
Eine oft und mit Recht gerühmte Erscheinung des Hochgebirges ist das Alpenglühen. Wir nehmen zu seiner Beobachtung unsern Standpunkt auf dem 2683 m hohen Gipfel des Faulhorns südlich vom Brienzer See; alle die riesigen Firnzinken des Berner Oberlandes sehen wir von unserem hohen Stuhl aus in das freudige Himmelblau aufragen. Die gewaltigen Bergpyramiden erscheinen uns noch in voller Bestimmtheit und Klarheit, nur drunten im Tal liegen die Hütten von Grindelwald schon in lauschiger Dämmerung. Doch auch auf den Höhen verliert sich allmählich die schneidende Klarheit; warmer, leuchtender Abendnebelrauch und hellockerfarbige Sonnendämpfe hüllen die Höhenzüge ein, sie scheinen in ein glänzendes, goldenes Nebelmeer getaucht. Den Bewohnern des Lütschinetals ist die Sonne schon längst unter den Horizont hinabgesunken; dunkle Schatten legen sich um die Hütten und die niedrigen Bergeshalden, aber zu uns herauf dringt das Echo des Alphorns, auf dem ein Alphornbläser den spät angekommenen Gästen ein Abendlied zum besten gibt. Während wir unsere Umschau halten, lenkt der Ruf unseres Führers unseren Blick nach Westen. Wir sehen die hohen Gipfel der Berner Alpenkette, jene Riesen mit den Schneehäuptern und den Gletscherbrüsten, rosig angehaucht, und das Gestein färbt sich mit jedem Augenblicke feuriger. Das Alpenglühen beginnt. Die Sonne ruht als dunkelroter Glutball auf dem Rücken des Jura, und alle Gegenstände, die noch im Bereich ihrer Beleuchtung liegen, färbt sie mit tiefem Purpurrot, auch unsere Kleider, Wäsche, Gesichter. Von unten herauf klimmen behende die dunklen Schatten und hüllen die vorher so klar dastehenden Bergpyramiden in Dunkel ein.
Doch in demselben raschen Zeitmaß steigert sich auch der tief gesättigte Ton der purpurnen Gipfelvergoldung. Hinter dem Jura verschwindet fürs Auge der rotglühende Ball des Tagesgestirns; aus dem vollen Rund wird eine Halbkugel, ein Kugelabschnitt, eine schmale Linie, ein Stern, ein blitzender Punkt, und entrückt ist sie dem sterblichen Auge. Doch hinter der Jurawand herauf schießt sie noch ihre Strahlen nach den in Schnee- und Eispanzer eingehüllten Alpenveteranen und übergießt sie mit flüssigem Rotgold.
»Ha, sieh der Alpen Haupt umschlungen
Vom Flammenkranz und glutumrollt,
Als ob zu sparen ihr gelungen
Ein Teil von ihrem Tagesgold.
Als ob tagüber sie gefangen
Zum Kranz die Rosen all im Tal,
Als ob bei Tag dir von den Wangen,
Du Volk des Tals, das Rot sie stahl.«
(Anast. Grün.)
Woher aber kommt die seltsame, keineswegs alltägliche Erscheinung? Drei Ursachen mögen es sein, die jene herrliche Gesamtwirkung ergeben: der Firn, die Höhe der beschienenen Gipfel und der Gegensatz in der Beleuchtung der flammenden Höhen und in Schatten gehüllten Tiefen. – Die Firnmasse besteht aus Millionen Kristallkörperchen mit Abermillionen kleinster Spiegelflächen, die das Sonnenlicht einsaugen und lange nachher noch zurückwerfen. Dazu kommt die hohe Lage der Firnhäupter gegenüber der unter den Horizont tauchenden Sonne. Uns auf dem Gipfel erscheint sie als rotglühender Ball, den Bewohnern der Ebene als gelbe, strahlenschießende Scheibe. Auf dem langen Wege haben die Strahlen die Dünste der Tiefen zu durchdringen, die besonders die kräftigen Rotstrahlen des Regenbogens durchlassen. Der Gegensatz der Lichtsammler, der Firnmassen, oben und der blaudunkeln Täler unten erhöht den Glanz des Schauspiels; »denn erst der Hintergrund der Nacht gibt den Raketen ihre Pracht«. –
* * *
Auch in die Firn- und Felsregion flutet die Welle des Lebens hinauf; es kann für den Bergsteiger kaum einen lieblicheren und zugleich vom Siege des Lebens erzählenden Anblick geben als violette Soldanellen, die sich durch den Rand eines Schneeflecks zum Lichte hindurchgearbeitet haben. Die Alpenweiden auf den sturmumheulten Schutthalden sind ein wunderbar sanftgrüner Kranz um die eisigen Berghäupter; je weiter hinab, desto höher wird ihr Gras – und ihre wunderbar reinfarbige Blumenwelt; »da weithin ein rosenroter Teppich der Alpennelken (Silene), dort wieder rosig weiße Anemonen, ein unbeschreiblich sattes Blau der Enziane, violette Primeln, wallende Felder rosiger Schneeheiden, dabei alle Farben ins Leuchtende gesteigert, von jener tiefen und ernsten Wirkung, wie, sie alte gemalte Glasfenster hervorbringen«.R. Francé Moorig und feucht ist hier allezeit der Boden; denn die großen Behälter festen Wassers droben lösen sich durch die Wärme der Sonne wieder zurück ins flüssige Element. Murmelnd beginnen die Wassergerinnsel zwischen dem frostgespaltenen, abgestürzten Trümmergestein, in Schluchten, die sie sich gegraben, brausen sie bald voll und laut als schäumende Wildbäche zu Tal – oder stürzen über die Steilwand eines alten Gletscherbettes zerstiebend in Regenbogentau als Gießbäche hinunter. Hinter dem Sturmbock einer Felsflanke entsendet der Nadelwald in diese Mattengegend eine Sturmkolonne von Wetterfichten; oder er kriecht liegend herauf als Krummholz der Bergkiefern und löst sich in die liebliche Strauchwelt der Alpenrosen auf (Rhododendren). Die Tierwelt belebt den grünen Mattenring: Berghummeln und Fliegen und Falter wagen sich Sommers in diese Blumenregion; Steinschmätzer und Flüevogel nisten hier oben, verfolgt von Wieseln und Mardern; das Schneehuhn vertritt hier das Rebhuhn der Tieflandgefilde; das Murmeltier, der Alpenhase lassen sich die würzigen Kräuter schmecken; die Gemse klettert von Felsengraten zu ihren Weiden herab; der Steinbock und die Steingeiß, wieder eingebürgert in die Bergwelt der Schweiz, sind womöglich noch kühner wie jene – und der Steinadler hat hier sein nächstes Jagdgebiet.
Auch der Mensch wandert für den Nordsommer hier herauf aus seinen Tälern mit der stattlichen Schar breitstirniger Rinder oder mit dem lustigen Klettervolk der meckernden Geißen. Da stehen die Heustadel und die Sennhütten auf den würzhauchduftenden Alpenmatten, das Geläute der Kuhglocken mischt sich mit dem lustigen Gesänge und den Juchzern und Jodlern der Sennen und Geißbuben, die sich von Alm zu Alm grüßen; und gegen den Abgrund sind urtümliche Bockzäune aufgestellt als Hürden. Die Milch wird zu Käse verarbeitet und zu Tal getragen.
Die Legföhrengebüsche leiten über zu den Waldflanken der Täler und der Vorberge, die oft bis zum Gipfel den Waldschmuck tragen und mit ihren grünen gerundeten Formen etwas Mittelgebirgshaftes haben. Die Fichte steigt bis 1800 m empor, mit ihr die herrliche Arve oder Zirbelkiefer, die freilich nur selten Bestände bildet, um so schöner aber als Einzelbaum hoch über ihren zurückbleibenden Brüdern am unteren Saume des Mattenkranzes steht. Abwärts folgen dann Lärchen und Tannen, endlich die Buchen- und Bergahornwälder; im Süden der welsche Nußbaum und die Kastanie. Getreidefelder und Obstbäume wagen sich bis in ihre Region, im Norden Roggen, im Süden der Mais aus der Poebene. Und das Meraner Tal ist erfüllt von Weingelände wie viele der warmen Südtäler.
Der Wald bildet eine Schutzwehr gegen die drohenden lebensfeindlichen Mächte droben in Fels und Firn; er wird gehütet und gehegt: er hindert die Lawinenbildung, weil er die winterliche Schneedecke an den stark geneigten Halden nicht ins Gleiten kommen läßt, sondern sie an seinen tausend Stämmen verankert. Er schützt auch vor den Lawinen aus den Hochregionen und versperrt ihnen den Weg der Verwüstung ins Tal der Menschen. Ebenso hält er mit seinem Wurzelgeflecht den nassen Haldenboden fest, daß er nicht als Bergschlipf hinabrutscht. Die Schweizer Bevölkerung hat ihre Bannwälder, aus denen kein Brennholz geholt wird. Sie sind zum Beispiel in Graubünden oft noch Urwälder.
»Der Alpenurwald ist ein stiller Totenacker, eine jener trüben, finsteren Verwesungsstätten der Natur, wo Leben und Zerstörung in stofflicher Wechselwirkung unmittelbar ineinander übergreifen. In düsterer Schwermut umstehen zähe, dunkelgrüne Arven und schlanke Weiß- und Rottannen die modernden Leichen ihrer Vorfahren, schmarotzend saugt und trinkt der wuchernde Schwamm Lebenskraft und Leibesnahrung aus dem Zellengerippe abgestorbener Stämme.«
Aus dem Wirrsal tönt der kichernde oder klagende Schrei des Spechtes, sein Trommelsignal, und aus den Lüften der pfeifende Gellruf des Adlers. Insekten summen, und Schmetterlinge fackeln vorüber: summende Urwaldstille.
Die U-förmigen Täler, in deren Mitte heute ein Gletscherbächlein rinnt, wie zum Beispiel die Lütschine im Lauterbrunnental, sind alte Gletscherbetten; denn für den Gießbach ist das Bett zu breit; er rinnt hindurch, irr und fremd, wie »eine Maus im Löwenzwinger«. Aber ihr breiter Boden, der oft alter Seeboden ist, weil eine alte Endmoränenreihe die Wasser staute, bis sie sich eine Abflußrinne nagten, ist besetzt vom Menschen, ist Kulturland geworden. Am oberen Talschluß hat sich oft noch der alte Löwe gelagert und rückt bald vor, bald zurück mit seiner weißen Tatze, doch ist der Rückgang der Gletscher erwiesen. Dorfschaften mit spitztürmigen Kirchen und steinbeschwerten Schindeldächern, Städte mit breiten Häuserfronten und oft mit alten Stadtbefestigungen neben modernen Hotelpalästen bergen sich in diesen Tälern; Straßen- und Eisenbahnen verbinden sie und verschwinden streckenweise in den Felsen, um Höhen zu meiden oder unter bekannten Lawinenbahnen durchzuschlüpfen.
Aber die Berggewässer haben sich auch mit der ganzen Kraft ihres rasenden Gefälles eigene Täler gerissen: eng und feucht vom tosenden Wassernebel wühlen sie Quertäler und Klammen, die nur auf Brücken und Hängesteigen zugänglich gemacht werden können. Seitdem man aber die lebendige Kraft solcher wilder Gießbäche in Turbinen zu bändigen und in Verbindung mit Dynamos nutzbar zu machen versteht, sind auch sie der Kultur der breiten Täler dienstbar, und viele der Alpenorte erglänzen am Abend im elektrischen Lichte, das ihnen die Wasserkräfte aus der lichten Höhe der Firnfelder herzuschafften.
Die Alpenmenschen werden vielfach von der wilden, übermächtigen Bergnatur bedroht, geängstigt, gefährdet durch Wildstürme, Wildbäche, Lawinen, Gletscherbewegung und Bergstürze; aber eben dadurch wird auch ihre gesamte Kraft des Körpers und des Geistes mächtig aufgeregt, zum Kampfe gerüstet, stets frisch erhalten und in der Übung gebildet. Dieses Verhältnis des Menschen zu seiner Hochgebirgsnatur ist die große Erziehungsschule der Alpenvölker, in der sie den Geist des Mutes und der Freiheit empfangen, das Bewußtsein ihrer Würde und Selbständigkeit, die Kunst, sich selbst zu helfen, und die Willenskraft, wodurch sich ihre Industrie kenntlich macht, und mit der sie neue Erfindungen zu machen und zu entwickeln wissen.
Aus ganz Europa, ja auch aus Amerika strömen die Menschen allsommerlich ins Alpenland: es ist der Gesundgarten Europas. Der Deutsche – und der Germane im weitesten Sinne – findet hier sein Lebenselement, den Kampf. Friede liegt über dem arbeitsfrohen Europa ringsum; hier kann er mit Berggewalten kämpfen und seinen Mut erproben im herrlichen Kampfe mit den Bergriesen. Der Alpinismus ist der Jungbrunnen männlicher, kühner Heldenkraft für Tausende geworden, die nicht im Alltagsgetriebe und in der Werkstattluft der Städte einrosten wollen, in denen vielmehr das naturfrische, tatenfrohe Gemüt der Väter nach Kampf und Siegen ruft.
Quelle: v. Berlepsch, Die Alpen. 5. Aufl. Jena 1885, H. Costenoble. Während der Begriff Paß oder Alpenpaß im engeren Sinne nur eine Einsattelung, einen Einschnitt im wasserscheidenden Kamme bezeichnet, zu dem von beiden Seiten in der Regel Flußtäler hinaufführen, verstehen wir darunter im weiteren Sinne die Kammeinsenkung mit den beiderseitigen Zugängen. Solche Alpenstraßen sind entweder fahrbare Kunststraßen oder Saum- und Fußpfade.
Auf jenen spielt sich jahraus, jahrein ein reges Verkehrsleben ab, während es auf diesen für die Winterszeit meist erloschen ist. Die Kunststraßen sind fast alle Werke des 19. Jahrhunderts; die erste verdankt Napoleons I. Genie ihre Entstehung; es ist die Simplonstraße, welche 1801-06 hergestellt wurde; bald folgten die Straßen über den Bernhardin, den Splügen, den Gotthard (1819-30). Die Zugänge für den Simplon bilden nördlich ein Nebental des Wallis und südlich das Val di Vedro; beim Bernhardin sind es nördlich das Hinterrhein-, südlich das Moesatal, beim Gotthard nördlich das Reuß-, südlich das Tessintal. Enge schluchtenartige Talbildung, auf deren Grunde der Gebirgsfluß schäumend dahinbraust, erschwert den Straßenbau. Man muß die Straße bald an die rechte, bald an die linke Seite der Felswand ankleben, die Schlucht überbrücken, die Steigung wächst auf 6:100, in zahlreichen Schlangenwindungen strebt die bald in den Felsen eingesprengte, bald durch Mauerwerk an die Wand angeklebte Straße die Schlucht hinauf. »Die Kehren oder Ränk – wie der Fuhrmann sagt –, mittels deren die Straße in eine höhere oder tiefere Stufe tritt, und die meist aufgemauert sind, sehen von der Tiefe wie übereinander errichtete Bollwerke von Festungen aus.« So muß man, um von Süden kommend, das Hospiz des Gotthard zu erreichen, nicht weniger als 46 stufenförmig übereinanderliegende Windungen erklimmen. Damit der vom Schneesturm überraschte Wanderer ein Unterkommen finde, sind an den gefährlichsten Stellen Zufluchtshäuser errichtet, die zum Teil von den wie in sibirischer Verbannung lebenden »Rutnern« (Straßenwärtern) bewohnt sind. Ja, in den kältesten Wintermonaten findet der durch Schneewehen oder Lawinensturz am Fortkommen gehinderte Reisende selbst in den unbewohnten Zufluchtshäusern Holz zum Kaminfeuer, ein Brot zur Stärkung und Heu für sein Reittier, falls er genötigt ist, eine längere, unfreiwillige Rast zu halten. Noch wichtigere Vorsichtsmaßregeln sind die »Galerien«, jene durch Felsen getriebenen Tunnel oder künstlich gemauerten Gewölbe, welche an den Stellen, wo öfters Lawinen niedergehen, errichtet sind, und die bestimmt sind, Mann, Pferde und Wagen zu bergen. Sie sind so fest gebaut, daß der Reisende ohne Furcht die Lawine darüber hinwegdonnern hören kann. Die Paßhöhe ist in der Regel gekrönt mit einfachem Holzkreuz, dem Zeichen, daß die Anstrengung überwunden ist, dem Wanderer ein Mahner zum Dankgebet für den göttlichen Schutz. Die Hospize liegen meist unterhalb des Scheitels auf der Südseite, um nicht allen Unbilden des Wetters ausgesetzt zu sein.
Auf diesen fahrbaren Kunststraßen lebt noch ein Stück jener Poesie, welche so gern sich durch das Posthorn heranlocken läßt. Da windet sich noch der schwere Planenwagen die Bergstraße hinauf, gelenkt vom taktmäßig knallenden Blaukittel, gezogen von sechs starkknochigen Bergpferden. Da naht, in Staubwolken gehüllt, eine Herde junger, dunkelfarbiger Melkkühe und Masttiere, die für einen italienischen Markt bestimmt sind. Voran schreitet der Knecht mit dem Bergstecken und mit dem unentbehrlichen Regenschirm unter dem Arm; auf der Schulter hat er den »Melktern« befestigt, und laut johlend läßt er seinen Lockruf »Ooo-ohohohohoho, komm wädli, wädli, wädli« erschallen. In der Mitte der breitgestirnten glatten Rinderschar wandert der Dolmetscher, ein herabgekommener, früher selbständiger Viehhändler, der der italienischen Bauernsprache vollkommen mächtig ist und auf dem Rücken der Tiere tapfer arbeitet. Am Ende des Zuges endlich folgt der Besitzer der Herde, der bereits auf dem Wege den Nutzen oder Schaden überschlägt, der ihm je nach dem Gange des Geschäfts erwachsen kann. Plötzlich schreckt ihn der um die Felswand biegende, in scharfem Trabe von oben kommende Eilwagen auf. Der auf hohem Sitz thronende, seiner Eigenschaft als Staatsdiener sich voll bewußte Postillon fährt rücksichtslos in die Herde hinein. Eine aufregende Szene entwickelt sich: die Treiber locken, toben, fluchen, schlagen, der Rosselenker freut sich laut lachend der Verwirrung und vermehrt sie durch sein Peitschengeknall. Die Kühe brüllen und versuchen der Gefahr den Rücken zu kehren, die Hunde treiben sie, grimmig kläffend, zu ihrer Pflicht zurück. Die Pferde werden unruhig, und eins oder das andere schlägt über die Stränge. Auch der Eilwagen muß halten. Unter allgemeinem Fluchen, Toben und den Angstschreien der Insassen des Wagens zieht die Herde vor dem ruhig haltenden Wagen vorüber, der nun mit beschleunigter Geschwindigkeit den gefahrvollen Pfad hinabsaust. Und in den Drähten des die Straße begleitenden Telegraphen springt ungestört und ungehört, geheimnisvoll der menschliche Gedanke von Deutschland nach Welschland über. Der Automobilsport hat sich auch die Alpenstraßen erobert. Spielend nimmt der Kraftwagen die Jochhöhe, und selbst die Mönche vom St. Gotthard haben sich in Mailand als Chauffeure ausbilden lassen.
Anders freilich ist das Leben, das sich im Winter auf diesen Straßen abspielt. Sobald die Schneedecke die Höhen einhüllt, hört der Wagenverkehr auf, um der Schlittenbeförderung Platz zu machen. Auf den französischen Paßstraßen werden der Reisenden je sechs in einen großen Postschlitten gepackt, der 10-12 Pferde als Vorspann erhält, sämtlich Schimmel, »da weiße Pferde nie ermüden«. Durch die hölzernen Klappläden des mit Verdeck versehenen Fahrzeugs dringt der Schnee, vom eisigen Winde gepeitscht, ein und belästigt das Gesicht der Reisenden.
Auf den Paßstraßen im Wallis und in Graubünden hat man einen zusammengreifenden Wagen- und Schlittendienst. Man fährt in bequemem Reisewagen, soweit die Bergstraße offen ist. Da, wo die Schneedecke fest zu werden beginnt, liegt eine Anzahl größerer und kleinerer umgestürzter Schlitten bereit, und zwar ohne Dach und Fach. Der Postillon tritt mit den Füßen eine Krippe in den Schnee und reicht den Pferden etwas Heu. Der Führer wählt unter den Schlitten je nach Bedarf aus, und es beginnt die Verladung der Güter, Briefsäcke, Koffer und Fahrgäste in die ein- und zweisitzigen Fahrzeuge. Jeder der Reisenden wird in einen tüchtigen Büffelmantel gehüllt. Die Schlitten sind sämtlich nur mit einem Pferd bespannt, den ersten lenkt der Postillon, den letzten der Führer, die mittleren sind ohne Leitung. Der Reisewagen bleibt ohne Hut unter freiem Himmel stehen, bis ihn eine von der anderen Seite kommende Schlittengesellschaft talabwärts benutzt. Bei sehr starkem Schneefall wird vor Ankunft der Post ein Ochsenschlitten vorausgesandt, welcher Bahn macht; ein halbes Dutzend kräftige »Rutner« begleiten ihn, um die Bahn fahrgerecht herzustellen. In einem harten Winter wird sie nur eingleisig ausgeschaufelt, doch gibt es in gewissen Entfernungen Ausweichestellen, wo die von oben kommenden Schlitten halten müssen, sobald von unten kommende in Sicht sind.
Weit einfacher sind die Alpenstraßen, die nicht Kunstbauten sind. Wo die Natur nur Schluchten öffnete, hat der Mensch mit Brecheisen und Sprengmitteln nur wenig nachgeholfen. Die Sumpfstellen sind durch hineingeworfene Felstrümmer notdürftig wegsam gemacht; keine Galerie überwölbt die durch Lawinenstürze gefährdeten Stellen, kein Hospiz gewährt dem Wanderer Obdach, Bewirtung und Pflege. Höchstens eine einfache Bretterhütte wird von den beiderseitigen Talbewohnern unterhalten, wo der Fuhrmann die ermüdeten Gäule füttern kann. Nur wenig Leben herrscht auf diesen Wegen, und die Gerippe von Pferden an ihrem Rande zeugen von Unglücksfällen, die sich hier zugetragen. Ausnahmen von diesen auch landschaftlich öden Straßen bilden zum Beispiel diejenigen über den großen St. Bernhard, die in der Nähe des Paßscheitels ihr geschichtliches Hospiz trägt, sowie über die Grimsel, auf welcher sich der sehr beträchtliche Käsehandel zwischen dem Kanton Bern und Italien abwickelt.
Eine seltene Erscheinung auf diesen Straßen ist heutzutage der »Säumer« mit seinen Saumrossen, welcher durch das ganze Mittelalter hindurch und bis zur Eröffnung der Kunststraßen für den Durchgangshandel der Schweiz eine charakteristische Erscheinung war. Nur auf verkehrsreichen, aber nicht fahrbaren Straßen, wie zum Beispiel der Gemmi, begegnet man ihm noch mit einem »Stab Rosse« (6-7 Stück). Jedes Saumtier, Pferd oder Maulesel trägt einen den ganzen Rücken bedeckenden und auf beiden Seiten weit hinabreichenden Holzsattel. Die Warenballen (bis zu 150 kg Gewicht) müssen auf beide Seiten vollständig gleichmäßig verteilt werden. Geschützt vor Regen und Schnee wird die Ladung durch eine Wachstuchdecke, welche den Namen des Säumers trägt. Die Tiere sind sämtlich mit Glocken versehen, damit entgegenkommende Karawanen einander rechtzeitig bemerken und an den Ausweichestellen halten können. Der Maulkorb soll den Lastträgern das Grasen unmöglich machen, weil dadurch die gleichmäßige Fortbewegung gehemmt wird. Unwillkürlich wandelt das Maultier und Saumroß sichern Schrittes am Rande des Weges nahe dem Abgrunde, nicht in der Mitte, um mit der weit vom Körper abstehenden Last nicht an die Felswand zu stoßen. Ein einziger Fehltritt kann es in den Abgrund stürzen, wo es zerschellt. Wie gesagt, sind diese kleinen, unschönen, muskelkräftigen und derbknochigen Saumrosse mit breiter Brust, plumpen Hufen, struppigen Mähnen und Füßen, mit dem sprichwörtlich gewordenen sicheren Gange heutzutage fast ganz verschwunden und mit ihnen ihre Herren, jene rohen, fluchenden Gesellen, die in ihren verwetterten Gesichtern gleichmäßig die Wirkungen der Anstrengungen wie des Branntweins erkennen ließen.
Viel zur Wegsamkeit der Alpen haben die Alpenvereine im Deutschen Reiche, in Österreich, der Schweiz, Frankreich usw. beigetragen. Herrliche Höhenwege führen zu trefflich eingerichteten, wohnlichen »Hütten«, die weit mehr sind, als der Name sonst sagt. Und selbst im Winter stehen viele dem Skifahrer, der die ausgleichende Schneebahn auf frei gewähltem Wege über Fels und Firn und Gestrüpp dahinzieht, als Raststätten und Schutzherbergen zur Verfügung.
Eine letzte und gefährlichste Gruppe nicht fahrbarer Alpenstraßen bilden jene Fußpfade, welche stundenlang über Firnfelder und Gletscher dahinlaufen. Der Pfad steht mehr nur vor dem inneren Auge des Fußgängers, als ihn die Natur angedeutet und vorgezeichnet hat. Durch düsteren Wald, über Gebirgsweiden und Geröllhalden schleicht hier der Pascher an grauenhaften Abgründen vorbei, während den Grenzjäger nur die zwingende Pflicht auf jene Wege führt.
Alpenreisen von J. G. Kohl. 2. Teil. Da, wo das Domleschger Tal durch die mit ihren Felsenstirnen zusammenstoßenden Ausläufer des Muttenhornes und des Piz Beverin abgeschlossen wird, liegt Thusis. Wir fanden diesen kleinen uralten Ort nur soeben erst aus der Asche als ein Phönix neu erstanden. Eine Feuersbrunst hatte ihn vor kurzem vernichtet, und alle Häuser und Straßen waren neu. Wer weiß, wie oft ihm dies Schicksal seit der Auswanderung seiner Bewohner aus Etrurien schon widerfahren ist und wie oft es in Zukunft ihn noch heimsucht. Er scheint ganz darauf gefaßt zu sein; denn bei den neuen Wohnungen war wieder mehr Holz als Stein verwendet worden. (Der Ort brannte tatsächlich 1845 wieder ab und ist seitdem in Stein aufgebaut worden. Nur an dem oberen Ende der Hauptstraße stehen noch ältere Häuser.)
Den mächtigen Gebirgswall, der sich hier vorschiebt, hat der Rhein in einer gewaltigen Spalte durchsägt, doch haben ihm wahrscheinlich unterirdische Kräfte dabei vorgearbeitet. Diese Spalte ist ungefähr 7 km lang; es war ehemals sehr schwer, darin neben dem Rheine fortzukommen. Der Hauptstraßenzug verließ daher das Rheintal und führte an den Höhen des Piz Beverin vorbei in den Schamser Gebirgskessel hinauf. Alle Warenzüge des Mittelalters, alle Pilger und Kreuzfahrer, alle deutschen Kaiser mit ihren Rittern, die auf Romfahrten nach Süden zogen, mußten hier bei Thusis den riesenhaften Felsriegel erklettern, um zu den oberen Tälern zu gelangen. Sie nannten dies »den guten Weg«. An den Bergen erkannten wir noch Teile und Spuren dieser uralt-ehrwürdigen Straße. Den Gemsjägersteig aber unten im Tale fort durch das Bohrloch des Rheins nannten sie »den schlechten Weg« (Via mala) und den ganzen Spalt selbst, der fast gar nicht benutzt werden konnte, »das verlorene Loch«.
Der Zug über die Höhen führte natürlich allerlei Unbequemlichkeiten mit sich, zunächst das steile Ansteigen, das nur durch lange Zickzackwege sich hätte vermeiden lassen, dann im Winter die dort sich anhäufenden Schneemassen. Allmählich ließ sich daher der Verkehr in die Tiefe hinab. Im Laufe von Jahrhunderten wurden wiederholt Versuche angestellt, einzelne Teile des Talbodens wegbar zu machen. Das vergangene Jahrhundert brach auch hier mit einer Straße durch, die, so gut sie ist, doch noch innerhalb der schlimmsten Strecke den Namen »Via mala« beibehielt.
Der Rheinstrom selbst hat sich zuweilen so tief in die Felsen hinabgegraben, und dabei ist er stellenweise zwischen so steile und eng zusammenstehende Wände eingeklemmt, daß er mehrmals ganz darunter verschwindet. Es ist daher unmöglich gewesen, mit der Straße ebenso weit in die Tiefe hinabzugehen, wie der Fluß selbst. Und eigentlich schlängelt sie sich daher in der Mitte der Schluchthöhe längs der Wände des Spaltes hin, bald auf dieser, bald auf jener Seite des Flusses sich anhängend, bald auf wundervollen Brücken über den Abgrund, in dessen versteckten Tiefen der Rhein braust, hinübersetzend, bald durch Felsenriegel sich Tore und Höhlengänge grabend, bald auf Vorsprünge und Absätze frei hinaustretend, bald auf künstlichen Mauergewölben am Abhange schwebend. Der grüne Rhein ist unten 90-120 m tief auf dem Boden der Spalte versteckt. Zuweilen sieht man frei bis auf seine schäumende Oberfläche hinab, zuweilen kann man selbst auf den Brücken stehend zwischen allen den vortretenden Felsenköpfen, die sich von beiden Seiten her ineinander verzahnen und verkeilen, nur ein grünes oder weißes Streifchen von ihm erkennen. Man fährt nahe an zwei Stunden zwischen den wundervollsten Ausblicken aufwärts, bis dann auf einmal der Rhein sich aus der Tiefe wieder hervorhebt, die Schlucht sich rechts und links erweitert, und ein flacher Talboden sich herbeiläßt, auf dem man dann bequemlich hineinrollt in das weidenreiche Schamser Tal durch die Dörfer Zillis, Andeer und andere. Die alten Kaiser und Ritter aber blieben immer oben auf der Berghöhe, auf ihrer »guten Straße«, und durchzogen die Reihe der oberen Schamser Dörfer Lohn, Mathon und Donat, da sie einmal oben waren und es nun zu unbequem fanden, erst wieder ins Tal hinabzusteigen, mit dem ihr Weg sie allmählich ganz von selbst wieder zusammenführte in dem wilden Paß der Roflen oder la Rofla.
Diese Rofel, durch die man aus dem Schams ins Rheinwaldtal hinaufgeht, ist etwas Ähnliches wie die Via mala zwischen dem Domleschg und dem Schams, ein Gebirgsriegeldurchbruch von einer Talstufe zur andern.
Der Rhein setzt zuweilen in schönen Wasserfällen, zuweilen in tiefen Klüften schäumend, zuweilen ungesehen, aber überall gehört, hindurch. Es türmen sich hier Massen auf Massen, die Wildnis ist unsäglich. Was die Natur Schreckliches oder Erhabenes in Felsenformen und Felsenfratzen hervorbringen kann, das hat sie hier in hundert und aber hundert Bildern dargestellt. Wie auf einer Blumenwiese unerschöpflich im Anmutigen und Nützlichen, so scheint sie hier unerschöpflich sein zu wollen im Wilden und Unnützlichen. Blickt man in die Tiefe, so steigen hier schaurige Gründe, der eine noch tiefer als der andere, hinab. Schaut man in die Höhe, so überbietet ein kahler Felsenkopf den andern, eine öde Wand hängt über der andern. Manche dieser Wände sind auf weite Strecken hin mit zerstörten Wäldern bedeckt, sei es, daß ein Waldbrand hier aufräumte, oder daß ein Wirbelwind die Bäume umknickte. Niemand kann hier den Waldbränden Einhalt tun: ja keiner gibt sich auch nur einmal die Mühe, die Holzernte, welche der Wind fällt, zu sammeln. Modernde Baumstämme, wirr durcheinandergeworfen, hängen oft stundenweit an allen Abhängen übereinander.
Zuletzt kommt man noch durch ein Felsentor, Sasaplana genannt, und schreitet dann endlich wieder in einem oberen Tale fort, dem alten Tal der »Freien am Rhyn«. So nannten sich die deutschen Bewohner dieses alleräußersten Rheintales (Val Rhin), des sogenannten Rheinwaldes. Sie wohnen bis zu den Quellen des Rheins, bis zum Hinterrheingletscher hinauf, und ihr Hauptort ist Splügen. Sie sollen von einer uralten Siedelung Deutscher abstammen, welche ein deutscher Kaiser, man sagt Friedrich der Rotbart, hier am Splügen als treue Wächter des Passes ansetzte. Diese Deutschen des Rheinwaldes bilden in ihren Dörfern Sufers, Splügen, Medels, Hinterrhein usw. ein kleines Staatswesen für sich und sind rundherum durch romanische Täler von den übrigen Deutschen gesondert. Sie kommen aber als die »Freien am Rhyn« schon sehr früh in der Graubündner Geschichte vor und werden auch mit unter denen genannt, welche die ersten Bündnisse der »Grauen« mit beschworen, Bündnisse, die dauern sollten, »so lange als Grund und Grat stehen«.
Wenn man mich mit verbundenen Augen in den Rheinwald brächte, ohne mir zu sagen, wo ich wäre, so würde ich doch nachher sofort erkennen, daß ich mich 1000-1200 m über dem Meere in einem jener kleinen Hohlkessel befände, die sich längs der Seiten eines Passes hinziehen, entweder im Rheinwald, oder im Urserentale, oder im Tale von Airolo, oder in dem von Simpeln (Simplon), oder in dem von Worms.An der oberen Adda, italienisch Bormio. Denn diese hohen Übergangstäler sehen sich alle ähnlich wie Zwillinge. Ihre kahlen Gründe, ihre spärlichen Tannen, ihre grauen hölzernen Dörfer, ihre öden Berggehänge und starren Gipfel, ihr kleines, mit Waren und Reisenden Tag und Nacht gefülltes Hauptdorf, dies ist überall dasselbe.
»Splügen« oder »Speluga« soll seinen Namen von dem lateinischen »specula« (Wachtturm) haben. Manche deuten dies auf einen dicken, alten Turm, der noch auf der Höhe des Passes steht, und der, wie viele ähnliche alte Hochalpengemäuer, aus der Lombardenzeit herstammen soll, den aber andere für ein Römerwerk halten. Auch im Tale selbst, nahe beim Dorfe Splügen, liegen Überreste eines alten Schlosses, welches nun die letzte Ritterburg in dem ganzen an Ritterburgen so reichen Rheintale ist. Ganz in der Nähe von Splügen, wenige Stunden weiter westwärts, erblickt man die Höhen von Adula, den Piz Val Rhin und das Moschelhorn, aus deren Eishöhlen die Quellen des Rheins hervorrauschen. Ich ließ von hier aus meine Gedanken längs der weit sich hinstreckenden Talgehänge und Landschaften des großen Stromes hingleiten, gedachte aller der schönen großen und kleinen Städte, deren Mauern er bespült, und war froh, daß ich einst auch das andere Ende dieses Stromes gesehen hatte in Holland, wo er sich in den Dünen verliert. Von dieser eisigen Gletscherurne im Rheinwald bis zu der hölzernen Schleuse innerhalb der holländischen Dünen, welche lange Perlenschnur von Städten, welche schöne Kette anmutiger Landschaften, welche Gegensätze der Natur, die batavischen Marschen und die rätischen Alpen!
Das Zurüsten zu dem bevorstehenden Alpenübergange, das Abschirren der ankommenden, das Anschirren der abgehenden Packpferde, die Beförderung der Posten und Eilwagen, das Schreien der Fuhrleute und Postillone, die Abfütterung der erfrorenen Reisenden, das Hin- und Herzerren des kleinen Häufleins von Warenballen – das alles nimmt in einem solchen kleinen Alpen-, Handels- und Durchgangsort, wie es Splügen ist, gar kein Ende, und diese lebhafte Wirtschaft eines solchen Hochalpenhafens bildet einen merkwürdigen Gegensatz zu der ernsten und wilden Natur des Tales. Tag und Nacht, Sommer und Winter, jahraus jahrein geht es hier so fort.
Graubündner Offiziere in fremdländischen Diensten, mit langen Bärten und bärbeißigen Gesichtern, die auf Urlaub einige Zeit in ihr Vaterland zurückkehren; Kapuziner, die zu Fuß aus einem Alpentale ins andere wandern; Handelsleute, denen die Reis- und Maissäcke, welche aus der gesegneten Lombardei herüberkommen, am Herzen liegen; romanische Fuhrleute, die als Mitglieder der alten eigensinnigen, bevorrechteten, bündnerischen »Porter« (Fuhrleutegesellschaften) ein scharfes Auge darauf haben, daß niemand ihnen ins Handwerk pfusche und keine Warenballen durch andere als ihre Hände befördert werden; italienische Viehhändler, die mit den deutschen Herdenbesitzern schachern und feilschen; Straßenarbeiter aus dem Schams, Domleschg oder Rheinwalde, die man auf bündnerisch »Rutner« oder »Ruter« nennt, und die mit ihrem Romanischen allerlei deutsche Worte mischen und besonders deutsche Spott- und Fluchwörter aufgenommen haben, zum Beispiel: »Quest umaun (Mensch) è un Esel, un verfluchter«, oder »ègli è un simpler Taglöhner!« – solche Menschen ungefähr bilden die Gesellschaft, unter der man sich gewöhnlich hier an den Quellen des Rheins befindet, und unter der auch wir uns herumbewegten.
In lang sich streckendem Zickzack durch öde Täler und Felswüsteneien, mitten zwischen hochaufgetürmten Berggipfeln, führt die Straße dann allmählich vom Dorfe Splügen aus auf die Höhe des Passes selbst. Alle die Berggehänge und Einschnitte und auch die Gipfel, die man hier sieht, können zu weiter nichts benutzt werden, als hie und da zur Weide der Schafe. Fast überall sind es die Bergamasker Schafhirten (Leute aus der italienischen Provinz Bergamo), welche den Bündnern die Weide abgepachtet haben. Seit uralten Zeiten kommen diese Bergamasken mit ihren Herden; sie haben sehr große Schafe mit langer grober Wolle, mit denen sie im Frühling alle die nach Graubünden führenden Täler, das Misox, das Bergell, das Puschlaw usw. emporwandern, um die ganze Reihe der bündnerischen Schafweiden längs der rätischen Alpenkette im Rheinwald, im Oberwald, im Engadin, in den Bergen von Avers und Stalla abzuweiden, – oder wie es heißt – ihre Tiere da sömmern zu lassen.
Der höchste Rücken des Passes findet sich etwa 1890 m über dem Meere. Noch jetzt im Sommer lagen hier überall große Schneehaufen, und stellenweise fuhren wir noch lange Strecken zwischen zwei Schneemauern von 6 m Höhe hin. Der Weg war dazwischen tief ausgegraben. Die Leute erzählten mir, daß sie voriges Jahr beim Weggraben des Schnees erstarrte Frösche darunter gefunden hatten, die unter dem Schnee überwintert und die, nachdem sie ins Wasser geworfen worden und da erwacht wären, sich ganz lebendig gerührt hätten.
Die italienische Grenze geht mitten über den Rücken der Paßhöhe hin, und wir erreichten bald die Dogana, wo in dem ewigen Schmutze und Schnee eine zahllose Menge von Last- und Personenwagen, von Rinderherden und Reisenden versammelt war.
Das italienische Tal, in das man zunächst hinabrollt, heißt Valle di S. Giacomo (St. Jakobstal). Wie erhält hier sofort die ganze Natur ein anderes Aussehen! Gleich werden die Berge baumlos und kahl fast bis auf den Boden hinab, nur in den tieferen Gründen ziehen sich reizende frischgrüne Kastaniengehölze längs des Flüßchens Mera hin. Diese verhältnismäßig große Waldlosigkeit, der man überall, sobald man einen Alpenpaß nach Süden hin überschritten hat, begegnet, ist zum Teil eine Folge klimatischer Einflüsse, erklärt sich aber auch aus dem Laufe der Flüsse; denn Holz, als eine schwerfällige Ware, bedarf zu seiner Beförderung notwendig der Flüsse, und die Waldgegenden werden daher um so mehr gelichtet werden, je mehr Holzes die Länder bedürfen, zu denen ihre Waldbäche hinabführen. Auf der Südseite der Alpen liegt das alte Kulturland Italien, das schon seit Jahrtausenden so vieles Holz verbraucht hat. So weit seine Flußläufe und Bergstromadern gehen, so weit fraß es die Alpenwälder weg und machte alle Berge kahl, bis zu den höchsten Höhen der Bergpässe hinauf. Den großen Waldreichtum jenseits der Bergpässe konnten sie aber nie antasten, weil die schwerfälligen Stämme und Balken sich nicht wohl über die Gebirgsrücken weg tragen ließen. Jenseits der Alpen im Norden lag das waldreiche Deutschland, das noch nicht nötig hatte, in dem Grade wie Italien die Wälder auszurotten. – Aus diesem Umstande erklärt sich zum Teil die Erscheinung, daß die waldigen Striche der nördlichen Alpentäler mit den kahlen Bergen der südlichen Täler überall so schroff absetzen und wenigstens überall da, wo die Flüsse nach verschiedenen Weltgegenden laufen, so stark miteinander in Gegensatz treten.
Die Natur hat von Splügen herab einen tiefen Schlund ausgegraben, den sogenannten »Cardinel«, der auf dem kürzesten Wege in das Tal führt. Statt, wie bei der Via mala, in diesen Schlund hinabzusteigen, hat man es vorgezogen, die Straße über die Berge zu führen und erst später in das Tal Giacomo hinabzugehen. Wie gewöhnlich, haben auch die Berge hier oben sanftere Abhänge; erst weiter unten gegen das Tal zu werden die Wände schroff, und hier haben die Straßenbauer alle ihre Kräfte zusammennehmen müssen.
Oben gibt es mehrere Stellen, die von Lawinen bedroht werden, und hier hat man dann die Straßen durch lange Galerien geführt, die sich wie Festungswerke ausnehmen. Diese berühmten Galerien bestehen nämlich aus festem Quadersteingemäuer, das sich dicht an den Berg anschließt und mit diesem verwächst. Oben sind sie mit einem schrägen Dache versehen, das mit dem Abhange des Berges ausgeglichen ist, so daß die Lawinen, die von oben herabfallen, leicht über das Dach hinwegrutschen. In der Mauer der Galerien sind große, meistens runde Licht- und Luftlöcher angebracht, die wie Kanonenlöcher aussehen. Im Winter helfen sie freilich nicht viel, da sie sich mit Eis und Schnee vollsetzen. Wir fanden jetzt auch die Löcher einiger Galerien verstopft. Die Straßenwächter, die in den sogenannten »Cantonieren« wohnen, sind daher mit Laternen versorgt, die sie im Winter in den Galerien aufhängen. Dieser Cantonieras oder Zufluchtshäuser gibt es mehrere am Wege. Es sind dickgemauerte Häuser, die wie Soldatenkasematten aussehen. Hier oben, wo Stürme, Lawinen und polternde Felsen einen ewigen Krieg führen, müssen alle Menschenwerke ein kriegerisches, festungsartiges Ansehen gewinnen.
Durch eine Reihe solcher Galerien, auf allerlei künstlichen Unterbauten, Gewölben und Brücken, auf zahllosen Zickzackwegen, die überall mit Brustmauern geschützt und gesäumt sind, rollt man auf diesen Höhen von einer Stufe zur andern hinab. Am außerordentlichsten und ergreifendsten ist der Anblick da, wo man an die steilste Wand des Tales gelangt. Hier blickt man in den genannten Schlund Cardinel hinunter. Ganz in der Tiefe, als läge es in einem natürlichen Grabgewölbe der Erde, sieht man das winzige Dörfchen Isola. Wie ein Blitz, der sich an den Boden anlegt, wie der Faden der Ariadne, führt die herrliche, zuverlässige Straße in diesen Schlund hinab. Bei jedem Schritt scheint die Natur ein »Nicht weiter!« gesprochen zu haben, und bei jedem Schritte siegte der Mensch mit seinem »Vorwärts!« Bei jeder Wendung glaubt man ängstlich, ohne weiteres in unermeßliche Abgründe hinabzuschießen, und bei jeder Wendung erhält man von neuem die angenehme Zuversicht, daß man ohne Gefahr und ganz bequem hier schreiten, traben, galoppieren kann, wie in einer Reitbahn. Man sieht die kühne Linie der Straße auf einer Reihe übereinander getürmter Terrassen fast zehnmal verschwinden und zehnmal wieder erscheinen. Auch oben hinauf sieht man Bruchstücke der Straße und die durchfahrenen Galerien und die Cantonieras an den Bergen sich hinziehen. Wer dies nicht gesehen hat, der kann es vielleicht kaum begreifen, daß der Anblick eines solchen Werkes Entzückung und Begeisterung hervorzurufen vermag, ebenso gut, wie der Anblick jeder anderen vollkommenen und großartigen Arbeit. Wie ohne diesen Schutz und diese Hilfe die deutschen Kaiser mit ihrem Gefolge hier herabgekommen sind, begreift man kaum. Vermutlich hat in den Schlünden des Cardinel mancher deutsche Ritter sein Leben eingebüßt, sowie auch bei dem kühnen Übergange der französischen Armee unter Macdonald im Jahre 1800 mancher Reiter und Fußmann hier seinen Tod fand.
Sowie man bei Campo Dolcino unten anlangt, findet man alles italienisch, die Menschen, die Bauart der Häuser, die Bäume und Pflanzen. Welschland stößt hier dichter mit Deutschland zusammen, als an anderen Alpenpunkten, als zum Beispiel im Tessintale, wo noch ein hochgelegener hinterer Talteil, das Tal von Airolo, eine Art Mischung von deutscher und italienischer Wirtschaft, deutschen und italienischen Sitten herbeiführt. Der Hauptbaum des Tales, wie überhaupt aller dieser nach Süden geöffneten Täler, ist die Kastanie. Die mehlige, nahrhafte Frucht dieses hier überall verbreiteten Baumes ist, glaube ich, die vornehmste Ursache der Erscheinung, daß sich die Italiener dem Kartoffelbau viel weniger ergeben haben als wir Deutschen. Fast überall und in allen Fällen, wo wir Kartoffeln speisen, essen sie Kastanien, die bei Geringen und Vornehmen fast ganz die Stelle der Erdäpfel einnehmen.
Man rollt noch durch zwei Kastanienhaine hindurch. Endlich erweitert sich das Tal, und da, wo sich die Gewässer des Jakobstales mit der aus dem Bergell hervorrauschenden Mera verbinden, da liegt das italienische Städtchen, das seine ersten Anbauer mit Recht als einen Schlüssel zu jenen beiden Tälern betrachteten, da sie es »Chiavenna« (Schlüsselburg) nannten.
Ich erinnere mich, daß in meiner Jugend der Zeichenlehrer immer große Landschaften und Ansichten von Städten oder Bergen an die Wandtafel malte. So wie sie unter seiner Hand und Kreide sich gestalteten, so mußten wir sie in unseren Büchern nachzeichnen. Darunter kamen auch italienische Ansichten vor, Häuser mit flachen Dächern, mit einzelnen kleinen Fensterlöchern, hohe, durchweg gleich dünne, viereckige Glockentürme, untermauerte Terrassen, auf denen die Gebäude sich übereinander erhoben, lange Reihen von Bogengängen, staffelförmige Gärten, irgendein fremdes Gewächs zwischen dem vielen Gemäuer. Ich fand diese Bilder eigentümlich und reich und glaubte sie aus der Umgegend von Neapel oder Sizilien hergeholt. Wie erstaunte ich aber, schon jetzt in den Alpen bei Chiavenna die vollständigsten Urbilder zu diesen Gemälden zu finden! Chiavenna ist eine ebenso italienische Stadt wie irgendeine in Sizilien. Man betrachtet mit Begierde all diese neuen und fremdartigen Formen und Vorgänge, die sofort einen ganz neuen Geist offenbaren: denn nicht nur die Häuser und Straßen, die Gärten und Bäume, sondern auch die Menschen haben ein anderes Gesicht, sie gehen und stehen anders, sie haben ein anderes Gebaren. Man fühlt sich in eine andere, neue und eigenartige Umwelt versetzt.
Quelle: Das Engadin, seine Heilquellen usw. Ein Vortrag von Dr. H. Lebert. Das Engadin im Kanton Graubünden ist das Längstal des Oberinns im Südosten der Schweizer Alpen. Es erstreckt sich von Südwest nach Nordost, vom Malojapaß an der Grenze der Lombardei bis zur Martinsbrücke an der Tiroler Grenze in einer Länge von fast 100 km. Einige zwanzig Seitentäler führen von Norden, von den Rätischen Alpen hernieder, während sie in den anderen Himmelsrichtungen aus Italien und Tirol sich herabsenken. Der Inn, der die Hauptrinne bildet, der auch in diesem Tale entspringt, hat auch der ganzen Landschaft den Namen gegeben; denn Engadin, ladinisch Engiadina, bedeutet Inntal. Das Engadin gehört mit dem Wallis zu den größten und höchsten Alpentälern.
Während der Talgrund von Tirol nach dem Maloja sich von 1000 bis 1800 m über die Meeresfläche erhebt, erreichen die nördlichen und südlichen Alpenketten eine Höhe, welche in der Bernina 4000 mSie ist 4052 m hoch, das Finsteraarhorn in den Berner Alpen 4275 m, die Jungfrau 4167 m. übersteigt, so daß diese in die Reihe der höchsten Berge Europas, des Montblanc, des Monte Rosa, des Matterhorns, der Jungfrau usw. tritt. Es finden sich dort zahlreiche und umfangreiche Gletschermassen, welche mit denen des Berner, des Walliser, des Savoyer Eismeers wetteifern. Urgebirge, Serpentin und Granit, welche zwischen Triaskalk und Schiefergebilden hervorragen, bauen diese Berge auf.
Den angenehmsten und lieblichsten Gegensatz zu den hohen Mauern der Alpen, zu den von ewigem Schnee bedeckten Spitzen, zu den von allen Seiten her ins Tal sich senkenden tiefgespaltenen Gletschern bildet der herrliche Baumwuchs an den Bergabhängen, wo die majestätische Arve, der zierliche Lärchenbaum von unabsehbaren Büschen der Alpenrosen umgeben sind. Steigt man noch höher, so findet man jenen schönen Blumenteppich der Alpen, in welchem der azurblaue Enzian mit dem schneeweißen Steinbrech, das großblumige dunkelblaue Veilchen mit der feinbereiften Aurikel, mit der rosigen Primel, mit dem duftenden Satyrion wechseln.
Der Inn durchströmt immer mächtiger das Tal seiner Wiege, und seine Quellseen spiegeln in ihrer kristallenen Flut schneebedeckte Berge, grüne Wälder und schöne Wohnungen einer Bevölkerung, welche, in allen großen Städten Europas durch Redlichkeit, Geschicklichkeit und Arbeitslust bekannt, eine lange freiwillige Verbannung aus dem geliebten Heimatlande gern erträgt, um den Abend des Lebens dort zu verleben, wo sie der Zauber der Naturschönheit hinzieht, wo sie als Kinder und Knaben geweilt, wo sie ihre Eltern, Verwandten und Freunde geliebt und geehrt haben, wo der gemeinschaftliche Friedhof noch die Reste vieler von denen einschließt, welche ihnen teuer waren, und deren Andenken sie begleitet, bis auch sie einst von ihrem schönen Alpentale für immer Abschied nehmen.
Das Engadin ist zwar ein Teil des großen Inntales, doch ist es so bestimmt nach Osten und Westen abgegrenzt, daß sich die Bevölkerung des Tales zu starker Eigenart entwickeln konnte. Eine fast senkrechte, 200 m hohe Felsmauer sondert das Ober-Engadin vom Bergell, von den lombardischen Nachbarn, und die tiefe schauerliche Schlucht von Finstermünz am unteren Taleingange trennt mit so mächtiger Gewalt das Unter-Engadin, das romantische Rätien von dem germanischen Tirol, daß Jahrhunderte dazu gehört haben, um stete Fehden und Feindschaft nur in gleichgültiges, entfremdetes Nebeneinanderleben umzuwandeln.
Hat man an der einsamen Martinsbrücke das Bündner Gebiet betreten, so gelangt man, nach anfänglich mühsamem Wandern in einer traurig öden Bergschlucht, erst eigentlich bei Remüs in den landschaftlich schönen Teil des Engadins. Das unheimliche Brausen des im tiefen Abgrunde strömenden Inn, die finsteren Wälder der steilen Bergabhänge, das Heulen des Windes machen jetzt den lieblichen Alpenwiesen, den sonnenreichen, vom Gesange des Menschen und dem Geräusche der Arbeit belebten Triften und Dörfern Platz, und heiter schauen die hohen Berggipfel auf den anmutigen Talgrund herab, ein Eindruck, welcher an den erinnert, den der Wanderer empfindet, wenn er von den wilden Schluchten der Teufelsbrücke durch den langen finsteren Gang des Urner Lochs auf einmal in die grünenden Matten des Urserentales tritt.
Das untere Engadin zeichnet sich durch seine eigentümlichen Talverengungen und Erweiterungen aus, welche treppenartig in drei verschiedenen Stufen übereinanderliegen; die drei Talkessel von Remüs, von Schuls-Tarasp und von Ardez, welche der Inn in tiefen Felsenrissen durchzieht.
Von den Ortschaften, welche man in diesem Treppentale antrifft, ist in erster Linie der 1560 m über dem Meere gelegene Flecken Sins merkwürdig. Denn die Sinser wandern von allen Engadinern am meisten nach dem Auslande. In dem geräumigen, länglichen Viereck, welches an ostdeutsche Marktplätze erinnert, finden wir ganz auffallend zierlich aufgeführte Gebäude, welche es von allen Seiten einfassen. Auf den Bänken vor den Häusern sitzen Gruppen von Männern in modischem, meist grellfarbigem Anzuge im lebhaften Gespräche begriffen, ihre Pfeifen und Zigarren rauchend. Was mag in jenem lärmenden Kreise junger Männer verhandelt werden, deren laute Stimme und lebhafte Gebärden unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Bedeutender Aufschlag der Zucker- und Kaffeepreise auf den Hauptmärkten Europas neben dem beabsichtigten Besuche auf einer Kuhalp der Gemeinde, ein Zusammenbruch oder kaufmännischer Glücksfall in Triest oder Livorno neben der Festsetzung des Tages der Roggenernte auf den Feldern des Fleckens, eine wichtige politische Tagesfrage neben den Erlebnissen eines ländlichen Tanzes beschäftigen die Gemüter, welche die fernen Güter mit dem Genusse der nahen und schönen Gegenwart, des heimischen Herdes und der Alpennatur mit all ihren Freuden so gut zu verbinden verstehen. – In welcher Sprache aber reden die Männer? Der romanische Grundton ist mit deutschen, italienischen und französischen Worten und Redensarten gemischt. Rings um den Brunnen in der Mitte des Platzes ist ein Kreis von Frauen mit Waschen und lebhaftem Gespräche beschäftigt. Ihre schwarze und dunkelfarbige Tracht birgt jeden Reiz des Körpers. Die Gesichtszüge der Männer und Frauen sind scharf gezeichnet, ausdrucksvoll und bei vielen schön, Gesichtsfarbe, Haare und Augen vorherrschend dunkel.
An einem sanften Bergabhange herabsteigend, gelangt man bald in die Talfläche von Schuls und Tarasp.
Schon aus der Ferne sieht man von allen Seiten her auf steilem Felsen das alte, noch wohlerhaltene Schloß von Tarasp (1418 m). Bei dem Dorfe Tarasp (1327 m), dem Weiler Vulpera (1208 m) und auf der anderen Seite des Inn bei dem Dorfe Schuls entspringen Mineralquellen, die an Heilkraft den besten aller Länder an die Seite zu stellen sind.
Kräftige Salzquellen, sprudelnde Stahl- und Sauerbrunnen, Schwefelquellen, reine Kohlensäureaushauchungen, sogenannte Mofetten, finden sich auf dem engen Raume beisammen.
In Vulpera weilen sehr viele Badegäste. Auf den Bänken rings um die Badeanlagen sitzen gruppenweise die Bewohner ferner und naher, deutscher und italienischer Gegenden. Hier der federgeschmückte Spitzhut des Deutschtirolers, dort der breitkrempige flache Hut des Welschen. Unter den Trinkgästen sieht man eine große Anzahl höchst beleibter Personen, die hier selten vergeblich Abhilfe von ihren Beschwerden suchen. Wohlgenährte alte Herren mit dunkelroten Weingesichtern und rubinroten Nasen suchen hier, wie der gläubige Hindu in den Fluten des Ganges, büßend in dem sonst verachteten Tranke die äußeren Merkmale ihrer Sünden abzuwaschen. Daneben gibt es Leidende aller Art und aller Stände. Der feine Fabrikherr mit galliger Gesichtsfarbe und Glacéhandschuhen, neben ihm der stämmige Bündner Bauer, der tirolische Klostergeistliche, der regsame lombardische Kaufmann, das schöne Geschlecht im rauschenden Seidenkleid wie in der anspruchslosen Tracht der Unter-Engadinerinnen. All das bewegt sich bunt durcheinander und unterhält sich in den verschiedensten Sprachen.
Wir wandern höher hinauf ins Ober-Engadin. Von Capella unterhalb Scanfs bis zum Maloja erstreckt sich das obere Engadin, dieser zwar rauhere, wildere, höher gelegene, aber weitaus schönste Teil des schweizerischen Inntales. Seine Höhe steigt von 1500-1750 m in einer Länge von sieben Stunden, also sehr mild sich erhebend. Die Talweite schwankt zwischen zwanzig Minuten und einer Stunde. Man teilt dieses höchste Alpental Europas in zwei Gebiete, in das der Wiesen von Scanfs bis Celerina, und in das der Seen, von St. Moritz bis zum Maloja.
An jenem Ende des Tals sollte man einen hohen Gebirgsstock wie an den ähnlichen Tälern des Rheins und der Rhone erwarten. Aber während nördlich das Tal von vielfach 3000 m überragenden Bergzügen mit ewigem Schnee und südlich von noch höheren Alpen begrenzt ist, welche in der majestätischen Bernina 4000 m übersteigen, bricht am Maloja das Tal plötzlich ab.
An den Grenzhäusern des Maloja steht man statt vor hohen Bergmauern nur an einer steil absteigenden Felswand, an welcher sich schlangenförmig eine herrliche Kunststraße hinabwindet, während ein lieblich grünendes Tal mit Sennhütten auf den Halden des Abhanges und freundlichen Dörfern im Talgrunde am rauschenden Bergbach das Auge erquickt: das Bergeller Tal, welches sich in die lombardische Ebene nach Chiavenna zu abflacht. Hat man bei Scanfs das Ober-Engadin betreten, so ändert sich sogleich das ganze Aussehen des Tals. Verschwunden sind die grausen Schluchten, auf welchen die einzelnen Hochstufen wie liebliche Oasen liegen. Man betritt ein hohes lichtes Tal, dessen einzelne Gebiete wohl noch durch gelinde Bodenanschwellungen in der Form von Querdämmen gesondert sind. Im großen und ganzen aber bildet das Ober-Engadin ein mehr zusammenhängendes Tal. Im Wiesengebiete von Scanfs bis Celerina genießt man mit heiterem unermüdeten Blicke den herrlichen Anblick der Alpenwelt. Ein mild in der Sonne erglänzendes Silberband gleitet durch das Tal, der junge Inn. Zahlreiche schöne und große Dörfer sind umgeben vom frischen, kräftigen Grün der Wiesen. Man hört aus der Ferne das wohlklingende Läuten der Kirchglocken. Die Straßen sind belebt von dem zur rüstigen Arbeit schreitenden Landmanne mit seinen kräftigen Zugtieren, von dem durchziehenden Tiroler mit dem Spitzhute, von dem im malerischen Gewande dahinschreitenden ernsten Bergamasker Schafhirten, von dem entzückten, in der reinen Bergluft alle jene Schönheiten der Alpennatur tief fühlenden Wanderer ferner Länder. Soweit das Auge reicht, schließen die Wiesen des Tals hohe Grate, oft mit Firn bedeckt, schlanke Gipfelzinnen mit ewigem Schnee ein. Zwischen den Alpenweiden mit den kleinen Sennhütten, zwischen dem dunklen Walde, welcher an das Talgebiet streift, drängen sich Gletschermassen an manchen Orten so weit herab, daß sie, von lieblichen Triften umgeben, wie ein Gruß des hohen Nordens an den warmen blütenreichen Süden ihre hellblauen Kristallmassen entfalten. Und über die ewigen Gletscher, über die prangende Flur, über den schattigen Wald wölbt sich ein so tief dunkelblauer Himmel, wie wir ihn im Norden uns kaum denken können.
Wandern wir nun nach St. Moritz zu, lassen wir die schönen Seitentäler unbeachtet, so gelangen wir durch Zuz, Ponte – wo der Albulapaß mündet – und Bevers zuerst nach Samaden, dem Mittelpunkte des einheimischen Lebens und Verkehrs. Jetzt, wo von Thusis im Domleschg eine kühne Schmalspurbahn sich an den Wänden des Albulatales anklammert, bald sich dem Flusse anschmiegt, bald mit kecken Brücken aus Stein das Tal überspringt, bald sich in die Felsen verkriecht, um zuletzt durch einen 5866 m langen Tunnel auf Bevers loszusteuern, jetzt genießt Samaden, Celerina und vor allen St. Moritz und Pontresina den Goldsegen des Fremdenzuflusses und hat einen viel regeren Verkehr als ehemals.
Bei Samaden ist die größte Talweite. In dem reichen Flecken sieht man neben den schönen Wohnhäusern der aus der Fremde heimgekehrten Engadiner auch die altberühmten Wohnungen der Männer, welche von Jahrhundert zu Jahrhundert die Geschichte des grauen Bundes mit hoher Ehrfurcht nennt. Die Familienwappen verlieren sich hier nicht farblos auf der grauen Mauer des Burgtores, sondern schweben in zierlicher Vornehmheit an den feinen eisernen Balkonen. Im Innern findet man neben vielen Spuren längst verschollener Zeiten alle Annehmlichkeiten des modernen Lebens.
Von Samaden aus hat man im Tale die schönste Aussicht auf das Tal von Pontresina, auf die Bernina und ihre Gletscher, unter denen der Morteratsch am tiefsten sich ins Tal senkt. Von Samaden gelangt man in den freundlichen Flecken Celerina, mit welchem das Gebiet der Wiesen abgeschlossen ist. Gar bald ist der waldige Querdamm überschritten, und wir befinden uns in St. Moritz. Wir betreten das Gebiet der Seen und Quellen.
Es ist ein ebenso schönes als wunderbar überraschendes Naturbild, wenn man, vom Julier herabkommend, nach und nach die ganze Herrlichkeit dieses Gesamtbildes des Seengebietes sich entfalten sieht. Die lichte Fläche jener klaren Seen mildert den ernsten Eindruck der hohen himmelansteigenden Felsenmauern mit ihren zackigen Spitzen und Graten und dem eisigen Hauche der Gletscher. In der durchsichtigen Flut spiegeln sich die Wiesen des Ufers, die Wälder der Bergabhänge mit den prächtigen Lärchen und der königlichen Arve, jener Zeder der südlichen Alpen. Die Schneegefilde des Hochgebirges bilden auf der glatten Spiegelfläche der Seen ein Gemälde von unendlichem Reize, und das rosige Alpenglühen mit seinem zarten Hauche wird durch den feuchten Glanz der Wellen zum anmutigsten Bilde. Den von Fedoz herkommenden wilden Sohn der Gletscher hegen und pflegen die freundlichen Nymphen der Seen und möchten ihn gerne in ihrer Alpenheimat zurückhalten, aber unaufhaltsam flieht er von der einen zur anderen, bis er aus dem St. Moritzer See bereits als Innstrom über einen breiten Abhang mit schäumenden Wellen herabstürzt. Grünende Matten, große, freundliche Dörfer mit schönen weißen Häusern und zierlichen Gärten, Saatfelder und Laubholz, selbst noch Fruchtbäume wechseln ab mit jenen stillen Seen von Sils, Silvaplana, von Campfèr und von St. Moritz. Des Menschen Fleiß und des Fleißes Kind, der Wohlstand, prangen unter jenen herrlichen Gaben der Natur.
Am nördlichen Talabhange zieht (in zahlreichen Windungen bei Silvaplana am Julier emporklimmend) die große Straße hin, welche von der Lombardei ins Tirol, vom Engadin in das rätische Vaterland, in das stets dem Engadiner ans Herz gewachsene Veltlin und in die italienische Ebene führt.
Für jede Stimmung des Gemüts findet der Wanderer in diesem Gebiete der Seen den geeignetsten Ruhepunkt. Vom Maloja seitlich liegt das Fextal, dessen höchste bewohnte Häuser, bis auf 2000 m aufsteigend, zu den höchsten Europas gehören. Von hier führt ein einsamer Pfad durch Berge, über Felsen und Gletscher in das Rosegtal und das eisige Reich der Bernina. Sils-Maria in seiner stillen Einsamkeit, mit seinen unübertrefflich schönen Baumgruppen, seinen freundlich gastlichen Wohnhäusern, dem hier beginnenden See, den auf solcher Höhe Erstaunen und Bewunderung erregenden Blumengärten – Sils macht den Eindruck eines jener stillen Orte der Alpenwelt, in welchem die Stürme des Lebens, die Sorgen tätigen Ringens freudevolle Vergessenheit in der Stille der Natur finden.
Silvaplana am Fuße des Juliers ist ein sehr belebter Ort. Hier kommen die Straßen verschiedener Bergpässe zusammen. Hier herrscht reges Treiben, und der Engadiner, welcher nach langem geschäftigem Leben in die liebe Heimat zurückkehrt, sieht hier im Sommer Fremde aus allen jenen fernen Gebieten, welche er durchwandert hat, sowie der Fremde nicht minder erstaunt ist, im Posthaus und seiner Umgebung die verschiedensten Sprachen, ja oft die heimische Mundart seiner Vaterstadt zu hören.
Vom Hotel Kulm in St. Moritz hat man die prächtigste, doch auch von dem Platze vor dem Kurhause zugleich die lieblichste und großartigste Aussicht. In nächster Nähe befindet sich der St. Moritzer See mit seinem klaren grünen Wasserspiegel, und oberhalb davon höchst malerisch emporsteigend das Dorf St. Moritz.
Wälder von Lärchen und Arven, deren weiches Moospolster von der nordischen Linnaea durchflochten ist, grüne Waldwiesen umgeben den See auf der Südseite, und von den Höhen des Julierpasses bis zu den steilen Granitspitzen oberhalb Samaden sieht man über dem ewigen Schnee und dem vergletscherten Firn den Piz della Margna, die einsamen Gletschergefilde der Suvretta, die rote, in zwei Stufen gipfelnde Pyramide des Piz Munteratsch (Piz Julier), die Bergspitzen von Nair, Padella, Ott. Nirgends endlich sieht man so schön die schlanke Felsengruppe und die schöne Spitze des Piz Languard, wie von St. Moritz aus. Wer nicht im einsamen Waldpfade, an den Ufern des Sees oder den Alpenwiesen am Abhange emporsteigen kann, findet Wagen, ja Straßenbahnen, welche ihn auf trefflichen Kunststraßen durch das ganze Tal, ja bis an den Fuß des einsamen Morteratschgletschers, selbst auf die Höhe des Berninapasses fahren können.
Die St. Moritzer Quellen gehören zu den kräftigsten Eisensäuerlingen. Die alte Quelle hat 5,6°C, die neue nur 4,4°C.
Der eigentliche Sommer ist im Oberengadin nur kurz und kühl, der Höhenlage entsprechend, er bietet aber viele trockene, sonnige Tage und verhältnismäßig wenig Niederschläge. Oft fällt schon in den Augustnächten so viel Schnee, daß am Morgen die ganze Landschaft vom weißen Winterkleide bedeckt ist und Eiszapfen zahlreich von den Dächern herabhängen. Doch meist schon am Abend hat die Gegend wieder ihr herrliches sommerliches Ansehen, und noch viel schöne, milde Tage folgen diesen ersten Schneefällen.
Man sagt vom Engadin, daß es acht Monate hindurch Winter habe, und gerade deshalb ist es der beliebteste Winteraufenthalt der vornehmen Welt geworden, die auf der Eisdecke der Seen dem Schlittschuhfahren, auf den steilen Gehängen den verschiedenen Arten des Schneeschuhlaufs und des Rodelns huldigt.
Nach genauen Beobachtungen bleibt im Durchschnitt der Schnee, dieser richtige Maßstab des Winters, hier 5 Monate und 22 Tage liegen. Die vollständigsten Beobachtungen sind gerade in Bevers, dem kältesten Orte des ganzen Engadins, vom Lehrer Krättli gemacht worden. Die mittlere Jahrestemperatur ist dort +2,5°C, die Mitteltemperatur der Sommermonate Juni, Juli, August +11,6°C, die der Monate Dezember, Januar, Februar -8°C, die der Frühlingsmonate März, April und Mai +1,9°C, und die der drei Herbstmonate September, Oktober, November +3,9°C, also fast +4°C. Im Sommer wie im Winter beobachtet man nicht selten bedeutende Temperatursprünge. Nach heißen Tagen sinkt das Thermometer auf den Gefrierpunkt in einzelnen Nächten des Sommers; nach eisiger Kälte im Winter von -25° steigt es mitunter rasch bis auf +5°C, was von dem oft schnellen Überspringen südwestlicher Winde in nordöstliche und umgekehrt abhängt. Der Frühling und die ersten Wintermonate sind besonders feucht. Winter und Sommer sind aber gewöhnlich trocken und heiter.
Bereits im März schmilzt der warme Hauch des Föhns an sonnigen Abhängen den Schnee, und alsbald erscheinen einzelne Blumen. Gewöhnlich aber findet man erst Ende dieses Monats den schönen dunkelblauen Frühlingsenzian. Gegen Ende April beginnt der Schnee überhaupt zu schmelzen. Mit den ersten Tagen des Mais ist das Tal von allem Schnee befreit, nachdem schon vorher größere Strecken sonniger Wiesen sich mit Blumen geschmückt haben, namentlich mit der schönen Frühlingsanemone, mit Krokuspflanzen, sowie an den Felsen mit den frischen grünen Blättern und rosigen Blumen der Bergprimeln. In den Lüften singt jetzt schon die Lerche ihr Frühlingslied, und gegen Ende April langen auch die Schwalben wieder an. Der Kuckuck aber wartet das Ende der Schneeschmelze ab, bevor sein einsamer Ruf die Luft durchtönt. Bald werden nun auch die lichten Seen frei vom Eise.
Die Bergamasker Schafhirten ziehen mit den Herden auf ihre Sommerweiden. Der Landmann besorgt seine Saat vom Getreide und Kartoffeln. Hat auch die Alpenrose ihre schönen Blüten entfaltet, so prangen die Fluren in aller Pracht ihres lieblichen Frühlingsgewandes. Die Herden verlassen jetzt das Tal, der Klang ihrer abgestimmten Glocken verkündet auf immer höher liegenden Alpenwiesen ihre Ankunft, bis sie gegen Ende September wieder ins Tal herabkommen. Im Juli blühen Roggen und Gerste. Gegen Ende dieses Monats beginnt die Heuernte, die weitaus bedeutendste für das Engadin, welche zu vielen frohen Festlichkeiten Veranlassung gibt. In der ersten Hälfte des Septembers wird auch das Getreide eingebracht. Die Schwalben verlassen jetzt bald das Tal, und gleichzeitig ziehen Scharen anderer Zugvögel über die Alpen.
Wir treffen im Engadin das Getreide bis zu einer Höhe von nahezu 1800 m, also über 600 m höher als in der nördlichen Schweiz und in den deutschen Gebirgen, ebenso hoch steigt auch die Kartoffel. In Sils-Maria reift noch die Kirsche, deren obere Grenze sonst ebenfalls nahezu 600 m tiefer ist. – Die Grenze des ewigen Schnees, welche in den übrigen Schweizer Alpen auf 2600 m angegeben wird, ist im Engadin in nahe 2800 m Höhe. Die Tanne gedeiht noch bis 1800 m. Die Arve und der Lärchenbaum übersteigen 2100 m. Diese günstigen Verhältnisse sind zum Teil dem leichten Zugange der warmen, aus Italien kommenden Luftströmungen zuzuschreiben.
Außerordentlich abwechselnd und reichhaltig ist auch die Blumenwelt. Nächst den Tälern von Saas und Zermatt im Wallis hat das Engadin die schönste Pflanzendecke der Schweiz. Wie in den Alpen überhaupt, trifft man hier neben den Blumen des hohen Nordens die der gemäßigten, selbst südlichen Länder. Italienische und Tiroler Pflanzen kommen mannigfach neben den der Schweiz eigenen vor. In Höhen von 3000 m, ja darüber, gibt es noch viele Stellen, wo der Boden ganz mit den rosigen Blüten der Androsace glacialis, den weißen Saxifragen, den dunkelblauen Enzianen und Phyteumaarten bedeckt ist. Der Stengel der Blumen ist fast verschwunden, und die zahlreichen Blüten ruhen weich und sanft auf dem grünen Rasen der Blätter. Auf dem Piz Languard, 3250 m, blüht noch das schöne dunkelblaue Vergißmeinnicht der Hochalpen, Erytrichum nanum.
Nicht minder merkwürdig als die Pflanzen des Engadins sind seine Tiere. In einsamen Waldungen haust noch der Bär. Auf den höheren Berggefilden stellt das Murmeltier seine aufmerksamen Schildwachen aus. Überall kommt die Gemse in Rudeln vor. Der edle Steinbock mit dem mächtigen Gehörne ist leider auch aus den Hochalpen des Engadins verschwunden; er haust nur noch in den Grajischen Alpen, wird aber jetzt von St. Gallen aus in der Schweiz wieder eingebürgert mit gutem Gelingen.
Zahlreiche Singvögel bewohnen im Sommer das Tal und die Wälder der Berge. Der Adler und der mächtige Lämmergeier nisten auf den hohen Felsen. Im Herbste durchziehen Scharen von Zugvögeln das Tal, um der Wärme des Südens zuzueilen, unter welchen man sogar Schwan und Taucher beobachtet hat.
Höchst mannigfach und an seltenen Arten reich sind auch die Insekten des Engadins; besonders schön sind seine Schmetterlinge, die fliegenden Blumen des Sommers. Hier kommt u. a. der seltenste aller europäischen Schmetterlinge, Euprepia flavia, vor. Zu den angenehmsten meiner naturwissenschaftlichen Erinnerungen gehört es, daß ich mir dort ein paar jener seltenen, sonst nur in Sibirien vorkommenden Falter verschaffen konnte. Auf dem Maloja habe ich auch zu meinem großen Erstaunen die Wanderheuschrecke angetroffen und erfuhr dann, daß sie im unteren Bergeller Tal große Verheerungen angerichtet hatte.
In diesem Alpenlande, welches soviel Eigentümlichkeiten darbietet, haben auch die Berggipfel und ihre Aussichten einen eigenen Charakter. Von dem 3250 m hohen Piz Languard sieht man, neben nur wenigem Talgrunde, über 800 hohe Bergspitzen, von denen ein großer Teil 3000 m überragt. Von der Bernina beherrscht man, außer einer Legion hoher Grate und Zinnen, eine Zahl und eine Mannigfaltigkeit naher und ferner Gletscher, wie sie weder der Montblanc noch Monte Rosa, noch die Gipfel des Berner Oberlandes darbieten. Leider ist die 4052 m hohe Bernina sehr schwer besteigbar. Nachdem sie der Ingenieur Coaz unter großen Gefahren im Jahre 1850 bezwungen hatte, war die Abenddämmerung hereingebrochen, bevor er das Gebiet der Gletscher verlassen konnte. Immer finsterer wurde die Nacht; immer schauriger die Aussicht auf den fast gewissen Tod in der eiskalten Nacht, ohne jeden Schutz vor unvermeidlicher Erstarrung. Da erschien plötzlich am Himmel der Mond in vollem Glanze und verbreitete ein so mildes Licht über die Gebiete des Eises und Firns, daß Coaz mit seinen Führern die am Morgen eingehauenen Tritte wieder erkennen konnte. Kaum waren sie über die Region der Gletscher hinaus, da verschwand der Mond wieder hinter den Wolken und, nach unsäglichen Mühen während voller zwanzig Stunden, gelangten sie in der Nacht um 2 Uhr an das gastliche Haus des Berninapasses.
Seitdem ist die Berninaspitze öfters bestiegen worden.
Die Bevölkerung des Tales beträgt ungefähr 10 000 Einwohner, von denen fast zwei Drittel auf das zwölf Stunden lange Unter-Engadin und etwas über ein Drittel auf das sieben Stunden lange Ober-Engadin kommen. Die Volkssprache, Ladin genannt, ist ein räto-romanischer Dialekt. Das Ladinische wird außer im Engadin auch im Albula- und Münstertale gesprochen. Verwandt ist das Churwelsche im Bündner Oberlande, in den Gebieten von Oberhalbstein und Schams und das Tiroler Romanisch im Enneberger und Grödner Tal. Während der nahezu fünfhundertjährigen Herrschaft der Römer über das Bündner Land hat sich, mit einiger Vermischung keltischer Worte, das Ladin entwickelt oder vielmehr in seiner Besonderheit erhalten. Es gleicht sehr der Sprache der Troubadours, dem Provençalischen, in mancher Beziehung dem Spanischen. Mit der milden, fast musikalischen Weichheit des Italienischen verbindet es die volltönenden Doppellaute und den mehr kräftigen Lautstand der deutschen Sprache. Es wird von der romanischen Bevölkerung Graubündens sehr hochgeschätzt und festgehalten. Ein junger, aus Würzburg zurückkommender Arzt, dessen Vater lange in Deutschland gelebt hatte, erzählte z. B., er hätte es nie wagen dürfen, seinem Vater anders als in ladinischer Sprache zu schreiben. Trotzdem gewinnt das Deutsche, das jetzt fast jeder Engadiner, der Bücher und Zeitungen liest, versteht, immer größere Ausbreitung, und in den Schulen wird überall Deutsch gelehrt. Das herrschende Bekenntnis ist das reformierte, mit Ausnahme des katholischen Tarasp und des Grenzgebietes von Samnaun.
Trotzdem, daß für ein fast neunzehn Stunden langes Tal eine Bevölkerung von 10 000 Einwohnern nicht übergroß erscheint, würde diese dennoch bei dem verhältnismäßig geringen Ackerlande und dem Fehlen der Industrie nur mit Mühe einen hinreichenden Lebensunterhalt finden. Daher die Wanderlust der Engadiner! Wohl jede große Stadt Italiens, Deutschlands, Frankreichs gibt den arbeitslustigen Söhnen der Alpen Beschäftigung. Welchen Beruf sie auch erwählen mögen, überall zeichnen sie sich durch Ehrlichkeit, Genügsamkeit und Fleiß aus. Voll natürlicher Würde in ihrem Wesen, sind sie überall beliebt und geachtet. Bis in die fernsten Gegenden bewahren sie treu ihre romanische Sprache. Unermüdlich ist ihre Tätigkeit, bis sie so viel erworben haben, daß sie in die liebe Alpenheimat zurückkehren und dort sorgenfrei von dem Ertrage ihres jahrelangen Fleißes leben können. Und darum zieren alle Dörfer herrliche Wohnhäuser; darum hört man in diesem Tale alle Sprachen und Mundarten des gebildeten Europa. Rührend ist es, zu sehen, mit welcher urväterlichen Einfachheit selbst die Reicheren im heimatlichen Dorfe leben. Der auflösende Prunk großer Städte hat ihr treues Herz nicht bestochen. In dem Aufrechthalten der besten Überlieferungen der Familie, in dem regsten Wohltätigkeitssinne finden sie noch bis ins höchste Alter neben dem Wonnegefühl, in der Heimat zu sein, ihre größten Freuden.
Zweckmäßig und wohnlich ist das Engadiner Haus. Fest aus Stein ausgeführt, seltener farbig als vom reinsten Weiß, mit dicken festen Mauern, mit kleinen, fast wie Schießscharten tief liegenden Fenstern, mit großem Toreingange, mannigfachen Zieraten bei den Begüterten, schönen Balkonen, bei einzelnen mit Wappen geziert, zeigt sich das Äußere einer solchen Wohnung.
Im Innern birgt das Haus außer den Zimmern auch den Heuboden und den Viehstall, der besonders sauber und gut eingerichtet ist. Neben der Bequemlichkeit, die Tiere versorgen zu können, ohne aus dem Hause zu gehen, wird so auch ihre Wärme während des langen Winters benutzt. Ja, im Viehstalle finden sich auch wohl Tische und gepolsterte Bänke, bei einigen sogar Spiele, Zeitungen und Bücher, so daß er auch als Stube dienen kann. Das gemeinschaftliche Wohnzimmer ist gewöhnlich mit Arvenholz getäfelt, bei den Wohlhabenderen mit schönen Holzschnitzereien verziert, so wie man hier auch noch jene hohen prächtigen Wandschränke mit schöner erhabener Arbeit findet, welche in neuerer Zeit wieder mit Recht sehr gesucht werden. Von ungewöhnlicher Größe ist der Ofen, welcher bei den Reicheren mit schönen Malereien geziert und mit einer kissenbedeckten Ofenbank umgeben ist. In dem oberen Stock liegt, durch eine verschließbare Öffnung mit der Wohnstube in Verbindung gebracht, das Schlafgemach, und daneben noch andere Zimmer. Selten ist ein Haus von mehr als einer Familie bewohnt.
Die Bevölkerung genießt gern in den Zeiten der Muße die Freuden des Lebens. Zu den Lieblingserholungen der Jugend gehört auch hier der Tanz, der jedes ländliche Fest beschließt. Auch ohne die feine Musik unserer Städte herrscht auf diesen ländlichen Bällen Frohsinn und Munterkeit; ja man sieht hier unter den schlanken Burschen und schönen Mädchen anmutsvollere Gestalten als im blendenden Licht der Kronleuchter in feinen Modekleidern, bei brausendem Schaumwein in den Tanzsälen. Die Bilder Segantinis geben dies Volk und sein Land in aller Kraft und Schönheit wieder.
Nach Bumüller, Buch der Welt. Der nördlichste Stock des schweizerischen Alpengebirges ist der Säntis;Vergleiche die vier Gedichte vom Säntis in den vier Jahreszeiten in den lyrischen Gedichten der Droste-Hülshoff! vereinzelt steht er da, wie ein gewaltiger Markstein oder wie ein Flügelmann vor der langen Reihe der Alpenhörner. Stolz schaut er mit 2504 m Meereshöhe über den Bodensee ins schwäbische Oberland, bis an die Rauhe Alb, auf deren Vorsprüngen man ihn überall sieht, von Ulm an bis an den Dreifaltigkeitsberg ob Spaichingen. Südlich begrüßt er als Nachbarn die Kette der Churfirsten, von denen ihn eine tiefe Senke trennt, in welcher die Thur ihre Quelle hat; da liegt das Dorf Wildhaus, der Geburtsort des Reformators Ulrich Zwingli. Südwestlich lagern sich einige Stunden weit die Nagelfluhberge der Toggenburg an, alle etwa 1000 m niedriger als die Kuppe des Säntis; östlich senkt sich der Kalkfelsenkamm des Gebirges im Altenmann, der Bruderkuppe der Säntishöhe, um 70 m, dann aber sehr bedeutend im Kamor; denn seine höchste Spitze, der »Hohe Kasten«, erhebt sich nur noch 1800 m über das Mittelmeer. Darauf verschwindet der Kalkstein und macht der Nagelfluh und dem Sandstein Platz, und damit hört auch die Kuppen- und Hörnerbildung auf, welche das Alpengebirge auszeichnet; das Gebirge verflacht sich in ein tafelförmiges Hochland, das da und dort zu langgestreckten Rücken anschwillt. Dieses Tafelland endet auf jeder Seite, gegen den Rhein, den Bodensee und die Thur, in einem scharfen Rande und fällt endlich gewöhnlich in zwei Stufen in die Talfläche ab. Eine gerade Linie von der Säntisspitze bis zum Bodensee ist nahezu sechs Stunden lang, und die Abdachung beträgt in dieser Richtung 2100 m, die Höhe des Säntis zu 2500 m, die des Bodensees zu 400 m, in runden Zahlen angenommen; eine Linie von Südost nach Nordost durch die größte Breite dieser Gebirgsinsel gezogen, vom Kamor bis Herisau (1800 bis 775 m), mißt fünf Stunden, und die Senkung erreicht beinahe die Hälfte der obigen (1025 m).
Dieses Hochland nun von der Säntiskuppe bis an den Rand der Hochfläche ist der Kanton Appenzell; ihn umgibt St. Gallen rundum, so daß es bis zum Rande des Oberlandes aufsteigt. Demnach bildet das 400 qkm große Ländchen der Appenzeller, so klein es auch ist, erdkundlich ein Ganzes, das stufenförmig emporsteigt, und in das der Wanderer, von welcher Seite er auch kommt, bergan steigen muß. Jetzt führen auf allen Seiten schöne Kunststraßen in dieses Hochland; und von Winterthur aus erklimmt gegenwärtig die Eisenbahn die Bergfeste Appenzell, Herisau und Stadt Appenzell verbindend. Vor Jahrhunderten wurden die Zugänge durch Verhaue und rohe Schanzen, aus Felssteinen und Baumstämmen dammartig aufgeführt, geschlossen, und vor dieser Festung ward von den Appenzellern mancher Feind blutig zurückgeschlagen.
Ein solches Hochland hat begreiflich einen langen Winter, der in der Regel vom November bis Ende Mai dauert. Wenn der Appenzeller im Hügellande des Thurgaus alles treiben und sprossen, wenn er den Bodensee mit grünem Saume umwunden sieht, deckt seine Heimat noch der Schnee, welcher erst der wärmenden Frühlingssonne und dem Südwinde ganz weicht, auf dem Säntis aber der Sonne und dem Föhn Trotz bietet. Getreidebau wird eigentlich gar nicht betrieben; der Anbau beschränkt sich auf die Kartoffel und einiges Gemüse. Doch ist in tieferen Lagen der Obstbau nicht ganz unbedeutend. Das Kleinod des Landes aber sind die herrlichen Wiesen und Weiden, deren saftiges Gras eine Menge der schönsten Kühe nährt, und da, wo an den Berg- und Felsenwänden noch Gras und Kraut wurzeln, klettern Schafe und mutwillige Ziegen, diese gewöhnlich das Eigentum armer Leute, welche keine Kuh zu halten vermögen. Die Viehzucht ist demnach ein Hauptnahrungszweig der Einwohner, besonders im hinteren und höheren Landesteile, am Säntis und Kamor, weniger im vorderen Lande, das ungewöhnlich stark bevölkert ist.
Der ohnehin so kleine Kanton ist doch noch in zwei Staaten geteilt: Appenzell-Inner-Rhoden und Appenzell-Außer-Rhoden; Rhoden steht mundartlich für »Rotten«, ursprünglich die militärische Einteilung des Ländchens bezeichnend, daher es eigentlich die »Innern Rhoden« und die »Äußern Rhoden« geschrieben wird. Inner-Rhoden ist etwas kleiner als Außer-Rhoden und beschränkt sich auf das eigentliche Gebirgsland; es ist ein Hirtenländlein mit etwas mehr als 13 000 Einwohnern; Außer-Rhoden nimmt hauptsächlich das Hochland ein und zählt über 54 000 Einwohner, die namentlich von dem Ertrage ihres Kunstfleißes leben; Inner-Rhoden ist arm, Außer-Rhoden aber wohlhabend, jenes katholisch, dieses protestantisch. Vor 400 Jahren machten die beiden Rhoden nur eine Volksgemeinde aus; als aber zur Zeit der Reformation der eine Teil die neue Lehre annahm und der andere der alten treu blieb, hielten sie es nicht mehr für möglich, gemeinsam hauszuhalten. Sie gingen auseinander, aber in Frieden, und nahmen auch später an den Religionskriegen in der Schweiz keinen Anteil.
* * *
Es ist ein lohnender Ausflug, eine Fußwanderung durch das Appenzell; denn in drei Tagen kann ein rüstiger Fußgänger das Ländchen durchkreuzen, und dann hat er eine wahre Vorschule für eine rechte Schweizerreise gemacht. Im katholischen Inner-Rhoden blicken wir noch in die stillen Hallen der Nonnenklöster, und aus einem anderen Kloster tritt uns der ehrwürdige Kapuziner entgegen; in Gonten, Weißbad und Gais treffen wir Badegäste aus halb Europa und lustiges, gesellschaftliches Leben. Auf den Bergwanderungen kehren wir in Sennhütten ein, um uns zu erquicken; die Hütte ist roh aus Balken und Steinen zusammengefügt, die Fugen sind mit Moos verstopft. Stühle zum Niedersetzen gibt es nicht überall, außer dem Melkstühlchen mit einem Fuße. Doch auf der Eben- und Meglisalp ist für die Einkehrenden schon besser gesorgt durch Tische und Bänke. In der einen Ecke hängt der große Käsekessel über dem Feuer, dessen Rauch zur Tür hinauszieht oder durch Ritzen und Spalten Nebenwege sucht. Auf der anderen Seite endet die Hütte in einen kleinen Stall, dessen Bewohner sich durch Grunzen zu erkennen geben. Auf der Decke des Stalles ist Heu ausgebreitet, ein paar grobe leinene Tücher oder Säcke verraten bald ihre Bestimmung – hier ist das Bett des Sennen. Dieser holt aus einer Höhle, die im Hintergrunde der Hütte in den Berg gegraben ist, Milch, Butter und Käse und ermahnt, tapfer zu essen, denn beim Bergsteigen bekommt man Hunger – und daß er recht hat, beweisen wir. Aber welcher Wohlgeschmack, diese Milch und diese Butter! Wer noch nie in den Bergen gewesen ist, kann es gar nicht glauben, daß sie so ganz anders schmecken als in den Ebenen. Da wachsen freilich auch ganz andere Futterkräuter als im Tale; betrachte einmal den Rasen der Alp (so nennt der Senne seine Bergweide), wie dunkelgrün, wie dicht, unter dem Fußtritte anschwellend wie ein grünes Sammetpolster; da sieht man keine hochgeschossenen dürren Halme, keine Disteln und Herbstzeitlosen, aber verschiedene Arten von Klee, mit roter, gelber und weißer Blüte, und andere würzige Kräuter, welche die Ebene nicht kennt.
Schon im Anfang Mai ziehen die Sennen mit Ziegen und Schafen auf die Alp; vier Wochen später langen dann auch die Kühe an, gewöhnlich in Zügen von 24 Stück mit einem Stier, was man ein Senntum heißt. Gemeiniglich rechnet man dazu auch 2-3 Schweine und 4-6 Ziegen. Von einem Senntum besitzen oft verschiedene Bauern einen verhältnismäßigen Anteil, und dies ist die einzige übliche Art der Gesellschaftssennereien. Wo mehrere Senntümer zusammenkommen, kämpfen die Stiere um die beiden Weideplätze, und die schwächeren müssen den stärkeren weichen. Als solche Plätze bezeichnet man namentlich die, wo das duftende Mutteri (Meum mutellina) und das Adelgras oder Rüz (Plantago alpina – Alpenwegerich) reichlich gedeihen.
Der Senne bleibt bis in den September auf seinen Bergeshöhen, kommt während der ganzen Zeit vielleicht nicht ein einziges Mal in sein Dorf herab, wird nur besucht, wenn man den Käse abholt, oder wenn eines seiner Angehörigen ihm Brot oder irgendein Werkzeug bringt. Seine Nahrung ist Milch und magerer Käse, und er behilft sich oft wochenlang ohne Brot; zeigt aber ein Reisender, der bei ihm einkehrt, Schinken, kalten Braten, oder gar eine Weinflasche, so sieht man den sonst so genügsamen Mann vor Begierde zittern, so sehr verlangt es ihn nach jenen gaumenreizenden Nahrungsmitteln, und er gibt gern Butter, Käse und Milch die Fülle für den ihm überlassenen Anteil.
Die Kleidung des Sennen ist so einfach als möglich; zwillichene Hosen, die bis über die Knie reichen, und eine blaue Bluse, hier Fulterhemd genannt; er geht barfuß oder auf hölzernen Sohlen, auf dem Kopfe sitzt ein schwarzes ledernes Käppchen, und eine kleine Pfeife läßt er selten aus dem Munde; schon die Buben rauchen, und sollten sie die Pfeife mit dürren Heublumen füllen müssen. Man trifft unter den Sennen häufig große Männer von kräftigem Körperbau, in der Regel aber ist der Appenzeller mehr untersetzt gebaut, stark geschultert, braun- oder blondhaarig; aus den grauen Augen, dem breiten Gesicht spricht Schalkheit und trotzige Derbheit. Er ist stolz auf seine Heimat, seinen Beruf und selbst auf seine Lebensweise; der Fremde, der ihn meistern oder gar seiner spotten will, wird mit einem Hagel von beißenden Witzen überschüttet und nicht allzu sanft heimgeschickt. Die Appenzeller sind durch ihren Mutterwitz in der Schweiz sprichwörtlich, und ihre Lustigkeit ist nicht geringer; eine Gesellschaft Appenzeller, besonders innerrhodischer Hirten, macht mehr Lärm als zehnmal soviel Norddeutsche. Da heißt es laut sprechen und schnell sprechen, und das geschieht in sehr hohen Noten mit einer eigentümlich hüpfenden Betonung, so daß einzelne Worte fast geschleudert werden. Schauplätze solcher Lust, wohl auch der Ausgelassenheit sind an schönen Sonntagen einzelne Punkte, die wegen ihrer herrlichen Fernsicht von dem Wanderer aufgesucht werden. An solchen Punkten hat das Land einen unglaublichen Reichtum, und von der Erhabenheit ihrer Aussicht: in das Gebirge der Alpen, in die tiefen Flußtäler, über den Bodensee hin bis in die bläuliche Ferne des deutschen Hügellandes kann man sich nur schwer eine Vorstellung machen; da reicht keine Beschreibung zu, selbst der Pinsel gibt nur ein schwaches Bild dieser Herrlichkeit.
Wir machen von Gais einen Ausflug an den Stoß, einen Paß nach Altstätten im Rheintal; dort steht eine Kapelle, zu welcher alle Innerrhoder einmal im Jahr in feierlichem Aufzuge wallfahren, weil da ihre Väter am Fronleichnamstage 1405 die Feinde siegreich zurückschlugen. Dem Fremden aber läßt die Aussicht nur wenig Zeit zur Erinnerung an die alten Heldentaten. Da schaut er hinab in das breite tiefe Rheintal, durch welches er den Fluß wohl zehn Meilen raschen Laufes daherströmen sieht. Zu beiden Seiten liegt ebenes, wohlangebautes Gelände, besät mit Dörfern und Städtlein. In gewaltigen Massen steigt das Gebirge Vorarlbergs und Tirols empor, nicht allmählich, sondern plötzlich, nur wenige Stunden von dem Beschauer entfernt. Man sieht die Umrisse des Gebirges so deutlich, die Fluhen, Felsen, Schnee- und Eismassen liegen so klar da, daß man glaubt, man müsse die Gemse sehen können, die zufällig über Fels und Eisstöcke hinwegsetzt. Und wie mannigfaltig ist die Beleuchtung dieser Landschaft! Wie dunkel der Fichtenkranz, der die untere breite Seite der Berge gürtet, wie hell strahlen Fels und Gletscher im Sonnenlicht, wie zittert das von den Bergwänden des Rheintals vielfach zurückgeworfene Licht über dem breiten Tale tief unter uns, wie schimmert der Strom in seinen fernsten Windungen!
Von Weißbach geht es auf die Ebenalp und das Wildkirchlein; in zwei Stunden sind wir dort. Die Ebenalp ist eine Felsplatte mit schwacher Neigung gegen Norden; sie ist schön begrünt und reicher an Alpenpflanzen als der Rigi; eine trichterförmige Vertiefung von 15 m im Umfange, das Wetterloch, enthält das ganze Jahr hindurch Schnee und Eis. Die Aussicht ist herrlich; sie erstreckt sich über den Bodensee, die östliche Schweiz mit den zahllosen Alpenfirsten und einen bedeutenden Teil des südlichen Baden, Württemberg und Bayern. Durch eine Felshöhle, 1000 Schritte lang, 18 m breit, mit einer Wölbung von 20 m, von welcher Kalkwasser tropft, gelangt man zum Wildkirchlein, einer natürlichen Grotte in Kalkfelsen, die in eine Kapelle verwandelt ist. Ein Glockentürmchen ist daneben angebracht worden, und ein bärtiger Einsiedler verkündet mit hellem Glöcklein die Tageszeiten über die reizende Gebirgsöde. Er bewohnt eine kleine Hütte; eine Felsengrotte dient ihm als Keller, aus dem er dem Reisenden Speise und Trank herbeiholt. Da sitzen wir 1500 m über dem Meere, an hoher Felsenwand, und betrachten mit Entzücken die reizende Gebirgswelt. Da möchte man tagelang weilen und scheidet mit schwerem Herzen von diesem erhabenen Schauspiele. Und Meister Scheffel hat nicht so unrecht, wenn er das Waltharilied Ekkehards hier oben in der Bergeinsamkeit entstehen läßt.
Wir wollen aber noch höher, auf die Säntishöhe von 2504 m, um von diesem erhabensten Punkte des Appenzells in die weite Welt zu blicken. Diese Bergfahrt dauert sechs Stunden. Gegen Abend brechen wir unter Leitung eines kundigen Führers auf, steigen vier Stunden rüstig bergan und übernachten in einer Sennhütte. An Schlafen ist nicht viel zu denken, und es macht Freude, das lustige Feuer von dürrem Tannenholz wohl anzuschüren. Mit dem ersten Tagesgrauen steigen wir wieder bergan, um den Gipfel vor Sonnenaufgang zu erreichen. Oder noch besser, wir steigen durch das Seealptal über die Meglisalp schon am Abend zur Säntisspitze empor und übernachten im – Hotel Säntis, einem bequem eingerichteten Wirtshäuschen, das gute Betten hat. Man kann dann den Sonnenunter- und Sonnenaufgang genießen. – Schön glühen die Alpenhörner Tirols in rosiger Pracht, immer weiter schreitet das purpurne Licht über die Berggipfel der gegen Süden und Südwesten gelagerten Alpen, während der Fuß der Berge und die Täler noch vom nächtlichen Grau umschleiert sind. Plötzlich hebt sich die Sonne empor über die östlichen Berge, ihre Häupter mit Licht überflutend; jetzt glänzen die Firsten silberhell, das Dunkel in der Tiefe verschwindet, und eine unermeßlich weite Welt liegt ausgebreitet vor dem erstaunten Blicke. Vor allem stellt sich das Alpengebirge in seiner Großartigkeit dar; von den steierischen, Salzburger und Tiroler Alpen gleitet das Auge über die Bündner zu den Glarner und über die Alpen von Uri bis zu den Riesen des Berner Oberlandes, dem Finsteraarhorn, Schreckhorn und der Jungfrau – eine Strecke von mehr als hundert Stunden! Nun soll die Säntisspitze eine Anlage für Funkspruch erhalten, um die Alpenkette leichter zu überbrücken, die bisher den elektrischen Stoßwellen Widerstand geboten hatte.
Wenden wir nun das Auge nach anderen Richtungen, so sehen wir den tiefen Einschnitt des Rheintals bis Graubünden, das Tal der Ill, das wie eine dunkle Kluft aus dem Gebirge tritt, und den Spiegel des Bodensees, der die Breite eines Stromes zu haben scheint. Über die schwäbische Hochebene schauen wir bis an die Vulkanberge des Hegaus und die Rauhe Alb und westlich bis an die Berge des Schwarzwaldes und die nordöstlichen Ausläufer des Jura, und südlich erblicken wir noch etwas vom See bei Zürich. Aber wie klein erscheinen die Städte und Dörfer! Es kostet Mühe, die ferneren mit dem Fernrohr zu erkennen, und doch können wir es nicht lassen, von dieser hohen Warte aus nach Deutschland zu schauen. So vergehen Stunden wie Augenblicke; wir haben uns nicht satt gesehen, aber die Luft ist empfindlich kalt, es türmen sich Wolkenschichten um den Gipfel herum, und der Führer prophezeit Gewitter und Sturm, die oft in dieser Höhe toben, während in dem Tale unten kaum ein leichter Regen fällt. Rasch geht es abwärts; munter schreiten wir über das Schneefeld und den Gletscher, den nördlichsten der ganzen Alpenkette; es freut uns, die scheue Gemse fliehen zu sehen; denn diese schönen Tiere sind wieder zahlreich am Säntis, seitdem eine durch das Gesetz vor den sonst schonungslosen Jägern geschützte Herde hingewandert ist. Wir sind glücklich wieder in die Dörfer hinuntergelangt; unsere Seele ist von einem mächtigen Gefühle ergriffen, das dem ähnlich ist, welches wir empfinden, wenn wir Zeugen einer großen geschichtlichen Begebenheit geworden sind.
In den Außer-Rhoden ist die Bevölkerung so dicht, wie in wenigen Gebirgen Europas, das sächsische Erzgebirge ausgenommen, und der Reisende, welcher gewohnt ist, in den Berggegenden armselige Häuser mit armen Bewohnern zu treffen, staunt über die herrlichen Dörfer, durch welche ihn sein Weg führt: man trifft da Gebäude, welche einer großstädtischen Residenz wohl anständen. Tausende von Häusern liegen wie herumgesät an Berg und Bühel, auf Anhöhen und in Gründen, welcher Anblick jeden in Erstaunen setzt, der etwa auf dem Bodensee von Konstanz nach Friedrichshafen fährt. Alle Häuser, auch die kleinsten, sind zierlich gebaut, von vielen Fenstern freundlich glänzend, besonders auf der Mittagsseite. Das Dach ist nie so hoch, als man es in dem benachbarten Schwaben findet, die Tür groß, mit schöner Schwelle, messingener Klinke und mit Ölfarbe angestrichen; ein gewöhnlich mattgrün angestrichener SchindelschirmDie Häuser sind mit ganz kleinen Schindeln wie mit einem Schuppenpanzer umgeben. schützt gegen den scharfen Wind und gegen die Nässe, wenn Nordost und West Schnee und kalten Regen gegen die Wohnung schlagen. Fast vor jedem Hause ist ein laufender Brunnen mit klarem, kühlem Bergwasser; denn das ganze Ländchen ist außerordentlich quellenreich. Auch im Innern sind alle Häuser sauber und zierlich, die Stuben ausgetäfelt, die Geschirre blank. Und doch sind viele dieser netten Häuser und Hütten bloß aus Holz gebaut, wie in den Gebirgsgegenden überhaupt. Dort sind sie aber oft rauchig und rußig, in Außer-Rhoden schmuck, ich möchte fast sagen, so hübsch wie ein angemalter Vogelkäfig. Freilich flammen diese hölzernen Häuser bei Brandunglück wie Fackeln auf und sind dann selten mehr zu retten. – Auch die Menschen sind sauber und reinlich angezogen, und der Mann, welcher eine Kuh am Horne über die Gasse führt, läßt einen schneeweißen Hemdärmel sehen. Die Nahrung der Außer-Rhoder ist einfach. Das Frühstück besteht fast in jedem Hause aus Kaffee und gerösteten Kartoffeln, bei Wohlhabenderen wird noch Butter und Käse dazu gegeben; das Mittagsmahl bietet in guten Zeiten Fleisch- oder Mehlspeise, wobei Obstmost oder Wein nicht fehlen darf; am Abend aber kommt wieder Kaffee mit Kartoffeln, und in armen Häusern oder, wenn der Verdienst stockt, hat man tagaus tagein Kaffee mit Kartoffeln. Die Bäcker liefern ein schneeweißes Brot; denn die Appenzeller essen kein Roggen- oder gar Gersten- und Haferbrot; der schwäbische Bauer würde das Brot bewundern, aber schwerlich in die Länge seinem Schwarzbrote vorziehen, weil es etwas trocken und fade schmeckt, wenn man an Roggenbrot gewöhnt ist.
Die Nettigkeit der Häuser, die musterhafte Reinlichkeit, wohl auch die übrige Lebensweise erklären sich aus dem Umstande, daß die Außer-Rhoder zum nicht geringen Teil von ihrem Kunstfleiße leben; von 54 000 Einwohnern beschäftigt sich wenigstens ein Zehntel mit der Herstellung von Baumwollen- und Seidenwaren. Man webt Musseline in glatten Stücken zu Vorhängen und Halstüchern, verziert sie mit mannigfaltigen Stickereien aus weißer Baumwolle zu Vorhemdchen, Hauben, Röcken; oder aus gefärbter Baumwolle zu Schürzen, Turbanen, Tapeten, Chorhemden, Manschetten, Bettdecken, Tauftüchern, Schälen, Schleiern und Flor. Zu ähnlichen Stoffen wird die Stickerei auch gehöhlt, ausgebogt oder mit dem Plattstich verbunden. Es gibt Fabrikanten, die einige hundert Weber und mehrere hundert auswärtige Stickerinnen beschäftigen. Die besten Stickerinnen sind in Inner-Rhoden, und sie verdienen jährlich von den Fabrikanten Außer-Rhodens große Summen. Da kann man kunstreiche Finger sehen, die auf dem weißen Grunde Blumen entfalten, welche an Farbenschönheit und zarten Umrissen ihren lieblichen Schwestern auf Wiesen und Auen nichts nachzugeben streben. Jetzt hat aber die Maschinenstickerei bereits die Handarbeit sehr in Schatten gestellt. Man trifft in Außer-Rhoden nicht bloß große Fabriken, sondern es wird hauptsächlich familienweise gearbeitet, daher in jedem Hause ein Webkeller, Webgaden ist. Die Arbeiten der Appenzeller gehen in die ganze Welt, besonders aber »übers Meer«, wie die Stickerinnen sagen, wenn man sie fragt, wer denn die Musseline kaufe. Neuyorker Handelshäuser hatten zur Zeit meines Besuchs ihre Zweiggeschäfte in St. Gallen und machten in Stickereiwaren sehr bedeutende Geschäfte. Der Handelsverkehr dieses Erwerbszweiges beläuft sich jährlich auf 2½ bis 3¼ Millionen Mark.
Ich habe die schmucken Häuser mit Vogelkäfigen verglichen, auch ihre Bewohner geben den Vögeln an Sangeslust nichts nach. Da jodelt der Hirte, wie überall, wo Matten grünen; aber außerdem hört man wohl nirgends auf der Welt so schönen vierstimmigen Gesang in den Dörfern, und man kann Außer-Rhoden mit vollem Recht ein Sängerland nennen. Seine Chöre sind daher auch bei allen Sängerfesten in Schwaben und der Schweiz, in Lindau und Ravensburg, in St. Gallen und Zürich willkommen, und bei Wettgesängen tragen sie stets einen Preis davon. Es gibt viele Familien, in denen nach vollbrachter Tagesarbeit abends Mann und Frau, Söhne und Töchter zusammensitzen und sich den Rest des Tages mit Gesang erheitern.
* * *
Das Hauptfest ist aber die Landsgemeinde, die immer regelmäßig, einmal in Hundswyl, einmal in Trogen, im Frühjahre abgehalten wird. Eine solche Landsgemeinde ist für den Fremden sehr anziehend, und wäre in Frankreich, England und Nordamerika ein Außer-Rhoden, so würde man in Deutschland viel mehr darüber lesen. Die Feier verläuft in folgender Weise: Schon am Samstagabend (denn es wird immer am Sonntag landsgemeindet) finden sich die ferner wohnenden Appenzeller in Trogen, Speicher und den umliegenden Ortschaften ein, wo sie bei Gastfreunden wohnen oder die Wirtshäuser füllen. Hier und dort läßt sich einer mit einem tüchtigen Jodler hören, zwischendrein knallen Schüsse, und die Buben lassen Frösche springen oder Petermännchen sprühen. Die ernsteren Männer sitzen beim Glase Wein zusammen und besprechen dies und das, das Gewerbe, den Verdienst und vor allem die Landsgemeinde. Jeder hat die gedruckte Denkschrift in der Hand, in welcher der Landrat die Gesetzesvorschläge, welche in der Landsgemeinde zur Entscheidung kommen sollen, vier Wochen vorher öffentlich vorgelegt hat. Man spricht bescheiden, wie es ehrbaren Männern geziemt, deren Stolz ihre Landsgemeinde ist, und wenn der Fremde Auskunft über diesen oder jenen Artikel verlangt, so wird sie bereitwillig und vollständig erteilt; nur hüte man sich, von der Landsgemeinde vornehm aburteilend oder spöttisch zu sprechen, wenn man nicht unwillkürlich das Feld räumen will. Hat man so dem Gespräche der einen oder der anderen Gesellschaft aufmerksam zugehört, so kann man den Gesetzesvorschlägen so ziemlich ihr Schicksal voraussagen; denn es werden keineswegs alle angenommen. Der Appenzeller will nicht gern etwas Neues und ist gegen die Herren, besonders gegen die »Studierten«, mißtrauisch; er fürchtet nämlich, daß am Ende so viele Gesetze gemacht würden, daß der gemeine Mann gar nicht mehr daraus klug werden könne und alle Einsicht darein verliere, so daß zuletzt die Beamten tun könnten, was ihnen gefiele. Darum wird bei den niederen Gerichten kein Rechtsanwalt geduldet, weil man von diesen Leuten nur Verwirrung in Recht und Gericht befürchtet.
Endlich wird es Sonntagmittag; von allen Seiten ziehen jauchzende Trupps heran; jeder ist mit einem Seitengewehr versehen; dieser hat einen Infanteriesäbel, jener einen Galanteriedegen, ein anderer einen Hirschfänger usw. Wenn es schönes Wetter ist, wird die Waffe über die Schulter gelegt und daran Jacke oder Rock getragen. Doch macht sich die neue Zeit auch darin bemerklich, daß dieser schlichte Aufzug mehr und mehr abkommt. Endlich ist alles auf dem schönen großen Platze in Trogen versammelt, wohl 8-10 000 Männer, vom achtzehnjährigen Jüngling bis zum Greise. Im Vordergrunde steht eine Bühne und auf ihr der Landammann im schwarzen Frack, einen aufgeschlagenen dreieckigen Hut auf dem Haupte, den Degen an der Seite; neben ihm steht der Landschreiber und der Landweibel, dieser im schwarz-weißen Waffenrocke,Auch die Trommler und Pfeifer tragen einen Frack, der auf der einen Seite weiß, auf der anderen Hälfte schwarz ist. kurzen schwarzen Hosen und weißen Strümpfen. Auf einer anderen Bühne seitwärts haben die anderen Landesobrigkeiten Platz genommen. Der Landammann eröffnet mit einer kurzen Rede die Landsgemeinde, und die Geschäfte nehmen ihren Anfang. Zuerst wird der neue regierende Landammann gewählt und auf die Bühne geführt; zwei Pfeifer und zwei Hellebardiere begleiten ihn; jene spielen einen alten Marsch auf ihren Pfeifen, die mit silbernen Denkmünzen behangen sind, ein Geschenk des jeweiligen Landammanns; diese machen langsam voranschreitend Platz durch die Menge. Eine gleiche Ehre widerfährt jedem Landrate, der auf die Bühne gerufen wird. Endlich werden die Gesetzesvorschläge der Denkschrift Abschnitt für Abschnitt vorgenommen; der Landweibel, das Sprachrohr des Landammanns, ruft: »Wem's wohlgefällt, daß – – (jetzt wird der betreffende Absatz wörtlich wiederholt) – der hebe die Hand auf!« Augenblicklich fliegen die rechten Hände in die Höhe, wie es scheint, fast alle. Das sind aber zarte, kleine, weiße Hände, denen man es ansieht, daß sie nur das Webschifflein oder den Baumwollfaden handhaben. Kämen da zufällig deutsche Bauernhände darunter, so würden diese sich ausnehmen wie aus knorrigen Eichen geschnitten. Doch es ist seit dem ersten »Mehr« (so heißt die Abstimmung durch die erhobene Rechte) kaum eine Minute vergangen, so ertönt es wieder von der Bühne herab: »Wem's aber nicht gefällt, – – – der hebe die Hand auf!« und zu unserem Erstaunen erheben sich mehr Hände als das erstemal, und der Vorschlag ist verworfen. Sind über einen und denselben Gegenstand mehrere Anträge vorgelegt, so wird einer nach dem anderen ins »Mehr« genommen, was gewöhnlich lange dauert, und oft damit endet, daß alle verworfen werden. Auch dem geübtesten Auge wird es oft schwer, zu entscheiden, für welchen Antrag das Mehr ergangen ist; dann ruft der Landammann zwei Landräte auf die Bühne und läßt noch einmal abmehren. Getrauen sich auch diese nicht, zu entscheiden, welches Mal das zahlreichere gewesen, so werden noch mehrere Räte gerufen, und die Hände müssen längere Zeit in der Höhe bleiben; wenn aber das Mehr immer noch nicht entschieden würde, müßte die Landsgemeinde in zwei Parteien auseinandertreten und Mann für Mann abgezählt werden, wie es vor einigen Jahren in Schwyz geschah, in Appenzell aber noch nicht vorgekommen ist. Nun könnte freilich dieser oder jener einwenden, die Herren auf der Bühne könnten leicht das Mehr als das überwiegende erklären, das ihnen gerade zusagte, denn wer will sie beaufsichtigen? Aber die Männer auf der Bühne haben einen Eid abgelegt, nach Gewissen und guter Treu zu sprechen. Verlöre das Volk sein Vertrauen zu den beeidigten Vorstehern, dann wäre es auch mit der ganzen Landsgemeinde vorbei.
Zuletzt werden auch noch die anderen Landesobrigkeiten aus den vorgeschlagenen Männern gewählt, und am Ende wird allen Anwesenden ein feierlicher Eid abgenommen; sie heben die Schwurfinger in die Höhe und geloben bei Gott, die Gesetze und Satzungen des Landes zu halten. Dann geht alles auseinander, die angenommenen Gesetzesvorschläge bilden fortan einen Teil des Landbuches, und noch lange Zeit nachher ist die Landsgemeinde das Gespräch der Männer.
Über den St. Gotthard. Reiseskizzen von A. W. Grube. Leipzig 1871. Der Vierwaldstätter See hat vor allen Alpenseen eine reiche Gliederung voraus, in welcher ihm nur der Luganer See, der auch in seinen malerischen Ufern mit ihm wetteifert, nahe kommt, ohne ihn zu erreichen. Diese Gliederung macht aus dem einen See sieben untereinander verschiedene, mit eigentümlichen Zügen begabte Seebecken. Nordnordwestlich die Luzerner, nordnordöstlich die Küßnachter Bucht; in der Mitte der Kreuztrichter und der Abschnitt zwischen der Zinne und den beiden Nasen – man könnte ihn die Weggiser Bucht nennen; südöstlich die Hergiswyler Bucht und – den Südfuß des Pilatus bespülend – die fast einen besonderen See bildende Alpnacher Bucht. Dann von Westen nach Osten gedehnt die Buochser Bucht, zwischen Gersau und Beckenried, und endlich ganz nach Süden umbiegend der Urner See, in dessen Tiefe das Reußbett plötzlich abfällt. Da darf man es den alten Schriftstellern wie den alten Anwohnern nicht verdenken, wenn sie, bevor die Eidgenossenschaft der vier Waldstätte: Uri, Schwyz und der beiden Unterwalden sich gebildet hatte, diesen See den »großen« (lacus magnus) nannten und den Namen noch lange neben dem neueren des Vierwaldstätter Sees beibehielten.
Der See erscheint seiner vielen Buchten wegen viel größer, als er ist, und man erstaunt, wenn man erfährt, daß er im ganzen nur 96 qkm messe. Indem man die Linie von Luzern nach Brunnen als den Stamm und die Alpnacher und Küßnachter Bucht als die beiden Arme betrachtet, gewinnt man die Figur eines etwas verschobenen Kreuzes, dessen Mitte der bekannte »Trichter« ist, der die überraschendsten und mannigfaltigsten Ausblicke gewährt. Am Bürgenstein, dem Südrande der Bucht von Weggis, ist die bedeutendste Tiefe des Sees von 320 m; der Urner See hat nur eine Tiefe von 240 m.
Eine Hauptachse wie beim Bodensee, Genfer, Thuner oder Brienzer See läßt sich beim Vierwaldstätter und Luganer See nicht ziehen; die Luzerner und Küßnachter Bucht, der Buochser und Urner See stoßen fast unter rechten Winkeln zusammen, so daß eigentlich verschiedene Becken einer Seengruppe verbunden sind zu einem See. Auch der Lowerzer, der Zuger, der Sarner See gehören dieser Gruppe zu.
Eine Fahrt vom Ausfluß der Reuß bis zur Einmündung ist wunderbar wechselvoll und stetig fesselnder. Denn ehe man sich's versieht, hat man die anfänglichen Ufer verloren, neue gewonnen und damit neue Durchblicke und Fernblicke erhalten. Aber auch die Eindrücke steigern sich, werden immer großartiger und überwältigender. In der milden, freundlichen Luzerner Bucht glauben wir uns noch halb in der Ebene, die Bergwelt steht noch in einer gewissen ehrfurchtgebietenden Ferne wie eine zusammengedrängte Masse vor uns. Wir nähern uns dem Kreuztrichter, und nach allen Seiten hin dehnt sich, groß und frei, der Wasserspiegel, die Berge engen ihn nicht ein, sie bilden nur seinen reich geschmückten Kranz. Wir steuern gegen Weggis weiter nach Vitznau und sehen dort in steil ansteigenden Windungen, die an tiefer Kluft kühn den Weg gesucht und gefunden haben, die Eisenbahn zur Rigihöhe aufsteigen. Mehr und mehr empfinden wir die Wucht der Felswände auf beiden Seiten; der See verengt sich zur Breite eines Stromes, wir durchfahren ein Felstor (zwischen den beiden »Nasen«), steuern wieder in ein großes, aber von allen Seiten umschlossenes Becken und schauen auf Beckenried und die herrlichen Bergspitzen des Stollens und Oberen Bauens (1960 m), deren rechte Flanke die üppig grüne Musenalp bildet.
Das Schiff wendet sich nach Südwest nach dem Unterwaldner Dorf Buochs, bei welchem die Engelberger AaĀā, Ā. ahd. aha = lat. aqua, Wasser, vgl. Ache, Salz-ach, Eis-ack. mündet. Wir schauen in die Talweite nach Stanz hinauf, der Hauptstadt des Halbkantons Nidwalden; dann geht's wieder am grünen Fuße des Buochser Horns östlich nach dem sonnigen Beckenried und wieder nordöstlich quer über den See auf Gersau zu. Hoch oben blickt über die steilen Felswände des Rigiabhangs das Gasthaus von Rigi-Scheidegg herab auf das schmucke Kirchlein, das auf dem äußersten Uferrande steht und von den Wellen des Sees umspült wird. Einen neuen Blick werfen wir nach rechts in das Muottatal, auf die rote Fluh, die Überschiebungsreste des großen und kleinen Mythen, von denen Schillers Berglied singt:
Zwei Zinken ragen ins Blaue der Luft,
Hoch über der Menschen Geschlechter.
Die nackten kahlen Spitzsäulen stellen ein malerisches Gegenbild dar zum Ufer von Beckenried, auf das wir, von Gersau weiterfahrend, noch einen Rückblick werfen. Es ist, als tönte von dort her Alphornklang, um uns auf die grünen Gehänge, auf die mattenreichen hohen Gipfel zu locken, während die Schwyzer Haken und Spitzen uns wie drohend zurückschrecken.
Wir fahren an der kleinen Kindlismord-Kapelle vorbei, wo nach einer Sage ein Spielmann sein Kind, das nach Brot schrie, an dem Felsen zerschmettert haben soll; – abermals verengt sich der See zu einem schmalen Durchgange. An der »Treib« tritt der Seelisberg mit einer Landspitze vor, gerade der Muottamündung gegenüber. Wir blicken tief in dies nach Norden hin sich öffnende Tal, das uns mit einem ganz neuen und eigentümlichen Bilde überrascht. Am Fuße der kahlen Mythenstöcke liegt mit seinen weithin zerstreuten weißgetünchten Häusern der Hauptort des Kantons Schwyz, welcher der ganzen Eidgenossenschaft den Namen gegeben.
Brunnen ist der Hafen von Schwyz, wie Flüelen der Hafenort von Uri. Das Tal, in das die weit von Osten herkommende Muotta einmündet, ist alter Seeboden; es biegt bei Seewen nach Westen um zum Lowerzer See und weiter über Goldau nach Arth zum Becken des Zuger Sees.
Die Gotthardbahn schlägt diesen Talweg ein, der die Rigigruppe im Nordosten umzieht; es ist der Landweg, der von Brunnen nach Küßnacht führt. Diesen Weg läßt die Sage auch Geßler ziehen und ihm vorauseilend Wilhelm Tell.
Es lag warme Luft auf See und Tal und warmes Sonnenlicht auf den nackten Felshöhen, so daß sie einen rötlichen Anflug des Lebens gewannen, und dennoch erschien mir die Bergeinfassung streng und ernst. Der Blick konnte bis auf die aus dem Muottatal aufsteigende Höhe des Pragelpasses und auf die Silberen, grauweiße öde Karrenfelder, die im Sonnenlicht wie weißer Firnschnee glänzten, hinüberschweifen. Aber schnell war die Fernsicht verschwunden, eine kleine Wendung des Schiffes, und zwischen der steil abfallenden Bergwand des Axenberges und den nicht minder schroff absteigenden Stufen des Seelisberges streckte sich in majestätischer Ruhe und erhabener Schönheit der fjordartige Urner See.
Wohl strahlte ein sonniger blauer Himmel herab auf dieses grüne Gewässer, dessen heller Spiegel nur durch einen leisen Windhauch gekräuselt wurde, und dessen Wassermasse in der mächtigen Felsenumarmung fest und sicher zu ruhen schien. Aber eben diese Bergriesen, die seine Ufer bilden, treten so nahe, so trotzig heran, als wollten sie dem Nachen jedes Anlanden, dem Menschen jede Ansiedelung wehren; sie steigen so senkrecht herab, daß der Blick unwillkürlich an diesen schroffen Uferwänden auch hinab zur Tiefe gleitet und man eine Ahnung gewinnt von dem furchtbaren Anblick, wenn der Sturm diese Tiefe aufwühlt. Wie uns auf hohen Alpengipfeln schwindelt und ein unwiderstehlicher Zug in die Tiefe erfaßt, so ziehen uns die Geister der Wassertiefe hinab, wenn wir ihnen von oben zuschauen und ihrem Reize uns überlassen.
Mit wunderbarer Naturtreue hat uns Schiller im Eingange zum Tell ebenso den verlockenden, sinnumstrickenden Reiz der Seenixe gemalt – »es lächelt der See, er ladet zum Bade« – wie den heranziehenden Sturm, den schrecklichen Zorn und das fürchterliche Wüten desselben Sees. Ruodi, der Fischer, spricht zu seinem Buben:
Mach hurtig, Jenni! Zieh die Naue ein!
Der graue Talvogt kommt, dumpf brüllt der Firn,
Der Mythenstein zieht seine Haube an,
Und kalt her bläst es aus dem Wetterloch;
Der Sturm, ich mein', wird da sein, eh' wir's denken.
Der »graue Talvogt« ist der Föhn, der vom Gotthard durch das Reußtal hinunterstürmt, der mit grauem Höhenrauch Fels und Tal überzieht, den Flanken der Berge lange Wolkenschwerter anhängt und dann mit Herrscherwillkür Tannen entwurzelt, Alpenhütten umstürzt, auf den Hochalpen Lawinen rollt und unten auf dem See das Schifflein in das Wogengetümmel jagt und in die Tiefe stürzt.
Eine Schiffersage vom Kreuztrichter berichtet, daß, wenn der Föhn im Anzuge sei, mitten auf dem Spiegel des Sees ein schwarzer Nachen erscheine; darin stehe eine weißgekleidete totenbleiche Jungfrau und winke nach allen Seiten den noch auf der Fahrt befindlichen Nauen. In die Felsspalte des Urner Sees wirft er sich zuerst –
Wehe dem Fahrzeug, das dann unterwegs,
In dieser furchtbar'n Wiege wird gewiegt!
Hier ist das Steuer unnütz und der Steurer,
Der Sturm ist Meister, Wind und Welle spielen
Ball mit dem Menschen. – Wenn der Sturm
In dieser Wasserkluft sich erst verfangen,
Dann rast er um sich mit des Raubtiers Angst,
Das an des Gitters Eisenstäbe schlägt!
Die Pforte sucht er heulend sich vergebens:
Denn ringsum schränken ihn die Felsen ein,
Die himmelhoch den engen Paß vermauern.
Weil Wind und Wetter den See für größere Heeresbewegungen oft unsicher machen, hat man 1863 und 1864 am schroffen Abhange des Fron-Alpstockes und des Axenbergs hin eine Straße angelegt, die von Brunnen bis Flüelen geht und wie der Seearm eine Länge von 2¾ Stunden hat. Ich hatte das Dampfschiff verlassen, um sie zu Fuß zu durchwandern. Schon war es 5 Uhr nachmittags; ich konnte in Brunnen nicht lange verweilen, ging schnell an dem alten Susthause vorüber, an dessen Giebelwand etwas grell, daher weithin sichtbar, zwei Bilder al fresco gemalt sind: Die drei ersten Eidgenossen, ihre Hände zum Schwur erhebend – zum Andenken an den 19. Dezember 1315, an welchem Tage die Urkantone, nachdem sie in der Schlacht am Morgarten glücklich für ihre Freiheit gestritten, den Bundesschwur erneuerten. Das andere Bild stellt zwei schwedische Männer, Swen und Swito, dar, die nach alter Überlieferung, die freilich nicht volle Glaubwürdigkeit hat, aus ihrem nordischen Vaterlande bis an den Vierwaldstätter See gezogen und die Ansiedlung von Schwyz begründet haben sollen. (Vergl. die Rede Stauffachers in Schillers Wilhelm Tell, II, Rütli-Szene.)
In Aegidius Tschudis helvetischer Chronik ist S. 276 ff. die Brunner Urkunde zu lesen, und es heißt am Schluß:
»Und durch das, daß die vorgeschriebene Sicherheit, und die Gedinge ewig und stäte beliben, so hant wir die Vorgenannten Landt-Lüte und Eidgenossen von Uri, von Schwiez und von Unterwalden unsere Sigele gehenckt an disen Brief, der ward geben zu Brunnen, da man zalt von Gottes Geburte drüzechen hundert Jar, und darnach in dem fünffzehenden Jare, am nächsten Zinstagg nach Sant Niclaus-Tag.
Sigillum Communitatis Vallis Uraniae.
Sigillum Universitatis in Swites.
Sigillum Universitatis Hominum de Stannes,
Vallis superioris & inferioris.Ob und nid dem Walde.
Wenige Bündnisse und Eidgelöbnisse haben so gut und so lange sich bewährt wie dieses! Nachdem die Kämpfe gegen Angriffe von außen nachließen, hat es nicht an Reibungen der Kantone untereinander, selbst nicht an Bürgerkriegen gefehlt. Und die Schwyzer, welche die Fahne der Freiheit im Kampfe gegen das Haus Habsburg so mannhaft vorantrugen, sind später oft genug selber Störenfriede geworden – »die Landlüte von Schwiez« wurden recht vornehm und entwickelten sich zu einem eigensinnig stolzen, bevorrechteten Stand. Noch bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts waren unter den 38 000 Seelen, welche das Schwyzer Volk zählte, kaum 15-16 000 staatsbürgerlich frei; diese nannten sich die »gefreiten Landleute«, ihre Wohnsitze hießen das »abgefreite Land«; die Insassen hingegen, die man kastenartig auf gewisse Gewerbe beschränkte und von den Staatsämtern ausschloß, hießen die »neuen Landleute«, waren und blieben Neulinge, mochten sie auch mehrere Jahrhunderte schon im Kanton ansässig sein. Erst als im Jahre 1798 die Franzosen ins Land brachen und man ohne Hilfe der »neuen Landleute« ihnen keinen Widerstand leisten konnte, beschloß die Landsgemeinde, daß sie fortan auch als »gefreite Landleute« angesehen werden sollten.
Mit dem Sturze Napoleons erhoben auch die Alteingesessenen in Schwyz wieder ihr Haupt und wollten die Rechte der »sechs äußeren Bezirke« nicht anerkennen; sie widersetzten sich, als im Jahre 1830 die Verfassung aller Schweizer Kantone im freiheitlichen Sinne verbessert wurde und brachten im Jahre 1833 sogar 600 Mann auf die Beine, die einen Angriff auf die »äußeren Bezirke« machten. Da schickte die Tagsatzung eine Truppenmacht von 10 000 Mann ins Land, und die »Herren-Landtlüte« fügten sich. Doch wie in Luzern, so gewannen auch in Schwyz die Jesuiten wieder die Oberhand, bis auch hier Waffengewalt der freiheitlichen Kantone den sonderbündlerischen Geist des Rückschrittes dämpfte. Und schließlich ist aus all den Wirren und Kämpfen eine neue Schweiz erstanden, gesund und tüchtig in ihrem staatlichen, kirchlichen, gesellschaftlichen und gewerblichen Leben – ein Freistaat, der die Einheit des Ganzen mit der Freiheit der Einzelnen zu verbinden wußte. In der neuen Bundesverfassung ist die Eigenherrlichkeit der einzelnen Kantone zum Besten aller beschränkt; der Heeresdienst, das Zoll-, Post, Münz-, Maß- und Gewichtswesen ist einheitlich geordnet, das Recht der freien Niederlassung unter gesetzlichen Formen gewährleistet, jeder Schweizer Bürger gleichberechtigt und sein Anteil an der Wahl des Bundesrats, der die höchste vollziehende Gewalt, und des Bundesgerichts, das die höchste richterliche Gewalt ausübt, gesichert.
Der Schweizer Bund wäre längst zerrissen, ein Tummelplatz für die Ränke der Nachbarn, eine Beute der großen Heermächte geworden wie der polnische Freistaat, wenn sich der Einzelwille nicht immer wieder dem Gesamtwillen gefügt und das Gefühl der Zusammengehörigkeit nicht alle Sondergelüste überwunden hätte. Die alte schweizerische Sitteneinfalt und urväterische Einfachheit ist längst dahin, doch der vaterländische Geist der alten Eidgenossen ist von ihren Nachkommen nicht gewichen, darum hat sich ihr Staatswesen behauptet, darum wird es von den Nachbarn geachtet, darum durften auch die Urkantone mit gutem Gewissen und mit edelster Begeisterung die hundertjährige Gedächtnisfeier unseres großen deutschen Dichters Friedrich Schiller begehen, der in seinem »Tell« die Heldentaten ihrer Vater gefeiert, den echten, lauteren Freiheitssinn der Schweizer verherrlicht und sein unsterbliches Freiheitslied allen Völkern ins Herz gesungen hat, die gleich den Eidgenossen nach Freiheit streben, nach einer Freiheit, die auf Recht und Sitte beruht, die durch Einheit Stärke gibt und dem einzelnen die Unabhängigkeit seines Vorwärtsstrebens sichert.
Drüben am Eingang des Urner Sees, Brunnen gegenüber und in gleicher Linie der Mythenstöcke, ragt hart am Ufer eine einzeln stehende, etwa 25 m hohe Felssäule empor. Daran steht in großen vergoldeten Lettern aus Gußeisen die einfache, weithin sichtbare und lesbare Inschrift: »Dem Sänger Tells, F. Schiller, die Urkantone 1859.« Schöner und sinniger ist wohl noch keinem Dichter ein Denkmal errichtet worden, als es hier geschehen! Aber kein Dichter ist auch so wie Schiller ein Dichter des Volkes im höchsten Sinne des Wortes, ein Lehrer, ein Priester und ein Seher gewesen, für alles, was in deutscher Zunge spricht.
Ich ging raschen Schrittes zur Axenstraße hinauf, die, nicht hoch über dem See, in die Felswand der Wasiflue hineingesägt ist. Auch hier, wie ich's früher an den Abhängen des Rigi bemerkte, finden sich Blöcke in Menge, die einst von den Granithöhen des St. Gotthard durch den Gletscherzug herabgeschleift worden sind. Gern hätte ich mir noch das auf grünsaftigen Wiesen zwischen üppigen Nußbäumen versteckte Dörfchen Morschach näher angesehen und lieber noch wäre ich zum Axenstein, dem neuen schloßartigen Kurhaus aufgestiegen, von dessen Vorbau der Blick auf beide Seearme, den Urner und Buochser See bis zum Pilatus hin und in Vorblick links auf den Uri-Rotstock und Blackenstock von überwältigender Schönheit sein soll. Aber wenn ich noch vor dem Dunkelwerden in Flüelen eintreffen und unterwegs zur Tellplatte hinabsteigen wollte, durfte ich nicht säumen. War doch der Uri-Rotstock auch von der Axenstraße gesehen eine landschaftlich so herrliche Erscheinung, daß vor diesem König des Urner Sees selbst das Bild des Pilatus, der den Vierwaldstätter See bis Brunnen beherrscht, in den Hintergrund trat. Schon auf meiner Rigifahrt hatte ich diesen Uri-Rotstock lieb gewonnen und den Blick auf ihn für den schönsten Genuß der Rigiaussicht erklärt. Obwohl er nicht die Höhe der Häupter des Berner Oberlandes erreicht (2710 m), so ist er durch seine zusammengeballte, gewaltige, scharf aufsteigende Masse, durch die vielen Zacken seiner Krone, zwischen denen in schön geschwungener Wellenlinie ein großes Becken für die Schnee- und Gletscherfelder, die auf seinem Haupte ruhen, sich eingebogen hat, einer der schönsten Berge, die ich kenne.
Leider umlagerten nach dieser Seite hin Wolken die Gipfel, und der Blick senkte sich nun um so öfter nach unten zur Wiege der schweizerischen Freiheit, dem Rütli oder Grütli,Verkleinerungsform von Rüti, Reute; das G ist nur eine Verstärkung des Anlautes. der grünen Wiese, die wie eine kleine Oase am unwirtlichen steilen Ufergelände erscheint, heimlich und anheimelnd. Sie schaut nach Brunnen und den Schwyzer Bergen hinüber und am selben Ufergelände, in das sie sich einbuchtet, auf den Mythenstein, der als ihr Wächter und Schildknappe am Eingange des Sees steht. Es ist die geweihte Stätte, auf der nach der Sage in der Nacht vom 7. zum 8. November 1307 Walther Fürst aus Attinghausen in Uri, Werner Stauffacher aus Steinen in Schwyz und Arnold ab der Halden aus dem Melchtal in Unterwalden mit dreißig Gesinnungsgenossen den Bundesschwur leisteten, dem Schiller so markige und eindringliche Gestalt gegeben hat:
Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,
In keiner Not uns trennen und Gefahr. –
Wir wollen frei sein, wie die Väter waren,
Eher den Tod! als in der Knechtschaft leben. –
Wir wollen trauen auf den höchsten Gott,
Und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.
(Teil II, 2.)
Drei Quellen rieseln aus der Bundeswiese hervor – nach der zartsinnigen, bedeutende Stätten heiligenden Sage dort, wo die drei Eidgenossen standen. Im Jahre 1859 veranstaltete die schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft eine Sammlung bei der gesamten Schweizerjugend, welche reichlich und wetteifernd beisteuerte, so daß die Bundeswiese als unveräußerliches Volkseigentum angekauft werden konnte.
Von A. W. Grube.Ein neues Wunder ist der Welt beschieden,
Ein Friedenswerk im Schweizer Alpenland,
Es tönt der Wagen mit dem Feuerbrand
Im Gotthard, einend, was bis jetzt geschieden!
Müller v. d. Werra.
Der Vierwaldstätter See mit seinem Ufergebiet hat nun, da der riesige Granitwall durchbohrt ist, der die deutsche Schweiz von der welschen Schweiz und von Italien trennt, verdoppelte Anziehung erhalten, aber auch, anstatt für viele das Endziel zu sein für eine Schweizerreise, sich in eine Durchgangsstraße verwandelt, deren Endpunkte in Mailand und Florenz, am Adriameer und am Busen von Genua liegen. Nordsee und Mittelmeer, Deutschland und Italien sind sich um ein Vielfaches näher gerückt. Die rauhe Jahreszeit wird nicht mehr wie früher den Güterverkehr hemmen, und selbst für den Personenzug werden die Jahreszeiten nicht mehr so scharf bezeichnete Scheidungslinien bilden. Der Strom der Vergnügungsreisenden, die von den Ufern des herrlichen Sees zu den herrlichen Bergen des Berner Oberlandes eilten, brach sich gleichsam an den nördlichen Abhängen der Hauptalpenkette; es kostete den meisten zu viel Mühe, Zeit und Geld, um die über den Kamm des Hochgebirges führenden Straßen zu überschreiten, die italienische Schweiz und weiter die Gefilde der Lombardei zu besuchen. Lawinen und Schneestürme im Winter und Frühling, Glatteis im Herbst, und oft schon im September Schneewehen und rasende Stürme machten die Reise über den Gotthardpaß nicht nur für den Fußgänger, sondern auch für den im Postwagen und Schlitten wohlverpackten Fahrgast zu einem gefährlichen Unternehmen. Wie ein reißender Fluß oder ein stürmisches Meer mit Felsenriffen, wie die wasserlose heiße Sandwüste forderte der St. Gotthard alljährlich seine Opfer an Tier- und Menschenleben. Die gefährlichsten Stellen des Passes waren und sind die Felsenschlucht der Schöllinen, die bis zu der merkwürdigen Stelle hinaufzieht, wo die Reuß aus dem Urserental durch einen schmalen Felsspalt hervorbricht und die alte und neue Teufelsbrücke über das wild aufschäumende, in die Tiefe hinabstürzende Gewässer sich wölben; ferner der steile Aufstieg von Hospental an der Roduntaly vorüber zur Paßhöhe, ein Tummelplatz für die »Guxete«, jene schrecklichen Schneestürme, die bei Nordwind an der Südseite, bei Südwind an der Nordseite des Paßsattels am heftigsten toben und die feinen Eis- und Schneekristalle in einen so unwiderstehlichen Wirbeltanz versetzen, daß Menschen und Tieren Hören und Sehen vergeht; und drittens die vom jungen Tessinfluß durchrauschte Felsenge. Der steile Absturz vom Gotthardhospiz nach der Südseite des Gebirges ist zwar durch kühn übereinandergemauerte »Kehren« und Schlangenwindungen überwunden, dann aber kommt ein Engpaß, der von beiden Seiten durch Lawinenstürze bedroht ist, die von den steilen Felshängen herabdonnern und die Straße verschütten. Das ist das schon in seinem Namen abschreckende Val tremola (Tal des Zitterns), vom deutschen Schweizer auch »Trümmelntal« genannt.
Von Flüelen, dem Anfangspunkt der Gotthardstraße, bis nach Göschenen hinauf fährt man noch bequem genug; dann aber beginnen die wilden Berggeister Menschen und Tieren ihre Schwäche fühlbar zu machen. Wenn alles gut ging, brauchte der wohlbespannte Eilwagen von Göschenen bis nach Airolo, dem ersten Halt am Südabhange des Gebirges 5-6 Stunden; jetzt fliegt die Lokomotive in 30-35 Minuten durch den schwülen Tunnel. Während oben in den Talschluchten und auf den Felsenhöhen eisige Stürme toben und meterhohe Schneemauern auf der Poststraße den Weg sperren, schließt der in gerader Linie tief unten dahineilende Insasse des Dampfwagens behaglich die Augen, um von der Sonne Italiens, von den Myrten- und Lorbeerbüschen am blauen Langensee zu träumen. Wie tanzende Irrlichter huschen die brennenden Lampen an ihm vorüber, das feuchte Steingewölbe, an das die Rauchmassen der Lokomotive anrennen wie gefangene Bestien an die Gitterstäbe ihres Käfigs, glitzert unheimlich, und der Gedanke an die furchtbare Möglichkeit, daß ein Stein aus der Wölbung sich lösen und den ganzen Zug verschütten könnte, beengt die schwerer atmende Brust. Doch schon dringt in das blinzelnde Auge ein tröstliches Dämmerlicht, ein lichter Punkt zeigt sich in der Ferne, rückt näher und wird größer, eine kleine Biegung, und die Ätherwellen des holden Himmelslichtes umfangen den Reisenden und füllen sein Herz mit neuer Hoffnung und frischem Reisemut.
Der Bahnhof von Airolo, an der Südmündung des Riesentunnels, etwas höher als die Pforte von Göschenen gelegen (1145 m über dem Meeresspiegel – Göschenen 1109 m), ist erreicht, und nun geht es mit dem talabwärts zum Langensee eilenden Tessin um die Wette und seine Schnelligkeit weit überholend durch das enge, aber reizende Livinental (Val Leventina) mit seinen malerischen Felswänden, grünen Matten und wilden Sturzbächen, über kühne Felsgalerien und Dämme, durch zahlreiche kleinere Tunnel nach Bellinzona, wo die Bahn sich teilt und sich einerseits zum Langensee (Magadino, Luino mit Zweigbahn nach Locarno), andererseits zum Luganer See wendet.
Die ebenso großartige als reizende und liebliche italienische Schweiz ist nun dem Vierwaldstätter See, diesem Kern der deutschen Urkantone, so nahe gerückt, daß selbst zur Winterszeit, wenn auf der Nordseite rauhe Nord- oder Ostwinde über die schneebedeckten Fluren stürmen, Vergnügungsfahrten an die oberitalienischen Seen unternommen werden können; man hat Sonderzüge nach den borromäischen Inseln und Belaggio mit Rück- und Rundreisekarten eingelegt, und mancher Brustkranke, der die Fahrt über den Alpenpaß nicht wagen durfte, kann nun vorzugsweise zur Winterszeit der milden Luft Italiens sich erfreuen. Ein italienischer Rigi, der Monte Generoso, läßt von seinen Felskuppen die große Alpenkette nordwärts in einem von Montblanc bis zum Ortler ausgespannten Bogen überschauen, während zu den Füßen die Spiegel der oberitalienischen Seen erglänzen und südwärts das »Maienland« der Vorfahren, die lombardische Ebene – die fruchtbare, aber auch blutgetränkte – sich dehnt.
Jahrhundertelang sind auf der ganzen Gotthardlinie blutige Kämpfe ausgefochten worden. Noch an der Scheide des vorigen Jahrhunderts tobte hier der Kampf zwischen Russen und Österreichern einerseits und Franzosen andererseits, die um den Besitz des Passes rangen. Vor vier Jahrhunderten stürmten, um die ins Livinental vordringenden Herzöge von Mailand zurückzuschlagen, die kampflustigen Bauern aus Uri und Unterwalden und Schwyz über den rauhen Gotthardpaß, ließen aber auch die befreiten Tessiner hart genug die Obmacht der sieghaften Eidgenossen empfinden, und erst durch die französische Revolution und Napoleon ward der Kanton Tessin seinen früheren Herren ebenbürtig. Jetzt, da ein einiges Italien erstanden ist, zieht es die italienischen Schweizer wieder südwärts. Das Opfer aber, das die deutschen Kantone durch Erbauung der Gotthardbahn brachten, ward nicht zum kleinsten Teile bestimmt durch die Hoffnung, daß die Eisenschiene ein neues festes Band werden möge zwischen deutscher und welscher Schweiz, wie sie ja auch die beiden Großmächte, Italien und Deutschland, die durch die politische Einigung im Dreibunde näher zusammengeführt wurden, durch den friedlichen Handelsverkehr fester verbindet.
Freilich trägt die Eisenschiene ebenso willig die Kanone wie den Güterwagen. Dennoch aber hilft sie mächtig dazu, daß, wie die räumlichen Entfernungen schwinden, so auch die Völker sich kennen lernen und lieber freundlich als feindlich miteinander verkehren.
Nicht unbesonnen und zwecklos haben Italien und das Deutsche Reich ihre Millionen beigesteuert, ohne welche die Gotthardbahn nimmer zustande gekommen wäre. Lag es in ihren politischen Absichten, eine von Frankreich und Österreich völlig unabhängige Linie zu gewinnen, so sprechen nicht minder gewichtige gewerbliche und Handelsgründe zugunsten der durch die Mitte der Schweiz und die Hauptkette der Alpen führenden Gotthardbahn, welche die Häfen der Nordsee, die gewerblichen Rheinprovinzen, Baden und Württemberg in jenen großen Strom des Handelsverkehrs faßte, der über Basel und Zürich in die lombardische Tiefebene, nach Mailand und nach Genua, dem größten italienischen Mittelmeerhafen, führt. Hätte man statt des Gotthard den Lukmanier gewählt und durch diesen den Durchbruch bewerkstelligt, so hätten wohl die Ostschweiz, namentlich das gewerb-fleißige St. Gallen und das weniger bedeutende Chur, auf deutschem Boden Augsburg und Ulm gewonnen; aber die Rheinlinie ist recht eigentlich die des Gotthard. Sie umfaßt im Norden nicht nur Holland und Belgien, Bremen und Hamburg, durchzieht dann nicht bloß die Rheinlande, die großen Handelsplätze: Köln, Frankfurt, Mainz, Mannheim berührend, sondern sie stößt auch in der Schweiz auf die bedeutendsten Plätze: Basel, Bern, Zürich, sodann Schaffhausen, Winterthur, Luzern, und schließlich hat sie auch Genua in den Stand gesetzt, den Wettkampf mit Marseille zu bestehen.
Merkwürdig und doch wieder aus der günstigen Mittelstellung der Gotthardeinsattelung leicht erklärlich: kein Paß hat wie der St. Gotthard den Zugang der Menschen von Norden wie von Süden her so erschwert, und keiner hat es schließlich allen seinen Mitbewerbern so zuvorgetan. Die Römer mögen ihn immerhin gekannt und unter den leeren Namen »Adula«, und »lepontische Berge« diese Region bezeichnet haben; doch sie benutzten ihn nicht, weil der Auf- und Abstieg zu viel Schwierigkeiten bot. Ihnen dienten der Julier und der Splügen als Übergänge zum Rheintal, nach Vindelizien und in die nördliche Schweiz; und über diese Pässe ging auch im Mittelalter eine vielbesuchte Heerstraße. Nach Germanien zogen die Römer über den Brenner, und diese wenig hohe, von Lawinen nicht gefährdete Brennerstraße bildete auch im Mittelalter die große Verbindungslinie zwischen Venedig und den deutschen Reichsstädten. Daß aber während des Mittelalters auch der Gotthard nicht unbekannt und unbenutzt war und schon von den Langobarden zu Einfällen nach Italien benutzt wurde, dafür scheint der bei Hospental nahe der Reuß auf einem Hügel erbaute Turm zu sprechen, gleichwie auf der Südseite unterhalb Airolo am Engpaß von Stalvedro Ruinen eines langobardischen Marmorturmes, casa dei pagani (Heidenhaus) genannt, stehen, welche die freilich ganz unverbürgte Sage auf den König Desiderius (774) zurückführt.
Die alte Gotthardstraße war sehr holpricht und blieb es auch, als man, nachdem sich der Bund der vier Waldstätte zum Bunde der acht alten Orte (1353) erweitert hatte, einen 3–5 m breiten Saumpfad anlegte, der an vielen Stellen gepflastert ward. Die Warenballen und Fässer wurden auf starkknochige, eigens dazu geübte Packpferde oder auch Maultiere geladen, über deren Rücken ein langer hölzerner Sattel gelegt war, auf dessen beiden Seiten man das Gepäck im Gleichgewicht aufhing (Vergl. S. 216). So poetisch ein solcher hoch im Nebel der Wolken daherkommender Zug von Saumrossen, die mit ihrem Geläut die erhabene Stille des Hochgebirgs belebten, den von ferne zuschauenden Reisenden berühren mochte: so war doch das Leben der Säumer wüst und roh. In stetem Kampf mit den Hindernissen und Gefahren, die ihnen eine übermächtige Natur entgegensetzte, wurden sie unwirsch und jähzornig, gewöhnten sich ans Fluchen und an den Trunk und brachten ihr Leben selten hoch. Bei günstigstem Wetter brauchten sie, um von Flüelen nach Bellinzona zu gelangen, vier Tage! Doch gehörte der Gotthardpaß zu den besuchtesten, und am Ende des 18. Jahrhunderts und zu Anfang des 19. zogen alljährlich etwa 16 000 Reisende und Amtspersonen über den Gotthard und 9000 Saumtiere. Die Zolleinnahmen Uris auf seinen drei Zollstätten betrugen durchschnittlich im Jahr 20 000 Gulden.
Das 19. Jahrhundert brachte aber auch für die Alpenübergänge eine neue Zeit. Das Genie und der starke Wille Napoleons schuf neue Kunststraßen in den Alpen, wenn auch nur zu kriegerischen Zwecken. Die prächtige, im Jahre 1801 begonnene, 1806 vollendete Simplonstraße machte den Anfang; dann folgten die zu breiten Straßen ausgebauten Linien über den Splügen und Bernhardin (1818 und 1819); unter Kaiser Franz von Österreich ward 1822 die sichere und bequeme Straße über das hohe Stilfserjoch gebaut zur Verbindung Tirols mit der Lombardei. Da sank schnell der Handelsverkehr der Gotthardlinie und nötigte die Kantone Uri und Tessin, mit dem Bau einer breiteren, auch von den schwersten Frachtwagen sicher zu befahrenden Kunststraße nicht länger zu zögern. In den Jahren 1820–24 und 1828–30 ward das große Werk vollendet, ein ehrendes Denkmal für die Tatkraft und Opferwilligkeit der wenig bemittelten Bürger Uris; denn die 19 großenteils armen Gemeinden des Bergländchens hatten die Summe von 1 260 000 Franken aufzubringen.
Im Jahre 1830 spannte man, 32 m über den Sturzwellen der aus dem Urserental hervorbrechenden Reuß, den kühnen Brückenbogen ob der alten »Teufelsbrücke«, welche bereits dem staunenden Volke so wunderbar erschienen war, daß sie nur mit Satans Hilfe fertig geworden sein konnte. Die neue Teufelsbrücke erhielt einen bequemen Zugang durch die an der Felswand aufgemauerten Rampen. Wenige Schritte aufwärts gelangt man an jenen Spalt zwischen Kilchberg und Teufelsberg, durch den die Reuß ein Ausfalltor gewonnen hat. Da am senkrecht abstürzenden Felsen keine Straße hergestellt werden konnte, hing man in Ketten einen Balkenweg über den Strom, die »stäubende Brücke« genannt, weil sie der Wasserstaub des Reußfalles immer naß erhielt. Aber noch mehr! Um festen Boden für den Durchgang zu gewinnen, hatten die Bewohner des Urserentals durch den ausgezeichneten Straßenbaumeister Peter Moretini im Jahre 1707, als anderwärts noch niemand an solche Felstunnels für Straßenanlagen gedacht hatte, den Kilchberg in einer Länge von 66 m durchbohrt. Dies ist das berühmte »Urner Loch«, die Eingangspforte aus der wilden Schlucht der Schöllinen in das grüne obere Urserental mit dem Hauptorte Andermatt.
Dieses Felstor wurde nun auf 6 m Breite erweitert. Ähnliche kühne Bauten wurden auch am Südabfall des Passes in den Felsschluchten des Tessinflusses ausgeführt und erregten die Bewunderung der Reisenden, deren Zahl sich schnell wieder hob, so daß die Gotthardstraße es im Verkehr am weitesten brachte. Im Jahre 1874 überschritten etwa 72 000 Postreisende den Gotthard. Am Fuße des Berges, in Andermatt, unterhielt die Posthalterei 150 Pferde. Oftmals wurden 50 Pferde zu einer einzigen Post benutzt. Die Warenballen mußten aber fast 9 Monate im Jahr auf Schlitten verteilt werden, und wenn diese nicht mehr fahren konnten, ward die Post von Menschen befördert, die Gefahr liefen, in den Schneemassen umzukommen.
Doch das Kulturleben schreitet mit Siebenmeilenstiefeln! In demselben Jahr 1830, als die obere Teufelsbrücke am Gotthardpaß vollendet ward, befuhr Georg Stephenson mit der von ihm erfundenen Lokomotive die Eisenbahn von Liverpool nach Manchester; bald, nachdem Fürth-Nürnberg und Leipzig-Dresden den Anfang gemacht, hatte die Eisenschiene in den Ebenen Deutschlands, Österreichs und selbst der Schweiz den Sieg über die Kunststraße (Chaussee) davongetragen, und je leichter man die Steigungen und Senkungen des Hügellandes überwand, desto näher trat der Gedanke, es auch mit Alpenbahnen zu versuchen. Österreich machte den Anfang im Ostflügel der Alpen mit der Überschienung des Semmerings (975 m) an der Grenze der Steiermark, im Jahr 1853, deren kunstvoller Bau noch bei weitem durch die Brennerbahn in Tirol übertroffen wurde (1367 m). Sie ward am 24. August 1867 eröffnet. Aber die Pässe der Mittelalpen und Westalpen steigen viel höher auf – die Paßhöhe des Gotthard beträgt 2114 m –, und an eine Überschienung konnte wegen der Schneemassen im Winter, der höheren Kämme und steileren Abstürze nach Süden nicht gedacht werden. Mit kleineren Tunnels war da nicht mehr zu helfen; an die Stelle des Überfahrens (Überschienens) mußte das Unterfahren treten. Es galt den Gebirgskamm selber zu durchbohren und vor der Sprengung eines meilenlangen Riesentunnels nicht zurückzuschrecken. In den Westalpen Savoyens ward zuerst das Wagnis unternommen und glücklich ausgeführt. In der Christnacht des Jahres 1870 sank die letzte Scheidewand des Mont-Cenis-Tunnels, der im Jahre 1857 im September an beiden Enden mit Handarbeit begonnen, dann aber durch Bohrmaschinen gefördert, nach 13 Jahren und 3 Monaten zur Vollendung kam. Seine Länge beträgt 12 200 m, die Breite 8 m, die Höhe 6 m; er ist fast ganz ausgemauert. In 25 Minuten fährt die Lokomotive ihre Wagenzüge hindurch.
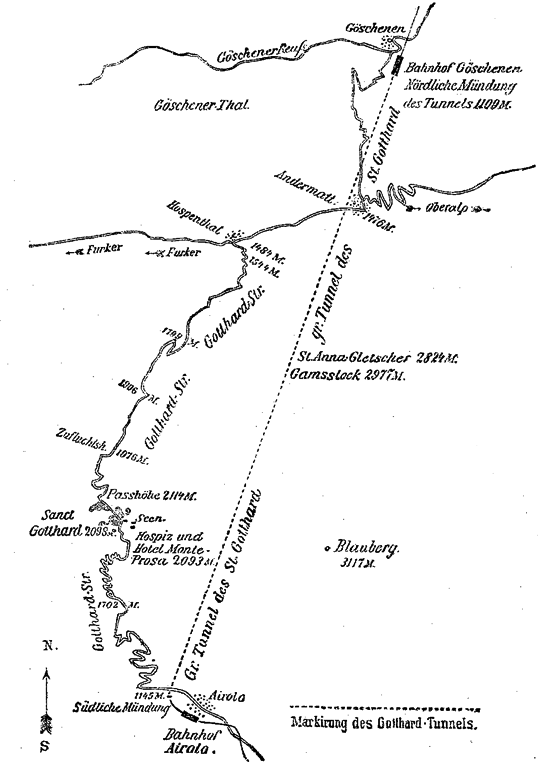
Der St. Gotthard-Tunnel.
Die reichen technischen Erfahrungen, die man bei diesem Wunderbau gesammelt, sollten einem größeren Unternehmen zustatten kommen. Sobald Deutschland den Krieg mit Frankreich glücklich beendet und Italien auch mit Österreich Frieden geschlossen hatte, ward der längst gehegte, reiflich erwogene, zwischen den drei Staaten Schweiz, Italien und Deutschland vereinbarte Plan einer Gotthard-Eisenbahn zur Ausführung gebracht. Das Hauptstück dieser Bahn, von dessen Vollendung Sein oder Nichtsein des ganzen Baues abhing, ward 1872 in Angriff genommen; in Airolo begannen die Bohrarbeiten am 1. Juli, in Göschenen schon am 4. Juni und trotz erheblicher Störungen durch Wasserzudrang und ein lockeres Gesteinsfeld in der Mitte des Tunnels, durch den Ausstand der italienischen Arbeiter in Göschenen (27. und 28. Juli 1875), wobei das Urner Militär einschreiten mußte, sodann durch den Brand von Airolo (17. September 1877) – konnte schon am Schalttage des Jahres 1880 der Telegraph aller Welt die frohe Botschaft verkünden, der Durchstich sei gelungen; die Richtstollen von Airolo und die von Göschenen trafen sich am 29. Februar, mit einer seitlichen Abweichung von nicht ganz 20 cm, während die Abweichung der Sohle nicht einmal 10 cm betrug, nach einer Arbeitszeit von 7 Jahren und 5 Monaten, also fast der Hälfte der Zeit, welche der Cenistunnel gekostet hatte. Und doch übertraf der Gotthardtunnel diesen um 2700 m; denn er hat 14 920 m Länge.
Täglich waren an dem Bau 3412 Arbeiter beschäftigt gewesen; die Handbohrung betrug für den Tag 0,65 m, die Maschinenbohrung dagegen auf italienischer Seite 2,05 m, auf schweizerischer Seite 2,56 m.
»Die für die Beschleunigung der Arbeit wirksamsten Gründe – so äußert sich ein gewiegter Physiker und Techniker, der sich um die Verbesserung der Bohr- und Lüftungsanlagen die größten Verdienste erworben, Prof. D. Colladon in Genf – waren die außerordentlich glückliche Verbindung der Eindämmung der Wildbäche und der Ausbeutung des in Wasserleitungen gesammelten Wassers als Bewegungskraft für die Turbinen, welche sehr hohen Fall benützten; die Herstellung von Luftverdichtern nach einer neuen Bauart, die mit großer Schnelligkeit arbeiteten; die Erkältung der Luft, die im Augenblick, wo sich diese durch Zusammenpressung in den Zylindern erhitzte, mittels Einspritzung zerstäubten Wassers erzielt wurde; die Anwendung des Dynamits als Sprengstoff; die zahlreichen und höchst wichtigen Verbesserungen an den Bohrmaschinen und ihren Gestellen; der von Anfang an vom geschickten Unternehmer L. de Favre aus Genf festgehaltene Entschluß, die Richtstollen in der First vorwärts zu treiben, sein gesunder Menschenverstand, seine hohe Einsicht, Erfahrung und unerschütterliche Tatkraft – das waren die wesentlichen Grundlagen, welche gestatteten, die Arbeiten im Tunnel des Gotthard mit einer Schnelligkeit vorwärts zu treiben, welche diejenige im Mont Cenis um mehr als das Doppelte übertraf.«
Der tüchtige Favre sollte die Vollendung seines Werks leider nicht erleben, er starb wie ein Krieger auf dem Schlachtfelde, mitten in seiner Arbeit im Tunnel, am 19. Juli 1879, vom Schlage getroffen. Noch manches Menschenleben mußte den Mächten der Tiefe geopfert werden; bleich und abgezehrt kehrte mancher Arbeiter aus der Tiefe zurück, der frisch und munter sein heißes Werk begonnen hatte. Die Ausdünstungen von Menschen und Tieren, die Sprenggase des Dynamits, die nach der Mitte des Tunnels sich derart steigernde Hitze, daß den fast nackten Menschen der Schweiß vom Leibe rann, konnten in ihrem verderblichen Einfluß auf die Gesundheit nur mühsam durch stete Luftzufuhr mittels der Verdichtungszylinder gemildert werden.
Noch bevor der Tunnel völlig ausgebaut war, beförderte man schon die Post auf seinen Eisenschienen. Die erste Postfahrt ward am 21. Dezember 1880 versucht und glücklich ausgeführt. Sie dauerte freilich noch volle vier Stunden.
Menschliche Kunst und Wissenschaft, aber auch menschliche Tatkraft hatten da einen Sieg errungen, wie ihn weder Altertum noch Mittelalter jemals kannten. Schon der Aufriß eines solchen Tunnels, obwohl er nur aus ein paar geraden Linien auf einem Blatt Papier besteht, muß dem Nichteingeweihten wie ein Wunder erscheinen. Zwei Punkte auf entgegengesetzten Seiten eines Gebirgszugs werden festgelegt, nach ihrer Meerhöhe gemessen; dann einige wenige, weithin sichtbare Bergspitzen oder Felswände auserwählt, auf die man ein farbiges Fähnlein pflanzt, das als Augenpunkt dient. Mit Hilfe eines sehr einfachen Meßgeräts, des Theodoliten,Er besteht im wesentlichen aus einem Fernrohr, das um die Achse eines senkrecht gestellten Kreises gedreht werden kann, auf dem die Winkelgrade verzeichnet sind. werden einige Dreiecke verzeichnet, es wird die Grundlinie gezogen und das Pendel gefällt, und nun bestimmt man genau die Richtungslinie des Stollens nach ihrer Länge und ihrer wagerechten Hebung oder Senkung. Um von der geraden Richtung nicht abzuweichen und zugleich eine etwa nötige Biegung genau bestimmen zu können (vor Airolo geht der Tunnel in einer nach Osten abbiegenden Krümmung aus) – trieb man in Göschenen dem Tunneleingang gegenüber einen kleinen Stollen in den gegenüberliegenden Felsen. Indem man von dort aus vermittels des Theodoliten nach einem im Tunnel befindlichen Licht äugte, erhielt man eine Linie, deren Endpunkte im Drehpunkte des Theodoliten und im Lichte lagen. Tag für Tag mußten die Berechnungen und Vermessungen fortgesetzt werden, um die durch den Aufriß bestimmte Linie genau einzuhalten, nicht tiefer, nicht höher das Gestein abzusprengen, als der Riß vorschrieb. Von oben, dem Firststollen, ging man nach unten, zur Sohle des Tunnels und arbeitete ihn zur bestimmten Tunnelweite aus.
Die Bohrmaschinen, von zusammengepreßter Luft in Bewegung gesetzt, hieben mit ihren Stahlmeißeln so wuchtig in das harte Gestein wie ein Röhrenbohrer in den Tannenstamm. Das harte Urgestein des Gotthardstocks, bestehend aus Granit, Gneis, Glimmerschiefer, erwies sich für die Bohrung viel günstiger, als die weicheren Schichten. Die oben erwähnte »böse Stelle«, auf welche die Arbeiter Ende 1879 stießen, war glücklicherweise nur von geringer Mächtigkeit. Ihr Druck war anfangs so furchtbar, daß meterdicke Verbolzungen zermalmt wurden. Hie und da stürzten aus Felsspalten sich kreuzende Wasserstrahlen mit solcher Gewalt, daß sie die Arbeiter niederwarfen! Am Südhange fanden sich zerklüftete Glimmerschiefer mit Letteneinlagerungen, welchen das Wasser entströmte, so daß die Arbeiter oft knietief im Schlamm stehen und waten mußten und häufig erkrankten.
Die Zahl der Bohrlöcher, in welche die sprengende Dynamitpatrone gesteckt wurde, wird auf 320 000 berechnet, die der verbrauchten Bohrer auf 1 650 000 und des verbrauchten Dynamits auf 490 000 Kilogramm. 1 450 000 Wagen führten den Abraum zutage.
Die Baukosten des Riesentunnels belaufen sich auf 40 Millionen Mark; er hat also trotz seiner größeren Länge 25–30 v. H. weniger gekostet als der Tunnel des Mont Cenis. Wie dieser hat er ein Doppelgleis. Seine Auswölbung ward mit größter Sorgfalt ausgeführt; große Strecken sind mit keilförmigen Granitstücken gewölbt. In die Tunnelhöhle ist ein Kanal geschnitten, welcher etwa eindringende Wasser abzuleiten bestimmt ist.
In schnurgerader Linie zieht er von Göschenen bis nahe vor Airolo, wo er zum Bahnhof hin den kleinen südöstlichen Bogen macht. Diese Linie teilt sich in zwei Hälften, eine größere aufsteigende und eine etwas kleinere absteigende; nur der Scheitel hat eine kurze wagrechte Strecke von 180 m Länge. Er geht unter Andermatt, dem St. Annagletscher und Gemsstock (2977 m), der höchsten Erhebung über dem Tunnel, hindurch, läßt die Gotthardstraße rechts, den Blauberg links.
Die Straße über den Gotthard ist nun still geworden! Das Rollen des vollbesetzten Postwagens, der Peitschenknall des Frachtfuhrmanns, der Schellenklang der Saumrosse läßt sich selten mehr hören! Die Wirte von Andermatt, Hospental und vom Hotel Monteprosa am Hospiz oben müssen bitter genug die Schädigung empfinden, die der Tunnel tief unter ihnen verursacht. Das Hospiz selber, das Hunderten armer Arbeiter eine warme Suppe und ein Nachtlager bot,Vom 1. Oktober 1879 bis 1. Oktober 1880 wurden an 18 024 arme Reisende aus aller Herren Länder 70 395 Speisungen samt verschiedenen Kleidungsstücken unentgeltlich verabreicht. ist fast unnötig geworden.
Für die ganze 80 km lange Gotthardbahn, die sich von Flüelen am Vierwaldstätter See bis nach Biaska im Tessintal erstreckt, bildet der große Tunnel den Scheitel. An diese Bergbahn schließen sich die Anschlußbahnen, welche ihre Verbindung mit den Linien der Schweiz und Italiens herstellen. Sie eröffnen den Fahrenden die schönsten Landschaftsbilder. Auf der nördlichen Rampe berührt der Zug Arth und die reizenden Ufer des Zuger Sees, fährt über drei Brücken und durch zwei Tunnel nach Goldau, kreuzt das Trümmerfeld des Bergsturzes von 1806 und die Bergbahn Arth-Rigi, dampft im Anblick der beiden Mythen-Kegel am Lowerzer See vorbei über Schwyz nach Brunnen an den prächtigen Urner See, der ihm eine Bergumgebung eröffnet, wie sie in solcher Herrlichkeit nur einmal vorhanden ist. Mit Hilfe von 9 Tunnels und 4 Überführungen, bald über, bald unter der Axenstraße, gelangt er nach Flüelen in die Talsohle der Reuß. Im ganzen mußten außer dem Scheiteltunnel noch gebaut werden: 9 Überführungen, 48 Brücken, 8 Galerien (die längste von 275 m bei Biaska), 7 Kehr- oder Schraubentunnels (der längste von 1557 m bei Fiesso) und 52 geradlinige Tunnels, darunter 6 von mehr als 1000 m Länge. Anfang August 1883 war auch das zweite Schienengleis fertiggestellt, und es kreuzten sich fortan täglich 6 Züge, darunter die Mittagsschnellzüge, innerhalb des Tunnels.
Die Bahnüberwachung im Gotthardtunnel geschieht in der Weise, daß zweimal vormittags und zweimal nachmittags mit Abgang des betreffenden Bahnzuges je ein Tunnelwärter die Bahnhöfe Göschenen und Airolo verläßt, den Tunnel bis zur Mitte begeht und nach ein- bis zweistündigem Aufenthalt den Rückweg antritt. Zu einer solchen Begehung hin und zurück braucht der Wärter ungefähr acht Stunden. Jeder Tunnelwärter ist mit einer ledernen Umhängetasche, mit Knallsignalbüchse, Handhammer, Bolzenschlüssel, Handsignal, Laterne und Kontrollbuch ausgerüstet.
Quelle: von Berlepsch, Die Alpen. Jena 1885. H. Costenoble. »Ein Ruffi ist gegangen im Glarner Land, und eine ganze Seite vom Glärnisch eingesunken« – diese Worte aus dem »Tell« sind bezeichnend für die Alpenwelt. Erdrutsche und Bergstürze ereignen sich dort nur allzu oft und zerstören die Talkultur des Menschen. Am 2. September 1806 vernichtete ein gewaltiger Bergsturz die Ortschaften Goldau, Rötten, Busingen und Lowerz im Kanton Schwyz binnen wenigen Minuten. Der seit alters über diese Dörfer emporragende Roßberg, scheinbar für die Ewigkeit gegründet, begrub sie unter seinem Schutte. Schon 1804 und 1805 hatte es in jener Gegend nicht an Regentagen gefehlt, doch die gewaltigsten Regenmassen in wolkenbruchartiger Form brachte der Hochsommer und besonders der endende August und 1. September 1806.
In tiefe Schwermut versunken erschien die zu reich getränkte Pflanzenwelt, während die Rollsteine wie blank gewaschen dalagen und die Bergwasser in willkürlich gegrabenen Rinnen hinabpolterten, Steinschutt und Ackerschicht mit sich hinabführend. Die Gipfel der Bergriesen waren unsichtbar, Wolken hüllten sie ein wie Schleier. Trübe war die Stimmung der ganzen Natur in Goldau am Vormittag des 2. September, als der Regen plötzlich aufhörte.
Schon am Morgen bemerkten Leute am östlichen Teile des Roßbergs frische, weitklaffende Risse im Erdreich, hörten zuweilen ein Knattern wie von Kleingewehrfeuer und sahen ununterbrochen NagelfluhFluh = Felsen. Nagelfluh, weil die Kalksteingerölle dieses Trümmergesteins aus dem gelblichen Sandsteinkitt wie Nagelköpfe heraustreten. an einer gewissen Stelle herabstürzen. Doch das waren Erscheinungen, die man auch sonst nach heftigen Regengüssen beobachtet hatte und die den Bergbewohner nicht schrecken konnten. Doch jene Erscheinungen nahmen Stunde für Stunde an Heftigkeit zu. Als am Nachmittage die Kirchenuhr in Arth 4¾ geschlagen hatte, öffnete sich plötzlich in der Mitte des Roßberges eine große Erdspalte, welche zusehends weiter aufgähnte. Der Rasenboden in der Nähe des Spaltes schob sich zusammen und kehrte die schwarze Unterseite zu oberst. Die herrlichen Tannen schlugen mit den Wipfeln gegeneinander, und die darin nistenden Vögel suchten ängstlich auffliegend das Weite. Bald setzte sich der betreffende Teil des Berges in langsame Bewegung nach unten. »In immer gesteigerter Geschwindigkeit nahm die angsterweckende Erscheinung zu; in immer weiteren Kreisen, in immer ausgedehnterem Umfange wurden angrenzende Matten und Wiesengelände, Obstbaumgärten und Wohnstätten samt Stallungen, Menschen und Vieh mit in die ungeheuerliche Bewegung hineingezogen. Das Volk, welches den Grund und Boden, auf dem es geboren und groß geworden war, unter seinen Füßen weichen sah, schreckte entsetzt auf und flüchtete. Da – Donner und Knall! als ob die Grundfesten der Erdrinde geborsten wären, ein rasselnd schmetterndes Krachen, ein knatterndes Geprassel, als ob ein tausendzackiges Blitzbündel aus den verderbendrohenden Wolken auf einen Schlag vernichtend in die Grundpfeiler der Berge hineingefahren wäre und das Innerste der Gebirge zersprengt und zertrümmert hätte. Die Steinbergerfluh, eine Felsenmasse von mehreren Millionen Kubikklaftern samt allem daraufstehenden Hochwald und die darunter stufenförmig sich niedersenkende Nagelfluhwand des ›Gemeinde-Märcht‹ waren eingestürzt. In wilder Auflösung jagten Felsenblöcke und Steinsplitter, Erdschlamm und Rasenfetzen, Gesträuchknäuel und Baumschäfte, alles in bald hochaufwirbelnde, bald fallende Staubwolken gehüllt, über die Berghalde dem Goldauer Tale zu.«
Besinnungraubend wirkte das schrecklich erhabene Schauspiel, in welchem häuserhohe Felsblöcke, welche noch den ursprünglich daraufstehenden Hochwald trugen, wie Federbälle durch die Luft flogen, andere dahinschossen, den Boden berührten, und durch den Prall abermals in die Höhe geschleudert wurden, andere wiederum mit Riesenkraft aneinanderschlugen und in Atome zerschellten. Sämtliche Wohnhäuser am Gehänge des Roßberges, wohl hundert an der Zahl mit ebensoviel Ställen und Scheunen, waren im Nu von der Erde hinweggefegt; doch auch am Fuße des Berges wurden großartige Zerstörungen angerichtet, indem die Dörfer Goldau, Busingen und Lowerz von den herabrasenden Felsblöcken, Stämmen, Schutt und Schlamm verschüttet wurden. Der Verlust der Habe wäre zu verschmerzen gewesen, wenn nicht 457 Menschenleben bei dem Ereignis zugrunde gegangen wären.
Doch die Chronik weilt lieber bei denen, die in dem Greuel der Verwüstung wie durch ein Wunder gerettet wurden. Oben am Berge wohnte Bläsi Mettler im einfachen Häuschen mit seinem jungen Weibe und einem erst vier Wochen alten Kinde. Er war auf dem Berge beschäftigt und meinte, als das Ereignis losbrach, in seiner abergläubischen Einfalt, daß der Hexensabbat beginne. In fliegender Eile stürzt er zum hochwürdigen Pfarrer von Arth, ihn zu bitten, daß er den bösen Geistern ihr Handwerk lege. Erst als der dem Krachen der Weltachse ähnliche Knall ertönte, deutete er die Vorzeichen recht und jagte, gepeitscht von wahnsinniger Angst, seiner Wohnung zu. Sein Weib hatte unterdessen die gewöhnlichen Tagesgeschäfte besorgt und eben den Abendbrei für das Kleine ans Feuer gesetzt, als der entsetzliche Donner erfolgte. Sie eilt vom Küchenherd in die Stube, entschlossen, wenn das Kleine schlafe, es nicht zu wecken, sondern bei ihm zu bleiben; doch siehe, es liegt ruhig da mit klaren, geöffneten Augen. Sie rafft das Kind auf, erfaßt ihres Mannes kleine Barschaft und eilt dem Stalle zu, gejagt von der Angst in ihrem Busen. Am Stallgebäude wendet sie das Antlitz, um zu sehen, wie ihr Wohnhaus in tausend Trümmer geht und in der allgemeinen Verwirrung mit Blitzesschnelle enteilt. Bläsi Mettler war seinem Gott dankbar, wenigstens seine Lieben wiederzufinden.
Etwas weiter unten am Berge wohnte Mettlers Bruder Bastian, der sich mit dem Vieh zur Zeit des Unglücks auf der Alp am Rigi befand, während sein Weib mit zwei Kindern daheim war. Kaum war der höllische Lärm zu Ende, als sich die Eltern und Geschwister der Frau aufmachten, nach ihr zu sehen. Weggefegt von der Erde war ihr Wohnhaus, von ihr und den Kindern keine Spur! Doch nach langem Suchen, weitab vom vorigen Standort des Hauses fand man in dicker Schlammmasse, die mit gewaltigen Steinblöcken untermengt war, ein Unterbett und sanft darauf ruhend das jüngste Kind. Sein Engel hatte es auf den Händen getragen, daß es in jenem Augenblicke, wo Steine, Balken, Äste nur so herniederhagelten, auf seinem Polster ruhend, gerettet worden war. Die Mutter freilich und das andere Kind suchte man vergebens.
Wunderbar entging auch ein Teil der Familie des wohlhabenden Bauern Wiget, der am Fuße des Berges in Busingen wohnte, dem Tode. Er war mit seinen zwei Knaben im Garten mit dem Auflesen des Fallobstes beschäftigt, als das Unglück begann. Er faßte seine beiden Knaben bei der Hand, rief seinem Weibe zu, ihm mit den jüngeren Kindern zu folgen, und eilte nach einer Anhöhe. Die Mutter, welche ein Kindchen von 11 Monaten nicht im Stich lassen wollte, sprang in die Stube, traf hier mit der treuen Magd Franziska zusammen, übergab dieser ihr fünfjähriges Marianneli, während sie selbst die beiden jüngsten an die Brust legte, und sie wollten eben dem Vater nachstürzen, als sie plötzlich in Finsternis gehüllt dastanden, ihr Haus zusammenstürzte und sie sich mit fortgerissen fühlten. Sie waren sofort getrennt. Eine Zeitlang behielt Franziska die Besinnung; dann wußte sie nicht, was mit ihr geschah. Als sie erwachte, war sie bis zum Kinn von Trümmern und Schlamm umhüllt. Sie lauschte in ihrem Gefängnisse auf einen menschlichen Laut, doch Totenstille! Sie meinte, der Weltuntergang sei da und sie selbst im Innersten der Erde. Doch horch! Plötzlich ertönt die Betglocke vom Steinerberge, ein ihr wohlbekannter Ton. Und langsam dämmert in ihr die Ahnung von ihrem grausigen Schicksale. Gleichzeitig vernimmt sie auch das Wimmern eines Kindes und erkennt an der Stimme ihr herziges Marianneli, das über Hunger und Schmerz im Unterleibe klagt. Obgleich der Gedanke des Lebendigbegrabenseins immer gewisser in ihr aufsteigt, tröstet sie doch das Kind, bis dies endlich still, ganz still wurde. »Es hat ausgelitten,« meint sie. Dunkler sinken draußen die Schatten nieder, vom Steinerberge ertönt jetzt die späte Nachtglocke. Unsere Verschüttete arbeitet mit den Füßen, um sich nur einigermaßen Luft, Bewegung, Wärme zu schaffen und durchwacht in quälender Angst die lange, unendlich lange Nacht. Kaum graut der Morgen, da erneuert sich ihre Hoffnung, zumal auch ihr kleiner Liebling sich wieder rührt, wenn auch wieder mit denselben Seufzern über Hunger und Kälte. Der Vater Wiget ist beim ersten Tagesgrauen schon bei der Arbeit des Suchens; wohl findet er in der Nähe seines ehemaligen stattlichen Hofes sein treues Weib mit den Kleinen an der Brust, aber tot, zerquetscht. Seine Brust macht sich in herzzerreißenden Schreien Luft; Franziska hört sie, sie schreit um Hilfe, und – Gott hat Erbarmen – sie wird gehört, wird mit dem Kinde gerettet. – Wie viele der Verschütteten damals zerschmettert und zerquetscht, wie viele lebendig begraben in unsäglicher Pein dem Hungertode erlagen, wer will das erzählen?
Unter Benutzung eines Aufsatzes von Edmund Zölliker, Dresdner Anzeiger, 18. Juli 1903. Wer das Bild von Moritz von Schwind gesehen hat: die Jungfrau – »wie sie als ewig reine Herrscherin der Berge aus Firnen und Gletschern über die Schatten der Tale hoch aufwächst; nicht einmal der Adler überwindet ihre Unnahbarkeit, nur mit der scheidenden Himmelskönigin tauscht sie, den Wolkenschleier um sich schlagend, keusch den schwesterlich grüßenden Kuß« – der kann die Gewalt des Natureindrucks mitempfinden, den »die Königin hoch und klar auf unvergänglichem Throne« auf ein schönheitsempfängliches Herz macht:
»Die Stirn umkränzt sie sich wunderbar
Mit diamantener Krone;
Drauf schießt die Sonne die Pfeile von Licht,
Sie vergolden sie nur und erwärmen sie nicht.«
(Schiller, Berglied.)
Doch die Unnahbarkeit des stolzen Berges im Berner Oberland ist durch das Geschick der Ingenieure der größten Zugänglichkeit gewichen, die trotzig gehütete Wunderwelt der spröden Hochgebirgsnatur ist durch die Jungfraubahn jedem erschlossen, der den naturgemäß hohen Fahrpreis erlegen kann; nicht bloß dem kühnen Kletterer, der mit Seil und Eispickel in angestrengtester Arbeit sich den Gipfel eroberte, entfaltet die Jungfrau die Herrlichkeit ihrer Reize, sondern mit Hilfe der modernen Technik dem genußsüchtigen Weltenbummler ebenso wie dem Lahmen und Kränklichen, für den sonst all die Firn- und Felspracht in ihrer starren Wucht unerreichbar war.
Woher kommt der Name des majestätischen Berges in den Berner Alpen? Dichter haben ihn in Zusammenhang bringen wollen mit der Unberührtheit vom groben Tritt des Bergbezwingers. Aber der Alpinismus ist über diese dichterische Wortdeutung längst nagelschuhbeschwert und pickelbewehrt hinweggeschritten. Nun hat ein ortsgeschichtlicher Rückblick von H. HartmannIn den Blättern für Bernische Geschichte. Kunst und Altertumsgeschichte. August 1910. wohl endgültig die Herkunft des Bergnamens festgelegt. Die Jungfrau ist der Jungfrauenberg, der Berg der Jungfrauen, nicht der Jungfrau. Der bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gewöhnlich gebrauchte Name war Jungfrauenhorn; erst seit etwa hundert Jahren ist, wohl vor allem unter dem Einfluß von Schillers Wilhelm Tell, die Einzahl Jungfrau allgemein durchgedrungen. Die volle Lösung des Rätsels bieten die alten Urbare des während der Reformation von der Bernischen Regierung aufgehobenen Augustinerinnenklosters zu Interlaken. Aus demselben erfahren wir, daß das Nonnenkloster am Fuße der Jungfrau mehrere »Berge«, sogenannte Kuhberge, besaß, die den Namen Jungfrauenberg führten. Was liegt nun näher, als daß die Eisspitze, an die diese Alpen anstießen, den Namen »Jungfrauenhorn« erhielt, um so mehr, als es an sich schon viel wahrscheinlicher ist, daß die Alpenbewohner zuerst den Weiden und dann erst den ihnen recht gleichgültigen unfruchtbaren Bergspitzen einen Namen gaben. Daß die Herkunft des Namens so rasch in Vergessenheit geriet, hing damit zusammen, daß die Bernische Regierung in dem nicht gerade mit Freuden protestantisch gewordenen Oberland jede Erinnerung an die katholische Zeit auslöschen wollte. Wie der Name »Kloster Interlaken« amtlich abgeschafft und durch »Spital« ersetzt wurde, so erhielten auch die nun in Staatsbesitz übergegangenen »Jungfrauenberge« in den Landvogteirodeln die Bezeichnung Hochberg. Das Volk hielt freilich trotzdem an dem alten Namen fest, und wie es heute noch vom Kloster redet, so sprach es auch weiter von dem Jungfrauenhorn, was dann Anlaß zu falschen Erklärungen gab.
In Interlaken, dem Sammelpunkte der Reichsten der Reichen aus Europa und Amerika, halten wir uns nicht lange unter den prächtigen Walnußbäumen des Höhenwegs auf, wo die Putzsucht und Genußsucht ihre Triumphe feiern. Die Bahn führt in die Täler der schwarzen Lütschine nach Grindelwald, der weißen nach Lauterbrunnen. In dies prächtige alte Gletschertal mit seiner kennzeichnenden U-form läßt uns Meister Thoma auf einem seiner herrlichsten Landschaftsbilder einen Blick tun. Da stürzt über die steile Fluh aus 300 m Höhe der Staubbach.
Strömt von der hohen,
Steilen Felswand
Der reine Strahl,
Dann stäubt er lieblich
In Wolkenwellen
Zum glatten Fels,
Und leicht empfangen
Wallt er verschleiernd,
Leisrauschend,
Zur Tiefe nieder.
Ragen Klippen
Dem Sturz entgegen,
Schäumt er unmutig,
Stufenweise,
Zum Abgrund.
Im flachen Bette
Schleicht er das Wiesental hin;
Und in dem glatten See
Weiden ihr Antlitz
Alle Gestirne«.
(Goethe in Thun 14. Okt. 1779.)
Eine Zahnradbahn mit nur 80 cm Spurweite nimmt heutzutage den Reisenden in Lauterbrunnen in einen ihrer kleinen Wagen auf, den ein wahres Pony von einer Lokomotive vor sich den Berg hinaufschiebt, und bringt ihn in halbstündiger Fahrt, während der sich der Ausblick auf die schneebedeckten Oberlandriesen immer prächtiger auftut, nach der Sommerfrische Wengen. Es liegt über die wiesengrüne Berglehne hingestreut auf halber Höhe zwischen Lauterbrunnen und Wengernalp und schaut gerade auf die Eispaläste der Jungfrau mit dem ihr vorgelagerten Silberhorn und dem düster aufragenden Schwarzen Mönch, auf Mittag-, Breit- und Tschingelhorn, deren Häupter alle den königlichen Hermelinschmuck ewigen Schnees tragen und in silberweißem Firnelicht strahlen. Tief unten liegt das Lauterbrunnental, und man sieht am Westhang die Drahtseilbahn zur Grütschalp hinaufklimmen und abends die Lichter von Mürren herüberschimmern, das mit einer elektrischen Bahn erreicht wird. Wengen bietet in etwa 20 großen Gasthäusern den zahlreichen Fremden Unterkunft und in seinen schönen Bergwäldern reichlich Erholung.
In 40 Minuten fährt die Zahnradbahn, je ein Wagen und eine Maschine, über Wengernalp zur kleinen Scheidegg. Die letzte Strecke aber sollte man lieber wandern. In ¾ Stunden führt der ansteigende Fußweg am Trümmletental entlang, das den Gletscherschutt von den himmelanragenden Wänden des Dreigestirns Jungfrau, Mönch, Eiger aufnimmt, über Alpenwiesen von unbeschreiblicher Farbenpracht der Blumen: da Veilchen von der Größe und Leuchtfarbe unserer Stiefmütterchen, hier die azurblauen Blütenkelche der Enziane zu Tausenden und Abertausenden im smaragdgrünen Grase.
Auf der Scheidegg ist an schönen Tagen ein Leben wie in einem Taubenschlag, unaufhörliches Kommen und Gehen von Ausflüglern; denn hier treffen sich die Bahnen von Lauterbrunnen und von Grindelwald herauf, und die Lawinen donnern um die Mittagszeit von den Hängen der Jungfrau zu Tale und machen den Hotelgästen, die hier in über 2000 m Höhe ihr Mahl einnehmen, eine eigenartige Tafelmusik. Infolge der großen Entfernungen erscheinen die jäh herabsausenden Schneelasten als sanft und sacht herabwallende Massen, und nur der Donner verkündet ihre vernichtende Gewalt.
Am kleinen Scheidegg nimmt in 2064 m Höhe die eigentliche Jungfraubahn ihren Anfang. Ihr Schöpfer, der Züricher Ingenieur Adolf Guyer-Zeller, hat sie als eine elektrische Bahn mit Oberleitung, Zahnstange und einer Spurweite von 1 m bei einer Höchststeigung von 25% entworfen. In sanften Windungen erreicht man so durch ewiges Schneegefilde die erste Station Eigergletscher mit ihren Sommer-Hörnerschlittenfahrten und ihrer 40 m langen Eisgrotte. Dann schlüpft die Bahn ganz in den Berg hinein, und nach 20 Minuten Dunkelfahrt über Station Rotstock in einem Tunnel von 4,35 m Höhe und 3,70 m Breite leuchtet in bunten Glühbirnen der Name »Eigerwand« auf. Wir verlassen den Zug und gelangen durch einen Seitenstollen in eine eingesprengte Felsgalerie, ähnlich der an der Axenstraße. Von dort aus 2868 m Höhe schweift der Blick durch die 5½ m breiten Felsenfenster in der Eigernordwand in die Hochalpenwelt bis zum Finsteraarhorn. In 3160 m Höhe ist die nächste Haltestelle »Eismeer«, bei 3240 m Höhe »Jungfraujoch« erschlossen worden, und »Jungfraukulm« wird bald folgen. Zuletzt soll ein 73 m langer Aufzug zum Gipfel mühelos emportragen. Die gebändigte Wasserkraft der reißenden Lütschine, die von den Schneegefilden des Jungfraugebietes herab durch das Lauterbrunnental rauscht, wird so als elektrische Kraft gezwungen, Tausende von Menschen zu ihren Quellspeichern hinaufzutragen.
Nach L. Vuillemin, Der Kanton Waadt. St. Gallen 1847. Westlich vom Gotthardknoten entspringt die Rhone dem Rhonegletscher und durchfließt zwischen den Berner und Walliser Alpen eins jener gewaltigen Längstäler der Alpen, in welchem sie an 80 Zuflüsse von beiden Seiten erhält: das Wallis (vallis = Tal). Hinter Martinach verläßt sie mit einer scharfen Wendung nach Norden das Wallis und zwängt sich durch ein riesiges Felsentor zwischen dem Dent de Morcles und dem Dent du Midi (= Südhorn) ins Waadtland hinein. Bald erweitert sich das Tal zu einer breiten Schotterebene, die schon südliche Kulturen zeigt: Weinfelder, Kastanien- und Maulbeerbaumhaine. Auf dem Talgehänge erscheinen zahlreiche Dörfer, darüber hängen dunkelblaue Wälder, noch höher die grünen Weiden mit ihren grauen Sennhütten. Die Rhone bildet hier die Grenze zwischen Waadt und Wallis. Das linke Ufer bleibt wallisisch – auch in der Großartigkeit seiner Bergwelt; das rechte Ufer erfreut durch seine Lieblichkeit. Hier hängt das Auge bald an einer auf der Halde erbauten Kapelle, bald schaut es in geheimnisvolle Täler und überall erfreut der Reichtum und die Farbenpracht der Natur. Es scheinen die Alpen einen Gefallen daran gefunden zu haben, dem majestätischen Strome ein würdiges Bett zu bereiten, und bei seiner Annäherung an den See schmücken sie sich vollends, gleichsam um seine Ankunft zu feiern, mit neuer Pracht und Größe. In zwei Arme geteilt, wälzt sich die Rhone durch die breiter gewordene Ebene fort und ergießt endlich ihre brausenden und schlammigen Fluten in den Leman,Der Waadtländer nennt mit einem gewissen Stolze den See, von dem er den größten Teil des Ufers besitzt, nicht Genfer See, sondern Leman – Lacus Lemanus der Römer, im Mittelalter Lac Losannette, Mer du Rhone (Rhone-Meer), jetzt Genfer See (Lac de Genève). der zurückweicht, als hätte er Furcht, daß bei diesem Zusammentreffen der tiefblaue Kristall seines Gewässers befleckt werden möchte. Er widersteht, und es kommt zwischen ihnen zum Kampf. Der schäumende Strom und der blaue See werden handgemein, und eilt der Nordwind dem Leman zu Hilfe, so fahren die Wellen empor und stürzen vorn und von der Seite auf den feindlichen Strom, setzen ihm hart zu und treiben ihn in die Enge. Man glaubt zwei kämpfenden Heeren zu begegnen; darum haben die Uferbewohner diesem Streite auch den Namen »la bataillère« beigelegt. Fährt ein Nachen über die wogende Fläche, so verspürt er an den heftigen Stößen den Zorn der Fluten. Noch eine Viertelstunde weit vom Ufer ist der Aufruhr fühlbar. Endlich ergibt sich der Strom in die Notwendigkeit, in das blaue Grab hinabzusteigen, aus dem er zwanzig Stunden weiter unten reiner und schöner wieder hervortritt.
Der See bespült den Fuß des Jura und der Alpen, das Savoyerland und den Schweizer-Kanton Waadt; sein heller Halbmond biegt sich von Genf nach Neustadt (Villeneuve). Von der geringen Breite bei Genf erweitert er sich zu der ansehnlichen von drei Stunden zwischen Evian und St. Sulpice. Die Längsachse des Sees ist 72, die Breitenachse 13,8 km; die Wassermasse hat einen Rauminhalt von 89 Kubikkilometern. Der Flächeninhalt beträgt 577 qkm, also 39 qkm mehr als der des Bodensees. Die Höhe des Leman über dem Meere beträgt 375 m.Der Bodensee liegt 398 m ü. d. Meere, die Längsachse beträgt 65 km, und an der tiefsten Stelle sind 252 m gemessen worden. Der Rauminhalt beträgt 47 Kubikkilometer. Die Tiefe des großen Sees, am Ufer noch unbedeutend, nimmt plötzlich zu. Bei Chillon beläuft sie sich auf 150 m; Meillerie gegenüber auf 240-270 m; nördlich von Evian auf 310 m. Der See bildet also eine große Wanne, die in ihrem von oben nach unten abnehmenden Umkreise bis auf 1½ Stunden sich verengt. Der Boden dieser Wanne liegt nicht viel höher als der Wasserspiegel des Meeres; er entspricht fast der Höhe der Rhone in der Nähe von Montelimar, derjenigen des Po unterhalb Pavia, der Seine oberhalb Paris und der Donau an der niedrigsten Stelle der ungarischen Ebene.
In der Eiszeit war der See nur ein Teil, ein Riesenblock des großen Rhonegletschers.
Die tiefsten Schichten des Sees haben eine Wärme von 4-5°C, doch ändert sich diese im Laufe eines Jahres um 0,1-0,3°; denn das Wasser der Rhone hat im Sommer 10-15°, das der Strandgegend 15-25°. Dieses Oberflächenwasser sinkt unter und führt diese Schwankungen herbei.Dr. F. A. Forel, Seenkunde, S. 123. Stuttgart 1901 (J. Engelhorn).. In den Jahren 762 und 805 soll der See zugefroren sein, welcher Fall seitdem nicht wieder vorgekommen ist.
Der Wasserstand des Sees schwankt auch von einer Jahreszeit zur andern, ja von einem Tag zum andern. Man hat berechnet, daß das Seebecken im Sommer infolge der Schneeschmelze mehr Wasser führt als im Winter wegen der Frostdürre. Die Zeit des höchsten Wasserstandes fällt gewöhnlich in die Mitte des August; jedoch tritt er auch im Juli und September ein. Der Zuwachs hängt fast ganz von der Rhone und vom Schmelzen des Schnee in den hohen Alpen ab. Abgesehen von diesen jährlich wiederkehrenden Veränderungen des Wasserstandes bemerkt man im Sommer bisweilen eine stehende Welle, eine rhythmische Schwingung der ganzen Wassermasse, die im Seebecken hin und wieder fährt. Von den Anwohnern des Genfer Sees wird diese Bewegung »seiches«, von denen des Bodensees »Ruhß« genannt. Der Spiegel des Sees erhebt sich langsam 30-40 Minuten zu einer veränderlichen Höhe von etlichen Zentimetern bis zu ebenso vielen Dezimetern, dann senkt er sich allmählich um den gleichen Betrag und diese Schwankungen dauern eine längere oder kürzere Zeit fort. Vom 26. März 1891 an fanden zum Beispiel in 7½ Tagen 147 Schwingungen von einer Periode von 73 Minuten statt. Die Höhe der Schwingungen ging von 20 cm auf 7 cm herab. Forel hat ähnliche Schwankungen in allen schweizerischen Seen nachgewiesen und die Ursache dieser schwingenden Bewegung der Wassermasse in örtlichen, einmal wirkenden Ursachen erkannt, besonders sprunghaften Änderungen des Luftdrucks. Die dadurch hervorgerufene Welle schreitet fort und zwar um so tiefgehender und schneller, je länger und tiefer der See ist.A. a. O. S. 79. Ferner zeigt der Genfer See Strömungen (ladières), die in ganz verschiedenen Richtungen gehen und mitunter so stark sind, daß die Ruder vergebens ihnen entgegenarbeiten. Sie werden sicher mit durch unterirdische Zuflüsse hervorgerufen, welche dem See einen Teil der Wassermasse zuführen, die er an seinem Ausfluß abgibt.
Unaufhörlich führt die Rhone Schlamm, Grus und Gerölle in den See und drängt ihn durch ihre allmählichen Ablagerungen immer weiter zurück; auch die savoyischen Gewässer setzen bedeutende Ablagerungen darin ab. Der dadurch eingeengte und oft vom Sturme angeschwellte See wirft sich auf das waadtländische Ufer, frißt es an und nötigt es durch seine steten Angriffe zur Erbauung von kostspieligen Widerlagern und Dämmen.
Obgleich der Leman weniger fischreich ist als alle anderen Schweizer Seen, so besitzt er doch 21 Arten Fische, worunter sich besonders die Weißwölfchen (Salmo fera) und Seeforellen (Salmo lacustris) auszeichnen. Unter den Vögeln, welche die Seeufer bewohnen, bemerkt man verschiedene Arten von Möwen, Tauchern und Enten. Im Winter lassen sich auch Züge von Schwänen sehen; der durchreisenden geflügelten Gäste hat wohl kein Land so viel als das Waadtland. Indem es nämlich im Westen vom Jura, im Osten von den waadtländischen und freiburgischen Alpen, im Süden von den savoyischen Gebirgen, welche bei Neustadt und Genf einen Ausgang nach Mittag gestatten, eingeschlossen ist, und sich nur im Norden durch den Neuenburger, Bieler und Murtener See nach dem Aartal zu öffnet, welches in das den Quellen der Donau naheliegende Rheintal mündet: so kann dieses Becken als der Sammelpunkt angesehen werden, wo die von Norden, von Süden, ja selbst von Osten herkommenden Vögel zusammentreffen.
Den verschiedenen Winden, welche auf dem See herrschen, haben die Schiffsleute besondere Namen gegeben. Die Bise oder der Nordostwind braust laut anschwellend im östlichen, aber nicht im westlichen Teile des Leman. Die Vaudaire, die aus dem Wallis kommt, ist wieder im kleinen See nicht fühlbar. Dieser heftige Wind treibt die Wellen oft zu einer bedeutenden Höhe, ja er hat sogar schon Gebäude umgeworfen. Der furchtbarste von allen ist aber der Bornand, der plötzlich und unerwartet aus den savoyischen Schluchten hervorbläst. Der Joran kommt über den Jura. Der Genfer Wind (aus Süd) bringt Regen. Der Rebat ist der sanfte Wind, welcher zur Sommerszeit am Mittag weht; er kommt bald von Nordost, bald von West, und dann bedeckt sich der See mit Rauten und rechtwinkeligen Vierecken. Noch ein anderer Wind aus Süden, der Sechard = Austrockner wird schon durch seinen Namen bezeichnet. Alle diese Winde ringen miteinander auf dem See, indem sie bald scherzend über dessen Fläche hinstreichen, Furchen ziehen, oder andere stets wechselnde Gestalten darauf zeichnen, bald grimmig einander anfallen und Wirbel erzeugen. Am 1. Juni 1841 waren die Wellen so gewaltig, daß sie einen 3000 kg wiegenden Block von der Stelle hoben und einige Meter weit forttrugen. Zuweilen treibt der Joran die Wellen gleich jener grünlich schäumenden Brandung, welche sich an dem steilen Meeresgestade bricht; manchmal auch, wenn die letzten Windstöße des Schirokko über die Alpen hereindringen, wütet der See und reißt die Barken mit einer Schnelligkeit fort, als wenn Möwen mit ihren leichten Schwingen auf der Wasserfläche hinstreiften. Schnell ist jedoch die Windsbraut vorüber, und der See spiegelt in seinem stillen, ruhig klaren Gewässer wieder den Frieden und die Majestät seiner Ufer ab. Kaum kräuselt dann der Abendwind seine durchsichtige Fläche, und bricht die Nacht herein, so hüllt er sich in Schweigen, und alle Sterne des Himmels strahlen wider in seinem Spiegel.
Eine Menge von Kähnen und kleinen Schiffen belebt die Wasserfläche; seit der Errichtung von Dampfschiffen besteht zwischen den Hauptorten des Sees eine regelmäßige alltägliche Verbindung. Im Jahre 1823 hat hier ein Amerikaner, Herr Church, das erste Dampfschiff, Wilhelm Tell, erbaut; darauf sind mehrere gefolgt, und jetzt dampft es allerorten. Von Nordosten führen zwei Eisenbahnarme, der eine von Bern über Freiburg, der andere von Neuenburg (Neufchatel) am Westrande des Neuenburger Sees hin an das Ufer des Leman. Bei Lausanne zusammenkommend, gehen sie dann einerseits nach Osten zur Einmündung und nach Westen zur Ausmündung der Rhone, und der ganze See ist diesseits mit der Eisenschiene wie mit einem Gürtel umgeben.
Genf ist der mächtige Anziehungspunkt, der eigentliche Brennpunkt für alles Reise-, Handels- und Industrieleben, das sich am Leman bewegt, aber auch für das wissenschaftliche und künstlerische Leben der Südwestschweiz. Genf ist die erste und reichste Stadt der Schweiz mit dem Gepräge einer echten Großstadt. Seine herrliche Lage an beiden Rhoneufern mit Aussichtspunkten, wie sie nur wenige der europäischen Großstädte bieten, die Bequemlichkeit und Vornehmheit, die es nebst allen geistigen Hilfsmitteln dem Reisenden bietet, bewirken, daß alljährlich Tausende von Fremden in seinen Mauern zusammenkommen. Genf ist als Handels- und Gewerbestadt ein europäischer Platz und namentlich durch seine Uhrenwerkstätten und Schmucksachen berühmt.
Oft ist das Bild des Genfer Sees, seiner Ufer und seines Amphitheaters entworfen worden. »Der Ozean,« sagt Boufflers, »hat einmal dieses Tal besucht, und da er sich in dasselbe verliebte, ließ er ihm sein Bildnis zurück.« »Es ist etwas Schönes,« sagte Pezay, »um ein Land, wo es keine Gärten gibt, weil es selbst einer ist.« Wirklich vereint der Genfer See die Großartigkeit einer breiten Wasserfläche mit der reizenden Uferbildung der italienischen Seen und der reichen Kultur der Ufer des Züricher Sees, indem er zugleich in herrlichster Alpeneinfassung mit dem Vierwaldstätter See wetteifert. Durch Rousseau sind die Namen Clarens und Meillerie von ganz Europa wiederholt worden. Matthisson bat in seinem »Genfer See« den Himmel nur um eine Hütte, ein Gärtchen am Leman, ein Grab an seinem Gestade. Chenedolle hat in seinem »Génie de l'homme« sehr schön die Anmut besungen, womit der Wechsel des Tages- und Nachtgestirns den See schmückt. Auch Byron, Lamartine und Viktor Hugo haben sein Lob gesungen – aber wer vermöchte je die Pracht dieses Gemäldes zu schildern? wer die Reinheit des Sees, die Schönheit seiner Windungen, die Kühnheit, Größe und Harmonie seiner Ufer darzustellen? wer mit Worten den Eindruck wiederzugeben, den der Anblick der Savoyer Alpen mit dem Riesen Montblanc gewährt? Diese Savoyer Riesenpyramiden bewundert man vom schweizerischen Ufer aus, während von Savoyen aus das gegenüberliegende Ufer unscheinbar erscheint. Zwischen beiden Ufern herrscht ein durchgreifender Gegensatz: auf der einen Seite der Friede, auf der anderen das unruhvolle Leben; hier der Protestantismus, dort der die heilige Jungfrau feiernde Priester; hier das zerstückelte Land, dort das Erstgeburtsrecht; in der Schweiz der Reichtum, in Savoyen die Armut. Aber auf beiden Seiten waltet die Natur in ihrer Größe und Anmut, ein mannigfaltiger Reichtum an ernsten und heiteren Farben, scharfe Umrisse und geheimnisvolle Tiefe: überall Reiz, Zauber – überall Gott, den die Seele wohl empfinden, aber nicht auszusprechen vermag.
O heller Leman, König du der Seen,
O schön geleg'ne himmelblaue Flut,
Bezeugt's, die oft mein nasses Aug' gesehen,
Es pries dich höher, als mein Sang je tut.
A. W. Grube, Alpenwanderungen. 3. Aufl., herausgeg. von Benda. Leipzig 1885, Ed. Kummer. Der Montblanc, die höchste Spitze des Alpengebirges und zugleich die höchste Erhebung des europäischen Festlandes, gehört zu dem französischen Savoyen. Etwa einen Längengrad westlich vom Monterosa und fast unter gleicher Breite mit diesem erhebt sich sein silberweißes Haupt noch 200 m höher, bis zu 4810 m Meereshöhe. Die Montblancgruppe, nicht die ausgedehnteste, aber die massigste und großartigste in dem Riesenwall, der sich in einem Halbbogen vom Meerbusen von Genua bis an die Ufer der Donau hinzieht, besteht vorherrschend aus altkristallinischem Gestein, dem grüne Talkblättchen beigemischt sind, welche ihm die charakteristische Färbung geben. Als Herr von Saussure den Montblanc zuerst umwanderte und dann bestieg, glaubte er, vor dem ältesten Gebirge der Erde zu stehen und nannte dieses Gestein Protogyn, das heißt Erstgeborener.
Die aus hartem Urgestein aufgebauten Zentralstöcke der Alpen sind zugleich von höchster senkrechter Erhebung und mit den mächtigsten Firn- und Gletschermassen belastet; in ihnen vereinigt sich die wilde Pracht und erhabene Schönheit des Hochgebirges.
Vorgelagert sind ihnen Berge der Kalk- und Klippenzone. So ist der »Protogyn« der Montblancgruppe von schwarzen Kalksteinen und Schiefern der unteren Juraformation eingefaßt, und nördlich vom Montblanc lagert sich die Klippenzone der Alpen des Chablais, nach dem Genfer See hin abfallend. Gegen Osten ist ein Zug von Karbon- und Triasgesteinen eingelagert, der die Gneise der Montblancgruppe von denen des Monterosa-Stockes trennt und überhaupt den Westalpen eigentümlich ist.
Die Montblancgruppe hat drei Zugänge. Von Süden her führt aus der Lombardei ein Weg ins Tal der Dora Baltea über Aosta nach dem piemontischen Städtchen Courmayeur in das wilde, fast elf Stunden lange Hochtal der Allée Blanche, mit wundervollen Blicken auf die Gletscherreihe des Südabhanges der Montblanckette. Die zweite Straße führt von St. Gotthard oder von Mailand her über den Simplon ins Rhonetal (Wallis) nach Martinach, von dort südlich über den Col de Balme oder den Bergpaß der Tête noire. Der dritte bekannte und beliebteste Eingang führt von Genf ins Tal der Arve über Bonneville nach St. Martin und Sallanches. Dort erscheint in riesiger Größe und schon ganz nahe, mächtig über die Vorberge in den blauen Äther aufragend, das blendend weiße Schneehaupt des »Monarchen«, wie ihn die Talleute genannt haben.
Schon wer dies Haupt von der Rhonebrücke in Genf, die »Montblancbrücke« genannt, erblickt, bleibt wie betroffen stehen – und möchte dann, von Sehnsucht ergriffen, sich die Bergmajestät, ihren Hof und Thron und ihr Schloß näher anschauen und trotz aller reizenden Schönheit des Leman weiter hinaufdringen in die Bergwildnis des Savoyer Hochlandes!
In frühester Zeit und bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts verspürte freilich niemand etwas von solcher Sehnsucht; der Anblick von Schnee und Eis im warmen Sommer wirkte mehr abstoßend als anziehend; der ästhetische Sinn für die Wildnis des Hochgebirges war noch nicht geweckt. Seit der Gründung der Benediktinerabtei le Prieuré durch den Genfer Grafen Aimon war das Hochtal von Chamonix, eingerahmt von der Montblancmasse im Süden und von den Aiguilles rouges (»roten Nadeln«) im Norden, nur den Bewohnern der nächsten Umgebung bekannt, und wenn die Nachbarn einmal eine Wallfahrt nach der Abtei unternahmen, dann pflegten sie sich wohl zu rüsten, insbesondere auch mit Waffen zu versehen; denn die Bewohner des Chamonixtales standen im Ruf, es mit dem Leben und Eigentum der Fremden nicht eben genau zu nehmen. Die erschrecklichen Bergriesen, Steintrümmer und Eisströme ringsum galten aber für so häßlich und »wüst«, daß man sie les montagnes maudites (die verfluchten Berge) nannte, denen zu nahen nicht ratsam sei.Noch heißt der zweithöchste Gipfel des Montblancs Mont Maudit. Seine Höhe beträgt 4771 m. Auch fehlte es so sehr an gangbaren Wegen, daß es wie eine heldenmütige Tat oder wie eine freiwillig übernommene Marter erschien, als der ehrwürdige Genfer Bischof Franz von Sales zu Anfang des 17. Jahrhunderts eine Fußreise nach Chamonix unternahm und glücklich ausführte. Diese Reise verbreitete weithin seinen Ruf und mag sogar das Ihre zu seiner späteren Heiligsprechung beigetragen haben.
Doch kam keinem gebildeten Menschen der Gedanke in den Sinn, in die Fußtapfen des wanderlustigen Bischofs zu treten; für die große Reisewelt blieb das Chamonixtal ein ebenso unbekanntes als gleichgültiges Land, und erst im Jahre 1741 wagten zwei Engländer, die sich vor dem Abenteuer nicht fürchteten, eine Wanderung in diese fremdartige Gebirgseinöde. Der Ritter Wyndham und der Reisende Pococke drangen ins obere Arvetal hinauf und am Montanvert hinauf bis auf das mer de glace oder »Eismeer«. Um die Entdecker eines der großartigsten und schönsten Alpentäler auf dem Erdenrund zu ehren, hat man ihre Namen in einen Felsen an dem mer de glace eingehauen. Der Vorsicht halber hatten sie sich nicht nur selber gut bewaffnet, sondern auch einen Trupp wohlbewaffneter Diener mit sich genommen, welche abends und nachts vor den Zelten, die sie mitgebracht hatten, Wachtfeuer unterhalten mußten, um die vermeintlichen Barbaren, welche die Abhänge des Montblanc bewohnen sollten, abzuschrecken.
Die Erzählung von den Naturwundern, die sie gesehen, regte wohl einige kühne englische Landsleute an, auch eine Reise ins Arvetal nach Chamonix zu unternehmen – sie übernachteten in dem gastfreundlichen Hause des Pfarrers –, doch kam der Besuch des Arvetals erst seit dem Jahre 1760 besonders durch die Schilderungen und Forschungen der Genfer Naturforscher de Saussure, de Luc, Pictet und Bourrit in Gang.
In genanntem Jahre begab sich Herr von Saussure, nachdem er am Jura und in der Umgebung von Genf bereits mit Eifer Gebirgsstudien getrieben, allein und zu Fuß von Genf aus in das Tal von Chamonix. Seine Seele ward freudig erregt beim Anblick des Riesendomes und der scharfen spitzen Felsnadeln an seinen Flanken, die aus ungeheuren Eis- und Firnmeeren hervorragten. Ein glühendes Verlangen ergriff ihn, auf den Gipfel des weißen Berges zu gelangen; allein das schien ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. »Bei meinen ersten Ausflügen nach Chamonix« – erzählt er in seinen berühmten Voyages dans les Alpes – »hatte ich in allen Kirchspielen des Tales bekannt machen lassen, jedem eine ansehnliche Belohnung geben zu wollen, der einen gangbaren Weg zum Gipfel ausfindig machen würde. Ich wollte auch für die Tage zahlen, an welchen man vergebliche Versuche angestellt haben würde.«
Doch alle diese Versprechungen hatten keinen Erfolg. Peter Simon, ein guter Bergsteiger, versuchte das eine Mal auf der Seite des Taculgletschers (auch glacier du Géant, »Riesengletscher« genannt, an der 3175 m hohen Aiguille du Tacul), das andere Mal auf der des Bossonsgletschers emporzuklimmen; er kam aber ganz entmutigt zurück. Fünfzehn Jahre später (1775) versuchten vier kühne Führer aus Chamonix über den Berg La Côte, der einen mit dem Bossonsgletscher fast gleich laufenden Grat bildet, zu gelangen und sich dem Gipfel zu nähern. Sie überwanden die ersten Hindernisse und kamen dann in ein enges Schneetal, von dessen Wänden die Sonnenstrahlen dermaßen zurückgeworfen wurden, daß bei völliger Windstille eine erstickende Hitze entstand. Ermattet und erschöpft kehrten sie um.
Im Jahre 1783 machten drei andere Führer aus dem Tal abermals einen Versuch, auf demselben Wege – über La Côte – vorzudringen. Sie brachten die Nacht auf diesem Berge am Rande des Gletschers zu und setzten am anderen Morgen, wiederum bei sonnig heiterem Wetter, ihren Marsch fort. In ansehnlicher Höhe angelangt, klagte plötzlich der rüstigste von ihnen über unwiderstehliche Schlafsucht. Er wünschte, daß die beiden auch ohne ihn ihren Marsch fortsetzen möchten; doch diese wollten ihn nicht verlassen und meinten, er sei vom Sonnenstich getroffen. Sie verzichteten auf ihr Unternehmen und stiegen zusammen wieder nach Chamonix hinunter. Sobald sie in tiefere Luftschichten gelangten, hob sich die Übelkeit und Schlafsucht von selber.
Trotz alledem versuchte der Naturforscher Bourrit aus Genf noch in demselben Jahr eine Besteigung. Er schlug auf dem Rücken von La Côte gleichfalls sein Nachtlager auf, wurde jedoch von einem Hochgewitter überfallen und mußte zurück.
Nun kam man von dem Gedanken ab, den Weg über La Côte zu nehmen. Unterdessen hatte sich das Gerücht verbreitet, daß zwei Gemsjäger aus dem Dorfe Grüe über verschiedene Felsenkämme bis nahe an die Spitze vorgedrungen seien, ohne von der gefürchteten Hitze belästigt worden zu sein. Bourrit begab sich sogleich zu den beiden hin, und noch am selben Abend brachen sie auf und erreichten in der Morgendämmerung den Fuß einer Felsennadel, welche erklettert werden sollte. Diese »Aiguilles« sind für das Urgestein der Montblancgruppe ebenso kennzeichnend wie die »Türme« im Dolomitkalke Südtirols. Bourrit und einer der Führer waren jedoch von Kälte und Anstrengung schon so matt geworden, daß sie zurückbleiben mußten, während die beiden anderen bis an den Fuß der höchsten Spitze kamen, sie jedoch nicht zu erreichen vermochten, da eingestürzte Eismassen ihnen den Weg verlegten.
Der regnerische und kalte Sommer des Jahres 1785 schreckte von einer Montblancfahrt zurück, doch als sich der Herbst besser anließ, rüstete Bourrit sich zu einer dritten Bergfahrt, auf der ihn sein Sohn und Saussure begleiten wollten. Herr Bourrit hatte den glücklichen Gedanken, zwei Tage vor dem Abmarsch drei Männer von Chamonix vorauszuschicken, welche am Fuße der Aiguille du Gouté eine Hütte aus Steinen erbauen mußten. Die Auffahrt begann am 12. September 1785 vom Dorfe Bionassay aus um 8 Uhr vormittags; es waren zusammen sechzehn Mann. Sie erreichten die Hütte schon um 1½ Uhr. Die Naturforscher hatten Muße genug, Beobachtungen anzustellen, da man hier übernachten wollte. Zwei der Führer stiegen aufwärts, um den besten Zugang zu der Nadel zu erkunden. Die Hütte stand 1700 m über der Talsohle; der Blick nach Chamonix hinab und in die Gebirgswelt hinauf, der heitere Abend und schöne Sonnenuntergang – alles stimmte freudig und hoffnungsvoll. In der Nacht wurde ein Feuer angezündet und unterhalten; doch blieb die Luft mild, und nur gegen Sonnenaufgang ward es kalt. Als die Morgensuppe verzehrt war, begann der Angriff auf die Nadel. Sie fällt überall sehr steil ab, und die Vertiefungen in den Felswänden sind mit Eis und Schnee gefüllt. Solche Runsen oder couloirs, wie sie in der Landessprache heißen, sind sehr gefährlich zu überschreiten. Zuerst mußte man über einen Gletscher gehen, um an den Fuß der Nadel zu gelangen; dann führte der Weg über ein steiles couloir. Um sich vor dem Fallen und Ausgleiten zu schützen, nahmen je zwei Führer, das Ende eines langen Alpenstockes festhaltend, einen der Herren in die Mitte, der sich auf den Stock stützen konnte und so eine mit ihm sich fortbewegende Schranke hatte. Der Felsgrat, den man erreichte, war so steil, daß der Fuß des vorangehenden Führers immer gerade über dem Kopfe des ihm nachfolgenden Wanderers stand. Das Aufsteigen ward noch mehr erschwert durch frisch gefallenen Schnee, der die glatten Eisflächen verdeckte. Es waren schon fünf Stunden verflossen, und noch hatte man den Gipfel der Aiguille du Gouté nicht erreicht. Die Hänge wurden immer steiler, der frisch gefallene Schnee häufte sich, und Peter Balmat, der vor Herrn von Saussure ging, gebot Halt, da er erst erkunden müsse, ob weiter oben fortzukommen sei. Nach einer Stunde kehrte er zurück, mit der Nachricht, die Felsspitze sei nicht zu erreichen, der lockere Schnee sei anderthalb Fuß tief!
Auf ein weiteres Vordringen mußte Verzicht geleistet werden; die erklommene Höhe bestimmte Saussure barometrisch auf 11 442 par. Fuß = 3520 m. Er war überzeugt, daß eine Erklimmung des Gipfels wohl noch gelingen werde; doch müsse es ein Jahr sein, in welchem wenig Schnee fiele.
Noch einmal taten sich im Juni des Jahres 1786 sechs Talbewohner zusammen, um auf der Westseite des Montblancgipfels den ihm nahestehenden Dôme du Gouté zu erreichen und von dort aus den Gipfel zu gewinnen. Doch auch hier stellten sich ihnen unüberwindliche Hindernisse entgegen; der Raum zwischen beiden Kuppen war durch breite Gletscherspalten zerrissen und der Grat so scharf, daß niemand ihn zu überschreiten wagte. Da faßte ein mutiger, eisenharter, gewandter Bewohner von Chamonix, Jacques Balmat, als Gemsjäger mit allen Schrecknissen des Hochgebirges wohl vertraut und mit feinem Ortssinn begabt, den Entschluß, es koste, was es wolle, das Haupt des Monarchen zu erreichen. Seine Gefährten bemühten sich vergebens, ihn von seinem Vorsatze abzubringen. Auf sich allein angewiesen und seiner Kraft vertrauend, ohne Leiter und Seile, drang er, kriechend und rutschend, über die Eisschründe durch das Gewirr der Eistürme oder séracs vor, während die anderen nach Chamonix zurückkehrten. Nach unbeschreiblichen Anstrengungen mußte sich aber der kühne Balmat überzeugen, daß es unmöglich sei, von dieser Seite die Montblanckuppe zu gewinnen. Er mußte sich, zum Teil rückwärts kriechend, über den gefährlichen Eiskamm wieder zurückziehen und entschloß sich, auf das 3780 m hohe »große Plateau« hinabzusteigen, um dort die Nacht zuzubringen und am folgenden Morgen einen neuen Angriff auf die Spitze des Gewaltigen zu unternehmen.
Um auf der Schneefläche nicht zu erfrieren, durfte er sich gar nicht setzen, geschweige niederlegen; er unternahm allerlei »lächerliche« (wie er selber nachher erzählte) turnerische Übungen, um seine Glieder geschmeidig zu erhalten. Aber damit erschöpfte er auch seine Kraft, und obwohl er mit Tagesanbruch noch einmal vorrückte, gelang es ihm doch nicht, die höchste Spitze zu erklimmen; doch von der Zugänglichkeit hatte er sich überzeugt. Er mußte sich zum Rückzuge entschließen, nahm sich aber noch im schwierigen gefahrvollen Herabsteigen fest vor, den von ihm über das große Plateau eingeschlagenen Weg zu beendigen, sobald das Wetter günstig sei.
Unverletzt kehrte er zu den Seinigen zurück, aber auch völlig erschöpft. Er sank aufs Krankenlager, und dem Dr. Paccard, der ihn behandelte, vertraute er sein Geheimnis des entdeckten Weges an mit dem Versprechen, er wolle ihn, wenn er wiederhergestellt sei, selber auf den Gipfel des Montblanc führen. Dr. Paccard war hoch erfreut, das langersehnte Ziel unter den ersten erreichen zu können. Am Nachmittag des 7. August 1786 verließen die beiden Männer die Abtei von Chamonix, vor Einbruch der Nacht erreichten sie die Höhe des Berges La Côte und übernachteten in der von Bourrit erbauten, noch wohl erhaltenen Hütte. Das Wetter war günstig. Am 8. August mit Tagesanbruch setzten sie ihren Marsch fort und kamen um 6½ Uhr abends wirklich auf dem domartig gerundeten Gipfel des Montblanc an. Eine halbe Stunde verweilten sie oben, dann stiegen sie mit Lebensgefahr von der luftigen Höhe herab, vom hellen Mondschein begünstigt, und um 9 Uhr morgens am folgenden Tage, am 9. August, trafen sie wieder in der Abtei ein. Ihre Gesichter waren geschwollen und tief gerötet; Dr. Paccard war schneeblind geworden und konnte erst nach einigen Tagen wieder ordentlich sehen. Ihre Ankunft auf dem Gipfel des Montblanc hatte man von Chamonix aus mit dem Fernrohr gesehen.
Es war eine Heldentat, welche die beiden Männer vollbracht hatten, und schnell und weit verbreitete sich ihr Ruf. Jacques Balmat wurde geadelt; denn er erhielt vom König von Sardinien den Beinamen du Montblanc, auf welchen seine Nachkommen noch stolz sind. Ein Alpenfreund und Naturforscher in Sachsen, Herr von Gersdorf, war so bewegt von der Kühnheit und Ausdauer des Bergsteigers, daß er 17 Friedrichsdor, damals eine ansehnliche Summe, für ihn sammelte und ihm als Ehrengabe übersandte.
Man kann sich denken, daß es nun auch Herrn von Saussure keine Ruhe mehr ließ; er gedachte, seine längst geplante Ersteigung des Montblanc noch in diesem Jahre auszuführen, allein die ungünstige Witterung hinderte ihn daran. Das nächste Jahr sollte und mußte sie aber unternommen werden. Im Juli traf er in Chamonix ein – doch wiederum wechselte das Wetter, und er mußte sich volle vier Wochen gedulden, bis die Führer erklärten, nun sei der Zeitpunkt günstig.
Am 1. und 2. August 1787 wagte er die Besteigung, begleitet von seinem Diener und 18 Führern, die seine physikalischen Instrumente und alles Gepäck trugen, dessen er bedurfte. Der Hauptführer war natürlich Jacques Balmat du Montblanc. Nachdem die Karawane am ersten Tage auf dem Gipfel vom La Côte-Gebirge übernachtet, begann sie den zweiten und viel beschwerlicheren Tagemarsch. Man muß zuvörderst den Gletscher von La Côte überschreiten, um den Fuß einer kleinen Felskette zu gewinnen, die aus den Schneefeldern des Montblanc hervorschaut. Dieser Gletscher ist schwierig und gefährlich zu begehen, weil er von breiten, tiefen und unregelmäßigen Spalten zerrissen ist, über welche man oft nur auf unsicheren Schneebrücken gelangen kann. »Einer meiner Führer,« berichtet Herr von Saussure, »wäre beinahe in einer solchen Spalte umgekommen. Um den Weg zu erkunden, war er am Abend zuvor mit zwei Begleitern vorausgegangen. Zum Glück hatten sie die Vorsicht gebraucht, sich durch ein Seil zu verbinden; eben als er eine Schneebrücke überschritt, brach diese zusammen, und er hing über einem tiefen Abgrunde, gehalten von seinen Kameraden. Wir kamen ganz nahe an der Öffnung vorbei, die sich unter ihm gebildet hatte, und es schauderte mich beim Anblicke der Gefahr, der er entronnen war. Die Überschreitung des Gletschers erforderte wegen der vielen Biegungen, die wir machen mußten, viel Zeit, so daß wir vom La Côte-Gipfel bis an den Fuß des alleinstehenden Felsgrates drei volle Stunden brauchten, obwohl die Entfernung in gerader Richtung nur eine Viertelstunde beträgt.
Nachdem wir die Felsen erreicht hatten, entfernten wir uns wieder davon, um in Schlangenlinie in einem Schneetale aufzusteigen, das sich von Nord nach Süd bis an den Fuß des höchsten Gipfels hinanzieht. Die Firnfelder sind ab und zu von ungeheuren Schrunden durchfurcht, deren Durchschnitt die wagerechten Schneelagen zeigt, wie sie in den einzelnen Jahrgängen sich bildeten. Wie breit oder schmal auch die Spalten sein mögen, man kann nirgends bis auf den Grund sehen.
Meine Führer wünschten, daß wir unser Nachtlager an einem der Felsen aufschlagen möchten, denen man auf dem Emporstieg begegnet; allein, da die höchsten doch noch 600-700 Toisen (1080-1260 m) unter der Spitze des Montblanc lagen, so wollte ich noch etwas höher steigen. Freilich mußten wir nun mitten im Schnee das Lager aufschlagen, und dazu meine Gefährten zu bestimmen, war nicht ganz leicht. Sie bildeten sich ein, daß auf dem Hochfirn während der Nacht eine geradezu unerträgliche Kälte herrsche, und fürchteten in allem Ernst, da zu erfrieren. Endlich faßte ich mich kurz und erklärte ihnen, daß ich fest entschlossen sei, hinaufzusteigen, und zwar mit denen unter ihnen, auf die ich mich verlassen könne. Wir würden uns tief in den Schnee eingraben, die Aushöhlung mit dem mitgenommenen Zeltdache überdecken, ganz nahe aneinander rücken und so jeder Kälte Trotz bieten, wie grimmig sie auch sei. Diese Anordnung beruhigte sie, und wir wanderten weiter.
Um vier Uhr nachmittags erreichten wir das zweite von den drei großen Firnfeldern, die wir zu überschreiten hatten. Und dort in einer Höhe von 2530 m über Chamonix und 3690 m über dem Meere hielten wir Rast. Wir gingen nicht bis auf das letzte Firnfeld, weil man dort den Lawinen ausgesetzt ist. Wir mußten über zwei Lawinen klettern, die seit der letzten Reise Balmats herabgekommen waren und deren Trümmer das Tal in seiner geringen Breite bedeckten.
Meine Leute begannen zuvörderst den Platz auszugraben, auf welchem wir die Nacht hinbringen sollten; aber sie merkten gar bald, daß es ihnen an Luft fehlte. Das Barometer stand nur 481 mm. Diese kräftigen Männer, für welche ein Marsch von 7-8 Stunden soviel wie nichts ist, hatten kaum 5-6 Schaufeln von Schnee fortgeschafft, als sie schon wieder einhalten und Atem schöpfen mußten. Einer von ihnen, der zurückgegangen war, um in einem Fäßchen Wasser zu holen, das wir in einer Spalte bemerkt hatten, fühlte sich plötzlich so unwohl, daß er ohne Wasser zurückkam und den Abend unter peinlichster Herzbeklemmung zubrachte. Ich selbst, der ich doch an die Gebirgsluft gewöhnt bin und mich darin am wohlsten fühle, wohler als in der dicken Luft der Tiefebene, fühlte mich beim Beobachten der meteorologischen Instrumente gänzlich abgespannt. Wir verspürten alle einen brennenden Durst und konnten uns doch auf keine andere Weise Wasser verschaffen als durch Schmelzen des Schnees. Denn wenn auch jemand nach Wasser zurückgegangen wäre, das wir unterwegs bemerkt hatten, so würde er es in der späten Abendstunde zu Eis erstarrt gefunden haben. Die kleine Kohlenpfanne, die ich hatte mitnehmen lassen, konnte zwanzig durstigen Seelen nur sehr langsam zu Hilfe kommen.
Am nächsten Morgen begannen wir das dritte und letzte Eisfeld hinaufzusteigen, dann hielten wir uns links, um auf den höchsten Grat im Osten der Spitze zu gelangen. Der Abhang ist außerordentlich steil, und wir brauchten zwei Stunden, um diesen 500 m hohen Abhang zu erklettern. Nachdem wir beim letzten Felsen angelangt waren, nahmen wir unsere Richtung wieder rechts nach Westen, um den letzten Abhang zu ersteigen, dessen senkrechte Höhe ungefähr 300 m beträgt. Dieses Gehänge bietet keine Schwierigkeit; aber die Luft ist hier bereits so dünn, daß sich die Kräfte sehr bald erschöpfen. Nahe am Gipfel konnte ich nur 15-16 Schritte machen und mußte dann Atem schöpfen; ja, ich bekam hin und wieder Anwandlungen von Ohnmacht, die mich zum Niedersitzen zwangen. Doch sobald die Atmung sich wieder herstellte, fühlte ich auch die Rückkehr meiner Kraft, und indem ich mich wieder in Marsch setzte, meinte ich, in einem Zuge den Gipfel des Berges erreichen zu können. Alle meine Leute waren nach Maßgabe ihrer Rüstigkeit in derselben Lage. Wir brauchten zwei Stunden vom letzten Felsen bis zur Kuppe, und es war 11 Uhr, als wir oben anlangten.
Nun konnte ich das große Schauspiel genießen, das sich vor meinen Augen ausbreitete. Ein leichter Dunst in den tieferen Luftschichten raubte mir freilich den Anblick der am tiefsten und entferntesten gelegenen Gegenstände, also der Ebenen Frankreichs und der Lombardei; doch ich bedauerte diesen Verlust nicht allzusehr in Anbetracht dessen, was ich wirklich sah. Und was ich in vollkommener Klarheit anzuschauen das Glück hatte, das war das Miteinander aller der Hochgipfel, nach deren Bekanntschaft ich so lange mich gesehnt hatte. Ich wollte zuerst meinen Augen nicht trauen, es schien mir wie ein Traum, als ich zu meinen Füßen diese hocherhabenen majestätischen Gipfel, diese schrecklichen Nadeln – die Aiguille du Midi, d'Argentières, du Géant – erblickte, an deren Fuß zu gelangen mir schon so schwierig und gefährlich geworden war. Ich erfaßte ihre Verhältnisse, ihre Verbindung, ihren Aufbau, und ein einziger Blick löste Zweifel, welche jahrelange Arbeit nicht zu beseitigen vermochte.
Unterdessen hatten meine Führer das Zelt aufgeschlagen und richteten darunter den kleinen Tisch zu, auf dem ich meine Beobachtungen über das Sieden des Wassers anstellen konnte. Doch als ich mich anschickte, mit meinem Meßgerät zu arbeiten, mußte ich jeden Augenblick meine Arbeit unterbrechen, um wieder Atem zu schöpfen.
Nachdem wir 4½ Stunden auf dem Gipfel verweilt hatten, begannen wir den Abstieg, der viel leichter von statten ging, als wir gehofft. Am anderen Tage auf dem Bergrücken von La Côte angekommen, traf ich Herrn Bourrit, der einige meiner Führer sogleich in Dienst nehmen wollte, um mit ihnen auf der Stelle nach dem Gipfel zurückzukehren; allein sie fühlten sich zu sehr angegriffen und verlangten, erst nach Chamonix zurückzukehren, um sich dort auszuruhen. So stiegen wir denn alle vergnügt zur Abtei hinunter, wo wir zum Mittagessen anlangten. Ich hatte die Freude, alle meine Leute gesund und wohl zurückzubringen; Gesicht und Augen hatten nicht gelitten, da wir sie mit schwarzem Krepp geschützt hatten. Diese Vorsicht hatte uns vor dem Schicksal der ersten Bergsteiger bewahrt, die halb blind, mit verbranntem und aufgesprungenem Gesicht zurückgekehrt waren.«
In Chamonix wurden bei der glücklichen Rückkehr der Karawane die Glocken des Kirchspiels geläutet und auch ein kirchliches Dankfest gefeiert. Es feierten aber nicht bloß menschlicher Mut und fester Wille, menschliche Ausdauer und Beharrlichkeit einen Sieg, auch die Wissenschaft hat einen ihrer schönsten Erfolge errungen: sie hatte das Chamonixtal und den Montblanc erobert und ein Vorbild für alle künftigen Bergfahrten aufgestellt, dem die besten Naturforscher nacheiferten: Die Geologie hat ihre Heimat in den Bergen.
Für das arme Chamonixtal wurde die Saussure'sche Bergfahrt, von der man in der ganzen gebildeten Welt erzählte, das größte Ereignis; denn das Hochtal wurde fortan der Magnet für zahllose Reisende, die seine Wunder mit eigenen Augen sehen wollten. Dem kühnen Gelehrten und seinem Führer ist 1887 in Chamonix ein schönes Denkmal errichtet worden, Balmat weist mit der Hand zum Gipfel des höchsten Alpenberges, während Saussure freudig erregt mit dem Blick folgt. 1892 hat der Pariser Astronom Janssen auf dem Schnee des Gipfels eine Wetterwarte erbaut, die mit ihrer eigentümlichen Form: abgestumpfte vierseitige Pyramide mit aufgesetzter sechsseitiger Säule als Türmchen, wie eine kleine Festung aussieht und in der Tat »ein himmelanstrebendes, in die Welt hinausleuchtendes Schloß der Wissenschaft ist«. Sie ist aber jetzt im Firn halb versunken und daher verlassen worden.