
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
1. Aus Dalmatien. – 2. Am Skutarisee. – 3. Über den Schipka ins Rosental von Kasanlik. – 4. Die Ägäis als Wiege der europäischen Kultur. – 5. Athen. – 6. Das Griechenland der Gegenwart. – 7. Alttürkisches Familienleben. – 8. In Konstantinopel.
Nach L. Passarge, Dalmatien und Montenegro, Leipzig 1904, B. Elischer Nachf. Dalmatien ist seiner Lage nach eine Art Riviera des östlichen Mittelmeers, die Riviera der Balkanhalbinsel und hat auch an seiner Küste klimatische Kurorte von Ruf, wie zum Beispiel Abbazia und Ragusa – andererseits ähnelt es in der Zerrissenheit seiner Küste, dem Inselhofe, der felsigen nackten Küste mit ihren Canali und Bocchen Norwegen mit seinem Skärgard und seinen Fjorden.
Dalmatien ist ein halbversunkenes Karstgebirge, dessen Kämme als langgestreckte malerische Inseln und Halbinseln von Veglia im Quarnero bis Meleda bei Ragusa das Festland gebliebene, mauerartige Küstengebirge begleiten, das nur von zwei Flüssen, der Cetina aus dem Morlakenlande und der Narenta aus der Herzegowina durchbrochen ist. Das »Isolario« ist außerdem übersät von einer Unzahl buntgestaltiger, meist unbewohnter Klippen, die hier Scoglien heißen. Sie leiden an Wassermangel, ihre Bewohner verdursten inmitten der unendlichen Meerflut. Die Canali, jene schmalen Meeresarme zwischen den Inseln, stellen versunkene Längstäler dar. Sie setzen sich oft hinter einer Landbrücke in einem Süßwassersee oder einem Überflutungsfelde, einem Polje, tief ins Festland hinein fort. Oft verbinden sich mehrere halb versunkene Täler zu einer phantastisch gestalteten Küstenbucht; die bekannteste und wegen der wunderbaren landschaftlichen Wirkung ihrer Gliederung berühmteste bilden die Bocche di Cattaro.sg. bocca, pl. bocche, die »Mäuler« oder Engen. In diesen Kanälen und Buchten treten häufig mit starkem Drucke Schlundquellen aus, Süßwasserwirbel, die oft bei der Wasserarmut des Kalklandes als Trinkwasser ausgebeutet werden oder auch Wasserkraftanlagen treiben müssen.
Die ganze Küste leidet unter der Gewalt der Bora, in welche sich der antike Boreas verwandelt hat, eines Fallwindes, der stoßweise mit Riesenkraft von den Karsthöhen herabstürzt und niederreißend und erkältend wirkt. Er fegt die Ackerkrume vom Felsen und reißt die Pflanzen los, so daß heute überall das nackte Gebirge auf das Meer herniederblickt, freilich auch so in seinem Formenreichtum und seiner herrlichen Beleuchtung und Beschattung von malerischer Wirkung.
Von Sebenico, einem malerischen Küstenstädtchen, zwischen felsigen Abhängen erbaut, führt eine Fahrstraße hinauf über das zerhackte Kalkland mit seinen grauen, harten Trockenpflanzen und seinen spärlichen, aber charaktervollen Wacholderbäumen nach Skardona an der Kerka. Von dort geht es an dem still fließenden Karstflusse, auf dem nur hie und da eine Barke mit Mahlgut zur Mühle fährt, aufwärts: rings wieder die stille Karstöde. Plötzlich ändert sich das Bild, man steht an den berühmten Wasserfällen. Hier stürzt das Wasser über einen der Querriegel des Längsgebirges, hinter dem es sich zu einem stillen See gestaut hat. Dabei ist das Wasser so kalkhaltig, daß fortgesetzt am Rande und weniger reißenden Stellen im Falle Sinterbildungen entstehen, die bei Hochwasser wieder hinweggeschwemmt werden, um wieder sich zu bilden. Im ganzen hat dieser Fluß acht solcher Querriegel zu überwinden. Rings um die Fälle ist frisches Gartengrün, das um so mehr das Auge erfreut, als es oasenartig in der Karstwüste auftaucht: Weiden, Pappeln und Rohr. Der Skardonische Fall rauscht über fünf Stufen nieder und verschwindet unten in einem siedenden Kessel. In der Mitte ist der Fall am weitesten zurückgewichen und hat eine hufeisenförmige Sturzkante gebildet. Eine Felsklippe teilt inselartig die breiten Wassersträhne. Aus der sinterigen Schwammtiefe aber fließt das Wasser als lebendige Kraft durch zahlreiche Kanäle auf die Räder der Walk- und Mahlmühlen. Mit dem betäubenden Rauschen und Brausen der fallenden Wasser mischt sich das Getöse der Räder und das Stampfen der Walkhämmer. Den Wanderer erfrischt die feuchte gesättigte Luft wie in einem Bade. Eine der Mühlen mahlt Insektenpulver aus dem hier überall trefflich gedeihenden Pyrethrum cinerariaefolium.
Die Bewohner dieser Karstlandschaft sind südslawischen Stammes, sie heißen Morlaken.Nach Th. Frank. In den Küstenstädten wohnen auch zahlreiche Italiener. Die Morlaken sind ein prachtvoller, hochgewachsener Menschenschlag mit kühn geschnittenen Gesichtszügen, ausdauernd und mutig, dabei arm wie der zerrissene Felsboden, der ihnen das tägliche Brot widerwillig und kärglich bietet. Schwarze Augen, dunkelbraunes Haar, das in einem Zopf über den Rücken baumelt, Fes und Turban auf dem Kopfe – eine rauhhaarige, vorn mit blauen, roten und weißen Streifen besetzte Jacke, ein rotes Leibchen mit Silberknöpfchen besetzt, das aber die breite, braune, haarige Brust frei läßt, ein breiter Ledergürtel, in welchem Pistolen und Handschar stecken, blaue türkische Pumphosen mit darübergezogenen weißwollenen Strümpfen, an den Füßen die mit Lederriemen zusammengeschnürten Opanken, die lange, mit einem Steinschloß versehene, türkisch geschäftete Flinte über die Achsel gehängt: das ist der Bewohner des morlakischen Landstriches, und Sinj ist dessen Hauptstadt.
Von Osten her senken sich die Abhänge der Dinarischen Alpen bald schroff abstürzend, bald in wellenförmigen Hügeln, aber immer steinig gegen die Adria. Ihre Spitzen, oft von finsteren Nebelkappen umzogen, im Herbste und Frühjahre schneebedeckt, lugen in das Land, lugen bis in den Hauptplatz des Marktfleckens Sinj. Einige breite, aus festen Quadern erbaute ungetünchte Häuser auf der einen Seite, ein Franziskaner-Kloster, eine Kirche und zwei kleinere Häuser auf der anderen Seite bilden den Platz, der eigentlich nur eine Erweiterung der von Spalato nach Knin und Verlika führenden Straße ist. Aus einem steinernen Brunnen – einer Seltenheit in Dalmatien – plätschert in eintönigem Laufe frisches, helles, köstliches Quellwasser in ein kleines Becken; auf der Ostseite des Platzes führt eine steile Straße bergan zu den oberen, terrassenförmig gebauten Häusern, darüber ragt ein mächtiger, steiler Felsblock, auf dessen Spitze die Reste eines türkischen Bergschlosses langsam zerfallen. Gegen Süden verläuft die Straße abwärts an einzelnen kleineren Häusergruppen und Morlakenhütten vorbei, und dann eröffnet sich eine weite Aussicht auf die Ebene oder das Tal von Sinj, welches, von dem Flusse Cetina durchströmt und von hohen schroffen Bergen ringsum begrenzt wird.
Es ist Sonntag, und die Glocken der Franziskanerkirche, der einzigen Kirche von Sinj, läuten zur Messe. Die Männer gehen einzeln hinein, jeder mit seinem Tschibuk in der Hand, den er ehrerbietig in der Vorhalle der Kirche an die Wand lehnt. Es stehen dort schon ganze Bündel von Tschibuks an den Wänden, und da sie alle gleichmäßig aus einem halblangen Rohre ohne Mundstück und einem braunen türkischen Tonkopf bestehen, so ist es nicht recht erklärlich, wie die Eigentümer nach der Messe ihre Tschibuks wieder finden können. Vielleicht nimmt sich auch nach der Messe nur jeder, der heraustritt, irgendeinen Tschibuk, ohne erst lange nach seinem eigenen zu suchen. Die Weiber und Mädchen betreten in kleinen Gruppen die Kirche und haben ein so scheues, demütiges Benehmen, einen so trippelnden Gang, gehen so zusammengedrängt aneinander, daß sie unwillkürlich an kleine Schafherden erinnern.
Der Morlake ist ein von Natur höflicher Mensch, höflich in seiner Weise. Er spricht niemals von seinem Weibe, seiner Schwester oder sonst von etwas, das ihm gehört, ohne die Entschuldigung »prostite« vorauszusenden. »Prostite« bedeutet aber ungefähr soviel als: »mit Respekt zu sagen« oder »salva venia«. Er sagt also beispielsweise: »Mein Weib – mit Respekt zu sagen – hat gestern auf dem Markte ein Schweinchen verkauft – mit Respekt zu sagen – und dafür sechs Gulden fünfzig Kreuzer gelöst.« Geht der Morlake in ein anderes Dorf, auf den Markt oder sonst irgendwohin, so sieht man sein Weib niemals an seiner Seite; sie geht demütig fünf oder sechs Schritte hinter ihm oder gar hinter dem Pferde spinnend oder strickend einher, auf welchem er rauchend sitzt. Das Weib ißt nicht mit den Männern an einem Tische. An dem Tische, der mitten in der Hütte steht, verzehren die Männer ihr einfaches Mahl. Sie trinken ihren gewässerten Wein, stopfen ihre Pfeifen, wenn das Mahl beendet, und strecken sich dann zur Sommerszeit rauchend vor der Hütte auf die Erde oder setzen sich, wenn zur Winterszeit die Bora heult, um das Feuer. Während des Essens hat die eine oder andere der Inwohnerinnen die Männer lautlos bedient, die anderen hocken in einem Winkel der Hütte, bis das Mahl der Männer beendet ist. Erst wenn diese aufgestanden, setzen sich die Weiber an den Tisch, um nun die Reste der Speisen zu verzehren.
Ein weißes, bis an die Knöchel reichendes Hemd, dessen Garn sie selbst gesponnen und das sie dann selbst gewebt, ein weißer linnener Unterrock, ein blaues, rotbesetztes Oberkleid aus Schafwolle, das, vorn offen, beinahe die Form eines riesigen Frackes hat, schafwollene Strümpfe und mit Lederriemen befestigte Sandalen, ein rotes Käppchen auf dem Kopfe: so kleidet sich die Morlakin jahraus, jahrein. Ist sie verheiratet, so trägt sie auf dem Kopfe eine Art kleinen hölzernen Fäßchens ohne Boden, über welches sie ein weißes Tuch unter dem Kinne zusammengebunden hat. Übrigens ist die Kleidung der Weiber beinahe in jedem Dorfe eine etwas andere, so daß man aus ihrer Kleidung mit ziemlicher Sicherheit auf das Dorf oder wenigstens auf den Bezirk schließen kann, welchen sie bewohnen. Ist Sonntags die Messe in der Franziskanerkirche zu Sinj beendet und verläßt das Volk die Kirche, so ist es ein gar farbenreiches Bild, das sich dem Beschauer darbietet. Das wimmelt blau, rot, weiß, grün, gelb und schwarz durcheinander aus der Kirche heraus, bis sich die Gruppen teilen und heimwärts in die oft stundenweit in den Gebirgen liegenden Dörfer ziehen.
Jahre, viele Jahre werden allerdings vergehen, bis es möglich sein wird, in diesen Gebirgsgegenden allenthalben Schulen zu errichten, Lehrer für die Schulen zu finden und es dahin zu bringen, daß alle Kinder auch die Schulen besuchen. Denn es ist ein gar armes Land, diese Morlakei, entwaldet, felsig, wenig bevölkert, wasserarm. Der Morlake hängt, wie vielleicht keine Nation in dem weiten, vielsprachigen Südosteuropa, an den ererbten Sitten und Gebräuchen seiner Vorväter. Wie diese das Schaf schoren, die Wolle spannen und färbten, den Mantel und die Jacke daraus schnitten, so tut er es heute noch; wie die Großväter das Feld bearbeiteten mit einem Pfluge, an dem kein Eisen, mit einem dürren Reisigbündel als Egge und einer Bespannung, die aus Ochsen, Kühen, Pferden und Eseln gemischt war, so pflegt er es auch heute noch; wie der Urgroßvater in barbarisch-türkischer Weise sein Weib behandelte als ein Wesen, das tief unter ihm stand, so läßt heute noch der Morlake sein Weib die schwersten und gröbsten Arbeiten verrichten, und wenn er von ihr sprechen muß, so tut er es nie, ohne beizufügen: »prostite«.
Der Morlake lebt fast im Naturzustande wie das Tier des Feldes. Seine steinerne Hütte hat meist nur Öffnungen, aber keine Fenster und Türen, die sie verschließen. Der Erdboden ist sein Bett. Seine Ziegen und sein Maisfeld müssen ihn nähren; im Herbste nur, wenn die Ziegenschläuche mit Wein gefüllt sind, betrinkt er sich. Fehlt es an Nahrung, so arbeitet er notgedrungen so viel, als nötig ist, oder er bettelt. Früher plünderte er in solchem Falle die Post oder die Reisenden aus, das war ihm unter der österreichischen Herrschaft nicht mehr möglich. Die Furcht vor der weltlichen Strafe, besonders der Freiheitsentziehung, hat sogar die seit Homers Zeiten übliche Blutrache fast beseitigt. Schön sind die Volkslieder dieser Barbaren, voller prächtiger Bilder, voller poetischer Empfindung.
Nach Kurt Hassert, Reise durch Montenegro. Wien 1893, A. Hartleben. Der Skutarisee stellt sich mit seinen farbenprächtigen Strandbildern den schönsten Istriens und Dalmatiens würdig zur Seite und kann mit Recht die Perle Montenegros genannt werden. Er umfaßt jetzt ein Gebiet von etwa 350 qkm. Er war aber einst viel größer und weiter; er endete bei Podgorica (das heißt unter dem Hügel), der volkreichsten Stadt der Tschernagora. Aber der Ausfluß durchnagte immer tiefer die sperrenden Riegel klüftigen Kalkes, die die Wasserfläche stauten; er wurde an zwei Stellen, am Bojana- und am Kiriaustritt, durchbrochen, und die tosenden Wellen fanden einen Ausweg zur Adria. Damit sank der Seespiegel, und ein breites Polje, ein Seeboden wurde bloßgelegt, durch den die Rijeka und Moratscha ihren Weg zum verkleinerten Stausee suchten. In den trockenen Monaten hielten sich Zufluß und Abfluß die Wage; zur Schnee- und Regenzeit aber traten regelmäßig Überschwemmungen ein, weil die schmalen Ausgänge die gewaltige Zufuhr nicht mehr bewältigen konnten. Das ist für viele dieser Karstbecken bezeichnend. Mehr und mehr staute die Wassermasse wieder rückwärts, und Vranina wurde zwischen 1200-1233 zur Insel. Als 1858/59 der Drin seinen Lauf änderte und in die Bojana einmündete – Strom gegen Strom –, da verstopften seine Ablagerungen den ungenügenden Auslaß des Sees noch mehr, und seitdem stieg er wieder, so daß fruchtbare Felder und Ortschaften unter Wasser gesetzt wurden, wenigstens für die wasserreiche Winterzeit.
Tief ist der See nirgends, am Westrande finden sich die größten Tiefen, an keiner Stelle über 8-10 m.
An einem drückend heißen Septembertage ging unser Gewährsmann, die Berge Altmontenegros zur Rechten, die Albanesischen Alpen zur Linken, durch die Ebene von Podgorica nach Süden. Die Vorberge, Reste alter Sperrketten des Sees, sind auf der einst türkischen Seite mit Festungen gekrönt. Eine lange Bogenbrücke führt über die jetzt wasserlose Cijevna. In den Dörfern wohnten mehr Albanesen als Montenegriner. Sie brachten auf Karren mit knarrenden Holzscheiben als Rädern ihre Ernte ein. Die Gerölle schwanden, der Humusboden nahm zusehends zu. Das Polje bildete ein wogendes Meer von Wiesen und Maisfeldern. Obstbäume, Maulbeerbäume und Pappeln schlossen sich zu kleinen malerischen Gruppen zusammen. Dichte Hecken aus Brombeerranken, wildem Wein, Weißdorn umgaben Äcker und Häuser mit lebendigen Mauern. Abzugsgräben entwässerten das Land, das nirgends mehr die Felsunterlage unter dem dicken Fruchtboden erkennen ließ.
Auch die geröllgefüllte Bettmulde der Moratscha hat nur wenig Wasser und doch ist sie zur Regenzeit ein majestätischer Strom. Unter Gewittergüssen erreichte der Reisende den Festungskegel von Sabljak. Plötzlich ist in den Gebirgswall, der die tischglatte Niederung abschließt, eine fast kreisrunde Lücke geschnitten; sumpfige Wiesen umsäumen eine tiefgrüne Wasserfläche, den oberen Karstsumpf. Ein Skutarisee im kleinen; er wird gespeist von dem Sinjakbache und steht durch einen unbedeutenden Wasserfaden, die Karatuna, in Verbindung mit dem großen See. Auf dem türkischen Friedhofe weidet das Vieh. Die Gebäude des Ortes Sabljak zeigen ganz türkische Bauart. Von der wohlerhaltenen Feste bot sich eine umfassende Rundsicht, vom Lovtschend. h. Jägerberg. mit seiner Peterkapelle bei Cetinje bis über den leuchtenden See nach Skutari.
Eine Londra, eines jener schmalen vorn und hinten zugespitzten Boote brachte den Reisenden auf der Karatuna durch den Sumpfgürtel in den Skutarisee.
»Leicht kräuseln sich seine Wellen im flutenden Sonnenlichte. Silberglänzende Fische schnellen blitzschnell aus dem blauen Wasser. Kleine Kähne und große Londras werden sichtbar. Vorspringende Kaps lassen uns den See noch nicht in seiner Gesamtausdehnung überschauen; vielmehr rudern wir in einer schmalen Straße hin, die von schroffen Gebirgsketten und nackten Inselleibern eingerahmt und von einem wirren Überzeuge grüner Sumpfpflanzen, zahlloser Wassernüsse und gelber oder weißer Seerosen noch mehr eingeengt wird. Gerade vor uns aber ragen die stolzen Felskegel von Vranina auf, und ein kleines, in den Wogen fast verschwindendes Eiland, Lesendra, das eine drohende Festung trägt, schmiegt sich ängstlich an ihren Fuß.«
Vranina ist die größte Seeinsel. Nur Lesendra und das Gefängniseiland Grmodschur sind auch noch bewohnt. Auf dem wild verkarsteten und stellenweise mit zerrissenen Karrenfeldern überzogenen Kalkgipfeln von Vranina sind Feldschanzen aus Steinen errichtet, hinter denen einst die Türken das Eiland verteidigt hatten. Von dort oben übersieht man den Skutarisee nach allen Seiten: »Jede Bucht, jede Klippe hob sich scharf aus der stahlblauen Wasserfläche ab, und bis zu den starren Gebirgen Albaniens und des Kutschilandes lag die weite Ebene vor uns. Als eine stattliche Hochgebirgskette stieg das Küstengebirge auf, und zum ersten Male blickte ich in die vor Fruchtbarkeit strotzenden Fluren der Crmnica hinab. Ein viel gewundener Fluß durchschnitt die grünen Wiesen, und aus lichtem Laubwalde schimmerte das Städtchen Virbazar hervor. Dort grüßten der scheinbar eng mit der Hinterwand verwachsene Festungsberg von Sabljak und der in blauen, grünen und braunen Farbentönen schillernde Gornje Blato herüber, und im Süden erhob sich das weiße Kastell von Skutari, hinter dem sich finster und drohend die Berge jenseit des Drin auftürmten.«
Ein kleines Kloster war am Fuße erbaut worden. Vom Dorfe aus, dessen abgezehrte, vom Sumpffieber geplagte Bewohner meist Seefischer waren, ging andern Tags die Londra nach Virbazar. Ein kleiner Raddampfer einer montenegrinischen Gesellschaft kam in Sicht. Er fährt zwischen Rijeka, Virbazar, Plavnica und Skutari. Am jenseitigen Ufer, das einem Wiesenplane glich, »tummelten sich zahlreiche Herden, und Reiher, Pelikane, Störche, Wasserhühner, Wildenten und andere Wasservögel suchten ihre Nahrung im mannshohen Röhricht. Der See ist auch ein beliebter Rastort für die nordeuropäischen Wandervögel. Über den plätschernden Wellen zogen gefräßige Möwen ihre Kreise und schossen gewandt herab, wenn ihr scharfes Auge einen Fisch erspähte, an denen der Skutarisee überreich ist. Man wird nicht müde, dem lustigen Spiele der stummen Geschöpfe zuzuschauen, und erstaunt über die Tausende der größten und schwersten Aale, Hechte, Karpfen, Forellen, Schleien usw., die täglich auf dem Basar von Skutari verkäuflich sind. Am wichtigsten von allen ist die Scoranze, ein sardellenartiger Fisch, der zur Herbstzeit seeauf zieht, um in den breiten Strömen zu überwintern. Sein Fang gilt als ein Volksfest und wird durch einen feierlichen Gottesdienst eingeleitet, der wohl am sinnigsten den ungeheueren Wert und die mit dem Erscheinen des kleinen Fisches verknüpften Hoffnungen zum Ausdruck bringt. Vermag man doch an einem Tage nicht selten 15-20 der größten Londras mit den Unmassen der Scoranzen zu füllen!«
Die Fahrt ging am steilen Westufer hin. Felsklippen mit gelbbraunen Schmutzstreifen, die das Hochwasser anzeigten, lagen im See; Gras, Glockenblumen, Brombeer- und Weidengestrüpp überwucherte die Kalkbänke; sie waren unbewohnt, nur auf Muridsch und Moratschnik stehen spärliche Kirchenruinen. Unser Reisender wäre gerne bis Skutari gerudert, doch seine Montenegriner fürchteten sich, da sie einige Arnauten (mohammedanische Albaner) auf dem Gewissen hatten und der Blutrache wegen sich nicht weiter getrauten.
Er übernachtete deshalb bei einem treuherzigen, montenegrinischen Albanesen im Dorfe Muridsch. Er war wie die übrigen Dorfbewohner Muselmane und übte auf die freundlichste Art Gastlichkeit. Nun fuhren drei Albanesen die Londra bis zur Grenzinsel Gorica Topal, dann quer gegen das verrufene jenseitige Ufer, endlich zurück nach Muridsch, wo der gastfreie Dorfhäuptling Omer Ali ein türkisches Mahl aus fettem Pilav und Reisbrotkuchen darbot, Zigaretten reichte und ein Deckenlager bereiten ließ.
Am anderen Morgen ging es an der Moschee von Muridsch hinaus auf das Karstgebirge, Antivari an der Adria zu. Bald lag der blitzende Spiegel des großen Karstsees mit seinen weißen Inselklippen hinter dem Reisenden, und in der Ferne verschwammen im Dunste die firnbedeckten Alpen Albaniens.
Mühsam wand sich unsere kleine Karawane in langen, endlos scheinenden Windungen die steile Höhe des Schipkapasses hinauf. Erschöpft machten die schwerbepackten Saumtiere Halt, und wir Reisegenossen warfen uns wie auf Befehl am Rande des nächsten Schneefeldes nieder, um in langen, gierigen Zügen das unterhalb angesammelte schmutzige und eiskalte Wasser zu schlürfen. Neu gestärkt erhoben wir uns, und während wir mit den Vorbereitungen zu unserer einfachen Mahlzeit beschäftigt waren, ließ ich selbst in traumverlorenem Sinnen die entzückten Blicke über das großartig wilde Landschaftsbild unter mir und um mich herum schweifen.
Ja, da waren die endlosen, sturmgepeitschten, rauschenden und üppiggrünen Waldungen, da waren auch die wild und wüst durcheinandergeschobenen und -gewürfelten Felsmassen, die jäh abfallenden gewaltigen Wände, die gähnenden Trichter, Spalten und Klüfte, die stein- und schuttbedeckten Hänge – und oben auf dem Kamme die saftigen Matten und Weiden, von denen ich schon als Knabe so oft geträumt, nach denen ich mich so unendlich gesehnt hatte, und die jetzt in Wirklichkeit zu schauen mir endlich vergönnt war. Wunderbar wild, öde, einsam, nach allen Richtungen hin zerklüftet und zerrissen war diese eigenartige Gebirgswelt, von der Sonne des Südens grell beleuchtet und mit einem duftigen Farbenhauch umkleidet, der in seinen sonderbaren Beleuchtungswirkungen selbst da außerordentliche Schönheiten ahnen und vermuten ließ, wo in Wirklichkeit keine vorhanden waren und nur nacktes Gestein schwarz und trotzig in die Lüfte starrte.
Totenstill ist es hier oben; nur der gellende Schrei eines hungrigen Raubvogels oder das rauhe Gegurgel des brunftenden Hirsches sind die Laute, die man im Hochbalkan zu hören bekommt, und die wie geschaffen erscheinen für diese ernste, finstere Hochgebirgswelt, in die das Gezwitscher der Singvögel oder das Plaudern fröhlicher Menschenkinder ohnehin nicht recht passen würden.
Die Zurufe meiner Gefährten schrecken mich aus all diesen Träumereien auf; langsam geht es weiter. Endlich ist der ein ergiebiges Weideland darstellende, aber stellenweise auch mit Felsblöcken und Schneefeldern bekleidete Kamm erreicht, und unwillkürlich hemmen wir wieder die Schritte. Welch ein Bild! Hinter uns das in den letzten Tagen durchwanderte anmutige Tafelland von Bulgarien, das sich, im Gegensatz zu der kristallinischen Hauptgebirgskette, aus Kalk- und Sandsteingebilden der Kreidezeit zusammensetzt, noch weiter zurück die steppenartige, sonnverbrannte Ebene mit dem schimmernden Silberbande der Donau im Hintergrunde, das, kaum dem Auge erkennbar, bisweilen als Abschluß des Ganzen hie und da am Horizont aufblitzt – und vor uns der steile, terrassenförmige Südabsturz des Balkans, die lachenden Gefilde des gesegneten Ostrumeliens, das weitgedehnte, vielbesungene Rosental von Kasanlik!
Wegen seiner vielen, tief eingeschnittenen Pässe ist der Balkan niemals eine trennende Scheide zwischen verschiedenen Völkern gewesen; aber dafür stellt er eine Klima-, Tier- und Pflanzengrenze im höchsten Sinne des Wortes dar. So sind denn auch Bulgarien und Ostrumelien in dieser Hinsicht gänzlich verschiedene Länder, ebenso wie Bosnien und die Herzegowina, während sie doch politisch und völkisch ein so gut und fest geschlossenes Ganzes bilden. Man kommt aus dem rauhen, einförmigen Norden in den warmen, sonnigen und buntbelebten Süden. Neue Blumen und Bäume fesseln unsere Aufmerksamkeit, bisher nicht gesehene Vögel und Schmetterlinge gaukeln durch die warme, von der glühenden Sonne durchzitterte und alles in den schärfsten Umrissen abzeichnende Luft, und schimmernde große Eidechsen huschen behende durch das Felsgeröll.
Unter solcherlei Wahrnehmungen erschien uns der Abstieg ziemlich kurz; wir durchwanderten wieder den herrlichen Waldgürtel mit seinen riesenhaften, vom Blitze zerfetzten, vom Sturme niedergebrochenen und vom Moder zerfressenen Baumleichen und ihren neckisch von Fels zu Fels hüpfenden Wildbächen und langten endlich spät abends todmüde und übersättigt von all den ununterbrochen auf uns einstürmenden neuen Eindrücke in dem Han (Gasthaus) am Fuße des Gebirges an. Hier lernten wir gleich wieder eine neue Gabe des gütigen Südens kennen: ein herrlicher, süßer und sektartig schaumiger Wein erquickte unsere erschlafften Lebensgeister, und noch lange lauschten wir bei dessen Genusse den wilden Räuberliedern der Zigeuner, bis endlich die erschöpfte Natur ihre Rechte geltend machte . .
Der Schipkapaß ist durch die Verteidigung der Paßhöhe unter General Gurko mit seinen sechs russischen und unter den Generälen Stoletoff und Derozinski mit ihren vier bulgarischen Bataillonen gegen den übermächtigen Ansturm Suleiman Paschas in den heißen Augusttagen 1877, durch den fruchtlosen, tollkühnen Ansturm des türkischen Regiments der Geweihten im September desselben Jahres, die auf den Koran den Eid geschworen hatten, die russische Stellung zu nehmen oder unterzugehen – weltbekannt geworden. Auch zur Zeit meiner Anwesenheit (1893) begegnete man noch den Spuren der erbitterten Kämpfe. Überall fand man Granatensprengstücke, Überreste von allerlei Waffen usw., und in unabsehbaren Reihen zogen sich die Gräber zu beiden Seiten des Weges meilenweit entlang als ein stummes und doch beredtes Zeugnis der hier stattgehabten Metzeleien. Übrigens muß man es den Russen lassen, daß sie mit großer Liebe das Andenken ihrer gefallenen Waffenbrüder ehren. Umgekehrt machten die türkischen Massengräber, die der Zahl nach bei weitem im Übergewicht sind, einen traurigen, verkommenen und verwahrlosten Eindruck, was mit der sonstigen ernsten und tiefen Religiosität der Türken in auffallendem Widerspruch steht und wohl hauptsächlich durch die Vertreibung der Türken aus dem Lande zu erklären ist.
Wahrhaft bezaubernd, völlig überwältigend ist der Eindruck, den der weite Rosengarten von Kasanlik auf den Fremdling macht, der ihn zum ersten Male betritt. Alles erscheint ihm hier blumen- und märchenhaft, alles wie in Rosenfarbe getaucht. Rosarot schimmern bis zum fernsten Horizonte hin die Felder, rosa die darin schwarmweise auf- und niederfliegenden Vögel, die Rosenstare, rosa leuchten die von der Abendsonne mit den zartesten Farbentönen übergossenen Schäfchenwölkchen am Himmelszelt, und rosenrot schimmern auch die Wangen der schlank gebauten Mädchen, die mit fleißigen Händen die duftende Gabe des heimatlichen Bodens abpflücken, entblättern und in großen Körben zu Rosenbergen auftürmen. Ein süßer, weicher und doch kräftiger, förmlich berauschender Duft durchschwängert die Lüfte, nimmt Herz und Sinne gefangen und läßt uns wie trunken umherirren in dieser Märchenwelt von Duft und Farbe. Und überall, in den Speisen und im Wein sogar, finden wir denselben süßen und berauschenden Rosenduft wieder . .
Kasanlik heißt zu deutsch Kessel, und es verdient diesen Namen; denn es liegt kesselartig zwischen den zu beiden Seiten weit in die Ebene der Tundscha hinein vorspringenden Terrassen des Balkans eingeschlossen. Auf diese Weise ist es vollkommen gegen rauhe Ost- und Nordwinde geschützt. Und im Sommer, wenn die sengende Sonne des Südens von den kahlen Felswänden abprallt, hat es wahrhaft tropische Wärmegrade aufzuweisen, während doch gleichzeitig die von dem Kamme des Balkans zurückgewiesenen und unterhalb hängen bleibenden Regenwolken für die nötige Feuchtigkeit sorgen. Dieser bevorzugten Lage vor allem hat die Stadt ihren von alters her berühmten Rosenbau zu verdanken. Soweit das Auge reicht, erstrecken sich die leuchtenden Blüten der Rosenfelder wie bunte Teppiche in die Ebene und in das Hügelland hinaus, und nur die Weingärten machen ihnen hie und da den Platz streitig.
Die zum Anbau verwendeten Rosen sind klein und nur wenig gefüllt, aber von köstlichem Wohlgeruch, von Farbe weiß, gelb oder rosa, doch herrscht rosa bei weitem vor. Wenn die Rosenfelder abgeerntet sind, büßen sie ihre Schönheit fast gänzlich ein und haben dann viel Ähnlichkeit mit unseren Kartoffelfeldern, da die Rosensträucher niedrig gehalten und in bestimmten Zwischenräumen reihenweise gepflanzt sind und dazwischen tiefe Furchen verlaufen. Die Feldarbeit und insbesondere das Abpflücken der Rosen wird fast nur von Frauen besorgt, während die Männer mit ihren Tragtieren die abgeernteten Rosenblätter nach Hause schaffen und dort alles zur Verarbeitung vorbereiten.
Die Herstellung des Rosenöls ist ein einfaches Abdampfen (Destillation) und wird in der ursprünglichsten und rohesten Weise durchgeführt. Die luftdicht sein sollenden Verschlüsse der Retorten und Kolben z. B. (zu jenen verwendet man vielfach alte Petroleumballone, zu diesen zurechtgebogene und flüchtig zusammengenietete Regenröhren) stellt man einfach dadurch her, daß man die betreffende Stelle mit einem alten Turban umwickelt. Es ist klar, daß bei einem zweckmäßigeren und von geschulteren Chemikern geleiteten Betriebe das Doppelte an Öl gewonnen werden könnte. So aber geht aus den schlecht schließenden Vorrichtungen das Rosenwasser in solchen Mengen verloren, daß ringsum der Boden davon aufgeweicht wird (das Abdampfen wird meist in den ungepflasterten Höfen und Hausgärten vorgenommen) und man bis an die Knöchel in diesem halb köstlichen, halb ekelhaften Brei herum watet. Es handelt sich eben ausschließlich um eine im kleinen betriebene Hausindustrie. Jeder Bauer im Tale von Kasanlik besitzt seine Rosenfelder wie bei uns seine Kartoffeläcker, die er selbst bebaut und deren Erträgnisse er selbst verarbeitet. Erst das fertige Rosenöl, das er nicht anderweitig absetzen kann, verkauft er an die wenigen, meist griechischen Großhändler, die es dann nach dem Auslande weiter vertreiben, nicht ohne es vorher – gründlich verfälscht und verdünnt zu haben. Das meiste ostrumelische Rosenöl wird im Morgenland (namentlich die Türken lieben es leidenschaftlich) selbst verbraucht; nur verhältnismäßig wenig geht nach Mittel- und Westeuropa, zumal ihm jetzt hier und anderswo in den gewinnbringenden Rosenpflanzungen von Leipzig ein starker Mitbewerb erwachsen ist.
Man gewinnt dreierlei aus den Rosenblättern: das Rosenwasser, das Rosenöl, und das Rosenwachs. Das Rosenwasser ist das eigentliche Erzeugnis des Abdampfens und wird viel weniger geschätzt als die beiden anderen, auch wird es in viel größerer Menge gewonnen. Auf seiner Oberfläche zeigt sich nach längerem Stehen eine dünne, ölige, gelb aussehende Schicht, die behutsam abgeschöpft und in besonderen Fläschchen in einem verborgenen Schränkchen aufbewahrt wird, dessen Schlüssel der Hausherr auf der bloßen Brust bei sich trägt und niemals weggibt. Dieses eigentliche Rosenöl ist in ganz unverdünntem Zustande bei gewöhnlicher Luftwärme keineswegs flüssig, sondern zeigt den Festigkeitszustand des Gänseschmalzes und verwandelt sich erst beim Erhitzen in eine wasserhelle Flüssigkeit. Die Bulgaren nennen es deshalb auch viel richtiger Rosen butter (masslow). Der Geruch dieser Rosenbutter ist nicht übermäßig angenehm und so stark und betäubend, daß sie in unverdünntem Zustande gar nicht verwendet werden kann. Die Gewichtseinheit, nach der sie verkauft wird, ist das nur für diesen Geschäftszweig zur Verwendung kommende Muskal. Ein Muskal ist gleich 4,812 g und kostet an Ort und Stelle 9-12 bulgarische Lewa (Franken). Dieser außerordentlich hohe Preis wird erklärlich, wenn man bedenkt, daß ungefähr 40 kg Rosenblätter dazu gehören, um ein einziges Muskal Rosenbutter zu gewinnen. Im Jahre 1890 führte das Tal von Kasanlik 3164 kg Rosenöl aus, was also der für jene Gegenden sehr bedeutenden Summe von 9 Millionen Franken entspricht. Wenn die Frauen und Töchter der Rosenbauern bei heißer Witterung diese Unmassen von Rosen abpflücken und zerzupfen, so bildet sich an ihren Händen bald ein klebriger Überzug, der mit feinen Messerchen abgeschabt und zu kleinen Kügelchen geknetet wird: dies ist das sogenannte Rosenwachs, nach Ansicht der Türken das köstlichste Erzeugnis des ganzen Rosenbaues, das demzufolge auch noch erheblich höher im Preise steht als die Rosenbutter. Nach Europa kommt es so gut wie gar nicht; desto geschätzter aber ist es im Morgenlande selbst, und namentlich in den Harems soll es eine große Rolle spielen. Vornehme Türken stecken kleine Krümelchen Rosenwachs in ihre Zigaretten und Wasserpfeifen, worauf sich dann beim Rauchen das ganze Zimmer mit dem köstlichsten Rosenduft erfüllt.
Natürlich hält es jeder Fremde, der nach Kasanlik kommt, für seine Pflicht, eine größere oder geringere Menge Rosenöl zu Geschenkzwecken einzukaufen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Denn der Kostbarkeit des Erzeugnisses entsprechend sind nach morgenländischer Sitte der Bräuche und Umständlichkeiten gar viele und langwierige. Wir kürzten die Sache zwar möglichst ab, brauchten aber doch einen halben Tag, um unseren Zweck zu erreichen. Da müssen zuerst die Rosengärten selbst und die Betriebsanlagen besichtigt werden, damit sich der Fremde überzeugen kann, daß alles wohl darin bestellt sei und es fein ordnungsgemäß darin hergehe. Dann wird mit einer gewissen Feierlichkeit nach endlosen Erkundigungen über das Befinden des Käufers und seiner Angehörigen das verborgene Schränkchen geöffnet und ihm ein Fläschchen der kostbaren Rosenbutter entnommen, während gleichzeitig, falls man sich nicht in einem türkischen Hause befindet, die Hausfrau in ihrem besten Sonntagsstaat erscheint und dem Fremden ein Schälchen duftenden Mokkas oder ein Tellerchen mit sehr süß eingemachten Früchten (Sladko) vorgesetzt wird, deren Ablehnung einer schweren Beleidigung gleichgeachtet werden und den sofortigen Abbruch des Handels nach sich ziehen würde. Dann beginnt ein höchst langwieriges und für den nicht an morgenländische Sitten gewöhnten Europäer nicht eben angenehmes Handeln und Feilschen über die Höhe des Preises, wobei die Vorzüge des Rosenöls nach allen Richtungen hin auf das lebhafteste geschildert und auseinandergesetzt werden. Ist man endlich über den Preis einig geworden, so wird unter Hinzuziehung von dritten Personen als Zeugen, die aber auch erst wieder feierlich begrüßt und bewirtet werden müssen, die Wage herbeigeholt, instand gesetzt und geprüft, hierauf das Fläschchen zur Flüssigmachung der Rosenbutter höchst vorsichtig erwärmt und schließlich mit ängstlicher Behutsamkeit die duftende Flüssigkeit in die zum Verkaufe bestimmten Fläschchen von ½ oder 1 Muskal Inhalt gegossen. Das alles geschieht mit unerschütterlichem Ernste und unter fortwährendem Herumreichen von Zigaretten und starkem türkischem Kaffee. Sind endlich die Fläschchen glücklich zugestöpselt und zugebunden, so verläßt man den Raum oft in einem förmlichen Kaffeerausch, unter dessen Folgen man noch tagelang zu leiden hat.
Zum Schlusse sei noch eine ganz besondere und wenig bekannte Eigenschaft des Rosenöls verraten. »O fremder Herr,« sagte die hübsche, junge, glutäugige Frau eines Kasanliker Rosenbauern in der blumenreichen Sprache des Morgenlandes zu mir, »was willst du wieder fortziehen in das rauhe Schwabenland, wo die Menschen oft krank werden und früh sterben müssen, weil sie keine Rosenbutter haben. Bleibe bei uns im Rosental! Hier ist niemand krank und niemand traurig, und der Tod kommt spät und schmerzlos. Nimm nur einen Tropfen Rosenbutter in deinen Wein, du junger Schwabe, wenn du krank und traurig bist, und schon nach einer Nacht wirst du wieder gesund und fröhlich sein. Und noch etwas muß ich dir sagen, Fremdling! Wenn dein Herz von Liebe gequält wird und die blauäugige Tochter des Nordens oder die schlanke Gazelle des Südens dich nicht erhören will, o, dann gehe nur in der Nacht des Vollmondes hinaus und bete und iß ein ganz klein wenig Rosenbutter, dann wird dein Herz erfüllt sein von süßem Liebesschauer, und die Geliebte« – dabei neigte sie das feingeschnittene Köpfchen mit den flammenden schwarzen Augen bis dicht an mein Ohr – »wird dir dann nicht mehr widerstehen, sondern dir gehören, ganz und für alle Zeiten.«Bis hierher nach Dr. Kurt Floericke, Bulgarien und die Bulgaren. Stuttgart 1906, Francksche Verlagshandlung. Etwas gekürzt.
Daß dies wunderbare Rosenland jeden bezaubert, wenn er auch aus rein wissenschaftlichem Triebe heraus hier seinen Forschungen obliegt und aller dichterischen Schwärmerei sonst abhold ist, lehrt uns die prächtige, gegenständliche Schilderung, die Moltke, der das Land noch unter türkischer Herrschaft 1835 besuchte, davon entwarf:
Schon von fern entdeckten wir ein Wäldchen von riesenhaften Nußbäumen, und in dem Wäldchen erst das Städtchen Kasanlik. Selbst die Minarette vermögen nicht über die Berge von Laub und Zweigen hinauszuschauen, unter welchen sie begraben liegen. Der Nußbaum ist gewiß einer der schönsten Bäume der Welt; ich habe mehrere gefunden, die ihre Zweige wagrecht über einen Raum von 100 Fuß im Durchmesser ausbreiteten; das überaus frische Grün der breiten Blätter, das Dunkel unter ihrem gewölbten Dache und das schöne Unterholz rings um den Stamm, endlich das Rauschen der Bäche und Quellen, in deren Nähe sie sich halten, das alles ist wunderschön, und dabei sind sie die großen Paläste, in denen wilde Tauben und Nachtigallen hausen. Von dem Wasserreichtum dieser Gegend kann man sich kaum eine Vorstellung machen. Ich fand eine Quelle am Wege, die 9 Zoll stark senkrecht aus dem Kiesgrund emporsprudelte und dann als kleiner Bach davoneilte. Wie in der Lombardei werden alle Gärten und Felder täglich aus dem Wasservorrat getränkt, welcher in Gräben und Rinnen dahinrauscht. Das ganze Tal ist das Bild des gesegneten Wohlstandes und der reichsten Fruchtbarkeit, ein wahres gelobtes Land; die weiten Felder sind mit mannshohen, wogenden Halmen, die Wiesen mit zahllosen Schaf- und Büffelherden bedeckt. Dabei hängt der Himmel voll dicker Gewitterwolken, die sich um die Schneegipfel der Berge auftürmen und die Fluren von Zeit zu Zeit begießen; zwischendurch funkelt die glühende Sonne, um sie wieder zu erwärmen; die Luft ist von Wohlgerüchen erfüllt, und das ist hier nicht bildlich, wie gewöhnlich in Reisebeschreibungen, sondern ganz buchstäblich zu nehmen. Kasanlik ist das Kaschmir Europas, das türkische Gülistan, das Land der Rosen; diese Blume wird hier nicht wie bei uns in Töpfen und Gärten, sondern auf den Feldern und in Furchen wie die Kartoffel gebaut. Nun läßt sich wirklich nichts Anmutigeres denken als solch ein Rosenacker. Wenn der Dekorationsmaler dergleichen malen wollte, so würde man ihn der Übertreibung anklagen. Millionen, ja viele Millionen von Zentifolien sind über den lichtgrünen Teppich der Rosenfelder ausgestreut; und doch ist jetzt vielleicht erst der vierte Teil der Knospen aufgebrochen. Nach dem Koran entstanden die Rosen erst während der nächtlichen Himmelfahrt des Propheten, und zwar die weißen aus seinen Schweißtropfen, die gelben aus denen seines Tieres, die roten aus denen des Gabriel; und man kommt in Kasanlik auf die Vermutung, daß wenigstens für den Erzengel jene Fahrt sehr angreifend gewesen sein muß. Die Rose = Gül würde mich jetzt auf die Nachtigall = Bülbül leiten, wenn ich nicht fürchtete, mich gar zu sehr ins Poetische zu verlieren. Ich will daher nur noch bemerken, daß man hier die Rosen nicht nur sieht und riecht, sondern auch ißt; eingemachte Rosenblätter sind in der Türkei eine sehr beliebte Leckerei und werden mit einem Glase frischen Wassers morgens vor dem Kaffee genossen. In Kasanlik wird auch Rosenöl gewonnen, auf das man hohen Wert legt. Es ist selbst in Konstantinopel schwer, sich dieses Öl unversetzt zu verschaffen, was schon daraus zu entnehmen ist, daß dort die Drachme 8, hier an Ort und Stelle aber 15 Piaster kommt. Ich hatte mir einen Vorrat Rosenöl mitgenommen, und da ich genötigt war, einen Tag mit der Flasche in der Tasche zu reiten, so duftete ich acht Tage wie ein Rosenstock.Nach den Reisebriefen des Grafen Moltke. S. 104. Berlin 1877, S. Mittler & Sohn.
Von J. G. Kohl. Zwischen Kleinasien, der Balkanhalbinsel und der breitvorgelagerten Insel Kreta liegt das Einbruchsmeer der Ägäis mit seinen Aus- und Zugängen zum Schwarzen Meer wie zum östlichen Mittelmeerbecken, eine inselbedeckte viereckige Meerflur, ein Mittelmeer im Mittelmeer.
Die Inseln sind alle bergig und steilufrig, einige vulkanischen Ursprungs und daher fruchtbar und reich an überraschenden Naturreizen. Ein glänzender Himmel, der sich auch in dem milden Winter wenig trübt, wölbt sich über ihnen, und die Sommerhitze ist durch die Seeluft gemildert. Sie bieten gute Anbauflächen für Trauben, Oliven und Zitronen und anderes mehr, und ihre Häfen sind sicher und bequem. Und die Küsten des Festlandzirkels umher sind reich gegliedert, und ihre tiefen Buchten gewähren der Schiffahrt weiten Zugang ins Innere des Landes und vorzüglichen Schutz.
Recht wohl könnte man das gesamte Griechenland ein Europa im kleinen nennen. Wie Europa durch seine vielfache Gliederung, seine wunderbare Verkettung des Flüssigen und des Festlandes allen anderen Erdteilen überlegen ist, so Griechenland dem übrigen Europa. Und wie die europäischen Völker, nachdem sie einmal erwacht waren, es allen anderen Völkern der Welt in Schiffahrt, Handel, Verkehr, Kultur und Wissenschaft zuvortun mußten, so war, scheint es, das Ägäische oder griechische Meer von Haus aus dazu bestimmt, die erste Wiege und Schule dieser europäischen Tatkraft und Blüte zu werden.
Wann und wie sich die erste menschliche Bevölkerung in dieses wundervolle Becken, über jene anmutigen Inseln und Halbinseln ergoß, ist in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Doch scheint aus der Sprache der Hellenen so viel ersichtlich, daß sie und ihre Stammväter oder Vorfahren, als welche man die Pelasger zu nennen pflegt, aus Osten, aus Asien gekommen sein müssen und dem großen indogermanischen Völkerstamm angehörten, der unserem Europa alle seine vornehmsten und geistreichsten Völker gegeben hat. Ihre Sprache zeigt sie uns innig verwandt mit den keltischen, romanischen, germanischen und slawischen Völkern.
Unter welcher Anführung, unter welchen näheren Umständen und Begebenheiten sich die Altvordern der Hellenen, die sogenannten »Pelasger«, schon in ihrer Urzeit hervortun mochten, wie sie sich nach ihrer neuen Heimat durchschlugen – dies alles hat uns niemand genau überliefert. Gerade die beiden Völker, welche im Altertum die größte Bildung und Bedeutung errangen, die Griechen und Römer, teilen das Schicksal, daß über ihre Urgeschichte und über die frühesten Bewohner ihrer Länder noch größere Ungewißheit herrscht, als über manche andere, minder gebildete Rassen, und dies ist zum Teil eine natürliche Folge eben ihrer frühzeitig gereiften Kultur und Blüte, die alles Vorgefundene und von alters dagewesene Barbarische verdunkelte, überstrahlte, verachtete und bald in Vergessenheit brachte. Wir können nur sagen, daß die »Pelasger« ein von vornherein trefflich beanlagtes Geschlecht gewesen sein müssen, das in ein Vaterland, in ein Haus eingeführt wurde, welches zur Entwicklung solcher trefflicher Grundeigenschaften so günstig wie möglich eingerichtet war, nämlich in jenes bunt gestaltete Einbruchsbecken des Ägäischen Meeres.
Trotz dieser Gunst und Gaben scheint es nichtsdestoweniger, daß auch bei den Griechen, wie bei manchem anderen europäischen Volke, die zündenden Funken von außen kommen mußten. Die Mythen der Helden weisen auf Einwanderungen hin als auf solche Ereignisse, welche ihnen die Anregungen zum sittlichen Leben gaben, auf eine aus der Fremde kommende Lehrerin des Ackerbaues, die Demeter, welche die Ehe stiftete, den Feigenbaum nach Griechenland brachte, wie Minerva den Ölbaum, – auf einen ausländischen Prometheus, der die Griechen die mit Feuer betriebenen Künste lehrte. Selbst den Gebrauch des Eisens empfingen sie aus der Fremde. Die Einführung des Pferdes, der Kunst des Spinnens und Webens wurde dem Poseidon, dem Gotte des Meeres, zugeschrieben, das heißt wohl nur: sie kamen übers Meer zu dem noch unkundigen Inselvolke. Ebenso gelangten zu ihnen zu Schiffe aus Phönizien und Ägypten durch Kadmos, Danaos, Pelops – die ersten Gesetzgeber, Staatengründer und die Erbauer von Burgen und Städten – ein großer Teil ihrer Götternamen, ihrer religiösen Fabeln und Satzungen.
Alle Anfänge der Gesittung brachten den Griechen Schiffer und Handelsleute zu; ihre Kultur war mit einem Worte aus dem Meere geboren. Der Lage und Beschaffenheit des Landes gemäß wuchs sie dann auch bei ihnen durch Hilfe des Meeres weiter. Schon frühzeitig wurden die Griechen selbst ein Volk von Seefahrern und Handelsleuten. Nach dem großen Gotte des allumfassenden Himmels, dem eingeborenen Zeus, war Poseidon, der Gott der Gewässer und Winde, bei ihnen der zweite. Er waltete über ihre Schicksale mächtiger und eingreifender als die anderen, zu ihm stiegen in den zahlreichen, auf den Inseln und Vorgebirgen errichteten Tempeln ihre eifrigsten Gebete empor. Aus den Salzwogen tauchte ihnen die Göttin der Schönheit Aphrodite hervor, und im Meere hatte selbst der Sonnengott Helios seinen Palast, wo er in den Armen der unter dem Wasser waltenden Thetis ruhte.
Die ersten bedeutenden gemeinsamen Unternehmungen der Griechen, in denen sie sich als einziges Volk betätigen und empfinden lernten, der Argonautenzug, der Trojanerkrieg, waren große Flotten- und Seereisen, und wie damals zur Zeit des Argonautenzuges sich ganz Griechenland aus dem Ägäischen Meere erhob, so hat es aus demselben Meere, aus seinen Inseln und Häfen noch oft so wieder frische Kräfte gezogen. Wie jener vom Herkules zu Boden geworfene Antäus stets von seiner Mutter, der Erde, neues Leben empfing, so hat sich Griechenland, wenn es niedergeworfen war (selbst wieder in unseren Tagen), aus seiner Mutter, der See, neugeboren. Ihre ältesten und bei ihnen am meisten volkstümlich gewordenen Gesänge, die Dichtungen Homers, haben Seeräubereien, Seeabenteuer und Schiffahrt zum Gegenstande. Es sind Poesien, die noch heutigestags, wie vor 3000 Jahren, beim griechischen Volke am besten verstanden werden, ebenso wie bei dem Nomadenvolke der Araber die Überlieferungen von ihren Hirtenpatriarchen Abraham und Ismael.
Einmal von außen her angeregt, entwickelte der fruchtbare und wie das Wasser bewegliche Genius der Griechen eine wunderbar vielseitige Tätigkeit nach allen Richtungen des menschlichen Schaffens hin. Zum Enthusiasmus – es ist ein schönes Wort griechischer Erfindung – geneigt, mit Phantasie und einem lebhaften Ahnungsvermögen begabt, erkannten sie auf den weitschauenden Gipfeln ihrer Berginseln, in den Hainen ihrer Küstentäler, auf den blumengeschmückten und von lieblichen Quellen und Flüssen berieselten Fluren ihrer kleinen Uferlandschaften überall die Spur einer Gottheit. Jedes Versteck ihres Landes wurde von der Dichtung verherrlicht und verewigt. Sie lernten die Götter verehren, und in allen Gegenden Griechenlands blühten Orakelstätten, Tempel und Wallfahrtsorte empor. Jeder Zoll des Landes wurde klassisch und geheiligt:
Alle Höhen füllten Oreaden –
Eine Dryas lebt' in jedem Baum,
Aus den Urnen lieblicher Najaden
Sprang der Ströme Silberschaum.
Wie ihr Land, so bot auch ihr Leben die stärksten Gegensätze. Das Schifferleben war reich an Wechsel und bunten Begebenheiten und hatte allein schon hingereicht, den Erzählern, den Rednern, den Dichtern den Mund zu öffnen. Im Hintergrunde dieses wild bewegten stürmischen Seelebens aber lagen die kleinen, reizenden und friedlichen Heimaten in den Inselverstecken, die häuslichen Herde an den Abhängen der Berge, die fruchtbaren Ackerfluren längs der klaren Flüsse und das idyllische Hirtenleben auf den Bergen Ida, Pelion, Helikon und im Innern von Arkadien.
Nach dem Muster der von den Ägyptern und Phöniziern bei ihnen gegründeten Gemeinden stifteten und ordneten sie blühende Städte, Republiken und Staaten in Menge rings um die Inselflur herum. Dort erstarkt, segelten sie weiter auf den nassen Pfaden des Meeres, erfüllten Italien und Sizilien mit ihren Kolonien, stellten Leuchttürme der Bildung an allen barbarischen Küsten des Schwarzen Meeres auf, umfaßten damit, wie mit einer goldenen glänzenden Verbrämung, den ganzen Nordsaum von Afrika und impften von Massilia aus dem fernen Gallien die ersten Anfänge der Kultur ein; selbst aus den Säulen der Herkules segelten sie hinaus auf den unermeßlichen Ozean.
Indem sie auf diese Weise die bekannte Welt durchmaßen, fingen sie, deren Geist ebenso idealer als praktischer Natur war, an, über das Weltall nachzudenken, und es traten mitten auf ihren mit Waren erfüllten Märkten und in ihren von Geschäften und Völkern wimmelnden und lärmenden Häfen ebenso scharfe als tiefsinnige Denker, Naturforscher und Philosophen auf, die je nach dem Standpunkte ihrer Weltanschauung eine Fülle von Lehrgebäuden, Schulen und Richtungen begründeten. Der Handel mit den verschiedenartigsten Völkern erzeugte bei ihnen Reichtum und Üppigkeit, ließ ein Streben nach der Ausschmückung des Alltagslebens erwachen – und die schönen Künste sich entfalten. Ein Apelles, ein Praxiteles und unzählige ihrer Schüler fanden sich ein, unter deren Händen der Marmor sich gestaltete, die herrlichsten Tempel und Hallen erwuchsen und die Schöpfung auf der Leinwand sich frischfarbig abspiegelte.
Wie es in dem Vaterlande der Griechen keinen beherrschenden, alles ausschließlich bedingenden Nil, keinen großen, gebieterischen Ganges, kein unermeßlich weit gestrecktes und einförmiges Mesopotamien gab, wie bei ihnen im Gegenteil alles zerklüftet, bunt und zierlich gegliedert war, wie es eine leicht zu handhabende und den Menschen nicht überwältigende Natur, kleine Täler, schmale Ebenen, zahlreiche mäßig hohe Berge gab, und doch dabei alles durch den glatten Spiegel des Meeres eng verbunden und verschmolzen war, so ist auch dementsprechend die Natur des griechischen Volksgeistes vielseitig wie ein geschliffener Edelstein geworden. Ganz im Gegensatze zu anderen Völkerschaften, zum Beispiel der einförmigen, ungegliederten Masse, welche der russische Land- und Volksgeist uns heutzutage bietet, stellten die Hellenen einen in viele Zweige auseinander gegangenen Baum mit gefälliger Anordnung der Teile dar. Ihre Sprache spaltete sich in mehrere Mundarten, ihr Stamm in zahlreiche Geschlechter, die alle sehr verschiedene Eigentümlichkeiten und doch alle gleich ausgezeichnete Grundtugenden besaßen, und die auch alle, trotz ihres Hinaustreibens in oft sehr entgegengesetzte Richtungen, doch, wie ihre Inseln durch das dazwischen ausgegossene Meer, von dem Bande gemeinsamer Neigungen und Bestrebungen untereinander umschlungen und verknüpft wurden.
Dieselben Verhältnisse, welche die verschiedenen Mundarten, Baustile und Philosophenschulen der dorischen, der ionischen und äolischen Griechen hervorbrachten, erzeugten bei ihnen auch ebenso eine ungemeine Mannigfaltigkeit der politischen Verfassungen und bürgerlichen Zustände. Auch in dieser Hinsicht haben sie innerhalb ihres Lebenskreises sozusagen alles Denkbare erschöpft. Demokratien, Monarchien, Oligarchien und Aristokratien, Geld- und Pöbelherrschaft, Militärdespotie und Priestergewalt wechselten unter ihnen je nach Geschlecht, Zeit und Ort. Man glaubt das Fremdartigste, Südpol und Nordpol, in Steinwurfnähe nebeneinander hausen zu sehen. Die entgegengesetztesten Zustände, zügelloseste Freiheit und unbarmherzigste Tyrannei unter dem Joch eines Einzelnen, scheinen sich unter den Griechen fast die Hände zu reichen, und zwischen beiden äußersten Zuständen in der Mitte gibt es dann wieder eine Fülle von Staatsschöpfungen, die aus der umsichtigsten Überlegung, aus der allseitigsten und sorgfältigsten Berücksichtigung des Charakters der menschlichen Natur hervorgingen.
Die Empörung und der Wechsel der Herrschaft waren bei diesen rastlosen und neuerungssüchtigen Leuten dauernd. Vergebens sieht man sich in ihrer stets stürmischen Geschichte nach einem solchen ruhigen, sonnigen Zeitpunkt um, wie ihn zum Beispiel die Geschichte Roms zur Zeit des Augustus und seiner Nachfolger darbot, in welchem die Künste des Friedens und die Wissenschaften nach unseren Begriffen gemächlich hätten blühen können.
Und dennoch blühten sie unter ihnen schöner als sonst irgendwo. Mit dem Schwerte gegürtet, schrieben die tatkräftigen Hellenen Geschichte in einer Weise, wie sie später so markig selten wieder geschrieben worden ist. Den Giftbecher leerend, den die unduldsamen Mitbürger ihnen reichten, gaben griechische Weise sittliche Lehren der Duldsamkeit und Liebe, die noch jetzt nicht vergessen sind. Mitten im irdischen Getümmel der Straße, unter den Aufregungen des Marktes sannen ihre Philosophen ruhig und unbeirrt über die überirdischen Dinge. Mitten in dem ewigen Parteigezänk und blutigen Waffengeklirr huldigten die Dichter und Künstler den Grazien und schufen vollkommene, wohlklingende und harmonische Sprachgebilde. Wenn man das Tun und Treiben der Griechen im ganzen überschaut, so glaubt man tollkühne, geniale Männer zu sehen, die es verstanden, Blumen zu ziehen in den feurigen Schlünden von Vulkanen, und die den Musen Tempel gebaut haben am Rande noch wütender Lavaströme.
Wie in dem Mutterland Hellas ging es auch in den Kolonialländern her. Die Töchterstädte der Griechen entstanden meistens infolge innerer Zwietracht und leidenschaftlicher Parteiausbrüche, und diese Kolonien selbst, mit denen sie die barbarischen Gestade des Mittelmeeres beglückten, scheinen ebensoviele Krater gewesen zu sein, die das Land umher wie der Ätna zugleich verwüsteten und wunderbar befruchteten.
Es lag vermutlich in der merkwürdig heftigen und feurigen Natur der Griechen, daß die ganze Zeit ihrer höchsten Blüte, ihres schönsten Schaffens nur kurz war und daß sich alle ihre schöpferische Kraft nur in eine, wie ein flüchtiger Traum vorüberschwebende Zeitspanne zusammendrängte. – Zur Zeit des Perikles im 5. Jahrhundert v. Chr. standen sie auf dem Gipfel ihrer Entwicklung. Um die Person dieses hellenischsten aller Hellenen gruppieren sich die ausgezeichnetsten der griechischen Namen, die durch ihre Leistungen in der ganzen Welt herrlich geworden sind.
Man hat die Griechen eine jugendliche, eine Jünglingsnation genannt. Ja, Hegel bezeichnet ihr ganzes völkisches Dasein und Treiben als eine einzige Jünglingstat. Man könnte ihr nationales Gesamtleben mit Einzelleben anderer genialer, hochstrebender Jünglingsnaturen vergleichen, zum Beispiel mit der Raffaels, der sich in der heißblütigen Entwicklung seiner Tatkraft frühzeitig aufrieb, dann aber den Nachkommen eine Erbschaft von Werken vermachte, an welchen sie sich für alle Zeiten entzückten. Mit dieser Erbschaft in der Hand, welche ihm die Zeitgenossen des Perikles hinterließen, hat der Nationalgeist der Griechen sich stets bis auf unsere Tage herab auf Erden mächtig und einflußreich erwiesen, obgleich seit des Perikles Tode bei ihnen nur eine fremde Eroberung der anderen folgte, und obwohl sie nie wieder zu einer so kraftvollen Unabhängigkeit gelangten, wie in den kurzen Jahren, da sie ungestraft untereinander streiten und nach der Palme ringen durften.
* * *
Seit jenen Zeiten der höchsten Blüte sind über die Bevölkerung von Hellas mannigfache und schwere Stürme hinweggezogen. Zuerst kamen Philippus und Alexander mit den Makedoniern über sie; doch hellenisierten sich diese barbarischen Könige des Nordens, huldigten dem Geiste der Griechen, nahmen ihre Sprache an und verbreiteten sie und ihren Geist über den ganzen Osten. Es folgten die Eroberungen der Römer, die Einfälle slawischer Völkerschaften nach der Teilung des römischen Reichs, endlich die Unterjochung durch die Türken im 15. Jahrhundert; zu jeder Zeit aber haben die Griechen, wenn auch in ihrer politischen Unabhängigkeit gestört, doch in kultureller Hinsicht Sieg auf Sieg davongetragen; die fremden Eindringlinge nahmen bald ihre Sprache, ihre Sitten, ihre Künste an.
Die Ursitze der Griechen wurden in ihren Hauptumrissen wenig verändert. In der Tat, vergleicht man sie, wie sie heutzutage vorhanden sind, mit denen, wie sie sich etwa 400 Jahre vor Christus zur Zeit des Perikles darstellten, so findet sich, daß beide fast völlig miteinander übereinstimmen, und daß alle die Türken- und Slawenkriege, alle die Wanderungen, Umwälzungen, Bevölkerungs-Ausrottungen und Verpflanzungen darin eine kaum merkliche Veränderung hervorgebracht haben. Noch immer umzingelt ein Saum griechischer Dörfer und Städte das Ägäische Meer. Griechen oder doch griechisch redende Menschen erfüllen den ganzen Peloponnes, fast das ganze Livadien oder die Provinzen Attika, Böotien, Euböa usw. und weiterhin Thessalien. Als ein schmaler Streifen umzieht griechisches Bevölkerungsgebiet den ganzen Küstenrand von Makedonien und Thrakien. Bei Konstantinopel erfüllen sie einen ziemlich bedeutenden Abschnitt des thrakischen Länderdreiecks bis Adrianopel hinauf und wohnen auf beiden Seiten der Propontis, des Hellesponts und des thrakischen Bosporus. Von hier aus ziehen sie sich, freilich überall mit türkischen Kolonien vermischt, einerseits ostwärts über Sinope hin bis Trapezunt längs des Nordrandes von Kleinasien, und andererseits über Troja, Smyrna, Ephesus nach Rhodus zu, von wo aus sie auch wieder ostwärts den Südrand von Kleinasien einnehmen. Ferner bewohnen sie als die bei weitem vorwiegende Bevölkerung alle Inseln der Ägäis, auch Kreta und Zypern, wo ihre Anzahl sich auf Hunderttausende beläuft, und endlich bilden sie auch im Westen auf den ionischen Inseln den Hauptteil der Bewohnerschaft.
Nur in der westlichen Hälfte des Mittelländischen Meeres, in Sizilien, das einst fast so griechisch war wie Zypern und Kreta, – in Süditalien, dem einstmaligen »Großgriechenland«, und dann in Korsika und Südfrankreich, Spanien usw. haben sich durch Romanisierung und Italianisierung fast alle alten griechischen Volksteile verloren. Doch glaubt man in den Mundarten und Sitten einiger Ortschaften der Provinz Neapel, selbst in einem der ältesten Stadtviertel von Marseille noch heutigestags Spuren alten dorischen, ionischen und äolischen Wesens zu erkennen. – Dagegen haben nun in neuerer Zeit wieder die Griechen, wie ihre Vorfahren, vom Handels- und Wandergeiste beseelt, in vielen anderen Gegenden Europas, wenn auch nicht mächtige, freie Republiken, doch wenigstens Handelsniederlassungen, Kontore und Faktoreien gegründet.
Wie in der Umgrenzung ihres ursprünglichen Wohngebietes am Ägäischen Meere, wie in ihrem Schifferleben und Handelsgeiste, der sie stets in die Welt hinaustrieb, so sind die heutigen Griechen auch in vielen anderen Beziehungen in ihren Sitten und Gebräuchen, in ihren körperlichen und geistigen Anlagen, in ihrer Sprache und in ihren Charaktereigenheiten vielfach die Alten geblieben.
Noch heute finden wir besonders bei den Inselgriechen schöne Gestalten und Körperformen und sehen den echt hellenischen Menschen gerade so erscheinen, wie die Werke des Praxiteles ihn uns zeigen. Jene tiefe Lage der Augen in gewölbten Augenhöhlen, der edle Schnitt und hohe Bogen der Augenlider, die kurze aufgebogene und aufknospende Oberlippe, das vollrunde feste Kinn, die geradwinkelige Senkung der Stirn und Nase, der breite feste Nacken, über dem allen der von Aphrodite selbst gescheitelte und gelockte Haarschmuck, dies alles ist noch jetzt keine ungewöhnliche Erscheinung.
Weniger Antikes gibt es bei den Neugriechen in der Kleidung. Die zottigen Wollmäntel der heutigen Epiroten und Palikaren erinnern lebhaft an die zottigen Chlamyden der Alten. Die roten Käppchen der heutigen Griechen und der Fes der Türken stammen wohl von den antiken Schiffermützen her, die ebenso geformt und mit derselben roten Farbe gemalt auf alten Vasen vorkommen. Die uralte sogenannte phrygische Mütze tragen noch jetzt die Hirtenknaben in Arkadien. Die aus schuppenartig übereinander genähten Silbermünzen gebildeten Brustlätze, welche die bräutliche Aussteuer der Jungfrauen in Livadien bilden, erinnern lebhaft an den Brustpanzer der Pallas, der uns aus unseren Museen bekannt ist. Die Form der Ohrringe, der Halsbänder, der Armspangen der neugriechischen Weiber, ihre Sitte, das dunkle Haar der Braut mit Goldpulver zu bestreuen, dies alles und noch sonst vieles nähert sich in hohem Grade dem Antiken. Auch färben die Frauen noch jetzt die Spitzen ihrer zierlichen Finger mit einem rötlichen Stoffe, ohne zu wissen, daß schon Homer die rosenfarbenen Finger der Aurora besungen hat.
Auch kirchliche und religiöse Handlungen, wie zum Beispiel Hochzeits- und Begräbnisgebräuche, enthalten Überreste aus dem Heidentume. Wie in alten Zeiten, so wird noch jetzt dem Brautpaare das Zeichen des Familienglückes, ein Granatapfel überreicht, und wie ehemals, so werden sie noch jetzt beim Eintritt ins Haus mit Reis bestreut, zum Zeichen, daß ihrer glücklichen Jahre so viele werden möchten wie die Körner. Wie vormals werden bei dem jährlichen Feste zur Feier der Verstorbenen Gerste, getrocknete Weinbeeren, Backwerk und Wein als Totenopfer dargebracht und auf die Gräber hingestellt. Auf den Kopfenden werden kleine Kerzen befestigt, dergestalt, daß der ganze Gottesacker in der Nacht von vielen zum Himmel anstrebenden Flämmchen beleuchtet erscheint. – Die Ansicht der Neugriechen über das Leben nach dem Tode, weit entfernt, der christlichen Lehre vom Paradiese und der Hölle gänzlich gewichen zu sein, zeigt sich in der Poesie jener Naturkinder als vollkommen antik: der alte Charon vertritt noch jetzt die Gestalt des Todes, und noch sind die alten Ausdrücke Hades und Tartaros gang und gäbe und finden sich häufig in den Klageliedern der einfachen, poetischen und abergläubischen Hirten, welche im Sommer die Hochtäler des Parnassus durchziehen.
Zaubermittel bereiten die alten Weiber noch wie sonst, und wie ehemals sind die Thessalierinnen als besonders geschickt in dieser Kunst berüchtigt. Der Knoblauch, den schon Hermes in der Odyssee als Gegenmittel gegen die Zaubereien der Kirke anwendet, wird auch griechischen Kindern unserer Tage in Form eines Amuletts um den Hals gehängt, um das verhexende Auge unschädlich zu machen. – Die Ackerbauwerkzeuge und häuslichen Gerätschaften der Neugriechen haben so antike Formen, daß die griechischen Bauernhütten unsere Museen mit den echtesten Mustern versehen könnten.
Was aber noch wichtiger und merkwürdiger als dies alles ist: auch das Echo der alten Sprache tönt uns aus diesem Lande hell und deutlich entgegen, jenes wundervollen, männlichen und zugleich wohltönenden Klanggebildes, eines der schönsten, edelsten und reichsten, das je auf menschlichen Lippen entstanden ist.
Freilich hat die neugriechische Sprache gleich einem schönen Bildwerk, das jahrhundertelang der Einwirkung zerstörender Wetter ausgesetzt war, mancherlei Veränderungen erfahren und Beimischungen aus dem Slawischen, Türkischen und auch aus dem Italienischen aufgenommen. Sie ist auch mehrfach in ihrem Satzbau verbildet und umgebildet und wird mit einem fremdartigen Tonfall, vielleicht nach Weise der Slawen, ausgesprochen; endlich hat sie, bemerkenswert genug, alle Spuren der alten mundartlichen Verschiedenheiten verloren; nach Ansicht der Gelehrten soll sie sich bloß aus der äolischen Mundart entwickelt haben. Nichtsdestoweniger aber ist sie im Wesen dieselbe geblieben, und zwar kann sie in weit höherem Maße griechisch genannt werden, als zum Beispiel das jetzige Italienisch dem alten Lateinischen gleichgestellt werden darf. Sie wird noch mit denselben Buchstaben geschrieben wie ehemals; ja die griechischen Dorfschreiber bringen sie noch in derselben Art zu Papier, auf dem Knie, auf langen Streifen, die sie zusammenrollen wie die Alten.
Noch jetzt werden in dieser schönen Sprache Volkslieder gedichtet und gesungen. Die Freiheitslieder, welche am Anfang dieses Jahrhunderts ein Rigas sang, sind weithin berühmt geworden. In der Sprache vieler neugriechischer Talbewohner haben sich nicht nur altgriechische Worte erhalten, welche die Umgangssprache der byzantinischen Griechen nicht mehr kennt, sondern es finden sich auch bei ihnen sogar manche Wurzelwörter, welche älter sind, als die uns bekannte alte Schriftsprache selbst.
Am wenigsten will man den hohen, enthusiastischen, patriotischen, der schönsten Tugenden fähigen Volksgeist der alten Hellenen in dem Charakter der jetzigen, als verschmitzt verschrienen, im Handel und Wandel übel berüchtigten Neugriechen wiedererkennen. Allein auch hierin gibt es vielleicht mehr Ähnlichkeit, als die allgemeine Stimme zugeben will. Verschlagenheit, List, Gewandtheit und Verstellungskunst, die dem Neugriechen jeder beilegt und die man gewöhnlich dem Türkendrucke und Slawenjoche zuschreibt, waren nach Homers Zeugnisse auch schon den alten Hellenen in hohem Grade eigen, und der erfindungsreiche Odysseus war, wie man sagt, »mit allen Wassern gewaschen«, mit betrügerischem Diebessinn, Raublust, hinterlistiger Überredungskunst und je nach den Umständen mit schmeichlerischer Höflichkeit reichlich begabt. Also auch diese Untugenden der Griechen sind schon althergebracht.
Auf der anderen Seite sind trotz Türkendruck und Slawenjoch die Neugriechen noch jetzt durch Lebhaftigkeit des Gefühls und der Phantasie, Beweglichkeit des Gemüts, Schärfe des Geistes und Frohsinn, wie die Alten ausgezeichnet. Liebe zu ihrer Berg- und Inselheimat und dabei doch ein großer Trieb, die Wellen des Meeres zu durchwandern, bewegt sie gleich ihren Altvordern, und an ruhmreichen Beispielen vaterländischer Hingebung und heldenmütiger, aufopfernder Verteidigung des Heimatlandes hat es auch in neueren Zeiten nicht gefehlt, ebensowenig wie an Antrieben zur größten Eifersucht, zur Uneinigkeit, Parteiwut und leidenschaftlichen Rachgier. Neben den größten Ränkestiftern findet man auch zuweilen noch im jetzigen Griechenland die biedersten und geradesten Männer, neben der ärgsten Charakter- und Tugendlosigkeit den reinsten, festesten Willen.
Für Gelehrsamkeit und Wissenschaft ist bei den Griechen der Same niemals völlig ausgestorben, und es hat selbst in den schlimmsten Zeiten des Türkendruckes in Konstantinopel immer ein Häuflein Griechenabkömmlinge gegeben, unter denen Bildung und Kenntnisse herkömmlich waren, und aus deren Mitte dann und wann große Gelehrte hervorgegangen sind, hellsehende Köpfe, weitleuchtende Lichter, die selbst in Westeuropa die Aufmerksamkeit auf sich zogen. In neuester Zeit hat sich die ganze Nation, soweit sie frei wurde, wieder dem Studium, der Lern- und Lehrbegierde hingegeben und Hoch- und Volksschulen geschaffen. Auch in bezug auf die Künste ist in den Volksanlagen die Bildsamkeit nie ganz ausgestorben; die Neugriechen haben sich auch auf diesem Gebiete einigen neuen Ruhm erworben.
Allerdings muß man alle diese Leistungen und Anlagen der Neugriechen im Vergleich mit dem, was ihre Altvordern uns hinterließen, als sehr bescheiden bezeichnen und bestenfalls als neue Keime betrachten auf dem Boden, auf dem einst ein so bedeutsamer und blütenreicher Musenhain stand. Sehr begreiflich ist es daher, daß die Neuen in ihren Erzählungen von den Verrichtungen der Alten wie von den Taten eines Titanengeschlechtes reden, und daß sie in ihren Sagen alles, was ihnen von diesen überliefert wurde, mit den Mythen von den weltstürmenden Zyklopen und Riesen vermischen.
Indem wir zum Schluß unserer Betrachtung noch einmal auf jenes kleine Meeresbecken, an dessen Ufern die Wiege und die alten Sitze der Griechen lagen, hinblicken, müssen wir sagen: dort am Archipel begann unser Europa; dort liegen die Wurzeln unserer Bildung, unserer Kulturideale; von diesem, ich möchte sagen, heiligen Meere, wo für uns Geistesleben, Freiheit, Sittlichkeit, Wissenschaft und Kunst entsprangen, sind Samenkörner der Menschlichkeit hinausgeweht worden bis in den äußersten Norden und Westen unseres Weltteils und dann weiter hinaus über den Ozean in eine neue Welt.Nach Gaston Deschamps, Das heutige Griechenland. Übersetzung von Paul Markus. Großenhain 1896, Hermann Starke.

Vgl. Hölderlins wundervolle Dichtung Archipelagus! Das 1832 neuerstandene Königreich Griechenland hat nach langem Schwanken seine »Stadt« (denn die übrigen griechischen Städte darf man getrost Dörfer nennen) fast genau an der Stelle des alten Athen angelegt; manche rieten zu Nauplia, andere zu Korinth wegen der Seenähe. Denn Altathen lag weit landeinwärts, weil man dort unter dem Schutze der Akropolis vor Seeräubern sicher war. Auch Ägina und Patras wurden genannt. Und doch haben die Griechen wohl daran getan, den idealen Mittelpunkt alles echten Hellenentums, dessen Sinnbild, die Akropolis, dem ganzen Abendlande heilig ist, zu ihrer Hauptstadt zu wählen. Dort sind sie ohne Kanonen sicherer als sonstwo. Und die »Leiter« von Athen, der Piräus, der Eisenbahnverbindung nach der Hauptstadt hat, ist ebenso wie Volo für Larissa, wie Nauplia für Argos, wie Jaffa für Jerusalem die Seestadt. Wer sich heutzutage vor der Seekrankheit fürchtet, der fährt mit vollem Dampfe durch Italien, schifft sich in Brindisi auf einem Lloyddampfer ein, landet in Korfu, begibt sich mit seinen Koffern auf ein griechisches Paketboot, das ihn die reizende Kürze der Fahrt durch starke Gerüche von Salzlake und Öl entgelten läßt, sieht im Vorbeifahren die neuen Häuser von Patras, bewundert den Golf von Lepanto und steigt in Korinth aus. Dort hochnotpeinliche Zolluntersuchung, dann geht es zur Eisenbahn, die ihn an kahlen Bergen vorbei, durch unfruchtbare Ebenen mit stolzen Stationsnamen, wie Megara oder Eleusis, nach Athen auf den Peloponnesischen Bahnhof bringt.
Aber den alten Überlieferungen entspricht es weit mehr, die Stadt über den Piräus zu erreichen. Das erweckt allerlei köstliche Träume. Vergebens sagt man sich, daß man auf dem Deck eines schnaubenden, qualmenden Dampfers sitzt, der sich schwerfällig tummelt wie ein ungeschlachtes Ungetüm: man muß an die bemalten, blumengeschmückten Dreiruderer denken, die sich unter Gesängen auf sieggekrönte Wettkämpfer auf den Wellen wiegten.
Will man Attika in seiner ganzen Schönheit genießen, so muß man an einem Frühlingstage im Piräus einlaufen, wenn die lauen Märztage die dürren Sandhügel mit einem leichten Grün beleben. Das Schiff legt an einem Kai aus graulichem Tuffstein an, und bald nahen die grünuniformierten Unholde des Zollamtes. Ist die Qual der Untersuchung überstanden und der Obolos erlegt, so macht man mit einem der zahlreichen Kutscher eine »Symphonie«, setzt sich in eine ámaxa, und, da der Rosselenker den längsten Weg fährt, weil er Zeit und niemals Eile hat, benutzt man die Gelegenheit, einen Blick in einige Winkel des Piräus zu werfen. Das Küstenbild ist buntfarbig und unterhaltend: den ganzen Kai entlang sieht man unter einer überdeckten Galerie, die an gewisse Straßen des Hafens von Genua erinnert, vor kleinen Läden, aus denen ein Geruch von gesalzenem Fleisch herausdringt, die Menschen schlendern, stehen, schwatzen; man braucht nicht weit zu gehen, um alles zu sehen, was den Grundstock der Nahrung des Palikaren ausmacht: Piment, Knoblauchzwiebeln, Wassermelonen, Kaviar, die Bottarga von Missolungi, einen trockenen gelben Teig aus Störrogen und dann unnennbare Leckereien, von denen die Fliegen ein gut Teil vorwegnaschen. Am Boden ganze Lawinen von Orangen; die Kaiks bringen sie von Syrien und Kreta und nehmen dafür Berge von Töpferwaren mit für die Bewohner der goldigen Inseln, wo es Farben und Wohlgerüche, aber keine Tonerde gibt. Das ist der malerische Piräus, der übrige Teil zeigt ganz die häßlichen amerikanischen Nützlichkeitsbauten, die öden Matrosentingeltangels wie alle Hafenstädte. Nur der Verfassungsplatz ist durch eine Periklessäule ein wenig »griechisch« gestaltet.
Eine lange weiße staubige Straße führt vom Piräus nach Athen. Die Landschaft färbt sich bunter. Die kleinen Berge, die sich mit sanfter Böschung nach dem Meere senken, der Ägaleos, der Korydalos, erheben sich allmählich in edleren Formen, in kräftigeren Umrissen. Die Gehänge sind nackt; kurze, dürftige Kräuter decken die Blößen kaum. Und doch bieten sie mit ihren zarten Farbentönen im Sonnenscheine dem Auge ein Fest.
Auf einer kleinen Brücke fährt man über einen kleinen Graben, ohne zu vermuten, daß man eben den Kephissos überschritten hat. Dann führt der Weg am Saum eines kleinen Olivengehölzes hin, das kein anderes ist als der heilige Hain von Kolonos. Da plötzlich sieht man bei einer Wendung des Weges auf einem Hintergrund von dunkleren Bergen das kraftvolle Relief eines gelbroten, nackten Felsens, eine Zuflucht und Festung, den Sockel, der den unsterblichen Tempel trug, in dem das Sinnbild der herrschenden Vernunft und der idealen Schönheit verehrt wurde: die Akropolis.
Man muß diese geweihte Stätte an einem heiteren Morgen erklimmen, um die Stunde, wo die Kuppen des Pentelikon im Sonnenscheine flammen, oder gegen Ende eines schönen Tages, wo vor der sinkenden Sonne die scharfen Umrisse von Salamis erglühen. Die Propyläen, die hinter den mittelalterlich-türkischen Mauerwerken der Westseite mit ihrer Freitreppe das festliche Tor der Burgstadt bildeten, deren Seitenflügel entsprechend der Doppelbestimmung der Burg ein Zeughaus und einen Bildersaal aufnahmen – führen zu dem schönsten Tempel des Altertums: dem Parthenon. Freilich die schönen dorischen Säulen, aus jenem feinen Marmor gemeißelt, der geschmeidig und voll warmen Lebens ist wie zarter Menschenleib, sind durch die Beschießung der Venetianer 1677 verwundet worden, und die Wunden sind noch offen. Von den Ziergiebeln sind die Götter geflohen, und der panathenäische Festzug ist nach kalten barbarischen Ländern gekommen. Gleichviel, so zerstört, so zerrüttet, so zerbröckelt das Parthenon sein mag, trotz seiner klaffenden Löcher, trotz des gähnenden Spaltes, der es in zwei Teile zerrissen, trotz der gestürzten Säulen und geborstenen Knäufe: noch in den Trümmern atmet der Bau die wohldurchdachte Schönheit des Gleichmaßes, die die Griechen mit einem schönen Wort Eurhythmie nannten.
Kein BildDoch möchte ich an dieser Stelle auf Du Boys-Reymonds Steinzeichnung hinweisen, erschienen bei B. G. Teubner in Leipzig, 100x70 cm. Sie gibt sehr schön den farbigen Anblick wieder und zeigt, welch eine Rolle das Licht in dieser Landschaft spielt kann von dieser wunderbaren Ruine einen vollkommenen Begriff geben. Der Lichtschimmer der Sonne vergoldet ihren Marmor, der Himmel badet die Säulen und Giebel in seinem Azur. Am Abende leuchtet in den schrägen Strahlen der Sonne das ernste Gewande in rötlichem Lichte; der zierliche Doppeltempel der Pallas und des Poseidon Erechtheus zeichnet auf dem purpurnen Horizonte seine hohen, schlanken, Blumenstengeln vergleichbaren ionischen Säulen ab. Und dort, ganz am äußersten Ende des Aufbaus, so nahe am Rand, daß man fürchtet, ihn in den Abgrund stürzen zu sehen, erstrahlt, so klein fast wie eine Kapelle, so zierlich wie ein Reliquienschrein, der Tempel der ungeflügelten Siegesgöttin. Allmählich sinkt die Sonne am flammenden Himmel hinab, setzt funkelnde Sterne auf die Häuser von Phaleron und auf die des Piräus und legt breite, blendende Lichtstreifen auf die Wasser des saronischen Meerbusens. Salamis schwimmt ganz veilchenblau in Purpur und Gold. Undeutlich erscheint im Spiegelglanze des Meeres die ferne Küste von Morea. Die Ebene von Attika hüllt sich am Fuße des langsam erblauenden Parnes in tiefen Schatten. Auf der Ostseite dagegen leuchtet rosenfarben der massige breite Hymettos; jetzt ist er schon flieder-, dann malvenfarben, endlich veilchenblau. Und die Schattierungen schwinden, die Farben ermatten, die Spitzlichter ersterben. – Die Sonne erlischt in der Kühle des Okeanos . .
Im Lichte des Tages erkennt das Auge im Allerheiligsten der Athene in verblichenen Farben die schmächtigen Hände, das geneigte Haupt und die großen, starren Augen der byzantinischen Panagia, erkennt in einem Winkel des Tempels die kleine Wendeltreppe, auf der der Muezzin zur Rampe des Minaretts emporstieg, um die Gläubigen zum Gebete zu rufen. Einen viereckigen kahlen Turm in der Mitte, auch ein Zeichen späterer Barbarei, hat man abgetragen.
Neuathen breitet seine Plätze, streut seine neuen Häuser in dem breiten Tale aus, das sich zwischen der Akropolis und dem Lykabettos öffnet und wächst gegen den Piräus, ins Ilissostal hinein, nach Kephissia und Patissia zu, kurz nach allen Seiten. Wäre es nicht so baum- und schattenlos, so würde es an Nizza oder Mentone erinnern. Von der Akropolis aus betrachtet, blendet der Glanz seiner Marmorschauseiten, für die die Brüche des Pentelikon noch immer ausreichen. Die Kuppel der Metropolitankirche und das grüne, runde Helmdach von St. Philippos verraten, daß wir eine byzantinische Stadt vor uns haben. Besonders anmutig ist der Anblick der Stadt von der kleinen Georgskapelle, die wie ein Firstziegel den Lykabettos krönt, wenn die Sonne aufgeht. Während drinnen der Pappas die Frühmesse liest, belebt ein dünnes, rosenrotes Band die Blässe des Himmels über dem Pentelikon. Allmählich erhellt sich der bläuliche, noch schlaftrunkene Block des Hymettos. Ein ganz bleiches Licht verbreitet sich über der weißen Stadt. Hähne krähen. In der Kaserne erklingt der Weckruf. Das Meer längs der fahlen zackigen Küsten entwindet sich langsam dem Schatten und erwacht unter dem Hauche des Frühwindes. Jetzt färbt sich der Osten tiefer mit feuriger Glut. Den Pentelikon schmückt eine leuchtende Strahlenkrone. Wie ein riesiges Giebelfeld hebt er sich von dem safrangelben Himmel ab. Der hochrote Streifen wird breiter. Das Meer nimmt eine veilchenblaue Färbung an. Über dem Ägaleos rosiger Schimmer – und mitten über der Stadt, wo nur selten ein früh wacher Spaziergänger schattengleich an den Häusern entlang schleicht, deren Fenster wie schlummernde Augen geschlossen sind, erstrahlt stolz im goldenen Glorienschein die Akropolis.
Die Straßen der neuen Stadt sind regelmäßig und breit, die Hermes- und Äolosstraße erscheinen wie zwei Riesenkorridore; das Königsschloß ist ziemlich kasernenmäßig angelegt. Die Plätze machen einen wüstenhaften Eindruck trotz ihrer dürftigen Bäume, die Häuser sind wenig stilvoll gebaut. Die Stadt zeigt das schnelle, unsichere Emporkommen auch äußerlich – und doch streift der Fremde ebenso gern im Frühlinge durch die sonnigen Straßen wie die Einwohner, weniger zur Arbeit als zum Genießen aufgelegt, die erfrischende veilchendurchduftete Luft und die sorglose Fröhlichkeit, die über alle Dinge ausgegossen ist, in sich aufzunehmen.
Die Frühlingseinkehr beschwichtigt selbst die politischen Leidenschaften der Neugriechen – und das will etwas heißen. Während die Kyllene noch eine Wolkenhaube trägt, während die Abhänge des Parnes noch mit dünnem Schnee überstäubt sind, duftet die heilige Straße nach Eleusis schon nach Lavendel und leuchtet von Purpuranemonen, auf denen ganze Trauben von Bienen sitzen; blüht die Akropolis über und über von Asphodelos, Thymian und Salbei, da zieht auch der verbissenste »Oppositionelle« aus seinem Café aus, grüßt seine Bekannten mit einem frohgemuten Kaliméra, das heißt guten Tag, und zeigt sich auf Straßen und Plätzen, das Wetter genießend. Viel Volks lagert am Lykabettos und singt näselnd seine eintönigen Weisen; kleine Gesellschaften braten im Freien ein Lamm und befeuchten es mit Rezinatwein. »Dabei vergeht die Zeit!« Arbeit in unserem Sinne ist dem Neugriechen duliá – Sklaverei.
Die Athenerin hat ihre Volkstracht zumeist aufgegeben, das albanesische wollene Rockhemd mit dem roten Hüftgürtel und das kürzere Obergewand mit den Rückenstreifen. Die Männertracht kann man aber auf der Agora, in den Verkaufsständen, die den orientalischen Basar ersetzen, noch sehen und kaufen, billiger und besser freilich auf dem Basar von Argos oder Tripolitza. Dazu gehört der rote Fes mit der blauen Wolltroddel, die enge Weste und die kurze Jacke, deren flatternde Ärmel kunstvoll mit Tressen bestickt sind; besonders aber die weiße Fustanella, die mit ihren röhrenförmig getollten Falten mehrmals um die Hüfte geht, so daß sie eine Art bauschiges Frauenröcklein bildet – endlich Tzaruchias, rote Schnabelschuhe, und blaue oder rote Knopfgamaschen.
Auf dem Fischmarkte handeln die Leute um rote Meerbarben oder Tintenfische, die die Gassenjungen von Phaleron am Fuße der Klippen fangen. Der Obstmarkt bietet allezeit Oliven, die das Frühstück bilden. Zu Mittag ein Stück Käse und ein Glas klares Wasser, das ist dem Griechen genug – Sonnenschein und Sorglosigkeit überall.
Von Prof. Dr. Josef Partsch.
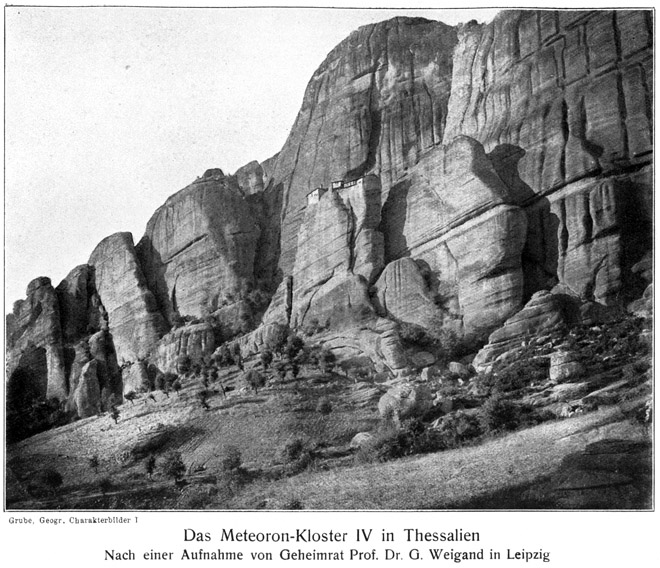
Unter allem Überraschenden, was Griechenland dem Wanderer darbietet, ist wohl das Merkwürdigste das, was man als selbstverständlich hinzunehmen pflegt: die Erhaltung griechischer Sprache und Nationalität durch die Stürme der Jahrtausende. Eine dichte Streu slawischer Ortsnamen beglaubigt bis in die Südspitze des Landes die Ausdehnung und die überwältigende Kraft der Völkerwellen, die im Mittelalter über diesen Boden hinrauschten. Daß sie jedoch das griechische Volk nicht völlig zu erdrücken vermochten, sondern seine Sprache – wenn auch nicht in der Schönheit und Formenfülle ihres antiken Baus, aber doch – fast frei von fremder Beimischung das Land wieder beherrscht, darin liegt zweifellos ein gewaltiges Zeugnis für die Kulturüberlegenheit des Griechentums über die in seine Heimat eingedrungenen fremden Völkermassen. Aber dieser Sieg des griechischen Geistes über den zuströmenden Völkerstoff wurde doch nur möglich dank der Schutzwehr von Land und Meer, dank fester Stellungen, an denen die Flut der Eindringlinge sich brach oder unschädlich vorüberglitt.
Dahin gehören zunächst die Inselkränze, die Griechenland umfangen. Sie wurden von der Masse der Zuwanderer nicht erreicht und behaupteten mit Ausnahme kleiner Felsschollen des Festlandufers gegenüber den tropfenweis herüberdringenden Fremdlingen immer ihre griechische Sprache. Des Winters wechselvolle Stürme legten die Schifffahrt alljährlich auf lange Monate ganz still, und auch im Sommer forderten die steifen, ständigen Nordwinde, die im Sonnenglanz weiße Schaumkränze über die stahlblaue, dunkle Flut jagen, seemännische Geschicklichkeit für die Landung in Buchten zwischen steilen Felsufern.
Auf dem Festland waren starke Burgen griechischen Wesens hauptsächlich die Städte, die in byzantinischer Zeit als Sitze gewerblicher Tätigkeit mit dem Geschick dafür auch die alte Kultursprache bewahrten. Die Burgberge der antiken Städte erwiesen sich als gut verteidigungsfähig auch im Mittelalter. Der Parthenon auf Athens Akropolis, das unvergleichliche Heiligtum der Stadtgöttin, war eine wehrfähige Festung und erlitt in diesem Beruf schließlich auch seine verhängnisvolle Zerstörung. Nicht minder war Akrokorinth noch im Mittelalter ein wertvolles Bollwerk nationaler Verteidigung. Und zu den antiken Festen gesellte sich manch neue Anlage, wie Mistra in Lakonien, das den Zauber mittelalterlicher Romantik neben die Erinnerungen Spartas stellt.
Als solche Stützpunkte hellenischer Widerstandskraft haben wir aber auch zu würdigen die Klöster der griechischen Kirche, von deren merkwürdigen Ortsanlagen und charakteristischer Bauart neue Abbildungen auch dem nicht zu ihnen Vordringenden eine lebendige Vorstellung vermitteln. Sie waren Zufluchtsstätten der Bildung und Stützen religiöser Beherrschung auch für eine fremdsprachige Umgebung. Das gilt in erster Linie von der Mönchsrepublik auf dem Berge Athos, dessen Gipfel (1935 m) auf dem östlichen Vorsprung der dreifingerigen Halbinsel Chalkidike als weit winkende Warte den Norden des Ägäischen Meeres überschaut. Sie birgt noch heute 7000 Mönche, verteilt auf 30 Siedlungen. Auch um die Erhaltung geistiger Errungenschaften des Altertums haben sie sich Verdienste erworben. Im Kloster Vatopedi erhielten sich Karten zu des Ptolemäus großem Tabellenwerk geographischer Ortsbestimmungen. Sehr zahlreich waren auch die Klöster des griechischen Festlands, von denen manche in stürmischen Zeiten nicht nur einzelnen, sondern ganzen Gauen eine wertvolle Zuflucht boten und ihre von Natur feste Lage in abgelegenen Schluchten, auf steilen Felsgipfeln oder in Höhlen an schwer erreichbaren Felswänden noch durch künstliche Befestigungen zu stärken wußten. Besonders berühmt war in Arkadiens schwer zugänglichen nördlichen Tälern das große Höhlenkloster Megaspilaeon in 924 m Höhe (über dem nur 639 m hohen Talgrund) an mächtiger Felswand so aufgeführt, daß seine durch gewaltige Stützmauern gehaltenen Gebäude den Eingang einer 30 m tiefen, 60 m weiten Höhle verdecken und nach oben wie nach unten mit dem Fels verwachsen scheinen. Darunter auf einer Schutthalde verteilen sich die Terrassen der Gärten. Noch 1827 hatte das Kloster seine Verteidigungsfähigkeit gegen Ibrahim Paschas Anschlag zu bewähren. Hohe Basteien beherrschten wirksam den einzigen, schmal unter überhängenden Felsen in den Talwinkel hineinführenden Zugang.
Die merkwürdigste Klosterkolonie bilden die Meteora, die »in der Luft schwebenden« Klöster in der Nordwestecke Thessaliens auf steilwandigen Felspfeilern, die an die »Steine« der Sächsischen Schweiz erinnern. Philippson hat am besten geschildert, wie diese hohen Felsklötze durch schmale Erosionsrinnen herausgeschnitten sind aus den Konglomeratbänken eines bis 300 m mächtigen Schuttkegels, den die Wildwasser des Gebirges als Delta in ein Meer der Vorzeit hineinbauten. Schon das Altertum scheint von diesen Felspfeilern für das Schutzbedürfnis Nutzen gezogen zu haben und sah staunend empor an der »fast unersteiglichen Feste« Äginion. Das 14. Jahrhundert mit seinen wilden Völkerkämpfen bot auf diesen Tafelbergen griechischen Mönchen eine Zuflucht. Nur eines der Klöster ist auf einem gewöhnlichen Felsensteig erreichbar. Bei anderen begreift man kaum, wie die ersten Ersteiger hinaufkamen. Denn nur auf hohen steilen Leitern oder eingeschnürt in ein an der lotrechten Felswand emporschwebendes Netz kann man hinauf- und wieder abwärtsgelangen.
All diese Klöster haben ihre große Zeit, da sie wirklich einen geschichtlichen Beruf erfüllten, hinter sich. Heute erscheinen sie nur durch ihre Gastfreundschaft für den hier rastenden Fremden verdienstlich, nicht mehr als ein Teil der Kräfte, welche die Nation vorwärts bringen.
Schwer genug war die Erhebung des griechischen Volkes nach langer Knechtschaft unter dem türkischen Joch in dem Freiheitskampf 1821 bis 1829, in dem die Griechen eine überraschende Kraft ringenden und ruhenden Widerstandes, ein wahres Heldentum der Entbehrung, geradezu des Hungerns bewiesen, bis der Eingriff der Westmächte und Rußlands das Geschick des anscheinend schon erliegenden Volkes wendete.
Das kleine zunächst geschaffene Königreich mit 47 000 qkm Fläche, auf denen noch heute nicht zwei Millionen Menschen wohnen, erstreckte sich – damals verwüstet und entvölkert – über den Peloponnes, Mittelgriechenland und einen Teil der ägäischen Inselflur. Erst dem Dänenprinzen, der 1864 ein Herrscherhaus begründete, gab England als wertvolles Angebinde die Ionischen Inseln mit auf den Weg in die neue Heimat: ein schon unter Venedigs Obhut, dann seit 1815 unter britischer Pflege glücklicher gediehenes Gebiet, den dichtest bevölkerten, reichsten, bestbebauten Teil griechischen Bodens. Auf 2600 qkm sitzen hier 270 000 Einwohner. Nun trat deutlich hervor, wie anders die Kräfteverteilung im neuen als im antiken Griechenland sich stellte. Wohl lag Griechenlands Hauptstadt, den großen Erinnerungen des Altertums entsprechend, wieder im Osten, nicht aber der Schwerpunkt wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Das dürre Attika und Argolis kann sich nicht vergleichen mit den Ölhainen und Korinthenfeldern des Westens. Aber auch der Gewinn der Ionischen Inseln bot immer noch keinen Ersatz für den Mangel an Getreideland, der das Königreich zehn Monate im Jahre abhängig machte von fremder Zufuhr. Selbst die erst 1890 vollendete Trockenlegung des Karstbeckens des Kopaïs-Sees in Böotien, die 250 qkm nutzbar machte, konnte daran nicht viel ändern.
Wichtiger war die Gewinnung des geräumigen Thessalischen Beckens 1881: 15 000 qkm mit 442 000 Einwohnern, und Artas in Süd-Epirus; allein die Auswanderung des türkischen Landvolkes vermochte Griechenland nicht sofort zu ersetzen.
Die nächsten Jahrzehnte füllte der Kampf um Kreta, das 1909 erst Griechenland endgültig überantwortet wurde: 8600 qkm, 310 000 Einwohner.
Der Mann, der die Seele des kretischen Freiheitskampfes gewesen war, Elevtherios Veniselos, trat nun 1910 an das Steuer der griechischen Politik und führte sie fest entschlossen 1912 in den Balkankrieg, und nachdem ihn des Kronprinzen militärische Fähigkeiten glücklich durchgeführt, nach Entzweiung der Sieger auch in den Kampf mit Bulgarien hinein. Der Ausgang brachte dem griechischen Königreich einen bedeutenden Zuwachs: Epirus, Mazedonien und einige Inseln des Archipels: Thasos, Lemnos, Lesbos, Chios, Samos, zusammen 46 800 qkm, 1 690 000 Bewohner. Das Endergebnis war ein Anwachsen des Königreichs auf 120 000 qkm mit 4 780 000 Einwohnern. Es ist wichtig, sich vorzustellen, was das bedeutet.
Die neue Grenze begann gegenüber Korfu und zog von da nordöstlich zum Presba-See. Sie griff damit erheblich auf albanesisches Gebiet über, noch mehr aber auf slawisches. Florina und den See von Ostrovo einschließend, ging sie bei Gevgeli über den Wardar, über den Doiran-See zur Belašica Planina, unter gleicher Breite ostwärts, um erst jenseit der Mesta südwärts zur Küste zu lenken und sie gegenüber der Insel Thasos zu erreichen.
Den Griechen fiel also hier nicht nur die ganze 2200 qkm messende mazedonische Ebene um den Golf von Saloniki zu mit dem wichtigen Hafenplatze und der Halbinsel Chalkidike, sondern auch die fruchtbare Seelandschaft nördlich von der Wurzel dieser Halbinsel mit der Bahnlinie Saloniki-Konstantinopel und die Unterläufe der Flüsse Wardar und Struma mit den Wegen gegen Belgrad und Sofia.
Wir haben keine Nationalitätsstatistik über Mazedonien. Aber sicher hat Griechenland hier seine Sprachgrenze weit überschritten, mindestens 900 000 Fremdsprachige in seine Grenze aufgenommen. Es ist zu Griechenlands Frommen nicht zu wünschen, daß es diesen Weg festländischer Eroberung, auf dem es festem Widerstand begegnen würde, weiter verfolgt. Auch Saloniki selbst ist keineswegs eine vorwiegend griechische Stadt. Nur ein Fünftel der 180 000 Einwohner ist griechisch, etwa die Hälfte Spaniolen, eingewanderte Juden spanischer Herkunft. Die Weltlage sichert dem Platz, der mit Marseille, Genua, Brindisi, Triest in Wettbewerb tritt, den Vorzug möglichster Abkürzung der Seefahrt nach Alexandrien und dem Suez-Kanal. Am Olymp vorbei geht nun die Bahnlinie nach Larissa und Athen. Östlicher haben die Häfen von Orfano und Kavalla ein fruchtbares Hinterland.
Der Weltkrieg stellte Griechenland vor eine schwere Entscheidung. Da seine ausgedehnte Küstenentwicklung unter dem unwiderstehlichen Druck der Seemächte stand, konnten wir nichts Günstigeres erwarten als Griechenlands Neutralität. Für sie hat der König Konstantin seinen unbeugsamen Willen eingesetzt und damit seinem Volke ungeheure Blutopfer erspart. Hätte ganz Griechenland hinter ihm gestanden, so wäre die Neutralität vielleicht erhalten geblieben. Aber in scharfem Gegensatz zum König stand die politische Überzeugung des Ministerpräsidenten Veniselos. Er wollte bei dem nahenden Zerfall der Türkei Griechenlands Ansprüche durch tatkräftiges Eingreifen gewahrt wissen und trat deshalb für Anschluß an die Westmächte ein.
Schon winken neue Erwerbungen vor den Toren Konstantinopels und am reichgegliederten Ufer Kleinasiens. Dort sind, von jungem Schwemmland verschüttet, die alten Seestädte Milet und Ephesus erstorben. Nur die Ablenkung des Hermos von der Bucht, deren Ausgang er zu verschließen begann, hat das gleiche Schicksal fern gehalten von Smyrna, der nun in griechischer Hand liegenden Pforte der Levante.
Sittenbilder aus dem Morgenlande. Von Herm. Vambéry. Berlin 1876, Allg. Verein für deutsche Literatur. Das alttürkische Haus zerfällt in zwei Teile: den Harem, die Gemächer für die Frauen und Kinder, und das Selamlik, die Räume für den Verkehr des Hausherrn mit der Außenwelt. Bei Armen besteht die Scheidewand meist nur aus einem Vorhange – das Frauengemach bleibt verschlossen und öffnet sich nur in Krankheitsfällen dem Arzte oder dem besuchenden Freunde. Dann pflegt einer der Haremswächter, ein Eunuche, laut zu rufen: »Kimse almazsin!« Niemand sei im Wege! – damit sich die zufällig anwesenden Frauen aus dem Gange in ihre Gemächer verstecken können.
Der Islam gestattet dem Türken die Vielweiberei, vier Frauen und dazu Sklavinnen in beliebiger Anzahl. Doch nötigen meist die Vermögensverhältnisse zur Einehe. Die Frauen werden durch die Abgeschlossenheit in ihrer geistigen Entwicklung beschränkt; der Männergesellschaft fehlt der ausgleichende veredelnde Einfluß der Frau. Dem türkischen Familienleben fehlt es daher meist an Eintracht, Liebe, Zärtlichkeit. Schon der Eintritt in ein konstantinopolitanisches Haus mit seinen leeren, nur mit einigen Teppichen und Diwans ausgestatteten Zimmern stimmt den Europäer kühl, es fehlt das Gemütliche. Einige dumpfe Schläge am Dolab, einem runden Drehkasten, werden hörbar. Das sind die Zeichen für die Dienerschaft und die Haremsmitglieder. Die Schläge werden heftiger, und bald vernimmt man die schweren Tritte eines Dieners, dem eine Sklavin die Mitteilung macht, der Herr des Hauses habe sich vom Pfühl erhoben, sein Bad genommen und werde nun das Selamlik betreten, seinen Morgentschibuk zu schmauchen. Eine kleine Pause, und es heißt: Der Pascha oder Bei oder Efendi ist herausgekommen!
Dieser Ruf bringt den Dienertroß auf die Beine. Ein Tschibuk- oder Nargileh-Wärter schleppt sich schwerfällig durch den Gang dem Gemach seines Herrn zu, bald mit den Händen die halb verschlafenen Augen reibend, bald aus voller Brust das Feuer anblasend, welches das übertäubende Gift beleben soll. Ihm folgt der Kaffee oder Tee tragende Diener; denn obschon der Hausherr an diesen Genüssen sich im Harem gestärkt hat, so muß er es doch noch einmal im Selamlik tun. Das dort Geschehene wird hier als nicht geschehen betrachtet; dort schon erwacht, muß er hier sozusagen noch einmal erwachen. Ohne gegrüßt zu werden oder selbst zu grüßen – denn der eigene Diener grüßt im Orient nie seinen Herrn, wird auch von diesem nicht gegrüßt – muß er nur in langen Zügen dem Pfeifenrohre und dem Getränke zusprechen. Kaum hat er sich dieser Pflicht entledigt, so nähert sich ihm schon der Wekil-Chardsch, das ist der Hausvogt, oder der Chazinedar, das ist Schatzmeister, die auf ellenlanges Papier geschriebene Rechnung vorlegend, um Genehmigung für diese oder jene Ausgabe und den Siegeldruck als Unterschrift zu erlangen. Denn die Pflichten der Hausfrau liegen bei den Mohammedanern immer dem Hausherrn ob. Mit schläfriger, verdrießlicher Miene durchläuft der Herr die langen Postenreihen der häuslichen Ausgaben, und mit Widerwillen greift er nach dem stets auf nackter Brust getragenen seidenen Säckchen, worin die verschiedenen Siegel stecken.
Die Rechnung wird richtig befunden, die besiegelte Geldanweisung unter manchem Seufzer verabfolgt. Zwar weiß der Herr, daß die Hälfte der Ausgaben erlogen ist; er weiß, daß der Mann, den er schon zehn Jahre im Hause hat, ihn frech bestiehlt und ferner bestehlen wird – das alles ist ihm kein Geheimnis, da der Mann einen Monatsgehalt von 36-45 Mark bezieht, während er 90, manchmal 180 Mark verausgabt. Er weiß aber auch, daß mit einem Dienerwechsel nichts gewonnen sein würde, und so schweigt er.
Dieselben Zustände herrschen im Staatsleben. Beamte mit 90 Mark Monatsgehalt verbrauchen 180. Der Schah oder Sultan sieht, wie mancher seiner Diener, der auf ein knappes Gehalt angewiesen ist, reich wird. Ein türkisches Sprichwort sagt: Des Padischah Reichtum ist ein Meer; wer nicht davon trinkt, ist ein Schwein!
Doch sehen wir weiter, wie es im Hause geht! Nach Vollendung des mühseligen Geschäfts des Zählens und Schuldenmachens raucht der Herr eine zweite Pfeife. Der Dolab läßt seine Schläge von neuem hören. Eine gellende jugendliche Stimme ruft einen der Diener, gewöhnlich den ältesten und vertrautesten herbei, damit er den jungen Bei, der den Harem verlassen will, zu seinem Vater führe. Der Diener begibt sich an den vor der Haremstür herabhängenden Vorhang, steckt die Hände dahinter und zieht den Knaben oder auch mehrere Kinder auf einmal hervor, die nun in frischem Anzug dem Vater vorgestellt werden. Obwohl erst im Alter von vier oder fünf Jahren, lassen sie sich doch mehreremal auffordern, sich zu setzen; denn das Kind soll aus Achtung vor seinem Vater stehen bleiben, und es gilt als besondere Gunst, wenn es sich in seiner Gegenwart setzen darf.
Haben sich die Kinder zurückgezogen, so beginnt die eigentliche Arbeitszeit, welche bis 11 Uhr, bis zum Frühstück oder Mittagsmahle dauert. Es ist dies die beliebteste Tageszeit im Hause des Morgenländers, der nur am Vormittag eine frische Arbeitskraft und Lebendigkeit entwickelt. Man findet auch bis 11 Uhr den Herrn am sichersten zu Hause. Ist er Beamter, wozu übrigens jeder Morgenländer höherer Klasse zählt, so empfängt er seine Untergebenen. Die Vorhalle des Selamlik ist von Dienerhaufen der kommenden und abgehenden Gäste erfüllt, die Zimmer selbst sind voll Tabaksrauch, da angeseheneren Gästen eine Pfeife gereicht wird. Das Gespräch wird jedoch, auch wenn zwanzig anwesend sind, nicht so laut, als wenn drei oder vier Südeuropäer beisammen wären. Trotzdem manche der anwesenden Herren unbeweglich wie Wachsfiguren stundenlang mit untergeschlagenen Füßen gesessen haben, entwickeln sie doch alle, ins Frühstückszimmer geladen, einen Riesenhunger.
Das Frühstück könnte, nach den mancherlei Gängen zu urteilen, eine Hauptmahlzeit genannt werden. Doch so langsam die Herren im Sprechen, so schnell und hastig sind sie im Verschlingen der ihnen vorgesetzten Speisen. Eine Tischunterhaltung findet nicht statt. Hätten sie wie in Europa eine Dame an ihrer Seite, so würden sie gewiß langsamer essen und sich besser unterhalten.
Um 11½ Uhr verfügen sich die Herren in ihre Arbeitsstätte. Alsdann ist das Selamlik verödet, das Haus nimmt andere Gestalt an. Dort an der Haremstür beginnt sich der Vorhang lebhaft zu bewegen. Einige muntere Mäuschen spüren, daß die Katze nicht zu Hause ist; sie fangen an, ihre Köpfchen freier zu bewegen. Die Sklavinnen oder sonstige jugendliche Damen finden es jetzt an der Zeit, sich mit Späßen und Neckereien zu unterhalten. Man klopft, ruft, um den einen oder anderen Diener herbeizulocken und verschwindet schnell wieder; man neckt sich mit Worten, oft in sehr derben Ausdrücken, ohne von der Gestalt mehr als einen Finger oder Kleidzipfel sehen zu lassen.
Die älteren Frauen besprechen mit den Dienern dies und jenes; während des Gesprächs müssen die Untergebenen die Blicke senken; denn es wäre wider allen Anstand, wenn ein Mann die ihm gegenüberstehende Frau ansehen wollte. Der Herr selber darf, in Gegenwart anderer Männer den Namen seiner Frau oder Tochter nicht aussprechen, nur andeuten. Das kaum dreijährige Kind erscheint vor seinem in Männergesellschaft befindlichen Vater, um eine Mitteilung zu machen. Der Vater neigt angstvoll seinen Kopf zum Kinde herab, das schüchtern und errötend umherblickt und ihm einige Worte ins Ohr flüstert. Es hat eine Botschaft von der Mutter gebracht, von der es aber nicht laut zu sprechen wagt. Mit solcher Zurückhaltung wird das Familienleben ertötet. Von Familienfesten kann keine Rede sein, da die Frauen im Harem zurückbleiben müssen, wenn zum Beispiel der Sohn in einer Männergesellschaft etwas vorträgt und seine Sache gut macht. Dem Vater fließen Freudentränen über die Wangen, die Mutter aber ist fern. Der Vater darf sich mit der Mutter seiner Kinder oder mit seinen Kindern nicht öffentlich zeigen. Geht er etwa mit ihnen auf den Basar, um Einkäufe zu machen, so sammeln sich nur die männlichen Mitglieder der Familie um ihn, die verschleierten Damen bleiben 5-6 Schritte zurück. Will nun pater familias seine Ehehälfte über etwas verständigen, so redet er, ohne sich umzudrehen, aufs Geratewohl in die Menge hinein, und die Frau muß erraten, daß ihr die Worte gelten.
Die Frau der höher gestellten Türken hat eine große Anzahl von Anverwandten und Dienerinnen um sich, die beim Mangel an ordentlicher Beschäftigung in allerlei verschwenderische Launen verfallen, und weigert sich der Hausherr, ihnen zu willfahren, so stehen ihm sofort alle weiblichen Familienglieder, darunter oft seine eigenen Töchter, feindlich gegenüber. Um den Ohrenbläsereien und Ränken des Harems zu entgehen, meidet er ihn den Tag über gern. Das Kind aber ist Zeuge des oft sehr unlauteren Treibens der Frauenwelt, und sein sittliches Gefühl wird schon früh verdorben. Man tut sich Knaben wie Mädchen gegenüber nicht den mindesten Zwang an, und jene bleiben bis zum zehnten Jahre und noch länger im Harem.
Mütter, die früher Sklavinnen waren, haben gegen ihre freigeborenen Töchter einen schweren Stand, und werden sie vom Hausherrn bevorzugt, so erwacht der Neid der anderen Frauen. Man bringt ihnen in Erinnerung, wieviel sie beim Ankauf gekostet, wie dürftig sie waren, als sie ins Haus kamen. Das merken sich auch die Kinder. Ich hatte, erzählt Professor Vambéry, einst zwei Zöglinge, von denen der eine ebenso friedfertig, gehorsam und fleißig, wie der andere zänkisch, widerspenstig und nachlässig war. Der eine gehorchte seiner Mutter auf den Wink, während der andere der seinigen durch Ungehorsam steten Verdruß bereitete. Sie waren Kinder eines Vaters, aber von verschiedenen Müttern, und als ich den Widerspenstigen wegen seiner Schlechtigkeit zurechtwies und ihm den Bruder als Muster der Folgsamkeit seiner Mutter gegenüber vorstellte, erwiderte der böse Bube trotzig: »Willst du etwa, daß ich meiner Mutter so gehorchen soll, wie mein Bruder der seinigen? Die hat 40 000 Piaster gekostet und meine nur 20 000!« – ein kleines, aber deutliches Zeichen dafür, wie weit die übeln Folgen der Mißachtung der Frau im Islam reichen.
Nach Friedrich Seiler, Konstantinopolitanische Reiseerlebnisse. Grenzboten 1904. Nr. 48, 49, 50, 51. (Gekürzt.) Wir fuhren an dem ziemlich öden europäischen Ufer des Hellespontes dahin und näherten uns einem auf einer Klippe erbauten Leuchtturme und einem ziemlich wüst aussehenden, größtenteils aus Holzhäusern bestehenden Orte. Es war Gallipoli, die erste europäische Stadt, die den Osmanen in die Hände fiel. Gegenüber am asiatischen Ufer sahen wir undeutlich das im Altertume durch seinen zügellos-üppigen Priaposdienst übel berüchtigte Lampsakus. Und dann tat sich das weite blaue Marmarameer vor uns auf mit der gleichnamigen Felseninsel, die wir rechts liegen ließen.
An Bord des russischen Dampfers herrschte reges Leben. Allerhand Sprachen schwirrten uns um die Ohren. Ein Hoteldragoman aus Konstantinopel und zwei Wienerinnen, von denen die ältere als Köchin, die jüngere als Zofe im Harem des verstorbenen Ismail Pascha angestellt waren, verstanden und sprachen unser Deutsch. Sie erzählten, daß der ganze Harem, einige dreißig Türkinnen und Tscherkessinnen, mit an Bord seien, um den Sommer in Konstantinopel zu verleben, wo sie mehr Freiheit hätten als in Alexandria. Die türkischen Zwischendeckpassagiere schnürten ihre Bündel, die Familien gruppierten sich malerisch mit ihren Habseligkeiten und ihrem Vieh. Ein kleines Mädchen kämmte ein schönes weißes Schaf, drehte ihm zierliche Kopflöckchen zurecht und durchflocht die Wollensträhne mit roten Bändern: das arme Tier, das bald auf der Schlachtbank bluten sollte, wurde nach antiker Art als Opfer geschmückt.
Wir hatten das Marmarameer schon fast hinter uns. Rechts erhoben sich die bergigen Prinzeninseln, links erschienen die Häuser von San Stefano, wo die Russen 1878 der Türkei den Frieden aufzwangen, dann kam die Stelle, wo die alten Stadtmauern von Byzantium ans Meer stoßen und das verfallene Schloß der sieben Türme ragt, dann die Häuser und Gärten von Stambul und auf der Höhe Moscheen mit kühnen Kuppeln und spitzen Minaretten. Nun verengerte sich das Wasser, rechts glitten die Häuser und gelben Kasernen von Kadiköi und Skutari an uns vorbei, beleuchtet von der sinkenden Sonne. Links folgten die weiten grünen Gärten und die Paläste und Mauern des Serails, über denen sich ein weißer viereckiger Turm mit schrägem, schwarzem Dache erhob, der genau so aussah wie der Turm einer deutschen Dorfkirche. Jetzt bog das Schiff scharf nach links ein, fuhr um die Landspitze des Serails, und gleich darauf rasselten die Anker nieder.
In märchenhafter Schönheit lag das Goldene Horn da, blau von Farbe, und doch ein goldenes Füllhorn voll aller Güter des Morgen- und Abendlandes, die in den Schiffen und auf den Kais verstaut und aufgespeichert lagen. Eine lange Brücke spannte sich von Ufer zu Ufer, über die ein einziger ununterbrochener wimmelnder Strom von Menschen und Tieren dahinflutete. In der Ferne verdämmerte der schmaler werdende Meeresarm an grünen Hügeln. Die Höhenzüge, die dieses blaue Band auf beiden Seiten einschlossen, bedeckte ein schier unentwirrbares Straßen- und Häusermeer. Dazwischen grüne Gärten, dunkelragende Zypressen, mächtige runde Warttürme, schlanke, blendendweiße Minarette und großartige prunkvolle Kuppeln. Ja, eine Weltstadt lag vor uns, eine Prachtstadt, eine gottbegnadigte Zauber- und Märchenstadt! Die Sonne stand im Westen hinter ihr, so lag sie in schattenrißhaftem Dunkel da, während sich hinter uns am asiatischen Ufer ein reiches Farbenspiel entfaltete.
Das erste Boot, das an der Schiffstreppe anlegen durfte, brachte eine vornehme Türkin mit mehreren Begleiterinnen an Bord. Ein stattlicher Offizier erwartete sie, mit Tränen in den Augen küßte sie seine Hand, während aus seinen dunkeln Augen ein Strahl der Freude und Liebe herniederschoß: es gibt bei diesen Türken trotz aller Vielweiberei auch treue Sehnsucht und Gattenliebe. Nun enterten die »Hafenhyänen« an Bord, große Schilder an Mütze, Brust und Arm, ergriffen uns und unser Gepäck und ruderten an Land. Die Paßprüfung und die Kofferdurchsicht geht rasch von statten, wenn man geschickt einen »Beschlik« oder »Tscherek«besch = fünf, lik = Stück = Fünfpiasterstücke, etwa 90 Pfennige. Tscherek = ein Viertel, nämlich der 4. Teil eines Medschidië, eines Zwanzigpiasterstücks. in die krumme Hand des Zöllners gleiten läßt, für ein rechtliches deutsches Staatsbürgergemüt ein empörender Anblick – aber die türkische Anschauung ist anders. Draußen vor dem Zollschuppen ergriffen etliche Hamals (Lastträger) unser Gepäck, der Führer winkte einer ámaxa (Droschke), und fort ging die Reise durch die engen Straßen von Galata hinauf nach Pera in ein Hotel, das europäischen Ansprüchen genügt.
Das erste, was dem Fremden in Konstantinopel zu tun obliegt, ist die Besteigung des Galataturmes, der schon um 500 n. Chr. gebaut wurde, dann den in Galata ansässigen Genuesen als Mittelpunkt ihrer Befestigungen diente und jetzt die Feuerwache beherbergt, die durch Flaggen am Tage, durch Laternen in der Nacht den Ausbruch einer Feuersbrunst anzuzeigen hat. Auf dem zweiten, etwas eingerückten Stockwerke dieses Turmes ist man etwa 150 m über dem Meere und genießt durch vierzehn Bogenfenster die Rundsicht. Diese kann man höchstens der vom einstigen Markusturm in Venedig vergleichen: ein großartiges Städte- und Wasserbild, aber hier viel reicher und abwechslungsvoller. Vom Markusturm sah man weite Lagunen, flache gelbe Inseln, Kanäle und unmittelbar sich zu Füßen die Dächer der Stadt, hier dagegen werden die dreifach verzweigten Wasserflächen des Goldenen Horns, des Bosporus und des Marmarameeres umkränzt von langgezogenen Berg- und Hügelketten, an deren Hängen sich freundliche Ortschaften und Landhäuser, liebliche Gärten und ernste Friedhöfe hinziehen, während sich jenseit des blauen Meeresarmes Stambul in seiner ganzen Ausdehnung unseren Blicken darbietet – und zwar nicht tellerflach wie Venedig, sondern hügelansteigend. Über dieser riesigen, von grünen Baumoasen unterbrochenen Häuserwüste erheben sich Kuppeln und Minarette, Türme und Brücken, hinter ihr schimmert ein blauer Streif des Marmarameeres, und darüber am Horizonte verdämmern die Berge der Prinzeninseln und des asiatischen Festlandes.
Die Halbinsel, die der Serail mit seinen dunkeln Gärten, weißen Palästen und kuppelverzierten Landhäusern bedeckt, mit dem seltsamen Turme, der nicht ins Bild paßt, zieht wie eine Perle im Ringe immer wieder die Blicke auf sich.
Und welches Leben auf dem Grunde dieses Rundbildes: die engen Straßen von Galata, die beiden Brücken übers Goldene Horn wimmeln von Menschen und Tieren, die Wasserfläche des Goldenen Horns von Schiffen aller Art, vom kleinen Boot bis zum größten Handels- und Vergnügungsdampfer; an den Kais verlädt man die Erzeugnisse dreier Weltteile. Eine Stadt in solcher Lage und Begünstigung konnten alle Eroberungen und Ausplünderungen, alle Aufstände, alle Mißwirtschaft nicht zugrunde richten. Sie wartet des Tages, wo Europa die verlorene Tochter wieder zu sich nehmen wird. Dann wird sie erstrahlen wie ehedem unter Konstantin und Justinian.
Obwohl Pera die Europäer- und Fremdenstadt ist, obwohl es die Gesandtschaften und Konsulate, die Gast- und Trinkhäuser, die Warenhäuser, die Tingeltangel beherbergt, ist es doch halbasiatisch. Nur zwei Straßen genügen europäischen Ansprüchen, die am türkischen Friedhofe und dem Stadtpark entlang, die Hotelstraße, und die »Große Straße« von Pera, die auf der Wasserscheide zwischen Goldenem Horn und Bosporus hinführt. Im letzten Teile wird sie so schmal, daß sich kaum zwei Wagen ausweichen können, und hat auch keine Fußsteige mehr. Haufen von Müll und Unrat liegen auch hier, und die gelben Straßenhunde durchwühlen sie mit ihren Schnauzen. Sie liegen auch quer auf den Straßendämmen und verunreinigen die Straßen mehr, als sie durch ihr Fressen die Reinlichkeit fördern. Hier, wo jeden Morgen der Kehricht aufgeräumt und abgefahren wird, sind sie eine unnütze Landplage.Inzwischen ist eine große Anzahl dieser Straßenhunde auf eine einsame Insel des Marmarameeres gebracht worden. In den Türkenvierteln mögen sie nötiger sein. Auch die Häuser sind durchaus nicht alle europäisch. Da liegt zum Beispiel neben der deutschen Schule, in der Nähe des Klubs Teutonia und der schwedischen Gesandtschaft, ein wüstes Tekke, ein Kloster tanzender Derwische. Jeden Freitag kann man hier das Schauspiel der »Drehwische« haben, wie sie in weißen Jacken, faltigen Röcken, mit wagerecht ausgestreckten Armen, die rechte Hand nach oben, die linke nach unten geöffnet, mit seitwärts hängendem Kopfe und geschlossenen Augen sich wie die Kreisel um sich selber und dabei zugleich in einem Ringe drehen, bis sie ermattet von dieser Art Versenkung in Gottes kosmisches Walten niedersinken. Asiatischer Fanatismus und deutsches Wissen dicht nebeneinander!
Galata ist das schmutzige, liederliche Hafenviertel am Uferstrande. Man steigt entweder eine große Treppe hinab, das »steile Pflaster«, oder benutzt die unterirdische Drahtseilbahn oder vertraut sich der Bogenlinie der Pferdebahn an. Über die neue Brücke, die auf eisernen Pontons ruht, gelangen wir nach Stambul, gerade auf die Moschee der Sultanin Valide (= Witwe) zu. Man tut hier gut, ein wenig stehen zu bleiben und die Türken, Griechen, Levantiner, Armenier und die abenteuerlich gekleideten Innerasiaten an sich vorüberziehen zu lassen.
Sobald man jenseit des Goldenen Horns auf der Höhe des Seraskeriats, des Kriegsministeriums, steht, fühlt man sich in einer fremden Welt: krumme Straßen, schlecht oder gar nicht gepflastert, ein- oder zweistöckige Häuser meist aus Holz, zahlreiche, durch schräge Balken gestützte Erker, die Fenster sämtlich durch Holzgitter oder Rohrgeflecht geschlossen, braunrote, löchrichte Ziegeldächer, alles unregelmäßig, winklig, unberechenbar; kein Laden, kein Geschäft, und die Gassen stellenweise wie ausgestorben. Selten, daß die düstere Gestalt eines verhüllten, schwarz gekleideten Weibes an den Häusern entlang schleicht, oder daß ein finster blickender Turbanträger mit langem, dunkelm Gewande und steinernen Gesichtszügen unsere Wege kreuzt.
Wer Türkisch versteht, ein wenig Mut und einen Kompaß hat, kann sich heutzutage ruhig in diese unheimliche Stadt wagen, er wird überall Auskunft erhalten. Die Läden sind hier wie in den mittelalterlichen deutschen Städten in besonderen Gassen untergebracht. Vor den Häusern stehen dann lange Reihen von Holzbuden mit arbeitenden oder träumenden Handwerkern; dazwischen treibt sich müßiges oder kauflustiges Volk aller Art herum. An der Ecke steht eine Gruppe grün beturbanter Softas, während ein Imam oder Otja mit weißem Turban und schwarzem Talar, mit aufgespanntem Sonnenschirm durch die Menge reitet. Hunde gibt es überall.
Wir fragten uns eines Tages nach der Porzellanmoschee Rustem Pascha durch, die im Häusergewirr verborgen liegt. Sie führt ihren Namen davon, daß ihre Wände und Pfeiler von oben bis unten mit vorwiegend blauen und weißen Fayenceplatten ausgelegt sind. Kalter Glanz, steife Feierlichkeit erfüllt daher das Heiligtum, dem zudem alles Bildliche, Körperliche fehlt wie jeder Moschee. Durch stinkige Gassen ging's zum ägyptischen Basar, wo alle Würzen, Drogen und Farbstoffe der Welt von langbärtigen Türken verkauft werden. Mit seinem Wohlgeruch, seiner Buntheit ist er ein Bild aus der Zeit Harun-al-Raschids. Dann fuhren wir mit der Pferdebahn bis zum Eingang der »Hohen Pforte«, eines langen Gebäudes in italienischem Stile, das die Ministerien des Äußern und Innern enthält. Ein Posten wehrt den Zutritt.
Von der Moschee Laleli-Dschami drangen wir zur Prinzenmoschee, Moschee Schah-Sadé vor, einem hellen Kuppelbau mit 214 Fenstern. Ein ganzes Netz übereinander gebauter Kuppeln und Halbkuppeln, die auseinander herauszuwachsen scheinen, verleiht dem Gebäude, das Sinan, der größte Baumeister der Osmanen, im 16. Jahrhundert erbaute, Geschick und Leichtigkeit, während der Wechsel von roten und gelblichen Steinen Unruhe in den Eindruck trägt. In Riesenbuchstaben zieren Koransprüche auf blauen Schildern die Ecken und Pfeiler.
Wir fühlten uns matt und gingen in ein Kaffeehaus. Vor dem niedrigen Gebäude hockten unter zwei Platanen auf niedrigen Holzschemeln ein paar alte, schweigsame Langbärte, die Kaffeetäßchen in der Hand. Dem einen brachte ein bunt geschürzter Aufwärter gerade die Wasserpfeife, die Nargileh, während die übrigen aus dem Tschibuk »Tabak tranken«, wie der Türke sagt. Wir setzten uns in die enge Stube und schlürften bald das heiße, satzreiche, ungezuckerte Getränk, konnten aber der Wasserpfeife keinen Geschmack abgewinnen.
Die Moschee Mohammeds II., des Eroberers, ist ein Dschami, ein Versammlungshaus, im Gegensatz zu den Mesdschids oder Bethäusern, woraus »Moschee« gebildet ist. Es ist eine kleine Stadt; ein Hof mit Spitzbogengängen und einem Brunnenhaus tut sich auf; dahinter liegt das Gotteshaus mit den Kollegienhäusern und Studentenwohnungen, eine Volksschule, eine große Armenküche, ein Krankenhaus, eine Bücherei, ein Gasthaus, ein Bad. Auch ein Garten mit den »Turben« des Gründers und einiger Angehörigen gehört dazu, endlich noch ein Hinterhof. Viele Gläubige verbringen den ganzen geschlagenen Tag hier, Allah und der Padischah nähren und kleiden sie schon; sie waschen sich, beten, ruhen und schweigen. Sie kennen keine Skrupel und Zweifel, dienen einfältig nach der Väter Weise ihrem Gotte und wissen, daß ihnen einst, wenn Allah will, die ewigen Wonnen des Paradieses winken. Den Gegensatz zu unserem europäischen, faustischen Hasten und Streben kann man hier deutlich empfinden: hier herrscht Ruhe, Wohlbehagen und Glück – ihre Religion ist diesen Morgenländern Kern und Stern des Daseins.
Gleich bei der »Mehemedsche« fängt der zweistöckige Aquädukt des Kaisers Valens an, der noch heute Stambul mit Wasser versorgt. Die doppelte Reihe Rundbogen ist dicht überhangen von Gebüsch und Geranke und bietet als »Hochstraße« eine herrliche Aussicht. Eine Rast bei »Tokatlian«, dem einzigen europäisch eingerichteten Restaurant in Stambul, tut uns not. Klares Quellwasser kostet hier die Karaffe 1 Piaster = 18 Pfennige. Unter einem bläulich bemalten, vielgekuppelten Dache liegt hier auch der große Basar, wo jeder Händler einen als gute Beute zu kapern sucht, anschreit, sogar festhält. Noch ein Blick in einen »Han«, den Validéhan, das ist ein Kaufmannshof mit Speichern und Kontoren, Lastträgern und Ballen, Kisten, Säcken. In der Bajesidmoschee ist ständiger Markt wie dereinst im Tempel von Jerusalem. Man kann hier den vielen schwarzblauen Tauben, die nach einem Vermächtnis des Erbauers Bajesid II., des Sohnes des Eroberers, gehalten werden, Futter streuen. Sie umschwirren einen dann in dichten Geschwadern, daß einem schwindelt, dichter als auf dem Markusplatze in Venedig. Auch die »Suleimanje«, die eben jener Sinan erbaute, ist als schönste Moschee nächst der Agia Sophia sehenswert. Ihr Inneres glänzt durch gediegene Pracht, wie sie eines Soliman des Prächtigen würdig ist: mächtige Granitsäulen aus dem Palaste Justinians, Marmorverkrustungen, Glasmalereien, natürlich nur Arabesken und Teppichmuster, marmorne Predigtkanzeln, große Schmuckschriften, Riesenkronleuchter und eine Fülle von Glasampeln, die in den heiligen Nächten einen märchenhaften Glanz ausstrahlen müssen – dazwischen aber auch Straußeneier, Elfenbeinzähne und ähnlicher barbarischer Flitterkram. Hinter der Moschee auch hier in stillen Zypressen- und Platanengärten die achteckigen Turben, die Totenhäuser des Sultans und seiner Frauen und Kinder. In der Nähe liegt der Seraskerturm, der, wie der Galataturm, einen weiten Umblick bietet. Es war gegen Abend. Die Sonne stand noch hinter Wolken. Dann aber trat sie darunter hervor, und nun erstrahlte alles in purpurnem Märchenlicht: der blaue Bosporus, Skutari und die asiatischen Berge, das Goldene Horn, Pera, das weite Marmarameer und Stambuls Kuppeln, Türme und Paläste. Jedes Haus zeigte eine Lichtseite, jedes Fenster blinkte in rötlichem Glanze – nun hieß es: fort aus Stambul; denn nach Sonnenuntergang ist es keinem Franken zu raten, sich hier noch herumzutreiben.
Noch blieb uns das Wichtigste und Schönste zu beschauen übrig: der Serail, die Museen, die Sophienkirche.
Der Serail ist die alte Residenz der Sultane, jetzt der Ruhesitz alter Sultaninnen und Palastdiener. Durchs Kaisertor, an dem in alten kräftigen Zeiten die Köpfe hingerichteter Paschas steckten, gelangt man durch einen Hof zum Orta Kapu, dem mitteln Tore, einem tiefen, zinnenbesetzten, von zwei weißen Türmen mit schwarzen Spitzdächern flankierten Gebäude – weiter darf der Fremde für gewöhnlich nicht. Es folgt ein zweiter Hof, ein drittes Tor, dann kommen die Laubengänge, Rosen- und Tulpenbeete der Serailgärten, die jetzt durch die Eisenbahn entweiht sind – die Prunkgebäude und Säle mit ihren Schätzen, aber auch das Tor, durch das die Leichen heimlich Gerichteter ins Meer geworfen wurden, die Seufzerkammern, in denen unbequeme Halbbrüder oder andere Verwandte des regierenden Herrn für immer verschwanden, die Stelle, wo die schönen Frauen, deren der launische Eheherr überdrüssig geworden war, in Säcke genäht hinabgerollt wurden in die verschwiegene Flut. Unerhörte Pracht – und unerhörte Greuel!
Die kaiserlichen Museen, das alte mit seinen griechisch-römischen, byzantinischen, cyprischen und semitischen Altertümern, auch etlichen der von Schliemann in Troja ausgegrabenen Schmucksachen, und das neue mit den sidonischen Steinsarkophagen, darunter dem weltbekannten Alexandersarg, sind die hervorragendsten geschichtlichen Sammlungen des Morgenlandes.
Und nun zur Agia Sophia! Sie läßt sich nur mit St. Peter in Rom vergleichen – und auch hier fällt der Vergleich zugunsten Konstantinopels aus. Die Sophia ist im Innern zweistöckig – und erscheint deshalb groß auf den ersten Blick: dazu das mäßige Kleinwerk, das feine Gleichmaß aller Teile, die ungezwungene Einfachheit der Anlage, die heitere Pracht und ernste Würde – alles zeichnet die Kirche Justinians vor der Julius II. aus. Die ursprüngliche äußere Gestalt ist freilich kaum noch erkennbar: Schon die Byzantiner mußten gegen die Einsturzgefahr nach Erdbeben Stützbauten ansetzen, die Schönheit des Innenraums galt ihnen als das Höchste und Wertvollste. Der Islam hat die Außenseite weiter durch angebaute Schulen, Turben, Küchen, die schlanken lanzenartigen Minarette, den Halbmond auf der Kuppel, den gelb- und rotgestreiften Putz stark verändert. Aber das Innere ist überwältigend schön geblieben: die große Kuppel scheint zu schweben; eine Fülle von kleinen Kuppeln und Halbkuppeln umgibt sie wie Trabanten; Nischen, Gewölbe, Säulengänge gewähren überraschende Durchblicke; eine Fülle von Licht strömt herein; die Pracht des glänzenden Marmors und der Mosaiken – all das bringt eine traumhafte Wirkung auf den hervor, der dies Heiligtum betritt. Dabei ist vieles Christliche übertüncht, und über die Gestalten der Propheten und Apostel sind grüne Schilde gehangen mit den goldenen Namen Allahs und seines Propheten. Die Gebetsnische mußte nach Mekka gerichtet sein, deshalb steht sie nicht in der alten Apsis, wo der Hochaltar stand, sondern seitwärts – ein künstlerischer Widersinn! Von Marmorbrüstungen und von einer Kanzel herab preist der »Chatib«, der Prediger, mit blankem Schwerte in der Hand den Sieg des Islams. Wie lange noch? Die Agia Sophia ist das Urbild aller griechischen Kirchen und aller Moscheen des mohammedanischen Ostens: »der schönste Innenbau der Welt«. (Gurlitt.)
Vor der benachbarten Achmedmoschee dehnt sich der verwahrloste Roßplatz, der Atmeidan, aus, einst der Hippodrom, der als Versammlungsplatz viel Kampf und Blut gesehen hat. Ein gemauerter byzantinischer und ein monolithischer Granitobelisk aus Ägypten und die bronzene Schlangensäule, auf der die Griechen einst den goldenen Dreifuß zu Ehren des Sieges von Platää aufgestellt hatten, stehen aus alter Zeit da, aus jüngster Zeit aber der Brunnen Wilhelms II., ein achtsäuliger Kuppelbau mit Rundbogen, Mosaiken und großem Sternzierat. Die Zeiten haben sich gewandelt; wir Deutsche sind »gut Freund« mit denen, gegen deren List und Mord Luther im Liede die Hilfe des Himmels anrief.
Vom »Schloß der sieben Türme«, türkisch Jedi-Kule, mit seinen verfallenen Zinnen, aus denen wilder Lorbeer sproßt, zieht sich die alte Stadtmauer, die Kaiser Theodosius erbaute, vom Marmarameere zum Goldenen Horn. Aber Stambul füllt das Gewand, das der Kaiser ihr einst angemessen, nicht mehr aus. Die Häuser reichen nicht bis an die Mauer heran, sondern Obst- und Gemüsegärten bilden einen breiten grünen Streifen hinter dem altersgrauen Steinring. Diese Mauer mit ihrem niederen äußeren und hohen inneren Ring läuft wie eine steinerne Riesenschlange hügelauf und hügelab. Der Graben ist halb verschüttet, dunkler Efeu und allerhand Gestrüpp spinnt sich um die alten Türme. Am Kanonentore fiel 1453 der letzte byzantinische Kaiser Konstantin XI. im Kampfe wider die anstürmenden Janitscharen. Der letzte Teil der Mauer vom Tekfurserail ab ist von Heraldios 200 Jahre später um das Blachernenviertel hoch und fest, aber ohne Graben und Außenring gezogen worden. Die gut erhaltenen Türme sind von dichten Efeuschleiern bedeckt, und freundliche Gartenhäuschen mit grün gestrichenen Läden schauen von ihren Zinnen auf die Gärten und Obstpflanzungen nieder wie der Zaunkönig aus dem Gefieder des Adlers.
Am Ende der Mauer liegt am Goldenen Horn der heiligste europäische Ort der Moslim, Ejub. Viele lassen sich dort begraben, und der Friedhof mit seinen schlanken Zypressen und duftenden Sträuchern, mit den schmalen hohen Steinen, die auf rotem Grunde goldene Arabesken und Schriftzeichen haben, mit Muschelzier versehen sind, wenn eine Frau, mit Turban oder Fes, wenn ein Mann dort ruht, gewährt mit seinem Weiß und Grün einen schönen Anblick. Ejub oder Hiob hieß der Fahnenträger des Propheten, der hier 672 beim ersten Ansturm des Islams auf Europas Ostpforte fiel; er liegt in einer prächtigen Moschee begraben, in die kein Fremdling eintreten darf.
Am Nordende des Goldenen Horns, wo im Tal von Kiathane die »süßen Wasser von Europa« münden, versammelt sich an jedem Freitag auf den saftigen Wiesen unter den Bäumen die türkische Welt. Da lagern Männer und Frauen und Kinder auf Strohmatten und Teppichen, naschen Süßigkeiten, schlürfen kühlende Getränke, rauchen Zigaretten. Die vornehmen Haremsdamen fahren in ihren Kaleschen einen langsamen Korso; Taschenspieler, Tänzerinnen zeigen ihre Künste; harmlose Fröhlichkeit herrscht überall, niemals wüster Lärm oder Trunkenheit. Vor Sonnenuntergang muß die Lust zu Ende, die Frau daheim sein, so gebietet der Prophet.
Sein Stellvertreter, der Padischah, wohnt im Yildis-Kiosk, das heißt Sternenpalast inmitten eines großen Parkes am Bosporus, der mit seinen alten gewaltigen Trutzschlössern auf den zypressen- und platanenbewachsenen Hängen, mit seinen modernen Palästen und Lusthäusern und seiner allerdings bis über 2 km breiten Wassergasse an den Rhein zwischen Bingen und Koblenz erinnert in seiner Eigenart. Vor dem Tore des Palastes zeigt sich jeden Freitag zum »Selamlik« der Sultan seinem Volke, indem er unter militärischem Pompe zu einer gottesdienstlichen Feier in eine nahe erbaute Moschee fährt. Padischahim tschôk jaschâ, lang lebe der Padischah! schallt es dann unter Fanfaren aus tausend Kehlen, und der Sultan-Kalif, der Oberhirt aller Gläubigen, verschwindet bald darauf wieder in dem engen Bezirk, in dem ihn das Mißtrauen vor Anschlägen auf sein Leben und seine Macht gefangen hält.