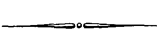|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Am 4. August 1870 war Berlin in furchtbarer Aufregung. Nicht eben weil wir just angekommen waren. Man erwartete Nachricht vom Kriegsschauplatz. Die Heere waren bei Weißenburg gegeneinander gerückt, die Schlacht war im Gange. Auch uns hatte das Fieber der Erwartung schon im Zuge gepackt. Wir fuhren vom Bahnhof direkt in die Markgrafenstraße 77, wo unsere mir noch unbekannte Wohnung lag, und wurden vom Hausmädchen freundlich in Empfang genommen. Wir fanden zwei Vorder- und zwei Hinterzimmer nebst Küche vor, ohne weiteren Zubehör (Berlin war damals noch nicht einmal kanalisiert), nicht unelegant aber bescheiden meubliert. Nur vor einem Riesenbett, das im sogenannten »Berliner Zimmer« stand, erschrak ich, in dem Mama und ich vorläufig zusammen schlafen mußten, das erst nach acht Tagen abgeholt wurde, um meinen eigenen Betten Platz zu machen.
Es war wohl 7 Uhr abends, als wir ein wenig umgekleidet, auf die Straße, den Linden zustürzten, wohin, wie wir sahen, alles drängte. Man rief Extrablätter aus; alles lief und schrie durcheinander. Gruppen hatten sich gebildet, in deren Mitte die Depeschen, d. h. der Sieg unsrer deutschen Truppen, laut vorgelesen wurden. Hier wurde »hurrah« geschrien, dort weinte man laut vor Freude; und wir beiden eben »Hereingeschneiten« weinten mit den uns gänzlich fremden Menschen. – Man zog mit Hurrahgeschrei vor des Königs Palais. Enthusiasmus und Menschengewühl nahmen immer größere Dimensionen an. Ungewohnt solcher Szenen suchten wir voller Angst einen Ausweg nach irgendeiner Nebenstraße zu gewinnen, wo wir einem Leipziger Bekannten in die Arme rannten, der sich sofort zu unserm Führer und Beschützer aufwarf. Ich weiß heute nicht einmal mehr, wer es gewesen, weiß nur, daß wir zusammen aßen und um 10 Uhr vor verschlossenen Türen standen. Unser Haustor hatte keine Klingel; alles Rufen, Fragen, Suchen war umsonst, wir waren einfach ausgesperrt. Wohl oder übel mußten wir uns zu einem Nachtquartier im Hotel entschließen und fuhren nach Schmelzer, wo wir ein gutes Zimmer und erhoffte Ruhe fanden nach dem so ereignisreichen Tage.
Am frühen Morgen wurden wir sehr unliebsam aus unsern Träumen durch Gesang geweckt, der ganz in unserer Nähe erscholl und uns geradezu empörte. Als wir beim Fortgehen den Korridor überschritten, mußten wir am Zimmer des betreffenden Sängers, dessen Tür halb offen stand, vorüber. Über drei Stühlen ausgestreckt, lag ein Riesenmensch im Nachtgewand, der Atem- und Tonstudien machte. Ein einziger Blick genügte, mich den verrückten Zottmeyer erkennen zu lassen. Vorsichtig, lautlos, schlichen wir ungesehen vorbei. Zu Hause angekommen, belehrte uns das Mädchen, daß man in Berlin nicht ohne Hausschlüssel ausgehen dürfe, da ein Portier nicht vorhanden und man höchstens auf die Gnade des Nachtwächters angewiesen sei, der, wenn man sich legitimieren könne, einem das Haustor öffne.
Generalintendant von Hülsen hatte mich – gleichviel ob ich meines Kontraktes in Leipzig enthoben würde oder nicht – für die Partie der Vielka in Meyerbeers Oper »Ein Feldlager in Schlesien« fest engagiert, die am 4. August zur Enthüllungsfeier des Reiterstandbildes Friedrich Wilhelms III. im Lustgarten stattfinden sollte. Die Oper ist für Berlin direkt komponiert, während sie unter dem Titel »Der Nordstern«, mit Veränderung von Personen und einzelner Musikstücke, viel über andere Bühnen gegangen war. Mir war sie unbekannt. Man hatte mir seinerzeit nur eine geschriebene, mit Baß unterlegte Partie der Vielka nach Leipzig geschickt, woraus ich – unbekannt alles anderen – die Oper lernen mußte. Eine merkwürdige Zumutung. Wirklich schwierig war die große Arie im letzten Akt, die mit abwechselnder Begleitung zweier Flöten eine einzige große Kadenz bildet, und sehr oft als Bravourstück von Koloratursängerinnen in Konzerten gesungen wurde. Der Ausbruch des Krieges hatte dem Plan der Enthüllungsfeier natürlich ein Ende gemacht.
Noch ehe die Spielzeit an der Kgl. Oper begann, bereitete ich alles zum Antritt meiner neuen Stellung vor. In Leipzig war ich bei keinem Kritiker gewesen, konnte mich nicht dazu entschließen, weil ich selbst diesen Akt der Courtoisie als eine Art von Bettelei ansah, welche ich unter der Würde der Kunst und des Kunstkritikers hielt. Zu meinem eigenen Schaden, wie ich gleich hinzufügen will, denn andere sehen es von einer andern Seite an. An Prof. Gust. Engel, der Danziger war, hatte ich von Danzig aus Empfehlungen, die ich abgeben mußte. Prof. Heinrich Dorn war ein uralter Bekannter meiner Mutter aus Königsberg und Riga, zu dem mußte ich gehen. Blieb noch Prof. Würst, den ich erst gelegentlich der Proben zu seiner Oper kennen lernte, in welcher Betz und ich sehr reizende Rollen sangen. Als ich einmal mit ihm über eine Sängerin plauderte, die er stets in den Himmel hob, die aber einen furchtbaren »Knödel« hatte, über den sich jeder mokierte, und ich ihn frug, warum er solche Unart niemals rüge, antwortete er mir: »Das höre ich gar nicht.« Keiner der drei Herren, denen ich vor meinem Gastspiel Besuche abstattete, interessierte sich auch nur im allergeringsten für mich.
Für Ausbeutung von Vorteilen im Interesse des »Gelobtwerdens«, wie es so vielen Künstlern eigen, hatte ich weder Talent noch Verlogenheit. Wer mein Streben und Können verstand, sollte mich gerecht beurteilen, das war alles, was ich als Künstlerin von der Kritik beanspruchte. Mich mit Nichtskönnern zusammen gelobt zu finden, ekelte mich an.
Nein! Gebettelt habe ich nie, bin nie gekrochen vor Kritik und Protektion. Stolz bin ich meinen eigenen Weg gegangen, den Weg des Wollens, Wissens und Könnens im Einklang mit meinem Streben und meinen Kräften. Dank meiner Erziehung, meinem Talent und Fleiß konnte ich ihn mit wachsender Autorität beschreiten. Schnell erfaßte ich, was der Kunst frommte, lernte gern von allen mit dem festen Vorsatz, die größtmöglichste Vollkommenheit der Künstlerschaft zu erreichen.
Hier, vielleicht nur an dieser Stelle darf ich das spätere Urteil eines uns teueren Mannes setzen, das erst gegen das Ende meiner Karriere von ihm gefällt ward. – Mag es hier zur Rechtfertigung meiner frühesten Empfindungen dienen und zur Bekräftigung des Urteils aller derjenigen beitragen, die mich lieb haben, mein künstlerisches Wachstum freudig, ja oft mit Genugtuung begrüßten. Eitel wird es nur solchen erscheinen, die mich nicht kennen, nicht lieben; und diesen werde ich ohnehin nichts zu sagen haben.
Dr. Ernst von Wildenbruch.
Berlin W. 10. 17. März 1905
Hohenzollernstraße 14 (abends).
Herrliche Frau
aus dem Carmen Sylva-Abend nach Haus zurückgekehrt, empfinde ich es als Bedürfnis und Pflicht, Ihnen, hohe Künstlerin, die ich Jahre und Jahre nicht mehr gehört hatte (ich gehe nur selten noch des Abends aus) zu sagen, wie groß, wie ganz wundervoll Ihr Gesang, Ihr Vortrag, Ihre ganze Persönlichkeit, Ihr alles auf mich gewirkt hat! »Da kommt endlich mal wieder Eine,« sagte ich mir, als Sie an den Flügel traten, »die nicht beim Publikum bettelt, sondern ihm gebietet! Da kommt Eine,« sagte ich mir, als Sie zu singen anhuben, »die mit ihrer letzten Seelenfaser mit ihrer Aufgabe verwachsen ist.« »Da habe ich endlich wieder mal,« sagte ich mir, als Sie geendigt hatten, »den aus einer Rasse-Persönlichkeit heraustönenden großen Stil genossen.«
Immer, so lange Sie singen, haben Sie uns viel gegeben – jetzt, da Sie wie die marmorne Verkörperung der klassischen Tradition unter den kleinen Gestalten der modernen Zeit stehen, geben Sie uns noch mehr, geben Sie uns Ihr Höchstes.
Daß ich Ihnen danke für das, was Sie mir heute gegeben haben, das erlauben Sie, herrliche Frau, Ihrem
Ernst von Wildenbruch.
Unaufhörlich folgte Sieg auf Sieg, und diesem wieder Siegeslieder und Spiele im Kgl. Opernhause. Am 17. August, dem Eröffnungsabend der Saison, sangen sämtliche Mitglieder der Kgl. Theater – zu denen ich nun auch zählte – feierlich von der Bühne herab die Volkshymne und den »Borussiachor«. Die Damen in weißen Kleidern mit schwarzen Schärpen, die Herren im Frack mit weißer Halsbinde. Wir sangen begeistert im Vollgefühl des geretteten Vaterlandes zur Ehre unserer braven Krieger. Diese Veranstaltungen wiederholten sich nur gar zu oft, um dauerndes Interesse einflößen zu können.
Am Morgen dieses meines ersten Auftretens hatte ich auch die erste und letzte Probe vom »Feldlager«, das am nächsten Abend schon in Szene ging und zu meinem größten Leide während der Kriegszeit und später auch bei jeder patriotischen Gelegenheit viel gegeben wurde. Die nichtssagende Partie der Vielka, die durch schlechte Nebenbesetzung nicht interessanter wurde, verlor bald ganz meine Sympathie und wurde mir auf die Dauer unerträglich. Wenige Tage später sagte in einer patriotischen Vorstellung Frau von Voggenhuber ab, welche ein eigens zu diesem Zwecke komponiertes Lied singen sollte. Es war ½7 Uhr abends, als Kapellmeister Radecke, der Komponist des Liedes, zu mir kam, um mich im Aufträge der Intendanz um die Gefälligkeit zu bitten, das Lied zu singen. Wenn ich mich auch lange weigerte, fuhr ich doch schließlich mit ihm ins Theater, wurde schnell angekleidet und sang es prima vista ohne Fehler von den Noten herunter. Tags darauf sagte sie auch die Agathe im Freischütz ab, und ohne die Rolle je gesungen zu haben, sprang ich abermals ein. Von der Zeit an sprang ich gar oft bald für sie, Frau Mallinger oder Frau Lucca ein, die beide miteinander im Hader lagen. Auf diese Art war ich in Berlin sehr bald eine utilité ersten Ranges; für meine autoritative Stellung war dies aber nicht vorteilhaft, und bald empfand ich – die Zurücksetzung. Man hatte sich daran gewöhnt, jederzeit auf mich bauen zu können, und verfuhr demgemäß oft sehr rücksichtslos gegen mich, indem man alle diejenigen berücksichtigte, die rücksichtslos gegen die Intendanz verfuhren. Doch muß ich Herrn von Hülsen die Gerechtigkeit widerfahren lassen und sagen, daß er meine Gefälligkeit extra honorierte und mir bereitwilligst alle erbetenen Urlaube gewährte, deren ich sehr viele beanspruchte, da ich außerhalb in vielen Konzerten sang, viel unterwegs war. Auch gegen Minderhochgestellte war er voller Fürsorge und half, so oft er nur konnte. Man durfte ihn allenthalben als väterlichen Freund betrachten.
An Beschäftigung fehlte es mir wahrlich nicht, denn zu den oft gesungenen alten Rollen kamen in den ersten zehn Monaten meines Engagements noch folgende neue hinzu: Vielka – Feldlager, Josephs – Zietenhusaren, Elvira – Stumme, Amazilli – Jessonda, Fridjof – Sigurd, Friede – Heimkehr.
Als Mitglieder der Kgl. Oper fand ich folgende Künstler vor:
Pauline Lucca, verwöhnt, schön und interessant. Schon bei meinem Antrittsbesuche sagte sie uns, daß sie 1872 bestimmt nach Amerika ginge, und wenn sie keinen Urlaub erhielte, durchzugehen beabsichtige.
Mathilde Mallinger, ein sehr starkes Bühnentalent, am Prager Konservatorium ausgebildet. Sie war eben von München gekommen, hatte stimmlich aber nach nur zweijähriger Tätigkeit schon schwer gelitten.
Wilma von Voggenhuber, eine sehr temperamentvolle dramatische Sängerin mit wunderschönem Mezzosopran, die nur leider – wie mir ein Musiker sagte – heute die Rolle spielte, die sie gestern gesungen hatte.
Marianne Brandt, Altistin, eine selten begabte, ernste Künstlerin.
Frau Harries-Wippern, die jungfräulichste Stimme, die ich je gehört habe. Sie war einst sehr gefeiert, und nur ungern sahen wir sie bald aus unserer Mitte scheiden, da sie krankheitshalber sich sehr früh schon pensionieren ließ.
Charlotte Grossi, eine hübsche, junge Wienerin mit recht hübscher Stimme und leidlich guter Koloratur. Protektionskind der Lucca, blutjunge Anfängerin, die aber seit einem Jahre schon engagiert, sich in manche Rolle und viel Arroganz hineingewachsen hatte, da das Fach der Koloratursängerin verwaist gewesen. Die Königin der Nacht z. B. wurde viele Jahre hindurch von einer Schauspielerin gesprochen!
Louise Horina, Sängerin für alles.
Marie Gey, Opernalte.
Unser führender Geist, nach dem sich alles richtete, war Albert Niemann. Wenn ich auch sagen muß, daß ich mich an seine Stimme gewöhnen mußte, weil er sich immer erst im Laufe einer Oper freisang, so imponierte seine künstlerische Autorität sofort der Lernenden. Die geistige Auffassung, sein einzig überzeugender Ausdruck, gaben ihm immer größeren Wert in meinen Augen, je mehr ich die Hohlheit und Unzulänglichkeit anderer Sänger dagegen erkennen lernte. Hier waren Genie, Kraft und vollendete Künstlerschaft mit Autorität verbunden. Man wurde nicht geblendet, sondern überzeugt. Von da an wurde Niemann mein Maßstab für den singenden Künstler, das – wenn auch nicht alleinige – Vorbild meines Strebens.
Neben ihm stand der männliche, etwas steife, sich eben zum Meistersinger entfaltende
Franz Betz und
August Fricke, unser nobler Baß, der nebst allen ernsten, auch köstlich humoristische Rollen schuf.
Anton Woworsky, unser feinster Kollege, der seiner frühen Pensionierung entgegen harrte.
Otto Schelper, dem es in Berlin nicht behagte, und den man leider ziehen ließ.
Heinrich Salomon, Baßbuffo, sehr feiner Schauspieler, von dem sein zukünftiger Schwiegervater – als er ihn im Don Juan sah – behauptete, daß er nie ein Don Juan gewesen sei, und ihm blindlings seine Tochter anvertraute.
Mehrere Herren für kleinere Rollen, und daß ichs nicht vergesse:
Krüger (Pseudonym), der »Schmalzamor« genannte Tenorbuffo.
Ferner die drei Kapellmeister:
W. Taubert, dirigierte fast ausschließlich Hofkonzerte oder seine sehr schönen Opern »Macbeth« und »Cesario«.
Carl Eckert, alle großen Werke.
Robert Radecke, alle Spielopern.
Mit dem hier genannten Personal, das bei Abgang eines Mitgliedes durch ein anderes komplettiert wurde, gab man – bis auf 2-4 Ballette monatlich – tagtäglich Opern, und nur sehr selten kam es vor, daß eine Oper abgesetzt und eine andere dafür gegeben wurde. Heute ist das Personal zehnmal so groß und der Absagen zehnmal so viele als damals. Für Woworsky trat nach ungefähr zwei Jahren der liebenswürdige Heinrich Ernst in das Fach des lyrischen Tenors und William Müller, der neben Niemann, oder wenn dieser beurlaubt war, Heldenrollen sang. Für Schelper kam Theodor Schmidt, und alle drei kamen – gleich den Schauspielern Richard Kahle und Georg Krause – von Leipzig. Nur wenige Mitglieder von bleibendem Wert traten im Laufe der nächsten 15 Jahre hinzu, unter denen Franz Krolop, Baß, hervorzuheben wäre.
Wenn ich bei manch einem Künstler ein wenig verweile, dessen sich, wie ich bestimmt annehmen darf, nur wenige auch nur dem Namen nach zu erinnern vermögen, so meine ich damit einer angenehmen Pflicht zu genügen, indem ich deren besonders guten Eigenschaften hervorhebe, die sie berechtigten, als Künstler bekannt und beliebt zu werden. Eigenschaften von besonderem Wert, die außer ihnen kein anderer Künstler besaß, die als schöne Erinnerung in mir weiterleben und meines Dankes darum nicht entbehren dürfen.
Als Gäste durften wir alljährlich in der Oper sowohl als im Schauspiel viele künstlerische Größen bewundern, die dem Repertoire Abwechslung und frisches Interesse zuführten, was mir anregende Arbeit bot, an der es mir freilich nie und nirgends fehlte.
Eines Tages teilte mir Hülsen mit, daß mein Kontrakt im Hauptquartier Ferrières vom König unterzeichnet sei, worauf ich – gewiß ganz törichterweise – nicht wenig stolz war. Nach dem Einzug der Truppen, dem wir mit Freunden aus einem Hause unter den Linden beiwohnten, lernte ich auch unsern herrlichen Kaiser Wilhelm I. persönlich kennen. Er unterhielt sich oft mit mir in Hofkonzerten sowohl als in der Oper, die er fast allabendlich besuchte. Damals gab es für die am Abend beschäftigten Solomitglieder eine kleine Bühnenloge im ersten Stock, wo sie, ungesehen vom Publikum, der Vorstellung folgen konnten. Parallel mit der dahin führenden Treppe lief eine ebensolche von der Bühne in die kaiserliche Proszeniumsloge, nur durch eine Bretterwand von der andern getrennt, die Se. Majestät auf die Bühne führte. Auf ¾ Höhe befand sich ein kleines Schiebefenster, das der Kaiser und andere Mitglieder der Kaiserlichen Familie benutzten, um in den Zwischenakten mit den Künstlern zu sprechen. Hier sprach ich ihn fast allabendlich in den Opern, in denen ich beschäftigt war, und hier hat er mir manches Interessante erzählt. Warum habe ich nicht damals schon alles so genau aufgeschrieben, wie jetzt? Manch ein liebes Wort ist dadurch dem Gedächtnis verloren gegangen, das von seiner unendlichen Güte, Liebenswürdigkeit, Einfachheit und Würde ein Zeugnis gäbe. Doch bleibt genug noch übrig, um mich stets aufs Neue zu mahnen, wie dankbar ich ihm sein muß für alle mir erwiesene Güte.
Nach dem schrecklichen Attentat, wobei er verwundet ward, an dessen Folgen er lange zu leiden hatte, kam er einmal wieder an das Fensterchen auf der Bühne und reichte mir gütig, wie immer, die Hand. Als ich mich gerührt nach seinem Befinden erkundigte und ihm mein tiefinnerliches Beileid aussprach, sagte er: »Es geht noch immer nicht, wie es sein sollte, denn ich bin noch nicht imstande, mir die Stiefel allein anzuziehen.« Nun mußte ich lachen und meinte: »Das brauchen aber Ew. Majestät auch nicht!« »Ach ja«, erwiderte der Kaiser, »ich bin gewöhnt, alles alleine zu tun, es macht mich unglücklich, daran gehindert zu sein. Auf Reisen packe ich meine Sachen selbst, damit nichts von dem mir Notwendigen fehle, und in alle dem bin ich jetzt geniert.« Als wir einst von einer Kunstausstellung sprachen und ich frug, welches seiner Bilder der Kaiser für am gelungensten hielt, antwortete er mir: »das von Lenbach, da es Ihre Majestät am schönsten findet.« Immer galant, der erste Kavalier. Rührend war's, wie einst in einem Hofkonzert im runden Saale, wo wir Künstlerinnen mitten im Saale saßen, Frau Artôt ihr Taschentuch beim Aufstehen fallen ließ. Ich bückte mich sofort, um es aufzuheben, aber auch der Kaiser war schon aufgesprungen und herbeigeeilt um dasselbe zu tun.
Noch kurz ehe ich Berlin verließ, erzählte er mir, wie er sich sehr wohl meines ersten Auftretens erinnere und wie ihm in den Hugenotten beim Auf- und Absteigen vom Pferde mein »schöner schlanker Fuß« aufgefallen sei. Hier durfte ich Sr. Majestät gleich erzählen, daß ich bei meinem Gastspiel noch gar nicht reiten konnte, sondern nach der Probe in den Kgl. Marstall geschickt worden war, um mir dort die Kunst des Auf- und Absteigens vom Pferde, das Halten der Zügel usw. anzueignen – da die Königin im III. Akt in Berlin zu Pferde kommt, auf der Bühne absteigen und nochmals um die Bühne herumreiten mußte. Daß ich in Leipzig es aber ordentlich gelernt hätte und dort sowohl als in Berlin öfter ausgeritten sei.
Ein kleines Abenteuer, das ich Sr. Majestät zum besten gab, machte ihm Spaß. Aus den Meistersingern war ich einmal allein nach Hause gegangen und unterwegs von einem Herrn angesprochen worden, den weder meine stolzen Blicke, noch mein beharrliches Schweigen abschrecken konnten. Kaum noch 200 Schritte vom Hause entfernt, entschloß ich mich, irgendeinen des Weges kommenden Herrn anzusprechen, der mich beschützen sollte. Der erste beste schien ein Bahnbeamter, auf den ich zueilte. Als ich ihn bat mir die wenigen Schritte bis zu meinem Hause das Geleit zu geben, was er zu tun sofort bereit war, stellte er sich mir als Leutnant der Artillerie v. S. vor, in dessen Schutz ich nun vor weiterer Verfolgung sicher war. Wie ich dem Kaiser die Galanterie seiner Offiziere lobte, erwiderte er mir rührend: »Das hätte ich auch getan, schade, daß ich es nicht gewesen bin.«
Manches Mal erzählte ich auch hübsche Anekdoten, die über ihn im Umlauf waren. Bei Geheimrat Henry traf ich sehr oft den Leibarzt des Kaisers, Dr. Lauer. Man erzählte sich, daß S. M. eines Abends Hummersalat aß und Lauer, der es ihm streng verboten hatte, ihn dabei überraschte. Lauer machte dem Kaiser ein vorwurfsvolles Gesicht, worauf dieser ihm heiter zugerufen hätte: »Lieber Lauer, seit ich versprochen habe, Sie zur Exzellenz zu machen, wenn ich 80 Jahre alt werde, gönnen Sie mir keinen guten Bissen mehr.« Der Kaiser lachte herzlich dazu und meinte: se non é vero è ben trovato. Exzellenz ist Dr. Lauer aber dann doch geworden.
Nicht selten sah man den Kaiser in den Zwischenakten im Vorzimmer seiner Loge arbeiten, wenn zufällig die Türe aufgemacht wurde. Er sagte mir, daß er sonst nicht fertig würde mit der Arbeit. In der kleinen Proszeniumsloge saß er immer ungesehen auf dem Rücksitz; nur wenn die Kaiserin oder die Frau Großherzogin von Baden, seine Tochter, mit ihm im Theater waren, saß er bei den Damen auf dem Vordersitz zunächst der Bühne. Aber ich zweifle, daß er sich dann so behaglich fühlte. In späteren Jahren schlief er oft während der Musik – wenigstens glaubten wir es von unserer Theaterloge vis-à-vis zu bemerken.
Seine Lieblingsopern waren: »Die weiße Frau«, »Das goldene Kreuz«, »Der Barbier von Sevilla« und sonstige Spielopern und Ballets, in denen er nur aus besonders wichtigen Gründen fehlte. Wie oft traten mir Tränen tiefster Rührung in die Augen, wenn ich mit ihm sprach. Wie schön wußte er das Interesse für jeden so auszudrücken, daß man glauben mußte, es interessiere ihn wirklich, was man mache und denke, und stets wartete er die Antwort ab, was so wenig Große zu tun verstehen.
Wie merkwürdig verschieden war er darin von der Kaiserin. Eine der pflichttreuesten und fleißigsten Frauen auf dem Throne, die es sicher nicht leicht hatte und es sich nicht leicht machte. Fast immer wurde ihre beste Absicht mißverstanden von denen, die sie ansprach, denen sie sich näherte. Man kannte sie nicht so genau wie den Kaiser, der die Offenheit selber war, der durch das Gefühl schönster Herzlichkeit erquickte und beglückte, was der Kaiserin in diesem Maße zu fehlen schien. Aber ich weiß, wie streng sie es mit ihren Pflichten, als Mutter des Volkes, nahm, wie treu sie die Ziele für dessen Wohlfahrt verfolgte, und wie weder Krankheit noch Alter sie daran verhinderten, sich ihnen ganz zu widmen.
Während der Jahre 1871-1872 wurden unendlich viel Wohltätigkeitskonzerte von Berufenen und Unberufenen – die sich »oben« lieb Kind machen wollten – arrangiert, die daraufhin oft genug auch dekoriert wurden. Es ist nicht zu hoch gegriffen, wenn ich sage, daß Marianne Brandt, die ewig Wohltätige und Gutmütige, und ich, in mindestens 25 Konzerten zum Besten der Krieger und ihrer Hinterbliebenen sangen. Nach einem dieser Konzerte, dessen Protektorin die Kaiserin war, erhielt ich ein Dankschreiben mit eigener Unterschrift, das ich als Andenken an die hohe Frau bewahre.
Mir ist der Gedanke stets unerträglich gewesen, mich für eine Wohltat, die ich so gern erwies, belohnen zu lassen; man kennt mich auch genug, um mir zu glauben, daß ich nicht daran dachte, mir eine Dekoration dafür zu erringen. Da aber so viele »Charpiezupfende« und »Leibbindennähende« – die auch noch in so feinfühlender Weise »auf Wiedersehen« hineingestickt hatten – hohe Dekorationen erhielten, so frage ich wohl nicht unberechtigt: wie es kam, daß Künstler, die in so reichem Maße selbstlos und aufopfernd wohltätig waren, sind und immer sein werden, nicht gleich den »Charpiezupfenden« und »Leibbindennähenden« Wohltätigkeitskolleginnen auch einmal dekoriert wurden? Meinetwegen Eine für Alle! Und Marianne Brandt hätte ich diese Auszeichnung von Herzen gegönnt. Wie tief unter dem Niveau der obengenannten Tätigkeiten die göttliche Kunst in den Augen so Vieler steht, die zu erlernen, Talent, Geist, ja das Opfer eines ganzen Lebens erfordert, das lernt man bei solchen Anlässen leider nur zu gut kennen, und tiefe Trauer beschleicht mich bei der Erkenntnis, wie weit die allgemeine Bildung noch davon entfernt ist: Kunst und Künstler einzuschätzen.
Bald schon hatte ich mich eingelebt in den Künstlerkreis, deren manche hoch über mir standen, mit denen künstlerisch zu arbeiten mir als langersehnte Notwendigkeit und Anregung erschien. Den Besten nachzueifern – was aus eigner Kraft noch nicht gelingen wollte –, sie endlich zu erreichen oder gar zu überholen, der Sphäre wenig Begabter, Unstrebsamer zu entfliehen, mich auf geistig-eigene Füße zu schwingen, mich den Größten durch Können und Wissen beizustellen, war mein Ziel. Ein Ziel, das einen beständigen Kampf meiner geistigen Kräfte mit meiner physischen Unzulänglichkeit bedeutete. Und dieser Kampf war ein nie endender. Galt es doch den Ursachen dieser Unzulänglichkeiten auf die Spur zu kommen, sie zu meistern, wozu ich eines langen Lebens bedurfte.
Wenn auch anfangs von den »Größten« über die Achsel angesehen, war man mir nicht unfreundlich entgegengekommen. Dennoch zog ich mir einmal eine böse Szene zu, als ich drei meiner Kollegen in aller Bescheidenheit gegen den »Größten« in Schutz nahm, die ihm seine große Szene im Rienzi verdorben hatten. Ein sehr alter Künstler und ein jüngerer Tenor, beide ohne Augengläser fast blind, die zwei Verschworene im Rienzi darstellten, und Marianne Brandt als Adriano sollten im 4. Akt an dem hinteren Pfeiler der Kirchentür stehen und unauffallend hinter der Kirche verschwinden, sobald Rienzi – vom Priester verflucht, auf den Stufen der Kirche festgebannt – auch von Irene, seiner Schwester, die – etwas entfernt von ihm – ohnmächtig zusammengebrochen ist – scheinbar ganz verlassen dasteht. Alles Volk ist entflohen; niemand mehr auf der Bühne außer Rienzi und Irene. Adriano stürzt endlich auf die Bühne, auf Irene zu, um sie mit sich zu führen. Irene erwacht, stößt Adriano in wahnsinniger Erregung von sich, sieht Rienzi und wirft sich ihm – dem Erstarrten – an die Brust. Rienzi, von plötzlichem Leben durchströmt, entwindet sich seiner Starrheit, nimmt Irenes Kopf in seine noch zitternden Hände, küßt sie inbrünstig mit Tränen in Stimme und Herzen, frägt tiefergriffen: »Irene, du?«, ermannt sich zu seiner ganzen Größe und ruft begeistert, indem er die geliebte Schwester an sich drückt: »Noch gibt's ein Rom!«
Ja, noch gab's einen Rienzi, noch ein Rom, als dieser Meister ihn uns darstellte mit seinem Geist, seiner Autorität und seinen Tränen. Aber auch ihn wird niemand mehr sehen, niemand mehr einen echten Rienzi kennen lernen. Wohl uns, die wir ihn noch schauen, ihm noch nachempfinden und zujauchzen durften!
Wir müssen aber wieder zurück zu den Verschworenen, die sich anstatt hinter Rienzi vor Rienzi aufgestellt hatten. Niemann winkte ihnen zu, als er es gewahrte, sie sollten dahintertreten. Alle drei glaubten darin eine Aufforderung Niemanns zu erkennen, sich auffallender ins Spiel zu mischen, und fingen nun an, sich da vorne bemerkbar zu machen und »verschworen« zu spielen wie nie zuvor. Niemann wird immer wütender, denn sie sehen und hören nicht, und auch meinen Rufen und Augenzwinkern bleiben alle drei taub und blind. Ich frug mich in Todesangst nur: wie das enden würde? Die drei hatten ihm wirklich die Szene verdorben, denn auch Adriano mußte nun, um zu Irene zu gelangen, vor Rienzi vorbei. Es war nicht auszudenken! Das Publikum jubelte indessen nach Schluß des Aktes wie sonst, hatte es wohl gar nicht bemerkt und rief Niemann ein dutzendmal vor den Vorhang. Und ich armes junges Ding mußte mit hinaus, obwohl ich nichts dazu beigetragen hatte außer meinem Besten, das damals noch recht wenig Äußeres hermachte sondern tief im Innern saß, weil die Pranke des Löwen mich fest packte und nicht losließ. Ich selbst war nach der Szene aufgelöst von der Macht dieses Titanen, von der Szene, die, von »ihm« so dargestellt, jeden erschüttern mußte.
Als wir von der Bühne gingen, war's aber um die drei – die allerdings nicht mehr da waren – geschehen. Nun brach seine Erbitterung los, der Löwe wollte Blut sehen. Ich sah, wie der Mann sich erregte nach der furchtbar ergreifenden Szene, und hatte die unglückliche Idee, ihn ganz bescheiden zu bitten, sich doch zu beruhigen; die drei Schuldigen hätten ihn mißverstanden, unabsichtlich die Szene gestört. Nun mußte er einen Blitzableiter haben, und sein Zorn traf mich Unglückswurm – indem er mich anschrie, daß mich die Sache nichts anginge – so bitter, daß ich laut schluchzend in meine Garderobe lief und kaum imstande war, den letzten Akt zu Ende zu singen.
Andern Tags verlangte ich meine Entlassung – resultatlos –, wofür man mir aber Genugtuung zu geben versprach. Lange Zeit wartete ich vergebens auf diesen Ausgleich. Der »Große« oder »Lange«, wie die Herren ihn nannten, existierte nun nicht mehr für mich. Ich hörte sein Bravorufen nicht, all seine Lobesworte gingen ungehört an mir vorbei, und obgleich ich nichts auf der Szene versäumte, wenn ich mit ihm beschäftigt war, hielt ich mich wohl drei Jahre fern von jeder Gemeinschaft, bis eines Tages sich die Spannung in idealen Sphären, denen sich kein Künstlerherz verschließen konnte, glücklich löste.
Es war und blieb der einzige Mißklang in den 15 Jahren meiner Zugehörigkeit an der Berliner Oper. Doch hatte mich mein Benehmen bei den anderen in Respekt gesetzt, denn der nicht sehr gesprächige Betz sagte mir eines Tages: »Aber Charakter haben Sie!«
Ein exemplarisch guter Ton herrschte unter den Berliner Künstlern, der niemals durch die geringste Nachlässigkeit oder Unfeinheit gestört wurde. Wohl konnte ich von Glück sagen, diesen anständigen Ton auch in Prag, Danzig und Leipzig getroffen zu haben, woran natürlich nicht nur die Direktoren, Regisseure und Kapellmeister schuld sind, zu dem man eben selber ein gut Teil, ja fast alles beitragen kann, indem man sich weniger Feinfühlenden gegenüber unnahbar macht. Das trauliche »Du«, das in Österreich zwischen allen Künstlern und, wie ich höre, auch unter Offizieren gebräuchlich ist, kommt in Deutschland wenig vor, oder auch nur bei solchen, die langjährige Kollegialität und Freundschaft verbindet. Allerdings gibt die österreichische Art sorgloser Herzlichkeit – so lange sie in ihren Grenzen bleibt – dem leicht empfänglichen Künstler viel Behaglichkeit, die norddeutschen Künstlerkreisen vollständig abgeht. Nur zu gerne gebe ich mich vorübergehend dieser Liebenswürdigkeit gefangen, und dennoch ziehe ich den Ernst des deutschen Künstlers vor. Die allzugroße Sorglosigkeit österreichischer Künstler ist in längerem Umgang auf die Dauer nicht leicht erträglich. In Deutschland wird ernster gearbeitet. Dafür hat Österreich stärkere Talente, die durch unmittelbare Herzlichkeit anderen so warm entgegenströmen, deren wirksamer Ursprünglichkeit zuzujubeln uns Deutsche innere Erkenntnis und freudigste Sehnsucht treibt.
Für den 27. Januar 1872 war eine Vorstellung vom »Figaro« mit Frau Mallinger als Susanne und Frau Lucca als Page angesetzt. Am 26. abends wollte ich nach Danzig zum Gastspiel, doch ließ mich Hülsen bitten, meine Reise auf den 28. früh zu verschieben. Er bat mich, am 27. abends in der Figarovorstellung zugegen zu sein, da ich möglicherweise die eine oder die andere Rolle im Laufe des Abends weitersingen müsse. Zwischen den Damen Mallinger und Lucca war es schon öfter zu unliebsamen Szenen gekommen. Letzthin hatte man der Lucca nach einer Faustaufführung so was wie »Straßengretl« in den Wagen hineingerufen, und als sich Frau Lucca beklagte, fuhr sie nunmehr in und aus der Vorstellung an der kaiserlichen Einfahrt vor: der Kaiser hatte es befohlen! Nun harrte ich am 27. Januar in der Künstlerloge der Dinge, die sich ereignen sollten. Die Vorstellung war an- und aufregend genug. Als Frau Lucca-Page auftrat, johlte, pfiff und zischte man von der Galerie herunter. Kaum wurde der Versuch gemacht, ein Wort zu sprechen, als der Lärm von neuem begann. Auch Eckerts Intention, mit dem Orchester die Pagenarie zu beginnen, mißlang vollständig. Endlich machte Frau Lucca Zeichen, daß sie sprechen wolle, worauf sich Gezisch und Applaus legten und sie echt luccaisch folgendes sprach: »Ich weiß nicht, was man von mir will, ich bin mir keiner Schuld bewußt und frage: ob ich singen soll, ob nicht?« Neuer Lärm, bis schließlich der Applaus und die Zurufe: »Singen!« Gezisch und Gejohle niederkämpften, die Vorstellung ihren Fortgang nehmen konnte.
Beide Damen hatten mich oben in der Loge sitzen sehen, sonst wäre unfehlbar die eine oder die andere in Ohnmacht gefallen, die Vorstellung gestört gewesen. Die Sache war aber noch nicht zu Ende. Im II. Akt soll Susanne, wie üblich, am Schluß der kleinen Arie dem Pagen einen Kuß geben. Frau Mallinger, die stets – und nicht nur an diesem Abend – nach neuen Nuancen suchte, darin oft zu weit ging, gab Frau Lucca anstatt des Kusses einen kleinen »Backenstreich«. Frau Lucca beklagte sich über die »Ohrfeige« und der Skandal spielte weiter bis ans Ende der Oper. Eine Schande für die Kgl. Oper und für beide Damen. Wer im Recht war, ließ sich im Augenblick nicht entscheiden und nun – hab ichs vergessen.
Frau Lucca war fast 12 Jahre in Berlin, hatte nur 8000 Taler Gage, wollte nach Amerika und kam nochmals um einen Urlaub ein, den man ihr weigerte. Als bald darauf der Figaro wieder angesetzt war, kam das Publikum vor verschlossene Türen: Frau Lucca war nach Amerika »abgereist«! Von da an sang ich viele ihrer Rollen.
Auf dem Tempelhoferfelde nahmen wir im September selben Jahres die Dreikaiserparade mit Freund Kohler in Augenschein, der von seinem Blatte extra nach Berlin dazu gesandt war. Unter vielen Festlichkeiten fand auch ein großes Hofkonzert im Weißen Saale statt, in dem ich sang und zum erstenmal alle Pracht der großen Zeremonien, die drei Kaiser: Wilhelm I., Franz Josef I. und Alexander II., Bismarck und Moltke sah. Es war das letzte Hofkonzert, dem Bismarck beiwohnte. Der Anblick war großartig. Im Weißen Saale des Berliner Schlosses spielen alle großen Zeremonien und Festlichkeiten.
Quer der Längsseite, am oberen Ende des Saales, ist eine Estrade für Orchester und Sänger aufgestellt. Ein großer breiter Mittelgang bleibt längs des Saales frei. Rechts vom Orchester sitzen in der Mitte auf Thronsesseln: der Kaiser – damals die drei Kaiser – und die Kaiserin; etwas niedriger von beiden Seiten der Majestäten: der Kronprinz, die Kronprinzessin und alle anderen Prinzen und Prinzessinnen des Kaiserlichen Hauses. Hinter dem Kaiser direkt, damals: Bismarck und Moltke. Den Majestäten vis-à-vis, vom Orchester links, sitzen die Botschafter mit ihren Gemahlinnen, hinter diesen das ganze diplomatische Korps mit seinen Damen, alle Minister und sonstigen hohen Würdenträger, sowie hochgestellte Offiziere. Dem Orchester entgegengesetzt jüngere Offiziere mit ihren Frauen und andere Gäste, die sich bis in die angrenzenden Galerien und Gemächer verteilen, welche der Hof bei seinem Kommen passiert. Obwohl das Konzert erst um 10 Uhr beginnt, muß alles im Saale schon um halb neun auf seinen Plätzen sein, und nur wir Sänger hatten den Vorzug, des aparten Eingangs wegen später kommen zu dürfen. Da alles stehen muß, waren die Damen oft schon totmüde, ehe es anging, und wirkliches Erbarmen faßte mich immer, wenn ich die kleine chinesische Botschafterin stehen sah und ihrer kleinen Stümpfe von Füßen gedachte, die sich auch nicht setzen durfte, aber gewiß grenzenlose Qualen ausgestanden haben mag.
Pagen in Rokokouniform tragen die Courschleppe der Kaiserin und kgl. Prinzessinnen. Alle anderen Damen tragen ihre Courschleppen, über den Arm geschlagen, selber. Die Pagen legen, nachdem die Majestäten Platz genommen, die Schleppen über die Thronstufen und nehmen dicht vor dem Orchester Stellung. Das Konzert beginnt, sobald vom Oberzeremonienmeister das Zeichen zum Anfang gegeben.
Während der Pause sprechen Ihre Majestäten zuerst mit den Botschaftern und ihren Frauen – auch das ist nach Zeit und Politik eingeteilt – dann mit allen denjenigen Persönlichkeiten, die besonders ausgezeichnet werden sollen. Der Kaiser ging, wenn dieser Pflicht genügt war, linksseitig in die hinteren Reihen zu den Damen der Diplomatie, um diese oder jene aufzusuchen, und kam dicht am Orchester zurück, wo er uns Künstler stets gütig begrüßte, nachdem er Hofkapellmeister Taubert zuerst die Hand gereicht hatte. Wenn alles wieder plaziert war, kam der zweite Teil des Konzertes. Nach Schluß desselben blieb alles stehen, bis sich der Hof durch Begrüßung sämtlicher Gäste in corpore wieder entfernt hatte und alles auseinanderstob.
Die Kaiserin war schon immer in den Proben anwesend, die am selben Vormittage im Schlosse stattfanden, um sich über alle Arrangements genau zu unterrichten. Hier begrüßte uns die hohe Frau und erkundigte sich nach allem und jedem. Hofkapellmeister Taubert reichte die Programme ein, und die Kaiserin wählte, was ihr am besten für ihre Gäste zu passen schien.
In diesen Konzerten wurden nur große Stücke gemacht. Anders war's in den kleinen Donnerstagskonzerten, die im Palais der Majestäten, Unter den Linden, stattfanden. Dort ging's sehr gemütlich zu. Die Gesellschaft saß zu 6-8 Personen an kleinen runden, mit köstlichen Blumen geschmückten Tischen. Dicht vor der Kaiserin stand das Klavier, so dicht, daß man kaum Platz zu einer würdigen Verbeugung hatte. An einem Tische präsidierte also Kaiserin Augusta, am nächsten der Kaiser, am dritten der Kronprinz, am nächsten die Kronprinzessin. Dort Prinz und Prinzessin Karl, Bruder und Schwester Ihrer Majestäten, und überall die Damen und Herren des Hofstaates verteilt nach Rang und Sitte.
Prinzessin Karl war eine der liebenswürdigsten Frauen unseres Kaiserhauses und zeichnete mich immer ganz besonders aus. Sie war die einzige, die immer frische Blumen in Händen hielt, die geschmackvollste und eleganteste Toilette des ganzes Hofes trug; sie liebte Tiere und ging stets in Begleitung dreier großer, weiß und schwarzer russischer Windhunde spazieren. Auf der Straße oder in Wiesbaden, wo ich ihr oft begegnete, sprach sie mich besonders gerne an. Dann nahm sie immer ihren Schleier ab, ein Feingefühl, das ich ihr besonders hoch anrechnete, weil ich es gelehrt bekam und mich nun doppelt freute, die zarte Rücksicht hier in die Tat umgesetzt zu sehen. Sie wußte mir stets Angenehmes und Liebes zu sagen, und ihr bewahre ich ein dankbares Andenken für die Güte zu mir und ihre Tierliebe insbesondere.
Als ich das erstemal zu diesen Donnerstagskonzerten zugezogen wurde – wir Künstler waren im Nebenzimmer des Saales, dessen große Flügeltüren offenstanden, wo wir von jedermann gesehen werden konnten – trat nach einem Musikstück Prinz Karl auf mich zu, den ich bereits vom Theater her kannte, und gleich darauf eine junge sehr einfach frisierte Frau mit wundervollen blauen Augen. Sie sprach mich sehr liebenswürdig an, so einfach, natürlich, wie sie aussah, wendete sich dann zum Prinzen und bat ihn, sie zu entschuldigen, wenn sie ginge, sie hätte furchtbare Kopfschmerzen. Hülsen belehrte mich, daß es die Kronprinzessin gewesen, die mit mir gesprochen. Ihre herrlichen blauen Augen hat Angeli so wundervoll wiedergegeben und uns erhalten. Doch kann sich nur derjenige einen annähernden Begriff von ihrem Ausdruck machen, der sie wirklich kannte. Dreimal sprach ich sie bei besonderen Gelegenheiten. Einmal im kronprinzlichen Palais, gleich nach Bayreuth, wo wir die Rheintöchterszene mit Siegfried – Ernst – sangen; ein zweitesmal bei Lord und Lady Russell-Amphtill, dem englischen Botschafter, und zuletzt als Kaiserin-Witwe im Grunewald, wo sie auf mich zukam, mir die Hand reichte und mir denkwürdige Worte sagte: »Sie machen sich von meinem Martyrium keinen Begriff!«
Ach ja, ich konnte mir wohl einen Begriff davon machen. So wenig ich auch von den innern Kämpfen dieser unglücklichen Frau wußte, brachte ich ihrem Martyrium doch mein volles Herz entgegen. Ohne zu ahnen, wie weit ihr Leiden vorgeschritten, versuchte ich kurz vor ihrem Tode ihr meine Dienste als Künstlerin anzubieten, um ihr vielleicht eine Freude zu bereiten, doch wurde mir von lieber Seite ihr ablehnender Dank mitgeteilt. Leider war sie nicht mehr imstande, jemand zu sehen, und bald darauf erlöste sie der Tod von ihrem seelischen und körperlichen Martyrium.
Schönheit, Männlichkeit und strahlende Heiterkeit waren des Kronprinzen Attribute. Eines jeden Antlitz erhellte sich und strahlte wieder vom Glanze dieser Persönlichkeit, die einem so entsetzlichen Schicksale verfallen sollte. Noch höre ich die Menge jubeln, wenn er daherschritt, und höre, wie beim 50jährigen Jubiläum der Königin Viktoria in London ihm ganz England zujauchzte, als sei er der Britten König, und sehe ihn in seiner ganzen großen Schönheit, in der im Sonnenglanz blendenden Uniform der Königin-Kürassiere dahersprengen, ahnungslos vom unerbittlichen Schicksal bereits im Innersten gezeichnet!
Auf ganz besonderem Fuße standen wir mit der Frau Prinzessin Friedrich Karl, geb. Prinzeß von Anhalt, Abkömmling der schönen Anna-Liese. Künstlerisch gebildet, verwöhnt durch ein ausgezeichnetes Theater, das der Anhalter Hof stets unterhielt, interessierte sie sich für Kunst und Künstler, war allabendlich im Opernhause und machte sich durch Blicke in unsere Loge verständlich, wenn ihr etwas gefiel oder mißfiel. Sie beobachtete sehr scharf und traf mit ihrem Urteil stets das Rechte. Hätte sie bei Hof oder nur in Berlin eine freiere Rolle spielen dürfen, würde sie sicher alle Künstler in ihrem Hause vereinigt haben. Da dies nicht sein durfte, mußte man sich begnügen, sie zu sehen, zu verstehen und zu lieben. In Wiesbaden stellte mir Prinz Karl ihre lieblichen Töchter, seine Enkelkinder, vor. Prinz Friedrich Karl blieb nach dem Dreikaiserfest – gleich Bismarck – für alle Zeiten allen Hofkonzerten und Theatern fern. Er beschäftigte sich mit Forstwirtschaft und Gärtnerei, die er leidenschaftlich betrieb und selber Hand mitanlegte, was ihm mehr Befriedigung gab als aller zeremonielle Pomp.
Außer den noch sehr jugendlichen Töchtern des Kronprinzenpaares gehörte noch die sehr elegante Prinzessin Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin zu diesem auserlesenen Kreise.
Die verehrungswürdige Großherzogin-Mutter von Mecklenburg-Schwerin – von der Heinrich Heine uns so viel aus ihren Mädchentagen zu erzählen weiß – des Kaisers hochbetagte Schwester, und Großherzogin Luise von Baden, seine Tochter, kamen nur bei besonderen Veranlassungen nach Berlin, mit vielen anderen gekrönten Häuptern und Fürstlichkeiten, die das illustre Ensemble vervollständigten.
Zu Kaisers Geburtstag am 22. März wurde Theater gespielt in der Bildergalerie. Kleine Bruchteile aus Opern oder extra gedichtete, komponierte oder kombinierte Spielereien, die amüsieren sollten, meiner unmaßgeblichen Meinung nach aber nie das geringste Ergötzliche boten. Ich denke mir, man muß sich tödlich gelangweilt haben. Hofkapellmeister Taubert, der mit Geschmack, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten sowie tausend andern Dingen zu rechnen hatte, mußte mit Desirée Artôt de Padilla, der einzig lieben Frau und Künstlerin, Kaiserin Augustas Liebling, fortwährend Opern und Szenen erfinden, Texte machen, Hokuspokus komponieren, um nur einigermaßen allen gerecht zu werden. Jeder wollte mitmachen und war gekränkt, wenn er übergangen ward. Aber Frau Artôt arrangierte, kombinierte, verschob Stimmen, Personen und Szenen zu allem, was sie nötig glaubte, machte alles möglich und selbst aus dem Savoyardenknaben Pierotto in der Linda von Chamonix – aus der man einmal eine Szene gab – eine Pierotta, weil sie zu stark war, um als Knabe erscheinen zu können. Aus Chören machte sie Quartette, aus Arien Duette usw.; kurz alles, was man brauchte, um alle und alles zu befriedigen. Desirée Artôt de Padilla war die feinste Frau, die ich auf der Bühne kennen gelernt. Nicht nur als Künstlerin von bezaubernder Liebenswürdigkeit, sondern auch vollendet in Umgangsformen und gutmütig aus tiefstem Herzen. Ihr und ihrem lieben Wesen, ihrer großen feinen Künstlerschaft danke ich mehr, als ich ausdrücken kann.
Bei den Geburtstagsfesten gab es große kalte Buffets für sämtliche Bühnenmitglieder, dicht neben dem Weißen Saal in einer anstoßenden Galerie. Es muß für Viele sehr verlockend gewesen sein, denn als ich einmal vor der Schloßvorstellung im Theater noch zu singen hatte, sagte Frl. Trepplin zu mir: »Ach, ich beneide Sie, Frl. Lehmann, Sie gehen heute noch hinauf, wo es so schön bibbert.« Mit dem »Bibber« meinte sie Aspic, Gelee und Gelatine, in denen die kalten Delikatessen zitterten.
Das Essen war aber auch wundervoll, und in Strömen flossen Wein und Champagner. Zu Fastnacht gab es einen herrlichen, lauen, weißen Punsch, der so wundervoll war, daß ich mir das Herz faßte, den Kaiser nach dem Rezept zu fragen. Der Kaiser sagte mir, daß es seine Mutter, die Königin Luise, aus einem Kloster in Königsberg mitgebracht habe, geheimgehalten werde und auch er dessen genaue Zubereitung nicht kenne.
Diener legten uns weiße Seidenpapiere unters Kuvert, um vom Konfekt mitzunehmen. Offiziere sah man mit gefüllten Paradehelmen die Treppen hinabgehen. Für ein junges Kind in unserem Hause hatte ich immer 2-3 Stückchen mitgenommen und ihm jedesmal gesagt: »Das schickt dir der Kaiser.« Das Kind war immer selig, und erst nach vielen Jahren zerstörte ich die kleine Lüge – die sie so selig machte – durch die Wahrheit.
Am gemütlichsten war's aber nach den kleinen Donnerstagskonzerten im Palais. Da aßen wir ebenfalls an kleinen Tischen im Nebensaal mit den jüngeren Offizieren und Diplomaten. Gewöhnlich saß Hofmarschall Graf Perponcher und Herr von Hülsen mit uns zusammen, denn es waren immer nur wenig Auserlesene dabei beschäftigt. Man aß hier ebenso ausgezeichnet, nur leider zu schnell. Wer Teller und Gläser nicht festhielt, kam nicht auf seine Kosten; fort waren sie, ehe man am Glase genippt oder einen Bissen gegessen hatte. Bedurfte es doch kaum eines Wortes zum freundlichen Nachbar: » adieu le saumon, la salade, le vin.« Nur einmal passierte mir das, dann hielt ich, was ich hatte. Jeder erhält ein Glas roten, ein Glas weißen Weines, ein Glas Wasser und ein Glas Champagner angeboten. Wer schnell trinkt, kommt wohl zu einem zweiten Glase, wer langsam dabei verfährt, kriegt gar nichts, denn im Umsehen ist alles abgeräumt. Nach Rücksprache mit dem Grafen Perponcher brachte ich es aber doch dahin, daß auf dem Künstlertisch stets eine ganze Karaffe Rotwein stand, aus der wir nach Belieben einschenken konnten, ohne ihr zu schnelles Verschwinden befürchten zu müssen.
Diejenigen, die nach dem Diner direkt zum Hofkonzert kamen, hatten's gut. Ich aber aß um 1 Uhr Mittag, trank um 4 Uhr eine Tasse Tee und sang gewöhnlich vor dem Hofkonzert noch eine große Partie im Theater, die man mit vollem Magen eben nicht singen kann. Nach der Vorstellung war kaum Zeit zum Abschminken, Umfrisieren und Umziehen, dann ging's in vollster Hetze zum oft recht verantwortungsvollen Konzert. Daß ich dann gegen Mitternacht nach einem Bissen schmachtete und gern ein Glas Wein trank, wird jeder verstehen, der sich einen Begriff von der geistigen und körperlichen Anstrengung solcher Jagden zu machen imstande ist.
Es war wirklich keine Kleinigkeit, 4-6 kleine Piècen für die Donnerstagskonzerte vom Morgen bis zum Abend zu lernen. Frau Artôt sang eine Menge Duette mit mir in allen Sprachen und Dialekten: französisch, spanisch, russisch, schwedisch, mit Koloraturen und Kadenzen, die oft erst Mittags in der Probe arrangiert und abends oft mitten im Singen geändert wurden. Da ich doch halbwegs wenigstens alles auswendig wissen mußte, war es eine große Anstrengung und bedurfte starker Konzentration. Außer mir hätte es wohl niemand fertig gebracht. Frau Artôt sang, meiner musikalischen Sicherheit halber, auch am liebsten mit mir, und daß ich dabei viel profitierte, ist selbstverständlich.
Am Abend merkte ich, ohne daß man mir nur ein Wort zu sagen brauchte, was und wie wir etwas machen oder nicht machen, d. h. ändern würden ohne ein Wort der Verständigung; ich war auf alles gefaßt. Gewiß wurde es mir leicht, aber es mußte doch gelernt sein, und blamieren durfte man sich im Kreise dieser internationalen Sprachkünstler auch nicht. Wieviel Elogen trugen mir diese Abende ein, wie stolz machten sie mich, wie glücklich meine liebe Mutter. –
Wurden wir schon während der Pause von beiden Majestäten mit Ansprachen ausgezeichnet, so sparte sich Kaiser Wilhelm immer noch eine ganz aparte Überraschung für den Schluß des Abends, nach dem flüchtigen Souper auf, indem er an unsern Tisch trat und sich in entzückendster Weise, heiter scherzend, noch eine Weile mit uns und anderen jungen Menschenkindern unterhielt. Immer wußte er glückliche Herzen und Gesichter hervorzuzaubern.
In diesen Donnerstagskreisen lernte ich auch den Erbgroßherzog von Mecklenburg-Schwerin, den Vater unserer heutigen bezaubernden Kronprinzessin, Cecilie, kennen. Der junge Fürst war von außergewöhnlicher Bescheidenheit und Einfachheit in seinem Wesen und immer gleichmäßig liebenswürdig die vielen Jahre hindurch, da ich ihm dort begegnete. Vielleicht hauptsächlich darum, weil man ihn krank nannte, brachte ich ihm ein großes menschliches Interesse entgegen, und ehrliche Freude bereitete es mir, als er eines Abends mir seine schöne Braut: Großfürstin Anastasia zeigte, mit der er sich soeben verlobt hatte. In Kronprinzessin Cecilie fand ich alle schönen Eigenschaften wieder, die Herz und Wesen ihres lieben Vaters auszeichneten. Außer ihm sah ich noch viele andere, deren ich später noch gedenken will.
Bald nach dem Tode der Königin-Witwe Elisabeth, Gemahlin Friedrich Wilhelms IV., geb. Prinzessin von Bayern, fand in den Elisabeth-Kammern des königl. Schlosses eine Art Trauerfeier, in Form eines religiösen Konzertes statt. Es wurden nur wenige klassische Nummern gemacht; Frau Mallinger, ich, Niemann und Betz sangen aus Mozarts Requiem das Benedictus. Alles war in schwarz gekleidet und besonders früh erschienen. Unser aller Liebling, Frau Prinzessin Friedrich Karl, trat zu uns beiden Damen heran und erzählte uns manchen Scherz und manche Bekümmernisse.
Von andrer Seite hatte ich bereits gehört, wie streng man gegen die jungen Prinzessinnen war, die sich nicht einmal nach Gefallen frisieren durften; niemand empfangen, ja, selbst ein freundlicher Gruß wurde zuweilen beanstandet. So war man auch der Kronprinzessin begegnet. Ihre herzige Art, ihr offenes Wesen und freundlich einfaches »sich geben« wurden unaufhörlich gerügt, bis sie verbittert sich in sich selbst verschloß.
Nach dem Konzert – wir saßen bereits beim Souper – trat Moltke mit einem Glase Sekt an mich heran, um Mozart mit mir zu feiern, ihm und mir für meine Mozartrollen zu danken. Es war nur das eine Mal, daß ich den großen »Schweiger« sprach, da er andern Festlichkeiten nicht mehr beiwohnte. Doch sah ich ihn und Bismarck fast täglich zur Parlamentszeit in der Leipzigerstraße zu Fuße gehen; eine Gelegenheit, die wir immer aufsuchten, weil man sich an den beiden Gestalten nicht satt sehen konnte.
Auch den alten 88jährigen »Papa Wrangel« sah ich täglich im Tiergarten auf meinen Spaziergängen, umgeben von einer Schar von Kindern, denen er Dreier und Bonbons austeilte, den alten General, dem man 1848 drohte, seine Frau zu hängen, falls er sich einfallen ließe, mit seinen Soldaten in Berlin einzuziehen. Aber er zog doch ein, und als er drin war, soll er im schönsten Berlinerisch geschmunzelt haben: »Soll mir nur wundern, ob se ihr hängen werden!« Auch wenn es nur Anekdote wäre, kennzeichnet sie »Papa Wrangel« vorzüglich.
Im Februar 1873 kam Richard Wagner nach Berlin, um hier ein Konzert zu dirigieren, das seine Freunde zum Besten des Bayreuther Fonds arrangiert hatten, und das im alten Konzerthause in der Leipzigerstraße stattfand. Wagner begrüßte Mama und mich aufs herzlichste und schrieb uns gleich eine Billetanweisung auf seiner Visitenkarte, die ich noch besitze. Als wir in der Probe mit Wagner plaudernd neben Maler Hertel standen, der blond, groß und schön gewachsen war, klopfte Wagner ihm vertraulich mit folgenden Worten auf die Schulter: »Sie müssen mir den Siegfried singen!« Hertel, der Wagner eben erst kennen lernte, mußte, ob schon geschmeichelt, bedauernd ablehnen, was bei den Umstehenden große Heiterkeit hervorrief. Der Enthusiasmus des Elitepublikums war grenzenlos. Schon damals war es Gräfin Schleinitz, geb. Freiin von Buch – deren Mutter in zweiter Ehe, mit dem Fürsten Hatzfeldt verheiratet, eine treue Freundin Liszt's und Wagner's war – die all ihren Einfluß durch Stellung und Namen aufbot, um Wagners Werke in der deutschen Kaiserstadt durchzusetzen. Sie wurde allerdings von Gleichgesinnten dabei energisch unterstützt; aber ohne ihre ideale Führung, ihren unermüdlichen Eifer wäre gewiß noch lange zurückgehalten worden, was sich schon jetzt unaufhaltsam vordrängend Bahn brach, um wenige Jahre später alles um so gewaltiger zu überfluten.
Im gräflich Schleinitz'schen Hause trafen alle führenden Geister der Kunst, Wissenschaft und Literatur zusammen. Einzelne kunstliebende und kunstverständige Familien der Aristokratie vervollständigten den oft nur kleinen Kreis, der sich um Liszt, Hans v. Bülow, Helmholtz, Adolf Menzel, Gustav Richter, Taussig, Rubinstein, Karl Klindworth, C. Eckert, Albert Niemann usw. bildete, dem auch Scholz und Dohm, die beiden Männer vom Kladderadatsch, angehörten. (David Kalisch, des Blattes Gründer, war eben dahingegangen.) Fürstin Hatzfeldt, Fürstin Carolath, die Schwester der Wirtin, Fürst und Fürstin Franz und Hedwig Liechtenstein, Graf und Gräfin Usedom mit Tochter Hildegard, die ihrer walkürenhaften Gestalt halber »Usekathedrale« genannt wurde, sowie Graf Wolkenstein-Trostburg gehörten zu den ständigen Gästen dieses friedlich vornehmen Hauses, wo philosophiert, musiziert (die Gräfin war eine ausgezeichnete Klaviervirtuosin) und gelacht wurde, wo niemand sich zu langweilen befürchten mußte.
Nur einer besonderen Frau, der ich so gern im Leben begegnet wäre, begegnete ich dort nicht mehr, da sie bereits, bevor ich noch im gräflichen Hause verkehrte, um 1872 starb. Frau von Muchanoff! Welch eine Persönlichkeit muß sie gewesen sein, welch ideale Freundin vieler großer Künstler, welch ideale Förderin der Kunst! Vielleicht war Gräfin Schleinitz ihre gelehrige Schülerin, welche bis zu ihrem vor kurzem erfolgten Tode die Fahne des Idealismus hochhielt, wie sie mir selber sagte, was sie so ewig jung erhielt. Vielleicht nahm sie das Zepter nur aus Frau von Muchanoffs müden Händen, um es für Wagner, der Frau von Muchanoff schon so sehr viel zu verdanken hatte, weiterzuführen! Im Salon der Gräfin stand ein wundervolles Bild der merkwürdigen Frau, von Lenbach gemalt, vergeistigt, durchsichtig, fast körperlos möchte ich sagen, von ihm festgehalten. Das Bild ging mit Gräfin Schleinitz 76 sogar mit nach Bayreuth, als sollte es den Triumph Wagners miterleben! Die Verehrung, mit welcher man dieser Frau von allen Seiten begegnete und heute noch gedenkt, grenzt an Anbetung. Ich kenne sie nur aus dem Bilde und ihren Briefen an ihre Tochter Coudenhoven; aber ich meine, man könnte nichts Schöneres von ihr wissen als diese Briefe, die das wundervolle Wesen dieser Frau mit dem Bilde Lenbachs in schönsten Einklang bringen, die eine Niegekannte unvergessen machen.
Hausminister Graf Schleinitz, der wohl um mehr denn 30 Jahre älter sein mochte als seine Gattin, war ein äußerst angenehmer Wirt. Wagnerianer war er nicht au fond du cœur, seiner Gattin zuliebe heuchelte er leise es zu sein. Wenn wir dort beratschlagten, wie Wagner am besten zu helfen wäre, oder Pläne zu Konzerten oder Veranstaltungen entwarfen, frug er wohl: was er dabei zu tun, wie dazu beitragen könne? wobei ihm das Amt des Veilchenverkäufers zufiel. Gerne bereit, die Mission zu übernehmen, zweifelte er gleichwohl bei seinem Alter, auf gute Geschäfte rechnen zu können, doch bedeutete ich ihm, daß ein so liebenswürdiger Hausminister und Graf auch für junge Mädchen immer noch Anziehungskraft genug besitze. Indessen kam alles anders, als es geplant war.
Viel anregende Abende brachte ich bei Paul Meyerheim zu, in dessen gemütlichem Heim eine kleine Schar auserlesener Künstler ganz unter sich, ihrem Urteil, Geschmack und Humor die Zügel schießen lassen durften. Hier wurden Mozart, Beethoven, Bach und Haydn angebetet. Meyerheim spielte Cello, Stockhausen und ich sangen, und andre gaben von dem Ihren reichlich hinzu. Als Stockhausen, nachdem er gesungen, einst Angeli, der auch sehr gut sang, aufforderte uns etwas zum besten zu geben, erwiderte ihm Angeli: »Nein, nicht nach Ihnen; denken Sie nur, wenn Sie nach mir malen sollten?!« Angeli hatte die Lacher auf seiner Seite. Einmal aber, als ich Angeli in seinem Atelier aufsuchte, wo ich ein Bild besichtigen sollte, malte er gerade an einem Porträt der Frau Prinzessin Friedrich Karl, und da erlaubte er mir, an einer Perle ihres Kolliers einen Pinselstrich zu machen.
Nach und nach war ich durch Frau Artôt und die vielen Hofkonzerte in allen Hofkreisen eingeführt, sang allüberall, war bei Fürst und Fürstin Anton Radziwill, sowie bei Lord und Lady Amphtill, dem englischen Botschafter, zu allen Jours geladen. Lord Amphtill, den wir schon als Lord Russell kannten, war ein außergewöhnlich einfacher lieber Mann, mit dem ich mich gerne allein unterhielt, wobei er mir von den Anfängen seiner Studienzeit erzählte, wie er als zweiter Sohn eines Lords sich in die allerbescheidensten Verhältnisse finden mußte. Wie alle Menschen von starkem Innenleben, war er zeitlebens einfach, ernst geblieben und machte auf mich einen selten gediegenen Eindruck. Seine bildschöne, liebe Frau flog heiter sorglos und glücklich durchs Leben, bis sein Tod sie den furchtbaren Ernst kennen lehrte.
Bei Fürst und Fürstin Anton Radziwill fand alljährlich am Vorabend von Kaisers Geburtstag eine große Soiree mit musikalischen Genüssen statt, zu der die Majestäten und der Kronprinz stets erschienen, wo es außerordentlich lebhaft und sehr gemütlich zuging. Als ich einmal neben der Obersthofmeisterin, Gräfin Perponcher sitze, tritt eine auffallend schöne, etwas zurecht gemachte Dame am Arme ihres Gatten ein. Mir entschlüpft ein leises »ah« der Bewunderung. »Kennen Sie die Dame?« frägt mich Gräfin Perponcher. »Nicht persönlich«, erwidere ich, doch erkannte ich in ihr sofort die einst berühmte entzückende Tänzerin Friedberg, jetzt Gräfin Westphalen, die ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hatte, die noch immer selten schön war.
Auch Bill Bismarck traf ich später dort, mit dem ich mich schon damals sehr lebhaft über Tierschutz unterhielt. Ich bat ihn, den Fürsten dafür zu interessieren. Er schrieb mir darüber, daß der Fürst, sein Vater, wenn er Zeit genug hätte, sich gern der Sache annähme; da er aber alles nur ganz und nicht halb mache, müsse er davon absehen, da seine Geschäfte es jetzt nicht erlaubten.
Hier traf ich mit Etelka Gerster zusammen, die mit vielen Empfehlungen gekommen sich in Berlin und wohl überhaupt zum erstenmal hören ließ, wobei sie sich Taubert und mir gegenüber durchaus nicht als Anfängerin benahm. Die Gräfinnen Perponcher, Danckelmann und Frau von Prillwitz, drei Geschwister, die in Hofkreisen eine große Rolle spielten, nahmen sich der jungen Sängerin herzlich an. Als sie bald darauf bei Kroll als Nachtwandlerin auftrat, überschütteten die Damen sie mit Blumen, wozu sie alle ihre jungen Freunde beisteuern ließen, und Etelka Gerster war »gemacht«. Sie hatte eine sehr liebe Stimme, viel Charme und sang sehr gut.
Ich kann dies Kapitel nicht schließen, ohne einer der liebenswürdigsten Erscheinungen am Hofe, der Hofdame Ihrer Königl. Hoheit der Frau Prinzessin Karl, Gräfin Josephine Seydewitz, nachmaliger Gräfin Carl Dönhoff, zu gedenken. Schönheit, Witz und Heiterkeit schufen ihr unendliche Feindinnen, die sie am liebsten vernichtet hätten, was ihnen aber zum Glück nicht gelang. Sie lud mich oft ein, und außerdem begegnete man sich fast täglich in allen Gesellschaften, bei denen sie allerdings mit ihrem Witz auch niemand verschonte. Noch immer schön, starb sie nach schwerem Leiden in einem Sanatorium bei Dresden, und wie mir ihre Wärterin erzählte: »wie ein Engel«.
In diesem Kreise stand mir die Herzogin von Sagan mit ihrer reizenden Tochter Dolly – die ich im Gesang unterrichtete – am nächsten. Der Herzog hatte mich persönlich darum gebeten, und die Herzogin verwöhnte mich gründlich. Dolly war eine sehr begabte, fleißige Schülerin, bis sie sich – fast ein Kind noch – mit dem Fürsten Carl Egon von Fürstenberg vermählte, der ihr nach kurzer Ehe durch den Tod entrissen wurde. Wenn ich um 9 Uhr früh zur Stunde kam – anders konnte ich nicht der Proben halber – steckte die Herzogin ihren lieben Kopf aus ihrem Zimmer, reichte mir die Hand, und mit einem herzlichen: » bon jour Mademoiselle Lehmann, vous allez bien?« verschwand sie wieder bis nach der Stunde. Oft mußte ich zum Frühstück bleiben, wenn meine Zeit es erlaubte, und wenn wir manchmal allein saßen, schüttete sie mir wohl auch ihr tiefbekümmertes Herz aus, und Tränen fielen aus den so klaren blauen Augen. Aber sie konnte auch sehr witzig und heiter sein, und viele mit Geist und Humor gewürzte Stunden verdanke ich diesen drei so feinen, liebvollen Menschen.
Viel unvergessene Momente bergen meine Erinnerungen an die höchsten und hohen Persönlichkeiten des deutschen Kaiserhauses, der Aristokratie und so vieler berühmter Menschen. Man kannte sich gut, denn man begegnete einander fast allabendlich im Laufe des Winters. Wie wenigen aber trat man wirklich näher. Ohne Stillstand flutete das Leben an ihnen vorüber. Im ewigen Banne der Repräsentationspflichten lernten viele möglicherweise ein persönliches Innenleben gar nicht kennen. Zu manch einem Wesen zog es mich, von dem ein Hauch der Seele oder des Herzens ausging, mit mir sympathisierte, schnell aber oder scheu sich wieder verschließend, als solle oder dürfe es nicht sein. Im Taumel der Freude, des Glanzes ihrer Stellungen streifen sie die Träger der Kunst ohne ihrer hohen Sendung, ihrer Seele inne zu werden. Die Kunst reizt sie im Künstler. Beides gewährt ihnen eine Unterhaltung auf Augenblicke oder Stunden und ist das einzige, meist lockere Band, das beide miteinander bindet. Ich aber habe vielen aus diesem Kreise ein treues Andenken bewahrt. Für das junge Mädchen war es eine glänzende Zeit; für die junge Künstlerin hätte sie es ebenfalls sein können, wenn die Musik, die man dort zu machen gezwungen war, nicht allzu minderwertig gewesen wäre. Nicht selten kam ich fast weinend aus diesen Konzerten und klagte meiner Mutter: »Mamachen, ich schäme mich vor den Leuten, solch elendes Zeug zu singen, sie werden denken, daß ich gar nichts Besseres kann.«
Der Gegenwart meiner Erzählung hastig vorauseilend, muß ich mich wieder in die Vergangenheit zurückfinden, da es in Wirklichkeit nicht gar so schnell ging, wie ich erzählen möchte, ja, mir manche Zeit sogar wie eine lange Geduldsprobe erschien.
Im Winter gastierte, wie alljährlich, Pollini mit seiner italienischen Gesellschaft, die aus Frau Artôt, ihrem Gatten, Mariano de Padilla, Tenor Vidal und anderen bestand. Man hatte Verdis Maskenball als Debüt annonciert, die Gattin des Kapellmeisters Goula, der man große Schönheit nachrühmte, sollte den Pagen singen. Drei Tage vor der ersten Vorstellung traf die Nachricht von deren schwerer Erkrankung aus Barcelona ein. Pollini wandte sich sofort an mich, ob ich den Pagen in kaum drei Tagen mehr lernen könne? Ich sagte zu. Obwohl ich nicht fließend italienisch sprach, wenn auch gewöhnt war, in der Sprache zu singen, und in Berlin wieder bei Maestro Pirani und dessen Gattin Stunden nahm, war's doch nicht leicht, da ich den Pagen in Aubers Maskenball gesungen hatte, der mir die alten Melodien gegen die neuen immer wieder aufzwang. Am dritten Abend sang ich aber die Rolle mit bestem Gelingen. Die Oper wurde wiederholt, und auch nach Hamburg gingen wir damit. In Goula lernte ich einen eminenten Kapellmeister kennen, der mich gar oft nach Spanien lud, und dem ich – weil ich die Einladungen abschlagen mußte – leider nie wieder begegnete. Die Rolle in italienischer Sprache in drei Tagen zu lernen war ein Kunststück. Es war aber nicht das letzte, das ich ausführte; und eines der vielen darf ich hier noch erwähnen.
Im Jahre 1875 schickte die Intendanz mittags um 12 Uhr zu mir, ob ich am Abend die Irma in »Maurer und Schlosser« singen und die Vorstellung retten wolle. Die Oper kannte ich gut, hatte auch die Henriette in Danzig darin gesungen, die Partie der Irma aber nie angesehen. Unter der Bedingung, nur das Allernotwendigste für den Abend lernen zu wollen, sagte ich zu. Um 4 Uhr war ich mit dem mir ziemlich unbekannten Duett und Finale, die beide recht schwierig sind, der ersten Arie und dem Dialog zu Ende gekommen; die zweite Arie wollte ich fortlassen. Als ich mich zum Fortfahren ins Theater vorbereitete, sagte meine liebe Mutter: »Lilli, es ist schade, daß du die zweite Arie fortläßt, sie ist viel dankbarer als die erste, ich habe sie immer viel lieber gesungen. Wenn du willst, so singe ich sie dir noch recht oft vor, dann lernst du sie noch schnell?« Gesagt, getan. Mamachen singt sie mir vor, ich singe sie nach und kann um 5 Uhr auch die zweite Arie. Im Theater wartete schon der Kapellmeister auf mich, mit dem ich die Rolle durchflog, ihm meine Tempi anzugeben, und fort ging's in die Schlacht! – Die Aufregung, die sich meiner bemächtigt hatte, war furchtbar, fast ohnmächtig fiel ich nach der ersten Szene in den Kulissen zusammen. Welche Sünde es ist, jemand so etwas zuzumuten, das sehe ich erst heute so recht ein. Ein Nervenschlag hätte mein Lohn sein können für die Gefälligkeit. Wer hätte mir meine Gesundheit und ein vernichtetes Leben vergütet? Viele Tage und Nächte lag mir die Erregung in den Gliedern, von der ich mich kaum wieder erholen konnte. Man wird mir sagen, daß es doch mein freier Wille und kein Zwang gewesen. Zugegeben; aber die Verlockung, eine Vorstellung zu retten, ist einem Künstler so angeboren, möchte ich sagen, daß es nur der Versuchung bedarf, um ihr bestimmt zu unterliegen.
Zu einer künstlerischen Ausarbeitung aller meiner Rollen, wie ich sie mir erträumt hatte, kam ich in Berlin vorderhand nicht. Die meisten Repertoireopern – auch wenn ich eine Rolle darin zum erstenmal sang – wurden ganz ohne Proben gegeben, und nur bei Einstudierung gänzlich unbekannter Werke wurde einem mehr Zeit gelassen. Freilich hatten wir ehrliche Künstler, die ihre Rollen für sich zu Hause studierten, damit fertig auf die Probe kamen und sich ineinander schickten, der Kleinere dem Größeren sich anpassend. – Denen tat ich's gleich vor allen andern, immer und überall. Für zweite oder dritte Kräfte aber, die weniger Künstler und meist gar nicht gewissenhaft waren, hatte man auch keine Zeit. Die sangen nun und spielten so schlecht oder gut, wie sie wollten und konnten. Wie vieles ließen Kapellmeister und Regisseure durchgehen, das oft haarsträubend, der Kunst unwürdig war.
Unter Regisseur Hein ging's noch, weil er den Sängern etwas zeigen konnte, aber er war oberflächlich, und auf den Proben ging's drunter und drüber. Dekorationen bekam man in den Proben überhaupt nicht zu sehen. Der ganze Chor ob beschäftigt oder nicht stand laut schwätzend auf der Szene. Manchmal war's zum verzweifeln. Nach einer Regimentstochter-Probe, die ich zum erstenmal singen sollte, wo es zuging, wie ich eben beschrieb, lehnte ich mich ernstlich dagegen auf. Aber es half mir nichts. – Unter Moritz Ernst wurde es nicht viel besser, vor allem andern wußte er viel weniger als sein Vorgänger. Dann kam Ferdinand von Strantz, der Nachfolger Laubes und Kompagnon Friedrich Haases in Leipzig. Da war's noch schlimmer. Strantz war ursprünglich Offizier, dann Sänger, dann Schauspieler gewesen, und nun Opernregisseur, bzw. Direktor der königl. Oper. Leider hatte er auch noch viele Nebenberufe; er spekulierte in Häusern, interessierte sich für Pferde und verkaufte beides. Kurz, er war von seinen eigenen Geschäften oft sehr in Anspruch genommen, daß er nur ein geringes Interesse seinem Hauptberufe entgegenbrachte, weil ihm die Häusergeschäfte nicht selten den Kopf recht warm machten. Die Proben wurden immer kürzer und unzulänglicher. Der Spielopern, in denen ich beschäftigt war, die auf den letzten Proben oft noch gar nicht zusammengingen, nahm ich mich an, indem ich meine Kollegen bat, nach den Proben auf der Bühne zu bleiben, damit wir Dialog und Stellungen noch besser fixieren konnten. Der Souffleur gesellte sich gern dazu, denn auch ihm lag daran, daß alles glatt ging. War doch manch einer dabei, der zu Hause gar nichts tun und alles von den Proben verlangen wollte, die eben nicht stattfanden. Die Nachsicht mit Anfängerinnen ging oft so weit, daß sie noch auf den letzten Proben die Rollen aus den Partien sangen. So etwas wäre an keinem Theater möglich gewesen und hätte von Rechts und von der Kunst wegen mit sofortiger Entlassung bestraft werden müssen. Ich frug mich nur immer, was man in Prag oder in Leipzig in solchen Fällen getan, was die Regisseure Hassel und Seidl gesagt hätten? In Berlin war es möglich und mit Frechheit von nichtskönnenden Anfängerinnen oft genug durchgeführt. Dann und wann spielte ich ganz energisch die Polizei, d. h., wenn ich beschäftigt war. Anderes ging mich nichts an. Daß ich von dieser Sorte als »neidisch auf junge Talente« erschien und bestens gehaßt war, läßt sich denken. Die Genugtuung ist mir aber geworden, daß manch ein Erfolg unserer hübschen Spielopern auf meine Rechnung zu setzen ist, nicht sowohl meiner Person wegen, sondern meines unermüdlichen Interesses halber für das Ganze, für das Kunstwerk, die Kunst und des Künstlers Ehre. Einmal auch begegnete es mir sogar, daß eine dieser »Künstlerinnen« sich nach ihrer Verheiratung herzlichst bei mir für die Zurechtweisungen bedankte und sich ihres unwürdigen Benehmens aufrichtig schämte. – Diese Art von unkünstlerischer Arbeit, von Gewissenlosigkeit und Leichtsinn, mit dem man so oft zu rechnen und zu wirken hatte, taten mir für die Kunst weher, als ich aussprechen kann.
Entschädigen mußten einen dafür alle diejenigen Aufführungen, in denen hauptsächlich alle ersten Kräfte beschäftigt waren, und eben solche, in denen ich autoritativ wirken konnte, indem ich auf eigne Faust mit den Nachlässigen probierte, mir einzelne sogar ins Haus bestellte und nicht eher locker ließ, bis sie einigermaßen Herren ihrer Rollen waren, zu dem ihnen allein Lust, Fleiß und Streben absolut fehlte. –
Hatte man nur mit sich allein zu tun, sich als passender Wert in Größeres einzufügen, dann war's ein Leichtes und eine Seligkeit. Nie hätte ich anders arbeiten mögen, nur immer mit höheren Geistern und größeren Talenten und nicht, um mich auf sie zu verlassen, sondern um mit ihnen zu kämpfen und zu ringen für das Ideal unsrer Kunst.
In Obhut ihrer zukünftigen Familie hatten wir meine Schwester zurückgelassen, die plötzlich alle Heiratspläne wieder aufgab; die Liebe zur Kunst war ihr zurückgekehrt. Wohl mochte sie sich die Verhältnisse anders erträumt haben, als sie in Wirklichkeit waren, und kurz entschlossen ging sie – nach manchem Ringen und Zagen – im Herbst 1871 nach Hamburg ins Engagement. Bald darauf holte sie unser alter lieber Freund, Direktor Behr, für fünf Jahre nach Köln. Einen Winter sang sie in Breslau, drei weitere Jahre in unserer alten Heimat Prag, und schließlich ging sie nach Wien, wo sie als k. u. k. Kammersängerin als Liebling des musikalischen Publikums vierzehn Jahre lang ununterbrochen tätig, noch heute unvergessen ist.
Als ihre Nerven aber wieder einmal und stärker als je vorher revoltierten, sagte sie – impulsiv wie immer – der Bühne Lebewohl. Viel zu früh beschloß sie eine reiche Karriere, viel zu jung und im Vollbesitz ihrer Stimmittel. Mahler wollte sie Wien durchaus wiedergewinnen, doch konnte sie sich nicht mehr entschließen, die Bühne wieder zu betreten, trotzdem ihr das Leben ohne ihre Kunst, leer und zwecklos vorkam.
Auch hier muß ich zurückgreifen. Im Jahre 1872 forderte mich Richard Wagner auf, die Sopranpartie in der 9. Sinfonie zur Grundsteinlegung des Bayreuther Wagnertheaters zu singen, doch wurde mir der Urlaub verweigert. Ich schlug Wagner vor, meine musikalische Schwester dafür zu engagieren, die sich ihrer Aufgabe zu seiner Zufriedenheit entledigte.
Wie leid tut es mir noch heute, daß ich die erhebende Feier der Grundsteinlegung nicht habe mitmachen können. Ich begriff aber auch, daß ich gerade zu der Zeit in Berlin unabkömmlich war, ich durfte nicht murren. Es gehörte zu den größten Enttäuschungen meiner lieben Mutter, daß Riezl die wiederholten Engagementsanträge Hülsens aus ganz haltlosen Gründen ablehnte, denn sie hätte es für die größte Freude ihres Lebens erachtet, uns beide an einer so großen Bühne vereint zu sehen. Später machte es sie freilich auch sehr glücklich, Riezlchen in Wien so außerordentlich anerkannt zu wissen. Sicher bin ich, daß meine Schwester besser nach Wien paßte als ins ernste Deutschland, dort, wo ihrer Heiterkeit und sorglosen Kollegialität ein angenehmerer Boden vorbereitet lag.
Im Laufe der fünfzehn Jahre meines Berliner Engagements sang meine Schwester sehr oft für mich an der königlichen Oper, so oft sie bei uns zu Besuch, ich zu Gastspielen fort war, was nach Abschluß meines zweiten Berliner Kontraktes gar oft der Fall gewesen. Leider konnte sie nicht überall für mich singen.

Marie Lehmann.
Anfangs der 70er Jahre erhielt ich folgendes Telegramm: »Können Sie morgen hier Rosine singen? Schloß.« Natürlich konnte ich. Ich besann mich nie lange, wenn es sich darum handelte, am Platz zu sein; hatte nichts Eiligeres zu tun, als mir von Hülsen den Urlaub zu erbitten, den er sofort bewilligte, besorgte mir mein Kostüm, telegraphierte an Schloß-Dresden, daß ich käme, und fuhr am andern Morgen um 8 Uhr selbst nach dort. Sehr erstaunt, keine Probe angezeigt vorzufinden, gehe ich ins Theater und erfahre zu meinem größten Schrecken, daß Schloß seit einem Jahre schon nicht mehr in Dresden, sondern in Hamburg sei und mich wahrscheinlich dort erwartete. Von Schloß' Rücktritt hatte ich kein Wort gehört, ich kannte Schloß nur in Dresden und war hauptsächlich darüber entsetzt, daß dieser nun in Hamburg umsonst auf mich wartete. Sofort telegraphierte ich: »Irrtümlich Dresden gereist,« und mußte mich schließlich dabei beruhigen, da ich's nicht ändern konnte. Dafür ging ich in die Galerie und sah zum erstenmal die »Sixtina«, ich möchte lieber sagen: zum erstenmal ein Bild! Bei seinem Anblick schwand mir jeder Irrtum, es war mir gleich, ob sie in Hamburg eine Rosine hatten oder nicht, ich sah nur dieses Bild, das mir zur lebendigen Erlösung wurde, mich in eine Kunst einweihte, die ich bis dahin noch nicht verstanden hatte. Der Eindruck war so nachhaltig wie Wagners Tristanvorspiel, obwohl beides so Grundverschiedenes gibt. Nur daß beides vom Genius empfunden und geschaffen war. Mir scheint, es gäbe kein größeres Glück, als ihn empfinden und verstehen zu dürfen!
Falls ich mich verbessern wollte, war es jetzt an der Zeit, meinen Kontrakt, der nach dem dritten Jahre – von beiden Seiten ungekündigt – stillschweigend unter den alten Bedingungen weiter laufen sollte, zu kündigen. Ich kündigte ihn also der Generalintendanz. Hülsen nahm die Verhandlungen auf, indem er mir zwei Vorschläge machte: Einen mehrjährigen Kontrakt mit erhöhter Gage oder einen lebenslänglichen Kontrakt mit 13 500 Mark Gehalt, ungarantiertes Spielgeld (45 Mark pro Abend) mit Pensionsberechtigung nach den Gesetzen für königliche Beamte. Ich war für die höhere Gage und kurze Kontraktzeit, Mamachen plädierte für den lebenslänglichen Kontrakt, der ihr das Bewußtsein meiner gesicherten Zukunft gab, dessen Bedingungen mir aber – selbst für die damaligen Verhältnisse, und vor allem für das, was ich in mir fühlte – zu gering erschienen, und den ich später immer noch zu erhalten meinte. Da Hülsen auf erhöhte Forderungen nicht einging, brachen wir die Verhandlungen ab. Nun folgte, was immer zwischen zwei Kontrahenten folgt, die nicht zusammenkommen können, eine Spannung. Man sah sich nicht gern, ging einander aus dem Wege. Aus der »Perle«, wie mich Hülsen in Briefen ansprach, wenn ich gefällig gewesen, für andere eingesprungen war oder über Nacht gelernt hatte, wurde wieder »Sehr geehrtes Fräulein«. Ich ärgerte mich, Hülsen ärgerte sich. Schon bevor ich nach Berlin ging, hatte ich Anträge von Dresden und Wien, Oberregisseur Schloß war schon in Leipzig wegen Kontraktes für Dresden bei mir gewesen, aber ich wäre ungern fort von Berlin, wo ich doch festen Fuß gefaßt und so glänzende Vorbilder hatte. Meiner lieben Mutter war's traurig zumute, ich konnte sie durch nichts heiter stimmen. Eines Tages tat Hülsen den ersten Schritt. Er redete mir nochmals eifrig zu, den lebenslänglichen Kontrakt zu unterschreiben, und obwohl es noch eine ganze Weile dauerte, bis er meiner Forderung: einen dritten Monat Urlaub – den man mir eventuell für doppelte Gage und doppeltes Spielgeld abkaufen sollte – nachgab, unterschrieb ich endlich. Tatsächlich nur, um meine liebe Mutter über meine Zukunft zu beruhigen; ich selbst konnte mich über die Folgen dieses Kontraktes keinen Augenblick täuschen. Ich wußte nur zu gut, daß ich mit dieser Unterschrift das Los einer königlichen Beamtin besiegelt hatte, daß ich in meiner Karriere niemals auf die Höhe, die ich zielbewußt in mir trug, gelangen, daß ich von Hülsen weiterhin als Utilité betrachtet werden, und er mich nie in meinen künstlerischen Zielen unterstützen würde. Die Zukunft bestätigte meine Befürchtungen.
Nun mein Bleiben gesichert war, dachte ich zuerst daran, mir einen guten Flügel anzuschaffen. Um meine kleinen Ersparnisse nicht anzurühren, erbat ich mir dafür einen Vorschuß, den man mir weigerte, es sei denn, daß ich ein »Armutszeugnis« einbrächte. Ich dankte und kaufte den Bechstein-Flügel dennoch, der aber nicht über unsere enge Haustreppe ging; und da es auch durchs Fenster unmöglich war, mußte er wieder ins Lager zurück. Nun litt es mich nicht mehr in der unbequemen Wohnung, wir gingen, eine bessere zu suchen.
Unterdessen war Frau Römer aus Prag mit Kopf- und Gliedschmerzen angekommen, und nach drei Tagen konstatierte unser alter Theaterarzt, Sanitätsrat Haugh, »die Pocken«. Er ordnete sofort alles zu ihrer Überführung ins Pockenlazarett an, und während ich zur Probe ging, zog Mama ihre arme Freundin – deren Nägel und Kopfhaut bereits blau waren – selber an, um sie an den bereitstehenden Krankenwagen zu führen. Weder Mama noch ich fürchteten uns vor irgendeiner Ansteckung, aber es war uns Herrn Römers wegen sehr fatal, der sich auf die Nachricht hin ganz verzweifelt und äußerst ungerecht gegen uns benahm. Meinte er doch, sie habe sich in Berlin angesteckt, während sie die Krankheit tatsächlich von der Reise mitbrachte. Sanitätsrat Haugh bestand darauf, uns andern Tags zu impfen. Aber schon am Abend vorher stellten sich bei mir plötzlicher Schüttelfrost und starkes Fieber ein, das nach einigen Stunden ebenso plötzlich wieder verschwand und keine weiteren Folgen hinterließ. Die Impfung hatte bei mir auch nicht den geringsten Erfolg, während Mamas rechter Arm sehr stark anschwoll.
Bei der armen Frau Römer hatten sich die schwarzen Pocken entwickelt, deren Gefahr wir uns keinen Augenblick verhehlten. Als sie wieder genesen war, erzählte sie uns, wie sie eines Nachts gelähmt dagelegen, den Arzt sagen hörte, daß sie tot sei. Erst nachdem er mit der Wärterin den Saal verlassen, sei ihr eine überirdische Kraft gekommen. Sie erhob sich, stürzte aus dem Bett, rannte in rasender Eile über die drei Treppen in den Hof hinunter, wo sie, von starken Händen umfaßt, ohnmächtig zusammenbrach. Von dem Augenblick besserte sich ihr Zustand.
Schon nach wenigen Wochen gingen wir täglich ans Hospital am Moritzplatz, brachten ihr stärkendes Essen und Getränke und sahen die Arme aus der Entfernung aus den schwarzbehängten Fenstern uns zunicken, bis unser Arzt sie uns eines Tages – sehr verändert – wieder zuführte. Ein trauriges und doch auch frohes Wiedersehen! Sie war munter und freute sich ihres wiedergewonnenen Lebens. Am selben Abend fuhr sie auf Wunsch des Arztes, von uns beiden zur Bahn gebracht, nach Prag zurück in die Arme ihres Gatten. Es dauerte sehr lange, bis dieser sich beruhigte und uns von aller Schuld frei sprach. Wie Hohn des Schicksals klang es, als uns zwei Jahre später Frau Römer davon benachrichtigte, daß ihr Gatte an den schwarzen Pocken gestorben sei. Sechs Monate vor seiner vollständigen Pensionierung, die ihm das Vierfache seiner jetzigen Einnahmen in Aussicht stellte, nach 30jähriger Berufszeit, um die er mehr als 20 Jahre allen Demütigungen als Künstler, allen pekuniären Abzügen getrotzt und mit seiner Familie geradezu kümmerlich eingeschränkt lebte, um die so sauer erworbenen Früchte der traurigen Zeiten in seinen alten Tagen zu genießen, um die ihn der Tod nun auch noch betrog!
Mama war zur Kur nach Marienbad abgereist, meine Schwester zu mir gekommen. Die Wohnungsfrage mußte nun endlich erledigt werden. Meine Mutter hatte sich eine passende Wohnung auf dem Leipziger Platz Nr. 19 angesehen und mir empfohlen; als ich aber die Mansardenfenster von unten sah, die nach dem Potsdamer Platz liefen, weigerte ich mich, hinaufzugehen, und sagte stolz: »In die Fenster bringen mich keine zehn Pferde«. Wir hatten eines Tages in der Charlottenstraße eine Wohnung angesehen, die ich bestimmt zu mieten gedachte, als uns der Zufall am Leipziger Platz vorbeiführte und mir die Wohnung Nr. 19 ins Gedächtnis zurückrief. Der Zettel hing noch am Hause, und besser gelaunt entschloß ich mich zum Aufstieg in den dritten Stock. Da flutete mir so viel Sonne, Licht und Wärme aus den kleinen neu hergerichteten Mansardenzimmern entgegen, denen ein einziges großes »Turmzimmer« als Aushängeschild diente, daß ich unbekümmert um alle Nebenumstände und den hohen Preis die Wohnung nahm und siebzehn Jahre lang behielt.
»Die goldene Sonne« in Leipzig, in der es so eisig ziehen konnte, hatte mir ein sehr unangenehmes Andenken hinterlassen. Es zwickte, zwackte und riß mich schon seit lange an Händen, Füßen, Armen, Beinen, Kopf und Schultern, der Schmerz flog unaufhörlich hin und her und steigerte sich bis zur Unerträglichkeit. Ich wurde gezwungen, in Wiesbaden Heilung vom fliegenden Rheumatismus und meinen Schmerzen zu suchen, wo Mama und ich während meiner Urlaubszeit im »Hotel Adler« stille Wohnung und ausgezeichnete Verpflegung fanden. Meist lagen wir um ½9 schon in den Federn, nur selten gingen wir ins Theater, das übrigens ausgezeichnet war, und wo wir Wilhelm Jahn und Gabriele Szégal, die dramatische Sängerin meiner Prager Epoche, wiederfanden. Gabriele Szégal hatte die größte und wärmste dramatische Stimme, deren ich mich erinnere. Sie war nebst Marie Wilt auch die letzte jener Sängerinnen, die außer hochdramatischen Rollen noch die Konstanze in der Entführung großartig sang und auch die Königin der Nacht singen konnte. Groß und stark, schien sie dennoch knochenlos in den oberen Extremitäten. So oft sie Hände und Arme aufhob, sanken sie haltlos sofort wieder herunter; nie kam eine ruhige Bewegung, nie der geringste Ausdruck dadurch zustande, und mit den Gesichtsmuskeln war's nicht viel besser. Sehr befreundet, übersprachen wir die Tatsache, doch gelang es der unendlich fleißig-strebsamen Künstlerin nicht, ihre Energie auf das Festhalten von Hand- und Armstellungen zu konzentrieren. Ich erwähne es, weil mir nie vorher oder nachher im Leben ähnliches Unvermögen vorgekommen ist.
An der Table d'hôte unseres Hotels, deren Präsident General von Schlichting war, lernten wir Kaufherrn Schwabe aus Manchester kennen, der bald darauf nach Berlin übersiedelte, in dessen Familie ich viel verkehrte; außerordentlich feinfühlende, gebildete Menschen. Bei ihnen traf ich im fröhlichen Kreise Rubinstein, Adolf Menzel, Ernst von Wildenbruch und Karl Maria von Webers Sohn, dessen Tochter Maria sich Ernst von Wildenbruch zur starken Lebensgefährtin erkor.
Auch Bodenstedt lernte ich in Wiesbaden kennen, der auf Spaziergängen öfter unser Begleiter wurde, mir aber trotz seines entzückenden Mirza Schaffy keine Sympathie abgewinnen konnte; ein Resultat, das sich bei seinen Berliner Besuchen nur erneuerte.
Die Kur bekam uns glänzend. Nie noch hatten Mutter und ich uns die unbedingte Ruhe gegönnt, die uns beiden seit langem schon not tat. Das regelmäßige Leben, der schöne Aufenthalt, frühes Zubettgehen ruhten meine Nerven und den angestrengten Körper aus. Die rheumatischen Schmerzen freilich nahmen wie nach jeder Heißwasserkur mehr überhand, aber nach Jahresfrist war ich vollständig davon befreit, sie meldeten sich nie wieder.
Ehe ich Wiesbaden verließ, sang ich in einem Konzert und zwei Tage darauf in Jahns Benefiz die Königin in den Hugenotten. Wie freute ich mich, Jahn gefällig sein zu dürfen, der uns als Kinder kannte und gegen Mama stets liebenswürdig gewesen war. Fräulein Szégal lieh mir ihre Kleider, aus deren Taillen alle Seitenteile genommen wurden, denn ich war noch immer übermäßig schlank, was dem Erfolg des Abends keinen Eintrag tat und mich, wie jeder Erfolg, ein wenig stolz machte.
Wie sonnig war's in unserer neuen Wohnung! Nicht viel größer, nicht eleganter als die alte, aber überall sah man auf Gärten und blühende Bäume. Die alten herrlichen Linden am Leipziger Platz, von denen die eine den ersten Sonnenstrahl des Ostens empfing und darum allen andern um mindestens acht Tage voraus war. Wenn sie dann alle ihre zarten durchsichtigen Blattgewebe eben ausgeschossen hatten, die schwarzen Äste und Zweige aber noch durchschimmerten, sahen sie aus wie hellgrüne Schleier körperloser Elfen aus alten Märchen. Mit jedem Frühling wurde das alte Wunder ein neues, herrlicheres, stimmungsvolleres. Unseren Fenstern gegenüber, die nach dem Potsdamer Platz liefen, stand das kleine Tiergarten-Hotel mit seiner blühenden Zauberecke, in der es monatelang täglich etwas Neues, Blühendes zu betrachten gab. Man hatte dabei das Gefühl des Eigentums, oder eines lieben Andenkens, das man keinem andern gönnen mochte, aus Angst, es könne weniger heilig gehalten, weniger geliebt werden. Und die alten Kastanienbäume der friedlichen Bellevue- und Potsdamerstraße! Mußte es nicht hell sein, wo so viele Kerzen leuchteten? Und fast mitten auf dem Platz stand die kleine brüchige »Comode«, die Ringapotheke, oder ihrer schlechten Medikamente halber vom Berliner die »Giftapotheke« getauft, von deren kleinem Balkon des ersten Stockes bei jeder patriotischen Gelegenheit zwei elende, kleinste schwarzweiße Fähnchen wehten. Und durch die ganze Königgrätzerstraße lief ein Bahngleis, auf dem Frachtzüge von einem Pol der großen Stadt zum andern mit Glockengeläute geschoben, d. h. gefahren wurden. Und was fuhr, zog und ritt nicht alles an uns vorbei! Der ganze Hof von und nach Potsdam und alle Einholungen fanden dort statt. Als ersten sahen wir den Schah von Persien einziehen. Und Regimenter zogen mit klingendem Spiel zu Paraden oder Übungen aufs Tempelhofer Feld, von deren Uniformen Mamachen immer per »Maskerade« sprach. Und der Tiergarten, in welchem man damals noch allein, sorglos spazieren gehen konnte, ohne Furcht vor Raub und Mord. Und der zoologische Garten, worin uns jedes Tier kannte und seine Freude ausdrückte bei unserem Kommen! Damals war Berlin noch eine kleine große Stadt, und urgemütlich waren die Berliner, die, nur noch in wenigen Originalen vorhanden, längst im Aussterben begriffen sind. Ach ja, Erinnerung ist ein Paradies, worin Glück, Dankbarkeit und Zufriedenheit ihre Lieblingsplätze zeitlebens besetzt halten.

Und wenn nach Bayreuth 76 die Ulanen am Potsdamer Platz gar so schön bliesen, so wußten wir, daß es unser damals noch junger Major – heute unser lieber, treuer, alter Freund, General Oscar v. Rabe, Exzellenz, war, der, seinem Regiment vorausreitend, so schön aufspielen ließ, dem wir huldvollen Dank vom hohen Balkon herunternickten. Das heißt, einen Balkon hatten wir nicht, wohl aber einen Dachgarten, auf dem wir uns wie Freiinnen dünkten; oder wir lächelten aus hohen Fenstern hernieder dem treuen Ritter zu.
Anfangs der siebziger Jahre war Oscar v. Rabe Adjutant des alten Wrangel gewesen, ihm und seiner Gattin bis in den Tod ergeben, was die Berliner nicht hinderte, den jungen Adjutanten »das Kindermädchen« zu nennen. Papa Wrangel war schon sehr kindisch! Oscar v. Rabe sang selbst recht gut, war Theaterenthusiast wie wenige. In Bayreuth erklomm er trotz seiner Anbetung für Mozart doch auch die Staffel des Wagnertums, wie er gleich allen Musikenthusiasten überall zu finden war, wo Kunst und Künstler Großes darzubieten versprachen.
Unser Haus, auf dessen Stätte sich heute das große Palast-Hotel erhebt, war vom Obertribunalsrat Heffter erbaut, der den ersten Stock bewohnte, das Haus aber bereits an Herrn Alwin Ball, im zweiten Stock, verkauft hatte. Den dritten Stock teilten wir vorläufig mit einer Witwe und deren drei Kindern, bis ich später die ganze Etage nahm, die nun aus acht Zimmern usw. bestand und auf den Potsdamer und Leipziger Platz die Aussicht hatte. Von Heffters, mit denen ich freundschaftlich eng verbunden war, brauche ich nur eine kleine Episode zu erzählen, um sie zu kennzeichnen. Als der liebe alte, 83jährige Obertribunalsrat starb, unterließ ich alles Singen, mußte aber am dritten Tage notwendig üben, nachdem ich zuvor herzlich hatte um Entschuldigung bitten lassen. Die einzigliebe Frau ließ mir sagen, das solle ich ja tun, denn ihr lieber Alter würde sich noch im Sarge freuen, mich zu hören. Glücklicher, gesunder Humor würzte der ganzen großen Familie das Leben, die doch auch manches Schwere zu ertragen hatte. Und wie ich die Großeltern liebte und verehrte, so hängen noch heute Enkel und Enkelkinder an mir in treuer Liebe und Freundschaft.
Ehe wir im Sommer 1874 in Selisberg Aufenthalt nahmen, hatte ich nach einer ziemlich anstrengenden Saison noch die »Genofeva« von Schumann für Hülsen gelernt, der die Oper gerne geben, sie aber erst sehen wollte, um sich ein Urteil darüber zu bilden. Wiesbaden, wohin er nach der Saison meistens ging, schien ihm der geeignetste Ort dafür. Dort also sang ich erst die Susanne im Figaro und gleich darauf, mit einer einzigen Probe, die Genofeva, mit der ich mir sehr viel Mühe gegeben hatte – die dann aber in Berlin, zum Dank, Frau Mallinger sang. Zu einer Wiederholung konnte ich mich nicht entschließen, da ich mich nach Ruhe und Freiheit sehnte.
Wir trafen Ende Juni in Selisberg ein. Zum erstenmal sah ich die Schweiz und ihre schönste Perle: den Vierwaldstätter See! Wir waren mit Gewitter über den See und oben am Hotel angekommen. Als wir aber gleich darauf heraustraten, stand über dem Axenstein – uns gegenüber – ein Regenbogen, wie es in Schillers Tell beschrieben, wenn die Männer am Rütli – eigentlich Grütli – unterhalb Selisberg, schwören. Wie ein Wunder stand die Szene vor unseren Blicken, obwohl es sich im Tell bekanntlich um einen Mondregenbogen handelt, den ich erst fünfzehn Jahre später, ebenfalls in der Schweiz kennen lernen sollte.
In Selisberg trafen wir Freiherrn von Rommel aus Kassel, der sich meiner Mutter lebhaft erinnerte, dessen Tochter ausgezeichnet Harfe spielte, und mit dem sie oft alte Erinnerungen tauschte. Es fand sich auch sonst für uns sehr angenehme Gesellschaft zusammen. Eines Tages kamen zwei junge Männer angereist. In demjenigen der einen Violinkasten trug, erkannte ich unseren alten Leipziger Freund, Wilhelm Schwendemann – später Professor am Würzburger Konservatorium; in dem anderen Dr. S. aus Berlin, später berühmter Halsarzt in London, die beide auf einem Bummel begriffen, uns zu überraschen gedachten. Die wenigen Tage, die sie sich oben aufhielten, benützten wir zum Musizieren. Dr. S. spielte glänzend Klavier, Schwendemann war ein ausgezeichneter Geiger. Nun wurde alles hervorgesucht, was mit Begleitung der beiden Instrumente zu singen war, ganz Selisberg stand auf dem Kopf. Natürlich fehlte es nicht an der Ursache zu einem Wohltätigkeitskonzert, das unter unserer »gütigen Mitwirkung« vom Morgen auf den Abend veranstaltet und 1000 Frs. für einen armen schwindsüchtigen Kapellmeister eintrug. Die eigentlichen Veranstalter des Konzertes waren: Herr und Frau General von Voigts-Rhetz, die erst selber spielen sollte, dann aber absagte, und die berühmt schöne Frau von Mutzenbecher aus Wiesbaden, die Kaiser Wilhelm gerne sah. Als die beiden fahrenden »Musikanten« talabwärts gezogen waren, wurde es wieder still und beschaulich in unserem Hotel und auf dem Berge.
Das Ereignis dieses herrlichen Aufenthaltes bildete ein Brief Richard Wagners an meine Mutter, worin er anfrug, ob wir beiden: Riezl und ich, in den Bayreuther Festspielen mitwirken könnten; er brauche frische, junge Kinder. Um alles Nähere zu besprechen, würde er sich freuen, uns bald in Bayreuth zu sehen. Mit freudigstem »Ja« sagten wir Wagner zu und versprachen unser Eintreffen in Bayreuth für Anfang August einzurichten.
Wir sollten noch Zeugen eines furchtbar traurigen Ereignisses sein, ehe wir Selisberg verließen. Föhn brach herein und hielt alle Gäste tagelang im Hause gefangen. Nur die Beherztesten, zu denen ich mich rechnen darf, trotzten Sturm und Regen und liefen durch Wälder über Berge. Hiobsposten drangen durch Boten zu uns herauf, Gäste konnten weder herauf noch hinunter, bis endlich nach acht Tagen das Wetter sich zu ändern anschickte. Kaum hatte ich ein Fleckchen blauen Himmels erspäht, das der Nebel sofort wieder neidisch verhüllte, als ich mich in Begleitung des alten Herrn von Rommel aufmachte, nach Weggis hinunter zu marschieren, teils um mich auszulaufen, teils um die Schäden zu besehen. Schon unterwegs boten sich uns schreckliche Bilder; die schönen Wege waren unpassierbar. Hier lagen herrliche Bäume darüber, dort waren große Flächen Äcker und Wiesen in die Tiefe abgerutscht, nur kahle Felsen sichtbar, auf denen sonst üppige Wiesen lagerten; vieler Jahre Mühen total vernichtet.
Beim Anblick der traurigen Bilder wüster Zerstörung ergriff mich ein wahrer Kummer, den ich heute noch tausendfach stärker empfinde, seitdem ich weiß, was alles in Stunden vereinter lebendig gewordener Elementarkräfte der Vernichtung preisgegeben ist. Da hegt und pflegt man an jedem Blümchen, jedem Tierchen, pflückt keinen Halm, zertritt kein Insekt, um sie dem Haushalt der Natur zu erhalten, und in einer einzigen Minute machen wütende Elemente Myriaden von Lebewesen, Blumen und Bäumen zu nichte.
Sämtliche Ortschaften am See standen tief unter Wasser, mit Kähnen hielt man den Verkehr aufrecht; ein ungeheurer Schaden war angerichtet. Traurig erstiegen wir die nun fast weglose Anhöhe. Ich wollte nicht mehr hineinsehen in das – wie mir schien nie wieder gut zu machende Unglück. Solcher Naturereignisse gewohnt, vielleicht auch stärker, weniger fein besaitet als wir, hatten die Schweizer nur weniger Tage bedurft, alles zu säubern; und sobald sich das Wasser verlaufen hatte, waren auch schnell die letzten Merkzeichen des Unglücks verschwunden. Mir aber tat's noch lange weh, nachdem wir Selisberg den Rücken kehrten, mit Alpenveilchensträußen überschüttet, die uns viel dankbare Menschenkinder mit auf den Weg gaben, die gut gemeint, mir in dieser Überfülle aber schon damals ein Vandalismus schienen, ein Raub an der Natur. –
Brichst Du Blumen, sei bescheiden
Nimm nicht gar zu viele fort! –
Nimm ein paar und laß die andern
In dem Grase, an dem Strauch!
Andre, die vorüberwandern
Freu'n sich an den Blumen auch.
(Joh. Trojan.)
Die liebe Sonne hatte es sich angelegen sein lassen, mir allüberall ein freundliches Plätzchen anzuweisen. Wie bescheiden, gut und billig wohnte man damals in der lieben Bayreuther Sonne! Außer dem Stammgast, Hauptmann von Schrenck, einem Freunde Wagners, der sich uns sogleich verstellte, waren Mama und ich die einzigen Hotelgäste. Wirt und Wirtin nahmen teil an dem vortrefflichen Mahl, das aus Suppe, Rindfleisch mit Kren (Meerrettich) und einer Mehlspeise bestand und pro Person 60 Pfennige kostete.
Am Nachmittag gingen wir zu Wagner. Da standen wir nun vor »Wahnfried« und lasen die vielbewitzelte Inschrift des Hauses:
»Hier, wo mein Wähnen Frieden fand
Wahnfried sei dies Haus von mir genannt.«
ein Fremdes, in das man hineinzuwachsen hatte!
Wagner empfing uns wie alte, liebe Freunde, die er tatsächlich, in meiner Mutter wenigstens, vor sich hatte. Nachdem wir auch Frau Cosima – von ihr aufs liebenswürdigste begrüßt – kennen gelernt, Wagner uns über seine Absichten etwas unterrichtet hatte, schlug er die Partitur von Rheingold auf, aus dem er uns die erste Szene spielte und sang. Kaum hatten wir einige Takte vernommen, als ich entzückt von dem melodischen Wohlklang der Harmonien, Woglindes Stimme vom Blatte zu singen mich hingerissen fühlte. Die ganze Heiterkeit, den Übermut der drei Mädchen erfassend, sah ich die Szene vor mir. Wie langersehntes Glück kam es über mich, wohl fühlend, daß ich Wagner etwas geben würde können, auf das er mit Recht hoffen durfte: Lust, Liebe und Verständnis zu seinem großen Werke. Gleich nach den ersten Takten hatte ich die Rollen im Kopfe besetzt und sagte zu Wagner, als wir die Szene geendet hatten: »Woglinde singe ich, Wellgunde meine Schwester, Floßhilde Fräulein Lammert; Sie brauchen sich um die Drei nun nicht mehr zu kümmern, lieber Herr Wagner.« Daß Hülsen uns den notwendigen Urlaub für die Proben 1875 und die Vorstellungen 1876 nicht weigern würde, setzte ich voraus.
Das große Bibliothek-, Empfang- und Schreibzimmer Wagners, in das man durch eine Halle – in welcher Büsten aufgestellt – gelangte, nahm mein regstes Interesse in Anspruch. Ein breites Viereck, von dessen rundausgebauter Breitwand gegenüber dem Eingang – eine Freitreppe in den schönen Garten führte, der, an den königlichen Garten stoßend, noch größer schien, als er eigentlich war, und zu dem Wagner Zutritt hatte. Rings an den Wänden Regale voll kostbarer Bücher in kostbaren Einbänden. Darüber Ölgemälde von König Ludwig und Gräfin d'Agoult, Frau Cosimas Mutter, unter dem Pseudonym »Daniel Stern« als Schriftstellerin bekannt. Links – vom Eingang gesehen – stand Schopenhauers Bild vor Wagners großem Schreibtisch, rechts der Flügel und Wilhelmine Schröder-Devrients Büste, die Wagner so hoch verehrte. Zwischen Bücherregalen und langen Tischen, auf denen viele Denkwürdigkeiten auf prächtigen Stoffen lagen, standen, wie im ganzen Raume, bequeme Stühle und Fauteuils aller Arten und Zeiten. Von der Freitreppe aus sah man über Rasen hinweg auf eine von Sträuchern beschattete Marmorplatte, der einstigen Ruhestätte Richard Wagners.
Wir sahen auch die vier Töchter und den kleinen stillen, kaum vier Jahre alten Siegfried, der in seinem Gärtchen grub und pflanzte. Jedes der Kinder hatte sein Plätzchen, wo es der Gärtnerei obliegen durfte. Zwei große Bernhardinerhunde, Marke und Brangäne, und mehrere Teckel liefen im Hofe herum; Wagner war ein großer Tierfreund. Wir aßen noch bei Wagners, wobei er viel über Vegetarismus sprach, den er so gerne ganz und gar angenommen hätte, dem sein Arzt aber entgegen war. Nach dem, was ich heute davon aus eigener Erfahrung kenne, bin ich sicher, daß Wagner – ohne in extremen Vegetarismus umzuschlagen – dem Leben dadurch länger erhalten geblieben wäre.
Andern Tags fuhren wir nach Berlin zurück, die Ferien waren zu Ende.
Nun galt es, meine Schwester sowohl als unsere jüngste Altistin, Minna Lammert, für die Rheintöchter zu gewinnen, die beide, überglücklich, annahmen. Minna Lammert war, gleich meiner Schwester, urmusikalisch, hatte eine sammetweiche Stimme, die einen schönen Hintergrund für unser beider hellen Sopranstimmen zu geben versprach – und ein außerordentlich heiteres Temperament, dem sie zeitweilig übermütig die Zügel schießen ließ. Das war's, was ich für die Rheintöchter brauchte. An Ordnung gewöhnt, alle Eventualitäten bedenkend, erwirkte ich uns für die Proben 1875 sowohl als für Proben und Vorstellung 1876 den Urlaub bei Hülsen, den er bereitwilligst zusagte, obwohl er damals noch durchaus nicht »Wagnerianer« war. Sehr bald darauf kamen unsere Rheingoldstimmen aus der »Nibelungenkanzlei«, wie man die Arbeits- und Wohnräume der Kapellmeisterjünger Anton Seidl, Felix Mottl und Franz Fischer usw. in Bayreuth nannte. Und da meine Schwester sich eben für längere Zeit bei mir aufhielt, konnten wir mit dem Studium sofort beginnen.
Das Rheingold hatten wir uns schnell zu eigen gemacht, es klang schon prächtig und löste in uns allen ein Glücksgefühl aus, dessen wir uns gar bald bewußt wurden. Anders war's mit der Götterdämmerung, deren Stimmen viel später erst in meine Hände gelangten, sehr klein geschrieben, schwer zu entziffern waren und mir viel Kopfzerbrechen verursachten. Wenn ich noch bedenke, wie ich darüber brütete und immer wieder zu dem Schlusse kam: es müsse falsch abgeschrieben sein! Als mir dann aber die gedruckten Stimmen die Harmonien deutlich machten und bewiesen, daß es so klingen müsse, da mußte es eben klingen und klang auch. Mit der Klarheit kamen Freude und Genuß an den Schönheiten des Werkes, die sich uns täglich, stündlich gewaltiger offenbarten und uns langsam zu den Gestalten emporwachsen ließen, die wir sein mußten.
Zu Rheingold und Götterdämmerung kam noch die Walküre, in der ich die Helmwiege, meine Schwester die Ortlinde, Minna Lammert die Roßweiße singen sollten, und für mich der Waldvogel im Siegfried. Alles, so wollte ich's, sollte bis zum Frühling 1875 fix und fertig studiert sein. – Trotz Wagners lebhaftem Wunsch gelang es mir leider nicht, seine Nichte, Frau Johanna Jachmann-Wagner, unserem Walküren-Studium anzugliedern. Sie war oft leidend oder auch anderweitig in Anspruch genommen, wir mußten das Studium eben auf uns drei beschränken. Was aber waren alle Schwierigkeiten dieser Rollen gegen die einzige Stelle in der Götterdämmerung:
»so weise und stark verwähnt sich der Held
als gebunden und blind er doch ist!«
Unüberwindlich schien damals, was überwunden werden mußte und überwunden ward. –
Wollte ich mein Programm ausgeführt sehen, so mußten wir außerordentlich fleißig sein. Der Winter brachte mir viel Anstrengung durch unendliche Proben zu Neuaufführungen, und das alte Repertoire stand auch nicht still. Nachdem ich schon in Tauberts Macbeth die erste Hexe gesungen, an die ich mich mit wahrer Schaffenslust machte, kreierte ich auch noch die Maria in seinem Cesario (nach Shakespeares »Was Ihr wollt«). Diese entzückende Rolle, die ich nach besten Kräften gestaltete, voll Leben und Übermut ausstattete, brachte mir die erste und einzige Strafe am »schwarzen Brett« im Konversationszimmer ein, die mich 3 Mark kosten sollte! Zur Serenadenszene im zweiten Akt, wo Maria, um Malvolio zu necken, in ihrer Herrin Kleidern am Fenster erscheint, ihm eine Rose zuzuwerfen, die sie in Händen trägt, hatte ich mir eine Riesenrose, es war wohl ein Lampenschirm, anfertigen lassen und rückte erst im letzten Moment damit heraus. Natürlich lachte das Publikum, meine Kollegen, und nur der scherzfeindliche Direktor Ernst war wütend. Nach Rücksprache mit Hülsen, der selber furchtbar gelacht hatte, schenkte man mir die Strafe und entfernte den Aushang.
»Cesario« kam im November, im Januar »A-ing-fo-hi« von Würst, heraus. Am 17. April erlebten die »Maccabäer« von Anton Rubinstein ihre Premiere und einen großen nachhaltigen Erfolg. Die Oper, die außer in Berlin nur über wenige Bühnen ging und schnell wieder verschwand, dankte ihren dauernden Erfolg der so günstig individuellen Besetzung aller Hauptrollen. Marianne Brandt war als Leah unerreichbar. Zwar wehrte sie sich mit Händ' und Füßen gegen die »Altpartie«, eine Marotte, die sie fortwährend mit sich selbst in Kämpfe verstrickte, führte während der Proben die schrecklichsten Szenen auf, behauptete laut klagend und weinend: »die Rolle ist der Nagel zu meinem Sarg!« sang die Rolle aber mehr als 50mal, ohne daran zu sterben. Ihr hauptsächlich hatte A. Rubinstein den Erfolg zu danken, die ihre Partie mit aller künstlerischen Hingabe und dem Aufgebot all ihrer Kräfte ausstattete. Betz war ein ganzer Mann als »Juda«, wenn auch kein leidenschaftlicher Held. Sicher hatte die Intendanz die Rolle der Noëmi nicht für sehr wichtig gehalten, sonst hätte man sie mir nicht zugeteilt. Ich aber sah gleich wie lieblich die Figur, »das Röslein von Saron«, gehalten war; wie sie den Schmerz um ihren, vom eigenen Gatten erschlagenen Vater fast stumm im Ausdruck wiedergeben und sich am Schluß zu einer Heldin würde aufschwingen können. Von nun an hatte ich eine dramatische Aufgabe, etwas, nach dem ich mich seit meiner Kindheit sehnte, seit ich mit Frau Binder in Prag studierte, die ich damals schon bat, so schwach ich war, mich etwas Dramatisches lernen zu lassen. Alten Briefen entnehme ich, daß Mama schon ziemlich früh, Spuren dramatischer Ausdrucksfähigkeit an mir bemerkte, was sie mir aber verschwieg. Heute erfüllt es mich mit großer Befriedigung, wenn Mamachen meine dramatische Laufbahn auch leider nicht erlebte.
Von nun an schloß ich mich ein, ließ mich von niemand mehr und von nichts in meinem Studium stören, wies alle Bekannten ab und studierte, wie man studieren muß, d. h. ich lebte nur noch meinem Studium und meiner Kunst. Somit war die Noëmi der eigentliche Anstoß zu einer neuen Epoche in meinem künstlerischen Schaffen. Nicht, daß ich mir nicht mit allem und jeder kleinsten Aufgabe dieselbe eingehendste Mühe gegeben oder weniger gut ausgearbeitet hätte. In dieser kleinen Noëmi lag aber ein Zug ins Große. Die Figur wuchs – oder konnte doch im Lauf des Werkes wachsen. Nach solch einer Aufgabe hatte sich mein Ehrgeiz längst gesehnt, sie allein konnte mich reizen und befriedigen. Der Erfolg gab mir und meinen Wünschen recht und neue Nahrung.
Charlotte Grossi war eine bildschöne Kleopatra, Heinrich Ernst ein feuriger Eleazar. Karl Eckert leitete die Proben, Rubinstein sollte die Première dirigieren. Der »liebe Löwe« hatte aber keine Theater- oder Opernroutine. Nach manchen Drangsalen unerquicklichen Hin- und Herparlamentierens übergab der Löwe sein Zepter an Karl Eckert, dessen Umsicht stärker, und in dessen Händen das Werk viel besser aufgehoben war als in den seinen.
Der liebe Löwe Anton Rubinstein! Seine Herzensgüte und Bescheidenheit sind wohl nur mit Franz Liszts herrlichen Eigenschaften zu vergleichen. Größe und Weichheit seines Spiels sind unvergleichlich. Ich hatte ihn lieb und verehrte ihn von ganzem Herzen; ihn und seine liebe Frau Wera. Aber auch er bewahrte seiner ersten Noëmi die treue Freundschaft bis ans Ende seines Lebens. Wie gütig war er stets zu mir, wie glücklich, wenn wir da oder dort zusammen musizierten. In einer der so üppigen Soiréen bei Professor Gustav Richter und seiner schönen Frau Cornelia, geborene Meyerbeer, begleitete er mir einmal einige seiner Lieder. Gleich vom Sturm wilder Leidenschaft gepeitschter Flammen klang die Begleitung des Liedes: »Wenn ich kommen Dich seh«, kaum daß ich nachkommen konnte. Als wir das Lied geendet, war uns beiden der Atem ausgegangen. Das Lied aber hatte gezündet. Er lachte mich aus ob seines wilden Tempos, und wir beide waren glücklich über den Erfolg, d. h. ich nur darum, weil der liebe Löwe mit mir zufrieden war.

Lilli Lehmann als Noëmi in Maccabäer.
Einmal nahm er mich mit zu Adolf Menzel, der heute seine Eisenschmiede im eigenen Atelier (Potsdamerstraße) den Augen seiner intimsten Freunde enthüllte. Als wir nach der Probe im Wagen saßen, berührten wir das künftige Bayreuth. Neidlos, doch sicherlich mit dem leisen Wunsche, daß auch er ein solches für sich finden möchte, glaubte der Löwe nicht an das Gelingen, oder höchstens an eine einzige vorübergehende Aufführung. Gleichzeitig erzählte er mir von seinem »Christus«, auf den er große Hoffnungen setzte, ein Werk, das, wie ich glaube, in Deutschland nie aufgeführt wurde.
Bei Menzel trafen wir Künstler und Schriftsteller, die vor dem Bilde in stummer oder lauter Bewunderung saßen und herumstanden. Ich verstand damals noch blutwenig von Malerei und mußte mich an das Urteil anderer halten. Adolf Menzel nahm mich sehr freundlich auf und blieb so mir gegenüber bei jeder weiteren Begegnung. Als ich ihn einmal in der Ausstellung – Kommandantenstraße seligen Andenkens – just neben dem Erstlingswerk eines uns bekannten Musikers stehend traf, bat ich ihn um sein Urteil. Menzel belorgnettierte die kleine Landschaft gründlich und faßte sein Urteil dahin zusammen: »Der Mann kann nicht zeichnen, der Mann wird nichts.« Der große Meister behielt recht. Nur einmal war er ungehalten, als ich ihn bat, sich uns bei der Petition gegen die Vivisektion anzuschließen, die sämtliche Maler und Künstler – Lenbach an der Spitze – bereits unterschrieben hatten.
Nach Bayreuth traf ich den lieben Löwen oft noch bei Gräfin Schleinitz. Immer hatte er am selben Abend bereits ein Riesenkonzert gespielt, von dem er total erschöpft mit durchnäßter Wäsche und Kleidern, Zigaretten rauchend, im Palais des Hausministers eintraf. Wie ich ihn bat, sich doch etwas Ruhe zu gönnen, antwortete er mir in seiner offenen, ungezwungenen Art: »Ja, Sie haben's gut, Lilli, Sie stehen in fester Gage. Wenn ich mir aber nur ein Nachtgeschirr kaufen will, so muß ich ein Konzert geben.« Armer Mann, dessen Talent und Güte so viele mißbrauchten. Wenige Monate vor seinem Tode begegneten wir uns auf dem Nordwestbahnhof in Wien; wir waren, ohne es zu wissen, im selben Zuge gewesen. Aus Furcht, ihn zu molestieren, wollte ich unerkannt an ihm vorbei, brachte es aber nicht übers Herz. Mutig an ihn herantretend, begrüßte ich ihn herzlich. Es dauerte eine ganze Weile, bis er mich erkannte, seine Augen waren getrübt, er sah nur mehr sehr schlecht. Dann aber erhellte sich sein Gesicht; er strich mir liebreich übers Haar und sagte mit seiner lieben verschleierten Stimme fast wehmütig, langsam und weich, als wollte er mir nicht wehe tun: »Lilli, aber Sie sind ja ganz weiß geworden?« »Das bin ich doch seit lange! Wir haben uns so lange nicht gesehen! Aber auch Sie, Lieber!« »Ja, ich! aber Sie, meine Noëmi!« Wir wechselten nur noch wenige Worte. Er wollte am Abend weiter, nach Rußland. Ich sah Anton Rubinstein nicht wieder!