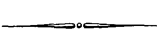|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wenn ich auch keinen Augenblick meinen Beruf versäumte, erschient mir doch eine Ewigkeit, bis ich wieder Freude fand an ihm, mich ihm mit vollem Herzen wieder hingeben konnte. Ich war die ganze Zeit über enorm beschäftigt, sang oft 15mal im Monat und viele neue, wenn auch nicht gerade sehr wichtige Rollen.
Im Dezember 75 brachten wir Ignaz Brülls, des so feinen Musikers und viel zu bescheidenen Menschen, entzückende Oper: »Das goldene Kreuz«, in dem ich die Christine kreierte, mit ausgezeichnetem Gelingen und größtem Erfolge heraus, die in den nächsten zehn Jahren unzählige Male über die Berliner Hofbühne ging. Zwei Jahre später folgte sein »Landfriede«, der zwar nicht weniger sympathisch und ebensogut studiert, doch weit hinter dem Erfolg des goldenen Kreuzes zurückblieb.
Der 15. April 1876 brachte ein Ereignis für mich: Verdis Requiem, das wir im königl. Opernhaus dreimal aufführten; Heinrich Ernst, Franz Betz, Marianne Brandt und ich. Trotz Wagners Flagge, unter der wir Bayreuth schon entgegensegelten, griff mir Verdis wundervolle Musik tief ins Herz. Ich war's ja gewöhnt, katholische Musik zu singen, kannte die Zeremonien, die mystische Dämmerung der katholischen Kirche, die tiefe Gläubigkeit des katholischen Volkes, die Macht der Musik im geweihten, weihrauchdurchschwängerten Raume und wußte mit Würde wiederzugeben, was dabei in meinem eigenen und dem Innern anderer vorging. So oft ich auch katholische Kirchenmusik – wo und was immer – in meinem Leben sang, stets fühlte ich mit Bestimmtheit, daß ich die einzige Mitwirkende war, welche der tief religiösen Empfindung, der Heiligkeit der Handlung im Ausdruck gerecht wurde. Vielleicht lag es an meiner mir wohlbewußten italienischen Stilkenntnis. Etwas mußte schon an diesen: Gefühle richtig sein, denn als wir: Heinrich Ernst, Georg Hentschel, Marianne Brandt und ich beim Kölner Musikfest 77 das Requiem unter Verdis eigener Leitung sangen, war ich die einzige, der Verdi nicht das geringste ausbesserte. Verdi war kein Mann von vielem Reden; es verstand sich bei ihm – wie bei allen »Könnern« – von selbst, daß man die Technik der künstlerischen Aufgaben, die man übernommen, meisterte. Und ohne daß er es mir sagte, wußte ich, daß er es gut fand. Als außergewöhnlicher Mensch wird Verdi von allen denen geschildert, die das Glück hatten, ihm näher treten zu dürfen. Ich weiß nur, daß er für mich um so größer wurde, je länger ich lebte, und daß ich ihn heute zu den Größten, Höchsten rechne und ihn gleich ihnen verehre und liebe. Verdi war mit seiner Gattin gekommen, und mit beiden so lieben, ruhigen Menschen erlebten wir, unter Führung des geistreichen, witzigen Ferdinand Hiller – der sich stets nur »Fasi« unterschrieb und mir als Künstler sehr befreundet war – ein wundervolles Fest, das Johannes Brahms als Dritter im Bunde verschönte, der damals noch glückstrahlend und heiter die ganze junge schöne Frauenwelt zu seinen Füßen liegen sah. Als ich am dritten Abend aufs Podium stieg, um eine Faustarie von Spohr zu singen und Brahms meinen Strauß zu halten gab, sah ich, wie er ihn zerpflückte, jedem jungen Mädchen des Chors eine Blume daraus verabreichte und sich dabei vor Lachen schüttelte.
Kurz vor diesem Kölner Musikfest hatten wir in Berlin » Le roi l'a dit« von Delibes gegeben, worin Minnie Hauk, der zuliebe man die Oper einstudierte, die Gervaise sang. Ich würde des Werkes vielleicht nicht Erwähnung tun, wenn sich für mich daran nicht eine Beobachtung knüpfte, die ich nicht verschweigen möchte. Minnie Hauk war eine Zeitlang sehr beliebt bei Presse und Publikum, zu dieser Zeit allerdings schon weniger und am allerwenigsten bei den Mitgliedern. Gegen alle Kollegen, weiblich oder männlich, war sie gleichmäßig unliebenswürdig. Als Niemann sie z. B. auf einer Aidaprobe am Schluß der Oper umfaßte, um sie sterbend niedergleiten zu lassen, forderte sie energisch, nicht angefaßt zu werden. Niemann sagte: »Dann fallen Sie ja um!« worauf sie antwortete: »Das schadet nichts!« und »bums« da lag sie. – Sie hatte der Intendanz zehn ausverkaufte Häuser für die Oper garantiert. Diese war nicht sonderlich studiert, Minnie Hauk machte nichts aus ihrer Rolle, und nur ein Duett, das Frau Hofmeister und ich – zwei junge Marquis – zu singen hatten, gefiel und mußte da capo gemacht werden. Nach fünfmaliger Wiederholung verschwand die Oper vom Spielplan.
Nun heißt's aber Gerechtigkeit üben. So wenig M. Hauk in Gesang oder Spiel mir bisher etwas Besonderes zu geben vermochte, um so viel bester gefiel sie mir an diesem Abend. Was das Publikum heute kalt ließ, war künstlerisch ungleich feiner ausgearbeitet als Früheres. Das Gutturale der Tiefe kam nicht wie sonst zu unangenehmer Geltung, Gesang und Spiel waren einfacher und vornehmer. Da kam mir zum Bewußtsein, daß es durchaus nicht nötig sei, zu brüllen; daß man auch mit wenig Stimme, wenn sie nur edel klänge, gut singen könne; daß man töricht sei, sich von großen Räumen und starken Nebenstimmen – einzig um der Kraftkonkurrenz willen – verleiten zu lassen, seine physischen Kräfte zu überspannen; und daß »schön« unter allen Umständen »schön« bliebe, auch wenn es nur vom einzelnen anerkannt würde. Die Mahnung vergaß ich niemals wieder. So hatte auch Minnie Hauk eine Saite am Schlusse ihres Engagements erklingen lassen, die mir zum besten taugte.
Wenn ich noch einer sehr talentvollen Arbeit, des Stuttgarter Hofkapellmeisters Abert romantischer Oper »Ekkehard«, gedenke, in der ich die liebliche Praxedis so gerne sang, so darf ich gleichzeitig seiner besten, in Prag einst viel gegebenen Oper »Astorga« gedenken, in der die Damen Huttary und Szégal, Bariton Ekhard und Tenor Vecko wahre Triumphe feierten, deren Melodien, von Vecko so herrlich gesungen, mir heute noch das Ohr umschmeichelt. Um so mehr, als das Hauptmotiv Astorgas Stabat mater entnommen, das wir als junge Mädchen alljährlich an Astorgas Gedenktag in der St. Josephs-Klosterkirche sangen, wo Astorga einstens gelebt.
Tenor Vecko war ein armer böhmischer Schullehrer, als seine Stimme entdeckt, er zuerst ohne Gehalt ans böhmische und dann als I. Tenor ans deutsche Theater mit 600 fl. jährlichem Einkommen engagiert wurde. Auf mehr als 8000 fl. hat er es sicher nicht gebracht. Heutzutage würde er mit dieser Stimme Millionen verdienen, mag sich aber damals schon mit 600 fl. als Millionär gefühlt haben. Leider trank Vecko Bier, viel Bier, und ging elend, noch ziemlich jung, daran zugrunde. Noch erinnere ich mich des einfachen guten Menschen, wie er mir – als ich zum Gastspiel in Prag war – guten Rat erteilte: »Bier, gnä' Fräulein, is gut für Stimme, trink ich immer Bier. Müssens immer haben Krügel Bier. Nachts, wann ich Durscht hab', geh' ich ans Fenster und hab' Krügel Bier hinter Fenster. Glaubens mir, Bier is immer gut für Stimme!« Man sollte nicht glauben, daß dieses Menschen Stimme einen zu Tränen rühren konnte.
Am 20. Februar 1878 wurde die Doppelhochzeit unserer schönen, heiteren Kronprinzen-Tochter, Charlotte, mit dem Erbherzog von Meiningen und der reizenden Friedrich-Carl-Tochter, Elisabeth, mit dem Erbgroßherzog von Oldenburg gefeiert. Als Festoper wurde »Titus« gegeben, zu der Ballettmeister Taglioni ein prachtvolles Ballett komponierte, in welchem die Damen vom Ballett zum erstenmal in langen Röcken erschienen; d. h. die Musik war von Mozart, denn zu damaliger Zeit hätte sich noch keiner unterstanden, den Klassikern was am Zeuge zu flicken, sie waren noch nicht »ausbesserungsbedürftig« wie heutzutage. Frau von Voggenhuber, Marianne Brandt und ich erhielten bei dieser Gelegenheit die große Medaille für Kunst und Wissenschaft am Bande vom Herzog von Meiningen, meine erste Auszeichnung; und wo was ist, kommt was hinzu.
Seit fünf Jahren war es der Intendanz so zur Gewohnheit geworden, mir meinen dritten Urlaubsmonat abzukaufen, daß ich schier daran verzweifelte, diesen jemals zu meinen eigenen Zwecken künstlerisch ausnützen zu dürfen. Da trat unser Bassist Conrad Behrens zu rechter Zeit als Deus ex machina mit der Frage an mich heran, ob ich mit ihm, Franz Betz und Kammervirtuos Franz Pönitz – der schon als Wunderknabe in Schweden bekannt – nicht auch einmal nach Stockholm zum Gastspiel wolle. Behrens hatte dort schon öfter den Impresario gespielt und war viel schuldig geblieben; aber ich nahm den Vorschlag mit möglichster Sicherheit an, falls er mir auch den Urlaub, der mir bisher stets abgeschlagen worden war, erwirken wolle. Was der Künstlerin nie gelang, gelang dem biederen Filou. Wenn auch nicht viel bei dem Gastspiel heraussah, galt mir doch die erstmalige Befreiung vom Zwange alles und zahlte sich in der Folge glänzend aus durch Erfolg, Bekanntwerden im Auslande und künstlerisches Emporblühen. Ende April traten wir mit einer Schülerin meiner Mutter, einer jungen lustigen Pastorstochter, Adele S., die mich chaperonnierte, die Reise über Stralsund-Malmö nach Stockholm an. Aus vollster Obstblüte der märk'schen Lande kamen wir bald ins noch winterlich tote Schweden. Eine lange öde Fahrt, die mir aber, die ich mich seltsamerweise stets nach dem Norden sehnte, als sollte mir am Nordkap mein Heil erblühn, sehr interessant und sympathisch war. Immer durch ödes totes Heideland, an Seen, Mooren, großen und kleinen mit Moos bewachsenen Felsstücken vorbei, an Wäldern und Sümpfen, stundenweit kein Mensch, kein Tier. Nach einer prächtig verschlafenen Nacht bogen wir morgens durch einen langen Tunnel, und vor uns lag eine der herrlichsten Städte: »Stockholm!«
Im Grund Hôtel, dicht am Mälarstrom, waren wir köstlich einquartiert. Welche Aussicht! Große Schiffe ankerten am jenseitigen Ufer, dicht unter dem königl. Schlosse; und mit rasender Schnelligkeit schossen Strom und Schiffe, kleine Dampferchen unter Brücken an Inseln vorbei oder solche, die den Verkehr von einem Ufer ans andere vermittelten. »Karl IX.«, der diesem Geschäfte oblag, sandte von seinem Anlegeplatz oft dicke Rauchsalven auf unseren Balkon, weshalb wir ihn, Fritz Reuter zu Ehren, kurzweg in »Korl Stänker« umtauften. Der 1. Mai war freilich noch kein Sommertag in Schweden; es war bitter kalt. Regengüsse wechselten mit Schneestürmen, denen wir alle unseren Tribut mit heftigen Katarrhen zahlten. Aber merkwürdig hell waren schon die Nächte, die uns um 10 Uhr abends im Freien zu lesen gestatteten, uns dafür wieder trotz dunkler Vorhänge die Nacht nicht schlafen ließen, da überall das Licht des Nordens hereinströmte und uns wachhielt.
Die Sitte erforderte, dem Landesherrn sich alsbald vorzustellen. Graf Perponcher hatte mir Empfehlungen an Hofmarschall Holtermann und andere bedeutende Persönlichkeiten mitgegeben, die jedenfalls nicht schadeten, wenn ich ihrer auch nicht bedurft hätte. Die Königin war außerhalb zur Kur und nur der Kronprinz bei seinem Vater und seinen Studien geblieben.
Der König ließ mich bitten, ihn an einem der ersten Tage um 11 Uhr morgens aufzusuchen. Der Hofmarschall und Graf Rosen empfingen mich vorher, zeigten mir die Gemächer, und Punkt 11 Uhr wurde ich zum König gerufen.
»König Oscar,« so schrieb ich damals meiner Mutter, »ist ein schöner, großer, eleganter Mann mit schönen Augen, voll ungezwungener Liebenswürdigkeit, und ich glaube, wir gefielen uns gegenseitig.«
Das königl. Theater war ein alter prächtiger, äußerst akustischer Bau. Historisch war der Saal, in dem König Gustav III. ermordet wurde, und das schöne Zimmer, in dem er seinen letzten Atem aushauchte, das mir nun als Garderobe diente. Diese Erinnerungen berührten mich seltsam genug, denn wie oft hatte ich die Historie als Page in Aubers und Verdis »Maskenball« selbst miterlebt.
Mit einem Konzert fingen wir im Theater unser Gastspiel an. Dann sangen wir Tell. Der König kam am Schluß des ersten Aktes, blieb bis zur letzten Note und dem letzten Beifallsklatschen und applaudierte mit erhobenen Händen. Während des Balletts, das nicht besonders war, ging er hinaus und kam erst wieder, nachdem es beendet. Adele meinte, da kämen unsere Könige eigentlich erst herein; freilich hielten sie sich ein besseres. Beim Eintritt ins Theater grüßte der König nach allen Seiten, eine Formalität, die er beim Verlassen desselben wiederholte. Schön und gespenstig sah es aus, wenn der Vorreiter mit brennender Fackel, dem königl. Wagen voranreitend, dahinflog.
Hier, in Stockholm, sang ich zum ersten Male die Elsa im Lohengrin. Man schrieb: jetzt erst habe man mich in meinem eigentlichen Fahrwasser gesehen, und allerseits verlangte man Donna Anna und Norma, Rollen, denen ich meinem Gefühl nach noch immer nicht gewachsen war. In den Kapellmeistern Normann und Dente fand ich ausgezeichnete Künstler, mit denen ich gern alles ohne Probe riskiert hätte. Auch Orchester und Chor waren ausgezeichnet und mehrere Sänger und Sängerinnen, letztere jedoch ohne Energie und Temperament. So sang ich Traviata mit einem ausgezeichneten Alfredo-Ödmann, der nur weder an schnelles Lernen noch Singen gewöhnt, mich im letzten Duett immer himmelhoch bat: » N'allez pas si vite, Mademoiselle Lehmann, je vous en prie il faut mettre des galoches pour vous suivre.« Mit ihm als José hörte ich Carmen zum erstenmal, die in Deutschland noch nicht gewesen war, und war entzückt von der Oper, der ich in begeisterter Anerkennung treu geblieben, die mich immer wieder aufs neue elektrisiert. Don Juan, in dem ich die Elvira sang, Barbier und Margarethe folgten.
Am 12. Mai erschütterte mich die Nachricht vom Attentat auf unseren geliebten Kaiser, die mir ein Herr der deutschen Botschaft überbrachte, aufs heftigste; ich telegraphierte sofort an Se. Majestät die Glückwünsche zur Errettung, die uns aus tiefstem Herzen kamen. Wünschte ich doch, das Volk würde den Verbrecher zerrissen haben.
Eines Morgens fuhren wir zum Konzert nach Upsala; Betz, Pönitz, Kapellmeister Deute, Adele und ich in schwarzen Konzertkleidern. Das Konzert sollte um 1 Uhr im Bibliotheksaal beginnen, um 4 Uhr wurden wir in Stockholm zurückerwartet. Das Konzert fand aber nicht statt, weil irgendjemand, mit dem Arrangement von Behrens betraut, das Konzert ohne Programme erst abends vorher angezeigt hatte und nur 150 Billetts verkauft waren. Behrens war wütend, wir lachten und baten, das Konzert ausfallen zu lassen. Upsala war trotz seiner 12 000 Einwohner eine tote Stadt, in der nur die Studenten »lebten« und einzig der alte herrliche Dom als Sehenswürdigkeit galt. Nachdem wir ihn bewundert, ich meinem Liebling, Gustav Wasa, einen stillen Gruß in seine Gruft hinabgesandt, wir die Wämser der ermordeten Sturen mit Grauen betrachtet hatten, zogen wir, laut singend, im Gänsemarsch am hellen, lichten Mittag durch die toten Straßen Upsalas dem Bahnhof zu und waren um 4 Uhr in Stockholm zurück. – Wenn Franz Pönitz, der Harfenvirtuose, dabei war, amüsierten wir uns immer königlich. Seine kindliche Heiterkeit wirkte selbst auf den steifen Kollegen Betz ansteckend, der dann gern mitlachte und scherzte und in Adele und mir stets Widerhall weckte. Leider schickte ihn Behrens mit einer »schwedischen Nachtigall«, die wir »Tunte Hebbe« tauften – so langstielig war sie –, zu Konzerten nach dem fernen Norden, um die nordischen Schweden mit Harfenklängen und die schwedischen Fische mit Angelhaken zu ködern, was Pönitz zu tun nie unterließ. Als er wiederkam, stürzte er mit den Worten: »Guten Morgen, meine Damen« in unser Zimmer und frug: »Wie heißt ›Verzweiflung‹ auf Französisch? Ich bin in Desesperation über das Wetter.« Da wir es auch waren, ließ ich Whistkarten kommen, und wir versuchten zu spielen. Ich spielte mit dem Strohmann, Adele, die es nie gespielt, mit Pönitz, was ihn wieder zur Desesperation brachte, weil sie ihn immer überstach und er mit der hübschen Berliner Redensart: »Ja, wenn Sie mit dem Gänseschmalz so aasen« auf Französisch nicht zurecht kommen konnte, und ich ihm mit »französischem Gänseschmalz« nicht unter die Arme greifen konnte. – Sobald das Wetter nur einigermaßen, liefen wir zwei Damen im herrlichen Djurgarden stundenlang spazieren, wo endlich Schlüsselblumen und Veilchen Wiesen und Wälder überfluteten, Moos in allen Farben die grauen Felsblöcke belebte. Seen und Wälder leuchteten plötzlich in sommerlichen Gluten.
Der König hatte mir wenige Tage nach meinem ersten Auftreten ein wundervolles Armband gesandt. Zwanzig Jahre lang hatte in Stockholm kein Hofkonzert mehr stattgefunden, nun hatte König Oscar für den 21. Mai eines angesetzt. Für den Abend vorher hatte er uns alle seine Räume zum Probieren zur Verfügung gestellt, doch lehnten wir dankend ab, da wir im Theater die Probe hielten.
Entgegen der Berliner Hofetikette, wo man nur »befohlen« war, wurden wir hier direkt als Gäste »eingeladen« wie der ganze Hof. Eigentümlich berührte mich die Sitte, alle Damen in schwarzdekolletierten Roben, kleinen weißen Mullärmelchen, mit schwarzem, schmalem Samtband gitterförmig garniert, zu sehen. Nur junge Mädchen gehen bei Ballfestlichkeiten in Weiß. Natürlich hatte auch ich eine schwarze Atlastoilette für den Abend angelegt.
Um ½9 Uhr war geladen, um 8 Uhr 15 Minuten fuhren wir hinauf. Graf Rosen führte mich am Arm der ganz alten Oberhofmeisterin zu, die mich reizend willkommen hieß und die Vorstellung bei Damen und Herren übernahm. Auch unser deutscher Botschafter kam gleich auf mich zu, um mich aufs herzlichste zu begrüßen, und alle Anwesenden zeichneten mich in liebenswürdigster Weise aus. Die Schweden haben etwas ungemein Bescheidenes, Vornehmes in ihrem Wesen, viel Herzlichkeit mit französischer Courtoisie gemischt. Um ¾ 9 Uhr erschien der König mit dem Kronprinzen Gustav, sprach seine Umgebung und Gäste mit dem so traulichen »Du« an und machte mir unglaubliche Elogen über meine Margarethe und Elsa. Auch bei Behrens bedankte er sich für die Einführung so ausgezeichneter Künstler. In der Zwischenpause kam der Kronprinz auf mich zu, mit dem ich mich lange unterhielt und der mir über seine vielen Studien klagte. Ich mußte ihm aber sagen, daß er als Kronprinz und einstiger König allen anderen mit gutem Beispiel vorangehen, sich das größte Wissen aneignen müßte, um solch einer großen Aufgabe gerecht zu werden. König Oscar beendete sein Gespräch mit folgenden Worten: »Das ist also abgemacht, Sie kommen im nächsten Jahre wieder. Ihre Margarethe hat mich entzückt – ich wäre gerne Faust gewesen –, Sie haben so viel Noblesse in Ihrem Wesen, Ihrer Erscheinung und geben künstlerisch so viel Schönes, ich habe nie Besseres gehört.« »Was willst Du mehr, liebes Mamachen, von einem König von Schweden«, so schrieb ich an meine liebe Mutter, die ja nicht dabei sein konnte, zu triumphieren, wie ihr Kind ausgezeichnet und verwöhnt wurde. Der König war ein feiner Musiker, sang, wie mir Frau Bäckström – die, selber eine Künstlerin, oft mit dem König musizierte – erzählte; sprach sieben lebende Sprachen und soll Shakespeare ganz vorzüglich ins Schwedische übersetzt haben. Dabei war er der liebenswürdigste Wirt, der mir beim Essen immer wieder noch bessere Sachen vorlegte. Seine Gäste fühlten sich demnach alle so behaglich, daß Betz die Bemerkung machte: »Intimer dürfe es gar nicht sein, sonst vergäße man, daß man bei ›Königs‹ wäre.« Der König war sehr heiter, so enthusiastisch, daß er mehrere seiner Gäste umarmte. Als er mir Adieu sagte, frug er noch, ob ich mit dem Publikum zufrieden sei? Und als ich erwidern mußte, daß es viel zu gütig gegen mich, meinte er: »O nein, das ist noch alles nicht genug; Sie verdienen viel, viel mehr.«
Ende Mai verabschiedete ich mich in langer Audienz beim König. Vom 3.-29. Mai hatte ich 14 mal gesungen. Nun sollten wir nach Gothenburg zum Konzert. Aber schon ehe wir abreisten, stimmten die Zahlungen bei unserem biederen Impresario nicht. Pönitz hatte noch 800, ich 1600 Kronen zu fordern, nur Betz war vorsichtig genug gewesen, seinen Beruf erst nach erfolgter Zahlung des Honorars auszuüben. In Gothenburg sollte die Rechnung glatt gemacht werden. Behrens übergab mir drei Brillantknöpfe, die er soeben vom König erhalten, als Pfand, die ich auch nahm, da es mir sicherer schien, etwas als gar nichts zu haben. In Gothenburg angekommen, wurden wir schon mit der Nachricht überrascht, daß Behrens nicht kommen würde, und so entschlossen auch wir uns kurzerhand, dies Konzert nicht zu singen, sondern an die sagenvollen Trollhättafälle zu reisen und uns dann sofort nach Berlin zurückzubegeben. Welche Fülle schwedischer Poesie stieg vor meinen Augen herauf, als ich lange ganz allein auf den Felsblöcken des größten der Fälle lag, die nicht gigantisch, wohl aber voll süßem, poetischem Zauber den Beschauer umrauschen.
Über Hamburg ging's heim, wo trotz allen Schreibens und Erkundigens von unserem biederen Impresario nichts mehr zu hören noch zu sehen war. Der Hauptgewinn dieses Gastspiels, das mir außer großen Auszeichnungen herzlichste Freude und künstlerische Anregung gebracht, lag in der Errungenschaft: über meinen dritten Urlaubsmonat von nun an bestimmt verfügen und denselben zu guten Gastspielen, d. h. höheren Zielen verwenden zu können.
Niemann als Florestan, dem wir alle zujauchzten, war das winterliche Ereignis Berlins. Endlich sah man Beethovens Idealgestalt verkörpert, wie es vor ihm vielleicht nur Schnorr von Carolsfeld gelang und nach Niemann keinem andern nochmals wieder gelingen wird. Seine unvergleichliche Meisterleistung stempelte das Werk, das bisher nur als Lückenbüßer mit Ballettanhang gedient hatte (den sich Niemann, solange er in Berlin sang, verbat) zur Zugoper.
Wagners alter Freund, Musikschriftsteller Richard Pohl, den ich in Bayreuth kennen lernte, lud mich nun alljährlich ein, am Geburtstag der Kaiserin, den diese in Baden-Baden feierte, in einem Konzert mitzuwirken, dem die hohe Frau stets beiwohnte. Dann sang ich in Bonn, wo ich zum erstenmal unserem damaligen Prinzen Wilhelm, dem jetzigen Kaiser, begegnete, der dort seinen Studien oblag.
Je öfter ich fern von Berlin gefeiert wurde, um so trauriger machten mich meine »Prinzessinnenrollen«, wenn ich, wie dies zeitweise geschah, allein auf diese angewiesen war. Da sang ich wieder einmal die greulichste aller Theaterprinzessinnen: die Elvira in der »Stummen von Portici!« Diesmal war ich sogar vorher schon auf dem Theaterzettel des Vorabendes angezeigt, was man bis dato in dieser Oper unterlassen hatte. Man mag mit der Rolle machen, was man will, alle Mühe ist vergebens, sie wird nicht besser! Das einzig erreichbare Ziel blieb: sich mit ruhiger Eleganz aus der Affäre zu ziehen. In der ersten Arie wiederholen sich die Verse:
»An diesem Wonnetag
Kündet des Herzens Schlag
Mehr als mein Mund vermag
Mein Hochentzücken.«
wohl 10mal mit Fiorituren und Trillern, daß einem übel wird. Mich ekelte vor der Rolle, und mehr noch vor meinem Prinz-Gemahl, eine der unglücklichsten Tenor-Prinzen-Rollen dritten Ranges, die sich moderne Phantasie kaum mehr auszudenken vermag. Als wir einstens, glücklich oder unglücklich getraut, aus der Kirchentür schritten, sang mich mein Prinz-Gemahl mit einer faden Phrase an, und »bums« klakst ein großes Bukett auf meine Schleppe, gerade zwischen mich und ihn, der noch die unglückliche Idee hatte, es aufzuheben und mir zu überreichen. »Bums«, da kam schon wieder eines aus der II. Rang-Proszeniumsloge angeflogen und noch ein drittes und viertes, bis das halbe Dutzend voll, das Publikum in die heiterste Laune versetzte. Auf der Bühne aber behielten alle ihre würdevolle Haltung, und erst als der Vorhang gefallen war, rannte ich heulend in die Garderobe, wo bereits die Objekte des schrecklichen Attentates abgegeben waren. Hier entpuppte sich der Verbrecher wider Willen. Ich war tags vorher in Gesellschaft mit Professor Noiré bekannt geworden, der mir, samt den liebenswürdigen Gastgebern, die schönen Blumen zugedacht, und statt ausdrücklich sie in meine Garderobe zu senden, es dem Blumenhändler überlassen hatte, der so ungeschickt gewesen, sie zu werfen. Heute lache ich darüber, damals aber heulte ich über die tragikomische Szene, deren ich Gottlob keine zweite mehr erlebte.
Goldmarks Königin von Saba war in Wien mit großem Erfolge in Szene gegangen; Materna-Königin, Wilt-Sulamith hatten von sich reden machen, und nun sollte auch Berlin die dekorativen Wüstenwunder erleben. Die Rollen waren verteilt; Königin: Frau von Voggenhuber. Anstatt mir, die doch einzig in Betracht kam, die Sulamith zu geben, gab man die Rolle an Frau Mallinger, die vernünftig genug war, sie sofort zurückzusenden. Aber auch jetzt sollte ich sie noch nicht erhalten, sondern man betraute eine elende Anfängerin damit, die weder persönlich noch stimmlich, geschweige denn als Künstlerin dazu taugte. Und erst als sich die Unmöglichkeit herausstellte, auch Eckert, der die Oper dirigierte, Front gegen sie machte, war ich gut genug, die Rolle kreieren zu dürfen. Nicht einmal das Selbstverständliche tat man für mein Talent, wieviel weniger das Fördernde! – Die Rolle lag hoch, verlangte schauspielerisch wie gesanglich Affekte, die Kraft und Technik bedingten, die selbst ich mir bei aller Praxis und künstlerischen Kenntnissen durch besondere Übungen aneignen mußte, weil jede neue Komposition neue Lagen, neue Schwierigkeiten für den Sänger mit neuen Stimmwirkungen ins Treffen führt.
Als ich eines Tages mit Eckert allein in der Zimmerprobe zur Saba saß, klagte er über seine Augen, die heute ganz besonders trüb seien. Mit meinen Handschuhen putzte ich ihm die Brille klar, doch behauptete er, daß es noch immer vor seinen Augen hin- und herflimmere. Als wir alle beisammen, begann die Probe. Wie wir zum zweiten Finale kamen, das, zum ersten Male im Ensemble probiert, nicht leicht zu singen war, wurden wir immer lauter, eifriger und falscher; einer überschrie den anderen, bis wir auf einem Höhepunkt angelangt, der nun in seinem musikalischen Durcheinander einer echten Judenschule glich, plötzlich laut lachend abbrachen und uns vor Heiterkeit schüttelten. Erst als wir uns ausgelacht und wieder beruhigt hatten, klappte Eckert die Partitur zu und sagte in seiner göttlich ruhigen Art: »Ich dächte, wir hätten für heute genug getan!« worauf Betz-Salomon ihn unterm Arm nahm, um bei Lutter und Wegner eine gute Flasche »Rotspohn« mit ihm zu leeren. Herzlich lachend gingen wir auseinander. Wie aber entsetzten wir uns, als wir am andern Morgen vom Tode Eckerts Kenntnis erhielten, der am selben Abend, als er nach langer Stundengeberei seine schöne Frau vom Diner abholen sollte, in der Droschke verstarb. Seine Persönlichkeit konnte auf der Polizei nur durch den Zufall festgestellt werden, daß man einen Brief von Fräulein Horina in seiner Tasche fand. Die schöne Frau Kathi, die vergeblich auf ihren seelensguten Mann gewartet hatte, wurde schnell vom »Unwohlbefinden« ihres Gatten benachrichtigt, den sie nur als Leiche wiederfand.
Wir hatten in Carl Eckert »Einen« zu beklagen, der nicht ersetzt werden, dem man des Guten nicht genug nachrühmen konnte. 1820 in Potsdam geboren, erhielt er schon als Wunderkind Unterricht von Zelter und Rungenhagen, auf der Violine von Ries, hatte Unterricht in Leipzig bei Mendelssohn-Bartholdy, war in Paris Kapellmeister der italienischen Oper, mit Henriette Sonntag in Amerika; 53-61 Hofkapellmeister und artistischer Direktor der Wiener Hofoper; 61-67 Hofkapellmeister in Stuttgart, und schließlich von 69-79 Hofkapellmeister in Berlin und allüberall gleichhoch verehrt. Eckert wußte noch etwas von Stimmbildung und Gesang; er hörte beim ersten Ton des Sängers, wie dieser disponiert, wo er ihm helfen, wo sich ausbreiten könnte, über was hinübergleiten müßte. Er hatte Kenntnisse außer seinem großen Talent und eine ungeheuere Praxis. Er wußte genau, was er dem Sänger schuldig war, wo sein Reich anfing oder aufhörte. Sein ebenso energischer als elastischer Arm führte den Sänger oder ließ sich führen, je nach des Künstlers richtigem Empfinden; und wenn Eckert da unten saß, fühlte man, daß musikalischer Schwung die Aufführung durchströmte. Was unmittelbar nach ihm kam, war traurig für die Oper und trauriger noch für die Kunst.
Meinem Versprechen getreu reiste ich Ende April 79 wieder nach Stockholm zum Gastspiel. Vom König aufs huldvollste, vom Publikum aufs freudigste begrüßt, war es wiederum eine herrliche, diesmal auch vom wundervollsten Wetter begünstigte Zeit für mich. Gleich bei meiner ersten Audienz verlieh mir der König seinen Orden Litteris et artibus. Außer Margarethe, Traviata und Elsa, und Ernani auf italienisch, sang ich diesmal auch noch die Elisabeth im »Tannhäuser« zum erstenmal, und Isaura in einer schwedischen Oper »die Wickinger« von Hallström, dem Lieblingskomponisten des Königs, der ihn auch stets zum Gesang begleitete. Die Rolle hatte ich mit deutschem Text studiert, doch wollte ich sie schnell noch schwedisch lernen, um mich dem König und auch dem Publikum dankbar zu erweisen. Zwei Akte konnte ich bereits auswendig, als mich der König abermals zu kommen bat, um sich erstens bei mir zu bedanken, mich gleichzeitig aber zu bitten, die Rolle deutsch, und zwar sofort zu singen, da er vor Ungeduld stürbe, und außerdem an einem bestimmten Tag zur Jagd müsse. König Oscar hatte noch die besondere Güte, mir am oben genannten Tage etwas vorzusingen. Er sang die Faustarie, verschiedene Kompositionen Hallströms und das Duett aus Faust mit mir. Hallström begleitete. Der König sang nicht wie ein Dilettant, sondern wie ein Künstler ersten Ranges. Nun begriff ich sein Verständnis, und welche unendliche Freude er aus der Musik schöpfte, die ihm zur zweiten Natur geworden. Als wir geendet, nahm er mich in sein Arbeitszimmer und ging wohl ½ Stunde, über Kunst plaudernd, mit mir darin herum, schrieb mir auch einige Zeilen an den Schloßverwalter in Gripsholm, wo König Erich so lange gefangen saß, und wünschte, daß ich das Schloß besuchte. Als mir der König aber ganz bedauernd sagte: ich würde in Schweden nicht so viele Soldaten sehen wie in Berlin, da mußte ich lachend, aus vollstem Herzen, rufen: »Gott sei Dank, Majestät, man atmet hier erleichtert auf!« Da lachte auch er herzlich mit. Beim Verlassen der Gemächer war ich einen falschen Weg gegangen. Noch ehe ich jemand fand, der mich zurecht gewiesen hätte, begegnete mir der König wieder, der mir galant zurief: » voilà les beaux esprits qui se rencontrent!«
Nochmals wieder zu kommen hatte ich versprochen und war auch fest gewillt dazu. Es machte sich aber nicht mehr, trotzdem mir oft Anträge von dort kamen. Und die Hoffnung, das schöne Stockholm mit seinem so gütigen Landesherrn wieder zu sehen, wurde durch seinen unvermuteten Tod vereitelt. Kurz zuvor hatte er mir durch Geraldine Farrar noch sagen lassen, daß ich kommen möchte, weil er mich so gern noch einmal hören würde, bevor er stürbe. Wer aber konnte an seinen so frühen Heimgang glauben? Immer noch sehe ich ihn im Tannhäuser in seiner Loge bei der Stelle: »daß auch für ihn einst der Erlöser litt« fast inbrünstig die Hände falten, begeistert lauschen. Es war erhebend, ihn mitfühlen, mitdenken zu wissen. Sein so künstlerisches Empfinden, sein Enthusiasmus begeisterte den Künstler für seine Aufgabe und ließ ihn sein Bestes geben.
Da mich meine liebe Mutter anfangs Juni in Christiania erwartete, sandte ich meine Begleiterin heim und nahm eine Einladung Frau Bäckströms an, die in der Nähe Stockholms einen herrlichen Landsitz besaß, deren Gatte alles aufbot, es seiner Familie angenehm zu gestalten. Vier prächtige Söhne im Alter von 10 bis 16 Jahren belebten Garten und Haus. Auf eigener Pacht segelten wir abends um 10 Uhr bis Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, d. h. die Sonne spielte nur ein wenig Verstecken, denn wenn wir meinten, sie sei eben untergegangen, kam sie aus der andern Seite auch schon wieder hervor. Wir sahen dem göttlichen Schauspiel oft bis 2 Uhr morgens zu. – Ein entzückendes Bild bot die Familie, wenn Frau Lilly das Ave Maria von Gounod sang, und drei ihrer Söhne sie am Klavier, auf Violine und Cello begleiteten. Von ihrem edlen Manne erzählte sie mir, daß er um sie gefreit, als sie ein reiches Mädchen, geb. von Löwenklau, war. Daß ihre Eltern ihm wenige Tage vor der Hochzeit ihren vollständigen Ruin entdeckten; daß er sämtliche Schulden bezahlt und seine Lilly, so arm sie war, heimführte, und nie ein Mensch erfuhr, was er für sie getan. Auf einer Ausfahrt besuchte sie, ohne daß ich es vorher wußte, das Grab ihrer Eltern, wo sie ein kurzes Gebet verrichtete. Ich war hinter ihr hergegangen; einen kleinen Strauß Maiglöckchen, den mir einer ihrer lieben Söhne zur Ausfahrt angesteckt, nahm ich von meiner Brust und legte ihn aufs Grab. Ich dachte nicht, daß sie es bemerken würde; sie umarmte mich jedoch ganz ergriffen mit den Worten: »Sie haben ein Herz.«
Frau Bäckström erzählte mir oft vom König Oscar und auch von seinem Bruder, dem verstorbenen König Karl XV., der in größter Einfachheit gelebt, gleich einem schlichten Bürger, in den meisten Bürgerfamilien ein- und ausging, da oder dort unangesagt zum Mittagessen oder Abendbrot blieb. Vom Volke wurde er vergöttert, niemand glaubte an den Tod des Königs; man wollte wissen, daß er nur krank sei oder sich zurückgezogen habe, um endlich wieder zu erscheinen.
Weite Spaziergänge, die uns durch üppige Fichtenwälder führten, machte ich in guter Kameradschaft mit den lieben Buben, die mich auch an die große Ökonomie Herrn Cadiers, des Besitzers des Grand Hotel, führten. Bewundernswert waren die Einrichtungen, interessant die prachtvollen Stallungen, insbesondere die enormen Schweineställe, die samt ihren Bewohnern von Sauberkeit blitzten. Neben den Winterräumen lagen große, freie Sommerplätze und führten direkt an einen schönen See, in welchem alle großen Schweine und alle kleinen Schweinchen täglich gebadet wurden. Die Tiere waren appetitlich, das mußte man gestehen. Herr Cadier legte mir zum Andenken an meinen Besuch ein kleines schwarz und weiß geflecktes Ferkelchen auf den Arm, das er mich mitzunehmen bat, und das ich wirklich bis nach Hause trug. Das Baby ließ ich dann als Pfand bei Lilly Bäckström. Als sie mir aber nach einem Jahr einen großen Schinken von dem niedlichen Baby sandte, war ich nicht imstande, auch nur einen Bissen davon zu essen. Ich hatte das Tierchen auf dem Arm getragen, und das genügte, um mir allen Appetit nach seinem Fleische zu nehmen.
Christiania! Überall ist's die Natur, die mich zu bewundern am meisten lockt. So bestieg ich allein den Frognesäter, genoß erst dort, und dann auf Oscar Hall, in stiller Betrachtung die Aussicht übers Land, über die Stadt, den Hafen, wo Hunderte von weißen großen und kleinen Segeln zwischen großen Schiffen über die blaue Meeresfläche, in orange-gold-farbiger Abendbeleuchtung dahinflogen. Andern Tags schloß ich Mama in meine Arme, die über Kopenhagen zu mir gekommen. Am Abend wanderten wir durch die Stadt. Kinder spielten in den Straßen, Leute gingen ihren Geschäften nach, als wäre es früh morgens, alles lebte und webte, und dennoch war's ½11 Uhr nachts; eben fing die Sonne an, sich blutrot gegen den westlichen Horizont zu neigen.
Einen geradezu unermeßlichen Eindruck machte auf mich der erste Fjord, den ich sah, in Ringericke. Im Wagen fuhren wir auf guter Chaussee von Christiania durch tropische Vegetation an kleinen Hügeln, vielen Mühlen und schönen Sommersitzen 2 bis 3 Stunden vorüber. Dann wurde es öde, Haus- und menschenleer. Ein großer Felsen schien den Weg zu sperren. Doch führte ein Tunnel, den man hier nicht vermutete, hindurch und öffnete plötzlich den Anblick auf den ganz einsamen, von hohen, kahlen, grauen, oft wieder in bunten Farben schillernden Felsen umgebenen Fjord. Blauer Himmel, blaues Wasser, kein lebendes Wesen zu sehen, nichts als erhabene Einsamkeit, ein nie zu vergessendes Bild tiefsten Friedens, unendlicher Ruhe; das Ziel meiner nordischen Sehnsucht, an dem ich ewig hätte weilen mögen.
Von Christiania ging's nach Lillehammer, von wo man entweder per Dampfer über den großen Mjösee oder mit der eben eröffneten Bahn nach Drontheim fahren konnte. Wir entschieden uns für letzteres. Auf dem kleinen Bahnhof, den Zug erwartend, hörte ich zwei ältere Damen, die einzigen Passagiere außer uns, pfälzerisch-deutsch sprechen. Voll Freude berichtete ich es Mama und mußte wohl so laut gesprochen haben, daß beide Damen es gehört, denn gleich darauf standen sie vor uns und sprachen uns an: »Ja, wir sein Pfälzerinnen und kennen Sie sehr gut; Sie sein die Lilli Lehmann und das is die Frau Lehmann, Ihre Mutter!« Wir waren sprachlos. Das Rätsel löste sich indessen schnell. Beide Damen waren intime Freundinnen von Tante Dall' Armi's Tochter, Hanauer. Von dieser waren sie über unsere norwegische Reise unterrichtet, kannten uns genau aus Bildern und hatten somit leichtes Spiel, uns zu erkennen. Sie lernten alljährlich im Winter eine Sprache und bereisten im Sommer das Land, hatten nur ganz wenig Gepäck und waren trotz ihrer 50 Jahre ausgezeichnete frische, praktische Reisende. Bis Drontheim blieben wir beisammen, machten noch Ausflüge an verschiedene Wasserfälle und trennten uns erst, als sie ans Nordkap, wir nach Molde gingen. In Molde blühten eben Flieder und Goldregen am kleinen, einfachen Hotel, ein lieblich Scheerenbild. Sogar ein Seehund lag am Ufer, der aber verschwand, sobald wir uns ihm näherten. Um das offene Meer zu sehen, versuchte ich am Abend einen Berg hinter dem Hotel zu besteigen; durch Wälder über Felsen, Moorwiesen, immer höher und höher, ohne die Spitze zu erreichen. Denn je höher ich stieg, je höher türmten sich neue Berge hinter dem eben erstiegenen auf, bis ich schließlich nachgab und stehen blieb. Da bot sich mir ein Bild, wie es Hildebrandt gemalt, wie ich es nie für wahr hielt. Weithin lag das Meer in goldenen Fluten vor mir, Hunderte von kleinen Felsenriffen dazwischen, in Gold getaucht; kaum, daß das Auge den Glanz ertrug, so war ich geblendet. Schutz suchend vor diesem Glanz wandte ich mich nach links, wo ich Hügel und Berge rot und violett erblickte, deren Farbenpracht ich mir erst erklärte, als ich selbst in leichten Nebelwölkchen eingehüllt stand, die rosa, rot und violett an mir vorbeihuschten. Als die Berge blasser und dunkler wurden, mußte ich daran denken, den Rückweg anzutreten, denn es war spät und ich allein auf dem mir unbekannten, sumpfigen, weglosen Berge.
Von Molde ging's per Dampfer nach Veblingsnäs, den Eingang ins Romsdalen, wo wir um 8 Uhr abends ankamen, um nach einigen Stunden mit einem kleinen zweirädrigen, einspännigen Wagen, Skies genannt, bis zur ersten Nachtstation zu fahren. Als wir gegen 11 Uhr in die Talenge einbogen, wehte uns ein heißer Scirocco entgegen. Die Fahrt wurde immer glühender, bis wir an einem Blockhause hielten. Kein lebend Wesen war zu erblicken. Der Kutscher holte aus irgendeinem Versteck den Hausschlüssel, schloß auf, führte uns in ein Zimmer mit zwei Betten, stellte eine große Bütte dicker, süßer Sahne auf den Tisch, legte Knickebrö dazu, sagte uns »gute Nacht« und verschwand. Mir schmeckte es großartig; meine arme alte Mutier aber, der das Brod zu beißen unmöglich war, ging hungrig zu Bett. An ein Fortkommen war andern Tags nicht zu denken. Der Scirocco wütete, wir mußten uns aneinander klammern, wenn wir nur über den Hof gehen wollten. 36 Stunden blieben wir in der Felseinöde, von hohen, kahlen dolomitenartigen Bergen umgeben. Da man uns keine Aussicht auf irgendwelches anderes Essen im ganzen Tale machen konnte, das zu durchwandern noch 4-5 Tage dauern sollte, änderten wir die Route und gingen nach Gudbransdalen über einen herrlichen, großen Fluß, der von Gletschern herunterstürzte, gingen an Björnsons Besitzung vorbei, die ziemlich hoch über der Straße auf grünem Wiesenhügel liegt, und kamen nach vierstündigem Lauf (meine Mutter war 71 Jahre alt) an ein Blockhaus mit Wirtschaft, wo wir ganz ausgezeichnete Verpflegung fanden. Gegen Abend setzten furchtbare Regengüsse ein, die uns bald in die hohen Bauernbetten trieben, worin wir, totmüde, sofort einschliefen. Nach kaum drei Stunden wurden wir durch lautes Sprechen und Rufen sehr unsanft geweckt, und mit Schrecken hörten wir, wie unser Vorzimmer, in welches unser einziger Ein- und Ausgang mündete, von Männern besetzt wurde. Sobald es ruhig geworden, schliefen auch wir wieder ein. Da ich mich morgens mit dem Wirt wegen unserer Weiterreise verständigen mußte, klopfte ich um 7 Uhr am Vorzimmer an, aus dem mir eine sehr kräftige junge Männerstimme: » Come in!« zurief. Ich trat also ein und sah zwei junge Studenten, aus langen Pfeifen rauchend, im Bette liegen. Bei meiner Rückkehr dasselbe Manöver, doch mußte ich lachen, als ich die beiden passierte. Als Mama und ich reisefertig, wiederum durchgehen mußten, waren auch die Studenten schon angezogen und halfen mir – da sie ein wenig Deutsch sprachen – mich mit dem Wirt über alles zu verständigen. Immer noch in strömendem Regen fuhren wir erst im Wagen zur Dampferstation, dann weiter per Dampfer nach Bergen.
Der Aufenthalt in Bergen wird leider durch den immensen Fischhandel beeinträchtigt. 40 Millionen Zentner Stockfische in getrocknetem Zustande werden jährlich allein nach Spanien geliefert. Man kann sich also einen Begriff von der dort aufgestapelten Fischmasse machen, und daß die von Fischgeruch geschwängerte Luft für Vergnügungsreisende nicht angenehm ist. Ich besah die Festung, hatte aber nicht Muße, mehr noch von der Umgebung zu sehen, denn meine liebe Mutter begann sich sehr unwohl zu fühlen. Der fremde Arzt riet uns die Heimreise an, und nach drei Tagen schon saßen wir auf dem Dampfer, der uns der Heimat zuführte. Man begegnete fast ausschließlich Engländern, die auf eigenen Yachten von der britischen Insel herüberkamen, dem Lachsfang in den großen Strömen oder Wasserfällen weit ins Land hinein oblagen, und die auf ihren, mit jedem Komfort ausgestatteten schwimmenden Hotels leicht reisen hatten. Darum kam man auch mit Englisch ganz gut weiter, obwohl es nicht allgemein verstanden wurde, während in Schweden – besonders in Stockholm – die französische Sprache vorherrschte. Ich sah in Norwegen oft, wie Briten beim Bezahlen in die Tasche langten, eine Handvoll Münzen herauszogen und sie offen dem Wirt oder Kellner reichten, der sich daraus seine Rechnung bezahlt machte. Heute, nach 33 Jahren, dürfte es anders sein.
In Stavanger, wo wir den Dampfer wechselten, war eine prachtvolle Basilika zu sehen, in deren Chornische Thorwaldsens Christus stand, der, als einziger Schmuck der ganzen Kirche, durch seine Einfachheit den reinsten Eindruck hervorrief. Selten hatte mich der Anblick einer Kirche so tief bewegt.
Ich kletterte denn auch noch auf den Chor, wo ein Harmonium stand, präludierte und sang ein Lied, dem nur meine Mutter und der Schließer zuhörten.
In Berlin angelangt, erholte sich Mama bald vollständig. Meine Ferien mußte ich zwar drangeben, aber wir machten es uns gemütlich im leeren Berlin. Trotz dem schlimmen Ende war die Reise doch schön gewesen. Für Mamachen allerdings zu strapaziös. Ich aber kehrte reicher an großen Eindrücken zurück, ohne zu ahnen, daß der größte Schmerz meines Lebens mir nicht mehr lange vorbehalten bleiben sollte.
Die Macht des Eindrucks, wie ihn große Künstler auf junge Talente ausüben, die Offenbarung des Ausdrucks dessen, was sich in eigener Seele junger Menschen noch scheu verbirgt, in kunstvollendeter Form vor sich zu sehen und zu hören, ist für das Wesen der Kunst mit keinem andern Gewinn vergleichbar. Scharf ausgedrückt zu sehen, was andre bewegt, was sie stürmen, lieben, entsagen und leiden läßt, das mit individueller Künstlerschaft verbunden, ist, was den Zuschauer und Hörer sieghaft mit fortreißt und entzückt. Die große Technik der Schauspielkunst sollte ich endlich in zwei großen Italienern zu erkennen Gelegenheit haben. Ich meine nicht die Technik die man allgemein mit » routine« bezeichnet, aus der weder Kunst noch Selbsterlebtes spricht, die vielen Komödianten auf und außer der Bühne anhaftet: Nein; diejenige, weniger auserlesener Künstler, die außer den vielseitigen Kenntnissen, ihr eigenes Innere preisgeben, also im eigentlichen Sinne »Menschen« darstellen, weltgeschichtliche oder psychisch interessante Charaktere, und somit tatsächlich individuell in ihrer Aufgabe aufgehen.
Gegen Ende der 70er Jahre gastierte mit einer italienischen Gesellschaft Adelaide Ristori am Nationaltheater in Berlin als: Elisabetta, Maria Antonietta, Lady Macbeth, Maria Stuart etc. Mit ihrer kolossalen Kunst öffnete sie mir die Augen für die Schauspielkunst im allgemeinen sowohl, als für die italienische insbesondre. Was konnte diese Frau, und wie wenig wurde man ihres Alters gewahr, das man über ihre große Kunst vollständig vergaß. Z. B. wenn sie als 16jährige Königin Maria Antonietta ihren schwachen Gatten, Ludwig XVI., mit ein paar liebenswürdigen Worten und einem losen Fingerspiel der so lebendigen Hände überredete, mit ihr nach Trianon zu gehen. Von ihr und Rossi lernte ich: Rollen ausarbeiten, und einsehen, daß alles, was ich bisher darin getan, so ganz und gar nichts war gegen die unermeßlichen Kunstschätze und Kenntnisse der technischen Mittel, welche diesen beiden großen Künstlern zu Gebote standen, die sie sich, gleich andern großen Meistern, durch unendliches Studium auch erst hatten aneignen müssen.
Rossi lernte ich bei Gelegenheit seines zweiten Gastspiels, das am königl. Theater stattfand, kennen. Er ließ sich mir vorstellen, besuchte mich und sagte mir, daß er am Hamlet allein 8 Jahre studiert habe, ehe er mit der Rolle herausgegangen, und daß er zu jeder Rolle viele Jahre eifrigsten Studiums bedürfe, bis er der Fassung sicher sei. Er begeisterte uns als Othello und Lear. Als er sein erstes Gastspiel mit dem Lear beschlossen hatte, trat wenige Tage später Edwin Booth darin aus, und merkwürdig genug war's zu sehen, wie gänzlich heterogen im Temperament die beiden großen Schauspieler den Lear auffaßten. Rossi als wolkenstürmender Hitzkopf, Booth als resignierter, ruhebedürftiger Greis, und daß beide Monarchen der Bühne in meinen Augen, in meinem Gefühl, durch ihre Künstlerschaft Shakespeare dennoch nichts schuldig blieben.
Mir haben diese Gastspiele den Blick geweitet. Kein Wunder, wenn einige Jahre später eine mir fremde Dame in Amerika, die mich als Brünnhild in der Götterdämmerung sah, zu der ihr fremden Nachbarin, meiner Bekannten, sagte: » She remembers me Adelaide Ristori.« Man möge mich nicht mißverstehen. Nur den Beweis wollte ich dafür aufbringen, wie nachhaltig die Impression auf mich wirkte. Niemand wird mich schelten dürfen, daß ich mir ein Beispiel nahm an ihrem »Können«. Bedauern muß ich diejenigen aber, die große Vorbilder unbenützt an sich vorbeigehen lassen, ihnen nicht alles absehen und abhören, was ihnen abzusehen und abzuhören ist, um es als edles Reis zum Wohle der Kunst auf die eigene Individualität zu verpflanzen.
Leider ist man heutzutage erhaben über die Kunst damaliger großer Tragöden, die es vermochten, uns mit ihrer »Individualität« und ihrem enormen »Können« in Ekstase zu versetzen, indem sie die schon vom Dichter als besonders hervorragend geschaffenen Figuren aus dem gegebenen Ganzen individuell herauswachsen ließen. Dafür bildet man sich nicht wenig auf die Natürlichkeit der heutigen Schauspielkunst ein, die der Künstler Individualität von der Regie zu nüchternen gleichgiltigen Menschen drillen und drücken läßt, denen man nur gar zu gern den Rücken kehrt. Um seinem besten Willen gerecht zu werden, versucht man immer wieder sein Interesse auf dies »Neue, Nichtssagende« – denn das »Ekelhafte und Gemeine« streiche ich gleich von vornherein – zu konzentrieren. Vergebens! Schon nach fünf Minuten ist man von der unindividuellen, unkünstlerischen, d. h. natürlich seinsollenden Art des heutigen Theaters uninteressiert oder gelangweilt und kann nach dem I. Akt getrost mit dem Bewußtsein das Theater verlassen, daß man beim Fortbleiben nichts verliert.
Es ist nur zu natürlich, daß genaue Kenntnis großer technischer Mittel eine gewisse Manier bei denjenigen erzeugt, die außerhalb der Repertoire-Fabrik stehen, sich nur mit wenigen ihrer Lieblingsrollen zeitlebens beschäftigen. In Stellungen und Bewegungen nicht gar zu typisch zu bleiben, ist dann die höchste Aufgabe des Künstlers, die ich folgendermaßen ausdrücken möchte: die Erlernung künstlerischer Technik, und diese selbst ist immer mit Übertreibung verbunden. Gilt es doch, sein eigenes feinstes Gefühl für irgend etwas, das gerade je feiner je komplizierter ist, andern in großen Räumen sichtbar, hörbar, d. h. begreiflich zu machen. Künstlerische Technik muß durch die Ästhetik der Seele zum Ebenmaß der Schönheitsform gelangen und kann nur dadurch wieder – scheinbar – zur Natur werden.
Goethe sagt das in kürzerer Form:
»Natur und Kunst sie scheinen sich zu fliehen
Und haben sich, eh' man es denkt, gefunden.«