
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In einer weiten Ebene, die zur Hälfte heute noch Steppe ist, zur Hälfte, von Kanälen durchzogen, ein fruchtbares Ackerland bildet, so etliche 15 km südlich von dem kahlen, ostwestlich streichenden Gebirgszug des Da ts'ing schan, liegt der heutige Hauptort der westlichen inneren Mongolei, die Stadt Kuei hoa tsch'eng (mongolisch: Kuku khoto oder die blaue Stadt). Das Wahrzeichen chinesischer Städte, eine dicke, zinnengekrönte, rechteckige Mauer mit vier Toren, fehlt ihr noch als einer neuen Niederlassung. Sie ist ein offener Marktort mit vielleicht 80 000 Einwohnern, hat dreihundert chinesische Firmen, ein bis zwei Dutzend chinesische Tempel und sechs mongolische Lamaklöster. Krumm, wie es der Zufall und das Gutdünken der chinesischen Kolonisten wollte, sind die Straßen gebaut. Nur ganz im Innern, fast in der Mitte der Stadt, findet man eine kleine burgartige Befestigung mit zwei Toren, die heute einen Teil der Tempel und Amtsgebäude enthält. Es sind zwei Ting 1905 wurden mehrere neue Ting an der Grenze gebildet, indem Stadtbezirke wie Kuei hoa und Bau tu geteilt wurden. Es lagen danach außerhalb der großen Mauer folgende Unterpräfekturen, die noch zu Schan si gehörten: Feng tschen ting, Tien ho ting, Ning yüan ting, Tao ling ting, Kuei hoa ting, Wu tschuan ting, Ho ling ka ör ting, Tsing schui ho ting, To ko to ting, Sa la tschi ting, Wu yuan ting. hier und ein Dao tai, der die elf außerhalb der »großen Mauer« liegenden Ting (Unterpräfekturen) zu kontrollieren und zu inspizieren hat. Die Stadt hat eine große Bedeutung für den Handel. Sie ist der Umschlagsplatz für den ganzen westmongolischen und sogar nordtibetischen Häute- und Schafwollehandel und die Tuchausfuhr.
Ich fühlte mich bei der Ankunft in Kuei hoa halb in der Heimat. Seit dem Frühjahr 1905 gibt es dort eine Post, ich konnte also wenigstens Briefe schreiben, und kaum hatte ich ein Gasthaus bezogen, da brachte mir bereits ein Kaufmann deutschen Sekt, deutschen Kognak, japanisches Bier und japanische Büchsenkonserven in mein Haus und bot sie mir zum Kaufe an. Die Sachen waren erstaunlich billig. Nur war es schwer, ja unmöglich, eine Flasche zu finden, die nicht ein anderer schon vorher »probiert« hatte! Der chinesische Kunde mag keine Katze im Sack kaufen und will sich stets vorher versichern, ob das auch gut ist, was ihm verkauft wird.
Die Stadt an sich, die Straßen boten auch im Vergleich zu den Landstädten, die ich seit Kün tschou in der Provinz Hu pe besucht hatte, ein ungewohntes und hochmodernes Aussehen. An allen Ecken sah man Schutzleute mit einem festen Prügel in der Hand neben einem Schildwachhäuschen, das schief und wie auf seinen Beinen nicht mehr ganz sicher auf einem der uralten Kehrichthaufen stand. Erst seit wenigen Monaten hatte man diese Neuerung eingeführt, und so war noch alles sauber und unzerrissen. Auch hinsichtlich der Straßenbeleuchtung war man dem Verlangen der Reformbewegnng in der Pekinger Zentralregierung bereits nachgekommen. Die Laternen in Kuei hoa tsch'eng standen sicher in keiner Weise denen von Lao ho kou nach. Das dazu verwendete Salatöl schien auch von der gleichen Güte zu sein. »Es muß jetzt in unserer Stadt aussehen wie in deiner Heimat. Wir Hang- und Gasthausbesitzer haben auch viel, viel Geld bezahlen müssen«, meinte mein Wirt. Im übrigen ist Kuei hoa tsch'eng ein sehr schmutziger Ort, und seine zu einem großen Teil fluktuierende arme und ungebildete Bevölkerung ist mit Recht verrufen. Dazu stand die Stadt bei meinem Besuch unter dem Eindruck eines schlechten Jahrganges. Zwar blühte der Großhandel wie zuvor. Die vielen Agenten und Kompradore von Tientsin-Firmen, die Großhändler in Ziegeltee, in Wolle, Schaffellen, großen grauen Ziegenfellen und Rinderhäuten spürten keinen Unterschied. Aber von allen Seiten drängten sich damals im August Arbeitsuchende nach der Stadt, die Pfandhäuser waren überlaufen und vom frühesten Morgen bis tief in die Nacht hinein von dichten Massen belagert. Die Leute, die oft weit aus dem Innern des Reichs hierhergekommen waren, um als Landarbeiter sich zu verdingen, hatten wenig Arbeit gefunden; die Ernte war schlecht. Die meisten mußten einen Teil ihrer Habe und Kleider veräußern, um sich das nötige Zehrgeld zu verschaffen. Reiche Chinesen klagten mir, es kämen in jenem Jahr ganz besonders viele Raubanfälle vor, und man ist hier im »Kou wei«, d. h. außerhalb der Tore des »Reichs der achtzehn Provinzen«, noch an ein gut Teil mehr Sittenlosigkeit gewöhnt als im Innern. Ich habe in China nicht oft einen Betrunkenen gesehen, und dann meist nur einen, der mit seligem Lächeln schlief; es schien, als habe das Opium alle Radaubrüder zahm gemacht. Aber hier ging es unter der Wirkung eines sehr guten und starken Hirseschnapses gar wild her. Orgien aller Art sah man in den Gassen und Hangs der Stadt.
In Kuei hoa tsch'eng war zur Zeit meines Besuchs kein Europäer ansässig. Für Missionare ist es kein guter Platz, dazu waren viele, ja fast alle, die einst hier gewohnt hatten, und von denen frühere Reisende berichten, im Jahr 1900 auf die schändlichste Weise ermordet worden. Nahe bei Kuei hoa tsch'eng erlitt auch Bischof Hammer den Märtyrertod. Er hatte einen Teil der jüngeren Priester seines Sprengels heimgesandt, damit sie wiederkommen könnten, wenn die Wirren beendet wären, aber sich selbst hielt er für zu alt und zu schwach, um die lange Reise durch die mongolischen Steppen und Wüsten noch überstehen zu können, auch wollte er als oberster Hirte bei seinen chinesischen Christen zurückbleiben. Der Straßenpöbel hat dafür dem ehrwürdigen, schier siebzigjährigen Greise seinen Bart ausgerissen, Soldaten haben ihn ausgepeitscht, ihm eine eiserne Kette unter dem einen Schlüsselbein durchgezogen und ihn so, nackt und bloß, unter höllischem Hohnlachen durch die Straßen der Stadt gezerrt, bis er endlich nach achttägigen Märtyrerqualen durch den Tod erlöst wurde. Mr.Watts-Jones, ein englischer Hauptmann, kam im Spätsommer 1900, ohne eine Ahnung von der Größe und Ausdehnung der chinesischen Wirren, nach Kuei hoa tsch'eng, nachdem er Se tschuan, Osttibet und Kan su durchreist hatte. Er wurde hier vom Dao tai zu einem Festessen eingeladen und dann im Ya men auf Befehl desselben Mannes meuchlings niedergeschossen.
Als ich in der Stadt weilte, war natürlich von all dem nichts mehr zu befürchten. Der Dao tai, der so viele Greuel mit seinem Gewissen hatte vereinbaren können, war 1901 auf die schwarze Liste gesetzt worden. Mein Essen in dem nahe gelegenen Sui yuan tsch'eng beim Tatarengeneral Er ist in der Revolutionszeit 1911 ermordet worden. verlief durchaus programmäßig mit etwa dreißig Gängen. Es fehlte auch nicht zum Schluß die Versicherung von Seiten der Exzellenz, daß sie mir gar nichts geboten hätte.
Den Tag vor der Abreise nach der Mongolei, am 15. des siebenten chinesischen Monats, hatten noch alle meine Leute, wie es sich für einen frommen Chinesen schickt – voran natürlich Ma, der, wo es nur eine protestantische Mission gab, immer eifrigst mit seinem chinesischen Gesangbuch in die Kirche stürmte –, den Manen ihrer Väter und anderen guten und grimmigen Geistern etliche hundert Papiercash zugesandt. Sie hatten aus Papier gestanztes Geld gekauft, wie es überall zu haben ist, wo nur Chinesen sich angesiedelt haben, und dieses im Tempel verbrannt. Denn drüben im Jenseits, in der Geisterwelt, geht es nach chinesischer Ansicht ganz so wie auf Erden zu. Man braucht auch Silber- und Kupfergeld, das man durch Verbrennen von Papierimitationen hinschicken kann. Es stand also meiner glücklichen Reise auch von dieser Seite nichts im Wege. Die Götter waren wie die Menschen durch Geld erkauft, dem chinesischen Sprichwort gemäß: »Mit Geld kannst du selbst Götter für dich in Bewegung bringen, ohne Geld rührt sich kein Mensch für dich.«
Der Da ts'ing schan im Norden von Kuei hoa erscheint von der Ebene aus als ein geschlossener, einheitlicher Bergwall. Er ist aber in Wirklichkeit ein sehr kompliziert zusammengesetztes Gebirge. Man kommt darin rasch von der tiefliegenden Fläche, in der Kuei hoa liegt, auf die viel höher liegende nördliche Mongolei. Ich folgte einem Karrenweg, der für chinesische Straßenbegriffe geradezu eine Kunststraße genannt werden muß, und der mich in nordwestlicher Richtung und rasch ansteigend, quer durch die Berge nach dem Ort Kuku irgö (chinesisch: Ko ko i li gen) brachte.
Auf dem Hochplateau, auf der »Rumpffläche« der Mongolei, trifft man seltener auf Löß. Der Boden ist sandig, von Sanddünen und größeren Quarzkieseln bedeckt. Diese Berggegenden sind sehr dünn bevölkert. Wo aber der Ackerbau noch etwas aussichtsvoll erscheint, in Talmulden zumal, an Ecken, wo ein Bach zur Bewässerung der Grundstücke herangezogen werden kann, haben sich heute die Chinesen angesiedelt. Mongolen bemerkt man nur wenige. Auch der Ort Ko ko i li gen ist so gut wie rein von Chinesen bewohnt. Er hat zwei hohe Tore zur Verteidigung und als Wohnplatz für Götter; eine Umwallung fehlt noch. Etwa 10 km nördlich erstrecken sich noch Felder, dann beginnt die Steppe.
Eine Tagereise westlich von Ko ko i li gen traf ich einen großen Gutshof, wie ich noch nie zuvor einen in China gesehen hatte. Er gehörte einem reichen Mann aus Schan si. Der hatte billig einige Quadratkilometer Landes gekauft, als hier, ähnlich wie wir es bei Scha leang gesehen haben, vom Staate »kolonisiert«, d. h. die Mongolen zurückgedrängt wurden. Mitten aus den mageren Prärien, die jetzt, zu Ende August, herbstlich braun zu werden anfingen und nur wenig Grün mehr zeigten, erhob sich eine allseitig geschlossene Gebäudegruppe. Es gab da Schweinehirten, von denen jeder viele Dutzend Stücke der riesigen schwarzen, breit- und langohrigen chinesischen Schweine zu hüten hatte, es gab Ziegenhirten, ferner Leute, die sich nur mit den vielen Pferden, mit den Rindern, Schafen und Kamelen abgaben. Die Felder hatten ihre besonderen Knechte; eigene Schmiede waren da, die nur die Karren des Herrn in Ordnung zu halten hatten und die notwendigen Pflugscharen an Ort und Stelle gossen und zurechtschmiedeten. Es gab eigene Köche und Küchenjungen für die einzelnen Dienerklassen und für die Aufseher. Diese letzteren bewohnten besondere Höfchen, in denen hübsche Blumenbeete mit wunderschönen Chrysanthemen, Violen, Kapuziner- und Kürbislauben zu sehen waren. Auch ein Gasthaus und, last not least: ein Pfandhaus waren mit dem Hof vereinigt! Bis weit hinaus in die Wüste war gerade das letztere berühmt. Hafer, Gerste, Buchweizen, Erbsen, Hirse und Kartoffeln werden hier in der Hauptsache angebaut und zum Markt nach Kuei hoa gebracht.
Die Kartoffeln sind von katholischen Vätern vor etwa vierzig Jahren in Nordchina eingeführt worden. Sie bilden jetzt ein wichtiges Nahrungsmittel in allen Grenzdistrikten Chinas. Wer aber die Wohltäter sind, die die Kartoffel, die »yang yü« (wörtlich übersetzt: die überseeische Aronswurzel), ins Land gebracht haben, ist heute dem Volke unbekannt. Nicht bloß einmal, in Lan tschou fu, in Hsi ning fu, auch in Kuei hoa hörte ich folgende Erzählung: Während eines großen Mohammedanerkrieges in Turkistan war der chinesische General Yang in große Not gekommen. Er wie seine Soldaten steckten mitten im Gebirge und hatten nichts mehr zu essen. Seine Leute erhoben sich deshalb insgesamt gegen ihn und drohten, ihn totzuschlagen, wenn er ihnen nichts zum Essen verschaffe. Da sah er in der höchsten Bedrängnis, wie sein Pferd einige Knollen aus dem Boden scharrte. Er bat seine Soldaten, diese Knollen noch als letztes zu versuchen, und siehe, sie waren eßbar. Es waren Kartoffeln, und daher nennt man sie die Kartoffeln, die Yü des Yang. »Du siehst, ihr Fremden habt da gar kein Verdienst dabei, wie du behaupten wolltest«, schloß einer meiner Gewährsleute Das Nichtanerkennen der Verdienste von Fremden ist eine typische Eigenschaft der Chinesen. 1908 hat sogar eine größere Pekinger Zeitung behauptet und mit Zeichnungen zu beweisen versucht, daß ein Chinese aus Canton schon im Jahre 1898 Zeppelins lenkbares Luftschiff erfunden habe..
Gleich hinter dem großen chinesischen Rittergut, das nach dem Namen des Pfandhauses allgemein als »Da yu tsing« bekannt ist, war leider mein Maultiertreiber mit einigen meiner Sachen, unbekannt wohin und unbekannt warum, verschwunden. Nun galt es, Ersatz für ihn zu finden. Stellensuchende gab es damals wohl genug, aber keiner konnte mit meinen kräftigen und schwer zu bändigenden Maultierhengsten umgehen. Diese hatte ich bei der Teuerung längst auf knappe Kost gesetzt, aber trotzdem mußte ich alle paar Tage einen Stall bezahlen, den sie beschädigt hatten, und unterwegs trug mir jeder munter 180 kg auf dem Rücken.
Nachdem der Maultiertreiber eben verschwunden war, holte ich einen braungebrannten, splitternackten Chinesen ein, der nur mit einem Stecken in der Hand und etwas Geld an einer Schnur um den Hals seines Weges zog. Man hätte meinen können, der Mann sei schon so europäisch und modern geworden, daß er »Körperkultur« treibe und ein Sonnenbad nehme. Er bettelte mich nicht einmal an. Wohl weil er damit bei seinen Landsleuten schon so oft schlechte Erfahrungen gemacht hatte, mochte er es gar nicht mehr versuchen. Er war ein Landarbeiter, der zur Ernte hergereist war. Nun gab es aber nichts zu ernten. Seine Zehrung war ihm ausgegangen, und da ihm in dem Pfandhaus in der Steppe für seine alten Kleider mehr geboten wurde, als er sonstwo erwarten konnte, so hatte er alles auf einmal verkauft, selbst seinen schönen, langen, blauschwarzen Zopf. Mit dem Erlös hoffte er, seine ferne Heimat wieder erreichen zu können. Er war ein munterer, intelligenter Mensch, und ich nahm ihn von der Straße weg in Dienst. Vom nächsten Gasthaus an stolzierte er dann in einer meiner Hosen einher. Gerne spielt kein Chinese den Sonnenbruder, die Nächte waren in den Bergen außerdem schon recht frisch. Ich hätte den Mann gerne behalten, aber in Sa la tschi, das ich einige Tage darauf erreichte, erklärten mir meine anderen Diener rundweg, mit einem Manne ohne Zopf könnten sie nicht zusammen dienen. Es sei unter ihrer Würde. Nirgends herrscht größeres Standesbewußtsein. »Das ist ehrenrührig«, versicherten sie, und dabei deuteten sie auf ihre Wange, weil dort ja die Ehre sitzt. So mußte ich den kleinen Kuli wieder entlassen.
Es tat mir leid, nach einer zehntägigen Reise die mongolischen Berge schon wieder verlassen zu müssen. Allein keiner meiner Diener verstand sich auf die Baumwollpolsterung der chinesischen Packsättel, und bereits stellten sich bei den Tieren Drücke ein.
Sá la tschi ting (mongolisch: Tsaghan kurä) ist ein sehr lebhafter Ort mit etwa 40 000 Einwohnern, unweit nördlich vom Hoang ho, in der gleichen Ebene wie Kuei hoa gelegen und von dieser Stadt 240 Li (120 km) in westlicher Richtung entfernt. Nach dreieinhalb Monaten begegnete ich hier zum erstenmal wieder Europäern, schwedischen Missionaren. Mr. Oberg ist einer der wenigen, die den Fremdenverfolgungen von 1900 entronnen sind. Er wohnte damals näher bei Kalgan und konnte sein und seiner Frau Leben retten, da der Beamte ihn heimlich bei der Flucht unterstützte. Von Sá la tschi selbst ist 1900 kein einziger der europäischen Missionare entkommen. Der Weg nach Osten, nach der Küste, war für sie längst gesperrt, ehe sie überhaupt etwas von der Gefahr erfahren hatten. Für eine Reise nach Norden durch die Wüste hatten sie nicht die genügenden Mittel. So blieben sie hier, und monatelang taten ihnen die Chinesen auch nichts zuleide. Da wurde eines Tags – ich folge der Erzählung Mr. Obergs – der Unterpräfekt, der Ör fu, von Sá la tschi nach Kuei hoa befohlen. Während eines großen Essens fragte dort der Dao tai den Ör fu, ob er auch sicher alle Missionare seines Bezirkes ausgerottet habe. Der Beamte erschrak und bejahte. Heimlich sandte er dann einen Boten an seine Frau mit der Weisung, sofort alle Europäer in der Stadt töten zu lassen. Etwa fünfzehn Personen, Männer, Frauen und Kinder, verfielen diesem Befehl. Sie wurden alle hingerichtet, bis auf eine Frau, die in tiefe Ohnmacht gefallen war, als sie ihren Mann niedersinken sah. Mitten in der Nacht wachte sie zitternd vor Frost wieder auf, alle Kleider hatte man ihr genommen, man hatte sie ja für tot gehalten, mutternackend lag sie da, im Mondschein, rings um sie Blut, die verstümmelten Leiber ihrer Freunde, ihres Mannes, ihres Kindes! Von Entsetzen gepackt, floh die Ärmste wie wahnsinnig von der Richtstätte. Am Morgen fand sie sich am Ufer des Hoang ho, hilflos, verlassen und hungernd. Ein schmieriger, in ein paar Lappen gehüllter Bettler, der das am Ufer angeschwemmte Reisig nach etwas Brauchbarem durchsuchte, begegnete ihr dort. Sie wollte sich rasch im Gebüsch verstecken, doch der Mann hatte sie schon bemerkt und rief sie an: »Habe doch keine Angst, du scheinst noch ärmer als ich. Sei ruhig. Ich will für dich sorgen.« Und wirklich, der Mann hielt sein Wort. Er brachte sie zu einer alten Frau in einen abgelegenen Hof. Dort lebte sie noch wochenlang, freilich die meiste Zeit krank, seelisch und körperlich. Schließlich wurde ihr Aufenthalt doch ruchbar; der Ör fu sandte Soldaten aus, und die erschlugen sie.
Nahe bei Sá la tschi, an der Straße nach Bau tu, sah ich einige Grabdenkmale protestantischer Missionare, Sühnegräber, die auf Befehl der Regierung errichtet worden waren. Es gibt in jenen Gegenden deren viele, die wenigsten aber enthalten die Gebeine der Märtyrer. Viele von den Ärmsten sind in den Bergen verhungert, haben geendet wie die verhungerten Bauern, deren Leichen ich bei meiner Durchreise herumliegen sah, wie sie eben von Hunden und Geiern angefressen wurden.
40 km von Sá la tschi liegt die Stadt Bau tu, die vom Sá la tschi ting verwaltet wird, damals aber der Wohnplatz des neu errichteten Wu yuan ting war, dem eben erst ein Ya men eine kleine Tagereise weiter im Westen von Bau tu errichtet wurde.
Bei meinem Besuche verwaltete dieser sein Gebiet noch von der Ferne. Der Beamte, ein San fu (ein Präfekt dritter Ordnung = Unterpräfekt), erzählte mir, es sei eine sehr schlechte Bevölkerung in seinem Bezirk, er habe allein in dem letzten halben Monat zehn Räuber köpfen lassen müssen. Er erwartete, daß im Winter darauf etwa 4 % der Bevölkerung der Stadt Hungers sterben würden. Man verteile wohl Brot und Kleider an die Armen, aber es könne nicht genug geschehen, es gebe stets zu viele Bedürftige. Die Stadt mochte etwa 40 000 Einwohner haben, die aber ebenso wie in den anderen Städten hier draußen größtenteils sehr fluktuierender Natur waren. Auch eine Altweiberanstalt gab es schon in dieser noch jungen Gemeinde. Es herrschte bei den Eingeborenen die Vorstellung, die Frauen der Fürsorgeanstalt, die bei Lebzeiten auf Kosten des Mandarins lebten, würden im Jenseits seine Pferde und Maultiere werden. Im Jenseits geht ja alles wie im Diesseits zu, wer hier Rangknöpfe und Ämter besitzt, hat sie auch drüben. Anderseits lehren die Buddhisten, daß auch Vergeltung sein müsse, und so werden die armen Frauen eben die Tiere des Mandarins. Die Chinesen denken in allem für uns sonderbar. Als ich dem Beamten in Bau tu meine Aufwartung machte, hing gerade der letzte von ihm Verurteilte als abschreckendes Beispiel im Käfig vor dem Tor seines Amtsgebäudes. Er war ein Räuber und Mörder gewesen, der zum Tod durch Erhängen verurteilt worden war, eine Todesart, die den Chinesen ungleich weniger schlimm erscheint als das Köpfen. Die schwerste Strafe in China war die, am Marterpfahl angebunden, langsam in Stücke geschnitten zu werden. Und zwar sind es weniger die Schmerzen, die diese Strafe den Chinesen so schrecklich erscheinen lassen, als die Vorstellung, daß der Betroffene damit auch im Jenseits gebrandmarkt sei.
In einem 2 m hohen Holzkäfig ohne Boden, den Kopf durch den massiven, schweren Holzdeckel hindurchgesteckt, hing der Räuber nur an Kinn und Hinterhaupt. Er sprach noch mit den Umstehenden, machte Witze mit den Garküchenwirten, den fliegenden Händlern und all dem Volk, das sich am Eingang eines jeden Ya men's von früh bis spät herumtreibt. Als ich auf dem Wege zum Beamten dicht an ihm vorbeikam, schimpfte er mich noch in den unflätigsten Ausdrücken und spie mich an, daß alle Umstehenden hellauflachten, soweit ich ihnen den Rücken zukehrte. Als ich zufällig am anderen Morgen wieder vorbeiritt, hing der Körper des Mannes schon schlaff in dem Käfig. Er war über Nacht gestorben; das Volk aber handelte und feilschte daneben weiter und beachtete ihn gar nicht mehr. Er hatte ja aufgehört, Späße zu machen, er konnte nun nicht mehr zur Unterhaltung dienen! Ein Verurteilter soll es in solch einem Käfig bis zu zweimal vierundzwanzig Stunden aushalten können. Vielen wird aber von ihren Bekannten Opium in den Mund geschmiert, damit sie weniger Schmerzen leiden und rascher sterben können.
Wenige Kilometer südlich der Stadt Bau tu, an der Fähre von Lan hai tse, setzte ich am 2. September über den Hoang ho.
Ich zog ziemlich genau südlich weiter, nach dem Ordos-Land, das ich von Nord nach Süd zu durchqueren beabsichtigte. Durch die Liebenswürdigkeit des Tatarengenerals in Kuei hoa war mir hierzu ein besonderer Paß ausgestellt worden. Ich hatte auch sonst im Gegensatz zu meiner bisherigen Reise größere Vorbereitungen treffen müssen. Im eigentlichen China hatte ich beinahe täglich die nötigen Vorräte für Tier und Mensch kaufen können. Jetzt sollte es tief in die Mongolei, in das »ts'ao ti«, das Grasland, hineingehen. Die Verpflegungsmöglichkeiten wurden mir in Bau tu als ganz schlecht geschildert, nirgends finde sich eine Unterkunft, man müsse alles selbst mitbringen. Ich hatte Ponys gekauft, die Lebensmittel und Futter zu tragen hatten, auch hatte ich eine größere Anzahl neuer Diener angestellt, ich wollte, falls einer hinter einem Busch verschwände, durch seine Flucht nicht sogleich in Verlegenheit geraten. Ein Teil des Lohnes mußte vorausbezahlt werden; womit sollten denn sonst die Familien ihr Leben fristen, solange der Mann und Vater über Land war? Trotzdem lief nur ein einziger der Neuen in der ersten Nacht wieder heim. Sonderbarerweise war es wiederum der Sachverständige für die Maultiere. Er war aber solch ein hohlwangiger Opiumraucher, daß er seine 5–6 Mace (20 g) Opium im Tag haben mußte, um sich einigermaßen frisch zu fühlen. Er hätte die großen Märsche, die nun folgten, auch wohl kaum aushalten können.
Ich hatte früher geglaubt, das Ordos-Land sei eine Wüste und werde nur von Mongolen bewohnt, die mit ihren Herden und Yurten bald da-, bald dorthin zögen. In Scha leang hatte ich vom Innern als Grasland sprechen hören. Als Steppe und trostloseste Wüste wird das Land noch von den beiden Lazaristen Huc und Gabet beschrieben, die es im Jahre 1845 durchquerten, und wir haben auch keinen Grund, deren Bericht in Zweifel zu ziehen. Nur haben sich die Verhältnisse inzwischen geändert Das Ordos-Land, das Gebiet innerhalb des großen Bogens des Hoang ho, wird von den Chinesen »Ho tao« genannt und ist zurzeit von den Ordos-Mongolen bewohnt. »Ordu« = chinesisch »ting« (Pavillon) = Lager, Kgl. Hoflager. Es ist ursprünglich ein türkisches Wort. Im besonderen wurde darunter das Lager des mongolischen Großkhan Dschinggis und später die goldene Horde verstanden, die seine irdischen Reste hütete. Die »Ordus« nennt Sanang Setsen in seiner »Geschichte der Ostmongolen« (Schmidt, Petersburg 1829, S. 191) »die Hüter der acht weißen Häuser (Filzyurten) des Herrschers«. Diese nahmen erst ums Jahr 1530 ihr jetziges Land in Besitz und brachten die Gebeine ihres Bogda Dschinggis Khan vom Norden, höchstwahrscheinlich vom Ufer des Kerulen, mit sich. Noch jetzt sehen die Ordos-Mongolen das Land um den Altai als ihre Heimat an.
Am ersten Tage meiner Ordos-Reise, am 2. September, reiste ich noch in der Hoang ho-Niederung. Wenige Höfe fanden sich an meinem Wege, aber überall sah ich Felder mit Hirse, Buchweizen, Kartoffeln, Wassermelonen, Lein und Hanf, viel Hanf, fast nirgends ein Stückchen unbebauten Landes. 12 km hinter dem Hoang ho überschritt ich einen Kanal, dessen Wasser meinen Leuten bis an die Hüften reichte. Hinter dieser Furt waren wir im Gebiet der Dalat-Mongolen. Noch einige Kilometer weiter, da ragte schon hinter Hirsefeldern der Hals und Helm eines »Tschorten« Heiligengrab und Bauwerk, das einen Ort gegen böse Einflüsse schützen soll, siehe S. 347, Anm. 1. über ein kleines, niederes Wäldchen hervor. Ich war wieder im Lande der Lamas, ich hatte ein Kloster erreicht, das schon ganz wie ein tibetisches aussah. Es fiel gegenüber chinesischen Bauten durch seine bunten Farben und seinen neuen Verputz angenehm auf, die Häuser waren auffallend klein und nieder. Es hängt dies mit der Holzarmut der Gegend zusammen. Dicht dabei lagen die ersten Dünen, aber auch diese waren noch mit Hirse bebaut.
Am 3. September kam ich schon in aller Frühe am zweiten Kloster vorbei, das ebenso niedlich und freundlich dreinsah. Ma wunderte sich sogar, wie diese Bauten europäischen Häusern in Hankow ähnlich sähen. Er wollte sicher damit ein Lob aussprechen, denn ein wohlerzogener Chinese sagt seinem Herrn nie etwas Unangenehmes. Wir stiegen über lange Dünenzüge, die alle WNW–OSO streichen und damit die hauptsächlichste Windrichtung angeben. Barchane, die halbmondförmigen Bogendünen der Wüste, stellten sich dazwischen ein. Es war der Anstieg auf ein flaches Plateau, das sich nun unendlich weit nach Süden und Westen vor mir auszudehnen schien. Wo nur ein Fleckchen sich frei von Dünen und den Anhäufungen des feinen pulverigen Triebsandes zeigte, da sah ich Felder und Chinesenhöfe. Auch am zweiten Reisetag, an dem ich 90 Li (45 km) gemacht hatte, war ich den Abend in einem guten chinesischen Gasthaus einquartiert. Ma und Dang fu aus Lung tschü tschai waren an jenem Abend geradezu in Ekstase. »Nein, das sind sonderbare Leute, die Mongolen!« riefen sie ein über das andere Mal. Der Tumäd-Mongole, der von mir als Dolmetscher angestellt war, hatte am Wege, als er an einem Melonenfeld vorbeikam, einen ihm fremden Mongolen um eine Melone gebeten, und dieser hatte sie ihm gegeben. Das war meinen Chinesen ganz erstaunlich. »Einem ihm gänzlich unbekannten Menschen hat er eine Melone geschenkt, das sind Kinder, das sind keine vernünftigen Menschen, daß sie so etwas herschenken können! Sie sind doch selbst nicht reich«, kalkulierten die beiden. Eine Melone ist dort etwa 15 Pfennig wert. Für Mongolen wie Chinesen ist diese kleine Episode sehr charakteristisch. Der Mongole erscheint im Grunde gutmütig, zumal wenn man ihn nicht an seiner Religion packt, und er ist freigebig und gastfreundlich, soweit es in seinen Mitteln liegt, während beim Chinesen alles stets ein Handelsobjekt darstellt.
Ich habe in Hunderten von chinesischen Privathäusern gewohnt, ich wurde ohne viele Umstände von den chinesischen Bauern aufgenommen, es war aber immer nur die klingende Münze, die mir die Türen öffnete. Von den wenigen Mongolen, die ich bei meiner raschen Durchquerung der Mongolei gesehen habe, haben mich aber zwei von sich aus eingeladen, in ihr Haus zu kommen.
Auch am dritten Marschtage im Ordos-Land immer weiter nichts als Felder. Es waren allerdings sehr schlechte Felder. Ich suchte vergeblich nach Filzyurten. Weithin zerstreut lagen in dem ganz flachwelligen, beinahe ebenen Gelände kleine Höfe, meistens Chinesenwohnungen, aber auch von Mongolen bewohnte Häuschen. Die letzteren machten einen freundlicheren Eindruck als die chinesischen, waren rechteckig, mit einem flachen, von Pappel- und Weidenstangen getragenen Dach, das auf Lehmwänden ruhte. Ganz selten nur sah ich an jenem Tage eine grasbedeckte Fläche.
Am Abend war ich zu Gast bei einem Tutselaktsi des Dalat-Beï tse
Im Gegensatz zu den Chinesen, die schon seit Kaiser Ts'in schi hoang ti (221 – 209 v. Chr.) bis auf verschwindende Ausnahmen keinen erblichen Adel mehr haben, zerfallen die Mongolen in Adel (taidschi) und Volk. Die einzelnen Mongolenstämme stehen unter erblichen Fürsten, die in sechs Rangklassen geteilt sind, die viel Ähnlichkeit mit den acht höheren erblichen Adelstiteln der Mandschu-Dynastie aufweisen. Die Rangstufen des hohen mongolischen Adels sind heute in der meist gebrauchten halbchinesischen Form:
1. Ts'in wang = khan (tatarisch) = König oder Fürst erster Klasse; 2. Tschün wang = König oder Fürst zweiter Klasse; 3. Beïli; 4. Beï tse; 5. Gung; 6. Dsassak, d. h. Bannerführer (letzterer, d. h. der Bannerführer, hat oft nur den Rang eines gewöhnlichen taidschi); 7. Taidschi, d. h. Adliger schlechtweg.
Die Fürsten ernennen aus der Zahl der Taidschi, die als Adlige schon einen blauen Knopf tragen dürfen, Helfer und Beamte. Die höchsten Beamten sind die Tutselaktsi oder Tussulatschi. Diese sind durch einen roten korallenen Knopf ausgezeichnet und stehen meist im Range der zweiten chinesischen Beamtenrangstufe. Unter den Tutselaktsi folgen dem Range nach: Dsángen oder Hóschu dsángen (etwa Oberst), die Méren, sodann Dsálang (etwa Major), Súmun dsángen (Rittmeister) und Kúndu (Leutnant), Boschko (Wachtmeister), kurz noch eine ganze Stufenleiter von Beamten und Offizieren.. Er wohnte in einem weitläufigen, einstöckigen Backsteinbau mit drei Höfen. In nichts konnte ich einen Unterschied gegenüber dem Haus eines reichen Chinesen
erkennen, freilich war es auch ganz von chinesischen Handwerkern errichtet worden. Nur die Bewohner waren verschieden, sie erschienen beinahe wie Fremde in diesen Räumen. Die Frauen hatten unverkrüppelte, große Füße, die mir selber nach so vielen Monaten, in denen ich nur Chinesenfrauen gesehen hatte, recht sonderbar und komisch, ja geradezu häßlich vorkamen. Die Mongolinnen, auch die Frau des Ministers, zeigten sich bei meinem Besuch in ihren Alltagskleidern. Die Frau Minister trug nur wenige kirschgroße Korallen in ihrem blauschwarzen, vollen Haar, das, in zwei Zöpfe geteilt, der Landessitte gemäß vor den Ohren herabhing. Auch ihre Zopfbänder, die als große Taschen, in die die Zopfenden gesteckt wurden, weiter über die Brust herab und unter dem Gürtel durch liefen, waren nicht sehr schön. Die Nähereien darauf sahen recht abgetragen aus. Leider war der Tutselaktsi nicht zu Hause. Sein Majordomus, ein höherer Priester, wußte nicht recht, wie er sich bei der Vertretung seines Herrn mir gegenüber verhalten sollte, doch konnte ich mich über nichts beklagen. Die Bezahlung des Essens und Futters meiner fünfzehnköpfigen Gesellschaft wurde ausdrücklich nur als Geschenk angenommen, gefordert wurde gar nichts.
Das Haus beherbergte über ein Dutzend Lamapriester, Bis in die Nacht hinein war der scharf skandierte Trommelschlag des Gelugba-Kultes, die Begleitung zu den Rezitationen und Litaneien der gelben Lamasekte, zu hören.
Die Priester spielen auch bei den Ordos-Mongolen eine große, wenn nicht die größte Rolle. Als Priester und Angehöriger eines der vielen Klöster, die durch Stiftungen der Fürsten entstehen, wird der gemeine Mann frei. Vorher wird er als Höriger behandelt, besitzt nicht das Recht der Freizügigkeit und wird zu hohen Steuern herangezogen, muß seinem Fürsten oder Grafen im Frondienst die Herden besorgen und andere Arbeit leisten. Darin liegt mit ein Grund, weshalb heute vielfach der dritte Teil der mongolischen Bevölkerung Priester ist. Wo die Mongolen mit den Chinesen zusammengestoßen sind, hat das spatzenartige Überhandnehmen der Chinesen dazu beigetragen, daß die Bevölkerung sich in die Beschaulichkeit des Klosterlebens zurückzieht und dem erschwerten Kampf ums Dasein ausweicht. Die natürliche Folge ist, daß die Mongolenbevölkerung rasch an Zahl abnimmt.
Die Chineseneinwanderung in das Land der neunundvierzig inneren Mongolenbanner Die »innere Mongolei« wurde von den Mandschuren in sechs Divisionen (meng) und im ganzen 49 Banner eingeteilt. und in die Ordos begann frühestens zu Ende des 18. Jahrhunderts. Arme Chinesen stellten den Mongolen in schön und gewandt gesetzten Worten vor, wie es weit praktischer für sie wäre, nur den Pachtherrn zu spielen; sie, die Chinesen, wollten ihnen dann so und so viel von der jährlichen Ernte abgeben; mittlerweile könnten sie ruhig beten oder Schnaps trinken, soviel und solange sie nur wollten. Und jetzt sitzen in vielen Teilen der Ordos die chinesischen Pächter, die »man tse«, zahlreicher als die mongolischen »Herren«. Die Mongolen haben um ihretwillen selber seßhaft werden müssen. Durch die Schuld der Adligen und Fürsten, die als Besitzer der besseren und anbaufähigen Ländereien die ersten Niederlassungen der Fremden zuließen, ist das Land für Nomaden zu eng geworden. Landschaftlich bietet das Ordos-Land wenig Anziehendes. Auch am 5. September machten wir 50 km durch öde Steppe, wobei ich immer einem schmalen, getretenen Pfad folgte.
In einer breiten Talmulde, von niederen Hügeln etwas geschützt, fand ich am 6. September (an meinem fünften Reisetag durch das Ordos-Land) die einfachen, aber hübschen Wohnhäuser des Wang-Fürsten, die zwischen freundlich dreinsehende Klostergebäude eingestreut lagen. Der Wang-Fürst soll über 2000–3000 Familien befehlen. In seinem Gebiet gab es Steppen mit hartem Gras, mit salzgeschwängerten Sümpfen und Dünen. Zahllose Kamele, Pferde, Ziegen- und Schafherden trieben sich friedlich und ohne Aufsicht auf den Weiden umher. Lößhalden waren nur ausnahmsweise und spärlich zu finden. Mongolen sah man nur wenige, und die meisten davon hörte ich etwas Chinesisch sprechen. Sie hatten einen freundlichen Gruß, einen Wunsch für jeden, der ihnen begegnete, etwas Unbekanntes im volkreichen China, wo man sich höchstens bei einem Bekannten erkundigt, ob er sich heute schon sattgegessen habe: ni tschi leao ma?
Im Lande des Wang beï tse, im Südosten, ist der Platz »Ighe Yetschen horo«, das »große Lager« (horo) des »Dschinggis«, das größte Nationalheiligtum der Ordos. Eine der vielen alten Ordos-Familien, die Darhad, ist dessen erblicher Verweser. Von den acht weißen Yurten, die der Geschichtschreiber und Ordos-Gung Sanang Setsen Ende des 17. Jahrhunderts erwähnt, stehen dort zwei, die die Gebeine oder die Asche des großen Königs enthalten sollen. Sie stehen dicht nebeneinander, so daß die eine die Vorhalle der zweiten bildet. Der Eingang ist wie bei einem chinesischen Palast nach Süden. An noch zwei anderen Stellen im Ordos-Land befinden sich Heiligtümer, die das Darhad-Geschlecht hütet. Sie enthalten die Waffen des großen Kaisers und die Überreste der Hauptfrau des Dschinggis Alljährlich am 21. des 6. Monats werden die drei Heiligtümer auf Kamelkarren zusammengebracht und wird ein großes Fest in Erinnerung an Dschinggis Khan gefeiert, bei dem nach dem Berichte meines Tumäd-Mongolen ein weißes Pferd geschlachtet und von allen Anwesenden verspeist werden soll. Es ist ein Ahnenkult..
Am 7. September, südlich des im Chinesischen Ying pan (Standlager) genannten Wohnplatzes des Wang-Fürsten, nahm wieder der Treibsand mehr überhand. Felder fehlten. Ich bewegte mich meist in 1400 m Meereshöhe. Zwischen den Sandflächen liegen zahlreiche große und kleine Seen und viele kleine, buntbemalte Klöster. Nach den verwahrlosten und verfallenen chinesischen Tempeln, die ich in der Umgebung der Ordos gesehen hatte, gaben mir diese »Dschao« (Klöster) in ihrer Sauberkeit und mit ihrem lustigen, vielfarbigen, weißen, roten und blauen Anstrich ein beredtes Zeugnis für die Lebendigkeit des Buddhismus in dieser Gegend. Die Insassen der Klöster in ihren roten togaartigen Gewandungen starrten mich aber bei meiner Durchreise zumeist sprachlos und etwas mürrischen Blickes an und antworteten etwas ungern.
Wir befanden uns nunmehr im Gebiet des Dschassak-Fürsten. Für Tier und Mensch gab es ein mühevolles Vorwärtskommen. Stundenlang wich bei jedem Schritt der feine Sand unter unseren Füßen, und tief sanken wir in die mehligen, staubartigen Massen ein, die ein heftiger Nordwestwind weitertrieb, jede Wegspur sofort wieder verwischend. Kilometerlange Dünenzüge sind dort häufig, und alle diese nachgiebigen und haltlosen Bergwellen mußten wir bei unserer Nord-Süd-Reise übersteigen. Hier im nördlichen Teil der den ganzen Süden des Ordos-Landes bedeckenden großen Sandzone sind übrigens die Dünen meist noch mit Wüstenpflanzen und einem niederen Gebüsch bewachsen. Nach einem langen Marsche erreichte ich mit einbrechender Dunkelheit eine Oase, die ihre Bewohner Bagh'a Ts'aidam Ts'aidam oder tsch'aidam bezeichnet Salzsumpf oder einen sumpfigen Ort überhaupt. und chinesisch Sche ban tai nannten. Zwischen dünenbedeckten Hügeln eingesenkt, liegt eine kleine, ton- und erdereiche Ebene mit schönen Quellen und vielen Bäumen, vorwiegend Weiden und Pappeln. Ich sah fast nur Chinesen. Auch die wenigen Mongolen, die dort angesiedelt waren, sollten von Chinesen abstammen, die einst von reichen Mongolenfamilien gekauft worden waren und nun als halbfreie Hörige die Felder der Adligen bebauten, eine übrigens vielfach im Ordos-Land vorkommende Sitte.
Gegen Mittag des achten und letzten Reisetages tauchte endlich aus all den unzählbaren Sandhügeln ein niederer Höhenzug links vor uns empor. Auf diesem erschienen dicke, knotenartige Anschwellungen. Es waren die ersten Wachtürme des nahen China. Von dort aus konnte einst mit Rauch- und Feuersignalen rasch und zeitig genug jeder heranrückende Reitertrupp an die Grenzmauer und zu den in den verschiedenen Lagern wohnenden Soldaten gemeldet werden. Als ich die ersten derartigen Zeichen erblickt hatte, dauerte es aber noch lange, bis wir aus dem Sand herauskamen. Viele Stunden lang folgten wir noch einer schmalen, wenig über 100 m breiten Lehmebene und einem Bachlauf, wo auch das letzte mögliche Streifchen mit Kartoffeln und Hirse angebaut war. Endlich kamen die Türme der großen Mauer selbst zum Vorschein. In schwach gekrümmten Windungen zieht sich diese hier in allgemein nordöstlicher Richtung hin. Um halb sechs Uhr abends ritt ich einen sandbedeckten Hügel hinauf, auf dem oben die Trümmer eines hohen und breiten, aus Ziegeln gemauerten Turmes standen (Tafel VII unten). Das einstige Tor besteht nicht mehr. Auf lange Strecken ist die Mauer eingefallen, manchmal unter den Sandmassen begraben. Wo sie noch besteht, da bildet sie einen 5 m hohen Lehmwall, der manchmal mit Ziegeln geflickt ist, und an dem alle 1OO m etwa ein Backsteinturm vorspringt, der, wie es scheint, auch erst in späterer Zeit eingefügt worden ist.
Ein Schuß dröhnte jetzt durch das weite, dünenerfüllte Tal. Ich war dicht vor der Stadt Yü lin fu. Das eigentliche Nordtor, durch das mich mein Weg geführt hätte, kann man heute längst nicht mehr benutzen; auch eine quer davorgebaute Schutzmauer ist schon von Sandmassen begraben. Ohne Führer, allein meinen Leuten vorausreitend, hatte ich darum Mühe, einen Eingang in die Stadt von Norden her zu finden. So wollte sich schon das Stadttor knarrend schließen, als ich es endlich in einem Winkel an der besonders eingefriedigten Westvorstadt entdeckte. Für ein gutes Trinkgeld ließen sich die Wächter gerne herbei, noch bis zur Ankunft meiner Lasttiere zu warten. Die Tore der Stadt Yü lin fu zu schließen, ist heute mehr alte Formsache, als daß es einen Zweck hätte. Das Nordtor ist zugeweht, auch das Osttor durch Sandmassen verschlossen, und der größte Teil der Ostmauer ist so tief unter den Dünen begraben, daß man an einigen Stellen von außen auf die Stadtmauer hinaufreiten kann.
Ich war noch am 15. des achten chinesischen Monates hier, wo man im alten China von Amts wegen den offiziellen Sommerhut mit dem Winterhut vertauschte, wo man überall endlose Besuche machte, opferte, und wo das Volk auf allen Gassen schlachtete. Der Hsien sandte mir einen Rinderschlegel, Wachskerzen und ähnliche Sachen (bei Geschenken müssen es immer drei oder vier Paare sein) als Gastgeschenk zu diesem Fest, worauf ich ihm mein gewöhnliches Gegengeschenk, ein Paar meiner japanischen Vasen und zwei Paar Elfenbeinstäbchen übersandte.
Als ich nach einigen Tagen von der halbversandeten Stadt Abschied genommen, zog ich innerhalb der großen Mauer weiter nach Südwest.
Vier Tagereisen hinter Yü lin fu überschritt ich die Mauer noch einmal; sie besteht auch in dieser Gegend wieder in der Hauptsache aus einer Kette viereckiger Backsteintürme. Die eigentliche Mauer, längst von Wind und Wetter zerstört, fehlt oft auf längere Strecken.
Wieder außerhalb der Mauer reisend, ganz im Süden des Winkels, mit dem die große Mauer weit nach der Provinz Schen si einspringt, kam ich nach zwei weiteren Tagemärschen nach Hsiao kiao pan (auf deutsch: Klein-Brücken-Brett), indem ich die letzten 40 km davon fast genau westlich ritt. Dies ist die wichtige katholische Missionsstation nahe bei dem Chinesenort Ning tiao leang.
Aufs liebenswürdigste wurde ich von den belgischen Pères aufgenommen, und gar viel habe ich ihnen zu danken. Ich kam in einem ziemlich elenden Gesundheitszustand auf der Mission an. »Erholen Sie sich bei uns, Sie haben es nötig. Ruhen Sie sich bei uns aus, solange Sie Zeit haben«, meinte gleich bei der Begrüßung der liebenswürdige Père Brahm. Es war allerdings an der Zeit, daß ich eine Pflege fand! Schon wochenlang hatte ich mich nur mit Mühe weitergeschleppt, immer in der Hoffnung, einen Ort und ein Gasthaus zu finden, die zum Bleiben einluden, und wo ich etwas abgesondert der Ruhe hätte pflegen können. Aber solche Plätze sind in Nordchina nicht so leicht zu finden.
Acht Tage lang haben mich die liebenswürdigen Patres gepflegt, und als ich weiterzog, da gaben sie mir noch einen ausgezeichneten Koch mit. Liu war sein Familienname. Er stammte ursprünglich aus dem Süden von Schen si, war aber, wie er oft erzählte, weit in Nordchina herumgekommen als bischöflicher Koch des großen Märtyrers Monseigneur Hammer und des Monseigneur Otto in Liang tschou. Er war ein guter Kerl, kochte musterhaft und verstand es vor allem, seine Kunstwerke überall auszuführen, mitten auf der Straße auf einem Dunghaufen oder in einem Lößhöhlengasthof. Mit seinen Kenntnissen in der Religion war es allerdings nicht ebensoweit her; solcher Art Fragen mochte er auch nicht leiden. Er entschuldigte seine Unkenntnis stets damit, daß er ja nicht lesen gelernt habe, außerdem sei er Zimmermann und nicht geweihter Priester. Er erzählte mir nur einmal von »Malia« Bekanntlich können die Chinesen kein richtiges r aussprechen.; ich bin aber nicht sicher, ob er damit nicht einen Mann gemeint hat.
Hsiao kiao pan ist, wie die Mehrzahl der Missionsstationen an der mongolischen Grenze, eine Kolonie, eine Art christlicher Musterwirtschaft. Langsam wurden von der Mission größere Länderstrecken angekauft. Diese werden an die Chinesen und Mongolen, an letztere, soweit sie dazu Lust haben, den Bauern zu spielen, gegen einen mäßigen Preis verpachtet. Die ziemlich großen Missionsanstalten können sich hierdurch beinahe selbst erhalten, und gleichzeitig wird die junge Christengemeinde enger zusammengehalten, ihre in Gewissenssachen gerne so sehr verschieden und oberflächlich denkenden Mitglieder können kontrolliert werden. Die Pères verlangen regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes und von den Kindern den Besuch ihrer Schulen und der Kinderlehre. Die Christen werden gehalten, nicht Opium zu rauchen und nicht um Geld zu spielen – die beiden Hauptlaster der Chinesen.
Innerhalb der burgartigen Umwallung, die eine Höhe von 8 m hat, liegen in Hsiao kiao pan die Kirche, die Wohnung der Pères, große Vorratskammern für Fälle der Not, Ökonomiegebäude und ein Waisenhaus, in dem ausgesetzte Mädchen eine christliche Erziehung erhalten. Es wird gleichzeitig damit bezweckt, daß die jungen katholischen Männer auch eine Christin als Frau bekommen können. Außerhalb der Umwallung liegen in Hsiao kiao pan ein paar sauber aussehende Straßen mit Lehmhäusern, in denen bei meinem Besuch einige hundert Familien wohnten. Es ist für die Pères nicht leicht, und namentlich kostet es bei den Chinesen, die erst als Erwachsene in die Gemeinde eingetreten sind, eine unendliche Geduld, auf den so ganz anders gearteten Stamm das fremdartige Reis der christlichen Religion und Weltanschauung aufzupflanzen. Es muß oft nachgeprüft werden, denn mancher ist ein fleißiger Kirchenbesucher und stellt sich fromm, beichtet auch fleißig, nur um den Genuß des billigen Pachtgütchens nicht zu verlieren; im stillen kotaut er aber am 1. und 15. jedes Monats den Göttern und Geistern wie zuvor und frönt auch ruhig seinem Opium weiter. Es liegt eine große Gefahr darin, nur »Reischristen« großzuziehen, d. h. Christen, die um der leiblichen Fürsorge der Mission willen die geistliche eben als eine unabweisbare Beigabe mit in den Kauf nehmen. In einer anderen Mission – nicht in Hsiao kiao pan und auch nicht in einer katholischen – habe ich später einmal als Gast gewohnt. Mit Stolz hatte mir der Missionar seinen einzigen treuen Christen vorgestellt, den er nun zur Belohnung, wie er sagte, für seine »aufrichtige christliche Gesinnung« zu seinem Torhüter gemacht hatte. In früher Morgendämmerung wachte ich in jenem Hause durch ein unaufhörliches, halblautes Geplapper auf, das aus dem anstoßenden Zimmer herüberklang. Auch am zweiten Morgen war das summende Geräusch wieder zu hören. Ich schaute durch eine Ritze in jenen Raum und sah meinen Diener noch schlafend am Boden liegen, der Torhüter aber saß unbeweglich da und murmelte vor sich hin. Mein Diener wollte später auf meine Frage natürlich nicht mit der Sprache heraus und gar nichts gehört haben. Als ich aber weiterforschte und gelobt hatte, dem Missionar nichts zu verraten, da erfuhr ich von meinem Mann, der Torhüter bete jeden Tag zusammen mit dem Missionar, denn er werde dafür sehr gut behandelt. Er habe es aber jetzt immer mit der Angst. Während er sich früher um seine väterlichen Götter wenig gekümmert habe, bete er jetzt fleißig zu ihnen, denn sonst würden sie ihm am Ende seine Christenläuferei übelnehmen.
Chinesen aus dem Volk haben fast immer irgend einen Fall, den sie vor Gericht austragen möchten, und auch in Hsiao kiao pan suchen viele die Hilfe und den Einfluß der Pères, damit diese ihnen bei ihren Rechtssachen und Streitigkeiten im Ya men helfen. Mit einem tiefen Ko tou nähern sie sich in solchen Fällen, und fast täglich bringen einige ihr bis ins feinste ausgesponnenes Ränkespiel an. Jeden Einwurf, jeden Zweifel wissen die scheinbar ungewandtesten Bauern rasch zu widerlegen. Wer nicht weitgehendste Erfahrung besitzt, fällt sicher herein.
Nicht immer hatte die Kolonie von Hsiao kiao pan so schöne Tage wie bei meinem Besuche. Père Brahm zeigte mir die alte Anlage der Kolonie. Über hundert Jahre ist es her, daß sie von den Franziskanern gegründet wurde. Einige der alten Christenfamilien, die ihres Glaubens wegen aus China vertrieben worden waren, hatten sich hier einst angesiedelt. Lange Zeit lag die Station in einem engen Talriß unweit vom heutigen Platz. In den Löß und Sand, der die weite Ebene bildet, und durch den das Tälchen zieht, waren die Wohnungen von Patres und Gemeinde, ja selbst die Kapelle eingegraben gewesen. Unweit der Lößhöhlen wohnte jahrelang eine Chinesin. Sie unterhielt eine Brücke über den morastigen Bach und forderte hierfür von jedem Passanten einen Kupfercash. Diese Brücke bestand aber nur aus einem Brett, und daher nannten die Chinesen den Ort Hsiao kiao pan, Klein-Brücken-Brett, wie die Mission heute noch heißt. Ein Pater der Christengemeinde hatte nun eines Tages den Mut, auch solch ein 4 m langes und ½ m breites Brett zu kaufen und über den schlammigen Bach zu legen, um seinen Gemeindekindern den Umweg über das viel weiter flußaufwärts liegende Brett und auch die ständige Ausgabe zu ersparen. Daraus entstand ein großer Prozeß. Die Chinesin, eine Witwe, klagte aus Wut darüber den Pater an, er habe ihren Mann umgebracht. Das war natürlich von Grund aus erlogen, aber angeklagt war er, und da er auf sein gutes Gewissen pochte und nicht, wie es landesüblich gewesen wäre, auf die Macht des Silbers, so mußte er schießlich die Reise nach der Provinzialhauptstadt antreten und jahrelang in Hsi ngan fu bleiben, bis die Grundlosigkeit der Behauptung der christenfeindlichen Gegenpartei als erwiesen anerkannt war und er seine Ehrenrettung durchgesetzt hatte. Die Chinesin aber besaß so lange ruhig weiter das Monopol für ihr kleines Brückenbrett.
Als das Jahr 1900 kam, hatten sich neun Europäer und viele hundert chinesische Christen in die Lehmumwallung geflüchtet und sich darin monatelang gegen Hunderte von Boxern und Mongolen, die mit Jingals und Flinten bewaffnet waren, gehalten. Ein belgischer Priester fiel bei der Verteidigung durch Kopfschuß. Mehrmals wurde während der Belagerung der Versuch gemacht, in die Mauer ein Loch zu graben. Nächtlicherweile hatten sich einige Verwegene von außen her in den toten Winkel unter der Mauer geschlichen und mit Hacken und Schaufeln begonnen, eine Bresche zu legen, während ihre Kameraden jeden von der Verteidigung scharf aufs Korn nahmen, der über die Mauer herabschießen wollte. Es fehlte damals der Lehmburg noch an vorspringenden Türmen, von denen aus man die Mauer selbst und den toten Winkel darunter bestreichen konnte. Trotz allen Minierens und verschiedener Sturmläufe hat aber die kleine Christenburg ausgehalten, bis die pekinesischen Wirren zu Ende waren und der Befehl kam, die Fremden zu schützen und nicht zu töten.
Jetzt ist es der Kampf mit den fortwährend wechselnden und vordringenden Sandmassen, der die Arbeit der Pères erschwert. Auch haben sie natürlich viel von den Lamas zu leiden, die von den chinesischen Beamten moralisch unterstützt werden. Der Ort selber ist ziemlich gesund, nur das Wasser schmeckt schlecht und brackig. Pocken, Typhus, Scharlach und die in China allenthalben sehr verbreitete Hundswut sind die Hauptübel. Einer der belgischen Pères, der wenige Wochen vorher von einem kleinen Hunde, den er hatte streicheln wollen, kaum fühlbar gebissen worden war, starb eben damals an der Hydrophobie. Auch die Kindersterblichkeit in der Gemeinde ist sehr groß. Fast täglich sah ich einen der Pères einem kleinen Sarge das Geleite geben. Die Bestattung von Kinderleichen muß die Mission ganz allein besorgen, auch den Sarg selbst stellen. Chinesische Eltern, auch Christen, kümmern sich in der Regel weiter nicht darum. Es ist schon viel, wenn der Pater erreicht, daß die Leiche nicht einfach über die Mauer geworfen, sondern wie die eines Erwachsenen durch das Hoftor durchgelassen wird. Nach chinesischer Ansicht kann so die Seele den Weg wieder zurückfinden und also ebensoviel Unheil anrichten wie die eines Erwachsenen, dessen Seele in China immer mit vielen Kosten gebannt und befriedigt wird.
Ein siebenstündiger Marsch von der Missionsstation weiter nach Westen, immer in der großen Ebene, in der auch Hsiao kiao pan liegt, und die einem alten zugewehten Salzsumpf zu entsprechen scheint, brachte mich aufs neue durch die große Mauer und gleich hinter und innerhalb dieser zur Stadt Ngan bien, dem Sitz eines Ör fu.
Um der Einförmigkeit zu entgehen und die Höhen kennen zu lernen, die die Ebene von Hsiao kiao pan und Ngan bien hsien im Süden begrenzen, fügte ich hier einen mehrtägigen Abstecher ein, der mich von der großen Mauer bei Ngan bien beinahe genau südlich führte. Ich ging aber nur so weit, bis ich jenseits wieder im Grunde von engen Schluchten horizontale Sandsteinbänke antraf. Das ganze Bergland, das bis zu 500 und 600 m über den südlich wie nördlich davon söhlig hervorsehenden Sandsteinen aufsteigt, bestand rein aus Löß. Kein Steinchen gab es darin, kaum irgendwo einige Kalkknollen und Tonkindchen, die mal eine Art Schichtung vortäuschen mochten; alles nur gleichmäßige, mürbe, gelbe Erde, die sich wie Mehl zwischen den Fingern zerreiben ließ, mit feinen röhrenförmigen Kanälchen im Innern und dann und wann ein paar kleinen Landschneckenschalen darin.
Ich hielt mich nun weiterhin mehrere Tagereisen an eine westöstlich ziehende Straße. Es gab dort lange Märsche. Dabei wurde mir so viel von Räubern erzählt, daß ich mir nicht mehr oft getraute, unterwegs meine Lasttiere ohne meine persönliche Aufsicht ziehen zu lassen. Zwischen den einzelnen Wasserplätzen lagen manchmal 30–40 km lange Strecken, und oft spät am Abend erst erreichte ich den nächsten Hof. Das Land ist reich an Salzpfannen, hat kleine flache Erhöhungen aus Kies und Sand, ist aber arm an Pflanzen und völlig baumlos.
Ich war nun nach der Provinz Kan su (spr.: Gan su) gekommen.
Die Grenze von Sehen si und Kan su läuft mitten durch diese Wüsteneien. Manchmal traf ich jetzt ganze Dörfer von Mohammedanern, die man leicht an ihrer Kleidung, vor allem an ihren blauen oder auch weißen Käppchen mit neun Zipfelchen erkennen konnte. Einen Turban dürfen die chinesischen Mohammedaner nicht tragen. Sie winden sich aber rote und weiße Tücher um den Kopf, sowie sie gegen die Chinesen Krieg führen. Auch bei den Gebeten in der Moschee setzen sie einen kleinen Turban auf, nachdem sie sich vorher den Zopf unter den Hut gesteckt haben, so daß es aussieht, als wäre ihr ganzer Kopf rasiert.
Der Gesichtsschnitt der Mohammedaner in dieser Ecke von Kan su kommt dem chinesischen noch sehr nahe. Das ist auch kein Wunder, denn jahrhundertelang haben sie sich chinesische Weiber genommen. Wieviel hundert Chinesenfrauen wurden nur allein schon aus den belgischen Missionen gestohlen und an die Mohammedaner weiterverkauft! Und doch, an gewissen Individuen schwerer, an anderen leichter, ist die Bastardierung zu erkennen. Der Epikanthus und die doppelte Lidfalte an den Augen, was das typische chinesische sogenannte »Schlitzauge« ausmacht, sind bei den Mohammedanern viel weniger stark vorhanden; gar oft erinnert nur noch ein kaum bemerkbares Fältchen daran. Die Hautfarbe ist um eine Schattierung weißer, der Plexus rosiger, die Nasen sind vielfach etwas schmäler, ja manchmal schon hier hakenförmig. Auch ihr Geruch nähert sich, wie mir die Chinesen wiederholt versichert haben, dem der westlichen Rassen. Es ist für die Kan su-Chinesen, nicht immer aber für die aus der großen ostchinesischen Ebene und für die Chinesen von der Küste, ein leichtes, aus dem Habitus, aus gewissen Ansätzen von Nase und Mund zu erkennen, ob ein Mann ein Chinese oder ein Mohammedaner ist. In außerordentlichen Zweifelsfällen hilft auch der Dialekt mit. Die Mohammedaner sprechen gewisse Worte eine Kleinigkeit anders aus (z. B. »fii« das Wasser), sie »mauscheln« im Chinesischen. Es ist eben noch erkennbar, daß mit ihnen eine fremde Rasse im Chinesentum aufzugehen droht. Im Chinesentum geht ja alles Fremde unter, wie auch vor einigen Jahrhunderten in Ho nan, Tsche kiang und anderen Provinzen größere echte Judengemeinden existierten, die heute bis auf ganz geringe Reste sich unter der anderen Bevölkerung verloren haben.
Die Mohammedaner in China – man nennt sie hier stets Hui hui Wahrscheinlich Nachkommen der Westturkistaner, die von Dschinggis Khan nach dem Osten gesandt wurden. – sind geriebene Geschäftsleute, sie haben in erster Linie den Pferde- und Rindviehhandel so gut wie ganz in ihren Händen, sie treiben aber auch Landwirtschaft, verstehen sich auf Pferde- und Maultierzucht, eine Kunst, die den Chinesen beinahe ganz abgeht, und sind in allen Handwerken tätig. Die Chinesen erklären die Mohammedaner für heimtückisch und unzuverlässig, auch werden viele Diebereien auf ihr Konto gesetzt, ob immer mit Recht, erscheint mir fraglich. Es ist wohl mehr die geringe gegenseitige Kontrolle in einem dünn bevölkerten Lande, was die von den Hui hui besiedelten Distrikte in China unsicherer macht. Ein Mohammedaner war es allerdings, der gerade bei meinem Einzug in das halb zerstörte Dorf Hoa ma tsche rasch den Anbinderiemen eines vor einem Laden stehenden Pferdes abschnitt, sich auf dessen Rücken schwang und so schnell davongaloppierte, daß ihn keiner seiner Verfolger mehr einzuholen vermochte. Auch bei mir wurde an jenem Abend ein Einbruch versucht. Zum Glück aber war mein Weckapparat, den ich mir aus Schnüren und Glocken improvisiert hatte, so gut aufgestellt, daß ein Schuß aus meinem Gewehr die Diebe noch beizeiten verscheuchte.
Eine andere unangenehme Entdeckung machte ich in jener Gegend. Es nahm mich wunder, daß meine Tiere trotz alles Fütterns dünner und dünner wurden. Ich ließ mir täglich das Futter, Erbsen, Kleie und Stroh, vormessen und hatte den Vorrat die Nacht über neben meinem Bett. Von dort mußten die Diener die Portionen alle paar Stunden holen, wenn sie füttern wollten. Die Chinesen füttern nämlich stets die Nacht über. Ich hörte dann die Tiere freudig wiehern, auch fressen und legte mich beruhigt aufs andere Ohr. Endlich brachte ich an drei aufeinanderfolgenden Tagen heraus, daß Ma nur ganz wenig in die Krippen werfen ließ, und auch das nur bei denjenigen Tieren, die nahe bei meinem Zimmer standen, zwei Drittel des Futters wurden an den Wirt zurückverkauft. Das war eine echt chinesische Tat!
Ich reiste nun wieder nach Norden und kam dabei am Tiä kin schan, einem auffallenden Bergzahn, vorbei. Von ihm erzählen die Umwohner, er habe früher Mi tan schan geheißen, und aus einer seiner Felsritzen sei einst Hirse (mi) hervorgerieselt, so daß, wer dort vorbeigekommen sei, sich daran habe satt essen können. Eines Tags aber kam ein Steinhauergeselle des Wegs, dem war die Öffnung zu klein, und die Hirse floß ihm allzu sachte. Er machte deshalb ein großes Loch in den Felsen. Da kam gleich gar nichts mehr aus dem Berg. Der Geselle hatte durch seine Gier den Berggott so sehr erzürnt, daß er den Menschen nichts mehr schenken wollte. Und dann hat man auch den Namen des Berges geändert.
Am 6. Oktober stand ich wieder am Ufer des Hoang ho und erreichte den Ort Ning ngan bu. Mit einem Schlage hatte die Gegend ein anderes Gepräge bekommen. Zahllose Bäume, Pappeln und Weiden, Birnen-, Pfirsichbäume und andere mehr, standen um unzählige Häuschen und Höfchen, um Äcker und spiegelblanke Lehmtennen, auf denen eben mit steinernen achtkantigen Walzen die Körner ausgequetscht wurden und auch Dreschflegel lustig und heimatlich erklangen. Kein Streifchen Landes blieb dort mehr ungenutzt.
Ning ngan bu ist eine Oase am Hoang ho und im Besitze eines sinnreichen Kanalsystems mit vielen Wehren und Schleusen. Von einem großen, weit ausholenden Hauptkanal aus kann alles Land zwischen dem Hoang ho und diesem Kanal berieselt werden, und Tausende haben dadurch ein Heim erhalten. Haarscharf außerhalb des Kanalbereichs beginnt die Wüste. Und wo Wehr und Kanal durch ein sommerliches Hochwasser zerstört war, da lagen auch Lehmhäuser und Äcker wieder verlassen da. Die chinesischen Bauern hier sind selten imstande, aus eigener Kraft einen größeren Schaden wieder gutzumachen, obwohl die Berieselungsanlagen äußerst primitiver Art sind. Sie sind viel zu arm und leben zu sehr von der Hand in den Mund, als daß es ihnen möglich wäre, ihre Arbeitskraft den eigenen Feldern zu entziehen und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, ohne daß sie sofort in drückendste materielle Not geraten. Auch scheint es an der Organisation, die einen Zusammenschluß der Arbeitskräfte bewirkt, zu fehlen. Es bedarf jedesmal der Hilfe eines Vertreters der Regierung oder, wenn es gilt, größere Arbeiten zu unternehmen, Schleusen und Kanäle zu bauen, eines großen Kapitalisten. Dieser bezahlt dann Löhne und Kost und erhält später von den Kleinbauern in einer Art Zehnten seine Ausgaben mit hohen Zinsen ersetzt.
Am 9. Oktober erreichte ich Kin (spr.: tschin) tse pu, ebenfalls eine Oase, die erst durch künstliche Bewässerung entstanden und auf drei Seiten von Wüsten und dürren Steppen umgeben ist. Kin tse pu hat im allgemeinen das gleiche Aussehen wie Ning ngan bu. Nur ein Unterschied fällt in die Augen: so ziemlich jede Familie, die es sich leisten kann, schützt sich und ihren Hof mit einer rechteckigen Umwallung aus gestampften Lehmmauern, die bis zu 7 m Höhe erreichen. Ein kleines Loch an einer der vier Seiten, knapp so hoch wie ein Mann, dient als Türöffnung, kaum daß ein Pony oder einer der kleinen Ochsen durchschlüpfen kann, und zahllose Steine zum Herabwerfen auf etwaige Angreifer liegen oben auf dem Mauerkranz bereit. Eine solche Burg, »bu tse« genannt, reiht sich in Kin tse pu an die andere.
Zwei Stunden lang war ich zwischen abgeernteten Reis- und Kornfeldern, über Brücken und Gräben durch die dicht besiedelte Oase geritten, als zwei besonders sorgfältig und groß angelegte Lehmburgen vor mir auftauchten, die dicht beieinander lagen und sich fast wie kleine Städte ausnahmen. Auch hier sah kein Turm, kein Hausdach aus dem Innern über die Umwallung heraus. Dies hätte ja das Föng schui, die geomantischen Einflüsse, stören und dadurch das Glück der Siedlung vernichten können.
In der südlichen Lehmburg wurde eben noch fleißig gearbeitet. Es wimmelte dort von Hunderten von Leuten, die Bäume zu Brettern zurechtsägten, den gelben Alluviallehm der Felder abgruben, ihn mit Strohhäcksel und Wasser kneteten, in kleine rechteckige Holzrähmchen stampften und dann diese dünnen Ziegel an der Sonne trocknen ließen. Daneben wurde exerziert und auf einer langen Reitbahn unter Aufsicht von Herren in Samt und Seide in voller Paßkarriere mit Musketen nach Scheiben geschossen. Die Umwallungen beider Lehmburgen waren bei meinem Besuch schon vollkommen fertig, nur im Innern der einen wurde noch weitergebaut. Es war mir eine Freude, einmal wieder etwas Sauberes, etwas Nichtzerstörtes zu sehen, alles war musterhaft in Ordnung gehalten und mit der größten Sorgfalt angelegt. Ohne Steilfeuergeschütze dürfte der Platz gar nicht so leicht zu nehmen sein, denn bekanntlich besitzt der Lößlehm auch gegen unsere modernen Geschosse eine sehr große Widerstandsfähigkeit.
Wer aber ist der Herr und Gebieter dieser stolzen Festen? – Wir standen hier plötzlich vor dem Ort, in den sich Tung fu hsiang, der große Boxerführer von 1900, zurückgezogen hatte. Auch er stand 1901 auf der schwarzen Liste und sollte zusammen mit den anderen Großen, die nach der Ansicht der Vertreter der europäischen Großmächte allzusehr gegen das Völkerrecht verstoßen, allzu barbarisch gehaust und allzuviel unschuldig Blut vergossen hatten, um einen Kopf kürzer gemacht werden. Aber als der Schützling der Kaiserin-Mutter entrann er diesem Schicksal, er durfte sich in seine Heimat zurückziehen und ging nicht einmal seines Rangs verlustig. Es hätte auch keiner gewagt, ihn anzutasten. Er lebte jetzt fernab von den bösen weißen Seeungeheuern im Schutze einer Leibwache und hatte sich die beiden Lehmschlösser angelegt für den Fall, daß da einer käme und ihn köpfen wollte. In der einen, in der nördlichen Burg lagen seine Soldaten, darum nannte man diese allgemein das »ying pan«.
Die Zahl seiner Krieger wurde mir verschieden, bald mit 600, bald mit 1000 Mann angegeben. Jedenfalls wimmelte es von sauber in gleiches Schwarz gekleideten Menschen. Einige Bewaffnete, mit dem deutschen Infanteriegewehr Modell 71 in der Hand, standen am Tore Schildwache. Diese ließen mich kaum einen Blick durchs Tor werfen; aus dem Innern ertönte sofort ein wüstes Gebrüll: »Yang gui tse! yang gui tse! schlagt zu, wenn er hereinkommen will.«
Die südliche Festung hat eine doppelte Mauer mit quadratischem Grundriß und über 100 m Seitenlänge. Die innere ist etwa 12 m hoch und trägt oben Wachhäuser an den Ecken. Man sah dort Geschütze stehen, die von Ko lu pu (Krupp) sein sollten, enge Löcher waren oben in der Lehmmauer; alles stand bereit zur sofortigen Verteidigung. Ein Tor wies nur die Ostfront auf, es war aber gleich dem einer kaiserlichen Feste mit einem hübschen Oberbau versehen, und große steinerne und eiserne Löwen prangten dort; alles, wie es in China nur ein Fürst sich bauen darf. Ich sandte seiner Exzellenz, dem Dung da jen, wie der alte Herr hier genannt wird, meine Tië tse und meine chinesische Visitenkarte hinein, aber umsonst. Ich wurde auch kaum bis an die Geistermauer vorgelassen, die innen hinter dem zweiten eisenbeschlagenen Tore den Eingang quer versperrt und Menschen wie böse Geister abzuhalten hat. Mit Mühe gelang es mir, während des Wartens einen Blick in den ersten Hof zu werfen. Jedes der beiden Tore war von zehn Bewaffneten bewacht. Seine Exzellenz ließ sich entschuldigen, wegen Schwerhörigkeit meinen Besuch nicht annehmen zu können. Ich bedauerte dies sehr, denn trotz all seiner Untaten war Tung fu hsiang doch ein großer Mann, kühn und mutig, wie nur wenige seiner Landsleute. Auch gibt es nicht viele Menschen, die von sämtlichen Großmächten zum Tode verurteilt, ungezählte Male in den Zeitungen tot gesagt worden sind und doch noch in alten Tagen unter dem Schutze einer privaten Leibwache ungestört der Bauwut eines reichen und großen Herrn frönen können!
Tung fu hsiang soll damals an 68 Jahre gewesen sein. Er bewohnte seine Lehmburg zusammen mit drei Adoptivsöhnen, Kindern seines Bruders. Er selbst hatte keine Kinder. Er wurde mir von verschiedenen Seiten als noch sehr rüstig beschrieben, sollte aber selten und dann nur begleitet von vielen Soldaten aus seinen Lehmmauern herauskommen. Er besaß große Reichtümer, überall hatte er Häuser und Güter. Allein 1900, als die Gesandtschaften in Peking noch belagert waren, sandte er weit über anderthalb Dutzend Karren voll Silber nach Hause. Er stammt aus Kin tse pu. Angefangen hat er als ein ganz gemeiner Straßenräuber, der in den 1860er Jahren, als Kin tse pu die Hochburg der Mohammedanerrebellion war, die großen Konvois der kaiserlichen Regierung überfiel und an der Spitze einer Bande besonders in der Umgebung von Ku yüan tschou viele Schandtaten auf sein Gewissen geladen, aber sich auch oft mit großer Kühnheit geschlagen hat. Er war ein Freibeuter, und er war kein Mohammedaner. Wegen seines Mutes machte ihn später ein chinesischer General zu seinem Sao kwan. Dieser durfte es sich hoch anrechnen, daß er dadurch den gefährlichen Mann für die Regierung gewonnen hatte.
Auch als Offizier zeichnete sich Tung fu hsiang so sehr aus, daß er rasch stieg. 1877 hatte er schon im Auftrag von Tso ts'ung tang, des Wiedereroberers von Turkistan, das Tarimbecken von rebellischen Mohammedanern zu säubern, wobei er sehr gründlich, aber auch sehr grausam vorgegangen sein soll, und 1894–1895 stand er an der Spitze einer großen Armee, die die Japaner bekriegen sollte. Seine Truppen kamen aber kaum ins Treffen. Seine Soldaten erzählten mir noch von dem furchtbaren Eindruck, den es damals auf alle gemacht habe, als Granaten in ihre Reihen einschlugen, sie aber doch noch immer nichts vom Feinde sahen. Aus dem japanischen Feldzug mußte er sofort in seine Heimatprovinz zurückeilen. Das bloße Gerücht vom Herannahen seines Heeres genügte allein schon, daß die große Mohammedanerrebellion von Hsi ning fu abflaute und die hart bedrängte Stadt entsetzt werden konnte. Damals stand sein Stern wohl am höchsten. Als oberster Führer der großen Armee, die gegen die Rebellen aufgeboten worden war, legte er auch den Grund zu seinem gewaltigen Vermögen. Übermütig geworden, bot er jetzt der Kaiserin-Mutter an, ihr die verhaßten Fremdlinge in die See zu jagen. Seine Truppen hätten es aber nie mit einem halbwegs geschulten Heer aufnehmen können. Es waren ganz undisziplinierte Scharen. Wie er selbst, so ließen sich auch seine Soldaten nur immer zu rohem Morden und Plündern verwenden. Die Kühnheit aber, die er als junger Mann in hervorragender Weise bewiesen haben muß, besaßen seine westchinesischen Kulihaufen nicht.
Eine Wegstunde vom Bu tse des Tung fu hsiang liegt die Stadt Ning ling ting. Diese ist Sitz eines Ör fu, ist aber ein kleines, ruhiges Städtchen, fernab vom Hoang ho. Ein Ting sitzt hier, weil ein solcher größere Freiheit in der Behandlung von Räubern hat. Er darf mehr und mit geringeren Umständen köpfen lassen als ein Hsien. Um die Stadt wohnen noch immer sehr viele Mohammedaner, und daß sie keine ganz friedliche Lage hat, beweisen schon die vielen Lehmburgen der Umgebung.
Ich hatte an jenem Abend keinen Platz im Innern der Stadt gefunden und war vor dem Osttor draußen in einer Herberge einquartiert, die für sich wieder eine kleine Festung vorstellte. Es war ein ganz gutes Quartier, soweit eben eine Stube von 6 qm, in der die Türe gleichzeitig das Fenster bildet und eine Lehmbank das Bett vorstellt, ein gutes Quartier sein kann. Der Wirt hatte mich höflich um Nennung meines Namens und Standes gebeten und – wie es sich auch im alten China für ein städtisches Gasthaus gehörte – kurz vor Torschluß noch sein amtliches Fremdenbuch in den Ya men geschickt und mich dort angemeldet. Ich war noch nicht lange zur Ruhe gegangen, als vom Tore des Gasthauses her wildes Klopfen und Schreien ertönte. Es ist in China nicht Sitte, bei Nacht irgendwo anzukommen. Die Nacht gehört den Gespenstern, ein anständiger Mensch muß bei Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein, und vollends in einer solchen Gegend macht niemand gerne die Tür bei Nacht auf. Durch die Ritzen im Tor sah mein Wirt draußen Leute mit Säbeln, Lanzen und Gabelflinten. Er alarmierte darum die ganze Herberge. Schon vorher, meinte er, sei es ihm nicht ganz geheuer vorgekommen, er habe diesen Abend so viel Schießen gehört. Die draußen aber klopften weiter am Tor und verlangten Einlaß. »Wir sind Soldaten, macht auf!« »Das kann jeder sagen«, bekamen sie von innen zur Antwort. »Was wollt ihr denn?« »Wir kommen im Auftrag des Ör fu ting da lao ye und sollen den Fremden beschützen.« Ich ließ ihnen sagen, ich verzichtete auf die Ehre, es sei beinahe Mitternacht, sie hätten etwas früher kommen können, wenn sie eine Ehrengarde vorstellten. Jetzt wurde als Beweis, daß wir wirklich Soldaten und keine Räuber vor uns hätten, eine Visitenkarte des Ting durch einen Spalt geschoben. Der Wirt erklärte nun, öffnen zu wollen, doch standen wir alle mit gespanntem Hahn da. Eine wild aussehende Gesellschaft, etwa ein Dutzend Leute, erschien und machte vor mir Ko tou. Es sei in der Nähe eine große Rebellion ausgebrochen, berichteten sie, der Ör fu lasse mich bitten, möglichst sofort in die Stadt umzusiedeln. Ich blieb aber lieber hier außen auf eigene Verantwortung. Bestand wirklich eine Gefahr, dann war ja gerade der Umzug ein gewagtes Unternehmen.
Wir hörten in jener Nacht von dem Ausguck am Wall der Privatburg öfters fernes Schießen. Vielleicht war es nur ein Bauer, der mit Papiercrackers böse Geister vertrieb, oder ein vorsichtiger Hausvater, der jede Nacht ein paarmal einen Schuß abgibt, um den Dieben zu verkünden, daß er ein Gewehr hat. Es kracht ja in China immer irgendwo. Aber es zogen auch vielfach bewaffnete Leute am Tore vorbei. Reiter ritten aus dem nahen Stadttor. Eine Stafette war schon lange, ehe man zu mir kam, nach Ning hsia fu abgesandt worden. Die wildesten Gerüchte von Krieg und Revolution, von verbrannten Städten und ermordeten Einwohnern gingen von Mund zu Mund, ganz China, so hieß es, sei in Aufruhr, kurz es war eine böse Nacht. Den wahren Sachverhalt erfuhr ich erst langsam den Tag darauf, als ich dem Ting einen Danksagungsbesuch abstattete. Die Ruhestörer waren eine angeblich mehrere tausend Mann starke Bande der damaligen Geheimgesellschaft Go lao hui Der Go lao hui, zu deutsch »Alter Bruderbund«, war die verbreitetste Geheimgesellschaft in Nordchina. In den westlichen Provinzen soll ihr mindestens ein Drittel der Bevölkerung angehört haben, öfters erschien sie auch unter anderen Namen. Sie war antidynastisch und erst in zweiter Linie fremdenfeindlich. Sie soll während der Tai ping-Rebellion, in deren Verlaufe in Nan king eine Rebellendynastie Tai ping verkündet worden war, gegründet worden sein und ursprünglich eine Art Unterstützungsverein vorgestellt haben. Mittlerweile ist sie in einer der Revolutionsparteien aufgegangen., darunter viele, erst im vergangenen Frühjahr von Tung fu hsiang entlassene Soldaten, die sich seither mit Erntearbeiten beschäftigt hatten, und denen nun Geld und Arbeit ausgegangen war. Sie hatten einen Offizier von Tung fu hsiang für sich gewonnen, der einen Schlüssel zum Arsenal seines Herrn hatte, und am vorhergehenden Abend hatten sie versucht, sich in den Besitz der viertausend Mausergewehre nebst der nötigen Munition zu setzen, die in der Burg des Tung fu hsiang aufgestapelt lagen. Dem Tung fu hsiang selbst wollten sie nichts tun, nur seine Waffen wollten sie haben, um, wie die Gefangenen behaupteten, die Mohammedaner zu bekriegen, die widerrechtlicherweise in der Nähe eine Moschee gebaut hatten. Den Mohammedanern war nämlich nach Niederwerfung ihres großen Aufstandes im Friedensvertrag vom Jahre 1870 für fünfzig Jahre das Recht abgesprochen worden, neue Moscheen zu bauen oder die alten, im Krieg niedergebrannten wiederaufzubauen, jetzt aber hatten sie es durch Bezahlung größerer Geldsummen doch fertiggebracht, hier in Ning ling ting eines ihrer Gotteshäuser errichten zu dürfen.
Der Anschlag auf das Arsenal des Tung fu hsiang war gerade noch rechtzeitig verraten worden. Es kam zu einem kleinen Scharmützel vor der Lehmburg, der größte Teil der Geheimbündler floh alsbald, mit ihm der verräterische Offizier. Einige wenige nur wurden gefangen, und sie hatte der Ting unter der Arbeit, als ich ihn besuchte. »Du ganz infamer Schildkrötensohn, du Schwein, du uneheliches Kind, was hast du mit den Waffen gewollt?« Der Gefangene, der halb ausgezogen am Boden lag, schwieg. »Da da!« »Haut ihn!« schrie der Mandarin, »er muß gestehen.« Endlich kam heraus, was der Beamte wollte, daß sie die Mandschu-Garnison bei Ning hsia fu hatten überfallen wollen. »Die Mandschu müssen weg, ihre Zeit ist abgelaufen!« »Da! da!« »Haut! haut!« schrie nun nur um so wilder der Mandarin. Und so haben sie die Gefangenen mit den amtlichen Marterstöcken totgeprügelt Dieser Vorgang gab den Anlaß, daß Tung fu hsiang im August 1906 nach Lan tschou fu reisen mußte, um persönlich seine Waffen abzuliefern. Er hat aber nur alte Vorderlader mitgebracht und angegeben, er besitze nichts anderes. Er war bei dem Besuch so verschüchtert, daß er aus Angst, vergiftet zu werden, nicht einmal den Tee berührte, den ihm der Vizekönig anbot. Schon in Ning ling ting wurde mir wiederholt versichert, er genieße nur Speisen, die sein Koch in seiner Gegenwart zur Hälfte verzehrt habe..
Einen Tag nach diesem Putschversuch reiste ich weiter. Die Bevölkerung verhielt sich ruhig. Ich begegnete nur ungewöhnlich vielen Soldaten, die auf den Straßen patrouillierten und mir gerne im Vorübergehen noch ein unflätiges Wort nachsandten. An einer Fähre 15 km nördlich von Ning ling ting setzte ich über den Gelben Fluß.
Noch einen ganzen Tag reiste ich hernach auf der Hauptstraße nach Ning hsia fu mitten durch das sehr große Bewässerungsgebiet, das dort schon seit alter Zeit, mindestens seit der frühen Han-Zeit (206 v. Chr. bis 26 n. Chr.) angelegt ist. Es sind vier große Längskanäle, von denen aus das Wasser in unregelmäßig gewundenen kleineren Kanälen, bald 4 m und 5 m hoch auf Dämmen, bald in tiefen Gräben fließend, an die Äcker verteilt wird.
Ich mußte mich in Ning hsia einige Tage erholen, ehe ich weiterreisen konnte, und habe dies in dem Gasthaus »Zu den fünf Glückseligkeiten« (Wu fu dien) getan. Es war dies auch ein solch altangesehenes Haus, das gleich nach meiner Ankunft frische Papierscheiben von mir bekam, und dessen allerschmutzigste fettige Wandstellen neben dem Bett – Kang – von mir tapeziert wurden. Gegen eine auffallend geringe Entschädigung ließ der Wirt sogar in dem Raum neben mir bei Nacht nicht mehr weiterarbeiten. Der Mann hatte nämlich noch einen Mehlhandel und mehrere Eselmühlen. Halbwüchsige Jungen saßen für gewöhnlich bei Tag und bei Nacht an den klappernden Kleiesieben und brachten durch ein abwechslungsreiches Links- und Rechtstreten die hölzernen Maschinen in Bewegung, die einem Europäer mit ihrem Klappern jeden Gedanken und den Schlaf rauben, manchen wohl rasend machen können.
In der Großstadt Ning hsia fu gab es allerlei sonderbare Genüsse. Das Beste waren getrocknete Früchte aus Hami in Turkistan und herrliche frische Trauben. Weniger anziehend dagegen wirkte auf mich die in kleinen Schalen auf den Straßen feilgebotene Schweine- und Menschenmilch. Es wurde aber auch echte Kuhmilch verkauft, wie ja überall in China, wo es Mohammedaner gibt. Die Mohammedaner verstanden hier auch allein ein gutes Brot zu backen.
In der Stadt war keine Mission mehr, seit 1900 die protestantische schwedische Mission von dort abgezogen war. Nach Hedin, der 1897 hier durchreiste, muß diese einst sehr geblüht haben; er weiß von dreißig Bekehrten zu berichten. Ein angeblich protestantischer Chinese besuchte mich, da er glaubte, ich sei ein Missionar. Er hoffte von mir eine Unterstützung zu bekommen.
Die Stadt Ning hsia hat nicht sehr viel Gewerbe und Handel. Am meisten ist sie über ganz Nordchina durch den Export von Gan tsʿao (1200 t Süßholz im Jahre) und durch ihre Knüpfteppichindustrie berühmt. Unter zehn chinesischen Meistern werden hier von je einem halben Dutzend Männer Teppiche geknüpft, ein Kunsthandwerk, das sonst in China nie oder höchstens unter dem Einfluß der Europäer (so in Schanghai und Tientsin) ausgeübt wird. Außer durch die Teppiche ist Ning hsia noch durch seinen Filz und sein Hanfpapier bekannt. In und außerhalb der Stadt werden diese von Chinesen und Mohammedanern verfertigt. Seit alter Zeit hatte die Stadt feine, weiße Lammfellmäntel an den Kaiserpalast nach Peking zu liefern. Diese mußten hübsch geringelt, aber auch langhaarig sein, da sie warm geben sollen. Die Zimmer sind ja im strengen Winter in Nordchina mit seinem kontinentalen Klima nicht durch Öfen geheizt; der Chinese hat nur den Kang, das mit langsam weiterglimmendem Mist geheizte Ofenbett, auf dem er bei Nacht schläft und bei Tag mit untergeschlagenen Beinen hockt und arbeitet. Die Mongolensteppen in der weiteren Umgebung rings um die Stadt liefern für jene Pelze besonders geeignete Felle. Diese werden in der Stadt gewaschen, mit Alaun und Salpeter zubereitet und im gleichen Geschäft zu den rechteckig geschnittenen Mänteln zusammengenäht. Jährlich werden über sechzigtausend Lammfelle verarbeitet.
Mein mehrtägiger Aufenthalt in Ning hsia fu wurde fast zu viel durch Besuche und Einladungen in Anspruch genommen. Mein bischöflicher Koch erlaubte mir auch, den Stadtkommandanten (Tschʿeng schu ying) zum Essen einzuladen. Er hatte den Rang eines Majors, war der Schwiegersohn von Tung fu hsiang und erzählte mir allerlei vom »Tung da jen« (Exzellenz Tung). Er hatte auch Photographien von ihm und von Yü hsien, dem berüchtigten Gouverneur von Schan si, der in seiner Hauptstadt Tai yüan fu nahezu sechzig europäische Missionare hatte köpfen lassen, deshalb auf die schwarze Liste gekommen und 1901 in Lan tschou fu ohne europäische Zeugen von den Chinesen enthauptet worden war. Das Bild war ganz kurz vor der Hinrichtung aufgenommen und zeigte den Gouverneur zusammen mit dem Generalgouverneur (Vizekönig) von Lan tschou fu, beide in dicke Pelzmäntel gehüllt und mit 10 cm dicken Filzsohlen an den Schuhen, Yü hsien mit der Hand auf die Herzgegend gelegt und verklärt nach oben sehend. Der Vizekönig zeigt nach oben gen Himmel. Die Enthauptung wurde später im Beisein einer großen Volksmenge vollzogen, der Kopf aber dann sofort wieder auf den Rumpf genäht, was die Familie allerdings noch sehr viel Geld gekostet haben soll. Vielleicht hat die Seele noch so lange gewartet, und der Gouverneur oder vielmehr seine Seele erreichte doch als Ganzes die Gefilde der Seligen! Wie man stirbt, so kommt man drüben im Himmel an, sagen die Chinesen.
Mein Herr Stadtkommandant fand anscheinend großes Vergnügen an dem europäischen Essen und freute sich über Gabel, Löffel und Messer. Er griff aber doch noch gerne mit den langen Eßstäbchen zu, als zum Schluß ein chinesisches Essen mit zehn Gängen folgte. Am Schmatzen merkte ich, daß ihm dieses doch mehr mundete. Als ich dann im Nebenraum aus einem Koffer einige Bilder hervorholte, die der Herr Major sehen wollte, trat zufällig mein Koch ins Speisezimmer. Der Major fragte ihn, ob er der Chef, der Koch, sei. »Nein«, log dieser sogleich. »Du bist nicht der Koch?« »Bu gan dang, wo bu sche da sche fu« (»Zuviel Ehre, ich bin nicht der Küchenchef«). Der Gast wußte damit ganz genau, daß der Koch wirklich der Koch war. Damit, daß er ihn überhaupt fragte, hatte er ihn schon belobt. Der Koch aber zeigte sich als ein Muster von Höflichkeit und guter Lebensart.
Von Ning hsia fu bis zur Stadt Tschung wei hsien führt die Straße – ich reiste auf der kaiserlichen Heerstraße – zwischen Feldern, und das Tal des Hoang ho war stets sehr gut angebaut. Aus Lehm und Backstein gebaut, standen alle 5 km fünf alte große Meilensteine neben einem kleinen Turm und einem Wachhaus, an dessen Tor mit Farben Soldaten mit Bogen, Pfeilen und Schwertern gemalt waren. Fliegende Händler, Spezialisten in »yu pin«, d. h. in Öl gebackenen Kuchen, in Paprikanudeln, Birnen, Nußkernen fanden sich immer wieder an trockenen Plätzen zwischen kilometerlangen Wegstrecken, die wie die anstoßenden Felder unter Wasser gesetzt waren. Rechter Hand von meiner Straße hatte ich dabei die Ausläufer des Alaschan-Gebirges als mäßig hohe Berge. In den Tälern dazwischen tauchten Teile der großen Mauer auf.
Ich setzte südlich von Tschung wei hsien wieder über den Fluß und verließ damit die Hauptstraße nach Lan tschou fu, der Hauptstadt der Provinz Kan su. Ich wollte versuchen, dem Hoang ho aufwärts zu folgen, der auf der Strecke von Tschung wei an bis nach Lan tschou fu bisher weder in Karten aufgenommen noch von einem Reisenden beschrieben worden ist.
Der Flußverkehr auf dem Hoang ho war an jenem 24. Oktober, an dem ich mich auf der Fähre 3 km südlich von der Stadt übersetzen ließ, ein recht lebhafter. Die dortige Flußzollstation ist sehr bedeutend, denn es werden hier alle Massengüter, wie Holz, Wolle, Häute, die von weiter oben, ja von den Grenzen Tibets auf Lederschläuchen und Holzflößen herabkommen, verzollt und in die flachgehenden Pappelholzboote verladen, die bis hierher regelmäßig und ohne große Mühe von Bau tu und Ho kou heraufgetreidelt werden. Die Strecke des Hoang ho von Bau tu über Ning hsia bis Tschung wei ist die nutzbarste des ganzen Gelben Flusses, war auch verschiedene Male schon für eine Dampfbootverbindung in Aussicht genommen. Das einzige Hindernis ist der strenge Winter, der hier während dreier Monate den Fluß gefrieren läßt. Auch hört die leichte Schiffbarkeit leider lange, ehe das strategisch wie administrativ wichtige Lan tschou erreicht ist, auf. Oberhalb von Tschung wei windet sich der Hoang ho in einer engen Felsschlucht mit scharfen Ecken und gefährlichen Klippen, die jedes Jahr ihren Tribut an Menschenleben verlangen. Der Ho, der Hoang ho, ist nirgends von der Nützlichkeit, von der leichten Schiffbarkeit wie der Kiang, der Yang tse kiang.
Kurz nachdem ich den Fährplatz verlassen hatte, befand ich mich schon zwischen Bergen, und die Flußrinne selbst war so eng und steil, daß ich erst dreieinhalb Tage später in dem Orte Da miao das Ufer wieder erreichen konnte. Alles umliegende Land ist sehr dünn bevölkert. Die Regenarmut ist zu groß. Nur wo künstliche Bewässerung möglich ist, sieht man Felder und Höfe. Da die Gegend deshalb wegen ihrer Räuber verschrieen ist, gab mir der Hsien von Tschung wei zwei Soldaten zur Begleitung mit.
Die größte Schwierigkeit fand ich in der Beschaffung von Pferdefutter. Öfters mußte ich die Tiere mit Hirse füttern, was gar leicht Verdauungsstörungen bei ihnen hervorruft. Am zweiten Reisetage hinter Tschung wei sah ich auf eine Entfernung von 40 km nur zwei Orte am Wege, mit je zwei Familien zu je sieben Köpfen. Sonst gab es weit und breit keinen Hof und keine Ortschaft. Auf den Höhen, die eine dünne Lößdecke zeigen, wächst sehr wenig Gras. Mein Nachtquartier hatte ich in einem Gutshof, wo ein sechzigjähriger Chinese patriarchalisch mit seinen zwei Frauen, drei Kindern und acht Kindeskindern und einigen Verwandten als Knechten wohnte. Der Hof bildete eine kleine Festung, so abgeschlossen war alles; und seine Bewohner hatten ein kleines Arsenal von Schwertern, Spießen und Gewehren. Sonst aber hatten sie trotz ihres armen Landes wohl gar wenig von draußen, höchstens vielleicht den Kattun zu ihren Sommerkleidern, ihre wenigen Eisengeräte und ihre Strohhüte. Das Vermögen des Mannes bestand in seinen Schafen und Ziegen. Aus ihrer Wolle machten sie Pelzmäntel und Filze.
In Filzjacken und Filzmäntel kleidet sich im Winter ein großer Teil der Bewohner von Kan su. Und was sie an Wolle dazu nicht verwenden, das verkaufen sie an den Yang hang, an den Agenten der europäischen Firmen in Tientsin.
Mein Wirt, in dessen Privathaus ich an jenem Abend aufgenommen war, war ein ungewöhnlich intelligenter Bauer. Er war in jungen Jahren weit »unter dem Himmel«, wie er sich ausdrückte, herumgekommen. Bei meiner Ankunft versteckte er rasch alle seine Götterbilder, und erst, als er sah, daß ich in meinem Gepäck einige chinesische Bronzegötter hatte, brachte er seine geliebten heimatlichen Penaten wieder heraus. Diese waren teilweise aus Ton, teilweise nur kleine Brettchen mit den Namen von Schutzpatronen, von früheren Generalen und Kaisern Chinas und von seinen Ahnen. Der Mann war sehr erstaunt, daß es auch Ausländer gebe, welche die chinesischen Götter nicht schlecht machen. Er war die ganze Zeit sehr freundlich gegen mich. Er wußte auch gar sehr zu würdigen, daß er sein Vermögen nur den gesteigerten Wollpreisen verdankte, welche die europäische Nachfrage hervorgerufen hatte, eine Ehrlichkeit, die man auch bei dem höflichsten Chinesen selten antrifft. Sein Vater war in der Rebellionszeit gänzlich verarmt und hatte ihm einen niedergebrannten Hof zurückgelassen. Nun bestellte er nur zum allernotwendigsten Auskommen die Felder, in der Hauptsache betrieb er Schafzucht.
Spät am Abend saß er noch still neben mir, schmauchte seine lange Metallpfeife und sah mir bei meinen Arbeiten und bei der Niederschrift des Tagebuches zu. Plötzlich unterbrach er die Stille: »Du bist ganz wie der Tschou da jen. – Kennst du nicht die Geschichte von Liu da lao ye und seinem Herrn Tschou?« Tschou da jen, die Exzellenz oder Hochwohlgeboren Herr Tschou. Das Chinesische ist die an Titeln und Anreden reichste Sprache. Eine allgemein gebräuchliche Anrede wie unser »Herr« gibt es nicht. Selbst die Worte für »Herr« sind dem Range nach abgestuft. Da jen wird meist mit Exzellenz übersetzt, ist aber noch nicht dasselbe, da es weit hinab in den Rangstufen angewandt wird und anderseits in der Anrede von Gouverneuren und Generalgouverneuren nicht mehr genügt. Ich wußte die Geschichte natürlich nicht. »Liu,« so fuhr der Bauer fort – ich lasse aber die Titel beiseite, die mein Gewährsmann stets wiederholte – »der war angestellt, der ›aß das Essen‹ bei Tschou. Dieser war ein hoher Beamter, besaß aber noch viele Ländereien und viele große Geschäfte in der Stadt. Jahrelang hatte Liu dem Herrn die Rechnung geführt. Er hatte wohl viel zu tun, war aber wegen seiner Stellung sehr angesehen und ging immer in Samt und Seide. Er hatte ein Pfandhaus unter sich und war eine Art Direktor. Eines Tages aber kündigte er und verließ seinen Posten zum großen Schmerze seines Herrn. Dieser stellte der Reihe nach verschiedene Leute an, aber bei keinem wollten die Geschäfte ebenso blühen wie unter Liu. Tschou entschloß sich deshalb, seinen früheren Angestellten zu besuchen. Endlich fand er das Dorf, wo jener beheimatet war, fand auch sein Haus. Dort wurde ihm gesagt, Liu sei auf dem Felde, und Tschou suchte ihn draußen auf. In einer Ecke des Feldes sah er die Ochsen grasen, die ihm bezeichnet worden waren, aber den Mann konnte er lange nicht entdecken. Schier wäre er aber beim Suchen auf ihn getreten. Liu hatte seinen verschossenen Kattunkittel ausgezogen und schlief wie ein Taglöhner mit nacktem Oberkörper in einer Ackerfurche. Mitleidig rief der Herr seinen alten Direktor an und forderte ihn auf, da es ihm anscheinend schlecht gehe, doch gleich mit ihm nach der Stadt zurückzufahren, dort könne er sich wieder in Seide kleiden, auch werde er ihm einen Rang, einen Knopf kaufen. Liu aber lächelte daraufhin nur. ›Sieh, Herr,‹ meinte Liu, ›das schönste ist, Bauer zu sein, einen Acker selbst zu pflügen und zu eggen. Hier habe ich keine Sorgen. In der Stadt aber und als Leiter eines großen Geschäftes muß ich achten, daß ich standesgemäß gekleidet bin, muß mich mit vielen Dienern herumärgern und habe keine Ruhe bei Nacht und bei Tag.‹ – Ich bin auch in Schanghai gewesen, habe dort viele Europäer gesehen,« meinte mein Hauswirt weiter, »aber nirgends habe ich einen Europäer gesehen, dem ich das Verständnis für solche Gedanken zutraute.«
Bald südlich von Tschung wei trifft man in den zunächst breiten, oben abgeflachten Bergmassen noch einzelne höhere Kuen lun-Ketten, Bergzüge, die mit einer N 70–75° W ziehenden Streichrichtung von dem ausgedehnten Gebirge herkommen, das wir auf allen unseren Karten als Nan schan oder Südberg eingetragen finden.
Diese Ketten, die vom 95. Längegrad an in südöstlicher oder ostsüdöstlicher Richtung streichen, setzen sich als stattliche Felsrücken, die nur ganz allmählich an Höhe abnehmen, auch noch weit über das rechte Hoang ho-Ufer fort. Es kostete mich große Mühe, in diesem Bergland den Hoang ho, der sich mühsam dazwischen durchzwängt, wiederzusehen. Die Gegend ist wegelos und sehr wenig übersichtlich. Es herrscht ein Labyrinth von Schluchten, und erst nach tagelangen Umwegen fand ich den Fluß wieder beim Orte Da miao.
Als ich nach dem Ort Da miao kam, lagen einige Soldaten von Tung fu hsiang darin, die seit der mißglückten Überrumplung der Burg ihres Herrn das ganze Land abpatrouillierten und alle Hoang ho-Übergänge bewachten, um der geflohenen Anführer habhaft zu werden. In wie großer Achtung und Furcht diese Privatsoldaten bei allen Bewohnern standen, mußte ich leider hier gleich beim Betreten meines Gasthauses erfahren. Die Tung fu hsiang-Leute waren gerade in Kneipen oder am Ufer des Flusses, als der Wirt des einzigen Gasthauses meine Karawane in seinen Hof führte. Meine Leute hatten abgeladen und waren im Begriff, die freistehenden Räume zu beziehen, als jene Soldaten in das Gasthaus zurückkehrten und, obwohl sie selbst nie etwas für ihr Quartier bezahlten, erklärten, sie könnten nicht dulden, daß ein Fremder im selben Hofe wie sie wohne. Es half nichts, daß meine Leute erwiderten, es sei doch genügend Platz für beide vorhanden. Die Soldaten des Tung fu hsiang schlugen sofort im Bewußtsein ihrer Übermacht auf meine Diener ein, ohne daß irgend jemand von den Ortsansässigen dazwischenzutreten wagte. In diesem Augenblick betrat ich das Gasthaus und verlangte natürlich sofort von den Polizeisoldaten aus Tschung wei, die mich geleiteten, sie sollten die Parteien trennen. »Hier können wir nicht einschreiten, dies sind Leute von Exzellenz Tung«, erhielt ich prompt zur Antwort. Mit den unglaublichsten Ausdrücken begannen die Soldaten Tung fu hsiang's auf mich, den Fremden, zu schimpfen, und einer wollte mich gar von hinten auf den Boden reißen. Doch er hatte vergeblich nach meinem Zopf gegriffen. Er hatte vergessen, daß Europäer keinen haben. Ich war damit aber zur Selbstverteidigung gezwungen. Zum Glück gelang es mir auch sogleich, einem meiner Angreifer die Waffe zu entreißen und dann die ganze Gesellschaft mit Ausnahme von einem aus dem Hof zu drängen. Den einen wollte ich durch meine beiden Polizeisoldaten verhaften lassen. Es war aber nur noch einer von meiner »Schutzwache« in meiner Nähe, und der machte auf dem schmutzigen Boden des Hofes Ko tou vor mir und bat mich mit jammerwürdiger Stimme, so etwas von ihm nicht zu verlangen, er könne das auch nicht tun, ohne daß sein Herr, der vier Tagereisen entfernt wohnte, es ihm befehle. Seinen Kollegen aber suchte ich vergebens, der hatte sich längst dünne gemacht. Beide fürchteten nämlich für später die Rache der Tung fu hsiang-Leute. Ich mußte also den letzten Tung fu hsiang-Krieger auch noch hinauslassen. Damit die Leute aber keine Dummheiten machen konnten, hatte ich ihre sämtlichen Waffen (ein Gewehr und sechs Säbel) zurückbehalten. Meine chinesischen Diener wanden sich mittlerweile am Boden. Sie schimpften, sie seien halbtot geschlagen worden, weil sie mir, einem Fremden, dienten. Zwei davon verlangten ihren Gehalt und ihre sofortige Entlassung.
Aber nur einer blutete ziemlich stark an der Schläfe, er hatte einen Säbelhieb erwischt – die meisten hatten nur tüchtige Schrammen. Erst das Versprechen eines Schmerzensgeldes von je einem halben Monatsgehalt brachte sie wieder in bessere Stimmung. Da es am Orte, wie auch weit in der Umgebung, keinen Beamten geben sollte, so verlangte ich den Dorfältesten zu sehen. Er ist nach chinesischem Gebrauch für den Frieden in seiner Gemarkung in erster Linie verantwortlich. Auch hier hieß es natürlich, es gebe keinen, er sei krank, er sei über Land, und niemand zeigte mir sein Haus. Spät am Abend kamen drei alte Mollah, die mit mir über die Angelegenheit verhandeln, d. h. die Waffen wieder haben wollten. Unklugerweise sagte ich diesen, ich müsse mich darüber beschweren, daß ein Tung fu hsiang, der doch nur als Privatmann aufzufassen sei, überhaupt noch Soldaten halte. »Bringe uns nicht ins Unglück,« riefen da alle drei, »es ist ja unser Fehler, daß wir nicht eingeschritten sind; die Raufbolde sind aber betrunkene Theaterbesucher und keine Soldaten von Tung fu hsiang.« Als ich unter Hinweis auf die Waffen dieser Auslegung widersprach, sollten die Raufbolde nun plötzlich kaiserliche Soldaten gewesen sein. Ich verlangte als Beweis die Pässe und Nationale zu sehen. Wenn auch im alten China die Soldaten sehr oft bewaffnet in Zivilkleidung Die Uniform des eigentlichen chinesischen Heeres (der Lü Ying-Bataillone) bestand bis vor kurzem nur aus einer kurzen roten oder gelben Baumwolltuchjacke, auf der mit großen Schriftzeichen die Kommandobehörde zu lesen war. Zur Zeit meiner Reise war diese Uniformierung in Westchina noch allgemein im Gebrauch. über Land reisten, so durfte doch keiner mit Waffen in der Hand ohne einen schriftlichen Ausweis die Garnison verlassen, und Privatleute durften anderseits keine Schußwaffen besitzen. So mußten die drei Mollah mir am Ende doch zugeben, daß es Leute von der Leibwache des Tung fu hsiang gewesen seien. Sie baten mich aber, die Sache doch ja nicht bei der Behörde anzuzeigen, und wollten mir, um mich willfährig zu stimmen, chinesische Süßigkeiten, Brot und Früchte schenken.
»Wenn du uns anzeigst, so ißt der Hsien und der Tung fu hsiang unser ganzes Vermögen, und wir armen Dorfbewohner haben doch nichts getan.« Ich wollte aber von einer Anzeige bei der Provinzialbehörde nicht abstehen und versprach nur, die Unterstützung der Dorfältesten anzuerkennen, wenn sie mir behilflich seien, das Corpus delicti, das Gewehr und die Schwerter, zum Distriktsmandarin nach Tsing yüan hsien zu schaffen. Dies wurde zugesagt. Und so zog ich ab, eine Strecke hinter mir drein die Tung fu hsiang-Leute.
Unbelästigt reiste ich drei lange Tagereisen weiter nach der nächsten Stadt Tsing yüan hsien. Der Weg führte durch eine wilde Gegend, selten waren darin Felder zu sehen. Ich hatte einen hohen Paß zu überschreiten, den Tai huo schan und Da tschang schan, der für die Lasttiere ein schweres Stück Arbeit abgab.
Tsing yüan hsien ist ein ruhiges Landstädtchen mit angeblich 800 Familien in einer langen und 2 km breiten Bewässerungsebene mit rotem Tongrund und liegt auf dem rechten Hoang ho-Ufer. Sein Mandarin, natürlich wieder ein steinalter Mann mit einem langen weißen Knebel- und Schnurrbart Die Chinesen tragen erst mit dem vierzigsten Jahre einen Schnurrbart und erst viel später, im Greisenalter, einen Vollbart., empfing mich sehr höflich steif. Er stellte so naive, unschuldige Fragen, als hätte er noch nie einen Europäer gesehen und kaum von unserer Existenz etwas vernommen. Beim Anblick der Waffen, die ihm die zwei Polizeisoldaten übergaben, rief er aus: »Die gehen mich nichts an, die gehören Soldaten der großen Exzellenz Tung fu hsiang.« Er gab sogleich die Waffen an jene tapferen Krieger zurück und wollte damit die Sache für erledigt erklären. Als ich hiergegen Einspruch erhob, suchte er mich durch Geschenke und durch eine Einladung zum Essen umzustimmen und machte den Vorschlag, die Krieger des Tung fu hsiang sollten sich vor ihm bei mir entschuldigen. Das wollten aber jene nicht, sie zogen vielmehr brummend ab.
Während meines Besuches fuhr der hohe Herr einmal unter seine verschiedenen seidenen Amtskleider, kam mit einer kleinen Beute zwischen den Fingern wieder heraus und zerdrückte diese zwischen den langen Fingernägeln, so daß man bei der atemlosen Stille, die bei dieser Pause in dem Amtszimmer entstanden war, einen leisen, aber doch deutlichen Knacks hören konnte. Auch den Gebrauch eines Taschentuchs, den chinesische Beamte sonst gut kennen, schien der Herr in seinem Alter und vielleicht auch in Anbetracht seiner schönen, zollangen Fingernägel, die teilweise goldene und silberne Futterale zu ihrem Schutz anhatten, längst abgeschafft zu haben. Der Mandarin gab auf meine Frage an, siebenzig Jahre alt zu sein. Es ist in China ja sehr höflich, sich nach dem Alter zu erkundigen. Er sah allerdings noch viel älter aus, und an seinem Gesicht wie an seinen braun gefärbten Fingerspitzen ließ sich leicht ablesen, daß er ein großer Opiumheld war. Wer war dies auch nicht in Kan su, wo das Opium ganz besonders billig war, wo selbst Chinesen mir oft versicherten, daß 70–80 % aller Erwachsenen Opium rauchten?
Vier Tagereisen trennten mich in Tsing yüan hsien von meinem nächsten und lang ersehnten Ziel, der Provinzialhauptstadt Lan tschou fu.
Am 4. November kam ich dort an, nachdem ich am letzten Tage nur noch durch das große, lößerfüllte Talbecken dieser Stadt zu reisen gehabt hatte. In der Nacht zuvor gab es noch eine Szene, die ich meinen Lesern nicht vorenthalten will. Sie scheint mir charakteristisch für das Leben, das Denken und Trachten des armen Kan su-Volkes. Es war sehr spät geworden, bis wir in dem Orte Hsiao ho kou ankamen. Es hatte auch Mühe gekostet, bis sich ein Tor auftat. Als ich endlich in einem kleinen Gasthofe untergebracht war, gab es bald darauf eine bösartig aussehende Rauferei, Frauen zankten und schrien, und zwei alte Chinesenväter hielten sich gegenseitig an den Zöpfen fest und suchten einer den anderen unterzukriegen und mit den Füßen zu treten und zu stoßen. Obwohl der Hof, in dem ich mit meinen Tieren untergebracht war, nur 8 m auf 8 m Bodenfläche hatte und an zwei Seiten nur je ein niederes Häuschen von je drei kleinen Travéegelassen (kien) sich befand, wurde das Hotel doch von zwei Parteien betrieben. Und ich hatte neun Tiere! Wer nun das neunte füttern und dann das geringe Strohgeld (etwa 25 Pfennig) einstreichen dürfe, darüber waren die zwei Besitzer uneins geworden. Als sie sich schließlich losließen, zog der eine einen meiner Gäule am Halfter auf seine Seite, und der andere hielt ihn am Schwanz. Kein Zureden half, und ich wollte doch kein salomonisches Urteil fällen!
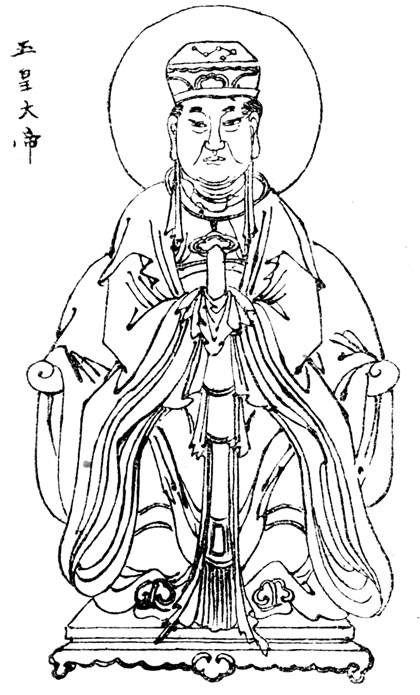
Abb. 2 Yü hoang (hwang) ti, der Edelsteinkaiser, der höchste taoistische Herrscher und Gott in der unsichtbaren Welt (Vergl. Seite 41)