
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wie wir gesehen haben, irrt der Gelehrte, wenn er die Tiere für Maschinen hält, und auch der Jäger irrt, wenn er von der »Klugheit« seines Hundes schwärmt. Die Wahrheit liegt, wie so häufig, in der Mitte. Wie könnte ein Vereinsamter, etwa eine alte Frau, auf den Gedanken kommen, sich einen Hund oder ein anderes Tier anzuschaffen, um für die Seele etwas zu haben? Die Freude des Hundes bei der Heimkehr seines Herrn oder seiner Herrin zeigt nichts, was einer Maschine eigen ist; möchte sie auch noch so geistreich ersonnen sein. Aber diese Freude des Tieres bereitet dem Einsamen einen seelischen Genuß, auf den es ihm gerade ankommt.
Der Jäger verwechselt, wie wir sahen, Klugheit mit der größeren Feinheit der tierischen Sinne. Das soll sogleich näher besprochen werden.
Vorher müssen wir uns noch über den Begriff »Haustiere« klarwerden. Man versteht gewöhnlich darunter solche zahme Tiere, die des Nutzens oder Vergnügens wegen in einem Lande gezüchtet werden. Bei uns handelt es sich um Hund, Katze, Pferd, Esel, Rind, Schwein, Ziege, Schaf, Kaninchen, Meerschweinchen, Frettchen, Huhn, Truthuhn, Perlhuhn, Fasan, Pfau, Taube, Ente, Gans, Schwan, Kanarienvogel, Wellensittich, Goldfisch, Seidenspinner und Biene.
Da wir uns mit dem Seelenleben der Haustiere beschäftigen wollen, so kommen für uns in erster Linie Hunde, Pferde und Katzen in Betracht. Denn vom Seelenleben der Meerschweinchen, Goldfische und Seidenwürmer ist, wie jeder weiß, nicht viel zu berichten. Dagegen wollen wir außerdem solche Tiere in den Kreis unserer Betrachtung ziehen, die strenggenommen keine Haustiere sind, wie Störche und Schwalben. Für den Landbewohner stehen sie mit den Haustieren auf einer Stufe, obwohl sie nicht zahm sind und nicht von ihm gefüttert werden. Dennoch spricht er von »Hausstörchen« und »Hausschwalben«. –
Wie wir sahen, hatte der Hund den erlegten Rehbock mit seiner feinen Nase aufgefunden. Er ist eben ein Nasentier im Gegensatz zu uns Menschen, die wir Augentiere sind.
Um ein Tier richtig beurteilen zu können, muß man zunächst die Schärfe der einzelnen Sinne kennenlernen. Was ich unter diesen Bezeichnungen verstehe, will ich nachstehend näher erklären.
Es besteht ein Verhältnis zwischen Auge und Nase, das man etwa wie folgt ausdrücken kann: je besser das Auge eines Geschöpfes ist, desto schlechter ist seine Nase. Dieser Satz gilt natürlich auch umgekehrt: je besser die Nase ist, desto schlechter sind die Augen. Genau genommen sollte es heißen: bei allen Geschöpfen ist die Summe der Sinne gleich groß. So wird zum Beispiel bei den Fledermäusen das beinahe fehlende und bei den Blindmäusen das gänzlich fehlende Gesicht nicht allein durch eine ausgezeichnete Nase, sondern obendrein durch ein ungeheuer feines Gefühl ersetzt.
Die Tiere, deren Grundsinn das Auge ist, wie Affen, Vögel u. a., nenne ich Augentiere, diejenigen, deren Grundsinn die Nase ist, wie Hunde, Schweine, Elefanten, Nasentiere.
Unter Grundsinn verstehe ich den Sinn, mittels dessen sich ein Tier von der Beschaffenheit einer Sache, namentlich einer unbeweglichen, überzeugt. Augentiere lassen die Augen umherschweifen und prüfen mit ihnen, ob es die richtige Sache ist. Der Mensch, der das Auge als Grundsinn hat, sieht deshalb genau hin, ob der Schirm auch der seinige ist. Nasentiere dagegen überzeugen sich durch Beschnüffeln von der Gleichheit gewisser Gegenstände. Deshalb beschnuppert der Hund seinen Herrn, um sich zu vergewissern, daß es auch wirklich sein Herr ist.
Wenn ich Auge und Nase als Grundsinne bezeichne, so ist mir niemals eingefallen zu bestreiten, daß auch die anderen Sinne eine hervorragende Rolle spielen. Alle Tiere hören mindestens ebenso fein wie der Mensch, gewöhnlich sogar besser. Fische sind Gefühlstiere, weil den meisten von ihnen wahrscheinlich das Gehör fehlt, das sie jedoch durch ein enorm feines Gefühl ersetzen.
Da höre ich den Einwand von der »Klingel am Karpfenteich«. Das Herbeikommen der Karpfen auf das Glockenzeichen ist wohl mehr auf die Erschütterung des Bodens beim Herannahen des Läutenden und der Schwingungen der Luftschichten über dem Wasser, als auf die von den Tieren etwa wahrgenommenen Töne zurückzuführen.
Die ungeheure Bedeutung des Gehörs für den Menschen wird kein Vernünftiger bestreiten. Ist das Gehör doch in der Dunkelheit unser Hauptsinn. Wenn der Elefant als Rüsseltier bezeichnet wird, so kommt selbst ein Vorschüler nicht auf den Gedanken, der Elefant habe keine Beine, sondern liefe vielleicht auf dem Bauche. So kann auch die Bezeichnung Augentier kaum zu dem Irrtum Anlaß geben, ein Augentier könne nicht hören.
Je nachdem ein Geschöpf sich mit dem Auge oder der Nase zurechtfindet, benimmt es sich ganz verschiedenartig. Für das Auge ist das Gesicht der interessanteste Körperteil, deshalb sagen wir zu einem Fremden, den wir näher kennenlernen wollen: »Lassen Sie sich einmal beschauen!« Für die Nasentiere aber sind gerade das Gegenteil vom Gesicht, nämlich After und Geschlecht, die interessantesten Teile des Körpers, weil sie die eigentümlichste Ausdünstung haben. Zwei Hunde, die sich auf der Straße begegnen, schauen sich daher nicht wie die Menschen ins Auge, sondern beschnüffeln ihr Hinterteil. Der Durchschnittsmensch, der sich diese täglich zu beobachtende Begrüßungsweise zweier Hunde betrachtet, wird, wenn man ihn nach dem Grunde dieses Benehmens fragt, antworten: »Ja, das sind eben unvernünftige Tiere!«
In Wirklichkeit handelt der Hund durchaus nicht unvernünftig, sondern von seiner Sinnesbeschaffenheit aus vollkommen zweckmäßig. Wenn wir Menschen die ganze Welt immer durch unser Schiebefenster betrachten, kommen wir freilich zu den allerungerechtesten und unzutreffendsten Urteilen.
Ist man im Zweifel, ob man ein Augen- oder Nasentier vor sich hat, so wird regelmäßig die Betrachtung genügen, wie sich ein Geschöpf gegen seinen Gatten oder sein Kind benimmt. Der Hengst beschnüffelt die Stute, die Stute das Fohlen, der Bulle die Kuh, die Kuh das Kalb am Hinterteil. Aber kein Affe, keine Katze, kein Vogel wird den Gatten oder die Jungen an dieser Stelle beschnüffeln.
After und Geschlechtsteile – auch wegen ihrer Ausdünstung die Füße – sind also sozusagen das Gesicht für die Nase. Dem Auge bieten diese Teile nur wenig, was zur Unterscheidung dienen könnte, wie umgekehrt unser Gesicht für Nasentiere keine besondere Ausdünstung zu haben scheint.
Dieser Unterschied des Grundsinns kommt auch äußerlich unverkennbar zum Ausdruck. Man betrachte zwei einander so ähnliche Baumtiere wie Affe und Faultier. Der Affe hat stechende Augen und eine stumpfe Nase, das Faultier blöde Schweinsaugen und eine schnüffelnde Hundenase. – Sollte das Zufall sein?
Wie oft habe ich im Zoologischen Garten dem Faultier zugeschaut und mir gesagt: Wenn ich jetzt einen Gegner meiner Theorie hier hätte, der sich das Faultier ansähe und dann nach dem Affenhause käme, ich glaube, er wäre in fünf Minuten bekehrt.
Giraffe und Kamel sind gleichfalls so verschieden wie Affe und Faultier. Das wunderbare Auge der Giraffe zeigt uns schon äußerlich, daß der Grundsinn dieses Tieres das Gesicht ist. Das wird auch durch die stumpfe Nase bestätigt. Die Giraffe will z. B. manchmal den Besucherinnen des Zoologischen Gartens künstliche Blumen vom Hute nehmen; das würde kein Nasentier machen. Das Kamel hat blöde Augen, dafür aber feuchte und große Nüstern.
Kann es wohl einen größeren Unterschied geben als das königliche Auge des Adlers und ein Schweinsauge? Umgekehrt hat der Adler wie alle Vögel eine trockene Hornnase, während das Schwein einen beweglichen Rüssel hat. Die Tiere mit beweglichen Nasen haben den schärfsten Geruch, Maulwürfe, Elefanten, Tapire u. a. liefern den Beweis.

Vor dem Giraffenhaus im Zoologischen Garten:
Die Giraffe als Augentier hält künstliche Blumen auf den Damenhüten für geeignete Nahrung.
Nach einer Originalzeichnung von
Paul Neumann.
Jedenfalls hat ein Nasentier immer eine feuchte Schnüffelnase, da Feuchtigkeit zum Aufsaugen der Gerüche unentbehrlich ist, wie ja auch Hunde mit trockener Nase nichts leisten können. Schon wegen der Trockenheit der Nase muß man es von vornherein für unwahrscheinlich halten, daß Vögel wittern können.
Einige Paviansarten haben mit Hunden wegen ihres riesigen Gebisses schon so auffallende Ähnlichkeit, daß sie im Altertum ›Hundsköpfe‹ genannt wurden. Und doch ist bei beiden Tieren der Grundsinn verschieden. Der Affe hat als Augentier ein stechendes Auge, aber eine trockene Nase, obwohl diese auf dem gewaltigen Oberkiefer mehr als genügend Platz hätte, um ebenso ausgebildet zu sein wie die des Hundes.
Sollte hier überall nur blinder Zufall walten? Oder habe ich recht, wenn ich behaupte, daß kein Geschöpf mit mehr Gaben ausgestattet ist, als es zu seinem Leben gerade nötig hat. Deshalb hat kein Tier mit scharfem Gebiß obendrein Hörner, kein guter Kletterer ist ein vortrefflicher Läufer, kein hervorragender Flieger ein Dauerläufer usw. Umgekehrt haben Horntiere kein Raubtiergebiß, Dauerrenner können nicht klettern usw.
Es ist merkwürdig, daß dieser Unterschied zwischen Augen- und Nasentieren nicht längst erkannt worden ist. Daran tragen eine Reihe von Umständen schuld. Hier ein Beispiel:
Der Mensch als Tagseher bedarf des Tageslichts, um scharf sehen zu können. In der Dunkelheit kann er nur mäßig sehen, während, wie bereits erwähnt, Nasentiere, die gewöhnlich große Pupillen haben, jeden Lichtstrahl auffangen und daher mindestens so gut sehen wie der Mensch. Da vielen Hunde- und Pferdebesitzern diese Überlegenheit ihrer Tiere längst aufgefallen ist, so schloß man irrigerweise daraus, Hunde und Pferde könnten auch am Tage besser sehen als der Mensch.
Einige Hunde nehmen eine Ausnahmestellung ein, wie z. B. Windhunde und Schäferhunde, deren Sehvermögen im Gegensatz zu anderen Hunderassen recht gut ist. Allerdings ist diese Ausbildung ihres Gesichts auf Kosten ihrer Nase vor sich gegangen.
Endlich sind die Augen der Nasentiere so gebaut, daß sie für Bewegungen empfänglicher sind als unsere Augen. Diese Erfahrung hat jeder Jäger seit alter Zeit beim Wilde gemacht. Deshalb ist es ein uralter Grundsatz, sich regungslos zu verhalten. Auch hieraus wurde irrtümlicherweise der Schluß gezogen, daß das Wild vorzüglich sehen könne.
In Wirklichkeit können Nasentiere nur grobe Umrisse, nicht die feineren Einzelheiten erkennen. Hunde und Pferde können infolgedessen ihren Herrn nicht am Gesicht erkennen, was Augentiere, wie Affen und Papageien, sehr wohl vermögen.
Wie alle Vögel, so sind auch unsere Hühner, Tauben, Enten usw. Augentiere. Von der Henne ist allgemein bekannt, daß sie einen Raubvogel bereits wahrnimmt, wenn unsere Augen im günstigsten Falle einen schwarzen Punkt am Himmel erkennen können. Ebenso haben mich Tauben des öfteren auf Raubvögel, die ich sonst übersehen hätte, aufmerksam gemacht. Das andauernde Äugen nach einer bestimmten Richtung fiel mir auf. Als ich diese verfolgte, stieß ich auf den gefiederten Räuber. Ähnliches erzählte mir ein Wärter im Berliner Zoologischen Garten. Er könne an dem Gebaren der Tauben stets erkennen, ob ein auf der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche horstender Wanderfalk – in Berlin Stößer genannt – in bedrohlicher Nähe sei.
Hierbei ist noch zu bemerken, daß die Unterscheidung der verschiedenen Raubvogelarten durchaus nicht einfach ist. Ein junges Habichtweibchen, das noch nicht das gesperberte Gefieder angelegt hat, sieht einem Bussard sehr ähnlich. Dabei ist der Habicht einer unserer gefährlichsten Räuber, während der Bussard verhältnismäßig harmlos ist und hauptsächlich von Mäusen lebt, weshalb er auch Mäusebussard heißt. Selbst bei manchen Förstern ist es, wie ich mich oft überzeugt habe, mit der Kenntnis unserer heimischen Raubvögel schwach bestellt. Um so mehr muß man darüber staunen, daß die Tiere sie so gut zu unterscheiden verstehen. Das geht daraus hervor, daß sie den einzelnen Räubern gegenüber ganz verschiedene Rettungsarten anwenden. So kann der pfeilgeschwinde Wanderfalk keine Beute vom Boden aufnehmen, was wiederum der weniger schnelle Habicht vermag. Deshalb flüchten Tauben vor dem Habicht aus Furcht vor seiner Geschwindigkeit in den Schlag, was sie beim Nahen des Wanderfalken nicht tun.
Von unsern Haussäugetieren ist nur die Katze ein Augentier. Windhunde und Ziegen nehmen eine Mittelstellung ein, weil ihre Augen auf Kosten der Nase besser entwickelt sind. Die Natur kennt keine starren Unterschiede, sondern bildet überall Übergänge.
Es hat mich oft gewundert, daß den Katzen das gute Sehvermögen, besonders bei Tageslicht, abgesprochen wird. Nach meinen Beobachtungen liegt dazu gar keine Ursache vor. Es ist vielmehr erstaunlich, daß die Katzen – im Gegensatz zum Hunde – ausgezeichnet sehen können. Unsere Vorfahren, die sich sehr eingehend mit den Tieren beschäftigten, haben ihre Eigenarten ganz richtig erkannt und eingeschätzt. Bei ihnen galt der Vers:
Nimm die Augen in die Hand
Und die Katz' aufs Knie,
Was du nicht siehst, sieht sie.

Gluckhenne mit Kücken, von einem Raubvogel bedroht.
Nach einem Gemälde von
A. Achleitner.
Hier sei übrigens an den Luchs erinnert, der ja nur eine vergrößerte Ausgabe unserer Katze ist. Mit Recht ist bereits im Altertum sein scharfes Sehvermögen bewundert worden, auch heute sprechen wir noch von ›Luchsaugen‹.
Es war schon hervorgehoben worden, daß Nasentiere, also Hunde, Pferde usw., Bewegungen besser als der Mensch sehen, daß sie sich selbst im Dunkeln leichter zurechtfinden. Darauf ist es auch zurückzuführen, daß die Zirkusdirektoren die dressierten Pferde mit der Peitsche oder genauer mit ihren Bewegungen lenken. So hebt auch der Jäger den Arm hoch, wenn er andeuten will, daß sich der Hund auf Zuruf hinlegen soll.
Abgesehen von diesen Überlegenheiten ist das Auge der Nasentiere bei Tageslicht minderwertig. Es ist erstaunlich, daß das noch so vielfach bestritten wird.
Hier mag eine alltägliche Geschichte Platz finden: Ein Hund hat im Gewühl der Großstadt seinen Herrn verloren. Kann es einen kläglicheren Anblick geben? Ein Knabe, der seine Angehörigen sucht, wird sich zu helfen wissen und sich überall umsehen, ob er seinen Begleiter nicht irgendwo entdeckt. Der Hund ist in solcher Lage dagegen ganz hilflos. Hätte er das gute Auge, das ihm angedichtet wird, so wäre sein Benehmen einfach unverständlich. Dagegen wird seine trostlose Lage sofort begreiflich, wenn wir uns seine Sinne vergegenwärtigen. Sein Grundsinn, der Geruch, kann ihm bei den tausend Fährten der Großstadt nichts nützen. Bei seinem minderwertigen Auge ist er gar nicht imstande, seinen Herrn unter zahlreichen fremden Personen aufzufinden. Deshalb bleibt ihm als einzige Rettung sein Gehör. Mit seinen scharfen Ohren lauscht er, ob nicht sein Herr ihm pfeift. Hört er den Pfiff, dann fühlt er sich geborgen, denn sonst hätte er ihn nicht gefunden.
Wäre es üblich, sich zahme Affen zu halten und mit ihnen spazierenzugehen, so würde jeder bald wissen, daß man ihnen nicht zu pfeifen braucht. Auch bei Kindern ist das nicht nötig. Kinder und Affen können erkennen, daß ein ihnen nahestehender Mensch aus der Haustür getreten ist und mit ihnen gehen will. Sie werden ihm also freudig entgegenspringen. Der Hund als Nasentier kann das aber nicht erkennen, deshalb muß ihm sein Herr pfeifen.
Einige weitere Beispiele:
Ein Gutsbesitzer wunderte sich darüber, daß jedesmal, wenn er mit seinem Wagen an den weidenden Kühen vorüberfuhr, die beiden Hirtenhunde mit großem Geblaff die vor den Wagen gespannten Schecken, also weiß und dunkel gefärbte Pferde, verfolgten. Der Hirt gab die folgende Erklärung über dies eigentümliche Gebaren: Die Hunde halten die beiden Schecken wegen ihrer ähnlichen Färbung ebenfalls für Kühe und wollen verhindern, daß sie sich von der Herde entfernen. Deshalb laufen sie mit Gebell hinterdrein.
Die Erklärung des Kuhhirten dürfte durchaus richtig sein, wie ja überhaupt unter solchen Leuten ausgezeichnete Tierbeobachter zu finden sind. Wie wenig muß also das Hundeauge fähig sein, Einzelheiten zu unterscheiden, wenn es sogar ein Pferd mit einer Kuh verwechseln kann.
Der Schweizer Bildhauer Urs-Eggenschwyler erzählt von einer ähnlichen Verwechslung: Er hatte einen jungen Löwen von etwa sechs Monaten, mit dem er spazierenging. Ein Ziehhund hielt die mächtige Katze für seinesgleichen und wollte mit ihr raufen. Erst als er sie vorher beroch und plötzlich merkte, wen er vor sich hatte, flüchtete er mit allen Zeichen großer Angst.
Ein deutscher Forstbeamter in Rußland schilderte vor dem Weltkriege folgendes Erlebnis: Sein Dachshund wurde von einem Wolf gepackt und fortgeschleppt. Schnell schoß er nach dem Räuber, der zwar nicht getroffen wurde, aber die Beute fallen ließ. Als der Hund wiederhergestellt war, flüchtete das sonst so mutige Tier vor jedem grauen Geschöpf von Wolfsgröße, selbst vor Schafen, die diese Färbung zeigten.
Von eigenen Erlebnissen will ich hier nur das folgende anführen:
Wir hatten einen Hund, der sich sehr zum Raufbold entwickelt hatte, weshalb ich ihn an der Leine führen mußte. Wie alle Hunde, suchte er mit Vorliebe auf der Straße Hundebekanntschaften zu machen. In einer ziemlich leeren Straße eines Vororts zerrte er plötzlich mächtig an der Leine. Ich wunderte mich darüber, weil ich keinen seiner Artgenossen im Umkreise erblicken konnte. Dagegen hatte ein Arbeiter das Pflaster aufgerissen, und aus der Grube, in der er stand, schaute sein Rücken heraus und bewegte sich hin und her. Als ich den Blick des Hundes weiterverfolgte und die Leine nachließ, wollte er wirklich auf diesen Mann zulaufen; er hielt dessen Rücken für einen Hund.
Sehr oft habe ich es erlebt, daß Hunde die auf Zäune verkehrt aufgestülpten Geschirre für Katzen hielten und heftig danach bellten.
Noch beweiskräftiger dürfte folgender Vorfall sein: Etwa ein halbes Dutzend Herren und ich, wir waren von einem Freunde zu einer Hasenjagd geladen. Jeder führte einen prächtigen Hund bei sich. Es war im Januar bei schönstem Sonnenschein, aber sehr windig. Als wir das Revier betreten hatten, sahen wir mit einem Male, daß uns der Wind von der etwa einige hundert Schritt entfernten Chaussee ein Stück braunes Packpapier zutrieb. Ein menschliches Auge konnte bei dem klaren Sonnenschein mit Leichtigkeit erkennen, was es war. Die Hunde dagegen hielten das heranrollende Papier für einen Hasen, und als wir sie zum Zwecke einer Prüfung losließen, stürzten sie alle darauf zu. Erst als sie kurz vor dem Papiere in die Windrichtung gekommen waren, klärte ihre Nase sie über den Irrtum auf.
Das Auge des Hundes kann also bei Tageslicht keine Einzelheiten unterscheiden. Daher stammen die groben Verwechslungen.
Alles, was dagegen angeführt wird, ist nicht stichhaltig. Wie oft wird erwidert: Ein Hase, der ein paar hundert Schritt entfernt war, wurde von meinem Hunde gesehen; er muß also gute Augen haben.
Der Schluß ist falsch. Der Hund hat nur gesehen, daß sich etwas Braunes bewegte, und vermutet: das kann ein Hase sein. Gewußt hat er es nicht. Ebenso beweist es nichts, wenn er einen im Schaufenster aufgestellten ausgestopften Fuchs wütend anbellt. Denn er würde ebenso wütend bellen, wenn man diesen Fuchs mit einem rothaarigen Dachshunde vertauschte.
Wir dürfen also bei der Beurteilung der Handlungen von Tieren niemals vergessen, daß ihre Sinne vielfach ganz anders beschaffen sind als die unsrigen. So ist es bekannt, daß Pferde manchmal vor den harmlosesten Dingen, z. B. einem Blatt Zeitungspapier, scheuen. Vergegenwärtigt man sich, daß Pferde ein schwaches Gesicht haben, so erscheint ihr Verhalten schon in einem ganz anderen Lichte.
Sodann müssen wir, wie schon hervorgehoben wurde, immer an die Lebensweise der wilden Vorfahren unserer Haustiere denken; denn diese sind nicht plötzlich als Haustiere auf unserer Erde erschienen, sie haben früher als wilde Tiere gelebt. Erst allmählich sind sie von dem Menschen gezähmt worden.
Zwar können wir nicht von allen Haustieren einwandfrei die wilden Vorfahren ermitteln. Doch das tut nichts zur Sache. Wenn auch Streit darüber entbrennt, wer z. B. der Vorfahr unseres Haushundes war, so steht das eine doch unzweifelhaft fest, daß er mit Wildhunden, Wölfen und Schakalen verwandt ist. Aus der Lebensweise dieser frei lebenden Geschöpfe können wir also die wichtigsten Folgerungen für unsern Haushund ziehen. Das werden wir später auch sehen.
Wir Menschen sind davon durchdrungen, daß es so, wie es bei uns ist, auch bei den Tieren sein muß – gelehrt drückt man das aus: wir nehmen den anthropozentrischen Standpunkt ein. – Deshalb hielt es eine sehr kluge Dame für die selbstverständlichste Sache der Welt, ihren Hund zur Strafe für eine Unart in die dunkle Kammer zu sperren.
Damit das Einsperren in einen dunklen Raum als Strafe wirkt, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Einmal muß das eingesperrte Geschöpf ein Herdentier sein, dem also die Vereinsamung unangenehm ist, zweitens aber muß es ein Tagtier und kein Nachttier sein. Denn für ein Geschöpf, das überhaupt in der Dunkelheit durchaus lebendig ist, kann die Finsternis keine Schrecken besitzen.
Beide Voraussetzungen treffen beispielsweise bei unserer Katze nicht zu. Und in der Tat hätte sich die erwähnte kluge Dame wohl auch besonnen, eine Katze, die etwa Milch genascht oder in der Speisekammer geräubert hätte, in einen dunkeln Raum einzusperren. Unsere Mieze wäre darüber seelenvergnügt gewesen. Einmal ist sie kein Herdentier wie der Hund, empfindet also das Alleinsein nicht als Strafe. Sodann ist sie, was allgemein bekannt ist, ein Geschöpf, das mit Vorliebe in der Nachtzeit auf den Fang von Mäusen ausgeht. Schon ihre Augen verraten, daß sie ein Nachttier ist. Je dunkler es wird, desto größer werden ihre Pupillen, während sie bei hellem Sonnenschein nur einen feinen Strich bilden.
Wie ist es nun mit dem Hunde? Ist er von Hause aus ein Tagtier oder Nachttier?
Ganz gewiß schläft der feiste Mops von Fräulein Tuntenhausen in der Nacht fest und ist sogar am Tage oft noch schläfrig. Ebenso schlafen die Löwen im Zoologischen Garten in der Nacht und sind am Tage wach. Das sind aber Ausnahmen, weil ganz unnatürliche Verhältnisse vorliegen. Es gibt ja auch bei uns Lebemänner, liederliches Weibsvolk, Bummler und Verbrecher, ganz abgesehen von jenen Menschen, die durch ihre Berufspflicht an die Nacht gebunden sind, wie Nachtwächter und zahlreiche Nachtarbeiter. Sie machen den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tage. Deshalb sind sie aber noch lange keine Nachtgeschöpfe.
Unsere Augen sind nicht für die Dunkelheit gebaut. Gewiß tut Anpassung sehr viel, und mancher Großstädter sieht mit Erstaunen, wie sich ein Dorfbewohner in einer finsteren Gegend zurechtfindet. Mit den Nachttieren verglichen, sind wir jedoch reine Stümper.
Als Jäger kann man oft beobachten, daß erschrecktes Wild eiligst in den Wald flüchtet. In schnellstem Lauf geht es durch die Bäume, kein Mensch könnte folgen.
Wie das Wild, so sind auch Wolf und Fuchs, die Verwandten unseres Haushundes, Nachttiere. Zur Nachtzeit sucht Isegrim auf der Weide ruhende Haustiere zu überfallen, ebenso macht Reineke seine Stallbesuche während der Dunkelheit.
Von den verwilderten Hunden im Orient wissen wir, daß sie am Tage ruhen und sich von der Sonne bescheinen lassen, während sie mit Einbruch der Dämmerung lebendig werden.
Genau so benimmt sich heute noch unser Hund in naturgemäßen Verhältnissen, z. B. der Dorfhund. Am Tage läßt er sich die Sonne auf den Pelz scheinen, wird aber mit Einbruch der Dunkelheit tatendurstig.
Am besten kann man das bei wildernden Hunden beobachten. Wenn es irgend möglich ist, wildern Hunde am liebsten zur Nachtzeit, wie noch heute Wolf und Fuchs in der Dunkelheit auf Raub ausgehen.
Der Hund wäre ja zur Nachtzeit kein so vortrefflicher Wächter, wenn er nicht selbst ursprünglich ein Nachttier gewesen wäre.
An seinen Augen können wir das unzweifelhaft feststellen. Wie alle Nachttiere, so hat auch der Hund auffallend große Pupillen. Durch ihre Größe fangen sie jeden Lichtstrahl auf. Deshalb sind Nachttiere in der Dunkelheit den Tagtieren im Sehvermögen überlegen.
Das Einsperren eines Hundes in eine dunkle Kammer ist also zwecklos, weil der Hund als ursprüngliches Nachttier die Dunkelheit durchaus nicht als etwas Unangenehmes empfindet, sondern sich sehr wohl dabei fühlt. Hingegen werden Hunde das Alleinsein nicht lieben, weil alle Wildhunde in Rudeln jagen. Das Einsperren in eine Kammer kann also an sich als Strafe wirken, nur braucht die Kammer dann nicht dunkel zu sein.

Pariahunde (herrenlose Hunde im Orient).
Mehr noch empfinden Tagaffen, namentlich junge, genau wie unsere Kinder das Alleinsein und die Dunkelheit als etwas Schreckliches. Bei jungen Schimpansen konnte ich mich überzeugen, daß sie ganz verzweifelt werden, wenn sie in einem dunkeln Raum allein sind. Sie sind eben, wie wir Menschen, Herdentiere und Tagtiere.
Wie der Hund, so sind auch Pferd, Rind, Schwein, Ziege und Schaf ursprünglich Nachtgeschöpfe. An ihren großen Pupillen ist das noch deutlich erkennbar.
Taggeschöpfe unter unseren Haustieren sind Hühner, Tauben, Fasanen, Puter usw.
Die Hühner suchen bekanntlich ihren Stall sehr zeitig auf. So scharf ihr Auge am Tage auch ist, so scheinen sie in der Dämmerung bereits schlecht sehen zu können. Von einem Menschen, der sich in der Dämmerung nicht zurechtfindet, sagt man deshalb scherzweise: Er hat die Hühnerkieke.
Wildenten sind sowohl am Tage als in der Nacht tätig. Solche Tiere, die gewissermaßen von der Sonne unabhängig sind, kommen unter den Vögeln nicht selten vor. Am bekanntesten ist die Nachtigall, die bei hellem Sonnenschein und auch in der Dunkelheit ihr Lied erschallen läßt. Während die Augen der Hühner und aller Tagvögel hell sind, haben Enten, Nachtigallen u. dgl. dunkle Augen.
Die Frage, ob ein Haustier ein Tag- oder Nachtgeschöpf ist, wird manchem als gelehrte Spielerei erscheinen. Das ist ein Irrtum. Diese Frage ist für die Fütterungszeiten von ausschlaggebender Bedeutung. Für kein Geschöpf wird es von Vorteil sein, kurz vor dem Schlafengehen sich den Leib vollzustopfen. Dagegen wird ein reichliches Frühstück stets ganz am Platze sein.

Wildentenzug.
Nach einem Gemälde von
G. Vastagh.
Die abendlichen Fütterungen von Pferden, Rindern usw. wären sehr wenig vorteilhaft, wenn es sich nicht um ursprüngliche Nachttiere handelte. Ebenso ist für den unter natürlichen Verhältnissen, also nicht im Zimmer lebenden Hund abends reichliches Futter am zweckmäßigsten.
Dagegen wird man es vermeiden, die ausgesprochenen Tagtiere, wie Hühner und Tauben, abends stark zu füttern, so daß sie mit vollem Magen ihre Ruhestätte aufsuchen.
Pferde in der Nacht ziehen zu lassen, ist also durchaus keine Tierquälerei, wie viele glauben. Denn die Wildpferde sind auch in der Nacht ständig auf den Beinen, da ihre Feinde, die Großkatzen und die Wölfe, zu dieser Zeit unter ihnen Beute zu machen suchen.
Den Schlaf in unserem Sinne kennen die meisten Tiere, namentlich Pferde, nicht. Es ist daher kein Wunder, daß, wenn man nachts den Pferdestall betritt, so viele Pferde wach sind. Eigentlich schlafen nur diejenigen fest, die am Tage schwer zu ziehen hatten.
Warum fürchten wir Menschen die Dunkelheit? Weil in früheren Zeiten zur Nachtzeit unsere Feinde, die großen Raubtiere, darauf ausgingen, uns gleichfalls zu überfallen. Außerdem leisten unsere Augen in der Finsternis nichts, weil wir, wie gesagt, Taggeschöpfe sind.
Pferde dagegen als ursprüngliche Nachttiere sehen in der Dunkelheit vortrefflich, wie jeder Reiter weiß. Das gleiche trifft für Hunde zu. Überhaupt sind alle Säugetiere unter unsern Haustieren – nicht nur die Katze – in früheren Zeiten Nachttiere gewesen.
Mit dem Lernen der Tiere ist es eine eigene Sache. Zwar heißt es in dem schönen Liede, daß die Enten schnattern »lernen«, und ebenso von anderen Tieren, daß sie fliegen, klettern, schwimmen usw. lernen. Aber da ist doch ein großer Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Wir pflegen zu sagen: »Mancher lernt's nie!« Und das stimmt! Dagegen habe ich bei Tieren niemals beobachten können, daß ein Tierjunges seine Lektion nicht erfaßt hätte. Wir wissen von unsern Luftschiffern, wie schwierig das Fliegen ist. Trotzdem hat man noch keinen Vogel gesehen, der es nicht gelernt hätte.

Schwere Arbeit.
Nach einem Gemälde von
A. Wesemann.
Vor einigen Jahren hat ein amerikanischer Professor seine Untersuchungen über das Lernen der Katzen veröffentlicht, die ganz im Widerspruch mit obigen Ausführungen stehen. Über das Ergebnis des Gelehrten wird berichtet: Er wählte eine Katze, die in aller Abgeschiedenheit drei Junge warf, und begann seine Versuche erst, als die drei jungen Katzen fünf Monate alt waren, mithin genug Kraft hatten, auch eine ausgewachsene Maus zu töten. Während dieser fünf Monate wurden die Jungen von der Außenwelt streng abgeschlossen, damit als sicher gelten konnte, daß sie vor den Versuchen keine Maus gesehen und noch weniger gejagt hatten. Der Kürze halber bezeichnen wir in der Folge die alte Katze mit dem Buchstaben A, die drei jungen mit B, C und D.
Als D in den Käfig, in dem eine große Maus gefangen war, eingelassen wurde, fing das Tier alsbald zu schnauben an und zeigte eine gewisse Unruhe. Dann, als die Maus eine Bewegung machte, bemerkte sie es, lief darauf zu und gab ihr mit der Pfote einen leichten Schlag. Hierauf begann ein endloses Versteckspiel, bei dem D nicht ein einziges Mal knurrte und niemals seine Krallen brauchte. Nach Ablauf einer Stunde wurde die Maus aus dem Käfig entfernt und untersucht. Sie hatte nicht eine einzige Kratzwunde am Leibe. Sodann wurden B und C der gleichen Prüfung unterzogen und verhielten sich dabei genau wie ihr Bruder; sie spielten mit der Maus, wie es alle jungen Katzen mit den Gegenständen tun, die sich bei der Berührung mit den Pfoten fortbewegen. Sie taten aber der Maus nichts zuleide. Diese Vorversuche stellten fest, daß keine der drei jungen Katzen einen instinktiven Hang zum Jagen, Töten und Fressen der Mäuse zeigte. Sechs Wochen später wurden die Versuche fortgesetzt. Jede Katze blieb zwanzig Minuten lang mit einer Maus im Käfig. Um noch sicherer zu gehen, hatte man diesmal die Katzen unmittelbar vorher 24 Stunden lang fasten lassen. Nun war das Spiel allerdings merklich ungestümer, und die Pfotenhiebe fielen sichtlich kräftiger aus, doch auch diesmal zogen sich die Mäuse ganz heil, ohne die geringste Schramme zurück.
Sodann war man begierig zu erfahren, ob die Jungen sich von der mütterlichen Kunst etwas aneignen, ob sie durch Anschauungsunterricht lernen würden, eine Reihe von Handlungen auszuführen, die ihnen ihr Instinkt nicht eingegeben hatte.
Nachdem man B zehn Minuten lang mit der Maus hatte spielen lassen, wurde die Mutter A in den Käfig geschoben. Sie stürzte sich sogleich und ohne weitere Umstände auf die Maus, tötete und fraß sie auf. Alle ihre Bewegungen wurden von B aufmerksam verfolgt. Als die Mutter ihr Mahl beendet hatte, wurde sie aus dem Käfig entfernt und eine andere Maus hineingelassen. Ungeachtet des mütterlichen Beispiels fing B mit der Maus wieder das harmlose Spiel an. Einige Minuten später trat D hinzu; nun spielten beide nach Herzenslust mit ihrem lebendigen Spielzeug weiter. Doch wenn eines die Maus zwischen den Pfoten hielt und das andere Miene machte, sie ihm zu entreißen, ließ der Bedrohte ein Murren hören; es war also schon eine kleine Kriegsstimmung entstanden. Man entfernte hierauf D und brachte wieder die Alte in den Käfig. Sie war mit der Maus bald fertig. Doch dieses Mal erlaubte sie dem Sprößling, den Kadaver mit den Zähnen zu ergreifen. Sie hatte ja ihren Heißhunger kurz vorher gestillt. Aber B wartete mit dem Fressen der Maus dennoch, bis die Mutter das Fleisch der Beute bloßgelegt hatte; dann, als er einmal davon gekostet hatte, ließ er sich freilich nicht bitten, das unerwartete Mahl gründlich zu genießen. Mit diesen Versuchen scheint bewiesen, daß die drei jungen Katzen im Alter von sieben Monaten keinen Instinkt mitbrachten, der sie antrieb, Mäuse zu fangen und zu fressen. Und damit wäre eine alte Anschauung widerlegt. Anderseits lehrten die Versuche, daß die Jungen das Mäusefangen rasch lernen, wenn die Mutter es ihnen vormacht. So das Ergebnis des amerikanischen Professors.
Für mich ist es ein glücklicher Umstand, daß ich bereits vor vielen Jahren eine ähnliche Ansicht hörte und mich deshalb eingehend mit der Sache befaßt habe. Ich hielt die Meinung für irrig, war aber nicht in der Lage, meine Behauptung zu begründen. Denn unsere jungen Katzen wachsen unter Anleitung der alten auf – wie soll man da beweisen, daß dieser Unterricht nicht unbedingt erforderlich ist?
Im Interesse der Wissenschaft habe ich deshalb mehrere junge Katzen aufgezogen, die eben erst von der Mutter entwöhnt waren. Um ganz sicher zu sein, daß sie nicht den geringsten Unterricht genossen hatten, wählte ich Junge von Großstadtkatzen, die aus Wohnungen stammten, wo es gar keine Mäuse gibt.
Hierbei konnte ich bei allen Katzen feststellen, daß sie ohne jede Anleitung ihr Räuberhandwerk in größter Vollendung ausüben. Namentlich waren sie sehr erpicht auf die Fliegenjagd. Das lautlose Anschleichen an eine Fliege, das regungslose Sichducken, den plötzlichen Sprung verstanden alle mit vollendeter Meisterschaft. Ebenso wußten sie sofort sehr gewandt mit der Pranke zu schlagen, um die an der Fensterscheibe befindliche Fliege zu haschen.
Weiter ein ähnlicher Fall: Einer meiner Bekannten wohnte seit vielen Jahren in Berlin. Als Tierfreund hielt er sich Hunde und Katzen. Eine seiner Katzen war in Berlin geboren und etwa acht Jahre alt, als er wieder aufs Land zurückkehrte und sich ein kleines Gut kaufte. Ich habe ihn dort wiederholt besucht. Hierbei machte er mich darauf aufmerksam, daß seine alte Katze, die in Berlin niemals ein Mauseloch kennengelernt hatte, sich auf dem Lande sofort als geübte Mäusefängerin gezeigt hätte. Wir beobachteten sie, erzählte er, wie sie auf dem Acker sprungbereit vor einem Loche saß. Und zwar saß sie ganz richtig, nämlich so, daß sie von der Maus nicht wahrgenommen werden konnte – genau wie eine alte, geübte Mäusefängerin.
Wer noch daran zweifelt, daß bei den Tieren der Unterricht nur ihre Fähigkeiten schneller erwachen läßt, aber sie durchaus nicht hervorruft, den möchte ich auf folgende Punkte aufmerksam machen: Man denke daran, wie unbeholfen ein junges Menschenkind ist, und wie sehr es behütet werden muß, damit ihm kein Übel geschieht. Nun nehme man ein eben erst entwöhntes Kätzchen von sechs Wochen und beobachte, wie sachgemäß es sich bei allen Gefahren zu benehmen weiß. So drohte einmal ein Tisch umzufallen, auf dem ein Kätzchen saß. Mit bewundernswerter Gewandtheit wußte es sofort einen Ausweg aus der Gefahr zu finden, es kletterte nach der obersten Kante und hielt sich mit seinen Krallen fest. Kommt ein fremder Hund, so weiß eine junge Katze sofort, daß sie einen Buckel machen und speien muß. Wie viele andere Raubtiere, so haben auch die Katzen die Gewohnheit, ihre Ausscheidungen zu vergraben. Das wird benutzt, um sie stubenrein zu halten. Man stellt deshalb einen Napf mit trockenem Sand in irgendeine Ecke. Jede junge Katze hat sofort aus eigenem Antriebe diesen stillen Winkel benutzt. Da jede Katze stets allein gehalten wurde, so hatte sie also niemals Gelegenheit, es von einer älteren Kameradin abzusehen. Jede Katze weiß außerdem, daß Pflanzen für ihre Verdauung vorteilhaft sind; denn sie sind ganz erpicht auf Blumen. Obwohl auf dem Gute meines Vaters stets eine Menge Katzen war, so war mir diese Leidenschaft der Katzen für Pflanzen – vom Baldrian abgesehen – noch nicht bekannt. Jede junge Katze weiß auch sofort mit tödlicher Sicherheit, an welcher Stelle sie am weichsten liegt.
Müßte das alles erst durch Unterricht erlernt werden, so könnte sich kein Mensch ein junges, eben erst entwöhntes Tierchen anschaffen. Er müßte immer erst warten, bis es bei der Alten »ausgelernt« hätte.
Wie erklärt sich der Unterschied der Ergebnisse, zu denen wir im Gegensatz zu dem amerikanischen Gelehrten gelangt sind? Sind etwa die amerikanischen Katzen dümmer? Ich halte das für ausgeschlossen und nehme an, daß der Gelehrte seine Versuche zu früh angestellt hat. Denn ich konnte auch bei meinen Katzen feststellen, daß sie für gewisse Dinge, z. B. Fischefangen, erst später Verständnis hatten.
Jedenfalls spielen »Schulfragen und Schulsorgen« in der Tierwelt glücklicherweise nur eine ganz nebensächliche Rolle.
Die meisten Tierbeobachter bejahen die Frage, ob die Tiere im Laufe der Lebenszeit an ihren geistigen Fähigkeiten zunehmen, also klüger werden, ganz unbedenklich. Namentlich die Jäger schwören darauf, daß ihr Hund, insbesondere der Jagdhund, durch den beständigen Verkehr mit dem Menschen ungeheuer klug geworden sei. Allgemein herrscht daher der Glaube, daß ein Hund, der verwildert ist und sich zu den Wölfen begibt, von ihnen zum Führer gewählt wird. Schon der bekannte Naturforscher Lenz hat diesen Glauben für lächerlich erklärt und behauptet: Die Wölfe werden niemals einen Hund zum Führer wählen; im Gegenteil, sie zerreißen und fressen ihn.

Glücklich entwischt!
Nach einem Gemälde von
H. Sperling.
Am meisten ist wohl Thompson von der Überzeugung durchdrungen, daß die Tiere den Grundsätzen der Entwicklung gemäß an Klugheit zunehmen. Er schildert eine Präriewölfin, die als Gefangene die Schliche des Menschen kennenlernt und später als freies Geschöpf sich klug den Verhältnissen anpaßt und ihre Nachkommenschaft in der Vermeidung der Gefahren unterrichtet.
Thompson ist also ein Anhänger von Darwin, der die Bedeutung der Erfahrung in der Tierwelt besonders hervorhebt. Und es ist unbestreitbar, daß sich überall die Jungen einer Tierart viel leichter fangen und beschleichen lassen als die Alten. Was die letztgenannten betrifft, meint Darwin, so ist es auch unmöglich, viele an demselben Ort mit derselben Art von Fallen zu fangen oder sie durch dieselbe Art Gift zu vernichten. Sie müssen daher lernen, vorsichtig zu werden, wenn sie ihre Genossen gefangen oder vergiftet sehen. In Nordamerika, wo die Pelztiere schon seit langem verfolgt werden, zeigen sie nach dem einstimmigen Zeugnis aller Beobachter einen fast unglaublichen Grad von Scharfsinn, Vorsicht und List; indes sind dort die Fallen bereits so lange in Gebrauch, daß hier nun vielleicht auch Vererbung mitspielt. Darwin hat mehrere Mitteilungen erhalten, nach denen in Gegenden, die von neuen Telegraphenleitungen berührt wurden, anfangs viele Vögel den Tod fanden, weil sie gegen die Drähte flogen. Aber im Laufe einiger weniger Jahre lernten sie diese Gefahr meiden; sie erkannten, wie viele ihrer Genossen den Tod gefunden hatten.
Dieser Ansicht Darwins muß man vollkommen beipflichten. Die Tiere lernen in der Tat durch Erfahrung. Auch hierfür einige Beispiele:
Als in Berlin die Stadtbahn eröffnet wurde, kam es anfänglich vor, daß Tauben, die sorglos auf den Schienen saßen, von der Lokomotive erfaßt und getötet oder verstümmelt wurden. Die Tiere hatten die Schnelligkeit des heranbrausenden Zuges unterschätzt. Später habe ich von ähnlichen Fällen nie etwas vernommen. Als in einem westlichen Vororte Berlins, den ich sehr genau kenne, an Stelle der bisherigen langsamen Dampf- bzw. Pferdebahn die schnelle elektrische Straßenbahn eingeführt war, kamen in der ersten Zeit etwa 30 Hunde durch Überfahrenwerden ums Leben. Jetzt, wo die Bahn seit Jahren fährt, habe ich ganz selten etwas davon gehört oder gelesen, daß Hunde überfahren worden seien.

Das erste Erlebnis.
Nach einem Aquarell von
A. Weczerzick.
Das Tier lernt also auch die technischen Neuerungen des Menschen verstehen und richtet sein Verhalten danach ein. Der Hund kennt sehr wohl den Zweck des Wagens, denn faule Hunde springen gern in ihn hinein. Doch nichts hat wohl größern Eindruck auf die Tierwelt gemacht als die Erfindung des Schießpulvers. Den Knall des Gewehrs kennt jedes Wild nur zu gut. Der Jagdhund ist überglücklich, wenn sein Herr die Flinte ergreift; er weiß, was sie zu bedeuten hat.
Von den Hunden hat besonders der Jagdhund manches hinzugelernt, was an sich seinem innersten Wesen teilweise ganz zuwider ist, z. B., daß er einen Hasen nicht hetzen oder ein erlegtes Wild nicht »anschneiden« darf. Der Hund des Trüffelsuchers lernt das Auffinden von Trüffeln, obgleich er doch als früheres Raubtier für Pilze sicherlich wenig Verständnis mitbringt.
Der Käfigvogel hebt sein Futter mit dem Schnabel auf. Der sonst so scheue Sperling nistet unmittelbar unter Eisenbahnbrücken; es stört ihn nicht, daß sich das Donnergetöse der Züge fast in jeder Minute hören läßt. Auch das Pferd, dem häufig ein Geräusch so starke Furcht einjagt, daß es sinnlos davonstürmt, hat sich an das Großstadtgetriebe allmählich gewöhnt. Den erfahrenen Droschkengaul bringt weder das Getöse der Eisenbahnen noch das Geratter und Geknatter der Autos, weder Militärmusik noch das Lärmen der Feuerwehr, weder Straßenbahnen noch riesige Möbelwagen aus seiner Ruhe. Um den Grad dieser Gewöhnung richtig einzuschätzen, muß man bedenken, daß bei dem ersten Auftauchen der Radfahrer Landpferde oft lediglich durch den bloßen Anblick dieser ungewohnten Erscheinung zu sinnlosem Durchgehen veranlaßt wurden. Auf Erziehung bzw. Gewöhnung ist auch der Umstand zurückzuführen, daß es sich beim Anspannen rückwärts an den Wagen schieben läßt und beim Anschirren ganz ruhig verhält.
Der Tierpsychologe Perty ist ebenfalls der Überzeugung, daß die Tiere durch Erfahrung klüger werden, und führt dafür einige Beispiele an:

Trüffelsuchendes Schwein
Phot. Géniaux, Paris.
Der Truthahngeier fliegt, wie der amerikanische Forscher Audubon beobachtet hat, gleichgültig über ein ruhendes oder schlafendes gesundes Tier hinweg, weicht aber nicht von einem kranken, verwundeten oder im Sumpfe steckenden, bis es tot ist. Die Kaninchen ziehen aus Erlebtem Erfahrungen und Kenntnisse für die Zukunft. Im Sommer gehen sie gegen 8 bis 9 Uhr morgens und dann einige Stunden vor Sonnenuntergang auf die Atzung. Sieht man sie aber schon um 2 oder 3 Uhr nachmittags draußen gierig fressen, minder vorsichtig als sonst, so regnet es ganz gewiß noch an demselben Abend oder aber in der Nacht.
Diese beiden Beispiele sind nicht überzeugend, da es sich hier um Gewohnheiten handelt, die diesen Tieren schon in Urzeiten eigentümlich waren.
Lehrreicher sind folgende Fälle: Der Rabe, der an sich oder anderen die Wirkung einer Flinte kennengelernt hat, flieht sogleich, wenn jemand mit einem Schießeisen naht; er bleibt aber ruhig sitzen, wenn Menschen mit Stangen, Reisigbündeln u. dgl. vorübergehen. Er unterscheidet also die Flinte von einem Stocke oder einer Stange, durch Erfahrung weiß er, daß jene ihm Gefahr bringt, und flieht. Manche Tierforscher behaupten, der Rabe könne die Flinte von gefahrlosen Gegenständen nicht unterscheiden, er rieche vielmehr das Pulver der Ladung. Aber das kommt m. E. auf eines heraus; immer muß Urteil und Schluß auf Erfahrung gegründet sein, mag die veranlassende Wahrnehmung durch den Gesichts- oder Geruchssinn erlangt worden sein. Manche Vögel, z. B. Rotkehlchen und Amseln, die man im Winter im Käfig gehalten hat und im Frühling fliegen ließ, fanden sich im Spätherbste wieder ein und verlangten Einlaß. So beobachtete der Tierforscher von Göze ein Rotkehlchen, das zwei Jahre nacheinander freiwillig in die Gefangenschaft zurückkehrte.
Auch Budde schließt sich in seinen Berichten über Tierbeobachtungen der herrschenden Ansicht an und begründet sie wie folgt: Im allgemeinen haben die nestbauenden Vögel die Eigenschaft, daß sie den Unrat ihrer Jungen sorgfältig im Schnabel wegtragen und ihn aus der Nähe des Nestes entfernen. Die Zweckmäßigkeit dieser Einrichtung liegt auf der Hand; täten es die Tiere nicht, so würde jedes Nest sehr bald durch den angesammelten Unrat von weitem kenntlich gemacht, und die Räuber hätten leichtes Spiel gegenüber den jungen Vögeln. Eine Abweichung von der Regel findet sich dementsprechend nur bei solchen, die so stark sind oder an so schwer zugänglichen Stellen wohnen, daß sie keine Räuber zu fürchten haben. Hochnistende Raubvögel, z. B. auch Raben und Kormorane, lassen den Schmutz ihrer Jungen fallen, wohin er will. Die Schwalbe hat nun für gewöhnlich dieselbe unreinliche Eigentümlichkeit wie die Adler und Raben; der Unrat ihrer Jungen wird unmittelbar am Nest fallen gelassen, und dadurch wird das Nest zu einer Schmutzquelle für die Umgebung. Diese Unterlassung hat keine bedenklichen Folgen, weil die Schwalbennester in der Regel unter Balken und Gesimsen hängen. Da ihr Inneres für Katzen und Wiesel unzugänglich ist, wäre es überflüssig, aus Gründen des Schutzes besondere Reinlichkeit zu beobachten. Es wird als sicher anzunehmen sein, daß die einzelne Schwalbe durchaus instinktiv handelt, wenn sie den Schmutz aus ihrem Nest dicht an seinem Rande zu Boden fallen läßt. Um so bemerkenswerter ist es aber, wenn die Tierchen in einzelnen Fällen, wo es sich um ihre gesicherte Existenz handelt, von dem Herkommen abweichen und Reinlichkeitsgewohnheiten annehmen, die ihnen für gewöhnlich fremd sind. In Japan wohnen sie vielfach in den Wohnhäusern der Eingeborenen, deren Türen bei Tage und meist auch bei Nacht offen stehen. Man schützt sie und pflegt unter ihren Nestern kleine Brettchen anzubringen, die den Schmutz vom Boden abhalten sollen. Nach glaubwürdigen Berichten haben viele Tierchen dort schon gelernt, das Schutzbrettchen überflüssig zu machen; sie tragen den Schmutz im Schnabel heraus und werfen ihn erst im Freien ab. Einzelne Tiere lernen bei uns das gleiche. In Néris-les-Bains befindet sich im Hofe des Hotels Raphanel in 2½ Meter Höhe vom Boden ein Schwalbennest. Es hängt dort seit mehreren Jahren, und die Baumeister erhöhen es jährlich um einige Millimeter. Als ich meiner Verwunderung Ausdruck gab, daß das Nest aus dem sehr reinlichen Hof nicht entfernt würde, sagte mir Herr Raphanel, daß die Vogelmutter seit mehreren Jahren allen Schmutz, der aus dem Nest auf den Boden fiele, sorgfältig im Schnabel weit forttrüge. Und er fügte hinzu: sie tue das, weil ihr sonst die Wohnung in dem Nest »gekündigt« würde.
So scheint die herrschende Ansicht, nach der die Tiere durch Erfahrung klüger werden, durchaus begründet zu sein. Von den Anhängern dieser Auffassung ist jedoch übersehen worden, daß sie doch mit zwei Tatsachen in unlösbarem Widerspruch steht.
Wäre der Hund durch den Verkehr mit den Menschen wirklich so viel klüger geworden, so könnte ihm wohl der Wolf körperlich überlegen sein, geistig aber nimmermehr. In Wirklichkeit liegt die Sache ganz anders. Der Wolf hat nicht nur ein viel stärkeres Gebiß und größere Kraft als der Hund, sondern er ist ihm auch an geistigen Gaben bedeutend überlegen. Nebenbei sei bemerkt, daß nur die Fabel aus diesem klugen Tier einen Dummkopf machen konnte. Die alten Römer, die die Wölfe ziemlich genau kannten, nannten Hannibal, ihren gefährlichsten Gegner, »veterem ac veteratorem lupum«, einen alten, durchtriebenen Wolf.
Der Beweis für die größere Klugheit des Wolfes ist leicht zu führen. Bereits im Altertum ist es aufgefallen, daß die Hirtenhunde in der lächerlichsten Weise von den Wölfen übertölpelt werden. Ein Wolf erscheint in der Nähe der Herde mit der Gebärde, als ob er rauben wolle. Die Hunde stürzen sich auf ihn und jagen ihn in die Flucht. Unterdessen brechen andere Wölfe in die unbewachte Herde ein und holen sich in aller Gemütsruhe einige Stücke heraus.
In gleicher Weise überlistet der Wolf im Winter den starken Haushund. Einer von Isegrims Scharen nähert sich dem Gebäude und flüchtet, sobald der Hund erscheint. Dieser fühlt sich als Sieger und verfolgt ihn ein gutes Stück und – rennt ins Verderben. Inzwischen hat ihm ein anderer Wolf den Rückweg abgeschnitten. Der Fliehende kehrt um, und beide Wölfe zerreißen den unklugen Wächter und lassen sich ihn gut schmecken.
Mit der vielgerühmten Klugheit des Haushundes ist es ganz unvereinbar, daß er immer wieder ein Opfer dieser Überlistung wird.
Ferner spricht gegen das »Klügerwerden durch Erfahrung« der Umstand, daß sich Raubtiere durch die Vogeleltern von den Jungen fortlocken lassen. Die alten Vögel stellen sich eine Zeitlang krank und fesseln dadurch den Feind an sich. Inzwischen bringen sich die Jungen in Sicherheit.
In meisterhafter Weise hat der bekannte amerikanische Tierkenner Thompson geschildert, wie eine Fasanenhenne einen Fuchs an der Nase herumführt, indem sie sich lahm stellt, so daß sie der Fuchs verfolgt, ohne sie jedoch zu bekommen. Nachdem die Henne den Rotrock gründlich entfernt hat, ist sie plötzlich ganz gesund und fliegt zu ihren Jungen zurück.
Diese von Thompson geschilderte Kriegslist kann man bei Vogeleltern sehr häufig beobachten. Ich habe an einem herrlichen Frühlingstage während eines Vormittags diese Verstellungskunst bei einem Rebhuhn, einem Fasan und einem Finkenweibchen selbst feststellen können. Ich begleitete nämlich meinen Freund auf dessen Jagdrevier, und die beiden zuerst genannten Vogelmütter stellten sich krank, um den Hund von den Jungen fortzulocken. Das Finkenweibchen aber flatterte zur Erde, als wir in die Nähe seines Nestes kamen.
Nur nebenbei möchte ich bemerken, daß manche Naturforscher der Meinung sind, die Weibchen verstellten sich gar nicht, sondern hätten durch das anhaltende Brüten steife Flügel und könnten tatsächlich nicht fliegen. Dem widerspricht aber der Umstand, daß andere Vogelweibchen trotz anhaltenden Brütens vortrefflich fliegen, z. B. Tauben. Nach Schillings und anderen Afrikareisenden stellt sich auch der Strauß krank, um Löwen und andere Raubtiere von den Jungen fortzulocken. Der Strauß muß sich doch verstellen, denn fliegen kann er überhaupt nicht. Hätte die Mutter bzw. der Vater aber wirklich steife Beine oder lahme Flügel, warum werden sie dann niemals von den Feinden gepackt?

Verstellungskunst:
Die Rebhuhnmutter stellt sich flügellahm, um den Räuber von ihren Jungen fortzulocken.
Nach einem Gemälde von
A. Achleitner.
Wir können diese Frage hier auf sich beruhen lassen, jedenfalls fallen die Raubtiere, und zwar selbst so kluge wie der Fuchs, seit Urzeiten auf den Schwindel herein, den die Vogeleltern mit ihnen treiben. Hier wäre ein Grund, an der Auffassung irre zu werden, daß die Tiere im Laufe der Zeit etwas hinzulernen.
Wenn man die Frage bejaht, so ist die Täuschung durch die Vogeleltern damit zu erklären, daß sie nur alljährlich einmal, zur Zeit der Aufzucht der jungen Brut, beobachtet wird. Die Raubtiere haben inzwischen vergessen, daß es sich nur um eine Komödie handelt.
Die geistige Überlegenheit des Wolfes gegenüber dem Hunde hingegen ist damit zu erklären, daß der Wolf ein Raubtier geblieben ist und bis heute noch seinen Raubtier-Instinkten folgt, während der Hund als Haustier die Triebe seiner Vorfahren größtenteils verloren hat. Demnach ist der Wolf nicht eigentlich klüger als der Hund, sondern er hat nur die dem Räuberleben besser angepaßten Naturtriebe.
So ließe sich etwa die Behauptung rechtfertigen, daß die Tiere durch Erfahrung klüger werden. Jedenfalls ist unsere Anschauung, daß Hunde wegen ihrer Klugheit von den Wölfen zu ihren Anführern gewählt werden, durchaus unbegründet.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß den Tieren List und Verstellung etwas ganz Bekanntes sind. Ich habe darüber ein ganzes Buch geschrieben. Die Meinung, daß die Kunst des Tierarztes leichter sei als die des Menschenarztes, da seine Patienten sich nicht verstellten, ist also ganz unbegründet.
Einen lehrreichen Fall von der Verstellungskunst der Hunde berichtet Oberstleutnant Berghaus. Er hatte sich einen kleinen, schneidigen Hund von schwarzer Farbe, namens »Marko«, angeschafft. Marko war nicht mehr ganz jung, jagdlich zwar ganz tauglich, aber nur mittelmäßig begabt; dennoch hat er sich folgenden Geniestreich geleistet. Sein Gefährte war ein großer Leonberger, der Frau Berghaus gehörte und ihm an Stärke weit überlegen war. Trotzdem ging er diesem sofort eifersüchtig zu Leibe, wenn man sich mit ihm beschäftigte, weil er sich dadurch zurückgesetzt fühlte; genau so machte er es, wenn ihn der Futterneid plagte. Mit Argusaugen bewachte er den Topf, der die gemeinsame Mahlzeit enthielt und zum Erkalten irgendwohin gesetzt worden war, und falls »Bobby«, der Leonberger, sich ahnungslos dem Futter näherte, fuhr er ihm in die Parade. Natürlich genügte ein Griff, und »Marko« lag auf dem Rücken; aber fast täglich spielte sich dasselbe Manöver ab, da »Bobby« sich damit begnügte, den kleinen Krakeeler umzulegen, statt ihn ordentlich zu züchtigen. Ihre Mittagsmahlzeit erhielten beide gleichzeitig, wenn auch möglichst voneinander getrennt, auf dem Hofe. Aber während »Bobby« mit der Miene eines Feinschmeckers, der etwas Gutes zu würdigen weiß, langsam und mit Verständnis seine Mahlzeit zu sich nahm, schlang »Marko« die seinige in der Hälfte der Zeit hinunter und stand dann gierig neben der Schüssel seines Hausgenossen, was der dann manchmal mit einem warnenden Zähnefletschen beantwortete.

Futterneid.
Nach einem Gemälde von
L. Cheviot.
Nachdem Berghaus sich einige Zeit nicht weiter darum bekümmert hatte, erschien eines Tages seine Frau und sagte: »Sieh dir doch einmal die Fütterung mit an, da passiert jetzt tagtäglich eine Art Jagdgeschichte, die ich nicht glauben würde, wenn ich sie nicht sähe, selbst wenn du sie mir erzählt hättest. Jetzt bekommen sie gerade ihr Futter, nun pass' mal auf.«
Gespannt beobachtete das Ehepaar hinter den Gardinen die beiden bei der Mahlzeit. Wie gewöhnlich war »Marko« bald fertig, während »Bobby« weiterfraß und den Kleinen deutlich anknurrte, als er sich verlangend dem Futternapfe näherte. Plötzlich stürzte sich »Marko« laut bellend auf die offene Hoftüre, »Bobby« ließ sein Futter im Stich und raste hinterher. Aber während dieser draußen genau untersuchte, was eigentlich vorging, schlich sich »Marko«, schleunigst kehrtmachend, an den verlassenen Futternapf, wo er sich gründlich gütlich tat. Als dann »Bobby« nach längerer Zeit zurückkehrte, waren nur noch einige traurige Knochenreste im Napf. »Marko« aber lag mit treuherziger Miene auf dem Hausflur. »So macht er es alle Tage,« meinte meine Frau; »erst dachte ich, es sei Zufall, und wollte dir nichts sagen, besonders weil du immer denkst, man will dir Jagdgeschichten erzählen; nun siehst du es aber selbst.« –
Dem Erzähler war die Sache so interessant, daß er es sich nicht versagen konnte, in den nächsten Tagen um die Mittagszeit seine Beobachtungen fortzusetzen. Und richtig, alles spielte sich genau so ab, wie das erstemal, bis nach drei Tagen »das Unglück nahte«! »Bobby«, der doch wohl mißtrauisch geworden war, lief am vierten Tage, als er wiederum auf den Leim gegangen war, vor die Türe, kehrte aber bald darauf zurück und fand »Marko« gerade bei seinem Futternapf. Jetzt nahm er den Kollegen gründlich vor. Man sah deutlich, wie er dachte: So also liegt die Sache, du verdammter Kerl! Vierzehn Tage hast du mich genasführt, aber jetzt will ich es dir besorgen. – Berghaus hat den sonst so gutmütigen Hund weder vorher noch nachher so wütend gesehen und mußte schließlich eingreifen, weil er fürchtete, »Bobby« werde »Marko« zuschanden beißen.
Die erste Bekanntschaft mit dem Ortssinn unserer Haustiere machte ich als Knabe auf dem väterlichen Gute. Eine alte Katze sollte abgeschafft werden. Als einfachstes und harmlosestes Mittel, sie loszuwerden, erschien das Aussetzen. Wir sperrten sie in einen Kasten, der auf einen kleinen Wagen gestellt wurde. Nun zogen wir alle – ich als der Jüngste eifrig dabei – mit ihr weit in den Wald hinein. Selbstverständlich machten wir erst die umständlichsten Zickzackfahrten, obgleich der Kasten ganz undurchsichtig war. Nach meiner Schätzung waren wir mindestens eine Meile gelaufen; man zählte damals noch nach Meilen. Bekanntlich ist eine Meile gleich 7,5 Kilometer. Es wird wohl aber nur die Hälfte oder dreiviertel gewesen sein. Nachdem wir noch, um die ausgesetzte Katze irrezuführen, weitergegangen waren, kehrten wir im Bogen nach dem Elternhause zurück. Hierbei überzeugten wir uns, daß Hinz uns nicht etwa folgte. Triumphierend wollten wir den Erfolg unseres Streiches verkünden. Doch wer beschreibt unser Staunen, als wir zu Hause unsere Katze in aller Seelenruhe auf ihrem alten Platze trafen.
Derartige Erlebnisse sind bei Dorfbewohnern so häufig und gelten als so selbstverständlich, daß unter ihnen gar kein Zweifel besteht: Haustiere haben einen ausgeprägten Ortssinn.
Ein anderes Mal waren wir erst am Abend aufgebrochen. Bei der Heimfahrt mußten wir eine gute Strecke durch einen dichten Wald fahren. Hierbei verirrte sich der Kutscher und wußte schließlich nicht mehr, wo wir waren. Da schien es am ratsamsten, den Pferden die Führung zu überlassen. Und das war unsere Rettung; denn die Tiere brachten uns glücklich auf dem geradesten Wege nach Hause.
Jeder Reiter auf dem Lande weiß das aus Erfahrung. Ich führe das Zeugnis eines gerichtlichen Sachverständigen für Pferde, des Hauptmanns Ahlers, an: »Als junger Artillerie-Offizier stand ich in Jüterbog in Garnison. Im Dorfe Frankenförde, etwa 12–15 Kilometer von Jüterbog entfernt, war einer meiner Mitschüler, der Sohn des Ortspfarrers, in den Ferien bei den Eltern. Ich wollte ihn besuchen und benutzte einen sonnigen Herbsttag zu einem Ritt nach Frankenförde. Ich ritt aber nicht auf der Landstraße, sondern nach der Generalstabskarte quer durch den Wald auf den Gestellen der verschiedenen Jagen. Als ich am Abend zurückreiten wollte, fragte mich der Pfarrer, ob ich denn auch den Weg kenne. Ich hatte keine Ahnung, denn ich war nie vorher in Frankenförde gewesen. Die Nacht war stockdunkel. Am nächsten Morgen sollte ich frühzeitig im Dienst sein, mußte also unbedingt fort. Mein Freund brachte mich auf den Weg, und ich überließ mich mit langen Zügeln meinem Pferde. Ich konnte in dem dunklen Wald nicht die Hand vor Augen sehen. Weil öfters Kiefernzweige meinen Kopf streiften, suchte ich die Mitte des Weges zu halten. Mein braves Pferd verstand mich und erfüllte meinen Wunsch. Nach einigen Stunden hörte ich in der Ferne das Rasseln eines Eisenbahnzuges; kurz darauf tauchten auch Lichter der Eisenbahn auf. Nun war ich geborgen. Plötzlich befand ich mich im Orte Zinna, von dem aus ich am Tage vorher in den Wald abgebogen war. Die brave ›Bellona‹ kannte weder diese Gegend noch den Weg, auf dem sie mich mit unfehlbarer Sicherheit zurückgebracht hatte. Ich selbst hätte mich bei der Finsternis niemals zurechtgefunden.«
Ebenso schildert von Unruh, welch ausgeprägten Ortssinn sein Fuchs (fuchsfarbenes Pferd) »Hans« ihm bei den häufigen Ritten durch die damals noch unbebauten Teile des westlichen Berlins bewiesen hat. Das Tier war nie im Zweifel, schreibt unser Gewährsmann, welcher Weg, auch wenn er ihm ganz neu war, der nächste zur Stallheimat sein könne. Ließ ich ihm den freien Willen, so suchte er sich einen Heimweg, der sich nachträglich auf der Karte stets als der allerkürzeste herausstellte. Er wählte dabei Wege, die ich selbst noch nie benutzt hatte, und er konnte sie nicht kennen, denn er war direkt aus seiner mecklenburgischen Heimat in unsern Stall gekommen. Die Sicherheit in der Richtung war bei Hans so auffällig und schien meinem Vater so unfaßlich, daß wir eine Probe machten. Wir ritten beide über Charlottenburg in die uns noch unbekannte Gegend von Saatwinkel, WNW von Berlin, von da nach Tegel im Norden, tauschten nach kurzer Rast die Pferde und ließen Hans die Wegwahl. Es fiel ihm gar nicht ein, etwa den weiten Umweg zurück zu wiederholen, er zauderte auch keinen Augenblick, sondern fand alsbald die große Straße von Tegel nach Berlin und folgte ihr bis zum Heimatsstall in der Nähe des Oranienburger Tores.
In Bekanntenkreisen, fährt von Unruh fort, sprach sich das herum. Ungläubige boten eine Wette an, daß Hans quer durch das damals noch mauerumgürtete Berlin den nächsten Weg nicht finde. Der einwandfreie Austrag der Wette wurde dadurch erleichtert, daß einer der Reiter den Osten und Norden Berlins überhaupt noch gar nicht kannte. Eines Sonntags im Oktober 1863 ritten wir, zusammen sechs Herren, ganz früh zum Halleschen Tor nach Süden hinaus, schwenkten um den Südosten der Stadt, so daß wir beim Friedrichshain in die unbebaute Gegend vor dem Landsberger Tor kamen. Hier bestieg der Ortsunkundige den Hans, verpflichtete sich, keinerlei Hilfen zu geben, sondern Hans völlig den Willen und, da er voranritt, die Führung zu lassen. Hans führte ohne Zögern durchs Tor in die Landsberger Straße hinein. Am Alexanderplatz stutzte er ein wenig, wählte dann die Alexander-, Münz-, Weinmeisterstraße und nach kaum merklichem Zögern die Gipsstraße. Wo diese die August- und Große Hamburger Straße erreicht, blieb er einen Augenblick stehen – wir fünf Hinterherreitenden natürlich auch –, dann folgte er der August-, dann der Kleinen Hamburger Straße bis zur Stadtmauer und gewann so das Oranienburger Tor und damit die Stallheimat. Die Wette war glänzend gewonnen, denn der Stadtplan ergab, daß Hans den allerkürzesten Weg genommen hatte.
von Unruh meint, daß solche Leistungen nur ausnahmsweise von hervorragenden Pferden vollbracht werden können. Er hat insofern recht, als es einzelne Pferde gibt, die keine Spur von Ortssinn haben. Wir machten einmal eine Probe mit einem Tier, das früher Berliner Omnibuspferd gewesen war und in der sandigen Niederlausitz seine Hufe auf dem weichen Ackerboden wieder gesunden lassen sollte. Wir fuhren also in einem mächtigen Kreise den ganzen Tag über und stellten schließlich fest, daß das Pferd keine Ahnung hatte, in die Nähe seines geliebten Stalles gekommen zu sein.
Hat das alles aber mit edler Abstammung etwas zu tun? Ich möchte das bezweifeln. In Berlin hatte das Tier, wo es jahrelang dieselbe Strecke fuhr, gar keine Gelegenheit gehabt, seinen Ortssinn anzuwenden. Ähnliches beobachten wir bei uns Menschen. Es gibt Damen, die, weil sie stets in Begleitung von Männern gehen und von ihnen geleitet werden, nicht mehr imstande sind, allein den Weg nach Hause zu finden, den sie unzählige Male in Gesellschaft gegangen sind.
Der Ortssinn eines Pferdes, überhaupt eines Haustieres, wird sich also um so deutlicher zeigen, je natürlicher die Verhältnisse sind, unter denen es lebt, also auf dem Lande und mehr noch unter Natur- als unter Kulturvölkern.
Der berühmte Reisende Marco Polo berichtet uns, daß unter den Reitervölkern Innerasiens der Ortssinn ihrer Tiere die Grundlage eines großartigen Raubüberfalls bildet. Es ist selbstverständlich, daß ein überfallenes Volk sich zur Wehr setzt und den Räubern nacheilt, um ihnen die Beute wieder abzunehmen. Selbst ein Überfall in der Nacht gelingt nicht immer. Die Räuber verirren sich leicht in der Dunkelheit, außerdem werden sie am andern Tage von den Bestohlenen verfolgt. Da ist nun folgendes Verfahren ausgeklügelt worden. Die Räuber nehmen die Zeit wahr, wo die Fohlen auch ohne ihre Mütter bereits einige Tage leben können. Dann besteigen sie die Stuten und führen mit ihnen einen großen Überfall aus. Bei der Flucht suchen die Mütter in größter Eile wieder zu ihren Fohlen zu kommen. Alle Räuber werden also auf dem schnellsten Wege in der Dunkelheit nach Hause gebracht, so daß eine Verfolgung durch die Überfallenen aussichtslos ist.
Wir sehen also, daß bereits vor mehr als einem halben Jahrtausend die Naturvölker mit dem Ortssinn der Tiere gewissermaßen ein Geschäft machten. Professor Heck, diese anerkannte Autorität, der Leiter des weltberühmten Berliner Zoologischen Gartens, bestätigt bei der Schilderung des Ameisenbären eine Beobachtung, die auch in anderen Zoologischen Gärten gemacht worden ist und den Ortssinn der Tiere in einem noch erstaunlicheren Lichte zeigt. Gefangene Tiere suchen naturgemäß die verlorene Freiheit wiederzugewinnen. Es ist nun mehr als wunderbar, daß manche Tiere stets eine Stelle zum Ausbruch wählen, die in der Richtung ihrer Heimat liegt. So suchen die aus Amerika stammenden Ameisenbären stets nach Westen auszubrechen, während sie es nach einer andern Richtung ebenso bequem hätten.
Vor dem Weltkriege brachte das Monatsblatt des verstorbenen Professors Jäger einen interessanten Bericht über den Ortssinn eines Hundes. Dieser Vorfall, für den sich ein Herr Th. Michaelis in München verbürgt, verdient wohl, der Vergessenheit entrissen zu werden:
In unserm Hause, schreibt der genannte Gewährsmann, verkehrt ein älterer Herr, Professor St., und sein Hund Lup, ein prachtvoller, zweijähriger Wolfshund von ungewöhnlicher Größe, schönem schlanken Gliederbau und graubraunem, dunkelglänzendem Fell.
Der Herr hatte die bei manchem Gelehrten häufig belächelte Schwäche, er war alltäglichen Dingen gegenüber zerstreut und vergeßlich. So vergaß er des öfteren, wenn er in den »Franziskaner«, sein Stammlokal, zum Abendbrot ging und in später Stunde den Rückweg nach der bekannten Vorstadt Schwabing antrat, seinen Hund Lup, den er im Hof des »Franziskaner« an die Kette gelegt hatte, loszubinden und mit heimzunehmen. Der Hund wartete geduldig, bis das Lokal geschlossen und er von einer mitleidigen Kellnerin frei gemacht wurde, um allein nach dem entlegenen Schwabing zu rennen.
Eines Tages oder vielmehr Nachts machten sich zwei Personen, die den Aufbruch des Professors beobachtet hatten, den Spaß, das verlassene Tier loszuketten und dem Wirt vorzutäuschen, sie würden dem Professor, der ihnen bekannt sei, den Hund wiederbringen. So wurde der Hund mitgenommen, aber nicht nach Schwabing, sondern weiß Gott wohin!
Zu Hause vermißte der Professor seinen Hund, und da dieser nicht, wie sonst sooft, noch in der Nacht vor seinen Fenstern um Einlaß bellte, ging er morgens in den »Franziskaner« und erfuhr dort die Entführung des Hundes.
Der Beschreibung nach glaubte er die eine Person zu kennen und ging in ihre Wohnung, um dort zu erfahren, daß sie für einige Tage verreist sei. Der Professor wartete drei Tage und fing dann an, mit Hilfe der Polizei Nachforschungen einzuleiten, um sein wertvolles Tier wiederzuerlangen. Die betreffende, dem Professor bekannte Person wurde auch aufgefunden und gab folgendes an: Sie sei an jenem Abend in Begleitung eines anderen noch mit dem letzten Zug nach Hersching am Ammersee gefahren, wo sie übernachtet hätten, und da sei ihnen der Hund, als sie ihn des Morgens herauslassen wollten, ausgerissen und wie toll davongejagt; sie hätten sich nur einen Scherz machen wollen und hätten ihm den Hund sicher am Abend wiedergebracht.
Dem Professor schien die Erzählung nicht sehr glaubhaft, denn von Ammersee nach München hätte Lup sich längst zurückgefunden, wenn er nicht festgehalten wurde. Es wurde nun an alle Bürgermeisterämter am Ammersee und an den »Ammersee-Landboten« geschrieben und inseriert, jedoch ohne Erfolg. Niemand hatte den Hund gesehen. Erst nach nochmaliger Vernehmung der dem Professor bekannten Person räumte sie ein, daß dem auswärtigen Herrn der Hund so gut gefallen habe, daß er ihn am nächsten Tage nach Berlin mitgenommen hätte. Die Polizei stellte weitere Nachforschungen an und fand heraus, daß an jenem Tage ein Herr mit einem ungewöhnlich großen Wolfshund eine Personenkarte und eine Hundekarte nach Berlin gelöst hatte. Weiter ließ sich die Sache aber nicht verfolgen.
Unser Professor mußte sich, nachdem weitere vierzehn Tage verflossen waren, mit dem Gedanken vertraut machen, seinen Lup nicht wiederzufinden. Er suchte Trost und Vergessen, indem er sein Stammlokal mied und im Schatten alter Kastanien nachmittags 5 Uhr in einem Brauereigarten seinen Durst stillte. Vor ihm stand ein Maßkrug, ringsum saßen Gartengäste – es war ein heißer Augusttag –, da entstand plötzlich allgemeine Aufregung: ein zum Skelett abgemagerter großer Wolfshund jagte herein, stürzte zum Tisch des Professors und versuchte unter kläglichem Winseln, Heulen und schrillem Schreien an ihm hochzuspringen, fiel aber ermattet zurück, ohne sich wieder erheben zu können. Und das war Lup, der Treue, der seinem Entführer in Berlin durchgebrannt war und in nahezu drei Wochen dauernder Irrfahrt nach München zurückgefunden hatte. Als er dort in der Wohnung seinen Herrn nicht antraf, hatte er die Spur aufgenommen und sich mit letzter Zähigkeit noch in den ihm fast unbekannten Biergarten geschleppt.
Sein Herr und die teilnehmenden, sich für das treue Tier interessierenden Gäste bemühten sich, den erschöpften Hund zu beruhigen. Sie gaben ihm vor allem zu trinken; er leckte gierig eine große Schüssel Wasser aus und blieb dann einige Stunden zu Füßen seines Herrn, der ihm seinen Rock als Decke untergeschoben hatte, schlafend liegen.
Dann trottete er mühsam mit ihm nach Hause, legte sich sofort wieder auf sein von ihm winselnd und wimmernd begrüßtes altes Lager und schlief ununterbrochen 24 Stunden, 8 Tage lang war er nur mit Schlafen, Saufen und etwas Fressen, an das er sich aber nur langsam wiedergewöhnen konnte, beschäftigt. Seine Pfoten waren ganz wundgelaufen, auch waren alle Rippen und Knochen zu zählen. Wahrscheinlich hat der Hund aus Furcht, wieder festgehalten zu werden, jedes Menschen Nähe gemieden, seinen Durst in Tümpeln und Bächen gelöscht und ist ununterbrochen gejagt, bis er München wieder erreicht hatte. –
In dem Buche von Perty finden wir noch andere Fälle angeführt: Ein Bullenbeißer, den d'Obsonville in Pondichery aufgezogen hatte, begleitete ihn und einen Freund nach dem 300 Stunden entfernten Bangalor auf einer Reise durch Flüsse und über Berge, die fast drei Wochen dauerte. Bei Bangalor verlor der Hund sie und lief nun den weiten Weg nach Pondichery zurück, nach dem Hause des Artilleriekommandanten Beylier, eines Freundes von d'Obsonville, mit dem dieser zusammen lebte.
Noch erstaunlicher ist die Geschichte einer bei der Insel Ascension im Stillen Ozean gefangenen Schildkröte, der man Buchstaben und Ziffern in den Panzer einbrannte. Im Britischen Kanal wurde sie ins Meer geworfen, weil sie dem Verenden nahe schien, aber zwei Jahre darauf bei Ascension wieder gefangen. Ganz rätselhaft ist auch der Vorgang mit jenem dem Kapitän Dundas gehörigen Esel, von dem Franklin in seinem »Leben der Tiere« berichtet. Auf der Fregatte »Ister« von Gibraltar nach Malta verschifft, wurde das Tier ins Meer geworfen, als das Schiff auf den Sandbänken von Gat, über 200 Seemeilen von Gibraltar entfernt, scheiterte. Es erreichte das Land und fand den kürzesten Rückweg nach Gibraltar durch gebirgige, von Flüssen durchschnittene Gegenden.
Solche Leistungen der Tiere werden uns verständlicher, wenn wir berücksichtigen, daß auch bei den Naturvölkern ein ausgeprägter Ortssinn festgestellt worden ist. So erzählt der Reisende Bates, daß ein zehnjähriger Indianerknabe ohne Besinnen die Richtung nach der Heimat angeben konnte, wozu ein Europäer nach der endlosen Wanderung ganz unfähig gewesen wäre. Ebenso ist Oberländer erstaunt über den Ortssinn der Neger in Afrika. Wie die Schwarzen, schreibt er, stets in gerader Linie durch die pfadlose Wildnis den Rückweg zum Lager zu finden wußten, ist mir heute noch ein Rätsel. In Ostafrika, wo die Sonne gegen Mittag beinahe im Zenit steht, ist die Bestimmung der Himmelsgegend nach diesem Merkmal nicht so einfach wie bei uns. Ich glaube auch nicht, daß die Leute sich nach der Sonne richteten; sie wußten einfach – dort ist das Lager, auch wenn wir, meilenweit entfernt, in wildfremden Gebieten uns befanden. Wer will ergründen, wie diese sich stets als zutreffend erweisenden Richtungsangaben zustande kommen? Wer will erklären, wie die verschiedenen Wildarten im Urwalde oder auf der endlosen Grassteppe stets ihre Heimat wiederfinden? Ich glaube gar nicht, daß die den richtigen Weg weisenden Vorstellungen sich im Bewußtsein abspielen, sowenig wir alle Dinge, die unser Auge erfaßt, bewußt sehen, alle Töne, die auf unser Gehör wirken, bewußt hören. Leute, die viel im Freien sind, haben beim Eindringen in das Innere eines Waldes, ohne irgendeine Himmelsrichtung zu kennen oder sich an Merkzeichen halten zu können, das Gefühl – dort ist die Richtung, in der wir gehen müssen! Mitunter wird sich dabei ein Irrtum ergeben; aber trotzdem – wie kommt dieses Gefühl, das den sein ganzes Leben im Freien verbringenden Wilden nie trügt, zustande? Man wäre beinahe versucht, an einen, beim Kulturmenschen verkümmerten sechsten Sinn, den Ortssinn, zu glauben, wenn man dieses ganz ausgezeichnete Orientierungsvermögen der Naturvölker in der Wildnis praktisch kennengelernt hat. Dieser Sinn ersetzt jeden Kompaß.
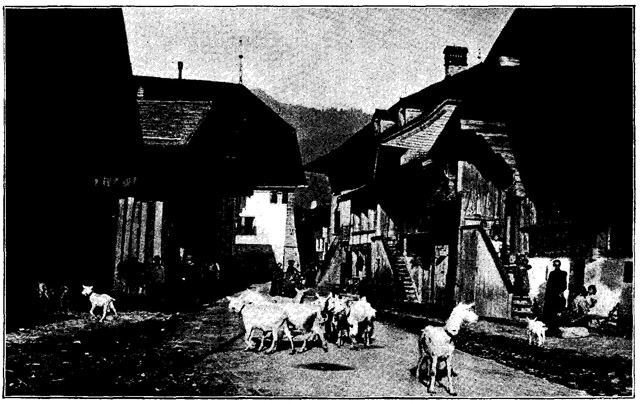
Rückkehr von der Weide.
Die Ziegen suchen ihre Stallungen selbständig auf.
Professor Groß hat sich eingehend mit unsern Zigeunern beschäftigt und auch bei ihnen das Vorhandensein eines Ortssinns festgestellt. Er schildert folgendes Erlebnis:
Als es sich im Okkupationsfeldzuge 1873 kurz vor der Einnahme von Serajewo darum handelte, eine Verbindung zwischen der östlich marschierenden Seitentruppe und der längs der Bosna südwärts kommenden Haupttruppe herzustellen, kamen einmal mitten in der Nacht, etwa um 2 Uhr, 2 Husaren zu unseren Vorposten mit Papieren an den Höchstkommandierenden. Die beiden kannten nur die Richtung, in der sie zu reiten hatten, und den Auftrag, österreichische Vorposten zu finden, die sie zu General v. Philippovich weisen sollten. Die beiden Husaren waren gegen Abend fortgeritten (ein Korporal und ein Gemeiner), ununterbrochen durch schwierigstes Terrain gekommen, das zudem überall von den Türken besetzt war, mußten zweimal Flüsse durchschwimmen und kamen glücklich und in unbegreiflich kurzer Zeit zu uns. Ich fragte den Korporal, wie er denn in dem Lande, in dem er nie zuvor gewesen, sich so zurechtfinden konnte, und erhielt die bezeichnende Antwort: »Ich nix wissen, aber Komerod is Zigeuner.« Nun erst sah ich mir den andern Husaren an und bemerkte beim schwachen Scheine des Lagerfeuers die echte Galgenphysiognomie des unverfälschten Zigeuners, den im Augenblicke meine halbgerauchte Zigarette zehnmal mehr interessierte als der ganze Feldzug! Wie ich später erfuhr, hat der Zigeuner sich und seinen Korporal auch glücklich wieder zurückgebracht.
Zur Erklärung führt Professor Groß an, man müsse erwägen, daß die Zigeuner, die jahrhundertelang oft unter den schwierigsten Umständen in ihnen gänzlich unbekannten Gegenden lebten, einen geradezu tierisch hochentwickelten Orientierungssinn erlangt haben. Man muß sich genau vorstellen, was es heißt, einen nur aus der Erzählung bekannten Ort, an dem z. B. von der Bande gestohlen werden soll, aufzusuchen, den kürzesten und sichersten Weg zu wissen, sich zu trennen und zu finden, mit dem Gestohlenen einen anderen, ebenso sicheren Weg zurückzulegen, vielleicht auseinandergesprengt zu werden und doch zusammenzutreffen und endlich wieder an einem bestimmten Orte sich zu vereinen – und das alles ohne Landkarte, ohne Kompaß, ohne lesen und schreiben zu können, ohne die Einwohner fragen zu dürfen oder sich sonst irgendwie zu verraten! Und doch, jede Zigeunerbande leistet das alle Tage!
Professor Groß kommt zu dem Ergebnis: Diese für unsere Sinne ganz unfaßbare Fähigkeit, sich überall zurechtzufinden, nie die Richtung zu verlieren, alles zu sehen und zu verwerten, darf man nie aus den Augen lassen, wenn es sich um die Beurteilung der Frage handelt, ob eine bestimmte Tat von Zigeunerin verübt wurde oder nicht. So trifft beinahe die Behauptung zu: »Dem Zigeuner ist alles möglich«, wofern »alles« dahin eingeschränkt werden muß: »was alles mit einer bis zum äußersten gesteigerten List, Gewandtheit, Keckheit, Verschlagenheit und Begehrlichkeit zu erreichen ist.«
König Ludwig XI. von Frankreich ritt einst auf die Jagd; denn einer seiner geschicktesten Astrologen hatte ihm gut Wetter verkündet. Am Walde bemerkte ihm ein Kohlenbrenner, der seinen Esel vor sich hertrieb, in wenig Stunden werde es ein schweres Gewitter geben. Der König kehrte um; das Gewitter kam wirklich. Tags darauf fragte der König den Kohlenbrenner, den er hatte kommen lassen, wo er die Sterndeuterkunst und Wetterprophezeiung gelernt hätte? Der Kohlenbrenner bekannte sich als einen ganz unwissenden Mann: »Aber, Sire, ich habe einen guten Sterndeuter im Hause, der mich niemals betrügt,« sagte er, »und dies ist mein Esel. Sobald ein Gewitter nahen will, läßt er die Ohren nach vorn hängen und den Kopf sinken, geht träger und reibt sich an den Mauern. So machte er es gestern, und darum konnte ich Eurer Majestät den Platzregen vorhersagen.« Der König spottete über seinen Astrologen, beschenkte den Kohlenbrenner und sagte: »Deinceps alio non utor Astrologo, quam Carbonario« (In Zukunft werde ich mich nur des Köhlers als Astrologen bedienen). Perty, der diesen Fall erzählt, bemerkt hierzu: »Die Meinung ist schon alt, daß der Esel das Wetter vorausfühle.«
Wir werden später von den Eskimohunden hören, daß sie durch ihr Benehmen das Herannahen von Stürmen mit Sicherheit anzeigen. Sie graben dann im Schnee und legen sich nieder.
Auch von unserer Katze ist bekannt, daß sie sich putzt, wenn das Wetter schön bleibt.
Leute, die sich für sehr aufgeklärt halten, nennen das Unsinn. So einfach liegt die Sache nicht. Ich will hier erzählen, was ich mit eigenen Augen gesehen habe:
Auf einem Jagdrevier gab es eine Unmenge wildernder Katzen, die großen Schaden anrichteten. Der Jagdaufseher, ein hervorragender Schütze, gab sich alle Mühe, ihre Zahl zu verringern.
Das ist aber nicht leicht auszuführen. Die Katze merkt sehr bald, daß man ihr nachstellt, und als nächtliches Tier geht sie dann nur in der Dunkelheit auf Raub aus. Was nützt dem vortrefflichsten Schützen seine Kunst? Um zu treffen, muß man sehen können, was in der Dunkelheit sehr schwer ist.
Diese Verhältnisse waren mir genau bekannt. Ich war daher aufs äußerste erstaunt, als ich am hellen Nachmittag etwa gegen 4 Uhr erst eine und dann später noch zwei andere Katzen aus dem Dorfe wandern sah, um der Jagdlust zu frönen. So etwas hatte ich noch nicht erlebt, es war mir neu.
Mir ging die Sache nicht aus dem Kopfe; ich grübelte darüber nach, was wohl die Katzen veranlaßt haben mochte, sich einer so augenscheinlichen Gefahr auszusetzen. Es war ein wunderschöner Tag; kein Wölkchen am Himmel. Gegen Abend änderte sich plötzlich das Bild. Ein schweres Gewitter zog auf, und in der Nacht regnete es in Strömen.
Jetzt wurde mir das Verhalten der Katzen klar. Sie hatten den Wetterumschlag bereits gefühlt und, da sie bei Regen nicht auf die Jagd gehen, setzten sie sich lieber am hellen Tage der Gefahr aus, statt ganz auf die Jagd zu verzichten. Ähnliche Fälle habe ich mehrfach erlebt, so daß für mich kein Zweifel besteht, daß manche Tiere ein Vorgefühl für den Wetterumschlag haben, der dem Durchschnittsmenschen abgeht.
Ein solches Vorgefühl treffen wir namentlich bei Tieren an, denen die zeitweilige Änderung des Wetters gesundheitlichen oder sonstigen Schaden bringen kann. So wird auch vermutet, daß bald Regen eintritt, wenn Kaninchen am Tage eifrig auf Nahrungssuche ausgehen. Denn das Kaninchen ist ein Nachttier und wie die Katze gegen Regen empfindlich.
Ein besonders feines Vorgefühl finden wir bei den Vögeln, namentlich den Raubvögeln. Für den Raubvogel ist es eine Lebensfrage, rechtzeitig den eintretenden Wetterumschlag zu erkennen, denn mit Flügeln, die mit Wasser beschwert sind, kann er nichts fangen; auch sind dann wenige Friedvögel zu erblicken.
Die an sich ganz richtige Beobachtung, daß gewisse Tiere einen Wetterumschlag vorausfühlen, ist den Gebildeten dadurch unglaubwürdig geworden, weil der wahre Kern der Sache durch ganz haltlose Zusätze verdunkelt worden ist. Nebenbei bemerkt, wollen Leute, die an Migräne und ähnlichen Krankheiten leiden, einen solchen Wetterumschlag gleichfalls im voraus empfinden.
Dieses Vorgefühl kann sich jedoch nur auf die nächsten vierundzwanzig Stunden erstrecken. Es ist daher beinahe töricht, was alljährlich in vielen Zeitungen zu lesen ist: »Da die Zugvögel uns sehr zeitig verlassen, so steht uns ein strenger Winter bevor.« Oder: »Das Bevorstehen von starkem Frost ist deshalb anzunehmen, weil die Bienen ihre Wohnung besonders stark gegen Kälte abschließen.«
Noch größer aber war die Torheit, als viele Völker den Schluß zogen: »Wenn das Tier weiß, wie das zukünftige Wetter wird, so kann es überhaupt in die Zukunft sehen.« Wer etwas Wichtiges vorhatte, schaute auf die Vögel, ob sie sich durch ihr Benehmen dem Vorhaben günstig oder ungünstig erwiesen!!
Dieser Schluß ist auch aus dem Benehmen der Katze gezogen worden. Solcher Unfug gehört in das Reich des Aberglaubens. So wird gesagt: »Wenn die Katze sich putzt, dann kommt Besuch.« Richtig ist allerdings, daß bei schönem Wetter leicht Besuch kommt. Ein Körnchen Wahrheit ist also vielleicht in dem Volksglauben enthalten.
Der Esel stammt aus heißen Ländern, wo es selten regnet. Das Vorgefühl für das kommende Gewitter ist bei ihm daher leicht erklärlich, weil er sehr empfindlich gegen Nässe ist.
Wenn also jemand fragt: »Woher kommt es, daß Esel und Katze, nicht aber Pferd und Hund ein Vorgefühl für das kommende Wetter haben?«, so lautet die Antwort: »Für den Hund und das Steppentier Pferd ist ein Gewitter etwas Gleichgültiges, dagegen für Katze und Esel etwas höchst Wichtiges. Ebenso ist auch für den Polarhund die Kenntnis eines nahenden Eissturmes eine Lebensfrage. Die Natur verleiht Gaben nur dort, wo sie zur Lebenserhaltung erforderlich sind.«
Deshalb ist die Annahme nicht unberechtigt, daß schönes Wetter bleibt, wenn Bienen schwärmen oder Spinnen ihre Netze spannen. Denn ein Gewitter könnte den Schwarm vernichten, ebenso auch das Kunstwerk der Spinne.
Über das Vorgefühl der Haustiere bei Erdbeben sind besonders in Italien wichtige und aufschlußreiche Beobachtungen gemacht worden. Über das Benehmen der Haustiere vor dem Ausbruch des furchtbaren Erdbebens im Jahre 1783 wird folgendes berichtet: Namentlich Hunde und Esel zeigten sehr frühe Äußerungen der Furcht, liefen mit wilden, starren Blicken heulend und schreiend hin und her. Pferde, Ochsen, Maulesel zitterten starren Blickes, stampften wiehernd, fast brüllend mit den Hufen und spitzten die Ohren. Die Katzen krümmten sich, ihre Haare standen borstenartig hoch, ihre Augen tränten und waren blutig, ihr Jammergeschrei klang gräßlich.
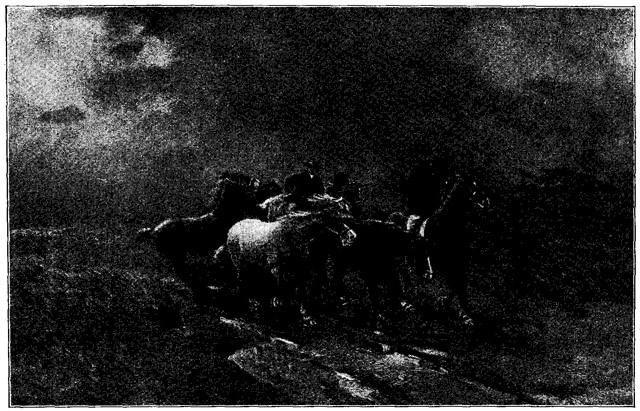
Pferderudel bei heraufziehendem Gewitter.
Nach einem Gemälde von
Johanna von Astudin-Meineke.
Die geringsten Vorempfindungen äußerten die Schweine. Es ist nicht zu verwundern, daß Schweine am wenigsten Vorgefühl für das nahende Erdbeben zeigten. Denn Wildschweine leben in morastigen Gegenden, wo solche Naturereignisse kaum vorkommen.
Eine andere Gabe, die das Tier vor den Menschen voraushat, ist seine schnelle Erkenntnis darüber, wer es mit ihm gut meint. Hierbei fällt mir folgendes Erlebnis ein:
Meine Waschfrau war nach außerhalb verzogen; ich hatte deshalb meine Wäsche einer in der Nähe gelegenen Waschanstalt anvertraut. Die Inhaberinnen des Geschäfts sind große Tierfreunde. Da sich Mäuse gezeigt hatten, so war etwa sechs Wochen vorher eine ganz junge Katze angeschafft worden. Mit dem alten Wolfsspitz Fritz, der bisher in den Räumen als Alleinherrscher waltete, stellte sie sich ganz gut. Ja, Fritz fing auf seine späten Tage noch an, mit dem Kätzlein zu spielen.
Den alten Hund kannte ich dem Ansehn nach schon längst. Gelegentlich eines Besuchs hatte ich ihm ein Stück Pelle mit daran haftender Wurst mitgebracht. Bei den teuren Preisen kann man ja nicht so, wie man gern möchte. Das Kätzlein hielt sich immer scheu im Hintergrund, und ich hatte mich noch niemals mit ihm beschäftigt.
Kürzlich mußte ich wegen einer Wäscheangelegenheit wieder hin und sah, daß Fritz mich freudig anwedelte. »Na,« sage ich zu der einen im Laden anwesenden Inhaberin, »der Hund hat ein gutes Gedächtnis. Der entsinnt sich noch, daß ich ihm ein Stück Pelle mitgebracht habe.« »Jawohl,« meint sie, »dafür hat er ein sehr gutes Gedächtnis!« Inzwischen ist der Hund näher gekommen und legt sich vor mich hin. Ich sollte ihm also das Fell streicheln. Das hätte ich auch gern getan, wenn mir nicht in demselben Augenblick das junge Kätzchen auf die Brust gesprungen wäre. Ich hatte es bei der ungünstigen Beleuchtung gar nicht gesehen und war über diese Zutraulichkeit des sonst so scheuen Tieres etwas verblüfft. Es kroch auf meine Schulter und blieb dort sitzen. Die Inhaberin hatte noch ein Taschentuch für mich zu plätten; ärgerlich über die Katze, befahl sie ihr, mich in Ruhe zu lassen. Das Tier blieb ruhig und unbeteiligt sitzen. Fritz seinerseits war nun eifersüchtig, daß er durch die Gefährtin in den Hintergrund gedrängt war, und daß ich ihm das Fell nicht zauste. Das konnte ich aber wieder nicht, weil sonst die Katze heruntergefallen wäre. So ergab sich ein nicht gerade alltägliches Bild: Die Inhaberin, die sich beeilte, mit dem Taschentuch fertig zu werden, der Hund, der sich fortwährend drehte, damit ich sein Fell bearbeiten sollte, und die Katze, die seelenruhig auf meiner Schulter thronte und schnurrte.
Nur mit Gewalt ließ sich die Katze von ihrer Herrin, als diese mit Plätten fertig war, von meiner Schulter reißen.
Bei Hunden kann man sich nun vorstellen, daß sie sich durch den Geruch leiten lassen, wenn sie sich zu einem fremden Menschen hingezogen fühlen. Der Tierfreund riecht ihnen eben angenehm. Umgekehrt ist es sehr wohl denkbar, daß ein Tierfeind, der beim Anblick eines Hundes in eine ärgerliche Stimmung gerät, auch eine für den Hund unangenehme Ausdünstung hat.
Die meisten Hunde pflegen auch fremde Personen, z. B. Besucher, ausgiebig zu beriechen, wenn sie dazu Gelegenheit haben.
Beim Hunde als Nasentier wäre also die schnelle Feststellung, ob er einen Tierfreund vor sich hat oder nicht, verhältnismäßig leicht zu erklären. Eine Katze aber riecht nicht besser als wir Menschen. Obendrein war die junge Katze, die mir so urplötzlich ihr Zutrauen schenkte, noch niemals in meine Nähe gekommen. Von Beriechen konnte also keine Rede sein.
Es bleiben demnach zur Erklärung für das Erkennen des Tierfreundes nur Stimmen und Worte übrig. Ich war zu dem Hunde freundlich, und das war für das Kätzchen schon hinreichend Anlaß, mich für einen Tierfreund zu halten. Dann kommen die Worte hinzu. Jeder Dresseur betont, daß wir Menschen mit unsern Worten Tiere geradezu bezaubern können. Wenn die Tiere auch selbst nicht sprechen können, so hören sie doch aus unserer Sprache unendlich viel heraus. Sie entnehmen dem Worte sofort die Seelenregung, in der sich der Sprechende befindet.
Es hat mich in großes Erstaunen versetzt, daß ein junges Tier von drei Monaten schon eine derartige Beobachtungsgabe besitzt. Eine Katze wird wie ein Hund etwa 15 Jahre alt und erreicht wie dieser mit sechs Monaten die volle Größe. Wirklich ausgewachsen sind beide erst mit zwei Jahren. Nehmen wir an, daß ein Mensch mit etwa 18 Jahren seine endgültige Größe erreicht, so entspräche die dreimonatige Katze einem Kinde von 9 Jahren. Obwohl wir Menschen auf unser Gehirn sehr stolz sind, so dürfte es für ein neunjähriges Kind wohl nicht immer leicht sein, die Fremden herauszufinden, die es gut mit ihm meinen.
Eine besorgte Menschenmutter läßt ihre kleinen Kinder meist gar nicht aus den Augen. Sie weiß, daß Unglück wohlfeil ist. Ist z. B. im Ofen Feuer angemacht, da hat sie ständig aufzupassen, daß die Kleinen ihm nicht zu nahe kommen. Zur Sommerszeit besteht zwar diese Feuersgefahr seltener, dann wollen die Kinder aber aus dem Fenster sehen! Bei höher gelegenen Wohnungen würde ein Sturz auf die Straße sicheren Tod bedeuten. Auch die Spielereien der Lieblinge müssen beaufsichtigt werden.
Bekommen die Kleinen Essen, so muß die Mutter sorglich aufpassen, daß sie ihren Magen nicht überladen. Geht sie mit ihnen im Walde spazieren, so müssen ihre Lieblinge davor behütet werden, daß sie giftige Beeren essen, etwa Tollkirschen naschen.
Die Sorgen der Menschenmutter haben kein Ende. Beständig fließt ihr Mund über von Belehrungen: Seid vorsichtig, tut das nicht, tut jenes nicht usw. usw.
Von allen diesen Dingen ist bei einer Tiermutter so gut wie gar nichts zu merken. Bei Friedtieren beobachten wir allerdings, daß sie ihr Kleines vor plötzlichen Überfällen durch Raubtiere zu schützen suchen. Gewöhnlich lassen sie es vorangehen, um ihm jederzeit zu Hilfe kommen zu können.
Aber sonst braucht ein junger Hund oder eine junge Katze nicht ermahnt zu werden, daß sie nicht zu dicht ans Feuer gehen sollen. Keiner braucht aufzupassen, daß sie nicht vom Tische oder aus dem Fenster fallen. Ebenso sind meist Belehrungen überflüssig, was und wie viel sie zu fressen haben.
Dieser grundlegende Unterschied zwischen Menschenkindern und Tierjungen ist natürlich von jeher aufgefallen. Da der Mensch das größte Gehirn hat, so wäre die Annahme berechtigt, unsere Kinder könnten den Tieren als Muster dienen. In Wirklichkeit ist es gerade umgekehrt. Um das zweckmäßige Handeln der Tiere zu erklären, wird es auf den »Instinkt« zurückgeführt. Denn es war unmöglich, die Zweckmäßigkeit bei den Handlungen der Tiere als Leistung des Gehirns aufzufassen.
Mit dem Worte »Instinkt« ist indessen wenig erklärt. Da wird statt einer Unbekannten eine andere Unbekannte gesetzt. Das kommt ja im Leben öfter vor!
Es gibt viele Gegner des Instinktbegriffes, die alles auf Überlegung zurückführen wollen. Davon kann jedoch keine Rede sein. Für mich waren immer gewisse Beobachtungen bei der Aufzucht der Fasanen und Rebhühner sehr überzeugend. In Jagdrevieren fand ich häufig verlassene Nester von Rebhühnern und Fasanen und hatte den Wunsch, die Eier ausbrüten zu lassen. Das ist leichter gesagt als getan. Gewiß, unsere Hennen brüten die Eier treulich aus, aber gewöhnlich wird nicht ein einziges Rebhuhn großgezogen. Unsere Haushenne gilt zwar sonst als Muster einer besorgten Mutter und verdient dieses Lob zu Recht. Ihre eigenen Kücken betreut sie mustergültig. Aber bei den kleinen Rebhühnern nützt ihre ganze Mutterliebe nichts. Denn die Glucke macht zwischen den eigenen und Rebhühner-Kücken, die heftigere Tritte nicht vertragen können, keinen Unterschied. So kommt es vor, daß fast täglich ein Rebhuhnküchlein totgetreten wird, und schließlich folgt auch das letzte seinen Geschwistern in den Tod.
Hier sieht man so recht, daß die Instinkte ganz der Natur entsprechen. Sowie aber ungewöhnliche Verhältnisse eintreten, dann versagen sie. Die alte Henne ist sonst rührend in ihrer Mutterliebe zu den Adoptivkindern. Trotzdem fehlt ihr die Einsicht, ihre tolpatschigen Füße etwas vorsichtiger aufzusetzen. Nein, sie tritt Tag für Tag ein Junges tot!
Der große Naturforscher Darwin hat den Instinkt wie folgt zu erklären versucht. Er behauptet, daß die zweckmäßige Handlungsweise vor Urzeiten von einem Vorfahren zufälligerweise angewendet wurde. Da die Art des Handelns den Verhältnissen entsprach, so zog das Tier daraus einen Vorteil gegenüber seinen Artgenossen und vererbte die als zweckmäßig erkannte Handlungsweise auf seine Nachkommen.
Diese Erklärung klingt zwar sehr gelehrt, ist aber mit den Tatsachen durchaus unvereinbar. Elefantenherden überschreiten die Gebirge an den günstigsten Stellen, so daß sie seit Urzeiten für die Menschen als Lehrmeister im Wegebau dienen. Genau so ist der Eisbär in unwegsamen Polarländern der Wegweiser für Polarreisende. Wir können uns keine Vorstellung davon machen, woran ein Elefant bei einem riesigen Gebirge den zum Überschreiten günstigsten Paß erkennt. Sein Auge ist obendrein auffallend schwach, und sein feiner Geruch kann ihm am Fuße eines Gebirgsstocks ebenfalls nichts nützen.
Elefanten bleiben stets in Herden. Es ist also ausgeschlossen, daß ein einzelner Elefant durch Zufall die Übergangsstelle gefunden hat.
Wäre der Instinkt eine vererbte Fähigkeit, so müßte er versagen, sobald neue, ungewohnte Verhältnisse vorliegen. Ist das der Fall?
Früher gab es kein Sacharin und keine Kunstwaben. Wenn der Instinkt auf Vererbung beruht, so müßten die Bienen dem Sacharin und den Kunstwaben ratlos gegenüberstehen. Das Gegenteil ist eingetreten, wie die Bienenzüchter übereinstimmend bekunden. Alle Bienen haben das Sacharin abgelehnt, und alle haben die Kunstwaben benützt. Die Sache mit dem Sacharin können wir uns zur Not erklären. Der Süßstoff hat den mit feinsten Geruchsnerven ausgestatteten Bienen übel gerochen. Weshalb aber alle Bienen die Kunstwaben angenommen haben, bleibt ein vollkommenes Rätsel.
Wir müssen uns also bescheiden und offen zugeben, daß wir vorläufig für den Instinkt keine zufriedenstellende Erklärung finden können.
Auch bei uns Menschen spielt der Instinkt eine weit größere Rolle, als gewöhnlich angenommen wird. Insbesondere lassen sich Frauen in vielen Fällen von ihren Instinkten leiten. Es kommt häufig vor, daß eine Frau erklärt, wenn ihr Mann einen Bekannten einführt: »Schaffe mir diesen Menschen aus den Augen – ich mag ihn nicht sehen!« Einen Grund für diese Abneigung kann sie zwar nicht angeben; sie verläßt sich einfach auf ihren Instinkt.
Vielleicht ist unser Erstaunen über die durch den Instinkt veranlaßten zweckmäßigen Handlungen ganz unbegründet. Denn das Leben wäre kein Leben, wenn ein frei lebendes Tier nicht seine Feinde und seine Nahrung kennen würde, schwimmen könnte, kurz, alle Fähigkeiten hätte, die zum Begriffe ›Leben‹ gehören. Sie verschwinden da, wo sie zum Leben nicht unbedingt erforderlich sind, beispielsweise bei den Haustieren und Menschen. Der Mensch kann vermöge seines Gehirnes die meisten Instinkte ersetzen.

Ungleiche Geschwister.
Nach einem Gemälde von
A. Weczerzick.
Daher sollten wir uns nicht über die Instinkte der Tiere wundern, sondern vielmehr darüber, daß wir Menschen so wenige haben.
Jedenfalls scheint das der einzige Weg zu sein, der uns eine Erklärung gibt, weshalb Haustiere so viel weniger Instinkte besitzen als frei lebende Tiere. Kein wildes Tier braucht einen Arzt, dennoch ist es gesund und lebensfroh. Dagegen haben die Tierärzte bei unsern Haustieren sehr viel zu tun.
Ein frei lebendes Tier hat sich wohl noch niemals zu Tode gefressen. Kommen aber unsere Pferde an eine wohlgefüllte Haferkiste, dann ist das in der Tat auch schon geschehen.
Wir erklären also Instinkt als die Gabe, den drohenden Gefahren des Lebens gegenüber zweckmäßig zu handeln, Nahrung zu finden und Nachkommenschaft großzuziehen. Diese Gaben müssen beim frei lebenden Tiere reichlicher verteilt sein als beim Menschen, der vermöge seines Gehirnes die erforderlichen Mittel beschaffen kann. Auch ist er imstande, die in seinen Diensten stehenden Haustiere vor Gefahren zu behüten. Deshalb brauchen unsere Haustiere weniger Instinkte.