
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Siehe die Kartenskizze. Diese Leute sind Mischlinge zwischen Kanuri und Marghi. Dazu aber auch stark infiltriert von älterer hamitischer Kultur.]
Kanuri und Bornu in ihrer ethnologischen Stellung. – Wir haben das alte, heute zerstörte Imperium des westlichen Tschadseebeckens seinem Wesen und seiner Bevölkerung, seiner geschichtlichen Wucht und seiner traditionellen Einflußsphäre nach höchstens in der Peripherie und dann auch nur im Lichte nicht sehr starker Geistesquellen kennengelernt. Zunächst war das im Haussaund Nupegebiet, wo die Bornumänner Berriberri genannt werden. Dort fand ich drei verschiedene Enklaven teilweise noch heidnischer Kanuri. Die erste war in der Kontagoraprovinz im Salikagebiet. Die Leute nannten sich da Kambali. Der zweite Kanuristamm war im Nupelande, und zwar in der Stadt Kutigi. Dort nannte er sich Bennu. Endlich konnte ich noch eine Kolonie in der Keffiprovinz um Lafia festlegen, wo die Leute ihren alten Haussanamen Berri-berri beibehalten haben. Außerdem tauchten die Spuren vergangener gewaltiger Macht des Bornukönigs im Jukumgebiet auf. Die Bornuleute heißen auch hier Berriberri. Wir wissen aus der Chronik, daß ein Bornukönig im sechzehnten Jahrhundert nach der Unterwerfung Kanos mit dem alten Jukumreich anknüpfte und aus den Traditionen der Wukarialten, daß er durch das befreundete Jukum eine Straße zum Süden anlegte.
Alles das wird dadurch noch wesentlicher, ja erhält tragfähige Säulenkraft, daß wir durch die Bornuchroniken über den Zeitpunkt orientiert sind, in dem diese Kolonien gegründet wurden und die Machtausdehnung Bornus so gewaltig gewachsen war. Es ist das elfte Jahrhundert. Nun haben aber alle Bornukolonisten von Kontagora bis nach Altkororofa zwar ihre alte Sprache aufgegeben, dagegen sämtlich die alte Tätowierung beibehalten, die in immer wiederkehrenden langen drei Parallellinien auf allen Körpergliedern und in einer Umrahmung des Gesichts mit etwa elf Parallellinien besteht. In dieser Anlage ist so ziemlich der einzige wesentliche Differenzierungsmodus gegeben. Zuweilen sind es rundherumgeführte Kreislinien, deren jede wieder in sich zurückläuft. Zuweilen sind sie abgebrochen, zuweilen nur auf dem Gesicht und nicht auf dem Oberkopf oder unter dem Kinn durchgeführt. Diese Tätowierung ist also eine Reihe von Jahrhunderten alt, und wir kennen ihre Verbreitung und ihr Umsichgreifen. Es ist sicher, daß ihr eine Ähnlichkeit mit manchen Mande- und Mossimarkungen innewohnt und allein dadurch wird sie einstmals großen Vergleichswert erhalten.
Mir erscheint die Betonung dieser Tatsache ganz besonders notwendig, weil infolge der hochwichtigen Erkenntnisse unserer großen Bornuforscher der Hauptgesichtspunkt bei der Beurteilung dieses Volkes der wurde, daß ihr derzeitiger Adel aus Tibesti und ihr kriegerisches Vorwärtsdrängen in den letzten Jahrzehnten des Bornureiches auf Adamaua zu, also nach Süden gerichtet war. Aber ich kann in der Untersuchung des Volkskultus der Bornuer nichts finden, was diesen beiden Entwicklungstendenzen entspräche, und in Adamaua habe ich durchaus keine Spuren der Einwirkung der alten Bornu-Kultur im Sinne derer, die unserer historisch im vorigen Jahrhundert gewonnenen Kenntnis entspräche, finden können.
Vielmehr überwiegt die Beziehung zu den westlichen Kulturstaaten. Daß das Verhältnis der Kanuri zum Nordosten, Osten, Süden viel lockerer war, als man nach den bisherigen Feststellungen annehmen zu müssen glaubte, geht daraus hervor, daß die eigentlichen Kanuri auf keinen Fall jemals das Wurfeisen besessen, d. h. hergestellt haben. Die Kanuri wandten allerdings Wurfmesser an, aber diese waren nicht ihr eigenes Produkt. Ihre Leichtbewaffneten hatten zwei verschiedene Formen im Gebrauch. Die eine hieß Daniski. Sie zeichnete sich durch Dicke und schweres Gewicht aus. Sie war nicht flach. Man kaufte sie immer bei den Marghi. Die andere dagegen hieß Gario. Die war ganz dünn und flach. Diese erwarb man stets in Bagirmi, in welchem, ehe die Bornustatthalter sich vom Heimatland frei und als unabhängige Herrscher erklärten, die Ssara allein die Oberhand hatten. Die Ssara (mit Lakka) waren ein äthiopischer Stamm wie die Mundang und Dakka. Von ihnen stammte das Saria genannte dünne Wurfeisen. Im übrigen erhielt ich an Namen für Wurfmesser:
Um aber auch nach anderer Richtung abzuschließen sei bemerkt, daß die Kanuri auch nicht das hölzerne Wurf holz kennen. Nun konnte ich aber im westlichen Gebiet zwei Formen feststellen, die in ihrem Zusammenhange ungemein wichtig sind. Ich skizziere beide Formen nebenstehend. Man sieht die Beziehung zwischen dem Kere, dem Wurfholz der Stämme nördlich Kanos, also der Damergustämme, Nun nennen die Kanuri die Damerguleute, die groß im Werfen der Kere sind aber Kere-kere, und damit dürfte gezeigt sein, daß den Kanuri die hölzernen Wurfgeschosse ebenso unbekannt waren wie das Wurfeisen.
Die Frage ist also, was die Kanuri eigentlich ihren Waffen zufolge für eine Stellung unter den Sudanstämmen einnahmen, ehe sie der Teddadynastie verfielen. Wir können es mit ziemlicher Klarheit feststellen. Die Kanuri führten als Reitervolk schwere Lanzen, als Fußkämpfer aber Bogen, die ungemein lehrreich sind. Es sind das nämlich mächtige äthiopische Bogen mit Sehnenschnur und papilloter Bespannung. Auch bei Tuarek und Tedda werden solche gelegentlich zur Jagd verwendet, wenn auch so selten, daß ich neuerdings nicht einmal den Namen erfahren konnte, nachdem ich früher an der guten Quelle vorbeigegangen war. Diese Bogen sind aber kümmerlich und schmächtig im Vergleich mit der Bornuwaffe, die der stärkste Bogen Innerafrikas überhaupt sein dürfte. Denn nicht nur, daß sie groß und stark gebaut ist, sie ist auch meist vollkommen umwickelt gewesen und von der klugen Behandlung durch die Schützen zeugt es, daß diese die Umwicklung meist mit Kuhmist bestrichen, anscheinend um die Austrocknung zu vermeiden. Vor allem aber haben diese Bogen auch die gleiche schöne Biegung, die man an besseren ostafrikanischen Bogen, zumal denen der Somali und Viktoriaseestämme bewundern kann. Der alte Kanuribogen, so sagen die alten Kanuri, war eine starke Waffe, er war »stark wie Eisen«. Heute soll es nur noch kümmerliche Überreste und Nachkommen geben, aber auch die sind kräftig genug, um zu imponieren. Früher muß danach der äthiopische Bogen eine Hauptstätte hier besessen haben, und unwillkürlich müssen wir an jene starken Bogen der Äthiopen denken, von denen Herodot erzählt.
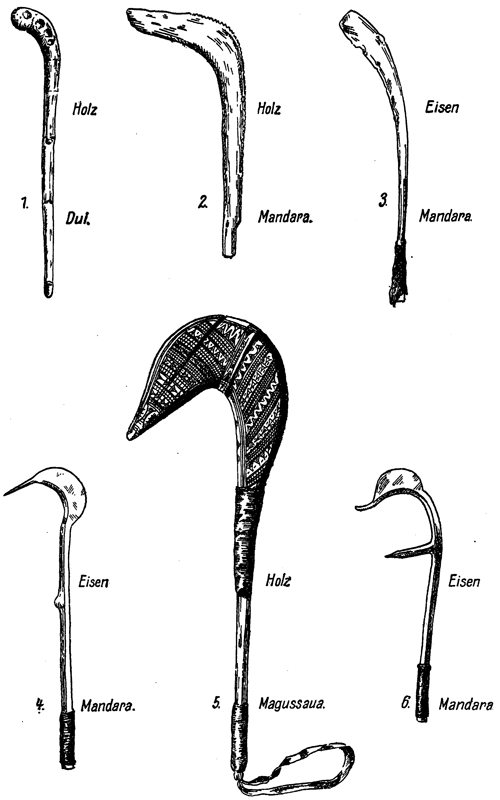
Abb. 1, 2 und 5 Wurfhölzer; 3, 4 und 6 Wurfeisen. Abb. 1 von den Dui in Nordkamerun, Abb. 5 von den Magussaua bei Kano, Abb. 2, 3, 4, 6 von den Nguduf, Mandaragebirge. (Abb. 5 trägt bei den Eingeborenen den Namen »Kere«)
Ich glaube, daß nichts die bedeutungsvolle äthiopische Wurzel, aus der die Bornupflanze, die nachmals so und so oft von so und so vielen Gärtnern veredelt wurde, so beweist als dieser Bogen, den alle Heidenstämme Bornus früher gehabt haben und dessen Einflußgebiet – vielleicht aus einem alten »Bornu-Zentrum« ausstrahlend! – man nicht niedrig einschätzen darf. Wenn wir oben darauf hinwiesen, daß die Kanuritätowierung die Mande und Kanuri verbindet, so müssen wir jetzt feststellen, daß der temporale Bogen die Mande und Haussa verbindet, nicht aber diese beiden mit den Kanuri. Der Kanuribogen aber ist älter, da der temporale Bogen aus einem Einfluß syrtischer Kultur hervorgewachsen ist und die Verbreitung des Papillotbogens durchbrochen hat. Das ist bedeutungsvoll. Und ebenso wesentlich erscheint es mir, daß der Adamauabogen, der unten travers (also erythräisch) und oben papillot ist, fast beziehungslos zum Haussa-Mande-Bogen erscheint, aber möglicherweise in einer Beziehung zum Bornubogen sich entwickelt haben muß. Das zuletzt Entscheidende für die Stellung Adamauas wird ja erst die gründliche Erforschung der ethnologischen Verhältnisse im Osten des Tschadsees und am Nil ergeben. Bis dahin können wir daran festhalten, daß Bornu seiner Wirkungstendenz nach entschieden mehr nach Norden und Westen als Osten und Süden gerichtet war.
Wie aber sein Bogen, so war auch seine sonstige Kultur eine vordem wesentlich äthiopische, und das will ich in den nachfolgenden Zeilen zeigen.
Heidentum, Äußeres, Kultus. – Es war mir sehr wesentlich einige Auskünfte über die religiösen Verhältnisse der Äthiopen des primitiven Bornu zu erlangen, und so nutzte ich die Gelegenheit und sandte einen alten Bornumann, der die Verhältnisse in jenen Gegenden von früher kannte, zur Auffrischung seiner Kenntnisse nach Mulgoi, das nach vielfach gehörter Ansicht einen alten echten Kanuristamm bergen soll – nicht so hinsichtlich der Sprache, die hier wie in allen äthiopischen Distrikten gleicherweise dialektisiert, sondern der Art und dem Wesen seiner Bevölkerung nach. Die Ausdrücke, die ich in folgender Zusammenfassung meiner Erkundigungen in Klammern setze, sind aber der Kanurisprache entlehnt, nicht der der Eingeborenen von Mulgoi, deren Dialekt heute schon dem der wilden Marghi sehr nahe stehen soll.
Die Mulgoi selber sind Heiden (= Kirdi). Darüber berichten sie folgende hübsche Geschichte, die sie nach eigenen Angaben von den städtischen Kanuri übernommen haben: «Früher waren alle Bewohner Bornus Kirdi (Heiden). Eines Tages kam Mohammed ins Land und sagte zu seiner Frau Auwa: »Bring mir alle Kanuri.« Die Frau Auwa ging hin. Sie nahm die Hälfte aller und versteckte sie. Sie brachte nur die Hälfte aller zu Mohammed. Mohammed fragte: »Sind das alle?« Auwa sagte: »Ja, das sind alle.« Mohammed fragte: »Sind das wirklich alle?« Auwa sagte: »Ja, es sind alle.« Darauf nahm Mohammed die Hälfte und die wurden Mus(e)lma. Die andern aber blieben Heiden.»
Die Mulgoileute und ihre Nachbarn zeichnen sich äußerlich vor allem dadurch aus, daß sie keine Beschneidung haben. Die Kleidung ist wenig kompliziert. Die Männer tragen kein Penisfutteral, wohl aber ein langes Schaffell über der Achsel wie die Bassariten. Das dient dann gleich als Schambedeckung. Hinten haben sie das Sitzleder, hier Puno genannt. Die Weiber aber haben vorne einen Lendenschurz, den Pusche, und hinten einen aus Baobabborke geklopften Rindenstoff, den Damdje. Blätter werden allen Angaben nach meist nicht getragen. Ich sah aber mehrere ansehnliche islamitische Kanurimänner einen Fluß so überschreiten, daß sie alles auszogen und schnell ihre Blößen vorn und hinten mit Blätterbüscheln bedeckten. Das soll als Notfall in Bornu öfters so gemacht werden.
Das wichtigste war es mir, in Erfahrung zu bringen, ob diese Kanurikirdi die gleichen Religionsverhältnisse haben, wie die Adamauastämme. Ich hörte darüber vor allem, daß die Schwirrhölzer und Schwirreisen fehlen, und daß der größte Unterschied in einem eigenartigen Baumdienst besteht.
Das Sanam (das Wort entspricht seiner Bedeutung nach dem Lauru der Fulbe, dem Dugudasiri der Mande) besteht vor allem in einem Baume, den die Kanuri Gudjo nennen und die Fulbe Djiho. Er soll nicht einen so dicken Stamm haben, wie eine Kuka (Baobab), aber viel höher sein. In jedem Jahr nun, wenn die Ernte geschnitten ist und in den Farmspeichern liegt, wenn das Gras gebrannt ist, dann wartet man die erste junge Mondsichel ab, um die Weihe vorzunehmen. Der Sanama, d. i. der Herr des Sanam, geht dann mit allen Kriegern hinaus zu diesem Baume, und ein jeder nimmt seine Kriegsaxt (Biëgo), seinen Speer (Djelli), seinen Schild (Gauwa), Bogen und Pfeil mit hinaus.
Dem Sanama werden zu dieser Maßnahme die Hände auf dem Rücken kreuzweise zusammengebunden. In dieser Stellung wird er herausgebracht, und so gefesselt, spricht er zu dem Baume: »Sieh alle unsere Waffen sind unter dir. Sei mit unseren Waffen. Gib, daß sie viel Glück im Krieg haben mögen. Gib, daß wir alle viel gewinnen. Gib, daß wir Kinder haben und Nahrung.« Danach stellen alle Krieger ihre Waffen unter den Baum und gehen nach Hause.
Während der nächsten drei (?) Monate bleiben die Waffen nun unter dem Baume. Während der ganzen Zeit darf niemand von der neuen Feldfrucht essen. Vielmehr muß diese unangerührt in den Farmspeichern liegen bleiben. Vor allen Dingen darf während dieser Zeit auch niemand seine Frau beschlafen. Da das nun in allen Gehöften – und das Gebiet der Mulgoi kennt nur Großfamiliengehöfte, keine Dörfer in unserem Sinne – weit und breit im Lande genau ebenso gemacht wird, so herrscht überall Friede. Das ganze Land, das sonst vom Kriegsgeschrei der verfeindeten Familien in langer, ununterbrochener Schallwelle widerhallt, hat nur eine einzige große Sache, den Frieden. Das Land liegt wie im Schlafe.
Wenn aber danach das zweitemal die feine Mondsichel auftaucht, rüstet sich der Sanama, ein großes Opferfest für die Sippe, deren geistlicher Berater er ist, zu veranstalten. Der Sanama scheint immer von seinen Stammesgenossen dadurch unterschieden zu sein, daß er ganz lange Haare und lange Fingernägel trägt. Er reinigt diese Auswüchse an diesem Tage besonders und begibt sich mit einem weißen Ziegenbock (Dali Killi) und seinen Söhnen zu dem Baum. Die andern Männer der Siedelung folgen. Am heiligen Platze schlachtet er den Ziegenbock durch einen Schnitt. Der Bock ist aber nicht festgebunden, so daß er sich im Sterben wild herumwälzt und sein Blut überall hin verspritzt, auf den Baumstamm, über den Platz hin und gegen die Waffen. Der Sanama, dem an diesem Tage natürlich die Arme nicht gebunden sind, betet dann: »Gib, daß wir im Kriege viele Sklaven machen. Gib, daß wir niemand verlieren. Gib, daß wir alle gesund bleiben. Gib, daß unsere Frauen Kinder erhalten. Gib, daß das Korn gute Ernte bringt!« Danach bereitet er von dem neuen Korn Essen. Er legt rundherum und klebt überall hin kleine Flocken des Breies und verspeist den Rest mit seinen Söhnen.
Wenn das Opfermahl beendet ist, ruft er die andern Männer herbei. Er nimmt eine jede Waffe, reicht sie seinem Besitzer und sagt: »Das ist dein!« »Das ist dein!« usw. Er verteilt alles. Damit ist die neue Zeit eingeleitet. Jeder kann nun von seinem Korn genießen, jeder sein Weib beschlafen und die Waffen gebrauchen.
Bricht nun eine Fehde aus, was in Anbetracht des Abschlusses des Landfriedens sehr wahrscheinlich ist, so hat er dem ausziehenden Volke eine Vorrichtung zu bereiten, die der allgemeinen Überzeugung nach den Waffen Glück bringen muß. Er geht hinaus auf den Kreuzweg (Djewandi). Dorthin legt er erst Katagablätter, darauf ein Kotgumji, das ist der Kopf eines Pilztermitenhaufens. Auf den legt er zwei Sandalen (Sumu), so daß eine kreuzweise über der andern liegt. Dann muß alles Kriegsvolk, einer nach dem andern, darüber hinwegschreiten. Sie ziehen in den Kampf. Der Sanama aber bleibt daheim.
Am Gudjobaum hat der Sanama aber im Notfalle noch folgende Zeremonie zu verrichten. Wenn kein Regen fällt und das Saatkorn in die Gefahr kommt zu vertrocknen, dann hat zunächst einmal jedermann den ganzen Tag über von der Farm fernzubleiben. Der Sanama aber bereitet zwei Schalen Kornmehl, mit denen begibt er sich dann abends zum Gudjobaume. Dort betet er: »Der Regen bleibt aus. Gib uns Regen. Alle Pflanzen vertrocknen. Wenn kein Regen kommt, werden wir nichts zu essen haben. Viele werden sterben. Gib uns also Regen!« So betet er lange, lange Zeit hintereinander fort. Nachher hebt er die Hände wie zum Empfange bereit, hoch auf, wie das die alten Griechen beim Gebet taten, und wendet auch das Antlitz gen Himmel. Gleichzeitig ruft er sehr laut und in hoher Stimmlage: »Huuu!« Die Bewohner des Gehöftes haben darauf gewartet. Wenn von draußen der Ruf des Priesters zu ihnen schallt, heben sie in gleicher Weise die Hände auf und rufen alle gemeinsam: »Hu!« Damit ist das Gebet um Regen beendet.
Die letzte Zeremonie, die, soweit ich erkunden konnte, der Sanama zu vollziehen hat, wird im Frühjahr vor der Saatzeit und einige Tage ehe die Leute die Farmarbeit beginnen, veranstaltet. Dann geht der Sanama mit einem roten Hahn (gudogun-rodi) und einer roten Grasart (Sab[e]a oder Schab[e]a) zu einem Kreuzwege. Auf dem Kreuzwege legt er das rote Gras hin. Dann tötet er den Hahn. Das Blut des Hahnes mischt er mit Sorghum, das er in einer kleinen Schale mitbrachte. Den Hahn legt er zunächst auf das Gras auf dem Kreuzwege nieder, und mit dem blutigen Korn begibt er sich auf seine Farm. In der Mitte seiner Farm macht er zwei schalenförmige Höhlungen, beide dicht nebeneinander. Er nimmt von dem blutigen Korn in jede Hand und kreuzt dann die Arme über den Höhlungen, so daß die linke Hand über der rechten und die rechte über der linken Höhlung ist. Er legt das Korn derart in die Erdausschalungen und betet dazu: »Ich bitte, daß dieses Jahr eine gute Ernte komme, daß keine Krankheit uns störe, daß alles gut gehe!« Nach diesem Gebet geht er heim. Er verrichtet das nur auf seiner eigenen Farm, auf keiner andern. Auf dem Heimweg nimmt er aber vom Kreuzweg den roten Hahn weg, der bis dahin auf dem roten Gras liegen geblieben war. Er nimmt ihn mit nach Hause. Dort röstet er ihn. Danach ruft er alle kleinen Knaben des Gehöftes zusammen, gibt jedem ein wenig von dem Hahn ab und sagt: »Ich bitte, daß alle Farm gut werde!« Dann ißt er selbst die eine Hälfte des Bratens, die Kinder die andere. – Von einer weiteren Zeremonie, die der Sanama zu vollziehen habe, hörte ich nichts.
Altersklasse, Brautstand, Ehe usw. – Die Mulgoi haben eigentlich keine Könige. Jede Familie lebt für sich und hat ein burgartiges Gehöft für sich. Wenn diese Genossenschaft nun mächtig genug ist, dann steht an ihrer Spitze ein sog. Marghi-mari, der hat eben Macht, soweit seine Macht reicht, nicht aber etwa nach der Tradition. Ihm folgt sein Bruder, und dessen Sache ist es zu versuchen, ob er sich die gleiche Stelle erhalten kann wie sein Vorgänger.
In dem so gebildeten Sippenumkreis spielt die Altersgenossenschaft keine große soziale Rolle. Nach Kanuriweise werden die Männer hier eingeteilt in: 1. Tataltiberini, das sind ganz kleine Kinder, 2. Tscholtscholi, das sind Kinder von drei bis vier Jahren, 3. Djero, das sind Beschnittene, 4. Patori, das sind Verheiratete, 5. Ndoti, das sind Alte, und 6. Kjari, das sind Greise. – Das ist muslimanisch. Bei den Kirdi ist es einfacher und infolge der Familienzusammenpressung und Mangels der Beschneidung nur noch wesentlich für die Frage der Kriegstüchtigkeit oder der Erbschaft. Ich kann die Einzelheiten nicht sagen. Der eigentümliche soziale Zustand aber, der diesen Heiden eigen ist, wird durch die Schilderung der Ehesitten am besten erläutert. Sie lassen an Eigenart nichts zu wünschen übrig.
Jugendfreundschaft wie bei den Kabre und Adamaua scheint man weder zu kennen noch anzustreben. Lange Liebelei liegt diesen tatkräftigen Menschen nicht. Man sieht sich. Man wird aufeinander aufmerksam. Man tastet – wenn es sich dann anfühlt wie Entgegenkommen, dann bespricht man sich. Man erklärt sein Einverständnis und verabredet Zeit und Stunde. Daran hält man sich dann. Der Bursche fängt das Mädchen am Wege ab und bringt sie in das Gehöft seines Vaters. Sobald der Vater der Braut das hört, kommt er selbst und erklärt höchst einfach: »Du hast mir meine Tochter weggenommen. Nun zahle!« Also bezahlt der Bursche oder vielmehr für ihn der Vater das »Geschenk«. Es besteht in zwei Töpfen Salz, zwei Ziegen, zehn runden Eisenkugeln (Dubull, das sind die Eisenkugeln, zu denen die Schmiede die Stücke Luppe zusammenschmieden, ehe sie sie auf den Markt bringen), und einem blauen Kleid (= Djambei).
Danach kommt als zweites nun eine Art Gefecht, der Kampf um die geraubte Braut hier genannt Luballa oder Luballa-perobe. Beide Familien treten einander mit Stöcken bewaffnet gegenüber, eiserne Waffen sind untersagt. Man beginnt mit Stöcken schonungslos aufeinander loszuschlagen. Es soll heftige Szenen und manche Wunde dabei setzen, denn die Sache wird durchaus ernst aufgefaßt. Gelingt es der Familie der Braut die andern zurückzudrängen, so müssen die das Mädchen wieder herausrücken, ohne daß sie aber den Kaufpreis zurückerhalten. Gelingt es dagegen der Familie des Bräutigams, das Schlachtfeld zu behaupten, dann bleibt die Braut da, wo sie augenblicklich ist. Der Bräutigam muß sich aber einer sehr eigenartigen Prozedur und Keuschheitsprobe unterziehen, fraglos eine der sinnreichsten und raffiniertesten, von der ich überhaupt je in diesen Dingen gehört habe.
Der Vater der Braut wird nämlich am nächsten Abend von seiner Gattin ausquartiert und mag sich für diese Nacht anderweitig ein Unterkommen suchen. Dafür lädt die Schwiegermutter den Räuber ihrer Tochter ein, für diese Nacht mit ihr das Schlafgemach zu teilen, und der Jüngling mag wollen oder nicht, er muß dieser Einladung, so schrecklich sie ihm auch sein mag, Folge leisten. In dieser Nacht nun versucht die Schwiegermutter an dem Liebhaber ihrer Tochter alles, »was sonst nur Frauen ihren Ehemännern zu tun pflegen«.
Das wirft aber ein merkwürdiges Licht auf die Züchtigkeit der Kanuridamen – nicht daß die um das Schicksal ihrer Tochter besorgte Mutter an ihren Schwiegersohn Standhaftigkeit und Gesundheitsuntersuchungen vornimmt, sondern wie sie das tut und daß dieses »wie« eben das ist, »was die Frauen ihren Ehemännern zu tun pflegen«. Man höre! Die Schwiegermutter legt den Schwiegersohn auf ihr Bett. Sie löscht das Licht aus, so daß nur noch wenig Beleuchtung den Raum erhellt. Sie hat einen Topf bereitstehen, in dem ist rote Farbe mit Öl gemischt. Sie beginnt dem lang Ausgestreckten nun die Oberschenkel streichelnd zu massieren. Sie gleitet mit den Fingern ein wenig über seinen Leib, um den Nabel herab. Dann streichelt sie sanft sein Glied. Sie drängt ihm die Oberschenkel auseinander und kitzelt ihm das Skrotum. Dann aber drängt sie sich gar neben ihn und bringt den ebenfalls geölten warmen Leib mit seiner Haut in Berührung. Sie murmelt ihm freundliche Sachen zu, wie: »Was bist du stark. Wie stark steht dein Glied! Wie gut wird es meine Tochter haben!« Das geht vom Abend bis zum Morgen, und zuletzt scheut sie sich nicht, mit dem Munde jene edleren Teile zu berühren!
Nun darf man nicht vergessen, daß der Versuchte ein Neger ist, der eben immer erregbar ist, und der nach meinen Erfahrungen die älteste und abgebrauchtetste Ware nicht scheut. Daß andrerseits diese Schwiegermutter noch nicht einmal dreißig Jahre alt zu sein, ergo gar nicht der Reize, die einen Negerleib erfreuen, bar zu sein braucht, daß sie vor allen Dingen aber, einmal auf den lüsternen Weg des Ehelebens getrieben, es jedenfalls, seit sie ihre Tochter gebar, zu außerordentlicher Geschicklichkeit in gewissen Dingen gebracht hat. Also glaube ich es meinen Berichterstattern gern, wenn sie sagen, daß viele Burschen den Versuchungen der Trmasdisitte (so heißt diese Versuchungsmaßnahme) anheimfallen und von der Schwiegermutter das unternähmen, was diese ihnen so nahe legt und was der Bräutigam doch eigentlich von der Tochter erwünscht. Sobald der Jüngling schwach wird und die Schwiegermutter beschläft, begleitet diese ihn am andern Tage unter Danksagungen hinaus, läßt den eigenen Gatten wieder seine Bettstatt beziehen und geht dann selbst hin, ihre Tochter wieder heimzuholen. Der junge Mann hat das Recht an sie verloren.
Verläßt der junge Mann aber als Sieger diese Höhle, so ist die Braut nach Sitte und Brauch rechtmäßig sein. Dann sendet die Mutter am andern Tage eine Botschaft an ihre geraubte Tochter, die lautet etwa: »Du hast einen guten Mann. Ich habe es die ganze Nacht versucht. Er aber hat mir nichts getan.« Sie sendet ihr außerdem Sorghummehl, Sesam (Marrasi, in Haussa Ridi) usw. Nachts erfolgt dann der Ehevollzug des jungen Paares. Der Beischlaf wird in allen Teilen Bornus angeblich in der Decklage ausgeführt. – Daß das Eheleben der Kanuri kein sehr keusches ist, war schon aus obigem zu ersehen. Bestätigt wird die Sache dadurch, daß die Kanuri ihre Frauen dazu erziehen, ihnen nach dem ersten Beischlafe in gleicher Nacht noch das zu tun, was die alten Römer nannten »einen gewissen Dienst« erweisen. Alle Kanurifrauen sollen ihre Lippen und Zunge zu diesem Verfahren hergeben, den Mund dann aber von der Beschmutzung durch die Spermen dadurch reinigen, daß der Gatte ihr andern Tages etwas Butter kauft, die Frau die Butter warm macht und damit den Mund ausspült. – Die Jungverheirateten bleiben vier Tage in ihrer Behausung und zeigen sich nicht. Wie mein Freund Bukkari sich ausdrückte: belehrt der junge Mann seine Frau in allem, was sie vorher nur von ihrer Mutter gehört hatte, was aber ihr Mann von der gleichen Frau gelernt hat. – Also von äthiopischer Züchtigkeit keine Spur. Inwieweit sich übrigens das alles sowohl in den Städten wie bei den Heiden des flachen Landes eingebürgert hat, ist schwer zu beurteilen. Die Ausdehnung der Sitte scheint aber schon weite Kreise gezogen zu haben. Sie ist libyschen Ursprungs.
Die Vermehrung geht in gleicher Weise vor sich wie bei den Äthiopen Adamauas. Die Wöchnerin sitzt im Hause auf einer umgekehrten Holzschale, zwei Frauen helfen. Die Nabelschnur (Dabudi) wird mit einem Rasiermesser flacher Form (Paga) abgeschnitten und die Nachgeburt (Kwakurra) im Hause begraben. Die Nabelschnur fällt bei Knaben nach drei Tagen, bei Mädchen nach vier Tagen ab und wird dann ebenda verscharrt, wo schon die Kwakurra liegt. –
Schmiede, Bestattung, Opfer. – Ehe wir nun der andern Seite des Lebens, dem Abschiednehmen, unser Augenmerk zuwenden, muß ich noch einige Worte über die Leute sagen, die daran hauptbeteiligt sind: die Schmiede.
Die Schmiede sind bei der heidnischen Landbevölkerung Bornus, soweit sie in der Richtung auf Adamaua zu wohnen, auf keinen Fall verachtet. Sie stehen als Kaste abseits. Wie die Verhältnisse aber dem tieferen Sinnwort nach liegen, das bezeugen uns folgende Sitten: Wenn irgendwo im Mulgoigebiet eine Gesellschaft zechender Männer sitzt und zufälligerweise ein Schmied vorbeikommt, da wird der Gastgeber jedesmal dem Schmied aus einer besonderen Schale einen Trank bieten. Und noch mehr: jeder Mann, der einen eigenen Acker hat, muß dem Schmiede nach jeder Ernte fünf Körbe ausgedroschenen Kornes schicken. Es wird ausdrücklich versichert, daß dies deswegen geschähe, weil man dem Schmied alles verdanke: von dem Messer, mit dem bei der Geburt der Nabel abgeschnitten wird, bis zur Schaufel, mit der die Farm bestellt und mit der das Grab ausgehoben wird, in dem der Schmied dann wieder dem Menschen die letzte Ruhestätte bereitet. Es ist also eine Anschauung, wie sie klipp und klar auch von den Mande ausgesprochen und sittengemäß durchgeführt wird. Es ist ein fundamentaler gleicher Wesenszug, den ich von Senegambien bis an das Kongobecken nachweisen konnte, und der von einer überraschenden Einheit in der Stellung zeugt. – Der Schmied heißt Kagelna. Der Zunftmeister der Schmiede Me(i)tramma. Dieses ist der, der die Bestattung überwacht.
Wenn der Mensch einer Krankheit (Kassua), die allgemein bekannt ist, verfällt, kann man ihn mit üblichen Medikamenten behandeln. Wenn er aber einer gewissen Starre, einem Delirium, der Bewußtlosigkeit verfällt, so nimmt man an, daß Vergiftung (Sirguma) vorläge oder daß ein »Karama« seine Hand im Spiele hat. Dann geht ein Familienmitglied zu einem Schmied, meist zum Zunftmeister, und der bringt dann dem Kranken eine Medizin bei. Der Erfolg ist, daß der Kranke auffährt und einen Namen nennt. Wenn das der Fall ist, dann weiß man, daß der Kranke dem Karama zum Opfer verfallen, dessen Namen er eben genannt hat.
Von dem Karama sagt man, daß er seine Kraft stets von Mutterseite, von der Familie der Mutter, nie vom Vater oder der Familie des Vaters ererbt, daß fernerhin sein ganzes Verfahren darin bestehe, daß er einem Mann oder einem Weib, das ihm gefällt, nachschaut und sagt: »Das ist ein hübscher Kerl!« Dann wäre der andere ihm sogleich verfallen und würde krank – heißt es bei den Mulgoi. Wir hätten es bei den Mulgoi nur mit dem »bösen Blick« zu tun, wie es bei den Kanuri wirklich echt und recht geglaubt wird, und zwar nach dem Rezept der Berber und Libyer, von denen der Karama ererbt ist. Die ältere Anschauung der Mulgoi, d. h. also der Vertreter des alten heidnischen Kanurivolkes, kann das aber nicht sein, und zwar kann ich das sogleich an zwei Symptomen belegen.
Zunächst also ist, wie oben erwähnt, vom Kranken der Karama genannt. Sogleich wird der Angeklagte zum Marghi-mari (König) oder Bulama (Bürgermeister, von Kuka aus früher eingesetzt oder bestätigt) gebracht. Der Zunftmeister der Schmiede muß ihm den Giftbecher (das Gift heißt hier Brongu) reichen. Wenn er das verweigert, erklärt er sich damit selbst als überführt. Dann verlangt man von ihm, daß er Wasser in den Mund nehme, diesen damit ausspülen und es wieder in eine Kalebasse rinnen lasse. Wenn der Kranke dann davon trinkt, wird er wieder genesen. Außerdem muß der Karama über sein Opfer hinwegschreiten. Danach aber wird der Karama getötet und seine ganze Familie verkauft.
Geht man nun trotz der auffallenden Symptome einer Erkrankung nicht zum Schmiede, bittet den um den Trank, der jenen veranlaßt in einer freien Minute den Namen des Karama zu nennen, so stirbt der Mann. Aber auch dann erfährt man noch Näheres über den Grund seines Todes. Nach dem Tode eines jeden Menschen muß der Schmied kommen und dem Leichnam Brust und Bauch aufschneiden. Aus dem Bilde, was sich zeigt, erkennt dann der Schmied, woran jener starb, ob an Krankheit, Vergiftung oder Verhexung durch einen Karama. Wenn nämlich ein Karama jenen getötet hat, so fließt kein Blut beim Schnitt. Der blutlose Schnitt beweist Einmischung der Karama und man geht sogleich zum Marghi-mari oder Bulama und bringt die Angelegenheit zur Anzeige. Das Oberhaupt kann nun allerdings nicht mehr feststellen, welche Persönlichkeit in der Runde die Schandtat vollbracht hat, kann also nicht mehr den Schuldigen durch den Tod für sein Verbrechen bestrafen. Wohl aber kann er mit Hilfe des Schmiedezunftmeisters alle Karama der Gegend feststellen und die werden dann, weil einer unter ihnen der Schuldige sein muß, aus dem Machtgebiet vertrieben.
In dieser Schilderung stehen an zwei Stellen die Belege dafür, daß die Mulgoi ursprünglich im bösen Blick nicht die alleinige oder auch nur entscheidende Kraft- und Genußform der bösen Menschen sahen. Einmal spricht das aus der Art und Weise, wie der Karama durch Wasserspülung aus seinem Munde in den Mund jenes die Lebenskraft zurückgibt, dann in dem blutlosen Schnitt. Beides beweist, daß die Mulgoi früher die Vorstellung von einer Art Subachen hatten, von Wesen, die das Blut oder Leben ihrer Opfer aussogen und jenen die so gestohlene Lebenskraft nur dadurch wieder geben konnten, daß sie aus ihrem eigenen »Ich« Speichel, Blut oder irgendeine Flüssigkeit in der primitiven Vorstellung einer »Transfusion« wieder in den zu Tode Geschwächten zurückleiteten.
Das Verfahren, dem die Mulgoi heute noch die Leichen ihrer Stammesglieder unterwerfen, beweist aber noch manches andere. Verfolgen wir aber erst die vollkommene Beisetzung der Verstorbenen,
Sobald ein Mensch gestorben ist, wird er erst gewaschen und dann führt der Schmied den eben geschilderten Schnitt aus, der nach vollkommen übereinstimmender Angabe nur den Zweck hat, festzustellen, woran jener starb. Danach wird ohne jede weitere Maßnahme der aufgeschnittene Leichnam wieder zugenäht und von oben bis unten mit roter Erdfarbe (Djiwa oder Tjiwa) eingeschmiert. Dann wird ein schwarzer Bulle geschlachtet. Der schwarze Bulle heißt Dalotjullum. Er muß aber unbedingt von der kleinen alten, früher auch in Marghi-Mulgoi weit verbreiteten buckellosen Rasse sein, die Bare heißt und durch das bei den Kanuri Pie genannte Buckelrind der Fulbe neuerdings fast ganz verdrängt ist. Der schwarze Bulle wird gehäutet. Die Leiche drückt man dann zusammen, so daß die Knie an die Brust kommen, also in peruanische Mumienstellung. Danach näht man den zusammengepreßten Toten in die frische Bullenhaut ein. Drei Tage verbringt der männliche, vier der weibliche Leichnam nach dem Tode noch auf der Erde, dann wird er in das Grab befördert.
Jede Sippe (Kanuri = Djirri; Fulbe = Lenjol; Haussa = Dengi) hat ihr eigenes Grab, Es besteht das zuweilen aus einer mächtigen Höhle, die man, nachdem man sich in einen verhältnismäßig engen Schacht in die Tiefe gearbeitet hat, durch Ausheben der Sohle im ganzen Umkreis geschaffen hat. Der Beschreibung nach hat der eigentliche Schacht bei großen und alten Gräbern einen Munddurchmesser von ca. 1,20–1,40 m. In dieser Weite führt er etwa 2–3 m tief hinab, dann erweitert er sich aber plötzlich trichterförmig zu einer Höhle, die einen Durchmesser von etwa 10 m bei etwa 2 m Höhe hat. Die Sohle dieser Höhle liegt also 4–7 m tief unter der Erdoberfläche. Dort hinab wird nun der Ballen mit der Leiche befördert, und zwar wird sie heute einfach hinabgeworfen. Sammelt sich unter dem Munde des Grabes die Fell- und Knochenmasse zu sehr an, so wird gelegentlich ein Schmied herabgesandt, der die alten Leichenteile zur Seite bringt und an den Rändern der Höhle verstaut.
Geschlossen wird der Grabmund zunächst durch eine mächtige Holzplanke aus festem Holz, diese rundherum mit Sorghumbrei bedeckt, damit die Termiten sich nicht ihrer bemächtigen. Über der Planke wird dann ein kleiner Erdhügel von etwa zwei Fuß Höhe aufgeworfen und dieser dann noch mit Sugugras, – das ist die Grasart, aus der man die hier Galla genannten Sekkomatten flicht – bepflanzt. Das Gras wächst jedes Jahr wieder hoch auf und an ihm erkennt man die Stelle, unter der das Grab liegt.
Nun meine ich, die Mulgoi, also die Äthiopen der alten Bornu, müßten vordem ihren Toten mehr Sorgfalt gewidmet haben. Ich schließe das nicht nur aus der doch teilweise offenbar mächtigen Art der Grabanlagen. Vor allem ist mir hier der Brustschnitt maßgebend, den der Schmied der Leiche beibringt, um die Todesart festzustellen und die heute ohne weiteres wieder zugenäht wird. Das wirkt dadurch wie ein Rest älterer Sitte. Man könnte meinen, daß ursprünglich die Leichen geöffnet, die Eingeweide herausgenommen und entweder am Feuer oder sonstwie mumifiziert oder einbalsamiert wurden. Dafür spricht auch, daß man heute noch die Leichen drei bis vier Tage außerhalb des Grabes läßt. Wir hatten also in der langen Kette der Völker, die vordem mumifizierten, ein neues Glied: Baja, Durru, Batta (?), Matafall, nun Mulgoi. Unsere Kenntnis der edleren und feineren Sitten des alten erythräischen Äthiopenreiches im Süden des Tschadsees gewinnt eine wesentliche Bereicherung.
An dem Grabe haben sie nur ein Opfer. Wenn nämlich die Zeit des Fastens abgeschlossen und einem jeden unter dem Gudjobaume vom Sanama die Waffe zurückgegeben ist, dann geht er mit einer Schale Mball (Bier) hinaus. Er betet um Ernte, Kriegsglück, Familienvermehrung, Jagderfolg und was ihm sonst auf dem Herzen liegt. Weitere Ahnenopfer oder gar spezielle Schädelverehrung sind hier nicht Sitte.
Auch die Ahnenweihe, die an jüngeren sterilen Weibern sonst am Ahnengrabe vorgenommen wird, fehlt im Sinne des Matriarchats und hat eine Form, die direkt als restierende matriarchalische bezeichnet werden muß. Sie geht folgendermaßen vor sich: Wie oben erörtert, ist die Ehe eine Raubehe, und es ist in Anbetracht der Enge des Wohnraumes und des entfernten Wohnens der Sippen selbstverständlich, daß jede Mutter ihre Tochter in einen andern Ort abziehen sieht, als den, in dem sie wohnt und demnach auch dem, aus dem sie selbst stammt. Wenn also eine Frau in A geboren ist, mag sie selbst in B verheiratet sein und ihre Tochter nach C abwandern sehen. Wenn nun die Tochter in C steril bleibt, so nimmt sie ein Küken und geht nach C, fordert ihre Tochter auf, ihr zu folgen und wandert mit ihr dann nach A. In A sucht die Frau die Stelle auf, an der sie selbst geboren ist. An der Stelle opfert sie das Küken und sagt: »Ich bin hier geboren. Hier hast du mich geboren. Hier ist meine Tochter, die nicht gebären kann. Hilf ihr, daß sie schwanger werde. Hier bringe ich also ein Küken.« Dann geht die junge Frau heim, darf sich aber auf dem Rückweg auf keinen Fall umsehen, sonst bleibt Opfer und Gebet unwirksam.
Ursprung der Zaubermittel. – Die Menschen erhielten alle Sanam (= magische Mittel und Zauberinstrumente) von den Jägern, den Karabina. Diese aber bekamen sie von ihrem Sallala (guten Freunde) auf folgende Weise:
Eines Tages ging ein Karabina (ein Jäger) in den Busch und legte eine Dumbull (d. i. eine Ringfalle). Dann ging er heim. Nachts fing sich darin eine Ngirri (Antilope, die bei den Haussa Barrewa heißt). Am andern Tage kam der Karabina wieder und wollte die Ngirri töten. Die Ngirri aber sagte: »Laß mich bitte frei. Ich habe daheim ein Kind. Ich bin ausgegangen, um etwas zu fressen, denn ich hatte für das Kind keine Milch. Nun aber habe ich Milch, laß mich also frei, daß ich nach Hause laufe und dem Kinde meine Milch geben kann. Morgen komme ich ganz bestimmt wieder!« Der Karabina sagte: »Dann laufe heim und gib deinem Kinde die Milch. Ich will sehen, ob du morgen wieder zurückkehrst.« Der Karabina ließ die Ngirri frei. Die Ngirri lief von dannen. Die Ngirri reichte ihrem Kinde die Milch, dann sagte die Ngirri: »Nun muß ich aber fortgehen, ich habe dem Karabina versprochen, wieder zu ihm zu kommen, wenn ich dir die Milch gegeben habe.« Die Ngirri lief fort. Sie kam zu dem Karabina und sagte: »Ich habe dir versprochen, zu dir zurückzukehren, hier bin ich.« Der Karabina sagte: »Du hast Wort gehalten. Nun will ich dich nicht töten. Nun sollst du mein Sallala sein!« Die Ngirri sagte: »Wenn ich dein Sallala sein soll, dann will ich dir alle Sanam sagen.« Darauf erzählte die Ngirri dem Karabina alle Sanam und alle Medikamente, die vorher nur die Ngirri kannte. – – –
Bei der Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, daß diese Legende nun von Semegambien bis zum Tschadsee nachgewiesen ist. Bei den Mande fand ich besonders reiche Angaben. Aber auch die Nupe und Haussa glauben, daß alle Zauber- und Heilmittel von einer Antilope (eine kleine, ziegengroße, rehfarbene mit spitzigen, geraden Hörnchen versehene Art; in Haussa Gade, in Nupe Ekoje) stamme und daß die Jäger (in Haussa Mahalbi, in Nupe Nardatsche) sie ihnen irgendwie abgelauscht oder abgenommen haben. Beide Völker glauben, daß diese Gada die klügste aller Antilopen sei und daß sie jeden Tag, ehe sie ihr Buschversteck verläßt, mit zwei großen flachen Früchten »boka« mache, also gewissermaßen das Orakel befrage, welchen Weg sie ungefährdet gehen könne und wo ihr Gefahren drohen. (Im Mossilegendarium muß, meine ich, auch etwas Ähnliches stehen.)
Weiterhin haben die Kanuri eine bestimmte Art, sich weiteres Jagdglück zu sichern, nachdem sie ein Tier erlegt haben. Sie wenden sie bei allen erlegten Tieren, zumal aber bei Büffel (= Ngarran) an. Sie stecken ihm nämlich Blätter vom Katagabaume in beide Nasenlöcher und legen ihm solche auch auf die Brust. Danach schneiden sie ihm nicht erst den Hals durch, wie die Islamiten, sondern sie öffnen den Leib da, wo das Herz liegt. Die Kirdikarabina – und es scheint, daß alle Karabina der Kanuri Kirdi sind – glauben, wenn sie dies nicht ausführen, daß sie dann an einem andern Tage kein Jagdglück haben werden. –
Die drei Locken des klugen Mannes. – Ein Maina (d. h. ein Mitglied einer Königsfamilie) wurde einmal vom König ausgewiesen. Der Maina sagte zu seinem Freunde: »Ich bin hinausgejagt von meinem Bruder. Ich muß die Gegend verlassen. Ich will in ein anderes Land gehen und eine neue Stadt aufbauen. Es werden dann andere Leute kommen. Du warst bisher mein Freund. Willst du nun mit mir das Land verlassen, mit in das andere Land kommen und mir helfen, eine neue Stadt zu bauen?« Der Freund sagte: »Es ist gut! Wir wollen zusammen in den Busch gehen. Ich bin dein Freund und kann dich nicht verlassen.« Der Maina und sein Freund verließen mit ihren Familien die Gegend. Der Maina hatte ein junges Mädchen geheiratet, die hatte kein Kind. Der Freund hatte eine Frau geheiratet, die hatte von ihrem ersten Manne schon einen Sohn und den brachte sie mit in die Ehe. Es waren alles in allem fünf Menschen, die verließen die Stadt und zogen in eine andere Gegend.
Dort baute der Maina eine neue Stadt. Zu den fünf Menschen kamen andere. Die Stadt wurde immer größer. Der Maina unternahm Kriegszüge. Er eroberte andere Städte. Der Maina wurde ein großer König. Der König hatte seinen alten Freund immer bei sich. Der Maina mochte seinen alten Freund aber nicht mehr leiden.
Der Freund hatte sich auf dem Kopfe drei Haarzöpfchen gespart. Den drei Haarzöpfchen hatte er Namen gegeben. Die Namen sagte er niemand. Der König fragte ihn: »Was ist es mit den drei Haarzöpfchen?« Der Freund sagte: »Die drei Haarzöpfchen haben Namen.« Der König sagte: »Welchen Namen haben sie?« Der Freund sagte: »Ich habe die Namen niemand gesagt; niemand weiß sie ohne mich.« Der König sagte: »Ich will sehen, ob ich die Namen der drei Haarzöpfchen nicht erfahre. Wenn ich sie weiß, kann ich dich dann töten?« Der Freund sagte: »Gewiß kannst du mich dann töten.«
Der König schickte den Freund in ein anderes Land mit einer Botschaft. Als der Freund fort war, rief er dessen Frau und sagte zu ihr: »Frau, du bist mit meinem Freunde verheiratet. Er ist nicht reich und kann dir nicht viel geben. Mein Freund hat auf dem Kopfe drei Haarzöpfchen, jedes hat seinen Namen. Wenn du sie erfährst und mir mitteilst, will ich meinen Freund verjagen und dich zu meiner Frau machen. Dann wirst du reich sein.« Die Frau sagte: »Ich will sehen, ob ich die Namen der drei Haare erfahren und sie dir mitteilen kann.« Dann ging die Frau wieder in das Haus ihres Mannes.
Nach einiger Zeit kam der Freund von der Reise wieder nach Hause. Als er zu seiner Frau kam, fand er sie weinend. Er fragte die Frau: »Meine Frau, was hast du?« Die Frau sagte: »Ach, laß mich.« Der Freund sagte: »So sag' mir doch, was du hast?« Die Frau sagte: »Du willst es ja doch nicht.« Der Freund ging fort. Die Frau weinte weiter. Am andern Tage sagte der Freund: »Du weinst immer. Was hast du?« Die Frau sagte: »Du kannst mich nicht leiden.« Der Freund sagte: »Was ist das? Was willst du?« Die Frau sagte: »Ich bin nun zwanzig Jahre mit dir verheiratet. Während der ganzen Zeit hast du die drei Haarlocken, sagst mir aber ihre Namen nicht. Du magst mich nicht!« Der Freund sagte: »Die Namen kann ich dir nicht sagen.« Der Freund ging. Die Frau weinte. Die Frau weinte drei Tage. Die Frau weinte weiter. Der Freund sagte: »Komm her, ich will dir also die drei Namen der Zöpfe auf meinem Kopfe sagen. Der Zopf hier vorne heißt: ›Niemand hat in seinem König einen wahren Freund.‹ Der zweite Zopf heißt: ›Niemand hat in einer Frau, die zum zweitenmal verheiratet ist, einen wahren Freund.‹ Der dritte Zopf heißt: ›Niemand hat in seinem Stiefsohn einen wahren Freund.‹ Nun weißt du die drei Namen. Nun behalte sie bei dir.« Die Frau sagte: »Ich danke dir.«
Als es nachts war, lief die Frau zum König und sagte: »Ich kenne die Namen der drei Zöpfe meines Mannes.« Der König sagte: »So sage sie mir.« Die Frau sagte: »Der vorderste Zopf heißt: ›Niemand hat in seinem König einen wahren Freund.‹ Der zweite Zopf heißt: ›Niemand hat in einer Frau, die zum zweitenmal geheiratet hat, einen wahren Freund.‹ Der dritte Zopf heißt: ›Niemand hat in seinem Stiefsohn einen wahren Freund.‹« Der König sagte: »Ich danke dir. Ich werde dich in kurzer Zeit belohnen.« Die Frau ging wieder nach Hause.
Am andern Morgen rüstete sich der Freund, den König zu begrüßen. Sein Stiefsohn war auf dem Felde. Sein Kleid lag da. Der Freund zog das Kleid seines Stiefsohnes über. (Eine im Sudan durchaus weit verbreitete Sitte, daß man die Kleider seiner Angehörigen gelegentlich leiht und trägt und verleiht.) Er ging dann zum König. Der König ließ trommeln. Er ließ alle Leute der Stadt zusammenrufen. Alle Leute der Stadt kamen. Der König sagte: »Hier ist mein Freund! Mein Freund hat drei Zöpfe auf seinem Kopfe. Jeder Zopf hat einen Namen. Mein Freund sagte mir, er wolle mir die Namen nicht nennen. Mein Freund sagte, ich könne meinen Freund töten, wenn ich die Namen erführe. Ist es so oder ist es nicht so?« Der Freund sagte: »Es ist so.«
Der König sagte: »Heute kann ich die Namen der drei Zöpfe sagen. Der vorderste Zopf heißt: ›Niemand hat in seinem König einen wahren Freund.‹ Der zweite Zopf heißt: ›Niemand hat in einer Frau, die zum zweitenmal verheiratet ist, einen wahren Freund!‹ Der dritte Zopf heißt: ›Niemand hat in seinem Stiefsohn einen wahren Freund.‹ Das sind die drei Namen. Ist es so oder ist es nicht so?« Der Freund sagte: »Es ist so.« Der König sagte: »So kann ich dich nun töten lassen?« Der Freund sagte: »Gewiß, nun kannst du mich töten lassen.«
Der König ließ seinen Freund fesseln und hinausführen. Viele Leute liefen hinterher und wollten sehen, wie der Freund getötet wird. Zu der Zeit kam der Stiefsohn des Freundes vom Felde. Er begegnete dem Zuge. Er fragte: »Was ist das? Was ist das?« Die Leute sagten: »Man bringt den Freund des Königs hinaus, um ihm den Kopf abzuschlagen.« Der Stiefsohn sagte: »Man will meinem Stiefvater den Kopf abschlagen. Mein Stiefvater hat aber mein bestes Kleid an. Mein bestes Kleid wird blutig und beschmutzt werden. Zieht meinem Stiefvater doch das Kleid aus und gebt es mir, ehe ihr ihm den Kopf abschlagt.«
Der Freund sagte: »Bringt mich noch einmal zurück zum König. Ich will ihn noch einmal sprechen, ehe ich sterbe.« Die Leute brachten ihn zum König. Der Stiefsohn lief voraus. Der Stiefsohn bat den König: »Mein Stiefvater hat heute mein bestes Kleid an! Du willst ihm den Kopf abschlagen lassen. Das Kleid wird blutig werden. Ich bitte dich, befiehl, daß man ihm erst das Kleid auszieht und dann den Kopf abschlägt.«
Der gefesselte Freund kam herein. Der gefesselte Freund sagte: »Hast du gehört, was mein Stiefsohn bittet?« Der König sagte: »Ich habe es gehört.« Der Freund sagte: »Ein wahrer Sohn und Freund würde nicht um das Kleid, sondern um das Leben bitten, ist es so oder ist es nicht so?« Der König sagte: »Es ist so.« Der Freund sagte: »Eine erste Frau würde als Freund nicht hingehen und dem König das Geheimnis ihres Mannes sagen, um selbst zu verdienen. Ist es so oder ist es nicht so?« Der König sagte: »Es ist so!« Der Freund sagte: »Ein König ist kein guter Freund, wenn er den Freund tötet, weil er die Wahrheit erkennt und spricht. Ist es so oder ist es nicht so?« Der König sagte: »Es ist so.«
Der Freund sagte: »Wenn es so ist, dann laß mich hinausführen und töten.« Der König sagte: »Nein, du sollst nicht getötet werden. Ich bitte dich, mein Freund zu bleiben.« Der Freund ward nicht getötet. – – –
Der Inhalt dieser Geschichte stimmt mit der Motivengeschichte von Surro Sanke der Mande überein (vgl. Atlantis Bd. VIII S. 88 ff.). Auch Fezzaner und Tunesier kannten diese Motive. Sie ist also wohl zum Bestand der jüngeren syrrtischen Kultur zu rechnen.
Schwiegermuttergeschichten. – Ein ganz merkwürdiges Interesse, das auf entsprechende Familienverhältnisse schließen läßt, scheinen die Kanuri für die Schwiegermutterprobleme zu haben. In den mancherlei Plaudereien, die ich dann und wann mit meinen Leuten pflegte, kamen diese Motive öfter vor. Zweimal notierte ich mir den an sich ziemlich flachen Inhalt der Geschichten.
Der ersten Geschichte nach gehen eines Tages ein Mann und seine Frau mit der Mutter des Mannes und der Mutter der Frau zusammen, also zu vieren durch den Busch. Sie wandern weit. Sie haben kein Wasser. Sie dursten. Der Mann sagt: »Ich will zur Seite in den Busch gehen und Wasser suchen.« Der Mann geht. Er findet einen alten Brunnen, der ganz tief unten Wasser hat. Der Mann ruft die Frauen herbei; er erklärte ihnen, daß es nur dann gelänge, von da unten Wasser heraufzubringen, wenn sie eine Kette bildeten, d. h. wenn einer immer den andern faßte. Das geschieht dann. Zuerst wird die Mutter der Frau herabgelassen. Die nachfolgende Mutter des Mannes hält ihren Fuß und wird dann ebenso gehalten vom Manne. Die Frau bleibt oben am Rande hocken und läßt ihren Mann hinab. Unten trinkt also zunächst die Mutter der Frau, die reicht auch Wasser nach oben, so daß alle trinken. Hernach soll die Kette wieder heraufgezogen werden. Dabei läßt die Mutter des Mannes die Mutter der Frau los. Diese stürzt hinab und ertrinkt. Die Frau hört dies oben und fragt: »Was ist da hineingefallen?« Der Mann antwortete: »Ich denke meine Mutter ist hineingefallen?« Die Frau dagegen: »Nein, meine Mutter ist hineingefallen. Wenn du nun nicht den Fuß deiner Mutter auch losläßt, so daß sie hinabfällt, so lasse ich deinen Fuß los und ihr ertrinkt dann alle beide.« Darauf läßt der Mann den Fuß seiner Mutter los, und diese stürzt zur andern Schwiegermutter herab und stirbt auch. Darauf gehen Mann und Weib wieder gemeinsam nach Hause.
Die andere, noch geistreichere Schwiegermutterlegende hat folgenden Inhalt: Ein Mann und eine Frau machen sich auf den Weg, der Mutter der Frau einen Besuch abzustatten und sie zu begrüßen. Sie treffen unterwegs Marguman (Vararus). Marguman sagt zu dem Manne: »Wenn du mich nicht tötest, wird deine Schwiegermutter sterben. Wenn du mich tötest, wird deine eigene Mutter sterben.« Der Mann sagte darauf zu seiner Frau: »Was meinst du? Marguman sagte zu mir, wenn ich ihn nicht töte, wird deine Mutter sterben. Wenn ich ihn aber töte, dann wird meine eigene Mutter sterben. Was meinst du nun: »Soll ich Marguman töten oder soll ich Marguman nicht töten?« Die Frau sagte darauf nichts. Beide, Mann und Frau, sagten eine Zeitlang gar nichts. Dann aber sagte der Mann: »Es ist doch besser, ich töte Marguman. Dann stirbt meine Mutter. Deine Mutter aber bleibt am Leben.« Darauf tötet der Mann also Marguman, zumal die Frau damit auch einverstanden ist. Sie setzten darauf den Weg zur Mutter der Frau nicht fort, sondern kehrten nach Hause zurück. Hier ist inzwischen die Mutter gestorben. – Die Mutter der Frau kommt aber selbst eines Tages, um ihren Gruß zu entbieten, um zu danken, daß man ihr Leben geschont hat. –