
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Das glaube ich Ihnen recht gern, und darum wollen wir in Berücksichtigung Ihres soeben ausgesprochenen Wunsches von etwas Anderem reden. Ist Ihnen vielleicht ein Mann bekannt, welcher Saltikoff hieß?«
»Nein,« antwortete der Graf, aus dessen Angesichte aber bei Steinbachs Frage die Farbe wich.
»Bitte, besinnen Sie sich!«
»Ich kenne den Namen Saltikoff gar nicht und weiß, daß jedes Besinnen vergeblich sein würde.«
»Vielleicht aber wäre es doch von Erfolg. Ich erlaube mir, Ihrem Gedächtnisse ein Wenig zu Hilfe zu kommen. Jener Saltikoff war ein Verbrecher –«
»Ein Verbrecher!« unterbrach ihn der Graf. »Sie meinen also, daß ich mit einem Verbrecher Umgang gepflogen habe?«
»Bisher ist von einem Umgange noch nicht die Rede gewesen. Ich habe nur gefragt, ob Sie ihn kennen. Auch der achtbarste Mann kann in die Lage kommen, einen Verbrecher kennen zu lernen. Da Sie aber selbst das Wort Umgang gebrauchen, so will ich mich desselben ebenso bedienen, denn es verlautet allerdings, daß Sie in sehr nahe Berührung oder sogar Beziehung zu ihm getreten seien.«
»Nicht, daß ich wüßte!«
»So! Man sagt, daß Sie sich seiner zur Erreichung gewisser Zwecke bedient haben sollen.«
»Das ist eine Lüge. Welche Zwecke sollen das sein?«
»Den Maharadscha von Nubrida zu stürzen.«
»Ist mir nicht eingefallen!«
»Hm! Man sagt, daß Sie dafür gesorgt haben, daß der Maharadscha für Saltikoff gehalten wurde.«
»Unmöglich!«
»O, diese Unmöglichkeit ist doch ausgeführt worden.«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Nun, Saltikoff war, wie bereits gesagt, ein Verbrecher und als solcher dem Strafgesetze verfallen. Der Maharadscha wurde während einer Pilgerreise über die Grenze gelockt und für Saltikoff ausgegeben.«
»Das ist ein Roman!«
»Nein. Es ist die Wirklichkeit!«
»Der Maharadscha hätte sich vertheidigt.«
»Dazu wurde ihm keine Zeit gelassen. Und welcher Mittel hätte er sich dabei bedienen sollen?«
»Es hätten ihm jedenfalls viele zu Gebote gestanden.«
»Keine! Er war arretirt worden und aller Beweismittel wohlweißlich beraubt worden.«
»So konnte er beschwören, wer er sei.«
»Dazu kam er nicht; es wurde vielmehr von dem bereits erwähnten Nena beschworen, daß er nicht der Maharadscha sei.«
»So wäre Nena zu bestrafen!«
»Allerdings. Aber dieser Nena soll eben nicht selbstständig gehandelt haben, sondern nur Ihr Werkzeug gewesen sein.«
»Das bestreite ich mit aller Kraft!«
»Der Maharadscha ist dann als Zobeljäger Nummer Fünf in die Urwälder gesteckt worden.«
»Das sind ja ganz wahnsinnige Behauptungen.«
»Die aber trotzdem auf Wirklichkeit beruhen. Sie sollen sich dann seiner Tochter bemächtigt haben.«
»Ich weiß von keiner Tochter Etwas.«
»Sie hat Semawa geheißen. Besinnen Sie sich!«
»Unsinn!«
»Wie kommt es denn, daß die Dame, deren Liebenswürdigkeit Sie rühmten, Gökala hieß? Das ist türkisch und heißt dasselbe wie das arabische Semawa, nämlich Himmelsblau?«
»Ein Zufall!«
»Hm! Das ist schon das zweite Mal, daß Sie von einem Zufalle zu sprechen belieben, Graf.«
»Es ist nichts Anderes. Es ist eine Verleumdung, mich zu dieser Sache in Beziehung zu bringen.«
»Ich halte es für kaum denkbar, daß Jemand sich selbst beleidigt und verleumdet.«
»Ich verstehe Sie wiederum nicht.«
»Sie selbst haben ja davon gesprochen, daß Sie der Schöpfer jenes Gedankens und seiner Ausführung seien.«
»Ich? Ich selbst?«
»Jawohl.«
»Zu wem sollte ich davon gesprochen haben?«
»Zu demselben Saltikoff, von welchem soeben jetzt zwischen uns die Rede gewesen ist.«
»Pah! Das ist eine Erfindung.«
»Es ist die Wirklichkeit, mein Herr.«
»Wann soll das geschehen sein?«
»Vor einigen Tagen.«
»Und wo?«
»In Platowa.«
»Da bin ich allerdings gewesen. Dann müßte aber auch Saltikoff sich dort befunden haben.«
»Natürlich!«
»Ich habe ihn weder früher gekannt noch während meines jetzigen Aufenthaltes in Platowa kennen gelernt.«
»O, er befindet sich seit langen Jahren da.«
»Davon weiß ich nichts!«
»Sie sind doch bei ihm abgestiegen!«
»Ich? Bei ihm? Wo denn?«
»Im Regierungsgebäude.«
»Da besuchte ich keinen Saltikoff, sondern den Kreishauptmann Rapnin und dessen Familie.«
»Sind Sie mit derselben befreundet?«
»Wenn nicht befreundet, so doch gut bekannt.«
»Dann werden Sie jedenfalls wissen, daß dieser Rapnin mit Saltikoff identisch ist.«
»Kein Wort!«
»Sie haben es doch zugegeben, gegen Rapnin selbst.«
»Eine Lüge!«
»O, ich weiß es sehr genau.«
»Wer hat das gesagt? Jedenfalls nicht Rapnin selbst.«
»Nein. Er wird es wohl auch eingestehen müssen, denn er und sein Sohn sind gefangen und befinden sich bereits nach Irkutsk unterwegs.«
Der Graf schrak sichtlich zusammen. Er ließ sich von seinem Schrecke hinreißen, zu fluchen:
»Donnerwetter! Wer hat ihn arretiren lassen?«
»Ich selbst,« lächelte Steinbach.
»Sie? Haben Sie das Recht dazu?«
»Allerdings.«
»In wiefern?«
»Davon später. Ich war von Rapnins Schuld überzeugt und habe ihn der Behörde übergeben.«
»Ich weiß von dieser Schuld nicht das Geringste!«
»Und haben doch mit ihm davon gesprochen!«
»Wer behauptet das?«
»Mein Gewährsmann.«
»Etwa derselbe dicke Kerl wie vorhin?«
»Ja.«
»So lügt er schauderhaft!«
»O bitte! Herr Barth lügt niemals.«
»Hier aber doch!«
»Er hat mir jedes Wort berichtet, welches Sie mit Rapnin und dessen Sohn gesprochen haben.«
»Angenommen, es sei wahr, wie könnte er eine solche Unterredung so genau wissen?«
»Er hat Sie belauscht.«
»Wo?«
»Im Keller.«
»Ich weiß von keinem Keller Etwas!«
»Pah! Haben Sie nicht dem Kreishauptmann eine gewisse Unterschrift zurückgekauft?«
»Nein.«
Trotz dieser Antwort aber machte der Graf eine Bewegung, als ob er sich zu schwach fühle, stehen zu bleiben.
»Sie leugnen, und das ist sehr natürlich,« sagte Steinbach kalt. »Haben Sie sich nicht auch nach einem Kosaken Nummer Zehn erkundigt?«
»Auch das ist nicht wahr.«
»Nun, Herr Barth hat sich im Keller befunden.«
»Dann müßte man ihn gesehen haben!«
»Er steckte hinter den Fässern.«
»Wie kam er hinein? Warum ging er hinab in den Keller? Er muß doch einen Grund gehabt haben!«
»Einfach den Grund, Sie zu belauschen.«
»Dann hätte er ja wissen müssen, daß wir da hinabkommen würden, Herr Steinbach.«
»Das hat er geahnt.«
»Unmöglich!«
»O bitte! Dieser kleine, dicke Mann ist klüger als mancher Andere. Er hat dann, als Sie den Keller verließen, eine gewisse Tasche leer gemacht.«
»Ah, ich ahne!« entfuhr es dem Grafen.
»Sie ahnen?« fragte Steinbach schnell. »Damit geben Sie nun freilich zu, daß Sie von –«
»Nichts, nichts gebe ich zu!« fiel der Graf schnell ein.
»O doch! Wenn Sie ahnen, was er genommen hat, müssen Sie wissen, was es zu nehmen gab.«
»Vermuthung!«
»Bitte, streiten wir uns nicht. Sie kennen also diesen früheren Verbrecher Saltikoff nicht?«
»Nein.«
»Auch den Maharadscha nicht?«
»Nein, auch nicht.«
»Und ebenso nicht den Indier Nena?«
»Nein, nein und zehnmal nein! Donnerwetter, ich sage es, und da muß es mir geglaubt werden!«
»Sprechen Sie von keinem Muß!« antwortete Steinbach in erhobenem Tone. »Es kann mir Niemand eine Lüge aufzwingen. Ich glaube, was mir beliebt. Und in dem vorliegenden Falle glaube ich eben nicht Ihnen, sondern den Anderen.«
»Welche Beleidigung!« fuhr der Graf auf.
»Wenn Sie sich davon beleidigt fühlen, daß ich Ihrem Leugnen keinen Glauben schenke, so müssen Sie mich für einen geistig nicht sehr hochbegabten Menschen halten. Man müßte geradezu Idiot sein, um annehmen zu können, daß Sie die Wahrheit sprechen.«
»Herrrrr – Steinbach!«
Er betonte bei diesem Ausruf den bürgerlichen Namen des vor ihm stehenden Deutschen.
»Pah!« antwortete dieser achselzuckend.
»Wissen Sie, wen Sie vor sich haben?«
»Sehr wohl.«
»Und ich weiß ebenso gut, wen ich vor mir habe.«
»Das glaube ich nicht!«
»Sie sind ein gewisser Steinbach!«
»So?« antwortete der Genannte lächelnd auf die verächtlich ausgesprochenen Worte des Grafen.
»Ja, also ein Mann – ein Mann – – nun ja, wie eben jeder Andere auch ein Mann ist.«
»Ganz recht. Es ist eine Ehre, ein Mann zu sein. Wenn ich Ihnen aber sage, daß ich Sie kenne, so spiele ich damit keineswegs auf Ihre Titel an.«
»Ah! Auf was denn sonst?«
»Auf Ihre Thaten!«
»Gegen welche Sie doch nichts haben werden!«
»Ich habe gegen sie so viel wie möglich, denn ich kenne sie. Also wir scheinen uns über einander nicht zu täuschen.«
»Sie sich über mich aber doch!«
»Vielleicht haben auch Sie von mir eine falsche Ansicht. Wollen sehen, ob Sie auch Andere so gut kennen, zum Beispiel diesen Mann!«
Er öffnete die Thür, und Nena trat herein. Er erkannte den Grafen augenblicklich, dieser aber nicht ihn, denn er fragte:
»Ob ich diesen kenne? Wer ist der Mensch?«
»Betrachten Sie ihn sich genau!«
»Das thue ich ja.«
»Und Sie erinnern sich wirklich nicht, ihn bereits einmal gesehen zu haben?«
»Nein.«
»Er ist der Indier, von dem ich sprach.«
»Ah, etwa Nena?«
»Ja.«
Er erschrak und sein Auge haftete mit ungewissem Blicke auf dem Indier. Die Augen des Letzteren aber glühten. Er trat auf den Grafen zu.
»Hallunke!« rief er. »Du willst mich nicht kennen! Das ist eine großartige Lüge.«
»Oho!« antwortete der Graf. »Was gehst Du mich an. Ich habe Dich niemals gesehen!«
»Lügner!«
»Beleidige mich nicht!« donnerte der Graf.
»Dich kann kein Mensch beleidigen. Du leugnest also, mich bereits einmal gesehen zu haben?«
»Ja.«
»Du lerntest mich nicht in Nubrida kennen?«
»Nein.«
»Verführtest mich dort zum Schlechten?«
»Nein.«
»Locktest den Maharadscha und Semawa über die Grenze und nahmst auch mich heimlich mit?«
»Nein.«
Diese Fragen wurden in immer steigendem Tone gesprochen. Die Antworten folgten darauf in augenblicklicher Schnelle, ein Nein immer lauter und zorniger als das andere.
»Hast mich nicht verführt, auszusagen, daß der Maharadscha nicht Maharadscha sei?«
»Nein.«
»Mich dann Jahre lang als Diener mit Dir in der Welt herumgenommen?«
»Auch nicht!«
»Und mich als Sclaven verkauft?«
»Das ist die großartigste Lüge, welche ich in meinem Leben gehört habe. Du bist ein Schwindler.«
»Und Du bist ein teuflischer Verbrecher, den Allahs Strafgericht ereilen wird.«
»Schweig!«
»Nein. Ich schweige nicht. Ich will sprechen. Ich will es in alle Welt hinausschreien, was Du für ein Satan bist.«
Da wendete sich der Graf an Steinbach:
»Wenn Sie keine andere und bessere Unterhaltung für mich haben, so gehe ich natürlich.«
Er wendete sich nach der Thür.
»Halt! Bleiben Sie!« antwortete Steinbach.
»Wozu?«
»Ich habe mit Ihnen zu sprechen.«
»Aber nicht ich mit Ihnen.«
»Darnach kann ich nicht fragen. Sie bleiben!«
Da wendete sich der Graf, welcher die Thür bereits erreicht hatte, zu ihm um und rief:
»Wollen Sie mir das etwa befehlen?«
»Ja.«
»Aus welcher Machtvollkommenheit?«
»Aus meiner eigenen.«
»Die erkenne ich nun freilich nicht an. Ich möchte wissen, welche Macht Sie besitzen könnten!«
»Wohl mehr als Sie!«
»Sie? Ein gewisser, sogenannter Steinbach?«
»Ja. Sie bleiben, wenn Sie sich nicht dem Falle aussetzen wollen, daß ich Sie zurückhalte.«
»Wollen sehen, ob Sie das wagen.«
Er warf Steinbach einen niederschmetternd sein sollenden Blick zu und öffnete die Thür. Draußen standen Jim und Tim.
»Macht Platz!« gebot er.
»Dir?« fragte Jim. »Bleib drin!«
»Macht Platz!« wiederholte er.
»Bleib nur drin!« antwortete Jim abermals.
»Wenn Ihr etwa meint, mich halten zu können, so habe ich ein sehr probates Mittel, Euch mir vom Leibe zu schaffen.«
Er zog den Revolver aus der Tasche.
»Solche Mittel haben wir auch.«
Bei diesen Worten glänzten auch ihm zwei Revolver entgegen, und zu gleicher Zeit schlug Jim ihm den seinigen aus der Hand.
»Alle Teufel!« schrie er auf. »Was wagt Ihr!«
»Gar nichts!«
»Das sollt Ihr mir entgelten!«
Er wollte sich bücken, um seine Waffe aufzuheben; aber Tim ergriff ihn beim Kragen, schleuderte ihn in die Stube zurück und lachte:
»Will es Dir entgelten! Esel, schrei nicht so dumm. Du wirst ja doch nur ausgelacht.«
Der Graf war zur Diele niedergestürzt. Er raffte sich schnell wieder auf und wollte Tim erfassen. Dieser aber schlug ihm die Thür vor der Nase zu und schob den Riegel vor.
»Donnerwetter!« brüllte der Graf. »Das wagt man mir zu thun. Dem Grafen Alexei Polikeff!«
»Ich habe es Ihnen gesagt!« lachte Steinbach. »Fügen Sie sich. Sie setzen sich sonst noch ganz anderen Unannehmlichkeiten aus.«
»Mensch! Kerl! Soll das eine Drohung sein?«
Da zog Steinbach die Brauen zusammen und antwortete ihm in drohendem Tone:
»Kommen Sie mir nicht so!«
»Oho! Ich verlange, hinausgelassen zu werden!«
»Und ich befehle Ihnen, zu bleiben.«
»Sie? Mir? Ein Lump will einem Graf – – –«
Er hielt inne, denn er bekam in demselben Augenblicke von Steinbach eine solche Ohrfeige, daß er zu Boden flog.
Vor Wuth und Schmerz taumelnd raffte er sich wieder auf und wollte Steinbach packen.
»Bleiben Sie mir fern!« antwortete dieser.
»Erwürgen, erwürgen will ich Dich!« knirschte der Graf, indem er die Fäuste ausstreckte.
Er bekam aber einen Hieb, der ihn bis an die Wand schleuderte, wo er stehen blieb, sich wohl sagend, daß gegen eine solche Körperkraft nicht aufzukommen sei.
»Rühre Dich nicht, Schurke!« gebot Steinbach. »Ich besitze noch ganz andere Mittel, mir Gehorsam zu verschaffen. Gestehest Du ein, daß Du Nena kennst, welcher hier steht?«
Der Graf antwortete nicht. Er blieb still. Er biß die Zähne zusammen.
»Ich werde Dich sprechen lehren!«
Bei diesen Worten zog Steinbach die Knute aus Nena's Gürtel und trat auf den Grafen zu.
»Kennst Du ihn?« fragte er abermals.
»Nein,« wurde nun doch geantwortet.
Da trat Steinbach an die Thür und klopfte.
»Kennst Du auch Den nicht?« fragte er.
Sam Barth ließ den Maharadscha ein.
»Donnerwetter!« rief der Graf. »Laßt mich in Ruhe und laßt mich hinaus. Was gehen mich die unbekannten Gesichter an!«
»Sie sind Dir nicht unbekannt!«
»Vollständig unbekannt. Ich werde mich beschweren, und Ihr erhaltet Eure Strafe!«
»Pah! Seid Jahren folge ich Ihnen nach, um Sie zu ergreifen. Heute nun, wo ich Sie endlich, endlich habe, halte ich Sie auch fest.«
»Wollen sehen!«
Er flammte Steinbach mit glühenden Augen an. Da trat der Maharadscha auf ihn zu und sagte:
»Graf Polikeff, Du willst wirklich behaupten, daß Du mich gar niemals gesehen habest?«
»Das behaupte ich!«
»Und mich gar nicht kennst?«
»Ja.«
»Du weißt nicht, daß ich der Maharadscha von Nubrida, dem indischen Reiche war?«
»Nein.«
»Und doch hast Du vorhin mit mir gesprochen.«
»Kein Wort!«
»Lügner!« donnerte der Maharadscha.
»Du selbst bist einer!«
Da schlug ihm der Fürst die Faust in das Gesicht.
»Freches Subject! Vorhin hast Du mir Deine Angebote gemacht, und jetzt leugnest Du es mir in das Gesicht!«
Der Graf fuhr mit beiden Händen nach seinen Wangen. Er zitterte vor Grimm; aber die Uebermacht war gegen ihn. Er mußte sich fügen.
»Ihr seid Alle wahnsinnig!« schrie er auf. »Aber man wird Euch schon zu kuriren wissen!«
Wie gern hätte er sich ganz anderer Ausdrücke bedient. Aber er sah es ja voraus, daß er dann noch mehr Ohrfeigen erhalten werde. Er befand sich in der Gewalt Derjenigen, die er so unendlich unglücklich gemacht hatte, und durfte auf keine Nachsicht rechnen.
»Wohl uns, wenn wir wahnsinnig gewesen wären,« antwortete der Maharadscha. »Dann hätten wir die Leiden weniger gefühlt, die wir Dir zu verdanken haben. Jetzt endlich ist die Stunde der Vergeltung gekommen. Nieder auf die Kniee mit Dir!«
Der Graf sah ihn starr an.
»Knie nieder!« wiederholte Maharadscha.
»Das könnte mir einfallen!«
»Ja, es wird Dir einfallen! Willst Du gehorchen, oder nicht?«
»Vor Dir niederknieen? Niemals!«
»So schlage ich Dich nieder!«
Er erhob die Faust.
»Wage es!« stieß der Graf hervor.
Aber in demselben Augenblicke stürzte er, von der Faust des Maharadscha getroffen, zu Boden.
»Himmel, heiliges Donnerw– –!«
Er kam mit seinem Fluche nicht zu Ende, denn der Maharadscha nahm Steinbach Nena's Knute aus der Hand und schlug damit in der Weise auf den Grafen ein, daß diesem alles Raisoniren verging.
Der also Gezüchtigte wußte sich keinen anderen Rath, als daß er sich auf die Knie erhob und bat:
»Halt auf! Du erschlägst mich ja!«
»Gut! Aber bleib knieen!« antwortete der Maharadscha, indem er die Knute fortlegte.
»Und jetzt gestehe es ein! Kennst Du mich?«
Der Graf zögerte mit der Antwort.
»Rede!«
Er griff abermals nach der Knute. Das veranlaßte den Grafen zu sprechen. Er antwortete:
»Ich habe es schon gesagt: Ich kenne Dich nicht.«
»Und hast mich, den Maharadscha Banda von Nubrida, niemals gekannt?«
»Nein.«
»So werde ich so lange an Dir herumschlagen, bis Du es gestehst.« Er ergriff die Knute wieder und holte aus.
Da ergriff Steinbach seinen Arm und sagte:
»Halt ein! Es ist nicht meine Absicht, ihm auf diese Art Folter ein Geständniß zu erpressen. Will er nicht gestehen, so haben wir genug Mittel, ihn zu überführen.«
Und sich an den Grafen wendend, fügte er hinzu:
»Jetzt frage ich Sie noch einmal, wo ist Gökala?«
»Ich weiß es nicht.«
»Haben Sie sie nicht mit nach Sibirien gebracht?«
»Nein.«
»Gökala ist aber Semawa?«
»Auch nicht.«
»Und Sie haben Semawa nie gekannt?«
»Bei allen Heiligen schwöre ich es, nein!«
»Nun, dann kennen Sie vielleicht diese hier.«
Er öffnete die Thür und Semawa trat ein.
Der Graf fuhr aus den Knieen empor. Das hatte er nicht erwartet. Er war überzeugt gewesen, daß sie sich in Platowa befinde.
»Gökala!« rief er aus.
Sie antwortete ihm nicht. Sie blickte ihn nicht einmal an. Sie ging zu Mila und Karparla und setzte sich zu ihnen.
»Nun, Graf,« lächelte Steinbach. »Halten Sie Ihr Leugnen vielleicht auch noch jetzt aufrecht?«
»Ich habe nichts zu leugnen.«
»Schön! Sie geben es also zu?«
»Nein, nein! Wenn ich nichts zu leugnen habe, so meine ich damit, daß ein Schuldiger leugnen kann, nicht aber ein Unschuldiger.«
»Aber Sie werden doch jetzt nicht die Stirn haben, zu behaupten, daß Sie Gökala nicht kennen.«
»Ja, die kenne ich freilich!«
»Also kennen Sie doch auch Semawa.«
»Nein.«
»Aber Beide sind doch eine und dieselbe Person!«
»Davon weiß ich nichts.«
»Gökala behauptet, daß Sie es wissen.«
»Sie lügt.«
»Schweigen Sie! Diese Dame lügt nie!«
»Aber wenn sie diese Behauptung ausspricht, lügt sie, so ist sie eine Schwindlerin!«
»Graf, wagen Sie es um Gotteswillen nicht, noch einmal ein solches Wort auszusprechen! Ich will Sie nicht körperlich züchtigen lassen. Das widerstrebt meinen Gefühlen und Ansichten. Aber wenn Sie Gökala beleidigen, so lasse ich Sie todtpeitschen!«
»Das dürfen Sie nicht wagen!«
»O, ich wage es.«
»Sie würden bestraft werden.«
»Von wem?«
»Das Gesetz würde diesen Mord rächen.«
»Ich brauche das Gesetz nicht zu fürchten.«
»So stehen Sie also außerhalb desselben?«
»Wo ich stehe, das geht Sie nichts an. Sie befinden sich endlich in meiner Gewalt, und nun werde ich thun, was mir beliebt und was ich für das Richtige halte. Sie können sich Ihre Lage nur durch ein Geständniß Ihrer Schuld verbessern. Wollen Sie dasselbe ablegen?«
»Ich habe nichts zu gestehen.«
»Gut! Nun beschweren Sie sich ja nicht, wenn ich alle Strenge gegen Sie in Anwendung bringe. Höre, Sam, komm herein!«
Der Dicke, welcher draußen gewartet hatte, kam.
»Schaffe den Grafen zu dem einstigen Derwisch in die Räucherkammer!«
»Oho!« rief der Graf. »Dagegen protestire ich.«
»Sie haben nichts zu protestiren!«
»Ich bin nicht vogelfrei!«
»O nein. Sie sind im Gegentheile mein Gefangener.«
»Das eben dulde ich nicht!«
»Was wollen Sie dagegen thun?«
»Alles, was ich vermag!«
»Nun, das wird wenig oder gar nichts sein.«
»Sie haben kein Recht, mich meiner Freiheit zu berauben!«
»Ich frage den Teufel nach Ihren Ansichten!«
»Sie sind keine Polizei!«
»Allerdings nicht.«
»Und auch kein Beauftragter derselben.«
»Auch das nicht.«
»So haben Sie sich nicht an mir zu vergreifen!«
»Ich thue es dennoch.«
»Dann sind Sie ein Räuber, ein – –!«
»Schweigen Sie, sonst lasse ich Sie dennoch durchhauen!«
»So muß ich mich einstweilen fügen: aber ich werde Sie zur Rechenschaft ziehen lassen!«
»Thun Sie das immerhin!«
»Meinen Sie etwa, daß man Sie nicht bestrafen könne, weil Sie ein Deutscher sind? So werden Sie – Ach, Gott sei Dank! Da kommt unerwartete Hilfe herbei!«
Sein Auge war durch das Fenster hinaus auf den Hof gefallen. Dort sah man den Major, welcher soeben vom Pferde sprang.
Sam hatte den Grafen beim Arme gepackt. Der Letztere riß sich los und wollte hinaus. Dort aber standen noch Jim und Tim an der Thür.
»Geh zurück!« rief der Erstere. »Ich habe Dir schon bewiesen, daß Du nicht durchkommst!«
Der Graf eilte zurück und an das Fenster, riß dasselbe auf und rief hinaus:
»Major! Herein, herein!«
»Was giebt es denn?« fragte der Officier.
»Ich brauche Hilfe, Hilfe.«
»Gegen wen?«
»Gegen Räuber, welche mich überfallen haben und gefangen fortführen wollen.«
»Scherz!« lachte der Major.
»Es ist Ernst, wirklicher Ernst!«
»Na, da bin ich doch neugierig:«
Er kam säbelrasselnd und sporrenklirrend herein geeilt, blickte sich um und erklärte:
»Ich hielt es für besser, Ihnen nachzufolgen. Die Bauern haben zuweilen harte Köpfe, und so hielt ich es für möglich, daß der Besitzer dieses Hofes sich weigern werde, die Pferde herzugeben.«
»Das hat er auch gethan.«
»Was! Du Hund willst die Pferde behalten?«
Diese zornige Frage war an den Dobronitsch gerichtet. Dieser antwortete furchtlos und ruhig:
»Ja, ich behalte sie.«
»Aber wir brauchen sie!«
»Das geht mich gar nichts an.«
»Schuft! Das muß Dich doch etwas angehen! Wir müssen sie haben!«
»Ich verkaufe sie nicht.«
»Wer spricht denn vom Verkaufen? Wir requiriren sie und nehmen sie mit. Wenn wir sie nicht mehr brauchen, so bringen wir sie Dir wieder.«
»Zunächst brauche ich sie selbst.«
»Das geht nun mich nichts an. Der Staat geht vor!«
»Nein; das Recht geht vor!«
»Mensch, was verstehst Du von einem Rechte? Der Kaiser ist das Recht, nach welchem ich handle.«
»Und das Recht, nach welchem ich handle, das bin ich selbst. Wer gegen dieses Recht verstößt, der hat es mit mir zu thun!«
Er sagte es in einem drohenden Tone, so daß der Major die Brauen emporzog und schnell fragte:
»Soll das eine Drohung sein?«
»Eine Warnung.«
»Für wen?«
»Für Jeden, der es unternehmen sollte, sich an meinem Eigenthume vergreifen zu wollen.«
»Das wäre ich?«
»Ich denke nicht, daß Du diese Absicht hast.«
»Und wenn ich sie doch habe?«
»So bist Du gewarnt.«
»Ah! Das wollte ich wissen! Du drohst mir also?«
»Nein. Ich wiederhole, daß ich nicht drohe, sondern nur warne. Man lasse mir mein Eigenthum!«
»Und ich werde mir die Pferde nehmen!«
»Ich werde mich dagegen wehren.«
»Wage es!«
»Sie sind mein Eigenthum, welches ich mir nicht nehmen lasse. Ich vertheidige es gegen jeden Raub.«
»Willst Du sagen, daß ich ein Räuber sei?«
»Wer sich an fremdem Eigenthum gegen alles Recht mit Gewalt vergreift, der ist ein Räuber.«
»Das ist mir noch nicht widerfahren!«
»So widerfährt es Dir jetzt.«
»Meinst Du, weil ich jetzt allein bin, könntest Du so auftreten? Ich werde fort reiten und mit einer ganzen Sotina von Kosaken zurückkommen!«
»Ich werde mich auch gegen sie vertheidigen.« »Ich schieße jeden nieder, der ein Pferd anrührt.«
»Das ist stark!«
»Siehst Du,« fiel jetzt der Graf ein, »so machen es die Bauern, wenn sie von diesen deutschen Hunden verhetzt werden.«
»Von welchen Deutschen?«
»Von dem Dicken da, welcher – –«
Er hielt inne. Er blickte sich nach Sam um und bemerkte, daß dieser verschwunden sei.
»Er ist fort,« sagte er.
»Wohin?« fragte der Major.
»Weiß es nicht. Aber er wird wiederkommen.«
»So werde ich ein ernstes Wort mit ihm reden. Doch sprachst Du nicht von mehreren Deutschen?«
»Ja. Ich meine auch noch diesen da, welcher mich gefangen nehmen lassen wollte.«
Er deutete auf Steinbach.
Dieser hatte gleich nach dem Eintritte des Majors Sam zu sich gewinkt und ihn gefragt:
»Du weißt also, daß der Kosak Nummer Zehn sich hier am Mückenflusse befindet?«
»Ja. Er ist hier versteckt.«
»Wo?«
»In einer verborgenen Höhle.«
»Und sodann dieser Boroda?«
»Ist bei ihm.«
»Kennst Du diese Höhle?«
»Ich weiß sie genau.
Das war natürlich sehr leise gefragt und beantwortet worden. Sie flüsterten noch einiges zusammen, wobei Sam Steinbach noch einige Erklärungen über Boroda gab; dann schlich sich der Dicke mit einem vor Freude leuchtenden Angesichte davon, wenige Augenblicke, bevor der Graf dann sein Verschwinden bemerkte.
Jetzt richtete der Letztere, wie bereits erwähnt, die Aufmerksamkeit des Majors auf Steinbach.
»Was?« fragte der Officier. »Gefangen nehmen lassen wollte er Dich? Warum denn?«
»Der Kerl hat ein Complott gegen mich geschmiedet.«
»Mit wem?«
»Mit diesen Kerls hier. Der Verbannte da will Maharadscha von Nubrida gewesen sein.«
»Diese Nummer Fünf? Welch ein Hirngespinst!«
»Ich soll ihn nach Sibirien gelockt haben.«
»Dem Kerl geben wir die Knute.«
»Und dieser Mensch hier ist ein Indier, welcher seinen Zeugen machen will.«
»Erhält auch die Knute!«
»Dieses Frauenzimmer behauptet gar, die Tochter des Ex-Maharadscha zu sein.«
»Die stecken wir ein.«
»Und nun dieser Mensch, der sich Steinbach nennt, ist der Anstifter des ganzen Planes.«
»Den peitschen wir, daß ihm die Haut in Fetzen von dem Leibe hängen soll!«
»Und endlich die beiden langen Kerls, welche dort an der Thür stehen, haben sogar mit Revolvern auf mich schießen wollen!«
»Also Mörder! Wir schießen sie krumm!«
Der Graf hatte auf jede Person, von welcher er sprach, mit der Hand gezeigt. Der Major hatte den Betreffenden angesehen und sodann augenblicklich sein Urtheil abgegeben.
»Einer der Hauptkerls ist soeben hinausgegangen,« fuhr der Graf fort. »Er wird aber, wie ich hoffe, bald zurückkommen.«
»So wird er seiner Strafe nicht entgehen.«
»Du siehst also ein, unter welcher Gesellschaft wir uns befinden. Dieses Haus ist eine Höhle, in welcher sie zusammenkommen.«
»Wie gut, daß wir das entdecken!«
»Ist es da ein Wunder, wenn Peter Dobronitsch sich öffentlich gegen Dich empört?«
»Nein, gar nicht. Aber er soll erfahren, was das zu bedeuten hat. Das ganze Volk, welches sich hier befindet, ist arretirt. Gehe schnell hinaus; reite nach der Stanitza und hole meine Kosaken. Ich werde hier bleiben, damit Keiner entkommt.«
Nichts kam dem Grafen gelegener als dieser Befehl. Er war natürlich ganz und gar überzeugt, daß der Major hier eine schlechte Rolle spielen werde; aber es war ihm darum zu thun, hinauszukommen. Darum wendete er sich jetzt schnell der Thüre zu. Aber da traf er auf Widerstand.
»Halt!« rief ihm Jim entgegen. »Du weißt ja, daß Du nicht fort darfst!«
»Hast Du nicht gehört, was der Major befahl?«
»Der hat nichts zu befehlen.«
»Hörst Du es?« fragte der Graf, sich zurück zu dem Major wendend.
Dieser Letztere trat zornig auf Jim zu und fragte ihn im drohendsten Tone:
»Was? Was hast Du jetzt gesagt?«
»Daß Du hier nichts zu befehlen hast.«
»Hund! So etwas wagst Du?«
»Da ist gar nichts zu wagen!«
»Weißt Du, daß ich Dich peitschen lassen werde, bis das Blut Dir in die Stiefel läuft?«
»Schön! Soll mir Spaß machen!«
»Jetzt lässest Du den Grafen hinaus!«
»Fällt mir nicht ein!«
»Ich gebiete es!«
»Geht mich nichts an! Hier hat ein ganz Anderer zu befehlen.«
»Wer denn?«
»Der dort.«
Er deutete auf Steinbach. Der Major trat auf diesen zu und sagte:
»Mensch, Du also bist der Anführer?«
»Wie Du hörst,« lächelte Steinbach.
»So wird Dich die stärkste Strafe treffen!«
»Wollen es abwarten.«
»Ich befehle Dir, sofort die beiden Kerls von der Thüre fort zu nehmen.«
»Das kann ich nicht thun.«
»Warum?«
»Sie sind dorthin postirt, um den Grafen an der Flucht zu verhindern.«
»Der braucht vor Niemandem zu fliehen.«
»Er will es aber thun. Ich habe ihn arretirt, weil er sich gegen die Ge– –«
Er konnte nicht weiter sprechen, weil er durch einen Ausruf des Majors unterbrochen wurde.
In diesem Augenblicke nämlich war Sam wieder eingetreten. Bei ihm befanden sich Boroda und der desertirte Kosak Nummer Zehn. Der Blick des Majors war auf den Letzteren gefallen.
»Nummer Zehn!« rief er.
»Das war ich,« antwortete Georg von Adlerhorst ruhig und ohne Zeichen der Angst.
»Das warst Du? Hund, das bist Du! Das bist Du noch! Oder denkst Du etwa, daß ich Dich nicht kenne?«
»Du kennst mich. Du hast mich ja einige Male in Platowa gesehen und auch mit mir gesprochen.«
»Du bist desertirt?«
»Ja.«
»Dein Oberlieutenant war da.«
»Auch das weiß ich.«
»Er hat Dich nicht gefunden. Nun aber bist Du zufälliger Weise hierher gekommen und in eine Falle gerathen, aus welcher Du nicht wieder entkommen wirst. Du wirst als Deserteur erschossen.«
»Aber nicht sogleich!« lächelte Georg.
»Sofort! Ich werde ein Kriegsgericht zusammentreten und Dich verurtheilen lassen.«
»So! Da mögen dann die Herren bedenken, daß ich nicht eingefangen worden bin.«
»Was denn? Ich fange Dich!«
»Nein. Ich kam freiwillig hierher.«
»Du? Freiwillig? Wirst Dich hüten!«
»O gewiß. Ich bin geholt worden.«
»Von wem?«
»Von diesem da.«
Er deutete auf Sam. Der Graf trat herbei und bemerkte gegen den Major:
»Das ist nämlich der dicke Kerl, welchen ich vermißte, auch ein Deutscher.«
»So! Schön! Wird auch die Knute bekommen. Also er soll die Nummer Zehn geholt haben! Aus welchem Grunde denn?«
»Es wurde mir befohlen,« antwortete Sam.
»Von wem?«
»Von Steinbach dort.«
»Der hat Dir gar nichts zu befehlen, ganz und gar nichts. Wer ist denn der andere Kerl?«
»Mein Neffe.«
»Was will er hier?«
»Steinbach hat befohlen, daß er kommen soll.«
»Donnerwetter!« schrie der Major. »Steinbach und immer wieder dieser Steinbach! Ihn soll der Teufel holen! Ich wiederhole, daß er hier gar nichts zu befehlen hat! Woher bringst Du denn diesen Deinen Neffen?«
»Aus dem Walde.«
Das Gesicht, welches Sam während dieses Verhöres machte, läßt sich gar nicht beschreiben. Es war so dumm und doch so pfiffig, so albern und doch so listig überlegen.
»Wie heißt denn dieser Kerl?«
»Alexius Boroda.«
Sam sprach diesen Namen im gleichgiltigsten Tone aus. Der Major aber fuhr um mehrere Schritte zurück.
»Kerl!« schrie er. »Ist's wahr?«
»Natürlich! Ich bin sein Oheim und muß ihn also kennen.«
»Und das sagst Du mir in solcher Ruhe?«
»Warum nicht? Soll ich etwa dabei mit den Beinen strampeln?«
»Aber kennst Du auch die Folgen?«
»Ja.«
»Wir suchen den Kerl! Wir brennen die Fanale und Feuerzeichen an! Wir alarmiren die ganze Grenze, um den Kerl zu erwischen! Und da kommt er in aller Gemüthlichkeit hier hereingetreten! Ist das menschenmöglich! Ein Deserteur, Nummer Zehn, und ein Aufrührer, Alexius Boroda! Welch ein Fang! So etwas scheint unmöglich zu sein, ist doch aber möglich, wie ich sehe. Kerl, Boroda, wo sind denn Deine Leute?«
»Fort.«
»Und Du allein bliebst da?«
»Ich ganz allein.«
»Wo sind Deine Eltern?«
»Die sind allerdings bei mir.«
»Herrlich, herrlich! Also auch die habe ich fest. Aber, Mensch, Du mußt doch ganz und gar verrückt sein! Warum bist Du denn nicht mit über die Grenze gegangen?«
»Mein Onkel wollte nicht.«
»So! Und ihm zu Liebe lässest Du Dich fangen! Welch eine riesige, riesige Dummheit! Du wirst natürlich von heut an nicht mehr wachsen, sondern ganz im Gegentheile in kurzer Zeit um einen Kopf kleiner sein.«
»Unten oder oben?« scherzte Sam.
»Schweig, Du dickes Vieh!« schnauzte der Major ihn an. »Natürlich oben, denn man wird ihn enthaupten. Uebrigens wird man mit dem ganzen Volke hier, mit Euch Allen, sehr kurzen Prozeß machen. Ihr werdet Alle sterben müssen, Alle, Alle!«
Er drehte sich im Kreise um und warf einem jeden Einzelnen einen triumphirenden Blick zu. Da sein Auge zuletzt auf Steinbach haften blieb, so meinte dieser:
»Hoffentlich aber stellt man mit uns ein ordentliches Verhör an, bevor man uns Alle enthauptet!«
»Verhör? Ist gar nicht nothwendig.«
»Nun, ich halte es für sehr nothwendig!«
»Schweig! Du wirst gar nicht gefragt! Das Verhör habe ja soeben ich hier abgehalten. Eure Schuld ist erwiesen, und nun wird Euch der Prozeß gemacht.«
»Und wie lautet das Urtheil?«
»Tod durch Kugel und Blei und auf dem Schaffot durch den Henker.«
»Wird man uns vielleicht vorher erlauben, zu apelliren?«
»Fällt Niemandem ein!«
»Oder ein Gnadengesuch an den Kaiser zu richten?«
»Ist nicht nöthig. Es hätte doch keinen Erfolg und würde über ein Jahr in Anspruch nehmen. So lange können wir Euch nicht füttern.«
Er merkte gar nicht, daß Steinbach nur ironisch zu ihm sprach. Jetzt aber machte der Letztere ein ernsthafteres Gesicht und sagte:
»Darein würde sich wohl Niemand fügen!«
»Was? Ihr müßt, Ihr müßt!«
»Fällt mir nicht ein! Lieber ergebe ich mich nicht.«
»Willst Du Dich etwa wehren?«
»Ja.«
»Das wage nicht. Ich würde Dich hier mit meiner Knute eines Bessern belehren!«
»Du? Pah! Von Dir kann man gar nichts lernen!«
»Hund!«
»Wenigstens nichts Gutes.«
»Schweig! Sonst haue ich Dich lahm!«
Er zog die Knute.
»Pah! Du wärest der Letzte, von dem ich mich schlagen ließe. Ein Offizier, der sich von einem einfachen Zobeljäger so an der Nase herumführen läßt wie Du, von dem ist nichts zu lernen!«
»Kerl, das soll Dein letztes Wort sein!«
Er holte aus. Aber Steinbach griff schnell zu und hielt ihm die Peitsche.
»Du!« warnte er. »Das kann ich nicht gut vertragen!«
»Was frage ich darnach, was Du vertragen kannst! Laß die Peitsche los!«
»Du hast hier nicht zu schlagen!«
»Nicht? Kerl, ich knute Dich, mag hier stehen, wer nur immer will!«
»Wenns nun ein Vorgesetzter von Dir wäre!«
»Da haue ich Dich erst recht!«
»Ein sehr hoher Vorgesetzter!«
»Der kann mir den Rücken hinauf kriechen. Ich fürchte mich vor dem Teufel nicht.«
»Also auch vor dem da nicht?«
Er warf schnell und gewandt den Oberrock ab und stand nun da in der Uniform eines Generallieutenants der russischen Gardekavallerie.
Der Major bewegte sich nicht. Er war ganz steif vor Schreck.
»Nun!« sagte Steinbach.
Der Major stieß einige Laute aus, deren Sinn nicht einmal errathen werden konnte.
»So knute doch!«
»Herr!« stammelte er.
»Bin ich nun noch der Anführer einer Räuberbande?«
»Verzeihung! Verzeihung! Excellenz!«
»Verzeihung? Davon wollen wir später sprechen. Ihre militärischen Eigenschaften gehen mich einstweilen nichts an; aber daß Sie sich von einem Schwindler und Verbrecher bethören lassen, das ist eigentlich unverzeihlich.«
»Schwindler?« fragte der Major kleinlaut.
»Ja doch!«
»Verbrecher? Wer sollte das sein?«
»Dieser Kerl hier, der Graf.«
Der Major blickte ganz rathlos von einem zum Andern. Der Graf aber war im wahrhaften Sinne des Wortes kreideweiß geworden. Es flimmerte ihm vor den Augen.
»Ein Verbrecher!« wiederholte der Offizier. »Unglaublich! Aber wenn Du es sagst, Excellenz, so ist es wahr.«
»Natürlich ist es wahr. Du hast seid gestern einige Dummheiten gemacht, welche Dir nur schwer vergeben werden können.«
»Excellenz, ich hoffe, daß Du nachsichtig sein wirst!«
»Wollen sehen. Vielleicht bin ich bereit, von den Vorkommnissen dieser Tage nichts gesehen und gehört zu haben.«
»Ich danke Dir! Die Hauptsache ist uns ja gelungen. Wir haben die Kerle.«
»Wir werden aber Beide wieder hergeben müssen, mein lieber Major.«
»Warum?«
»Weil sie begnadigt werden.«
»Von wem?«
»Vom Kaiser natürlich.«
»O, das dauert lange!«
»Nein. Das dauert fünf Minuten.«
»Unmöglich!«
»Und doch. Der Kaiser hat einige Blanco's gegeben, die ich nur auszufüllen brauche.«
Das riß den Major fast auf die Kniee nieder.
»Blanco's! Herr! Excellenz! Bist Du ein kaiserlicher Großfürst?«
»Nein,« lächelte Steinbach.
»Ein regierender Ausländer?«
»Still mit solchen Fragen!«
»Oder irgend ein Thronfolger? So etwas mußt Du sein, denn sonst hättest Du keine Blanco's erhalten. Du mußt gekommen sein in einer sehr wichtigen Angelegenheit, vielleicht einer hochwichtigen Untersuchung wegen.«
»Das hast Du ganz richtig errathen. Du sollst gleich sehen, welche wichtige Untersuchung und Angelegenheit es ist. Vorher aber wollen wir Kleineres ordnen.«
Er setzte sich in seiner brillanten, goldblitzenden Uniform an den Tisch und zog eine wohlgefüllte Brieftasche heraus. Der Bauer mußte ihm Tinte und Feder bringen, worauf er zwei große, bereits unterzeichnete und mit dem kaiserlichen Siegel versehene Formulare herausnahm, sie auseinander faltete und dann auszufüllen begann. Dann, als er fertig war, sagte er laut, so daß Alle es hören konnten:
»Zunächst habe ich Dir, Major, als hiesigen Oberstcommandirenden mitzutheilen, daß Seine Majestät geruht hat, den ehemaligen Hauptmann Georg von Adlerhorst, welcher als Nummer Zehn hier vor Dir steht, als unschuldig verurtheilt zu befinden. Aus diesem Grunde soll er augenblicklich entlassen und mit den nöthigen, reichlichen Mitteln versehen werden, um standesgemäß die Heimreise antreten zu können. Er wird als Oberstlieutenant verabschiedet und pensionirt werden, wobei ihm das auf die Jahre seines hiesigen Aufenthaltes rückständige Gehalt dieser hohen, militärischen Charge ausgezahlt wird. Hier ist der kaiserliche Ukas.«
Er gab dem Major das Schriftstück hin. Dieser las es durch, machte ein Zeichen demüthigen Erstaunens und gab es dann dem einstigen Kosaken Nummer Zehn.
»Hier hast Du den kaiserlichen Befehl,« sagte er. »Du bist von diesem Augenblicke an ein freier Mann.«
Georg von Adlerhorst überflog mit leuchtenden Augen die Zeilen, drückte das Dokument voller Wonne an sein Herz und stürzte auf Steinbach zu, um demselben zu danken.
»Lassen Sie, lieber Freund!« sagte derselbe abwehrend. »Sprechen wir später davon.«
Da kam Karparla herbei geeilt.
»Ists wahr? Ists wahr?« rief sie voller Entzücken aus. »Du bist frei, ganz frei?«
»Ja, vollständig frei,« antwortete er jubelnd.
»Dank, Dank sei dem Kaiser, der Dich begnadigt hat!«
»Begnadigt? O nein! Hast Du es denn nicht vernommen? Ich bin nicht begnadigt. Eine Begnadigung hätte ich abgewiesen. Nur der wirklich Schuldige kann begnadigt werden. Ich aber bin unschuldig. Und hier steht es ja auch Schwarz auf Weiß, daß der Kaiser mich als unschuldig verurtheilt befunden hat. Meine Ehre ist wieder hergestellt, und ich bin nicht nur in meine frühere dienstliche Stellung eingesetzt, sondern sogar zum Oberstlieutenant avancirt und werde die Pension dieser Charge erhalten und den Betrag, der während meiner Verbannung verflossenen Zeit dazu. Welch ein Glück!«
»Ja, welch ein Glück!« stimmte sie bei, die Arme um ihn schlingend. »Nun brauchst Du wohl auch nicht von hier zu entfliehen?«
»Nein. Das habe ich nun nicht nothwendig.«
»Kannst offen und ohne Scheu hier bleiben?«
»Hier bleiben oder abreisen,« nickte er ihr zu. »Ganz wie es mir beliebt. Ich bin nicht mehr vogelfrei.«
»Nicht abreisen! Du mußt bei uns bleiben!«
»Das mag ich denn doch nicht thun.«
»Warum nicht? Gelten wir Dir denn nichts?«
Steinbach ahnte, daß eine Weiterführung dieses Gespräches zu augenblicklichen Differenzen führen werde. Darum unterbrach er dasselbe:
»Davon wollen wir später sprechen. Jetzt habe ich hier den zweiten Ukas und bitte, von dem Inhalte desselben Notiz zu nehmen.«
Er gab das Dokument dem Major. Dieser las es aufmerksam durch und verkündete dann:
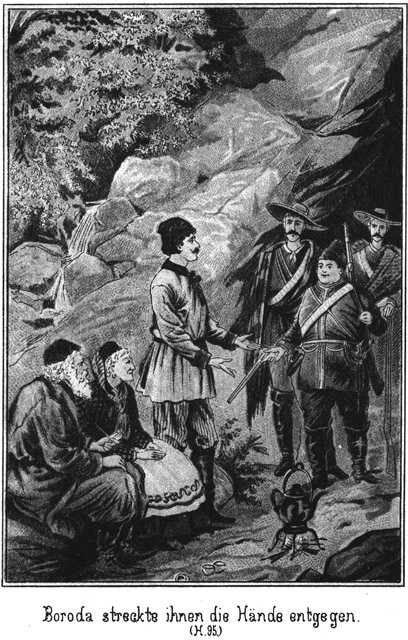
»Der geborene Deutsche und später naturalisirte russische Unterthan Karl Boroda, welcher zu lebenslänglicher Deportation verurtheilt wurde, ist sofort frei zu lassen und mit den nöthigen Mitteln zu versehen, um in die Heimath gelangen zu können. Sein confiscirtes Besitzthum ist ihm dort zurück zu erstatten sammt den Zinsen, welche es getragen hätte, wenn die Nutzniesung ihm verblieben wäre. Diese Zinsen sind bis auf acht Prozent auf das Jahr zu berechnen. Sollte dieser Karl Boroda einen Fluchtversuch unternommen haben, so ist ihm und allen Personen, welche ihm dabei halfen, die darauf ruhende Strafe zu erlassen und Alles, was sich dabei begeben haben könnte, als völlig ungeschehen zu betrachten.«
Ein lauter Freudenruf erscholl. Boroda hatte ihn ausgestoßen. Der Major gab ihm das Papier.
»Mann, Du hast ein großes Glück!« sagte er. »Nicht nur ist Dein Vater begnadigt, sondern Du selbst entgehst der Strafe. Danke es dem großen Zaren!«
»Dem Zaren? Nein, nicht ihm, sondern diesem Herrn da habe ich zu danken, keinem Andern.«
Er eilte auf Steinbach zu.
»Lassen Sie das!« wehrte dieser auch jetzt wieder ab. »Es freut mich herzlich, den Verwandten meines braven Sam Barth diesen kleinen Dienst erweisen zu können.«
Da geschah dasselbe, was vorhin bei Georg von Adlerhorst geschehen war: Auch Boroda wurde von weichen Armen umschlungen. Mila konnte dem freudigen Drange ihres Herzens nicht widerstehen. Sie kam zu dem Geliebten herbei, umfaßte ihn und rief:
»Alexius, Du bist frei! Welch eine große Ueberraschung! Nun brauchst Du Dich mit Deinen Eltern nicht mehr zu verstecken.«
»Nein,« jubelte er. »Das habe ich nicht mehr nöthig. Niemand darf mir mehr Etwas thun.«
»Du kannst nun offen bei uns bleiben und brauchst nicht heimlich nach Deutschland zu entfliehen.«
»Ja, aber nach Deutschland gehe ich doch!«
»Wirklich? Willst Du nicht in Rußland bleiben?«
»Nein. Ich habe hier zu viele schlimme Erfahrungen gemacht. Nun aber will ich vor allen Dingen zu den Eltern. Ihnen muß ich diese Botschaft bringen.«
Er wollte fort. Da aber vertrat der Major ihm sehr rasch den Weg zur Thür und fragte:
»Zu Deinen Eltern willst Du? Sind sie denn etwa hier?«
»Ja,« lachte Boroda.
»Wo sind sie denn?«
»Das ist ein Geheimniß.«
»Aber Du darfst es doch nun verrathen.«
»Werde mich hüten!«
»Es tritt ja keine Strafe ein!«
»Das ist freilich wahr; aber dennoch ist es besser, wenn ich die Sache ganz für mich behalte.«
»Sind sie denn auf Dobronitschs Besitzung?«
»Hm! Nein.«
Das war eine Unwahrheit, zu der er gezwungen war, um dem Bauer nicht zu schaden.
»Aber in der Nähe der Stanitza?«
»Ziemlich nahe.«
»Verflucht! Da geht bei uns Alles drunter und drüber; wir halten eine ganze, ewig lange Nacht am Flusse, um die Boroda's zu fangen; wir plagen und hetzen uns vergeblich ab, und nun erfahre ich, daß diese Leute sich ganz wohl und in Sicherheit befinden! Das ist doch, um sich todt zu ärgern!«
»Hoffentlich stirbst Du nicht daran,« antwortete Boroda, indem er herzlich lachte.
»Lache nicht! Ich werde es doch heraus bekommen, wo Deine Eltern sich versteckt haben.«
»Wie willst Du das anfangen?«
»Es ist sehr leicht. Ich brauche ja nur jetzt mit Dir zu gehen, wenn Du sie holst.«
»Werde ich Dich aber mitnehmen?«
»Darnach wirst Du gar nicht gefragt.«
»Nun, so versuche es einmal!«
Er schob den Major zur Seite und huschte zur Thür hinaus, dieselbe von draußen schnell verschließend.
»Alle Teufel!« rief der Offizier, welcher vergeblich an der Klinke herumdrückte. »Da bin ich nun als Gefangener eingeschlossen!«
»Wir ebenso,« meinte Steinbach lächelnd. »Sie sehen, daß mit Boroda nicht zu spaßen ist. Lassen Sie ihn laufen! Es hat ja nun kein Interesse mehr für uns, zu wissen, wo seine Eltern versteckt sind.«
»O, sogar ein sehr bedeutendes Interesse!«
»Sie sind ja doch begnadigt!«
»Aber jedenfalls befinden sie sich an einem Orte, welcher von den Flüchtlingen oft als Versteck benutzt wird.«
»Vielleicht zeigen sie es uns, wenn sie nachher kommen. Wir haben jetzt noch Nothwendigeres zu thun.«
»Etwa noch eine Begnadigung?«
»Nein, sondern etwas Anderes.«
Er ging zur Thür und klopfte. Sie wurde von Jim geöffnet, und Steinbach befahl, den einstigen Derwisch herein zu bringen. Dann wandte er sich an Georg:
»Herr von Adlerhorst, Sie werden jetzt einen Mann zu sehen bekommen, in Beziehung dessen es mir von großem Interesse ist, ob Sie ihn erkennen.«
»Wer ist es?« fragte Georg.
»Das will ich jetzt noch verschweigen. Sehen Sie sich ihn einmal recht genau an!«
Der frühere Kammerdiener der Familie Adlerhorst wurde gebracht. Als er die Anwesenden erblickte, erschrack er zusehends. Sie machten alle so feierliche, ernste Gesichter. Es war klar, daß hier etwas für ihn Unheimliches im Anzuge war.
Jim und Tim traten mit ein. Diese Beiden und Sam stellten sich so, daß es für ihn eine Unmöglichkeit war, durch die Thür zu entkommen.
»Ich habe Dich zu fragen, ob Du noch immer dabei bleibst, der Kaufmann Peter Lomonow aus Orenburg zu sein.«
Steinbach sprach diese Worte im strengsten Tone. Der Umstand, daß der Sprecher die Uniform eines der höchsten Offiziere trug, vermehrte die Bangigkeit des Verbrechers. Dennoch antwortete er leugnend:
»Ich bin Lomonow.«
»Warst Du in Amerika?«
»Nein.«
»Auch nicht in Konstantinopel und Tunis?«
»Auch nicht.«
»Und hast Du Dich nicht vorher im Dienste einer deutschen Familie befunden?«
»Nein.«
»Lüge, das ist Lüge!« rief da Georg von Adlerhorst. »Es sind seit jener Zeit viele Jahre vergangen, aber ich kenne ihn doch gleich wieder.«
»So! Wer ist er denn?«
»Er ist Florin, unser früherer Kammerdiener, ein geborener Franzose. Sein Gesicht ist gar nicht zu vergessen, wenn man es einmal gesehen hat.«
Florin erschrack, als er diese Worte hörte. Er starrte den Sprecher an, und es war zu bemerken, daß er ihn erkannte. Natürlich aber hütete er sich sehr, dies durch irgend ein Wort zu verrathen.
»Nun, fragte ihn Steinbach, »was sagst Du dazu?«
»Der Mann täuscht sich,« antwortete er.
»Erkennst Du ihn nicht?«
»Nein.«
»Oho! Er hat mich ja auch erkannt. Das war ihm anzusehen!« sagte Georg.
»Erkannt?« fragte Florin. »Ich habe Dich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen.«
»Das ist Lüge!«
»Ich habe auch den Namen einer Familie Adlerhorst noch nie gehört.«
»Aber in Deutschland warest Du?« fragte ihn Steinbach, indem er eine unbefangene Miene zeigte.
»Auch nicht.«
»Sonderbar! Du leugnest Alles ab. Und doch bin auch ich selbst ein Zeuge gegen Dich. Ich kenne Dich.«
»Ich Dich nicht!« behauptete Florin.
»Du hast mich mehrere Male gesehen.«
»Nicht ein einziges Mal!«
»Das ist nun freilich eine große und offenbare Lüge. Du warst in Amerika und nanntest Dich dort Bill Newton.«
Florin, welcher sein Heil im strengen Leugnen suchte, antwortete in verbissenem Ingrimm:
»Wenn Du von Lügen redest, so bin nicht ich, der sie macht. Es ist vielmehr Deine Behauptung eine große Lüge!«
»Höre, so darfst Du mir freilich nicht kommen. Wenn Du es noch einmal wagen solltest, mich auf diese Art und Weise zu beleidigen, so lasse ich Dich peitschen. Merke Dir das!«
»Hast Du das Recht dazu?«
»Ja. Ich befinde mich in einer sehr amtlichen Eigenschaft hier.«
»Beweise es!«
»Wünsche das ja nicht, denn ich würde es Dir durch die Knute beweisen. Befandest Du Dich nicht drüben im Staate New-Mexiko?«
»Nein.«
»Mit zwei sehr hübschen Burschen, welche Walker und Leflor hießen?«
»Nein.«
»Dann gingt Ihr nach dem Thale des Todes, aus welchem es Dir leider gelang, zu entweichen?«
»Davon weiß ich kein Wort.«
»Und vorher befandest Du Dich in Konstantinopel, wo Du den Pascha Ibrahim kanntest?«
»Ich habe ihn gar nicht gesehen.«
Bisher war die Unterredung in russischer Sprache geführt worden. Jetzt aber fragte Steinbach plötzlich in deutscher Sprache:
»Hast Du nicht dort zwei Fremde gesehen, welche Freunde waren und Wallert und Normann hießen?«
Diese Frage war der vorhergehenden Antwort so schnell gefolgt und in einem so gleichgiltigen Tone gesprochen, daß es Florin gar nicht auffiel, daß Steinbach jetzt plötzlich deutsch sprach. Er antwortete in derselben Sprache:
»Ich habe mich dort nie um Fremde gekümmert.«
»Sie waren Deutsche!«
»Das ist mir sehr gleichgiltig.«
»Schön! Aber dieselbe Gleichgiltigkeit hat Dich in die Falle geführt, welche ich Dir gestellt habe.«
»Ich soll mich in einer Falle befinden?«
»Ja. Erst leugnetest Du, in Konstantinopel gewesen zu sein. Dann sagst Du, daß Du Dich dort nie um Fremde gekümmert habest.«
»Ich sehe nichts von einer Falle!«
»Wenn Du von »dort« sprichst, mußt Du doch dort gewesen sein; das ist sehr einleuchtend.«
»Ich habe mich eines falschen Ausdruckes bedient.«
»So! Alsdann leugnetest Du, in Deutschland gewesen zu sein, und jetzt sprichst Du ein recht fließendes Deutsch.«
»Das habe ich im Auslande kennen gelernt.«
»Im Auslande pflegt man es nicht so richtig und fließend sprechen zu lernen.«
»Ich lernte es von geborenen Deutschen.«
*