
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Ausrede! Auf diese Weise entkommst Du mir freilich nicht. Hier befinden sich fünf Zeugen, welche Dich entweder in Amerika oder der Türkei gesehen haben und es beschwören werden, daß Du Florin, Bill Newton und der Derwisch Osman warst. Außerdem hat Dich Graf Polikeff auch gekannt. Er wird das jetzt zwar leugnen; aber es giebt Mittel, ihn zum Sprechen zu bringen. Du bist angeklagt, in Verbindung mit Ibrahim Pascha ein entsetzliches Verbrechen an der Familie Adlerhorst begangen zu haben. Man wird die Untersuchung gegen Dich einleiten.«
»Dagegen protestire ich!«
»Das hilft Dir gar nichts.«
»Ich kenne ja diese Familie nicht!«
»Man wird Dir beweisen, daß Du sie kennst. Es ist an Rußland, wo Du Dich jetzt befindest, das Ersuchen gegangen, Dich auszuliefern, und die Behörde wird diesem Wunsche entsprechen.«
»Das dulde ich nicht! Ich bin russischer Bürger!«
»Das bezweifle ich. Du wirst als mein Gefangener mit mir reisen.«
»Das fällt mir nicht ein!«
»Rede nicht so dumm! Was willst Du dagegen thun?«
»Ich wehre mich!«
»Beim geringsten Versuche des Widerstandes wirst Du gepeitscht, so daß Du sehr gern gefügig sein wirst.«
»Ich kann aber beweisen, daß ich wirklich Peter Lomonow aus Orenburg bin!«
»Womit?«
»Mit den Papieren, welche ich bei mir habe. Ich werde sie Dir vorlegen.«
Florin gab ihm die Legitimationen. Steinbach sah sie genau durch und meinte sodann:
»Es scheint, als ob weder das Alter noch das Signalement genau passe. Die Papiere sind vielleicht auf unrechtmäßige Weise in Deine Hände gekommen. Wir werden übrigens auf unserer Reise Orenburg berühren. Da wird es sich finden, ob Du der legale Besitzer derselben bist.«
Florin erschrak. Doch nahm er sich zusammen.
»Ich erkläre, daß man mich vergewaltigt. Ich kann nur durch die Polizei arretirt werden!«
»Die Polizei, das bin ich! Wir befinden uns hier im Grenzbezirk, in welchem selbst die Civilverhältnisse der Militärbehörde unterstehen. Und übrigens ist es mir sehr gleichgiltig, was Du denkst und sagst. Ich handle nach meinem Ermessen und warne Dich, Dich ja nicht gegen dasselbe aufzulehnen. Es würde Dir das jedenfalls sehr schlecht bekommen.
Florin warf einen wilden Blick umher.
»So bin ich also Dein Gefangener?« fragte er.
»Ja.«
»Noch nicht! Lieber todt!«
Er wendete sich blitzschnell nach der Thür und holte mit beiden Fäusten aus, um Sam, Jim und Tim von derselben fortzustoßen. Aber der kleine Dicke war ebenso schnell wie er. Er bückte sich, so daß der gegen ihn gerichtete Hieb daneben ging, und rannte ihm die beiden Fäuste so gegen den Leib, daß Florin wie ein Klotz zu Boden krachte.
»Recht so!« sagte Steinbach. »Bindet ihn!«
Dieser Befehl war in wenigen Augenblicken vollzogen. Florin schäumte vor Wuth. Er stieß eine Fluth von Verwünschungen aus, was aber gar nicht verhinderte, daß er nach einer Ecke geschleift wurde, wo ihm Jim noch einige derbe Fußtritte versetzte.
Jetzt kehrte Boroda zurück. Er brachte seine Eltern mit. Natürlich hatte er denselben bereits mitgetheilt, daß sie begnadigt seien und wem sie es zu verdanken hatten. Darum wendeten sie sich sofort an Steinbach, um ihm zu danken. Er aber wehrte sie ab, indem er bemerkte, daß es zum Dank auch später Zeit genug sei; jetzt gebe es Nothwendigeres zu thun.
Der Graf hatte bisher als stiller Zeuge dagestanden, regungslos an die Wand gelehnt. Sein Auge war mit haßerfülltem Blicke auf Steinbach gerichtet. Es tobte und stürmte in seinem Inneren. Er erkannte, daß ihm das Leugnen nichts helfen könne. Alles war verrathen. Steinbach wußte Alles, und es waren Zeugen vorhanden, gegen deren Aussage die seinige nichts gelten konnte.
Wo und wie gab es Rettung für ihn? Er sann und sann. In offenem Widerstande? Nein. Er war allein gegen eine solche Uebermacht. Diesen unerschrockenen Prairiejägern war er nicht gewachsen. Konnte er sich nicht durch List retten? Auch nicht. Seine Schuld lag ja offen zu Tage. Es war aus mit ihm. Sein Name war geschändet und seine Ehre dahin. Selbst wenn er auf Begnadigung rechnen konnte, war es ihm unmöglich, sich jemals wieder sehen zu lassen. Und auf Gnade war nicht zu rechnen. Was er gethan hatte, rief geradezu das Gesetz heraus.
Es gab nur Eins für ihn: die Flucht, die schleunigste Flucht. Er mußte fort, mußte die Weiten Sibiriens auf schnellen Rossen durchjagen, um ja nicht eingeholt werden zu können, mußte nach dem eigentlichen Rußland, wo seine Güter lagen, dort eiligst so viel Geld wie möglich zusammenraffen und damit in ein Land gehen, in welchem er nicht gefunden werden konnte.
Die Hauptsache war, jetzt zu entkommen. Draußen standen zwei gesattelte Pferde, deren er und der Major sich bedient hatte. Hinaus, in den Sattel und fort!
Aber wie?
Er knirrschte mit den Zähnen, als sein Blick auf Semawa fiel. Er hatte nach dem Besitze dieses herrlichen Wesens gestrebt, aber ohne auch den geringsten Erfolg. Nicht einmal berühren hatte er sie dürfen. Und nun stand sie da als die Hauptzeugin gegen ihn. Sie haßte und sie verachtete ihn; er war ihr so sehr zuwider, daß sie es verschmähte, ihn auch nur anzusehen. Ganz gewiß wurde sie nun das Eigenthum Steinbachs, dieses abenteuerlichen, geheimnißvollen Menschen, den er in den tiefsten Abgrund der Hölle verwünschte.
Dieser Gedanke erregte seine Nerven und spannte seine Muskeln und Flechsen zur größten Anstrengung. Er sah, daß die allgemeine Aufmerksamkeit jetzt auf den gefesselten Florin und auf Boroda's Eltern gerichtet war. Ihn selbst schien man weniger zu beachten. Dieser Augenblick war für sein Vorhaben günstig. Jetzt oder nie mußte er die Flucht versuchen.
Noch einen Blick warf er im Kreise umher. Kein Auge ruhte auf ihm. Er wagte es. Den Revolver aus der Tasche ziehend, that er einen Sprung nach der Thür.
Aber er hatte sich getäuscht. Er kannte Steinbach doch noch nicht. Dieser hatte ihn trotz seiner scheinbaren Gleichgiltigkeit doch nicht aus dem Auge gelassen. Mit einer gedankenschnellen Bewegung sprang er hinzu und faßte den Grafen am linken Arme.
»Halt!« rief er. »Sie bleiben!«
»Laß los!« schrie der Graf. »Sonst – – –!«
Er richtete den Revolver auf Steinbachs Brust und drückte ab. Steinbach aber schlug ihm noch im richtigen Moment die Waffe aus der Faust. Der Schuß ging zwar los, doch fuhr die Kugel in den Boden.
»Also auch Mörder!« sagte Steinbach. »Man wird sich vorsehen müssen. Bindet auch ihn!«
Er schleuderte den Grafen dahin, wo Jim, Tim und Sam standen. Diese nahmen ihn sofort in Empfang. Die beiden Ersteren legten ihre Arme um ihn, so daß er sich gar nicht bewegen konnte, und der Dicke zog einige Riemen aus der Tasche, mit denen er den Grafen an Händen und Füßen band.
»So, mein Bester!« lachte er. »Habe mich mit diesen Riemchen versehen, weil ich ahnte, daß wir Dich ein Wenig binden würden, grad wie den ehemaligen Kammerdiener.«
Der Gefesselte wurde auf einen Stuhl gesetzt. Die Flucht war mißlungen. Er sah die Augen Aller auf sich ruhen und schloß die seinigen. Was er fühlte, das war gar nicht zu beschreiben.
Haß, Wuth und Scham rangen mit einander in seinem Inneren um die Oberhand. Es hatte ihn eine Aufregung ergriffen, welche sich nicht nur seines Geistes, sondern auch seines Körpers bemächtigte. Er zitterte an allen Gliedern. Seine Brust wogte heftig, und sein Athem drang hörbar, fast pfeifend aus seinem Munde.
Semawa war auf Steinbach zugeeilt.
»Um Gotteswillen! Bist Du verwundet?« fragte sie voller Angst.
»Nein. Die Kugel ging fehl.«
»Dem Himmel sei Dank! Mir bebt das Herz.«
»Sei ruhig, meine Seele! Ich befinde mich ganz wohl, so wohl, daß ich in meinen Eröffnungen fortfahren kann.«
Er zog ein Papier aus der Brieftasche und reichte dasselbe dem Major, indem er sagte:
»Sie sind hier Commandirender. Ihnen muß ich also diesen Verhaftsbefehl vorzeigen.«
Der Officier nahm den Zettel und las:
»Dem Vorzeiger Dieses steht es zu, den Grafen Alexei von Polikeff zu verhaften, wo und wie er ihn nur immer findet. Seinen Anordnungen ist von allen Behörden Folge zu leisten, grad als ob ich selbst mich an seiner Stelle befände.«
Unterzeichnet war der Justizminister.
»Ah, welch eine Machtvollkommenheit!« sagte der Major erstaunt. »So etwas habe ich freilich noch nicht erlebt.«
»So haben Sie wohl auch Dieses noch nicht erlebt?«
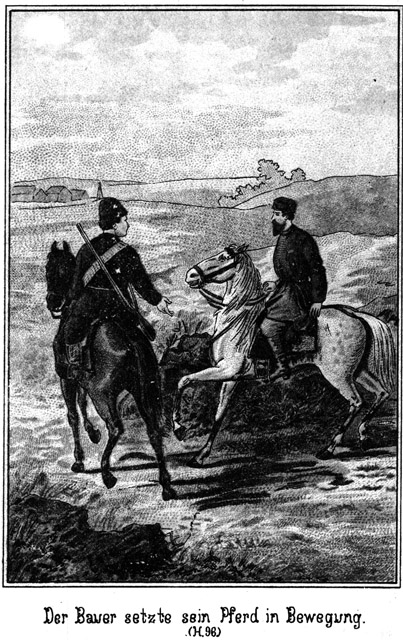
Steinbach nahm, indem er dies sagte, von dem Tische, an welchem er vorhin geschrieben hatte, ein weiteres Document und gab es ihm.
»Abermals vom Kaiser selbst unterzeichnet!« rief der Officier, als sein Blick auf die Unterschrift fiel.
»Bitte, lesen Sie laut vor!«
Der Inhalt lautete:
»Der zu ewiger Verbannung in die Zobelwälder verurtheilte Inhaftat Nummer Fünf soll, sobald es sich herausstellt, daß er der Maharadscha Banda von Nubrida ist, sofort entlassen werden. Es ist seine Reise nach Petersburg an den kaiserlichen Hof zu verfügen, wobei ihm alle Ehren zu erweisen sind und dafür zu sorgen ist, daß die Reise mit der Bequemlichkeit geschieht, welche seinem hohen Stande angemessen ist.
Die Untersuchung wird ergeben, auf welche Weise ein so außerordentlicher Fall ermöglicht werden konnte. Doch hat bereits jetzt die Vorbestimmung in Kraft zu treten, daß ihm für jedes Jahr seiner Verbannung ein Lak Rupien auszuzahlen sind, welche Summe der Graf Polikeff zu tragen hat. Aus diesem Grunde sind die Güter des Letzteren augenblicklich mit Beschlag zu belegen.«
Ein Lak Rupien ist indisches Geld und heißt so viel wie hunderttausend Rupien oder hundertneunzigtausend Mark.
Diese Verfügung rief natürlich ein ganz außerordentliches Aufsehen hervor.
»Vater, mein Vater! Du bist frei!« rief Semawa, indem sie sich an seine Brust warf.
Die Anderen eilten auf ihn zu, um ihm zu gratuliren. Er winkte sie von sich ab. Er war sprachlos vor freudiger Ueberraschung und mußte sich niedersetzen.
Die Scene, welche es nun gab, war gar nicht zu beschreiben. Die Personen, denen nach so langen Leiden die goldene Freiheit wieder winkte, konnten sich vor Freude gar nicht fassen. Das war ein Jubeliren und Jauchzen! Natürlich flossen Alle von Dankesworten gegen Steinbach über.
Und der Graf und Florin mußten Zeuge dieses Jubels sein! Das war nicht die geringste Strafe, welche sie traf. Besonders dem Grafen war es, als ob er vor Wuth wahnsinnig werden müsse.
Als sich dann die freudige Aufregung etwas gelegt hatte, sagte der Major, welcher ein echt russisches, gutes Herz besaß:
»Ich freue mich mit Euch Allen, obgleich der schlimmste Theil davon auf mich gefallen ist. Mir sind die Flüchtlinge mit Allem entwischt, was sie mitgenommen haben. Ich werde mich wohl kaum verantworten können. Ich muß ihnen nach und hoffe, daß Du mir Deine Pferde dazu giebst.«
Diese Worte waren an Peter Dobronitsch gerichtet, welcher ihm antwortete:
»Gern, sehr gern würde ich es thun. Zumal in der jetzigen glücklichen Stimmung kann ich nicht gern einen Wunsch versagen.«
»Ich hoffe, daß Du ihn mir erfüllst!«
»Es ist mir leider unmöglich.«
»Warum?«
»Weil die Pferde nicht mehr mir gehören. Ich habe Alles verkauft und die Pferde dazu.«
»Was! Davon weiß ich doch gar nichts?«
»Es ist in der Stille geschehen.«
»Nun so kannst Du mir also die Pferde nicht verweigern. Sie gehören nicht mehr Dir, und ich werde sie mir also nehmen.«
»Das geht nicht. Ich habe das Gut noch nicht übergeben. Der Käufer verlangt, was er bezahlt hat und würde mir also den Betrag der Pferde abziehen.«
»Den bekommst Du später von mir zurück.«
»Danke sehr! Du würdest mir nicht zahlen, was ich verlange, und übrigens bin ich dann wohl nicht mehr hier.«
»Willst Du fort?«
»Ja.«
»Wohin?«
»Nach – nach – – nach Deutschland.«
Dieses letztere Wort wollte ihm gar nicht recht vom Munde, und als es heraus war, athmete er wie erleichtert auf.
»Nach Deutschland?« fragte der Major. »Wie kommst Du auf diesen dummen Gedanken?«
»Der da hat ihn mir eingegeben.«
Er deutete auf Sam.
»Der da? Der Dicke? Das traue ich ihm zu. Dieser dicke Mensch ist im Stande, allein eine Revolution hervor zu rufen. Wie kommt er aber auf diesen Gedanken?«
»Seines Neffen wegen.«
»Wegen Boroda? Was hat er damit zu thun?«
»Er zieht ja nach Deutschland, und da muß ich mit.«
»Du? Warum?«
»Als – sein –,– Schwiegervater.«
»Schwie – schwie – schwie –!«
Das Wort blieb ihm im Munde stecken, und erst nach einer Weile fuhr er fort:
»Schwiegervater! Du bist der Schwiegervater dieses berüchtigten – – Donnerwetter!«
»Ja,« nickte Dobronitsch lachend.
»Ah, nun geht mir freilich ein großes Licht auf. Auf diese Weise konnte ich ihn nicht erwischen. Du selbst, Du hast ihn versteckt!«
»Wer sagt das?«
»Schweig! Das versteht sich ja ganz von selbst! Willst Du es vielleicht nicht eingestehen?«
»Nein.«
»Nein? Nun, das ist wohl auch gar nicht nöthig. Ich weiß doch, woran ich bin. Ihr Kerls habt mich an der Nase herumgeführt. Ein Glück für Euch, daß Ihr fort macht! Sonst wollte ich es Euch entgelten. Prügel solltet Ihr bekommen, daß die Haut aufspringt!«
Er sagte das halb im Scherze und halb im Ernste. Steinbach versuchte, ihn zu trösten:
»Auf die Pferde unseres Wirthes werden Sie verzichten müssen. Uebrigens, wenn die Flüchtigen entkommen, so geht die Welt nicht deshalb unter. Ich werde schauen, ob es mir möglich ist, dieser Angelegenheit eine solche Wendung zu geben, daß Sie keine Unannehmlichkeiten davon haben.«
»Excellenz! Wollten Sie das wirklich?«
»Ja, ich will es.«
»Dann bin ich beruhigt. Nach Allem, was ich hier gesehen, gehört und erfahren habe, sind Sie der Mann, welcher sein Wort zu halten vermag. Mir fällt ein Stein vom Herzen!«
»Wenn er fällt, so lassen Sie ihn getrost liegen. Es verlohnt sich nicht, ihn wieder aufzuheben. Sie sehen, wie glücklich wir uns Alle fühlen, und da wünsche ich, daß auch Sie zufrieden sind. Schauen Sie nur diese Beiden an! Sehen sie nicht aus, als ob sie sich bereits im Himmel befänden?«
Er deutete auf Boroda und Mila, welche sich umschlungen hielten. Sie waren allerdings glücklich, da der Bauer ganz ungefragt sein Jawort ertheilt und zugleich auch verkündet hatte, daß er mit nach Deutschland ziehen wolle.
Seine Frau, die gute Maria Petrowna, war darüber so freudig überrascht, daß sie ihn eben jetzt beim Kopfe nahm, um ihn recht herzhaft abzuküssen.
»Ja, die können glücklich sein!« antwortete der Major. »Bei mir aber steht es anders.«
»Nehmen Sie nur an ihrem Glücke theil. Die Verlobung ist ausgesprochen worden und muß in Folge dessen auch gefeiert werden. Sie bleiben da!«
»Ich? Unmöglich! Ich muß den Flüchtlingen nach.«
»Pah! Die erwischen Sie nun doch nicht mehr.«
»Hm! Verdammte Geschichte!«
»Lassen Sie! Denken Sie nicht mehr daran!«
»Nicht mehr daran denken! Ich darf nicht hier bleiben. Ich kann es nicht verantworten.«
»So verantworte ich es.«
»Ja, wenn Sie das auf sich nehmen, so ist es etwas ganz Anderes.«
»Schön! Sie bleiben also und senden einen Boten nach der Stanitza, damit man weiß, wo Sie sind. Peter Dobronitsch bist Du einverstanden, daß die Verlobung gefeiert wird?«
»Ja. Meinetwegen gleich die Hochzeit!«
»Damit wollen wir noch warten. Vielleicht finden sich noch einige andere Paare dazu.«
»Ganz wie Du willst, Herr. Nun soll mein Wein, den ich noch habe, zu Ehren kommen, und ich lasse einen ganzen Ochsen braten. Den Befehl dazu werde ich sofort ertheilen.«
Jetzt erlangte Alles ein sehr festliches Gepräge. Der Graf und Florin wurden in die Räucherkammer geschafft und dort eingeschlossen. Draußen vor dem Hause brannte man ein großes Feuer an, an welchem der Ochse nach tungusischer Weise gebraten werden sollte.
Bula, der Fürst, rief seine Leute herbei und opferte ihnen auch ein ganzes Rind und mehrere Schafe. Bald erfüllte der Bratenduft die ganze Gegend, und wo es vor Kurzem so kriegerisch ausgesehen hatte, da saßen jetzt die Menschen glücklich und in Frieden bei einander.
Da gab es zu fragen und zu antworten, zu erzählen und zu berichten.
Vor Allem war es Steinbach, auf den die allgemeine Aufmerksamkeit gerichtet war. Das Geheimniß, welches seine hohe, imposante Person umgab, verdoppelte die Ehrerbietung, welche man ihm widmete.
Er bemerkte das gar wohl und bemühte sich so viel wie möglich, das allgemeine Interesse von sich abzulenken. Aus diesem Grunde vertauschte er die Uniform mit einem gewöhnlichen Anzuge und zog sich dann in den Garten zurück, um über das Geschehene nachzudenken.
Aber er sollte nicht lange allein auf der Bank sitzen, an welcher vorhin die Erkennungsscene zwischen Semawa und ihrem Vater stattgefunden hatte.
Das herrliche Mädchen hatte ihre Zeit bis jetzt natürlich ihrem Vater gewidmet. Nun aber dachte sie auch an den Geliebten. Als sie ihn nirgends erblickte, begab sie sich nach dem Garten. Ihr Herz sagte ihr, daß er ganz gewiß an dem Orte zu finden sein werde, an welchem er ihr den Vater wiedergegeben hatte.
Als er sie kommen sah, stand er auf, ergriff ihre beiden Hände und zog sie neben sich nieder.
»Suchtest Du mich, Gökala?« fragte er.
»Ja; ich hatte Dich doch ganz vernachlässigt.«
»Das darfst Du nicht sagen. Du gehörst jetzt Deinem Vater, und ich bin Nebenperson.«
»Nebenperson? O nein! Grad die Hauptperson bist Du. Dir ist ja alles, alles Glück zu verdanken, welches heut hier eingekehrt ist. Oskar, ich weiß nicht, wie ich das, was ich empfinde, in Worte fassen soll!«
Er zog sie an sich und antwortete:
»So fasse es gar nicht in Worte. Solche Seligkeiten sind nicht auszudenken und also noch viel weniger auszusprechen. Das fühle ich ja auch selbst. Daß ich Dich nun endlich, endlich gefunden habe und mein Eigen nennen darf, dieses Entzücken kann ich ja auch nicht beschreiben. Ich befinde mich in ganz anderen Regionen. Es ist mir gar nicht, als ob ich mich noch auf der Erde und gar in Sibirien befände. Ich bin – bin – ja, ich bin vor Glück so aus der Fassung gekommen, daß ich nicht einmal weiß, wie ich Dich nennen soll.«
Sie hatte das Köpfchen an seine Brust gelegt und blickte fragend zu ihm auf.
»Soll ich Gökala zu Dir sagen oder Semawa?« fragte er.
»Welches ist Dir lieber?«
»Mir gelten beide Namen gleich. Freilich als Gökala habe ich Dich kennen gelernt. Und dieser Name ist mit dem Bilde, welches ich von Dir im Herzen trug, auf das Innigste verwachsen.«
»So nenne mich auch ferner Gökala!«
»Und dennoch ist mir der Name auch verhaßt, denn der Graf hat ihn Dir gegeben. Ich möchte alle Erinnerung an diesen Menschen aus meinem Herzen reißen. Wie nennt Dein Vater Dich?«
»Wie er mich stets genannt hat, Semawa.«
»So sollst Du auch aus meinem Munde Semawa heißen. Semawa klingt ebenso reizend wie Gökala. Und doch, wie unendlich schöner noch als der Name bist Du selbst!«
»So genüge ich Dir?« fragte sie, indem sie mit einem glücklichen Lächeln zu ihm aufblickte.
»Genügen! Welch ein Wort! Kann ein Engel einem Sterblichen genügen!«
»Ja,« lächelte sie, jetzt aber ein wenig ironisch. »Ich bin ein höheres Wesen gegen Dich. Das ist sehr wahr.«
Er blickte ihr forschend in das Gesicht.
»Wie meinst Du das?«
»Nun, steht die Tochter eines indischen Maharadscha nicht unendlich höher als ein armer Assessor am deutschen auswärtigen Amte?«
Er lachte lustig auf.
»Ach ja! Ich bin ja nur Assessor.«
»Und das habe ich geglaubt!«
»Wirklich?«
»Nein. Ich schwieg dazu, weil ich glaubte, Du habest Veranlassung, Deinen Stand zu verschweigen.«
»Die habe ich auch. Aber bitte, sage mir doch, für was Du mich gehalten hast?«
»Darüber habe ich nicht nachgedacht.«
»So ist meine Person Dir so sehr gleichgiltig, daß Du Dich mit dieser Frage gar nicht beschäftigen wolltest?«
»Oskar! Ich liebte Dich. Ich wußte, daß Dir mein Herz gehörte und daß das Deinige mein Eigen sei. Das war mir genug. Alles Andere ging mich einstweilen noch nichts an.«
Er küßte sie innig auf den ihm rosig entgegenschwellenden Mund.
»Mein herrliches, herrliches Wesen! So soll und so muß es sein. Die Liebe ist sich selbst genug. Aber das böse Leben stellt leider auch seine Ansprüche, mit denen man zu rechnen hat, und so wirst Du Dich nun wohl auch fragen müssen, wer Der ist, den Du liebst.«
»O nein. Das thue ich nicht. Mich selbst frage ich nicht.«
»Wen sonst?«
»Und wenn ich es Dir nicht sage?«
»Wirst Du so grausam sein?«
»Nein. Und doch möchte ich mich noch ein Wenig länger in dieses reizende Geheimniß hüllen.«
»Hast Du Veranlassung dazu?«
»Ja.«
»So thue es! Ich werde nicht in Dich dringen.«
»Ich danke Dir! Aber einstweilen will ich Dich versichern, daß ich der Tochter eines indischen Fürsten vielleicht ebenbürtig bin.«
»Oskar! Das will ich nicht wissen! Ich liebe Dich, und wärst Du ein armer, armer Arbeiter, ich würde Dir gehören.«
»Ob Dein Vater Dir es erlaubte?«
»Gewiß!«
»Kennst Du ihn so?«
»Ja. Er liebt mich sehr und würde nichts thun, was mein Glück verletzen könnte. Ich muß ihn bei Dir entschuldigen. Er ist so voller Dankbarkeit gegen Dich und hat dieselbe noch gar nicht so recht ausgesprochen.«
»Er hat mir gedankt. Du brauchst ihn also nicht zu entschuldigen.«
»Er hat gedankt, ja, aber wie! Es war ja keine Rede, sondern nur ein Stammeln.«
»Semawa, dieses Stammeln war beredter als wenn er viele Worte gemacht hätte. Ahnt er, daß wir uns lieb haben?«
»Er ahnt es nicht nur, sondern er weiß es.«
»Von Dir?«
»Ja. Ich habe es ihm gesagt.«
»Unaufgefordert?«
»Nein. Er fragte mich. Er hatte ja gehört, was ich zu Dir sagte, als ich Dich für verwundet hielt.«
»Und wie ist seine Entscheidung gefallen?«
Sie schlang beide Arme um ihn und antwortete:
»Ganz nach dem Wunsche meines Herzens. Er war so glücklich, als er hörte, daß mir Dein Herz gehört. Er sagte, es gebe keinen Würdigeren, als ich wäre. Wirst Du mit ihm davon sprechen?«
»Ja, aber nicht jetzt. Erst mögen sich die Wogen legen, welche jetzt noch durch unsere Seelen fluthen. Dann will ich ihn um Dich bitten. Wo ist er jetzt?«
»Das Glück hat ihn so angegriffen, daß er ermüdet ist. Er hat sich niederlegen müssen; aber ich sorge mich nicht um ihn. Er wird desto gestärkter erwachen.«
Die beiden Liebenden saßen noch einige Zeit bei einander. Dann wurden sie gestört. Die Eltern von Alexius Boroda kamen. Sie waren in den Garten gegangen, um sich für einige Zeit dem bewegten Leben zu entziehen, welches jetzt in der Nähe des Hauses herrschte. Sie fühlten das Bedürfniß, sich gegenseitig über die glückliche Wendung auszusprechen, welche ihr Schicksal am heutigen Tage genommen hatte.
Als sie die Beiden sitzen sahen, wollten sie sich entfernen; aber Steinbach bat sie, näher zu kommen. Sie befolgten diese Aufforderung in ehrerbietiger Weise und nahmen neben ihnen Platz, da die Bank lang genug für vier Personen war.
Die alten, glücklichen Leute wollten sich abermals in Dankesworten ergehen; aber Steinbach schnitt ihnen die Rede ab, indem er sie fragte:
»Sind Sie denn nun auch jetzt, da Sie sich offen zeigen dürfen, gewillt, mit mir zu reisen?«
»O, gern, wenn Sie es uns erlauben!«
»Ich erlaube es nicht nur, sondern ich sage Ihnen aufrichtig, daß es mich freut, Sie bei mir haben zu können.«
»Solche einfache Leute!«
»Einfach zu sein ist keine Schande, sondern eine große Ehre. Uebrigens möchte ich meinen guten Sam nicht vermissen, und ich weiß doch sicher, daß er bei Ihnen bleiben würde, wenn Sie nicht mit mir reisen.«
»Er hat uns außerordentlich viel von Ihnen erzählt, gnädiger Herr General.«
»Nennen Sie mich nicht General, sondern ganz einfach Steinbach wie bisher. Was ich eigentlich bin, das ist jetzt Nebensache. Haben Sie sich schon schlüssig gemacht über das, was Sie in der Heimath beginnen werden?«
»Nein.«
»Auch nicht über den Ort, an welchem Sie sich niederlassen wollen?«
»Wir haben noch nicht darüber nachgedacht.«
»Nun, was das betrifft, so wünsche ich sehr, daß Sam in meiner Nähe bleibe. Da Sie sich nun jedenfalls nicht von ihm trennen mögen, so möchte ich Sie bitten, Ihre Entscheidung einstweilen noch nicht zu treffen. Vielleicht mache ich Ihnen später einen Vorschlag, welchen Sie acceptiren werden. Verwandte haben Sie weiter nicht?«
»Nein. Sam ist unser einziger Verwandte.«
»Und Kinder auch nicht, die vielleicht bei Ihrer Transportation zurück geblieben sind?«
»Nein. Wir nahmen die beiden, welche wir hatten, mit.«
»Ich kenne nur Alexius. Sie haben also außer diesem noch ein Kind?«
»Jetzt nicht mehr. Es ist gestorben.«
»Während Ihrer Verbannung natürlich?«
»Nein, sondern während des Transportes.«
»Das beklage ich mit Ihnen. Vermuthlich hat es die Anstrengungen der langen Reise nicht auszuhalten vermocht?«
»Noch schlimmer als das. Es ist erfroren.«
»O weh! Welche Schmerzen muß Ihnen eine solche Erinnerung bereiten! Es war ein Knabe?«
»Nein, ein Mädchen. Wir wissen nicht einmal, wo wir das Grab dieses Kindes zu suchen haben.«
»Sie müssen sich doch den Namen des betreffenden Ortes gemerkt haben?«
»Es gab da keinen Ort. Es war unterwegs. Ganz zufällig trafen wir auf das Winterlager von Eingeborenen.«
Jetzt wurde Steinbach aufmerksam.
»Ein Winterlager von Eingeborenen?« fragte er. »Wissen Sie vielleicht, welcher Völkerschaft sie angehörten?«
»Wenn ich mich nicht irre, waren es Tungusen.«
»Sagen Sie mir doch, wie der letzte Ort hieß, durch welchen Sie gekommen waren!«
»Es war vier Tage, nachdem wir Irkutsk verlassen hatten. Wir zogen über eine jener entsetzlichen Ebenen, welche hier Tundra genannt werden.«
»Diese Ebenen aber haben ihre bestimmten Namen. Können Sie sich nicht auf den Namen jener Tundra besinnen.«
»Gar wohl! Ich werde ihn niemals vergessen. Sie wurde die Tundra des Mooses genannt.«
»Ah! Sonderbar!«
Er sagte das in einem Tone, welcher die Aufmerksamkeit des Ehepaares erregte.
»Bitte, was ist sonderbar?« fragte Bart.
»Sonderbar ist, daß auch ich von einem Kinde weiß, welches dort begraben wurde.«
»Ein Kind Verbannter?«
»Ja.«
»War es ein Mädchen?«
»Ein kleines Mädchen, welches erfroren war.«
»Vielleicht ist es das unsere!«
»Bitte, beschreiben Sie mir das Kind! Welche Farbe hatten die Haare?«
»Sie waren blond.«
»Und die Augen?«
»Himmelblau. Es war ein so liebes, schönes Kind, und es hat so langer Zeit bedurft, bevor wir uns über diesen Verlust trösten konnten.«
»Waren Sie denn bei den Tungusen eingekehrt?«
»Nur auf ganz kurze Zeit. Als meine Frau das Kind aus der Hülle nahm, um es am Feuer zu erwärmen, war es todt.«
»Sie armen Leute! Natürlich haben Sie es gleich dort an Ort und Stelle begraben müssen?«
»Nicht einmal das war uns vergönnt. Der uns eskortirende Officier erklärte, daß er nicht so lange warten könne. Wir mußten die Leiche den Tungusen zurücklassen, welche uns versprochen, sie einstweilen in den tiefen Schnee zu betten und dann, wenn im Frühjahre der Erdboden aufgethaut sei, ihr ein richtiges Grab zu geben. Sie können sich denken, mit welchen Gefühlen wir dann fortgezogen sind, immer weiter in den fürchterlichen Wintersturm hinein!«
»Es war kein heiterer Wintertag?« fragte Steinbach, um sich ganz genau zu orientiren.
»O nein. Es herrschte vielmehr ein Schneesturm, wie ich ihn so entsetzlich kaum jemals wieder erlebt habe, selbst in Ostsibirien nicht.«
»Es gab also keine Bahn?«
»Nein. Der Schnee lag hoch und fiel so dicht vom Himmel, daß unsere Fußtapfen sofort wieder verweht wurden.«
»Welch eine Anstrengung, wenn Verbannte bei solchem Wetter den weiten Weg zu Fuße machen müssen! Haben Sie denn nicht nach dem Namen des Anführers dieser Tungusen gefragt?«
»Nein. Wir waren über den Tod des Kindes so unglücklich, daß wir an so etwas gar nicht dachten.«
»Ganz ähnlich war es in dem Falle, den man mir erzählte. Es handelte sich auch um ein Mädchen, welches aber lebendig begraben wurde.«
»Lebendig?« rief Bart.
»Ja, lebendig.«
»Welch ein Verbrechen!«
»O, es handelte sich nicht um ein Verbrechen, sondern nur um ein Versehen. Die Eltern und mit ihnen alle Anderen hatten das Kind für todt gehalten. Es war aber nur erstarrt.«
»Und wurde begraben?«
»Ja. Glücklicher Weise aber hat der Schnee die köstliche Eigenschaft, den Frost aus dem Körper zu ziehen. Dies geschah auch hier. Die Tungusen begruben die ihnen anvertraute Leiche. Das Kind wurde durch den Schnee erwärmt, bekam das Leben zurück und begann, nach einiger Zeit, zu schreien.«
»Herrgott! Es erwachte! Wurde es gehört?«
»Ja. Die Tungusen nahmen die lebendig gewordene kleine Leiche aus dem Schnee heraus und in ihr Zelt. Sie haben das kleine Mädchen erzogen und an Kindesstelle angenommen.«
»Sollte man so etwas für möglich halten! Warum haben sie nicht das Kind den Eltern zurückgegeben?«
»Weil dieselben nicht aufzufinden waren.«
»Das kann nur diesen armen Verbannten passiren!«
»Leider. War denn der damalige Tag gar so entsetzlich kalt, oder hatten Sie keine Kleidungsstücke, um Ihr Kind gegen die Kälte zu verwahren?«
»Es war beides der Fall. Die Kälte war geradezu fürchterlich, und wir waren fast nur in Lumpen gehüllt. Meine Frau hatte das Kind am bloßen Leibe getragen, um es zu erwärmen.«
»War das Kindchen denn in gar nichts gehüllt?«
»Nur in einige kleine Lumpen.«
»Die Sie mit genommen haben?«
»Nein. Das wäre eine große Versündigung gewesen. Wir haben die kleine Leiche in dieser Umhüllung gelassen.«
Der Sprecher ahnte nicht, weshalb Steinbach ihn so ausfragte. Der Letztere stand auf und sagte auf türkisch zu Semawa:
»Unterhalte sie, bis ich wiederkomme.«
Sie wußte nicht, weshalb er dies sagte; aber sie befolgte seinen Willen. Sie sprach mit den beiden tief geprüften Leuten über ihre Vergangenheit und über den Verlust ihres Kindes.
Steinbach aber begab sich in das Innere des Wohnhauses, um nach Karparla zu suchen. Sie befand sich in der Stube, und er gab ihr einen Wink, ihm zu folgen. Er führte sie seitwärts, so daß Niemand ihr Gespräch hören konnte, und sagte:
»Der Fürst hat mir in Platowa erzählt, daß er eigentlich nicht Dein Vater ist. Weißt auch Du davon?«
»Ja,« antwortete sie. »Ich bin das Kind armer Verbannter, und darum ist es mir eine so große Freude, wenn ich ›armen Leuten‹ helfen kann.«
»Hast Du nie gewünscht, Deine wirklichen Eltern einmal zu sehen, sie kennen zu lernen?«
»Wie oft, wie oft! Aber wie soll ich sie finden? Sie sind wohl längst schon todt, vielleicht schon damals im Schneesturm umgekommen.«
»Dein Pflegevater sagte mir, daß er die Sachen, in welche Du gewickelt warst, aufgehoben habe?«
»Ja, ich habe sie noch. Ich führe sie stets bei mir.«
»Hast Du sie auch heut hier?«
»Jawohl.«
»Würdest Du sie mir einmal zeigen?«
Sie blickte ihn betroffen an und fragte:
»Warum? Hast Du einen Grund dazu?«
»Ja.«
»Welchen, Herr? Schnell, schnell, sage es!«
»Ich erinnerte mich soeben, von ›armen Leuten‹ gehört zu haben, welche glaubten, ihr Kind sei erfroren. Sie mußten die kleine Leiche bei Tungusen zurücklassen.«
»O Gott! Bin ich das etwa?«
»Ich weiß es nicht!«
»Kennst Du diese Leute?«
»Ja.«
»Wo sind sie? Wo befinden sie sich?«
»Hm, das ist nicht leicht zu beantworten. Vielleicht gelingt es mir, sie aufzufinden. Hole nur einmal die kleinen Hüllen herbei, in welche Du damals gewickelt warst! Ich möchte sie mir einmal ansehen.«
Die Tungusen hatten natürlich, als sie ihr Lager vom Mückenflusse nach dem Hofe verlegt hatten, auch die Pferde mitgebracht. Mehrere von den Letzteren waren als Packthiere benutzt worden. Man hatte sie abgeladen. Dort befand sich das Gepäck des Fürsten Bula und dabei auch das Eigenthum Karparla's. Sie suchte eine kleine Ledertasche und entnahm derselben die ärmliche Umhüllung, in welche sie damals als Kind gewickelt gewesen war. Sie gab dieselbe an Steinbach.
»Willst Du es mir für eine Viertelstunde anvertrauen?« fragte er.
»Ja, recht gern. Aber warum wünschest Du, es zu haben? Hast Du eine Absicht dabei?«
»Ja. Ich will es Jemandem zeigen.«
»Wem?«
»Das sollst Du später erfahren, wenn es sich gezeigt hat, ob meine Vermuthung begründet ist.«
»Eine Vermuthung hast Du?« fragte sie betroffen. »Was für eine? Betrifft sie etwa mich?«
»Ja. Diese Sache ist so hochwichtig für Dich, daß ich es für meine Pflicht halte, Dir jetzt bereits wenigstens eine kleine Andeutung zu geben. Vielleicht ist es möglich, daß Deine Eltern noch leben.«
Sie schlug freudig erschrocken die Hände zusammen.
»Wirklich, wirklich! Gott, wenn dies der Fall wäre!«
»Ich habe etwas gehört, was mich ahnen läßt, daß sie noch leben, ja, daß sie sich in der Nähe befinden.«
»Herr, sag wo, wo?«
»Erlaß mir die Beantwortung dieser Frage noch. Ich will erst einmal einen Versuch mit diesen Sachen machen.«
»So thue es schnell, sehr schnell!«
»Das werde ich thun. Indessen kannst Du Bula und Kalyna darauf aufmerksam machen, damit sie nicht allzu sehr überrascht werden.«
Er ging, und sie eilte in höchster Erregung zu ihren Pflegeeltern, um ihnen zu erzählen, was sie von ihm gehört hatte.
Das Päckchen war nicht groß. Er konnte es ganz gut in der Tasche verstecken. Als er wieder in den Garten zu Semawa und den beiden alten Leuten zurückkam, setzte er sich zu ihnen und führte die Unterhaltung noch ein kleines Weilchen fort. Dann that er, als ob ihm etwas einfalle, was sehr schnell zu erledigen sei. Er stand auf und entfernte sich eiligst mit der Geliebten. Vorher jedoch zog er das Päckchen aus der Tasche, faltete es unbemerkt aus einander und ließ es auf der Bank liegen, so daß es nach seiner Entfernung unbedingt gesehen werden mußte.
Kaum hatte er sich sehen lassen, so kam der Tungusenfürst mit seiner Frau und Karparla zu ihm.
»Herr,« sagte er erregt. »Meine Tochter bringt mir eine wichtige Botschaft von Dir. Du willst sie uns rauben!«
»Rauben? O nein! Daran habe ich nicht im Entferntesten gedacht. Diese Absicht steht mir fern.«
»Aber Du willst ihr die Eltern wiedergeben!«
»Das ist noch nicht so bestimmt, wie Du anzunehmen scheinst. Warten wir es einfach ab.«
»Hast Du sie denn entdeckt?«
»Ich vermuthe es, weiß es aber nicht genau.«
»Wo befinden sie sich?«
»Hier.«
»Alle Himmel! Hier? So müssen wir sie kennen?«
»Ja. Ihr habt sie gesehen.«
»Wer ist es?«
»Die Eltern Alexius Boroda's.«
Die beiden Leute starrten ihn ganz erstaunt an. Karparla fragte fast athemlos:
»So wäre Boroda mein Bruder?«
»Ja, wenn meine Vermuthung mich nicht täuscht.«
»Haben seine Eltern denn ein Töchterchen gehabt?«
»Ja. Während ihres Transportes haben sie geglaubt, es sei erfroren und die vermeintliche Leiche bei Tungusen zur Beerdigung zurücklassen müssen.«
»Das ist nicht wahr, nicht wahr!« rief der Fürst voller Sorge, »Karparla hergeben zu müssen.«
»Es ist wahr,« antwortete Steinbach. »Allerdings fragt es sich, ob Karparla dieses Kind war.«
»Sie ist es nicht. Sie ist es nicht! Mögen diese Leute kommen. Ich gebe Karparla nicht her!«
Da legte Steinbach ihm die Hand auf die Achsel und sagte in ernstem, eindringlichem Tone:
»Lieber Freund, ist das Dein Ernst?«
»Ja, ja!«
»So hast Du vergessen, wer das größte Recht auf den Besitz eines Kindes hat.«
»Es hat Niemand ein Recht, Niemand!«
»Auch die Eltern nicht?«
»Die Eltern sind wir!«
»Die Pflegeeltern, aber nicht die richtigen.«
»Diese richtigen Eltern haben sich so lange Jahre nicht um ihr Kind bekümmert!«
»Konnten sie es? Sie waren verbannt, weit, weit fort von hier. Sie konnten nicht zurück und hielten überdies ihr Kind für todt.«
»Das ändert nichts an der Sache. Wir haben Karparla bei uns aufgenommen und sie erzogen. Sie ist unser Kind, unsere Tochter geworden!«
»Das gebe ich zu. Aber frage Kalyna, Dein gutes Weib. Sie hat zwar nie ein Kind geboren; sie ist nicht Mutter gewesen, aber ihr Herz wird ihr dennoch sagen, daß Karparla's Eltern heilige Anrechte an ihre Tochter haben.«
Die Fürstin war so bestürzt, daß sie bis jetzt kein Wort hervorgebracht hatte. Ihr volles, rothes Gesicht war leichenblaß geworden. Jetzt nun schlang sie die Arme um Karparla und jammerte:
»Mein Kind, mein Kind! Man will Dich uns rauben! Das werde ich nicht überleben können!«
Karparla wußte nicht, was sie sagen solle. Sie liebte die Pflegeeltern, als ob sie ihre leiblichen seien. Sie hatte sich an den Gedanken gewöhnt, daß sie diese Letzteren niemals zu sehen bekommen werde. Und nun trat so plötzlich die Wahrscheinlichkeit, ja sogar die Gewißheit an sie heran, daß sie sich hier befanden.
Sie wurde bald blaß und bald roth. Ihre Augen standen voller Thränen. Waren es Thränen des Schmerzes oder der Freude? Sie wußte es nicht.
»Mutter!« rief sie. »Ich liebe Euch über Alles. Aber wollt Ihr es mir versagen, meine armen Eltern kennen zu lernen?«
»Nein, wir versagen es Dir nicht,« antwortete die Fürstin. »Aber sie dürfen Dich nicht mitnehmen. Du mußt bei uns bleiben!«
»Laßt diese Frage einstweilen ruhen,« sagte Steinbach. »Jetzt ist es unmöglich, bereits darüber zu entscheiden. Ach, da kommen sie!«
Barth und seine Frau kamen in eiligen Schritten vom Garten herbei. Die Letztere hatte die in dem Päckchen enthaltenen Sachen in der Hand.
»Herr,« rief sie bereits von Weitem. »Wir haben etwas gefunden. Es lag auf der Bank. Hast Du es verloren?«
Bula, Kalyna und Karparla standen zuwartend da. Steinbach nahm die Sachen in die Hand, betrachtete sie und antwortete ruhig:
»Ja, ich habe sie liegen lassen. Sie müssen mir aus der Tasche gefallen sein.«
»Wo hast Du sie her?«
Sie fragte das in einem Tone, als ob Leben und Seligkeit von der Beantwortung dieser Frage abhänge. Steinbach that, als ob er gar nichts ahne. Er fragte scheinbar verwundert:
»Warum willst Du das wissen?«
»Weil – weil – – Gott, ich kann nicht weiter sprechen. Rede Du, erkläre es ihm!«
Sie zitterte am ganzen Körper. Ihr Athem ging laut, aber stockend. Sie hatte die letztere Aufforderung an ihren Mann gerichtet.
»Wir haben Dir von dem kleinen Töchterchen erzählt, welches uns erfroren war,« erklärte er. Das hier sind die Sachen, in welche die Leiche gewickelt gewesen ist. Sage uns, woher Du sie hast!«
»Von diesen braven Leuten hier.«
Er deutete auf Bula und dessen Frau.
»Von Euch?« wendete Barth sich an die Zwei. »Wie seid Ihr in den Besitz derselben gekommen?«
Bula beachtete diese Frage zunächst gar nicht. Er starrte Barth und dessen Weib an und sagte dann zu Kalyna:
»Kennst Du sie denn? Kommen Sie Dir etwa bekannt vor?
»Nein,« antwortete sie kopfschüttelnd.
»Auch mir sind sie fremd. Sie sind es nicht.«
»Irrt Euch nicht,« bemerkte Steinbach. »Ihr müßt bedenken, welch eine lange Zeit zwischen damals und heute liegt. Die Gefangenen waren an jenem Tage von Kälte, Sturm, Wetter und Hunger angegriffen. Heut sehen sie anders aus und sind natürlich älter geworden.«
»Habt Ihr uns denn gesehen?« fragte Barth den Fürsten.
»Nein. Wir kennen Dich ja eben nicht.«
»Aber wie kommt Ihr zu diesen Sachen? Wer hat sie Euch gegeben?«
»Sie stammen von Verbannten, deren Kind hineingewickelt war.«
»Herrgott! Diese Verbannten waren wir. Unser Töchterchen war erfroren.«
»Nein. Es lebte noch! Hörst Du, Frau, es lebte noch!«
»Ja,« erklärte Kalyna, deren gutes Herz sie drängte, die freudige Kunde mitzutheilen. »Es lebte noch. Es war nicht todt, sondern es erwachte wieder.«
»Und wo befindet sich das Kind? Wo ist es? Oder ist es indessen gestorben?«
»Halt, halt! Nicht so eilig!« antwortete Bula, dem diese drängende Frage Angst machte. »Noch wissen wir nicht, ob Ihr die Richtigen seid.«
»Wir sind es; wir sind es!«
»Das ist zu beweisen. Wir haben zwar ein für todt gehaltenes Mädchen erhalten; aber ob von Euch, das ist noch ungewiß.«
»Wir erkennen ja die Sachen, in welche es gewickelt gewesen ist!« rief Barth.
»Auch das kann täuschen!«
»Aber wie sollen wir anders beweisen, daß wir es gewesen sind?«
»Könnt Ihr Euch auf damals besinnen?«
»O, ganz genau. Der Tag, an welchem man ein Kind verliert, bleibt ja unvergeßlich.«
»Wo war es denn?«
»Auf der Tundra des Mooses.«
»Hatten wir Hütten oder Zelte?«
»Filzzelte.«
»Es waren ihrer wenige. Ihr müßt Euch die Zahl derselben leicht gemerkt haben.«
»Es waren sechs. Ich weiß es sehr genau.«
»Wie standen sie?«
»In einem Halbkreise. Wir wurden von dem Besitzer des größten Zeltes empfangen.«
»Welche Kleidung hatte er an?«
»Er war ganz in Rennthierfelle gekleidet, deren Haarseite nach Außen gerichtet war.«
»Das stimmt. Habt Ihr sonst nichts an ihm bemerkt?«
»O doch. Er hatte ein Auge verbunden.«
Jetzt war der Fürst überzeugt, daß Barth sich nicht irre. Er sagte zu seinem Weibe:
»Kalyna, liebe Kalyna, sie sind es. Mein rechtes Auge war damals sehr entzündet. Ich hatte mich verkältet. Du weißt es auch noch.«
»Ja, ich weiß es. O, mein Gott, sie sind es! Wir müssen unsere Karparla hergeben!«
»Karparla?« fragte Frau Barth, indem sie ihren Blick auf die Genannte richtete. »Mein Himmel! Sollte Karparla unser – – –!«
Sie wagte es nicht, diesen Gedanken auszusprechen; aber ihre Arme erhoben sich, und sie machte eine Bewegung, sich Karparla zu nähern.
Diese hatte tief bewegt aber stumm dagestanden. Was in ihrem Innern vorging, läßt sich nicht beschreiben. Es trieb sie zu den Eltern, und doch hielt es sie zurück. Jetzt aber riß es sie mächtig zu ihnen hin. Die Gewißheit, daß die Beiden ihre Eltern seien, war ja gar nicht weiter abzuleugnen.
»Mutter, meine Mutter!« schrie sie auf und warf sich in ihre Arme.
»Mein Kind, mein Kind!« schluchzte Frau Barth auf. »Ist es möglich? Ist es wahr?«
Sie hielten sich innig umschlungen. Dann schob die glückliche Frau die wiedergefundene Tochter in die Arme des Vaters.
»Kalyna, o Kalyna!« jammerte der Fürst. »Das ist der unglücklichste Tag unsers Lebens.«
»Ja,« antwortete sie weinend. »Der unglücklichste oder aber auch der glücklichste.«
»Das ist doch nur Scherz?«
»Nein. Ist es nicht ein Glück für uns, diesen guten Leuten eine solche Seligkeit bereiten zu können?«
»Wenn Du es von dieser Seite betrachtest, so – – –«
Er sprach nicht weiter; er wendete sich ab. Er weinte leise vor sich hin. Da riß Karparla sich von den Eltern los und eilte zu ihm. Ihn umschlingend, bat sie:
»Weine nicht, Vater, weine nicht, Mutter! Ihr seid ja auch meine Eltern und sollt es stets bleiben.«
»Das geht ja nicht!« meinte der Fürst betrübt.
»Warum denn nicht?«
»Zwei Vater und zwei Mutter, also zwei Elternpaare! Das ist doch zu viel für ein Mädchen!«
Dieser kindliche Ausbruch seines Schmerzes war eigentlich ein Wenig spaßhaft; aber es fiel Niemand ein, zu lachen. Fast zornig fügte Bula hinzu:
»Und wem haben wir das zu danken? Diesem vornehmen, fremden Herrn, welcher – – –«
Er drehte sich um, indem er sich an Steinbach wenden wollte. Dieser befand sich nicht mehr hier. Er hatte sich entfernt, um die fünf Personen mit ihren Gefühlen allein zu lassen.
Drinnen in der Stube sah er Boroda, welcher bei Mila, seiner Geliebten saß.
»Deine Eltern wünschen Dich zu sehen,« sagte er zu ihm. »Du findest sie auf dem Wege nach dem Brunnen.«
Boroda ging, und Steinbach winkte Georg von Adlerhorst zu sich, um ihm zu sagen:
»Auch Sie wird es interessiren, weshalb Boroda von mir zu seinen Eltern gesandt wird. Sie lieben Karparla; ich habe mich darüber gefreut, denn sie ist Ihrer würdig. Sie werden glücklich mit ihr sein.«
Georg schüttelte den Kopf und antwortete trüb:
»Das bezweifle ich. Karparla kann mir ja niemals gehören.«
»Weil Sie annehmen, daß sie ihre Eltern niemals verlassen werde?«
»Ja.«
»Haben Sie mit ihr davon gesprochen?«
»Einige Male. Ich soll hier bleiben und kann doch nicht. Ebenso sehe ich ein, daß es ihr unmöglich ist, mir zu folgen.«
»Vielleicht geht sie doch noch mit Ihnen!«
»Gewiß nicht. Ich bin auch nicht so herzlos, den Eltern ihr Kind zu rauben. Und sodann fragt es sich, selbst wenn Karparla mir folgen wollte, ob sie es aushalten würde. Ich glaube, die Sehnsucht nach ihren Eltern würde an ihr zehren.«
»Wenn sie nun ihre Eltern bei sich hätte?«
»Das kann wohl nicht geschehen. Bula wird die sibirische Erde nie verlassen.«
»Hm! Er hat große Lust, Europa zu sehen.«
»Und wenn er das thäte, so wäre das doch nur vorübergehend. Er kehrt nach hier zurück.«
»Aber während seiner Reise, während seines Aufenthaltes in civilisirten Ländern könnte er seine Ansicht geändert haben. Uebrigens hat nicht er allein über Karparla zu bestimmen.«
»Wer sonst?«
»Ihre Eltern.«
»Nun, das sind doch Bula und Kalyna.«
»Nein, sie sind nur die Pflegeeltern.«
Da fuhr Georg um einige Schritte zurück.
»Herr Steinbach!« rief er aus.
»Erschrecken Sie darüber?«
»Nein. Ich erstaune. Daß diese Beiden nur Karparla's Pflegeeltern sind, das ist wohl Gegenstand des Gespräches gewesen, aber aus Ihrer Ausdrucksweise möchte man schließen, daß die wirklichen Eltern noch vorhanden sind.«
»Das sind sie auch.«
»Herrgott! Karparla weiß doch nichts von ihnen!«
»Sie kennt sie jetzt. Sie hat sie gefunden.«
»Welches Glück, welche Freude!«
»Gehen Sie hinaus zu Boroda. Da werden Sie sie sehen.«
»Zu Boroda? Herr Steinbach, mir kommt eine Ahnung!«
»Was denn für eine?«
»Vielleicht ist es Ihnen und auch Anderen entgangen; aber da ich Karparla lieb habe, so beobachte ich natürlicher Weise Alles genauer, was sie betrifft. Da habe ich denn bemerkt, daß sie eine große Aehnlichkeit mit Boroda besitzt.«
»Jetzt nun finde ich das auch. Vorher aber ist es mir entgangen. Ich war seit meiner Ankunft hier so allgemein in Anspruch genommen, daß ich für Besonderes keine Zeit hatte.«
»Sollte ich also richtig vermuthen! Sie ist die Schwester von Boroda!«
»Ja.«
»Was höre ich! Diese Barths sind ihre Eltern!«
Er schlug in seinem großen Erstaunen die Hände zusammen. Fast schien es, als ob die Nachricht ihn nicht sehr freudig berühre. Darum fragte ihn Steinbach:
»Sie scheinen davon nicht erbaut zu sein?«
»Wieso?«
»Es klingt grad wie eine Enttäuschung aus dem Tone, in welchem Sie sprachen.«
»Meinen Sie? Mir ist nichts bewußt. Warum sollte ich mich enttäuscht fühlen?«
»Sie haben Karparla bisher für die Tochter eines allerdings tungusischen Fürsten gehalten – – –!«
»Ach so! Glauben Sie, daß dieser Umstand bei mir in das Gewicht gefallen sei?«
»Also nicht?«
»Nein. Ich liebe Karparla ihrer selbst wegen. Was ist übrigens ein tungusischer Fürst! Wie hoch würde er auf der europäischen Stufenleiter stehen! Der hiesige Rang des Fürsten ist mir ganz im Gegentheile gar nicht sonderlich erfreulich gewesen.«
»Das ist allerdings sehr leicht zu denken.«
»Wäre Karparla die Tochter eines gewöhnlichen Tungusen, so könnte sie mit ihren Eltern mir nach Deutschland folgen. Bula aber hat seinem Stamme gegenüber Verpflichtungen, denen er sich wohl nur schwer entziehen kann.«
»Pah! Man darf das nicht so schwer nehmen. Es ist hier nicht mit demjenigen Einflusse zu rechnen, welche europäische Traditionen besitzen. Wollte Bula nach Europa, so könnte er seine Heerden verkaufen. Man würde an seiner Stelle einen anderen Fürsten wählen und ihm, da er eine gute, liebe Seele war, ein freundliches, herzliches Andenken widmen. Das ist Alles. Also der Gedanke, ihn mit von hier fortzunehmen, ist keineswegs so unausführbar, wie es den Anschein hat. Nun aber, da Karparla ihre wirklichen Eltern gefunden hat, kann ihr Schicksal sehr leicht oder es wird vielmehr sehr wahrscheinlich eine ganz andere als die bisherige Richtung nehmen.«
»Ist es denn wirklich erwiesen, daß sie Barths Tochter ist?« fragte Georg, noch zweifelnd.
»Zur Evidenz!«
Da erhellte sich Georgs Miene immer mehr auf, so daß sein Gesicht endlich vor Freude strahlte.
»Wenn es so ist,« sagte er, »so bringen Sie mir allerdings eine Botschaft des Glückes, für welche ich Ihnen gar nicht genug zu danken vermag.«
»O, mir sind Sie keinen Dank schuldig.«
»Doch! Ich müßte mich sehr irren, wenn Sie es nicht gewesen sind, welcher die Eltern entdeckt hat.«
»Ich habe sie allerdings gefunden, doch nur ganz zufälliger Weise.«
»Ja, das kennt man an Ihnen! Sie handeln planvoll und schreiben dann das Gelingen auf das Conto des Zufalles, damit man Ihnen ja nicht danken möge!«
»Woher wissen Sie das? Sie thun ja, als ob Sie eine ganz genaue Kenntniß meines Charakters hätten.«
»Sam hat viel von Ihnen erzählt.«
»Ah, Sam, den habe ich ganz vergessen. Er ist doch als glücklicher Oheim in hohem Grade betheiligt.«
Sam saß am Tische und hatte, da Steinbach sich zu ihm wendete und die letzten Worte laut sprach, dieselben gehört:
»Was für ein Onkel soll ich sein?« fragte er.
»Ein sehr glücklicher.«
»Hm! Aus welchem besonderen Grunde denn?«
»Sie haben nicht nur einen Neffen, sondern auch eine Nichte. Ist das nicht doppeltes Glück?«
»Eine Nichte? Von ihr weiß ich kein Wort. Wenn diese Nichte mich ebenso genau kennt wie ich sie, so ist es mit der Verwandtschaft nicht sehr schlimm.«
»Sie ist soeben erst entdeckt worden.«
»Entdeckt? Werden denn die Nichten entdeckt? Hm! Davon weiß ich auch noch nichts. Welcher Astronom hat sie denn durch das Fernrohr gesehen?«
»Ich!«
»Sie? Da halte ich es freilich für möglich.«
»Gehen Sie hinaus zu Ihrem Bruder. Er wird sie Ihnen zeigen. Karparla ist Ihre Nichte.«
»Kar – par – la!« rief der Dicke. »Ich, Sam Barth aus Herlasgrün, soll der Onkel einer so prächtigen Nichte sein? Daran bin ich vollständig unschuldig. Das kann ich auf Ehre und Seligkeit versichern! Uebrigens muß ich durch diese Nichte sehr an Respect gewonnen haben, da ich so plötzlich mit ›Sie‹ angeredet werde. Ich muß nur schnell hinaus, um zu sehen, was Wahres daran ist.«
Er eilte hinaus, aber nicht er allein, sondern alle Anderen außer Semawa folgten ihm. Auch sie waren von der Neuigkeit so freudig überrascht, daß sie sich schnellen Beweis holen wollten.
Kaum war eine Minute vergangen, so ließen sich draußen laute, frohlockende Stimmen hören. Jedermann gönnte der schönen, allgemein geliebten Karparla das Glück, ihre Eltern gefunden zu haben.
Samt war unendlich stolz darauf, der Oheim einer solchen Nichte zu sein. Er erhob seine Stimme am Allerlautesten, und es war in der Stube zu hören, daß er ein dreimaliges Hoch auf dieses so unerwartete Wiedersehen ausbrachte.
Semawa trat zu Steinbach, welcher am Fenster stand und lächelnd auf die Freudenrufe hörte, schlang den Arm um ihn und sagte:
»Mein Geliebter! Welch ein herrlicher, prächtiger Mann bist Du! Es ist, als ob überall das Glück mit Dir einkehre.«
»Willst Du mich etwa vergöttern?« fragte er glücklich.
»Fast möchte ich es. Bist Du denn nicht der Schöpfer auch dieser jetzigen, neuen Freude?«
Er antwortete nicht, aber er drückte sie an sich und küßte sie auf die warmen, schwellenden Lippen.
Da wurde leise die Thür zum Nebengemache geöffnet. Dort in demselben hatte der Maharadscha ausgeruht. Er wollte herein. Als er die schöne Gruppe erblickte, zog er sich zurück und machte die Thüre leise wieder zu. Draußen sank er in die Kniee nieder, faltete die Hände und betete:
»Allah, ich danke Dir! Er liebt sie! Er liebt mein Kind! Jetzt kann ich getrost und ohne Sorge in die Zukunft blicken. Mein Lebensabend wird nach so langen, schweren Leiden ein heiterer und glücklicher sein! – – –«
*