
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
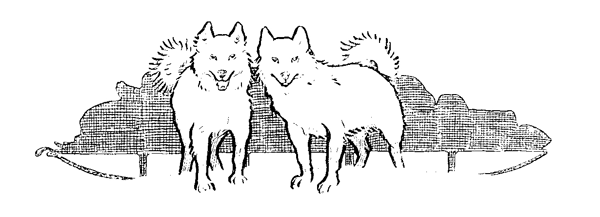
Besteigung der Eisterrasse und Fahrt zwischen den Seehundsnunataks. – Unsere Tagesordnung während der Fahrt. – Einige lange Marschtage. – Die Sturmperiode beginnt. – Ueber Risse und Spalten bis an das Land. – Ein Unglückstag.
Am Morgen stellten sich etliche Windstösse ein, die mich veranlassten, bis um 7 Uhr im Sack zu bleiben. Dann stand ich schleunigst auf: es handelte sich darum, Proviant für eine neue Woche herauszuholen und die Errichtung des Depots anzuordnen. Unser Schlitten wurde jetzt noch mehr erleichtert, so dass seine Last nur noch aus den beiden Schlafsäcken, den Schneeschuhen, Spaten, der Instrumententasche und einigen Kleinigkeiten bestand, das ganze Gewicht betrug, den Schlitten einberechnet, kaum mehr als 50 kg. Auch der Hundeschlitten war allmählich etwas leichter geworden, da wir von dem Proviant verbraucht hatten.
Nie ist uns die Sonne so glühend heiss erschienen wie jetzt, wo uns unser Weg an der Eismauer entlang, zwischen zahllosen Eisbergen von allen Grössen hindurchführte.
Ein strammer Marsch brachte uns in dreieinhalb Stunden direkt zurück, bis wir einen Platz fanden, wo der Wall ohne Fährlichkeiten bestiegen werden konnte, an einer mächtigen Schneewehe entlang, die sich im Schutz eines langen Eisberges an seinem Fuss gebildet hatte. Unser Weg richtete sich nun auf den östlichsten der aus dem Eise aufragenden Nunataks und ging zu Anfang stark bergauf. Völlig ungewiss, welchen Gefahren wir hier entgegengingen, hatte ich diese Fahrt auf das Landeis begonnen. Glücklicherweise war das Eis vorzüglich, eben, mit hartem Schnee bedeckt, fast ohne Sasturgi und vor allem ohne offene Spalten, die wir am allermeisten fürchteten. Allmählich gelangten wir auf die höchste Wölbung hinauf, worauf es wieder langsam abwärts ging, und am Abend schlugen wir unser Lager in der Nähe des langgestreckten Bergrückens auf, der das Ziel des heutigen Tages gewesen war. Noch am selben Abend unternahm ich eine Wanderung hinauf. Es dämmerte bereits, als ich zwischen den wildzerklüfteten, schwarzen Zacken anlangte, die noch die zerrissenen Formen zeigten, in denen die glutflüssige Lava einstmals erstarrt war. Einen Vulkan im eigentlichen Sinne kann man diesen Berg, dem ich den Namen Oceana-Nunatak gegeben habe, nicht nennen.
Das Wetter sah gegen Abend sehr drohend aus, aber diesmal kamen wir doch ohne Sturm davon. Für unsere Schlittenfahrt war diese lange Period von schönem Wetter von grösster Bedeutung, und nur dadurch wurde es uns möglich, in der Zeit, wo das Gepäck am schwersten war, so weit zu kommen. – –
Am nächsten Morgen stattete ich dem Gipfel des Berges einen neuen Besuch ab, ehe wir unsere Fahrt fortsetzten. In wildem Galopp sausten die Hunde den steilen Eisabhang hinab, und nur mit Mühe gelang es Jonassen, ein Unglück zu verhindern. Nachdem wir auf das flache Eis hinuntergekommen waren, nahmen wir unsern Kurs in der Richtung auf den nächsten Nunatak zu, aber wir waren noch nicht weit gekommen, als plötzlich ein Sturm mit dichtem Schneegestöber von der Südseite her losbrach. Ich bog nach dem Lande zu ab, um Schutz unter dem zunächstgelegenen westlichen Vorgebirge zu suchen, wo wir nach einer Stunde angestrengten Marsches, direkt gegen den Sturm an, glücklich eintrafen. Hier angelangt, fanden wir an der ganzen Seite des Berges entlang eine tiefe Rinne, eine Einsenkung in das Eis, die sich dadurch gebildet hatte, dass die Sonnenwärme von der dunkeln Bergwand zurückgestrahlt wurde. Diese Vertiefungen sind sehr charakteristisch, wenigstens für die nördliche Seite der Nunataks in dieser Gegend, und der Wind hält sie, wenn sie sich einmal gebildet haben, offen, indem er allen Schnee wegtreibt, der sich sonst darin ablagern würde.
Da wir vermuteten, unten im Tal Schutz zu finden, wollten wir unsere Schlitten dahin fahren. Der Abhang war aber sehr hoch und steil, weswegen ich mich nach einer Stelle umsah, wo wir bequem hinunter kommen konnten. Jonassen wurde aber die Zeit lang, und ungeduldig, wie er war, fuhr er mit Hunden und Schlitten die fast senkrechte Eiswand hinab. An der steilsten Stelle warf der Schlitten um und im nächsten Augenblick rollten Mann, Hunde und Schlitten durcheinander in die Tiefe hinab. Erschrocken eilte ich herzu, denn ich war fest überzeugt, dass Jonassen schwer zu Schaden gekommen sei, mindestens Arme und Beine gebrochen habe. Wunderbarerweise waren er und die Hunde ganz unversehrt, das einzige, was einer Ausbesserung bedurfte, war eine Petroleumkanne, die ein arges Leck bekommen hatte. Wir schlugen unser Zelt auf und blieben für den Rest des Tages ruhig unten im Tal liegen.
Gegen Abend fiel die Temperatur bedeutend, es war sonderbar, wie sehr man sich schon von der Kälte entwöhnt hatte, aber das kam wohl daher, dass die Haut an allen unbedeckten Stellen infolge der starken Sonne und des scharfen Frostes aufgesprungen war.
Auch der folgende Tag begann mit Kälte und Nebel. Unsere erste Sorge war, aus unserer Gruft heraus und dann auf den hohen Schneewall hinaufzukommen, der den Kastor- und den Hertha-Nunatak verbindet. Oben angelangt, konnten wir jedoch nichts sehen, da die unteren Gegenden in dichten Nebel gehüllt waren. Wir mussten unsern Kurs nach dem Kompass südwestlich nehmen, in der Hoffnung, hier auf keinen allzusteilen Weg zu stossen. Damit hatten wir auch wirklich Glück, die Schlitten glitten einen sanft abfallenden Abhang hinab, und der schwach von hinten kommende Wind half uns vorwärts. Am Nachmittag fing der Nebel an sich zu lichten, und allmählich sahen wir im Süden das König Oscar-Land in seiner ganzen Ausdehnung vor uns liegen, scheinbar durch einige isolierte, in weiter Ferne aufragende Bergspitzen abgeschlossen.
Der Nordwind hatte im Laufe des Tages zugenommen, und nach der Witterung zu urteilen, die wir jetzt schon so lange gehabt hatten, fürchteten wir fast, dass in dieser Jahreszeit der Südwestwind nicht der gefährliche Wind sei. Auf unserm Lagerplatz angelangt, hielten wir es deswegen für geraten, die Öffnung unseres Zeltes der Südseite zuzuwenden. Dies war jedoch sehr unvorsichtig, um so mehr, als wir auf Sturm gefasst sein konnten. Das Barometer war nämlich gefallen, und am Abend hatten wir eine jener wunderbaren Beleuchtungen, die in der Regel Vorboten schlechten Wetters waren, schwere zusammengeballte Wolken, die sich bis auf das Land herabsenken, dessen äussere Vorgebirge wie freistehende Alpenpartien aufragen, während das innere Hochland völlig in Nebel gehüllt ist und der Horizont in blutroten Tinten flammt. Als wir eben in das Zelt gekommen waren, begann der Nordostwind zu heulen, um sich aber ebenso schnell wieder zu beruhigen, so dass ungefähr fünf Minuten lang völlige Windstille herrschte. Da ertönte plötzlich in einiger Entfernung ein lautes Getöse, und im nächsten Augenblick rüttelte ein fürchterlicher Sturm unser Zelt. Wir hofften, dass dieser Zustand vorübergehen würde, statt dessen aber wurde der Wind immer heftiger, und im Zelt, durch dessen Öffnung Schnee und Wind hereindrangen, war es sehr kalt. Glücklicherweise aber blieb es unversehrt stehen, bis Sobral am nächsten Morgen hinaus gehen wollte, um die meteorologischen Observationen vorzunehmen. Da stürmte der Wind mit einer solchen Macht herein, dass es unmöglich war, die Türöffnung wieder zu schliessen. Wir mussten schnell aufstehen und das Zelt herumdrehen, was uns auch gelang, ohne dass wir genötigt waren, unsere im Zelt befindlichen Sachen hinauszuschaffen. Dann kochten wir Kaffee und krochen wieder in unsere Säcke.
Im Laufe der Nacht liess der Wind wieder nach, und nun folgten drei Arbeitstage, die infolge der langen Märsche zu den beschwerlichsten auf unserer ganzen Expedition, zugleich aber auch zu den erfolgreichsten gehören. Die Kälte war schneidend, und beständig hatten wir den scharfen Wind im Gesicht. Um ein anschauliches Bild von dem Leben auf unsern Schlittenfahrten zu geben, will ich hier den Verlauf eines solchen Tages schildern:
Auf dem Breitengrad, auf dem wir uns jetzt befinden, ist es in dieser Jahreszeit fast die ganze Nacht hindurch hell, in der Regel steht aber niemand von uns früher als gegen 7 Uhr auf. Es ist zur Gewohnheit geworden, dass ich den Schlafsack zuerst verlasse und das Frühstück bereite. Unter den obwaltenden Verhältnissen ist diese Arbeit sauer genug. Die Kleider, die allmählich mit Feuchtigkeit und Schweiss getränkt sind, gefrieren in der Luft, wenn man aus dem warmen Bett kommt. Noch ehe man die Knöpfe an der Zelttür geöffnet hat, sind die Hände schon ganz erstarrt, so dass man sie schnell in die Fausthandschuhe stecken muss, um sie wieder aufzutauen. »Das Kochen ist ein kaltes Vergnügen!« so schliesst eine Seite in meinem Tagebuch, und so manche Erinnerung knüpft sich an diese Worte, denn es ist wirklich kein Spass, mit frosterstarrten Fingern alle Gerätschaften zusammenzuholen, den Spiritusbrenner anzuzünden und den eisgefüllten Kochtopf aufzusetzen.
Der Speisezettel für unser Frühstück ist immer derselbe, das Hauptgericht besteht aus Pemmikan, wovon 600 g zu einer dicken, beinahe breiartigen Suppe verkocht werden, deren bedeutenden Nährwert man förmlich zu fühlen vermeint. Ferner bekommen wir Kaffee, vier gehäufte Esslöffel voll in einem Kochtopf gekocht, sowie Fleischcakes, Butter und Zucker, und an dieser Ration müssen wir uns dann den ganzen Tag genügen lassen, was wir auch tun, ohne eigentlich Hunger zu spüren.
Während es meine Aufgabe ist, das Essen zu bereiten, liegt es Jonassen ob, das Zelt abzuschlagen und den grossen Schlitten zu beladen und anzuschirren. Unsern Schlitten bringt in der Regel Sobral in Ordnung. Zwischen 9 und 10 Uhr geht es von dannen, in schnellem Marsch, mit höchstens einmaliger Rast in der Stunde, abgesehen natürlich von den Fällen, wo Observationen gemacht werden sollen. Alles hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der Sobral und ich unsern Schlitten ziehen können, denn die Hunde folgen uns immer auf den Fersen. Wenn wir ungefähr neun Stunden auf diese Weise gefahren sind, fangen wir an, nach einem passenden Lagerplatz auszuspähen, auf ebenem, schneebedecktem Terrain, doch darf der Schnee weder zu lose, noch zu hart sein, und wenn wir die richtige Stelle gefunden haben, fahren wir mit unsern Schlitten dahin. Je einen derselben plazieren wir zu beiden Seiten des Zeltes, das letztere ist mit eisernen Krampen und mit Pfählen festgemacht, die teils von den Zeltstangen, teils von zwei horizontalen Seitenstangen aus Bambus ausgehen, welche an die Schlitten befestigt sind.
Jonassen schlägt das Zelt auf und ordnet die Sachen, worauf er den Hunden zu fressen gibt. Inzwischen schicke ich mich an, mit Sobrals Hilfe das Abendbrot zu bereiten. Dies ist beträchtlich weniger massiv als das Frühstück und besteht abwechselnd aus Linsen- oder Erbsensuppe und Fleisch-Schokolade mit Brot, Butter und Pastete, oder zuweilen Schinken. Sobald die Mahlzeit eingenommen ist, werden die Schlafsäcke ausgebreitet. Jonassen und ich kriechen in den grossen zweischläfrigen Sack aus Renntierfell. Der Rock wird ausgezogen und unter den Kopf gelegt, ebenso die Schuhe, die mit Heu ausgestopft werden, damit sie, falls sie während der Nacht steif frieren, ihre Form nicht zu sehr verlieren. Wir haben auch jeder unser Guanacofell, in das der Oberkörper gehüllt wird; Dies ist meiner Ansicht nach eine äusserst angenehme Zugabe zu der gewöhnlichen Ausrüstung, denn solche Felle wiegen nur ganz wenig, und ihnen haben wir es zu verdanken, dass wir fast niemals froren und, was noch wichtiger ist, gänzlich unabhängig voneinander waren, so dass z. B. derjenige, der mit unbedecktem Kopf liegen wollte, es ruhig tun konnte, ohne seinen Schlafgefährten zu stören.
Sobral hatte seinen eigenen, etwas kleineren, aus Segeltuch und dreifachem Filz verfertigten Schlafsack mitgenommen. Dieser war weniger warm als der unsere, und um nicht zu frieren, musste Sobral beständig ganz angekleidet schlafen.
Meine Kleidung am Tage bestand aus einem Friesanzug und doppelten wollenen Unterkleidern. Auf dem Kopf hatte ich eine Pelzmütze, an den Händen Fausthandschuhe, an den Füssen Strümpfe und kurze Socken aus Wolle mit hineingewebten Menschenhaaren, und darüber sogenannte »Skaller«-Schuhe aus Renntierfell. Bei Sturm zog ich Windkleider aus Segeltuch darüber, aber ich war nur sehr selten gezwungen, sie zu benutzen. So lange man in Bewegung ist, empfindet man die Kälte nur wenig.
An jedem dieser drei Tage legten wir nach dem Schrittmesser 50 000 Schritte zurück, einer Weglänge von 35 km entsprechend. Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, dass wir während dieser Zeit viele neue Beobachtungen machten. Die ganze, weit gestreckte Alpenlandschaft, der wir, uns in schrägem Kurs näherten, musste als unbekannt angesehen werden. Vor uns lag das Gebiet, das Larsen den Jonasberg benannt hat. So weit wir sehen konnten, besteht dies ebenso wie die Robertson-Insel aus einer zusammenhängenden Eiskuppel, aus der am Rande einige unbedeutende Nunataks aufragen.
Am interessantesten von allem war indes die sonderbare Eisterrasse, über die unsere Fahrt dahinging. Noch zu Ende dieser Zeit war ich mir nicht ganz klar darüber, ob wir nicht über altes Meereis wanderten, wenn auch das Fehlen jeglicher Spalte und Eisberge dagegen sprach. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist es wohl möglich, dass eine solche Auffassung absolut die richtigste wäre; dass wir es hier aber nicht mit gewöhnlichem Meereis zu tun hatten, wie wir es in andern Gegenden kennen gelernt, sollte die Erfahrung der folgenden Tage zeigen.

Unsere vierbeinigen Kameraden
Die Geschwindigkeit unseres Marsches erklärt sich dadurch, dass unsere Lasten allmählich bedeutend leichter wurden, freilich wäre ein so schnelles Vorwärtskommen unmöglich gewesen, wenn uns unsere Hunde nicht so kräftigen Beistand geleistet hätten. Wer Gelegenheit gehabt hat, Vergleiche anzustellen, wird wohl keinen Augenblick darüber im Zweifel sein, welche Vorteile die Verwendung von Hunden statt der Menschenkräfte einer Expedition gewährt. Mit diesen treuen Gehilfen knüpft sich unter solchen Verhältnissen ein Freundschaftsband, das um so fester wird, je einsamer man sich im übrigen fühlt, und man kann nicht genug bewundern, wie geduldig sie den ganzen Tag hindurch die schwere Last schleppen. Ganz gegen unsere Erwartung zog Kurre tüchtig mit an, und obwohl er sich in Bezug auf Stärke nicht mit den Grönländern messen konnte, bewies er doch, dass sich die falkländische Hunderasse für kürzere Schlittenfahrten wohl anwenden lässt.
Unsere vierbeinigen Kameraden waren jetzt allerdings nicht mehr so kräftig wie im Anfang. Des Abends hatten sie einen wahren Heisshunger, ihre aus ? kg Pemmikan bestehende Ration verschlangen sie im Handumdrehen und gingen dann sofort bei den schwächeren Kameraden auf Raub aus. Überhaupt hat man hier oft Gelegenheit zu sehen, wie der Stärkere über den Schwächeren herfällt. Wenn z. B. Jonassen verstimmt darüber ist, dass nicht alles so geht, wie er es sich gewünscht hat, findet er sehr bald Veranlassung, einen der Hunde, z. B. Suggen, dies entgelten zu lassen. Im nächsten Augenblick stürzt sich dieser auf Basken, den andern Hund, der ebenso gross und stark ist wie er selber, der aber nach der bei diesen Tieren herrschenden Rangordnung verurteilt ist, dem Herrscher der Schar die grösste Untertänigkeit zu erweisen. Unter jämmerlichem Geheul wirft er sich auf den Rücken und fleht um Gnade, während Suggen knurrend und zähnefletschend daneben steht. Kaum aber hat sich der letztere abgewendet, als auch der erstere schon wieder auf den Beinen ist und entweder eine der Hündinnen oder noch häufiger den armen Kurre überfällt, der von seinem Platz weggejagt, seines Futters beraubt, gebissen und oft mit dem Tode bedroht wird.
Einige Eindrücke aus den folgenden Tagen müssen hier nach dem Tagebuch angeführt werden.
Den 17. Oktober. So ist denn endlich der Sturm allen Ernstes gekommen; hier hegen wir nun in unsern Säcken und können nichts weiter tun, als uns in Geduld üben. Es war ein schöner Festtag, den wir nach Verabredung mit den Zuhausegebliebenen am 16., dem Jahrestag unserer Abreise aus Schweden, feiern wollten, – ein wenig Schokolade, zu der wir das Wasser aus Schnee gewannen, der ins Zelt hineingeweht wurde, sowie Butter und Brot, zum Abendessen trockenes Brot und Schokolade.
Sonderbar, dass ich immer da liegen und an Essen denken muss, an gutes Essen, Leckerbissen, wie ich sie früher gegessen habe oder hätte essen können, oder wie ich sie noch einmal zu essen hoffe, und zwar plagen mich diese Visionen im Wachen wie im Träumen. Namentlich träume ich davon, wie gut es sein wird, wieder einmal eine ordentliche Mahlzeit zu verzehren, wenn wir nach der Station zurückgekehrt sind. Dergleichen Dinge pflegen doch sonst meine Gedanken nicht zu beschäftigen. Ich habe auch gemerkt, dass ich den Geschmack auf der Zungenspitze fast völlig eingebüsst habe; als ich unsern Proviant umpacken wollte und mir ein Päckchen Salz in die Hände fiel, musste ich erst die andern fragen, um sicher zu sein, dass es kein Zucker war. Das machen wohl alle die heissen Suppen, die man beständig essen muss und die einem die Zunge verbrennen.
Jetzt gegen Abend lässt der Wind ein wenig nach und wir dürfen morgen wohl auf einen günstigeren Tag rechnen. Wir sind nun nach jeder Richtung hin so weit gediehen, dass, wenn die Fahrt, wie es doch mein Wunsch ist, ein abgeschlossenes Resultat ergeben soll, wir alles daran setzen müssen, um schleunigst vorwärts zu gelangen. Später müssen wir dann auf Glück, guten Willen und gutes Wetter während der Heimfahrt hoffen, um die neu entdeckten Gegenden genauer untersuchen zu können. Deswegen habe ich beschlossen, den kleinen Schlitten mit allem Gepäck, das wir entbehren können, hier draussen auf dem Eise zurückzulassen und mit Proviant für nur acht Tage ausgerüstet weiter zu gehen.
Den 18. Oktober. Am Morgen wehte es wieder heftig und es waren schlechte Aussichten für unsern Marsch, dann aber wurde es ein wenig stiller, und gegen Mittag machten wir uns auf den Weg. Kaum waren wir jedoch unterwegs, als der Wind sich wieder aufmachte, trotzdem ging unsere Fahrt jetzt, da wir nur einen Schlitten hatten, bedeutend schneller von statten. Ich ging, so schnell ich konnte, voran, und es machte den Hunden keine Schwierigkeit zu folgen. Es war meine Absicht, die alleräusserste Bergspitze, die im Süden sichtbar war, zu erreichen. Ich rechnete, dass es zwei Tage erfordern würde, um bis dahin zu gelangen, und hoffte, dann noch einen dritten Tag zur Verfügung zu haben, um auf Schneeschuhen unsere Untersuchungen fortsetzen zu können.
Bis zu diesem Augenblick war ich mir nicht klar darüber gewesen, ob wir uns auf Meereis oder Gletschereis befanden, jetzt aber trafen wir häufig Spalten an, die uns belehrten, dass das letztere der Fall war. Damit waren alle unsere Hoffnungen, Seehunde zur Vermehrung unseres Proviants zu finden, vernichtet. Kaum waren wir zu dieser Überzeugung gelangt, als wir auf eine neue, unter diesen Verhältnissen ebenso unerwartete wie unwillkommene Erscheinung stiessen. Ganz nahe vor uns erhob sich ein langer Wall, der von dem im Westen gelegenen Lande ausging und im Osten am Horizont verschwand, wo er offenbar mit den Eismassen um den Jasonberg herum zusammentraf. Wir würden also gezwungen sein, eine neue, hohe Gletscherterrasse zu besteigen, und dass sie nicht so eben war wie das Eis, das wir eben passiert hatten, konnte man schon aus der Entfernung sehen. Gleichzeitig nahm der Wind zu, und unsere Aussichten erwiesen sich für diesen langen Marsch so schlecht wie möglich.
Bald waren wir an der Eismauer angelangt, deren unterer Rand leicht bestiegen werden konnte, oben stiessen wir aber auf ein Terrain, das meiner Erfahrung nach ganz neu war, wenngleich es bei arktischen Gletschern nichts ungewöhnliches ist. Auf einer Strecke von ungefähr einer Meile war nämlich das Eis durch und durch von Spalten zerteilt, die glücklicherweise einen scharfen Winkel zu unserer Marschrichtung bildeten und jetzt um diese Jahreszeit mit ganz festen Eisbrücken überspannt waren. Trotzdem war es unangenehm, ohne die nötige Zeit zur Rekognoszierung, auf einem völlig unbekannten Gebiet und in schnellem Tempo vorwärts zu marschieren, der Gefahr ausgesetzt, im nächsten Augenblick in einen so tiefen Spalt hinein zu rennen, dass jegliche Rettung ausgeschlossen gewesen wäre. Hart am Rande vieler Meter breiter, grundloser, gähnender, blauer Abgründe ging es dahin über gebrechliche Schneebrücken, die in der Regel wenigstens an der einen Seite so dünn waren, dass der Fuss hindurch sank. Mehrmals blieb ich bis zum Gürtel im Schnee stecken; die schlimmste Erfahrung sollte ich aber an einem breiten Spalt machen, den wir ganz unerwartet antrafen, lange nachdem wir die eigentliche Spaltenzone passiert hatten. Ehe ich noch wusste, wie mir geschah, versank ich schon bis an die Achseln. Glücklicherweise gelang es mir, den Stab quer über den Spalt zu werfen, so dass ich, mich auf die feste Eiskante stützend, wieder heraufklettern konnte. Der Schlitten und die Hunde folgten mir auf den Fersen, ich konnte sie nicht zurückhalten, ehe auch sie sich mitten über dem Spalt befanden, und infolgedessen brach dann auch Jonassen ein. Er hatte so viel Geistesgegenwart, sich an den Schlitten zu klammern, der sich glücklicherweise auf der Oberfläche hielt und der mit vereinten Kräften schleunigst hinüber gezogen wurde. Es fehlte nicht viel daran, so hätte dieser Spalt uns samt dem Schlitten verschlungen, und keine Spur wäre von uns zurückgeblieben.

Mehrere Male versank man in breite Spalten, und es galt, vorsichtig zu sein
Ich war froh, als wir wieder festeres Eis unter den Füssen hatten. Ich hatte unsern Kurs geändert und steuerte jetzt auf die nächste Bergpartie zu, um die Nacht nicht draussen zwischen den Spalten zuzubringen. Der Weg führte uns anfänglich einen kleinen Abhang hinab; eine Weile lang verschwand nun das Ziel unsern Blicken, dann ging es einen langen Hügel hinauf, und schliesslich kamen wir auf ebenes, hartes, blaues Eis mit ganz wenig Schnee, bis wir gegen 6 Uhr abends den Rand des Berges erreichten.
Den ganzen Tag hatten wir den Südwestwind gerade ins Gesicht gehabt, aber hier war es ganz geschützt. Wir machten nicht viel Umstände mit dem Lagerplatz, sondern schlugen unser Zelt auf dem Eise am Fusse eines vorspringenden, braun verwitterten Felsenvorgebirges auf, das vom Frost in gewaltige Blöcke zersprengt war. Man stelle sich vor, mit welchen Gefühlen ich zu diesen Klippen hineilte, war es doch das erstemal, dass eines Menschen Fuss die ganze Ostküste des westantarktischen Festlandes betrat. Das Gestein bestand aus einem Porphyrit, in dem zahlreiche dunklere Bruchstücke enthalten waren. Es wäre mir lieber gewesen, ein anderes Gestein anzutreffen, das für ein grösseres Gebiet als typisch angesehen werden konnte, aber ich vertröstete mich mit der Hoffnung auf einen andern Platz.
Den 19. Oktober. Es scheint, als ob die Sonntage unsere Unglückstage sein sollten, aber der heutige war doch der schlimmste von allen. Als wir in unsere Schlafsäcke gekrochen waren, kam es uns drinnen recht warm vor, aber um ½3 brach der Sturm mit erneuter Kraft los und wir merkten bald, dass unser Lagerplatz schlecht gewählt war. Dicht neben uns befand sich eine tiefe Rinne zwischen der Bergwand und dem Eise, von derselben Art wie die, in der wir am Kastor-Nunatak einen so geschützten Lagerplatz gefunden hatten. Schon am Abend hatten wir gemeint, dass wir dort Schutz suchen mussten, und jetzt, als der Sturm immer schlimmer wurde, standen wir um 4 Uhr morgens auf und fuhren mit allen unsern Sachen nach dieser Rinne. Es war unser Unglück, dass der Wind gerade jetzt ein wenig nachliess, wir unterschätzten ihn infolgedessen und glaubten uns in Sicherheit, nachdem wir unser Zelt an einem Platz aufgeschlagen hatten, der uns geschützt erschien. Ich war in das Zelt hineingegangen, um unsere Sachen zu ordnen, als ich an Jonassens Stimme, der noch immer draussen war, erkannte, dass ein Unglück geschehen sein musste. Gleich darauf kam er herein, bleich und elend, und erzählte, sein linker Arm sei beinahe von einem grossen Steinblock zerschmettert worden, den er habe herbeischleppen wollen, um das Zelt damit zu befestigen. Er war auf dem glatten, nur mit wenigem Schnee bedeckten Eise ausgeglitten, und es war ein grosses Glück, dass der Arm nicht ganz verloren war. Er schwoll schnell an und wurde ganz blau. Gerade weil niemand von uns die Grösse der Gefahr zu beurteilen vermochte, kann man sich nicht wundern, dass ich der Zukunft ein wenig trübe entgegensah; selbst im besten Falle war es unmöglich für ihn, den Arm zu schweren Arbeiten zu benutzen, so lange wir von der Station entfernt waren.

Schliesslich gelang es uns, oben zwischen den Klippen einen einigermassen geschützten Lagerplatz zu finden
Wir sollten uns auf unserm neuen Lagerplatz nicht lange der Ruhe erfreuen. Der Sturm nahm zu und trat hier mit gewaltigen Stössen auf, denen allemal eine kurze Windstille folgte. Es war unheimlich, ruhig dazuliegen und diesen orkanartigen Stössen zu lauschen, die unser ganzes kleines Zelt erschütterten und uns wegzufegen drohten. Wir versuchten still zu sein und uns mit der Hoffnung auf Besserung zu trösten, aber statt dessen wurde das Wetter ärger und ärger. Ich ging hinaus, um noch einige Steine für die Befestigung des Zeltes zu holen und zugleich nachzusehen, ob ich nicht einen etwas geschützteren Platz für unser Lager finden könne. Der Sturm war aber so heftig, dass er mich wieder und wieder auf dem Eise umwarf, und irgend welchen Schutz konnte ich nicht finden. Also kroch ich wieder in meinen Sack und hoffte von ganzem Herzen, dass eine Besserung eintreten möge. Die Gewaltsamkeit des Orkans steigerte sich indessen von Stunde zu Stunde; um 12 Uhr zerriss das Zelt, und nun gab es keine Hilfe mehr, wir mussten uns alle in grösster Eile in Sicherheit bringen. Kräftig vom Winde unterstützt, brachten wir unsern Schlitten auf das jetzt ganz spiegelglatte Eis, von dem aller Schnee weggeweht war.
Es handelte sich nun darum, Schutz auf der andern Seite des Felsvorsprungs zu finden, wo wir zuerst unser Lager aufgeschlagen hatten. Erwies sich dieser Versuch als fruchtlos, so schwebte voraussichtlich unser Leben in Gefahr. Aber diesmal war uns das Glück hold. Die Windstösse kamen hier von beiden Seiten, hatten aber keine richtige Kraft. Jonassen nähte mitten in allem Sturm das Zelt wieder zusammen, dabei erfroren ihm aber alle Finger an der einen Hand. Sobral und ich arbeiteten währenddessen ganz oben zwischen den Felsklippen, wo wir eine Stufe in eine kleine Schneewehe hauten und mit Steinen eine Terrasse bauten, die gross genug war, um die Unterlage für unser Zelt zu bilden. Gegen 6 Uhr war alles fertig, und ich konnte anfangen, unser Mittag zu kochen. Wie herrlich war es aber, nach der Mahlzeit wieder in den Schlafsack zu kriechen, nachdem wir endlich wieder ein Dach über dem Haupte hatten.