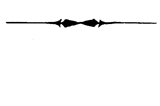|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Schule des Fräulein Berg erfreute sich mit Recht des besten Rufes. Sie nahm sowohl Mädchen als Knaben auf; in den vorderen Zimmern saßen die Knaben, in den hinteren die Mädchen. Die Knaben wogten jetzt vor dem Anfange der Stunden bunt durcheinander, die Freunde begrüßten sich, fragten nach den Erlebnissen in den Ferien und hatten sich aus dieser goldenen Zeit mancherlei zu erzählen, oder betrachteten neugierig die »Füchse«, die schüchtern an den Wänden standen und mit Staunen und Ehrfurcht die älteren Schüler beobachteten. Der Doctor führte nun Heinz durch die Menge der Knaben, deren Blicke sich auf den neuen Ankömmling richteten, zu Fräulein Berg, einer ältlichen Dame mit einem freundlichen Gesicht, welche durch Frau Agnes schon einigermaßen mit den Charakteranlagen ihres neuen Schülers bekannt war. Sie kam ihm daher sehr freundlich entgegen, ließ sich auch dadurch durchaus nicht irre machen, daß Heinz auf keine ihrer Fragen antwortete und sich darauf beschränkte, sie hartnäckig anzustarren. Der Doctor ging nun fort und Heinz blieb allein zurück. Ihm wurde ein Platz angewiesen und nun zogen wie im Traum drei Stunden lang allerlei unerhörte Bilder an ihm vorüber. Alle die Knaben, die ihn vorhin so peinlich betrachtet hatten, kamen nun herein und setzten sich an denselben langen, schwarzen Tisch, an dem auch er saß. Darauf kam eine bleiche, junge Dame und setzte sich an das eine Ende des Tisches. Dann sprangen ein halbes Dutzend der kleinen Burschen auf, ergriffen lange, braune Stöcke und stellten sich mit ihnen vor eine große Wandkarte. »Wo ist unsere Stadt?« fragte das bleiche junge Mädchen, »nun?« und sogleich fuhren die Spitzen von fünf Stöcken auf einen Punkt der Karte zusammen, der sechste aber irrte weit ab. Da ist jedoch Nichts zu sehen als ein brauner Fleck. Unterdessen fliegen Heinz mehrfach kleine Papierkugeln an den Kopf, ohne daß sich irgend errathen ließe, woher sie kommen.
Dann folgte eine Pause von ein paar Augenblicken, wo Alle aufstehen und durcheinandergehen, und da tritt ein kleiner flachsköpfiger Bursche ihn auf den Fuß und sieht ihn dazu höhnisch von oben bis unten an, während die Umstehenden in ein schallendes Gelächter ausbrechen. Jetzt nimmt den Platz der jungen Dame mit den bleichen Wangen eine junge Dame ein, die Wangen hat so roth wie Weihnachtsäpfel. Als nach einer Stunde auch diese junge Dame sich entfernt, benutzt der Junge mit den flachsblonden Haaren die Zwischenpause dazu, um mit seiner flachen Hand recht derb über Heinzens Gesicht zu fahren, erst von unten nach oben, dann von oben nach unten und ihm bei dieser Gelegenheit mitzutheilen, daß man so nach Riga und wieder zurück fahre. Ehe Heinz noch Zeit hat, diese unerhörte Beleidigung zu ahnden, setzt sich schon wieder Alles und Heinz hört nun von den Thaten des Herakles erzählen. Nun tritt eine längere Pause ein; jeder Junge zieht große Butterbröde hervor und begiebt sich in's Vorzimmer. Heinz aber hungert und bleibt sitzen, weil er nicht weiß, wie er sich den Spöttereien des Flachsblonden gegenüber verhalten soll. Seine Verwirrung wird natürlich noch bei weitem vermehrt, als plötzlich ein untersetzter Bursche vor ihn tritt, und ihn ebenfalls vom Kopf bis zu den Zehen mustert, als ob er ein Schneider wäre, der Heinz einen Anzug machen müßte, ohne Maaß nehmen zu dürfen und ihn dann im impertinentesten Tone fragt, wie er heiße?
»Ich heiße Heinrich.«
»Heinrich? Heinrich kann jeder heißen!«
»Was fragst Du denn das Fuchsgesicht, wie es heißt,« ruft der Flachsblonde dem Untersetzten zu. »Es weiß ja nicht, wie es heißt. Es heißt ja nicht Heinrich, sondern Gänserich.«
So par es behandelt zu werden, ist denn doch selbst Heinz zu stark und er merkt, daß er absichtlich verhöhnt wird. Darüber kommt er zur Besinnung und die äußerste Wuth bemächtigt sich seiner. »Du heißt vielleicht nicht Gänserich, aber Du bist einer,« ruft er dem Flachsblonden zu, und als sich ihm dieser nun mit drohender Miene nähert, giebt er ihm ein paar regelrechte Ohrfeigen. Große Sensation! Die öffentliche Meinung theilt sich in zwei Heerlager. Die Majorität ist der Meinung, daß man ein solches Betragen seitens der Füchse durchaus nicht aufkommen lassen dürfe, die Minorität dagegen ist der Ansicht, daß der Flachsblonde alles Maaß überschritten habe und Heinz daher in seinem Recht sei. Unterdessen balgen sich die Beiden, aber Heinz ist viel stärker als sein Gegner und zerprügelt ihn jämmerlich. Er hat seine erste Prügelei mit Ehren bestanden und wird daher von älteren Sachverständigen beglückwünscht. In der nächsten und letzten Pause nähern sich ihm mehrere von den ältesten Schülern der Classe und erkundigen sich in achtungsvollem Tone nach seinen Personalien. Sie wünschen seine nähere Bekanntschaft zu machen, und einer von ihnen proponirt ihm, nach dem Schluß der Schule gemeinsam einige Kuchen beim Conditor zu verzehren. Heinz kann aber auf diese lockende Proposition nicht eingehen, da heute, als an seinem ersten Schultage, ihn Weinthal abholen soll. Er erhält dann beim Schluß der Schule eine kleine, rosafarbene Karte, die er seiner Mutter zu überliefern hat, wird von Fräulein Berg freundlich gefragt, ob es ihm denn auch in der Schule gefallen habe, und trottet dann an der Seite Weinthals sehr zufrieden dem väterlichen Hause zu. Er ist in sehr angenehmer Stimmung. Er hat nun das Schulfieber hinter sich und fühlt sich als Schüler. Er weiht Weinthal natürlich in das Abenteuer mit dem Flachsblonden ein und erhält dafür hohes Lob. »So ist's gut, Jungherrchen,« sagt Weinthal. »Nicht geraisonnirt – zugehauen! Solch ein infamichter Bengel! Denn sollte der gnädige Herr einmal in die Hände bekommen! Er würde ihm schon zeigen! Aber nun, schad't nichts, Jungherrchen hat ihm gut gegeben, Jungherrchen ist dem gnädigen Herrn sein Sohn, wie wird denn Jungherrchen keine Courage nicht haben?«
Zu Hause angelangt, erzählt Heinz nun auch der Mutter seine Erlebnisse, und sie ist Eichenstamm genug, um sein energisches Verfahren zu würdigen. Heinz sitzt auf der Mutter Bett, verspeiset ein Butterbrod nach dem andern, schwatzt dabei wie ein Rohrsperling und ist seelenvergnügt.
Als ihn die Mutter nachher mit einem Auftrage in die Küche schickt, wird er auch hier durchaus honorirt. Annettchen theilt ihm mit, daß sie stolz darauf sei, daß Jungherrchen schon in die Schule gehe und bewirthet ihn in Folge dessen mit Kirschsaft; Weinthal erzählt von der Heldenthat und Emma hört ihm andächtig zu, indem sie Heinzens Auftreten vollkommen billigt.
Emma handelt in diesem Augenblick sehr edel, denn sie hätte das Recht gehabt, bei dieser Gelegenheit eine gewisse Theilnahmlosigkeit gegen Heinzens Schicksale an den Tag zu legen. Gestern Abend war die Scene zwischen dem Doctor und seinem Sohn auf die Tagesordnung der Küche gesetzt worden, und in der sich nun entspinnenden Debatte hatte Emma sich die Worte entschlüpfen lassen: »Es ist ganz gut, daß der gnädige Herr dafür sorgen thut, daß der Jungherrchen nicht auch wird, wie dem Jungherrchen sein Vater selber ist.« Diese Bemerkung zog ihr von Seiten Annettens die Zurechtweisung zu, daß sie eine junge Person, d. h. erst seit fünf Jahren in diesem Hause sei, es sich für sie daher nicht schicke, so äußerst unbedacht zu reden; daß sie ja, falls es ihr bei den Eichenstamms nicht gefalle, das Haus verlassen könne, und daß sie jedenfalls die Gefühle anderer, weniger rücksichtsloser Leute schonen solle. Weinthal hatte sie sogar eine »obsternaksche Person« genannt und selbst der Kutscher hatte ein sehr vernehmbares Murren hören lassen. Emma war über die Aufnahme, welche ihre Worte fanden, sehr erschreckt gewesen, und hatte mit etwas weinerlicher Stimme erklärt, daß, wenn sie gesagt habe, daß es wünschenswerth sei, Heinz möchte nicht wie sein Vater werden, sie nur gemeint habe, sie könne nur wünschen, daß Heinz ganz wie der Vater würde. Darauf hatten zwar die Drei, erwidert, daß sie mit dieser Erklärung zufrieden seien, sie waren aber doch während des ganzen Abends sehr zurückhaltend gegen sie gewesen.
Indessen trug Emma, wie man sieht, diese Kränkung dem unschuldigen Heinz nicht nach.
Später kam der Doctor nach Hause, und Heinz sollte nun auch ihm erzählen, wie es ihm in der Schule ergangen, er war aber sehr maulfaul und erzählte Nichts.
Nach dem Mittagsessen theilte ihm die Mutter mit, daß er zum Onkel Joseph gehen dürfe; daß er Ziep mitnehmen, und daß er nun, da er Schüler sei, zum ersten Mal allein über die Straße gehen könne. Ueberglücklich eilte Heinz davon.
Onkel Joseph war Lelia's Vater. Er hieß Rechberg und war des Doctors Schwager, da seine verstorbene Frau des Doctors Schwester gewesen war. Er hatte die Selige, ein kühnes, energisches Weib, voll Herrschsucht und Thatkraft, über alle Maßen geliebt, und sie hatte ihm das geringe Quantum Energie, das vielleicht noch in ihm gelegen, ganz und völlig ausgetrieben. Sie hatte ihn gehegt und gepflegt wie ein Mädchen ihre Puppe, aber er hatte ebensowenig mitzusprechen gehabt, als eine solche. Während sie in kleinen Dingen seine Wünsche erfüllte, noch ehe sie ihm selbst zum Bewußtsein gekommen waren, hatte sie in großen an dem Eichenstamm'schen Grundsatz festgehalten: »Nicht raisonnirt, gehorcht und geschwiegen!« Dazu hatte sie ihn »sich nicht geheirathet« (um den Ausdruck ihres Bruders zu gebrauchen), damit er ihr etwas zu befehlen habe, denn das verstand sie selbst. Uebrigens war sie sehr klug, sehr thätig und umsichtig, und wenn sie ihren Mann mit Eifersucht plagte und ihn so wenig aus den Augen ließ, wie eine sorgsame Bonne ihren Zögling, so war sie andererseits doch auch eine treffliche, witzige Gesellschafterin. Sie starb ganz plötzlich und ihre letzten Worte waren: »Joseph, Du mußt morgen schon ein baumwollenes Hemd anziehen, die Luft wird doch schon zu frisch.«
Dem Notar, dieses Amt bekleidete Joseph Rechberg, war nach ihrem Tode zu Muthe gewesen, wie einem verwöhnten Muttersöhnchen, das plötzlich in die Fremde versetzt wird und nun rathlos dasteht. Er wußte weder, wo er sein Geld verwahren, noch wie und wann er es ausgeben sollte; er hatte durchaus keine Vorstellung davon, was er mit seinem kleinen Kinde anfangen sollte und wie man einen Hausstand erhält. Unter diesen Umständen kamen ihm zum Glück zwei Dinge zu Hülfe: einmal, daß sein alter Vater im Hause lebte, sodann, daß sein Töchterchen von der Natur so ausgestattet war, daß sie auch ungestützt gerade wuchs. Sein alter Vater war ursprünglich ein lettischer Bauerwirth gewesen, er hatte sich's aber in den Kopf gesetzt, daß seine beiden Söhne studieren sollten, und er hatte diese Absicht vermittelst der Beihilfe seines wohlwollenden Grundherrn auch durchgeführt. Der ältere Bruder, den wir noch kennen lernen werden, war Geistlicher in der Nähe der Stadt, der jüngere war unser Joseph. Der Alte lebte nun eine Zeitlang abwechselnd bei einem oder dem andern Sohn, bis er sich ganz bei Joseph niederließ. Er war ein lieber alter Mann mit schneeweißem Haar, und mit einem so sanften und reinen Gemüth wie ein Kind. Er war sehr demüthig, anspruchslos und bescheiden, dabei von tiefer Frömmigkeit. Die Schwiegertochter hatte in ihm ihren Mann geliebt und ihn wie diesen bemuttert. Da hatte er denn gern in ihrem Hause geweilt und darin ein wundersam stilles Leben geführt. Er hatte die Bienen und den Garten gepflegt, und schöne Hühner und Tauben gezogen; ganz besonders liebte er die Tauben. Er war der beste Taubenzüchter in der Stadt, keiner besaß so schöne Klotten, Kopenhagener und Weißschwänze wie er und kein Schwarm hielt so fest zusammen und stieg so hoch, wie der seinige. Als nun die Hausfrau starb, faßte er sich schneller als der Sohn, und übernahm es, die alltäglichen kleinen Sorgen dem Sohne vom Leibe zu halten und das gelang ihm leidlich.
Der Notar konnte nun seine freie Zeit ungehindert verbringen, wie er wollte; er konnte in der warmen Jahreszeit an dem in ein Blumenbeet verwandelten Grabhügel seiner Frau stundenlang sitzen, konnte mit seinem Töchterchen spazieren gehen und mit ihr spielen, konnte endlich im Gärtchen weilen und dem Monde zusehen, der durch die Bäume blickte. Er fand an seinem greisen Vater einen unermüdlichen Zuhörer, wenn er von den Vorzügen der Seligen redete, und eine verwandte Seele, wenn es ihn einmal drängte, was selten geschah, einem Freunde mitzutheilen, was seine harmlose Seele bewegte. Beider größtes Glück war Lelia, und es war wirklich ein holdseliges Geschöpf, dies kleine Mädchen, äußerlich und innerlich. So zart und fein wie ein Haideröslein, hatte sie eine Seele so rein und durchsichtig hell, wie der Quell, der aus Felsen sprudelt. Ihr ganzes Wesen war voll gewinnender Freundlichkeit, ihr kleines Herz voll Liebe. Alles ward ihr zur Freude, das Thier wie der Baum, die Blume wie der Wurm, alles nannte sie mit den zärtlichsten Liebesworten, drückte es an sich, hegte und küßte es. Wenn sie mit Jemand sprach, so hielt sie gern seine Hand und drückte sie zuweilen. Sie kam Jedem mit offenen Armen entgegen, dem Ministerial, der Abends dem Vater die Acten brachte, wie den Tanten und Onkeln. Sie wußte noch nicht, daß man nur mit Auswahl zärtlich sein darf. Für sie war noch die ganze Erde ein fruchtbares Gartenland, für sie gab es weder Weg, noch Fels, noch Dornen. Sie streute den Samen ihrer Liebe aus nach allen Seiten und überall wuchsen Rosen auf und duftige Blumen. Wer konnte auch in dieses liebe, freundliche Gesichtchen sehen, ohne selbst zu lächeln, wer konnte ihr treuherziges, anschmiegendes Wesen zurückweisen! Ihr silberhelles Lachen klang durch das Haus, wie der Lerche Jubellied durch den Frühlingshimmel klingt in sonntäglicher Morgenstunde; ihr leichter Schritt eilte durch die stillen Räume mit des Rehes Behendigkeit, wenn es durch den Birkenwald huscht; ihr Gesichtchen war wie der Sonnenstrahl auf der Aue, wo es hinsah, lachte die Flur. Wie ein holdes Rosenknöspchen war sie, und der Vater und der Großvater standen still dabei und beobachteten das süße Geheimniß.
Der Notar bewohnte ein kleines, einstöckiges Haus an der Schmiedestraße, dessen Hof und Garten, die auch an den Kanal stießen, dem Eichenstammschen Hofe gegenüber lagen. Als Heinz und Ziep eintraten, saß Lelia auf einer kleinen Bank neben dem Hühnerhause und plauderte mit ihren Lieblingen. Zu ihrer Rechten lag Pascha, der gelbe Neufundländer, und zu ihrer Linken Korah, seine graue Gemahlin. Um sie herum stolzirten allerlei Hähne mit ihren Familien, während die Tauben zwischen Dach und Pflaster hin und her flatterten, sich neben Lelia auf die Bank setzten, oder gar auf ihre Schulter flogen. Sie hatte eben einen kleinen japanesischen Hahn im Schooß und fuhr mit einer Feder von Zeit zu Zeit langsam über seinen Rücken, während sie ihm Vorstellungen wegen seines unverträglichen Wesens machte. Dieser kleine Hahn war ihr eigentlicher Liebling. Er war ein dachsbeiniger, kleiner Kerl, den kein Vogel auf dem Hofe recht leiden konnte, auf den alle gelegentlich hackten und den seine eigenen Hennen verlassen hatten. Und das nicht ohne Grund, denn er zeigte sich immer eitel, zänkisch, jähzornig und weit über seine Verhältnisse streitlustig.
Korah und Pascha knurrten nun und erschreckten dadurch Ziep tödtlich, denn dieser hatte eigentlich nur in des Doctors Gegenwart das Gefühl der Sicherheit, sonst aber war ihm immer noch in der Stunde der Gefahr das Gefühl, einst ein herrenloses, halbverhungertes Bauernhündchen gewesen zu sein, hinderlich und machte ihn feige. Lelia setzte den Hahn rasch auf den Boden und eilte Heinz entgegen.
»Mein liebes, liebes Heinzchen,« sagte sie, indem sie ihn zärtlich umfing, ihn küßte und zu der Bank führte, »wie geht es Dir denn und was macht Dein Mutterchen?«
Heinz setzte sich und sagte kühl: »Weißt Du, Lelia, ich bin heute in der Schule gewesen.«
»Ja, bei Fräulein Berg.«
»Wirklich! Wie gefiel es Dir denn da?«
»Wie Du fragen kannst! Wie soll es mir denn in der Schule nicht gefallen!«
»Aber Du wolltest ja doch nicht hingehen?«
»Ja, siehst Du, Lelia, das war so: Er wollte haben, ich sollte hingehen, und deshalb wollte ich es nicht. Hätte Mutter es gewollt, ich wäre gleich gegangen.«
»Aber das war doch sehr unartig von Dir, Heinzchen! Wie kannst Du denn Deinem Vaterchen nicht gehorchen wollen?«
Heinz lachte. »Ich habe gar kein Vaterchen!« sagte er, »er ist kein Vaterchen, sondern ein Vater.«
Lelia sah ihn verwundert an. »In der Schule waren wohl viele Knaben?« fragte sie.
»Eine Menge, und ich habe auch gleich einen geprügelt.«
»Wie? Geprügelt?«
»Ja, da wurde so ein kleiner, blonder Junge gegen mich unverschämt, und da gab ich ihm natürlich ein paar Ohrfeigen.«
»Aber Heinzchen!« rief Lelia und sprang erschreckt auf.
Heinz blieb ruhig sitzen und baumelte mit den Beinen hin und her. Er theilte seiner Zuhörerin in sehr entschiedenem Tone mit, daß er bei dieser Gelegenheit nur gethan, was er auch künftig gelegentlich zu thun gedenke und unterrichtete sie nebenbei über seine Zukunftspläne. Er hatte die Absicht, die Berg'sche Schule in zwei Jahren durchzumachen und dann auf's Gymnasium zu gehen. Dann wollte er studiren, Doctor werden und sehr viel Geld verdienen, so viel, daß er drei große Häuser erbauen könnte, eines für seine Mutter, eines für Lelia und eines für sich. »Ein Taubenhaus aber lasse ich Dir nicht bauen,« schloß er, »und ein Hühnerhaus auch nicht, damit Du nicht die Tauben und Hühner ebenso lieb haben kannst, wie mich; denn das sage ich Dir, Lelia, dann darfst Du nur mich lieb haben und keinen Menschen sonst auf der Welt.«
Lelia lachte hell auf. »Höre, Heinzchen,« sagte sie, »Du bist doch ein bischen dumm. Wie soll ich denn nur Dich lieb haben? Ich muß doch auch Großvaterchen und Vaterchen und Dein Mutterchen, Marlising und Greeting und Tanting Adelheid und Tanting Irene und Korah und Pascha, und meinen kleinen Hahn lieb haben und des Großvaterchens Blumchen.«
»Das ist es eben!« rief Heinz eifrig, »das ist es eben. Alle liebst Du. Das ist eben so abscheulich von Dir! Habe mich nur gar nicht lieb, wenn Du alle Andern auch liebst!«
»Aber, Heinzchen, Du liebst doch auch viele Menschen?«
»Nein, gar nicht, Lelia, gar nicht. Meine Mutter liebe ich und Dich liebe ich, und Ziep und Weinthal würde ich lieben, wenn sie ihn nicht auch liebten, und sonst liebe ich Niemand auf der Welt. Wenn Du in meinem Hause leben wirst, darfst Du auch Niemand lieben als meine Mutter und mich.«
»Dann will ich gar nicht in Deinem Hause leben.«
»Ich werde Dich gar nicht fragen, Du mußt!«
Darüber wurde noch hin und her verhandelt, als der Vater dazu kam und das Gespräch unterbrach.
Die Kinder mochten ein paar Stunden gespielt haben, als Weinthal Heinz abholte. Tante Agathe sei aus dem Seebade zurückgekehrt und habe gleich nach dem Jungherrn verlangt. Das kleine Fräuleinchen solle auch mitkommen, beide sich recht beeilen.
Tante Agathe war des Doctors Großtante und ein steinaltes Fräulein. Sie war die lebendige Tradition der Familie und hatte trotz ihres hohen Alters, denn sie war, wie sie oft mit Stolz erzählte, von der schönen Dorothee, als diese noch ein Fräulein von Medem war, zur Taufe gehalten worden, noch ein treffliches Gedächtniß. Sie besaß ein kleines Vermögen, von dem sie lebte, und bewohnte das kleine, grüne Haus hinter dem grünen Zaun im Hofe des Doctors. Sie war sehr energisch und muthig, dazu klug und menschenkundig und genoß in der Familie großes Ansehen. Niemand lachte über ihr altväterliches Kostüm und Jedermann nahm die größte Rücksicht auf ihre übertriebene Reinlichkeitsliebe und ihren peinlichen Ordnungssinn.
Tante Agathens Lieblinge waren Frau Agnes und ihr Heinz. Das wußten die Beiden und ließen sich wohl einmal ihr gegenüber ein wenig gehen.