
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Carl Spitteler um 1911 in seinem Garten
*
In anderer Absicht und mit anderen Gefühlen bereist man den Gotthard als die übrigen Schweizer Gebirge. Wohl ist auch hier Ruhe, Einsamkeit und köstliche Alpenluft zu finden, nicht weniger als anderswo, aber auch nicht mehr; wohl bietet auch der Gotthard Naturschönheiten ersten Ranges, doch kaum eine, welche, für sich allein genommen, nicht ebenbürtige oder überlegene Nebenbuhler hätte.
Wenn die Erwartung des Gotthardfahrers sich höher spannt, wenn der Reisemut desjenigen, der eine Fahrkarte nach Lugano löst, sich steigert, wenn die Augen zu leuchten beginnen, sobald der Zug südwärts abbiegt, so beruht das zum weitaus größten Teil auf jener geistigen Mittätigkeit, die zwar im Grunde in jeden Naturgenuß hineinspielt, die sich indessen nirgends so lebhaft und so unabweislich einstellt wie auf der Gotthardstraße. Der Gotthard ist vor allem ‹interessant›, wie der stereotype Ausdruck lautet.
Begleitende Nebengedanken nennt mans, Hauptsache ist es. Was ist es denn, was der Überwindung eines Gebirgspasses einen besondern Reiz verleiht? Das Vorausempfinden der jenseitigen Landschaft, welche in die Phantasie des Wanderers herüberleuchtet, – die erhebenden Gefühle des Mittelpunktes, des Überganges, der Wasser- und Völkerscheide, – das gesteigerte Gegenwart- und Ortsbewußtsein und eine Menge anderer Motive mehr, die unvermerkt einen jeden beeinflussen; um so stärker, je mehr Bildung und Kenntnisse einer mitbringt. Jede Reise über einen Gebirgspaß ist eine Entdeckungsreise.
Der Gotthard nun ist in vollkommenerem Sinne ein Paß als jeder andere Paß; darauf beruht sein Ruhm, darin liegt sein entscheidender Vorzug. Er ist zentral, in das Herz der Völker führend und Länder und Berge teilend, – er ist beherrschend, indem er ein ganzes System von Kämmen und Pässen kreuzend vereinigt und die Wasserquellen nach allen Richtungen den verschiedensten Meeren entgegensendet, – er ist einfach und übersichtlich, in ziemlich gerader Linie von Norden nach Süden führend, mit Seitentälern, welche unter einander parallel laufen, – er ist kurz und ist nah, ob wir nun von einem Fuß zum andern oder von den Kulturzentren aus messen mögen, – er ist ferner (und das ist ein höchst wichtiger Punkt) rein und vollständig; das heißt, er führt nicht aus Seitentälern in Sackgassen, aus welchen wir uns wieder mittelst eines zweiten Passes mühsam hinauswinden müssen, sondern er mündet auf beiden Seiten in die Ebene, – endlich: er entwickelt die denkbar stärksten Gegensätze. Gibt es doch in dem weiten Reiche des Geistes und der Natur kaum ein Gebiet, das der Gotthard nicht trennte. Sprache, Sitte, Rasse, Politik, Geschichte und Kultur, Pflanzen- und Steinwelt, Klima, Farbe und Licht, alles ist drüben anders als hüben. Hier Norden, dort Süden; hier germanische, dort romanische Rasse; diesseits historisches Neuland, jenseits Durchdüngung mit uralter Kultur und mit Völkermoder. Je schärfer aber die Gegensätze, je deutlicher und je näher sie neben einander treten, um so genußreicher wird ihre Überbrückung mittelst des Passes. Darum verspüren wir die gehobene Stimmung, die sich in schwächerem Grade bei jedem Paß einfindet, so unvergleichlich lebhaft auf dem Gotthard. Man weiß sich hier mehr in Europa als überall sonst.
Natur und Kunst haben diesen Vorzügen noch ein übriges hinzugefügt: längs des Weges eine lückenlose Reihe von großartigen Landschaftsbildern, so daß von Luzern bis Como kein Fleck zu finden ist, der nicht bedeutend wäre, der nicht das Verweilen und die nähere Bekanntschaft lohnte, – an beiden Enden der Straße Naturschönheiten, die jedes Lobes und Vergleiches spotten, nämlich der stolze Vierwaldstättersee und die blühenden Gestade der italienischen Seen, – unmittelbar dahinter zwei Städte, zwar von ungleicher Art und Größe, aber beide in ihrer Art wohl geeignet, den Reisenden zu halten, Luzern und Mailand, – und eine Eisenbahn, welche, aus der Not eine Tugend schöpfend, den schwierigen technischen Aufgaben eine solche Lösung abzuringen verstanden hat, daß sie ihrerseits das Merkmal des Interessanten, das dem Gotthard ohnehin anhaftet, verstärkt. Den letzten Akzent hat schließlich das Eidgenössische Militärdepartement auf den Gotthard geworfen, indem es den Paß mit Festungen krönte. Wer dann noch nicht glaubt, daß der Gotthard das Gebirge beherrscht, dem ist nicht zu helfen.
Und den Namen wollen wir doch auch nicht vergessen; denn ein Name vermag viel. Der glückliche Einfall des Klosters Disentis, zum Schutzpatron der Bergkapelle zur Abwechslung einmal einen entlegenen Heiligen, den St. Gotthard, hervorzuziehen, nachdem es erlauchtere Heilige für andere Bergkapellen bereits verbraucht hatte, lieh unserem Passe einen lauttönenden Namen, der überdies nachträglich durch ein groteskes Mißverständnis pompöse Bedeutung erlangte. Nachdem nämlich der Anlaß der Namenstaufe in Vergessenheit geraten war, – und das Mittelalter vergaß rasch –, wurde der Name Gotthard auf göttliche Eigenschaften des Berges gedeutet, also auf die alle andern Gebirge überragende Höhe des Gotthard. Daß der Gotthard der höchste Berg der Welt sei, blieb hinfort Jahrhunderte lang Dogma. Die ersten schüchternen Versuche, den Chimborasso und den Himalaja für höher zu erklären, wurden mit Entrüstung zurückgewiesen, als ein Frevel am Gotthard. Und als sich die Tatsache endlich schlechterdings nicht mehr bestreiten ließ, hielt man wenigstens für Europa den Vorrang des Gotthard fest. Erst Saussure, gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, zerstörte diese Fabel. Soviel vermag ein Name.
Den genannten Eigentümlichkeiten zufolge wird eine Gotthardreise naturgemäß nicht diesen oder jenen einzelnen Punkt, sondern die Gesamtstrecke zum Ziel nehmen. Der Gotthard bleibt vor allen Dingen ein Weg. Man reist auf den Rigi, auf den Pilatus, auf das Brienzer Rothorn; aber man reist über den Gotthard oder durch den Gotthard. Gewiß hat ja auch der Gotthard vornehme stille Riesentäler, geeignet, sich dort festzusetzen, um der Ruhe und Erholung zu pflegen; und nichts liegt mir ferner, als jemand die Lust dazu verleiden zu wollen; nur handelt es sich dann um eine willkürliche Beschränkung, bei welcher die eigentümlichen Vorzüge des Gotthard nebenabfallen. Diese bedingen öftern Wechsel der Stationen und setzen zu diesem Zwecke nicht Ruhebedürfnis, sondern im Gegenteil Unternehmungslust voraus, verbunden mit mäßiger körperlicher Rüstigkeit.
Schnell, in rascher Folge und, worauf ich ein Hauptgewicht lege, vollständig will der Gotthard genossen sein, wo möglich innerhalb eines Sommers, mittelst mannigfacher Streifereien, die fortgesetzt werden, bis aus den verschiedenen Teilen sich endlich das Ganze von selbst zusammenfügt. Dann erhält man das gewaltige Bild in richtiger Proportion, dann durchfährt man späterhin den Gotthard mit Heimatgefühlen, dann wird uns das Gebirge endgültig aus einer Schranke zur Brücke, dann leuchtet einem zeitlebens Italien in die nordische Gegenwart herüber. Denn wohin wir Weg und Steg kennen, das ist nahe.
Vorbemerkung: Ein Irrtum und eine Lücke
Ehe wir die Reise antreten, gilt es, sich eines Vorirrtums zu entledigen.
Der Fremde setzt unwillkürlich einen allmählichen Übergang aus der fruchtbaren Ebene in das unwirtliche Gebirge voraus und erwartet demgemäß während des langen Verlaufes von Luzern bis Amsteg eine stufenweise Veränderung des Landschafts- und Vegetationscharakters, namentlich, wenn er vergißt oder nicht bedenkt, daß Luzern und Altdorf auf derselben Höhe über dem Meere liegen. Die Täuschung gerät um so leichter, als der Anblick der immer mächtiger werdenden Gebirge sie unterstützt. Der Goldauer Bergsturz wirkt auf den Neuling wie das erstmalige Auftreten des Gotthardthemas; dazu kommen die drohenden Mythen, die kahlen Klippen des Urnersees und endlich die gewaltigen Gletscher des Urirotstocks und des Schloßbergs.
Dennoch ist es eine Täuschung. Am Südfuße des Gotthard, im Tessin, findet dergleichen statt, nicht aber am Nordfuße. Der Goldauer Bergsturz erklärt nicht den Landschaftscharakter, sondern fälscht ihn; die kahlen Klippen des Urnersees, genauer betrachtet, bergen sommerliche Geheimnisse; die Gletscherstöcke von Uri verhalten sich zum untern Reußtal wie die Jungfrau zu Interlaken, das heißt sie bilden Hintergrund und Gegensatz.
Vielmehr durchlaufen wir von Luzern bis Erstfeld, wir können sogar sagen: bis Amsteg, eine Gegend, welche nicht bloß keine Spur von der späteren Gotthardwildnis bekundet, sondern klimatisch und infolgedessen im Pflanzenwuchs dermaßen bevorzugt ist, daß die übrige deutsche Schweiz davor zurücksteht. Es ist ein Stück über den Gotthard gesprengtes Italien, kein ebenbürtiges, doch ein verwandtes.
Diese Vorstellung wird dem Fremden und wohl auch manchem Einheimischen so neu erscheinen, daß ich sie Schritt für Schritt mit Proben belegen will.
Das Klima der Luzerner- und Küßnachterbucht kennt jedermann: Weggiserklima mit Kirschlorbeer und Zedern; weniger wohl das Zugerklima. Nun, am Zugersee steht der schönste herrschaftliche Park der deutschen Schweiz (bei Buonas); am Zugersee wachsen die besten Kirschen der Welt (von hier stammt ja das berühmte Kirschwasser); am südlichen Zugersee finden sich Edelkastanien in großer Zahl und zwar an beiden Ufern. Am gründlichsten täuscht der Schein im Schwyzertal, eben infolge des unglückseligen Bergsturzes. Um zu verstehen, wie das Schwyzertal gemeint ist, müssen Sie wissen, daß die dem Rigi gegenüberliegenden Berghalden ein wahres Obstparadies sind, daß der Roßberg in das fruchtbarste Gelände fiel, daß im Schwyzertal früher Wein gepflanzt wurde, daß die Alpen unmittelbar über dem Flecken Schwyz, gegen die Mythen hinan, als die saftigsten des Kantons gelten, daß in Schwyz Zedern und Kryptomerien üppig gedeihen, Aucuba im Freien überwintert, neuestens sogar Magnolia grandiflora versuchsweise gepflanzt wird, bis jetzt mit Erfolg. Und sehen Sie sich doch einmal den Rigi an! Ein Berg von 1800 Meter Höhe, von oben bis unten mit würzigem Weideland bedeckt. Vergleichen Sie dann mit dem Rigi die nackten Bergkuppen des Kantons Tessin! Man darf also nicht durch diesen Garten, der schon im frühen Mittelalter wegen seines gesegneten Klimas berühmt war, des Goldauer Bergsturzes wegen mit Schreckhorngefühlen reisen.
Über den Urnersee mögen folgende Daten orientieren: Er ist der heißeste Teil des Vierwaldstättersees, selbst Gersau und Vitznau übertreffend. Ehe Gersau und Vitznau klimatisch entdeckt wurden, war es Uri und namentlich der Urnersee, welches in den schweizerischen Urkunden für außerordentlich warm und mild galt. Besonders bevorzugte Stellen von südlichem Vegetationscharakter sind: die Strecke von Seedorf nach Isleten, die Tellsplatte (Tellskapelle) mit ihrer Umgebung, das Rütli, welches den Gärten von Altdorf und Brunnen die edleren Ziersträucher liefert. Die Wildflora des Urnersees zeigt eine merkwürdige Übereinstimmung mit derjenigen des Luganersees, eine Notiz, die ich einem umsichtigen und erfahrenen Beobachter, dem Präsidenten der Luzerner Naturforschenden Gesellschaft, Herrn Suidter, verdanke.
Auch mit dem untern Reußtal bleiben wir noch immer auf klimatisch bevorzugtem Boden. In Altdorf gedeiht noch die Wellingtonia; in den Gärten der Kapuziner und des Landammanns werden zarte Obstsorten gezüchtet, die anderswo nicht gelingen wollen. Schattdorf liegt in einem Walde der herrlichsten Nußbäume. In Erstfeld wuchs einst Wein. Von Flüelen bis Intschi hinauf ziehen sich in entzückender Fülle riesige Obstbäume, namentlich Birn- und Nußbäume. Neulich wurde oberhalb Amsteg ein fünfhundertjähriger Nußbaum von anderthalb Meter Stammdurchmesser gefällt.
Erst über Intschi, jenseits des Wassener Waldes, beginnt die Gotthardwildnis, und zwar ohne längeres Zaudern, fast plötzlich. Bis dorthin aber herrscht Üppigkeit und Segen.
Wie der untere Kanton Tessin mit den italienischen Seen vor der lombardischen Ebene, so ist das untere Uri mit Zugersee und Vierwaldstättersee vor der Schweizer Hochebene klimatisch ausgezeichnet. Dies einmal mit klaren Worten auszusprechen, vor Beginn einer Gotthardfahrt, halte ich nicht für eine Abschweifung.
Die Gotthardbahn führt uns in das Herz der Schweiz, mitten durch zwei der drei Urkantone, und zwar durch die zwei wichtigsten. Tell und Stauffacher, Rütli und Hohle Gasse, Altdorf und Bürglen, Schwyz und Uri sind interpopuläre Namen von vertrautem Klang. Einigen Anteil historischer Art, zurückschauendes Interesse wird jeder Reisende verspüren, wenn er an diesen berühmten Stätten vorüberfährt. Nicht bloß um zu sehen, schaut er da aus dem Wagenfenster, sondern auch, um wo möglich etwas hieher Passendes zu denken.
Einige geschichtliche Kenntnisse würden wir bei solchem Anlasse nicht als eine Last empfinden. Da jedoch bis vor kurzem die Geschichte über die Verhältnisse der Urschweiz geschwiegen hatte, indem sie den poetischen Erzählungen der Sage lauschte, so ist völlige Unkenntnis über die wichtigsten Tatsachen und Vorbedingungen er Entstehung der schweizerischen Eidgenossenschaft ebenso allgemein, wie sie entschuldbar ist. Es ist jedoch zu melden, daß seit einem Menschenalter die schweizerische Geschichtsforschung gewaltige Fortschritte gemacht, ja daß sie für die Entstehung des Schweizerbundes eine durchaus andere Grundlage gefunden hat als diejenige, welche von der Poesie und Sage vorausgesetzt wird. Es bleibt also alles umzulernen. Und es kann auch umgelernt werden, da die Lücke der Geschichte gegenwärtig zum größten Teil ausgefüllt ist, so daß nur noch die Lücke in den Kenntnissen des einzelnen übrig bleibt. Als einfachstes Mittel, dem abzuhelfen, empfehle ich zwei Bücher: «Rilliet, Les origines de la Confédération Suisse» und «Prof. Oechsli, Die Anfänge der schweizerischen Eidgenossenschaft». Das erstgenannte Werk – es ist das ältere – setzt sich mit der Sage auseinander und hat den Akzent auf den politischen Zuständen. Das zweite, von Oechsli, läßt sich überhaupt mit der Sage gar nicht mehr ein, außer anmerkungsweise, sondern gründet die Geschichte neu und unabhängig. Sein Hauptakzent ruht auf der Kulturgeschichte und auf den ökonomischen Verhältnissen; überdies führt es uns sämtliche Urkunden vor Augen. Im Zweifel wähle man Oechslis Werk, welches die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen vereinigt und gesichtet bringt. Niemand ist gehalten, es zu lesen; man kann ja auch ohne gelehrte Ausrüstung fröhlich reisen; aber niemand darf auch glauben, das mindeste von der Entstehung der Schweiz zu wissen, der das Buch oder einen seiner neuesten Verwandten nicht gelesen hat.
Einiges historisches Wissen über Schwyz und Uri (namentlich über Uri) kommt übrigens einem Gotthardreischen auch jenseits des Gotthard zu statten, da ja der obere Tessin Uri untertan war. Dazio Grande hat seinen Namen von den Urner Zollherren; in Faido herrschte ein Urner Landvogt; in Bellinzona erblicken Sie noch die Türme der eidgenössischen Zwingburgen, welche sogar ihre alten Namen, Uri, Schwyz und Unterwalden, beibehalten haben.
Luzern-Goldau
Die große Neuigkeit ist, daß die Gotthardbahn vom Jahre 1897 an ihren Weg von Luzern nach Goldau nicht mehr wie bisher über Rotkreuz, sondern über Meggen und Küßnacht nehmen wird. Das ist lauter Gewinn und zwar ein mannigfacher. Denn, abgesehen von einer kleinen Zeitersparnis – ungefähr zehn Minuten –, von dem Wegfall der langweiligen Strecke Ebikon-Gisikon-Rotkreuz und von der Vermeidung der verdrießlichsten Haltstation (Rotkreuz), erhalten wir fortan ein beträchtliches Stück Vierwaldstättersee mehr zur Gotthardbahn hinzu, was nicht nur eine Zutat von so und so viel Einzelschönheiten bedeutet, sondern überhaupt der Reise bis Flüelen einen wesentlich andern Charakter verleiht: einen einheitlichen, der zugleich entzückend sein wird.
Das leidige Gefühl, hintenherum zu fahren, fällt jetzt weg; denn immer wieder treffen wir den Vierwaldstättersee, jedesmal an einer andern Bucht, der mit uns Versteckens spielt, unter öfterem Grüßen und Abschiednehmen. Und nicht den Vierwaldstättersee allein, der Zugersee und der Lowerzersee sind ja auch noch da. Eine förmliche Seefahrt wird es künftig sein, in prächtigem Sichelbogen um die Rigi-Insel herum, Wasser und Land in raschem Zeitmaß wechselnd, das Wasser vorwiegend. Zunächst der Luzernersee mit seinen villenbekränzten Hügeln, hierauf die Küßnachterbucht, vom Rigi überthront, dann der stille, innige Zugersee, und zwar wie bisher da, wo seine Ufer und seine Farben am schönsten sind; dann der kleine Lowerzersee, später auf einen kurzen Augenblick bei Brunnen die Gersauer Seekammer und endlich der stolze, tiefe Urnersee. Also sechs Seen innerhalb einer einzigen Stunde.
Und jeder See hat seine eigene Palette: die Küßnachterbucht ein derbes Ultramarin, der Zugersee gegen Arth ein unvergleichlich mildes Enzianenblau, der Lowerzersee gegen den Urmiberg eine an den Lungernsee gemahnende Spiegelung, der See bei Brunnen ein wundersames Schillern in allen Tönen zwischen blau und grün, einem Pfauenschweif vergleichbar, der Urnersee veränderliche Proteusnatur, wechselnd vom freundlichsten Königsblau bis zu unheimlichem, schwärzlichem Düster.
Sehen wir uns nun den Verlauf der neuen Linie etwas näher an. Aus dem stattlichen Gebäude des neuen Bahnhofes fahren wir zunächst in nördlicher Richtung wie bisher durch den Gütsch, aber in einem neuen, doppelspurigen Tunnel, schwenken auf eigener Brücke über die Reuß, den Gotthardfluß, unter dessen Quellgebiet wir nach Verlauf von zwei Stunden durchfahren werden. Jenseits der Reuß geht es sofort in den Berg hinein, worauf die Stadt Luzern in einem weiten Halbkreis mittelst eines Tunnels von zwei Kilometer Länge umgangen wird. Draußen in der Haldenstraße hinter dem Hôtel d'Europe kommt die Linie wieder ans Tageslicht. Diese Tunnelausfahrt beim Hôtel d'Europe, zwischen Villen und Gärten, in kühner Richtung gegen den kaum hundert Schritt entfernten See, mit dem Blick auf den Bürgenstock und allem, was darum und dahinter liegt, muß von überwältigender Wirkung sein, doppelt überwältigend durch die Überraschung und den Gegensatz. Reußabwärts hatten wir die Stadt verlassen, als ob es Basel oder Zürich zuginge; wenn wir dagegen aus der Erde kommen, befinden wir uns zwei Kilometer weiter oben, seeaufwärts, das Gesicht gegen Italien gerichtet. Wäre es auch nur um dieser Tunnelmündung willen, so müßten wir schon die neue Linie als einen großen Gewinn gegenüber der alten preisen.
Auf erhöhtem Damm über offenem, flachem Feld, mit weitem, freiem Blick auf den See und die Berge steuert nun die Bahn durch das sogenannte Würzenmoos, gegen Seeburg. Bei Seeburg, am Eingange des kurzen Schilteneune- und Seeburgtunnels, erhalten wir einen letzten schönen Rückblick auf Luzern. Das Meggenhorn durchschneiden wir durch den Lärchenbühltunnel. Hinter dem letztern erscheint mit plötzlicher Verwandlung der Szene ein neues Bild: die Luzernerbucht ist verschwunden, und wir lenken, die Habsburg vor Augen, in die Küßnachterbucht ein. Gegenüber, in nächster Nähe, kaum eine Stunde in der Luftlinie entfernt, steht, groß und gewaltig, in seiner ganzen westlichen Breite der Rigi, das Gesichtsfeld völlig beherrschend. Unten, jenseits des Wassers, das Dörfchen Greppen, auf mittlerer Höhe die freie Terrasse des Rigi-Seebodens mit dem gleichnamigen Kurhause; hoch oben am Himmel Rigi-Kulm, -Staffel, -Rotstock und -Känzeli. Deutlich werden wir den Rauch der nach dem Kulm dampfenden Züge sich gegen den Himmel abheben sehen.
Die Bahn, hinfort nur durch einige ganz kurze Tunnels unterbrochen, hält sich beständig unweit des Seeufers. In die Mitte der beiden Dörfer Vorder-Meggen und Hinter-Meggen, nahe der Villa Ephrussi, kommt die Station Meggen zu stehen, welche natürlich die Schnellzüge nichts angeht. Die Anlage des Bahnhofes Küßnacht bei der sogenannten Talstraße auf der Nordseite des Dorfes gehörte infolge der Bodenverhältnisse zu den schwierigeren Aufgaben. Hinter Küßnacht geht es nun über die schmale Landzunge unweit der ‹Hohlen Gasse› vorbei, welche wir rechts liegen lassen, gegen Immensee, wo das neue Geleise in das alte, von Rotkreuz herkommende einmündet, und zwar unmittelbar vor der Station Immensee. Wie bisher eilen wir nun durch die wonnigen Edelkastanien- und Nußbaumhalden zwischen Rigi und Zugersee nach Goldau, wo sich uns der Zürcher Gotthardzug anschließen wird.
Verfolgen wir jetzt, der Vollständigkeit wegen, anhangsweise auch den Lauf der neuen Zürcherlinie von Zürich nach Goldau.
Wie bekannt, beschäftigte sich bisher der Zürcher Zug hauptsächlich damit, den Uetliberg zu belagern, gründlich, von drei Seiten, als wollte er ihn aushungern, bis er sich endlich südwärts bemühte, durch das unendliche Knonaueramt, das, so klein es auch ist, immer von neuem Miene macht, nie aufhören zu wollen. Hernach ging es, das Städtchen Zug bei Seite lassend, über Cham nach Rotkreuz, wo der Zürcher Zug den Luzerner Zug traf, um mit ihm vereint nach dem Gotthard abzubiegen.
Dies wird nun gründlich anders, und zwar ebenfalls unvergleichlich genußreicher. Denn auch die Zürcher Zufahrtslinie läuft hinfort bis Flüelen fast beständig im Anblick eines Seespiegels, mit einziger Ausnahme der Strecke von Horgen bis Baar, die größtenteils unterirdisch zurückgelegt wird. «Eine der aussichtsreichsten Linien der Schweiz» nennt ein Bahntechniker die Strecke Zürich-Goldau.
Von Zürich geht es zunächst auf dem Geleise der linksufrigen Zürichseebahn über Zürich-Enge, Wollishofen, Bendlikon und Rüschlikon nach Thalwil, zwischen Rebbergen, Fruchtland, Gärten, Landhäusern und Dörfern, wo in verwirrendem Reichtum die Ortschaften derart ineinandergreifen, daß man versucht wird, das gesamte Zürcherseegelände als eine dörfliche Vorstadt von Zürich aufzufassen. Bei Thalwil zweigt die Linie nach dem Gotthard ab. Die Bahn bleibt noch eine Weile in der Nähe des Ufers, nur wenig von der Seebahn entfernt, etwas rechts davon, auf mäßiger Höhe. Hierauf, bei Oberrieden, fängt sie an, in der Richtung gegen Bocken, einem beliebten Ausflugsziel der Zürcher, kräftiger zu steigen. Wer die Gegend des Zürchersees im mindesten kennt, weiß, daß die geringste Steigung, einerlei an welchem Punkte unternommen, dem Auge ungeahnte Lust bringt, indem sie sofort das ganze Amphitheater der zahllosen Dörfer über dem duftigen See aufrollt, mit dem gewaltigen Zürich im Hintergrunde. Wie ein riesiger Komet in einem Sternhaufen, so liegt Zürich inmitten der Dörfer da.
Nachdem die Bahnlinie über dem volkreichen Dorfe Horgen eine Höhe von ungefähr achtzig Metern über dem See erreicht hat, nahe dem Punkte, wo das Geleise die Landstraße trifft, die sich von Horgen herauf nach dem Zimmerberge windet, schlüpft der Schienenweg mit einer scharfen Wendung in der Richtung nach Zug unter die Erde, in den S-förmigen, 1980 Meter langen Horgentunnel.
Wenn wir herauskommen, befinden wir uns in dem dunklen Tale des Sihlwaldes, des stattlichsten Forstes des Kantons Zürich, wo einst der Dichter und Maler Salomon Geßner gastlich hauste. Zwar die Wohnung des Forstmeisters selber – ‹Sihlherrn› nannte man den Forstmeister zu Geßners Zeit – liegt tiefer im Tal, unterhalb des ‹Schnabels›, im ‹untern Sihlwald› oder schlechthin ‹Sihlwald›, wie man sich in Zürich der Kürze wegen ausdrückt, während wir im obern Sihlwaldgebiet hervorkommen, unterhalb des Oberalbis, wo die Talsohle der Sihl sich hundert Meter über dem Zürchersee erhebt. In landschaftlicher Hinsicht verlieren wir hiedurch nichts, im Gegenteil. Um das Stückchen Waldeinsamkeit in dem mächtigen Sihlforste darf die Zürcher Zufahrtslinie von der Luzerner beneidet werden. Bei der Schmalheit des Tales würde freilich die Freude kurz währen, wenn nicht glücklicherweise der Anschluß von der Sihltalbahn her im Tale eine Station, ‹Sihlbrugg›, und an der Station einen Aufenthalt bedingte. Von der Eisenbahnstation ‹Sihlbrugg› ist übrigens das altberühmte, prächtig gelegene ‹Sihlbrugg› der Poststraße zu unterscheiden. Das letztere Sihlbrugg befindet sich noch eine gute halbe Stunde weiter oben im Walde und bleibt außerhalb unseres Gesichtskreises.
Hinter der Station Sihlbrugg geht es dann sofort in den 3300 Meter langen Albistunnel, den zweitgrößten Tunnel der Schweiz. Bei seiner Ausmündung treffen wir uns in einem verlorenen Fleckchen Erde, wohin wohl kaum je einer von uns sich früher verirrt hat, in einem Obstrevier bei Deinikon auf einer kleinen Höhe über Baar, zwischen dem Baarerberg und Kappel, wo einst Zwingli den Tod fand. Ich rechne aus – und die Rechnung wird wohl ziemlich stimmen –, daß bei der Tunnelausmündung oder gleich nachher der Rigi und rechts davon die Gletscher des Berner Oberlandes mit der Jungfrau auftauchen werden, wahrscheinlich auch in der Tiefe der Zugersee. Wie dem auch sei, jedenfalls muß die plötzliche Entfaltung des obstreichen Zugerlandes mit seinen einfach großen Gebirgen entzückend wirken. Hernach gleiten wir in die Ebene von Baar, das wir berühren, und gelangen so direkt nach Zug.
Von Zug über Walchwil nach Goldau folgt die Bahnlinie, sobald einmal hinter dem Städtchen der See erreicht ist, ziemlich genau den sanften Windungen der Landstraße, aber auf höherer, in jedem Sinn überlegener Stufe. Die Landstraße unten am See entwickelt Uferlandschaften, welche an diejenigen von Weggis gemahnen, immerhin infolge des weiteren Horizontes und des bäurischen Charakters des Gefildes mit gänzlich anderer, nach meinem Gefühl ernsterer Stimmung. Bedeutsame Waldpartien mit Buchen, die in den See überhangen, Kastanienhalden, düstere Silhouetten von massigen Gehöften, welche, von Pappeln flankiert, weit in den See vorspringen, diese Motive schweben mir in der Erinnerung vor Augen. Dem fügt nun die beträchtlich höhere Bahnlinie noch Brücken und Schluchten hinzu, nebst jenen Vorzügen, welche einer Aussicht auf überragender Terrasse eigen. Wie mißlich es auch sonst sein mag, Aussichten zum voraus abschätzen zu wollen, eine Höhenstraße gegenüber dem Rigi kann nicht anders als überwältigend wirken. ‹Corniche› ist wohl das Wort, welches die Linie Zug-Goldau am bündigsten kennzeichnet, und dieses Wort enthält zugleich eine Lobpreisung.
Die Vereinigung der beiden Hauptzufahrtslinien Luzern-Küßnacht-Goldau einerseits und Zürich-Zug-Goldau anderseits, sowie ferner die Einmündung der aargauischen Südbahn Aarau-Rotkreuz-Goldau, welche den direkten Gütertransport zwischen Deutschland und Italien vermittelt, haben nun in Goldau einem umfangreichen Bahnhof gerufen, dessen stattliches Aufnahmegebäude auf dem Kamme des Goldauer Bergsturzgebietes liegt. Der Personenbahnhof ist als Inselbahnhof angelegt, das will sagen, er steht in der Mitte des Vereinigungswinkels der beiden Zufahrtslinien, so daß das Ein- und Aussteigen sich nach beiden Seiten getrennt vollziehen kann. Der Umstieg in die Südostbahn (nach Einsiedeln) und die Arth-Rigibahn geschieht unter gedeckten Perronhallen.
Durchs Schwyzertal
Wir halten also in Goldau, mitten im Trümmergebiet des Bergsturzes, in der Mulde zwischen dem Roßberg und dem Rigi, im Vereinigungspunkte von allerlei Bahnen und Bähnchen, von welchen einige links und rechts den Berg hinaufklettern; eines krabbelt sogar vom See her uns entgegen. Die Lage des neuen Bahnhofs am Rande der Anhöhe über dem See ist großartig, der Rückblick auf den See fesselnd.
Hier auf der Höhe sperrte zur Zeit des Morgartenkrieges die innere Verteidigungsmauer der Schwyzer (›Letze› nannte man solche Mauern) das Tal querüber ab. Unten am See bis an die beiderseitigen Berge stand die äußere, größere ‹Letze›. ein formidables Werk von zwölf Fuß Höhe mit Toren und Türmen. Im See selbst drohten Palissaden zum Schutze Arths. Dieses ‹Letze‹-System war es, was das feindliche Heer bewog, den Umweg über Aegeri und Morgarten zu nehmen.
Wie wir wissen oder wie die Karte uns zeigt, befinden wir uns hier im Kanton Schwyz. Allein das ist nur in politischer Hinsicht richtig. Wir stehen auf altem Arther-Boden, Arth aber hat mit allem seinem ehemaligen Zubehör, Rigi, Goldau und Lowerz, in ökonomischer Beziehung noch seine uralte Sonderstellung behalten, die es zur Zeit seiner freiwilligen Angleichung an Schwyz hatte, das heißt vor dem Morgartenkrieg. Noch heutzutage ist es nicht Schwyz, sondern Arth, welches auf Rigi-Kulm und -Staffel gebietet. Von Arth werden die Herden den Rigi hinauf- und hinunterdirigiert; mit den Herren von Arth muß sich auseinandersetzen, wer auf dem Rigi Land kaufen oder einen Gasthof errichten oder ein Chalet bauen oder eine Eisenbahn gründen will. Aber nicht nur der Rigi, sondern auch die Frohnalp, ja sogar die Silbernalp weit hinten im Muotatal gegen Glarus unterstehen dem Korporationsregiment von Arth. Das gesamte Arther Korporationsgebiet nun führt den sonderbaren Namen ‹Unteralp›. amtlich ‹Unterallmend›. Oder mutet es Sie nicht sonderbar an, wenn Sie den achtzehnhundert Meter hohen Rigi-Kulm und die neunzehnhundert Meter hohe Frohnalp ‹Unteralp› nennen hören? Man fragt sich, wo denn schließlich die Oberalp anfange, und sucht mit den Blicken am Himmel herum. So ist es freilich nicht gemeint, sondern folgendermaßen: Arth liegt tiefer als Schwyz; jenes ist mithin das Unterland, dieses das Oberland des Kantons. Darum heißen sämtliche Alpen von Arth, und wären sie noch so himmelhoch, ‹Unteralp›. das will sagen Alp, die der untern Kantonshälfte gehört; ebenso heißt umgekehrt jede zur Korporation Schwyz gehörende Alp, und wäre sie der kleinste Hügel, ‹Oberalp›. verstehe: Alp, welche zur obern Kantonshälfte gehört. Um Oberalp von Unteralp, mit andern Worten, den Kantonsteil Arth von dem Kantonsteil Schwyz zu unterscheiden, genügt ein einziger Blick. Wenden Sie in Goldau das Gesicht gegen Schwyz: alle Berge, die rechts von den Tälern liegen, bis nach Uri und Glarus, sind Unteralp, die linksseitigen Oberalp. Wenn Sie aber vielleicht bei dieser kurzen Darlegung ungeduldig geworden sind, in dem Gedanken: «Was geht mich das an und was hat das für ein Interesse?», so lassen Sie mich zu meiner Rechtfertigung hinzufügen: Die beiden Korporationen Arth und Schwyz sind das ABC zum Verständnis des wahrhaftigen, lebendigen Kantons Schwyz. Wer nichts von Oberalp und Unteralp weiß, weiß nichts von Schwyz.
Von Goldau beschreibt die Bahnlinie einen Bogen gegen den nördlichen Talrand, um Steinen zu berühren. Der Weg zeigt uns den hübschen Lowerzersee mit der malerisch gelegenen Insel Schwanau, bei deren Anblick man sich jedoch nicht mit romantischen Phantasien verköstigen möge. Für Schwanenritterlichkeit, Mondschein und Liebesabenteuer ist die derbe Urschweiz kein geeigneter Boden. Der Name Schwanau hat denn auch mit dem Poesievogel Schwan nichts zu schaffen; er lautet richtiger Schwandau: Schwand aber bedeutet ganz prosaisch ‹ausgerodetes Land›. Außer dem Lowerzersee weist unser Weg nach Steinen nicht viel auf. Doch nur deshalb, weil wir zu tief unten in der Talsohle und zu nahe am Bergfuße fahren. Steigen wir zu Fuß gegen den Kräbel (gegen Rigi-Klösterli) hinan oder nach dem Steinerberg – Rigi-Scheidegg und Rigi-Kulm liegen wieder zu hoch –, dann werden wir staunend bewundern lernen, was für eine stimmungsvolle Harmonie über dem strengen, geschlossenen Tale ruht.
Mit Steinen haben wir das eigentliche alte Schwyzerland erreicht, welches dem schweizerischen Staate das Leben gegeben und den Namen und das Wappen verliehen hat. Das Schwyzer Banner war übrigens ursprünglich rot, erhielt dann aber später, etwas vor dem Morgartenkriege, nach dem Zuge nach Besançon, die ‹heilige Marter› als Abzeichen dazu geschenkt, aus welcher sich das weiße Kreuz erhalten hat. Drei kleine Gemeinden sind es, welche den politischen Kern des alten Ländchens Schwyz bildeten: Steinen, Dorf Schwyz und Muotathal; diesen Namen vor allem gebührt ehrerbietige Erinnerung. Daran schlossen sich, in derselben Talschaft vereinigt: Seewen, Morschach, Urmi, Auf Iberg und der Hafenplatz Brunnen. Diese winzige Talschaft zwischen Rigi und Mythen, die ein einziger Blick zusammenzufassen vermag, ist das Herz der Schweiz. Nur muß man sich das Tal bevölkerter vorstellen, als es jetzt ist.
Von den drei Urgemeinden Steinen, Schwyz und Muotathal hat das Muotatal in Rasse, Sprache und Sitte den ursprünglichen Typus am treusten bewahrt. Dort hinten auf den Alpen gegen Glarus findet man noch den Typus des alten Schwyzers. Merkwürdig ist das hohe Alter des auf einem Hügel abgelegenen Morschach, wo sogar Überreste aus der Bronzezeit gefunden wurden. Offenbar führte von jeher ein Paß aus dem Schwyzertal über Morschach nach Uri, gewiß nach Sisikon, vielleicht auch von dort weiter zu Land ins Reußtal, über den Axenberg, ob wir schon nicht wissen, wie und wo hinüber.
Bei Steinen denkt jeder an den Namen Stauffacher. Und mit Recht. Denn die Geschichte hat in diesem Punkte die Sage bestätigt. Die Stauffacher waren in der Tat ein angesehenes und mächtiges Geschlecht bäurischer Abkunft, hatten zeitweilen das höchste Amt in der Schwyzer Mark inne, nämlich das Amt des Landammanns (verstehe: Generalammann), und spielten auch in der äußern Politik eine Rolle. Die Stauffacherkapelle in Steinen ist alt.
Aber noch etwas anderes läßt sich bei dem Namen Steinen denken. Der Name deutet ohne Zweifel auf Steintrümmer, und da er uralt ist, beweist er, daß der Roßberg schon im frühen Mittelalter Felsen herunterschickte. Das wird auch durch die Tradition bestätigt, welche die Erinnerung von einem Bergsturz im vierzehnten Jahrhundert bewahrte. Doch der Name Steinen ist noch weit älter, es müssen mithin kleinere Bergstürze schon lange vor dem vierzehnten Jahrhundert stattgefunden haben.
Wenn wir so durch die Abhalden des Arther- und Schwyzerlandes fahren, erhalten wir eher den Eindruck bäurischer Kultur als denjenigen einer Hirtenbevölkerung. In Wirklichkeit jedoch soll, wie ich von Schwyzern erfahren habe, die es wissen können, die Viehzucht heutzutage im Kanton Schwyz eine noch wichtigere Rolle spielen als je zuvor. Und zwar zielt man gegenwärtig mit einer gewissen Geringschätzung gegen die Milchwirtschaft, die anderswo der Viehzucht Hauptsache ist, im Kanton Schwyz durchaus auf Rassenzucht ab. Es handelt sich, wofern ich recht verstanden habe, darum, eine Art Rindviehadel zu züchten, der alljährlich im Herbst nach aller Herren Ställen versandt wird, um dem ungeschlachten fremden Hornzeug als Väter, Gattinnen und Mütter bessere Haltung und Manieren beizubringen. Übrigens bekenne ich meine völlige Unkenntnis in dieser Materie und berichte einfach, was mir mitgeteilt wurde. Zu der Zeit vor der Gotthardbahn geschah der herbstliche Auslandsverkauf des jungen Nachwuchses von Zucht- und Mastvieh mittelst großer, imposanter Herdezüge über den Gotthardpaß, wobei es übermütig und protzig herzugehen pflegte. Mit naturwüchsiger Poesie und köstlichem Humor schildert eine solche Welschlandfahrt schwyzerischer Herden über den Gotthard Meinrad Lienert von Einsiedeln, ein Schriftsteller, der überhaupt über Schwyzer Volksart und Sprache vortrefflich Bescheid weiß. Er bildet für diesen Kanton Autorität, wie Jeremias Gotthelf für den Kanton Bern.
Statt nach Schwyz führt die Bahn, abkürzend, an Seewen vorbei (gemeinschaftlicher Bahnhof Schwyz-Seewen), wodurch leider der Flecken Schwyz dem nähern Augenschein entrückt wird. Dafür erhalten wir an der Station Schwyz-Seewen den ersten sensationellen Ausblick: den Blick nach dem Urirotstock, der sich hier eindrucksvoller aus der Umgebung abzeichnet als später bei größerer Nähe.
Mit kühner Wendung um den Urmiberg (so heißt der letzte Ausläufer des Rigi) eilen wir ihm seewärts entgegen, windschief, wie eine Fregatte, die vom Stapel läuft. Ein paar stolze Minuten, die Fahrt von Schwyz nach Brunnen, auf der schrägen Ebene gleitend, inmitten eines der berühmtesten und schönsten Amphitheater Europas: zur Rechten der Urmiberg, hinten die beiden Mythen, zur Linken das Muotatal mit dem Wasserberg, weiter seewärts der Frohnalpstock mit dem Stoos und der Höhe von Morschach, endlich vorn der Urirotstock.
Bei Brunnen, dem die Geschichte denjenigen Rang zuerkennt, welchen die Sage dem Rütli leiht, treffen wir einen kurzen Augenblick wieder den Vierwaldstättersee, kaum genügend, um die bekannten Berggesichter zu agnoszieren und einen letzten Abschiedsgruß in der Richtung nach Luzern zu werfen; dann verschlingt uns der erste der zahllosen Tunnels des Urnersees. Vieles geht selbstverständlich durch die Galerienkette verloren, doch nicht alles. Die sprühenden Lichtbündel der Luftlöcher, das immer von neuem innerhalb der schwarzen Tunnelrahmen hindurchleuchtende Gemälde des Seelisberges mit dem Urirotstock und dem tiefblauen Wasser sind Zauberbilder, deren Wert durch die Hurtigkeit des Verschwindens nicht aufgehoben wird. Aber vom Wetter sind wir hier mehr abhängig als überall sonst. Die kleinste Trübung: das Bild wird farblos und der Urirotstock verbirgt sich. Regen verhüllt nicht bloß die Berge, sondern selbst den See mit trostlosem Grau.
In Flüelen halten während der Sommermonate alle Züge ohne Ausnahme einen Augenblick, um die Dampfbootpassagiere aufzunehmen. Beiläufig gesagt, ich möchte die Kombination von Schiff und Bahn nur in Ausnahmefällen empfehlen; denn jede Kombination, selbst die gescheiteste, erzeugt Unruhe; dazu kommt die Notwendigkeit, in kürzester Zeit einen Platz im bereits besetzten Zuge zu erobern und endlich der Umstand, daß die Seefahrt von Luzern nach Flüelen sowohl durch den Überreichtum des Geschauten als wegen der zehrenden Seeluft erfahrungsgemäß ein beträchtliches Maß von Kraft verbraucht. Sowohl der Vierwaldstättersee aber wie der Gotthard sind jeder für sich frischer Kräfte und des besondern Zieles wert.
Mit Flüelen ziehen wir in das Herz des Kantons Uri ein, desjenigen Kantons, dem der Gotthardpaß einst nicht bloß nationalökonomische Blüte, sondern zugleich eine überragende militärische und politische Macht verlieh, welche innerhalb der Eidgenossenschaft einzig dem Kanton Bern nachstand, desjenigen Kantons, dessen Grenzen während mehr als drei Jahrhunderten bis nach Biasca hinunterreichten, so daß noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts der Satz lautete: «Der Gotthard liegt von einem Fuße bis zum andern im Kanton Uri.»
In Uri
Schon mit Sisikon überschritten wir die Urnergrenze. Das jenseitige Ufer aber liegt gänzlich im Urnergebiet, von Seelisberg bis Seedorf, und zwar von Alters her, weswegen von jeher die Bucht ‹Urnersee› und der Rotstock ‹Urirotstock› heißt.
Doch erst mit Flüelen gelangen wir in den Kernteil von Uri, welches ähnlich wie Schwyz im engsten Raum eine ungemein dichte Bevölkerung beherbergte. Nämlich, was im Mittelalter Uri genannt wurde, das beschränkte sich auf den untersten Reußboden zwischen Flüelen und Silenen (herwärts Amsteg); dazu kam noch das Schächental, das für Uri so wichtig war wie das Muotatal für Schwyz; während am Urnersee nur versprengte, politisch unbedeutende Ansiedelungen existierten und das obere Reußtal von Silenen nach Göschenen hinauf als spärlich bewohntes Hinterland zu Silenen gerechnet wurde. Die oberen Seitentäler, zum Beispiel das große Maderanertal, spielten gar keine Rolle, werden sogar kaum genannt.
Sobald wir Flüelen hinter uns gelassen haben, taucht ein ganzer Kranz von Dörfern, Weilern, Kirchen, Klöstern, Kapellen und Ruinen rings um uns auf, so dicht beisammen gelagert, daß sie sich fürs Auge ineinander verschieben, kaum zu trennen und zu unterscheiden. Suchen wir, uns in dem lieblichen Gewirr zurechtzufinden.
Zunächst werden wir beobachten, daß die Mitte des Talbodens leer steht; die Niederlassungen haben sich links und rechts am Fuße der Berge gruppiert. Sie sind dem Gewässer ausgewichen, der Reuß und dem Schächenbach, welche früher in der Mitte des Tales ein unwirtliches Delta mit Geschiebe und Überschwemmungen bildeten. Ferner werden wir wahrnehmen, daß der Großteil der modernen Ortschaften zu unserer Linken liegt, während die rechte Seite jenseits der Reuß hauptsächlich Überreste alter Niederlassungen, also vereinzelte Gebäude und Ruinen oder kleinere Häusergruppen, aufweist. Nennen wir nun die Namen, indem wir uns zunächst an das linksseitige Wagenfenster setzen.
Die zahlreichste Häusermenge zur Linken, die wir bald nach Flüelen streifen, die sich jedoch nicht vor unseren Blicken aufrollt, sondern sich vielmehr in dem Maße nach dem Berge zurückzieht, als wir die Spitzen davon berühren, ist Altdorf, der Hauptort des Kantons. Dort, unter der berühmten Linde, schlichtete einst der nachmalige König Rudolf von Habsburg als Schiedsrichter die Familienfehde zwischen den Iseli und Gruoba, welche Uri entzweite. Dort steht seit 1895 die neue Teilstatue von Kißling, die wir in Gegenwart des schweizerischen Bundespräsidenten und des Urner Landammanns feierlich einweihten, mit einem Festspiel von Arnold Ott, einem unserer tüchtigsten schweizerischen Schriftsteller (Musik von Arnold). Etwas erhöht, gegen den Grünewald hin, steht das Kapuzinerkloster, das älteste der deutschen Schweiz. Der Grünewald schützt Altdorf vor Lawinen und ‹Riesen› (Schuttlawinen) und wurde deshalb, nachdem einmal im Mittelalter eine Lawine ins Dorf geschlagen, zum Bannwald erklärt, das heißt zu einem Wald, der nicht ausgeholzt werden darf.
Hinten über Altdorf, auf einem Hügel, genau in der Mitte der Berglücke, auf der Schwelle des Schächentales, erhebt sich das anmutige Bürglen, nebst Silenen der älteste Ort der Urschweiz, den die Urkunden nennen (857). Altdorf, Bürglen und Silenen waren die drei ursprünglichen Gemeinden Uris, alle drei dem Frauenkloster Zürich Untertan. Den Namen Bürglen (älteste Form: Burgilla) wollen einige sogar auf römischen Ursprung deuten. Uralt ist Bürglen jedenfalls.
Über Bürglen hinweg dringt der Blick in das freundliche, lichtdurchspülte Schächental, aus dessen Innern einige ferne verschleierte Berge hervorgrüßen. Schwarzgrüne Wälder halten zu beiden Seiten der weitgeöffneten Talpforte Wacht. Bürglen mit dem Eingang des Schächentals bildet den landschaftlichen Mittelpunkt von Uri, den Augenpunkt, um welchen sich das anmutige Wirrsal der Ortschaften gruppiert und zu einem Bild vereinigt.
Jenseits von Bürglen, nach vorn, in der Richtung unserer Fahrt, erhebt sich als Gegenstück zum Altdorfer Grünewald der Bürgler und Schattdorfer Bannwald. Unter demselben, herwärts in der Tiefe, sehen wir Schattdorf (eigentlich Schach-Dorf, das will sagen Walddorf), in dessen Nähe alljährlich unter freiem Himmel die Urner Landsgemeinde abgehalten wird. Unter all den Ortschaften, die uns hier umgeben, nahm Schattdorf längere Zeit insofern eine Sonderstellung ein, als es nicht dem Frauenkloster von Zürich, sondern dem Zisterzienserkloster Wettingen zugehörte. Die Nähe des Schächenbachs brachte Schattdorf wiederholt Verderben; mehrmals im Laufe der Jahrhunderte wurde es durch Überflutungen des Schächenbaches nahezu vernichtet, während Bürglen und Altdorf weniger litten.
Setzen wir uns jetzt ans gegenüberliegende Wagenfenster, nach der Reußseite, also zur Rechten, wenn wir talaufwärts fahren.
Zurückblickend entdecken wir weit hinten in der Nähe des Seegestades einige Häuser. Das sind die Überreste des alten Seedorf, welches wieder in Ober- und Unter-Seedorf geschieden war. Dort stand im Mittelalter ein vornehmes Pilgerhaus des Lazaristenordens, mit ungefähr dreißig Herren und ebensoviel Damen, unter der Oberaufsicht eines Komturs. Ein Gotthardhospiz unten im Tale, ungleich bedeutender als das Hospiz oben auf der Paßhöhe. In Seedorf das Spital, in Flüelen der Reichszoll, so sprach schon die Seeküste vom Gotthard.
Schauen wir dagegen nach vorn, so erblicken wir jenseits der Reuß, da, wo die Reuß der Bahnlinie am nächsten kommt, gegenüber der Mündung des Schächenbaches und der ‹Stillen Reuß'› in die Reuß, Attinghausen, den berühmten Sitz der mächtigen Freiherren von Attinghausen-Schweinsberg, des vornehmsten Geschlechtes der Urschweiz, des einzigen, welches dem hohen Adel beigezählt werden darf, übrigens burgundischer Herkunft, aus dem bernischen Emmental. Mit den bäurischen Stauffachern von Steinen und den ebenfalls bäurischen Fürsto aus dem Schächental teilen die Edlen von Attinghausen die seltene Gunst des Schicksals, daß Sage und Geschichte vereint ihren Ruhm verkünden. Was die Sage von den Attinghausen berichtet, weiß jeder; die Geschichte kennt sie als Landammänner, Siegelbewahrer, Zollherren und Bundesgesandte. Ihre Güter erstreckten sich bis in den Kanton Schwyz (Morschach). Die Trümmer ihres gewaltigen Schlosses bilden die stolzeste Ruine der Urschweiz.
Dies alles also drängt sich, wie gesagt, im engsten Raume zusammen, während der Schnellzug ohne jede Haltstation daran vorüberfliegt. Da sehe eben jeder zu, was er davon erhasche. Zum Schlummern oder Fahrplanstudieren jedenfalls ist hier ein schlecht gewählter Augenblick.
Bald nach Altdorf kommen wir über den Schächenbach, dem man sein vormaliges Ungestüm nicht mehr ansieht; so zahm fließt er jetzt dahin. Man hat ihn endlich gebändigt. Seine einstige Wut wird am ehesten aus der Nachricht ermessen, daß einmal die haushohe Brücke hinter Bürglen von den tobenden Wellen des Baches soll erreicht worden sein.
Kaum haben wir den Schächenbach hinter uns, so fahren wir schon wieder über ein anderes Wasser, das eher den Charakter eines Flusses als den eines Baches hat; das ist die sogenannte ‹Stille Reuß›. Wundern Sie sich vielleicht, daß der Name ‹Reuß› auch einem Nebenfluß zugeteilt wird? Getrost, das kommt später noch bunter: ‹Meienreuß›. ‹Göschenerreuß›. ‹Voralperreuß›. ‹Schwarze Reuß›. ‹Realpreuß›. ‹Gotthardreuß›. In Uri heißt so ziemlich alles, was fließt, ‹Reuß›, wie in Graubünden alles, was naß ist, ‹Rhein›. Die ‹Stille Reuß› ist gewiß eines der kürzesten Flüßchen Europas. Dort drüben unter der Reinacher Fluh bei Schattdorf entspringt sie; hart neben uns, bei Attinghausen, hat sie ein Ende. Ihr Gesamtlauf beträgt nicht einmal eine Stunde. Vielleicht mutet Sie diese befremdende ‹Reuß› traulicher an, wenn ich Ihnen mitteile, daß sie bei den Umwohnern wegen ihrer Forellen berühmt ist.
Erstfeld ist die erste Schnellzugsstation nach Goldau; denn der Halt in Flüelen während des Hochsommers bedeutet bloß eine kleine Gefälligkeitspause für die Dampfschiffpassagiere. Der Aufenthalt in Erstfeld aber wird durch den Umtausch der Lokomotive gegen eine kräftigere Berglokomotive gefordert, die uns bis Biasca führen wird, wo wir wieder in die Ebene gelangen. In Erstfeld also beginnt die Bergstrecke der Gotthardbahn, wenn man will, die Gotthardbahn im engern Sinne (Höhenunterschied zwischen Erstfeld und Luzern kaum vierzig Meter, zwischen Erstfeld und Göschenen über sechshundert Meter). Was sich vor Erstfeld und hinter Biasca anschließt, sind Talbahnen, die nur zwischen Giubiasco und Lugano durch eine kürzere Bergstrecke (Monte Ceneri) mit sechsundzwanzig Promille Steigung unterbrochen werden. Die tessinischen Talbahnen Biasca-Bellinzona-Locarno führten 1874–1882 bis zur Eröffnung der Hauptlinie ein gesondertes Leben, obwohl sie der nämlichen Gesellschaft angehören. Umgekehrt gelangen die nördlichen Zufahrtslinien, Luzern-Küßnacht-Immensee-Goldau und Zürich-Zug-Walchwil-Goldau, obschon sie von jeher im Plan des Gotthardsystems gestanden hatten, erst jetzt zur Ausführung. Damit ist die Verbindung zwischen den deutschen und den italienischen Eisenbahnen mittelst einer schweizerischen Gotthardeisenbahn in dem Umfange hergestellt, wie es der internationale Vertrag vom 15. Oktober 1869 vorgesehen hat.
Die Haltstelle in Erstfeld konnte an keinem glücklichern Punkte gewählt werden. Läge die Station auch nur ein paar Dutzend Meter weiter talauf oder talab, so würden wir eines hohen Naturgenusses verlustig gehen, der uns jetzt zuteil wird. Nämlich, wir halten genau vor der schmalen Öffnung des Erstfeldertales, gewinnen also hiemit die Gelegenheit, während der fünf Minuten, die der Tausch der Lokomotive erfordert, in aller Muße den glitzernden Schloßberggletscher zu bewundern, über die vorstehenden Wagenreihen hinweg, rechts, in der Richtung von Engelberg. Melden wir es gleich vorweg: wir werden fortan auf der ganzen Gotthardlinie nur noch einen einzigen Gletscher zu Gesicht bekommen: oben bei Göschenen. Was einer sonst noch etwa an Schnee erblicken mag, ist verspäteter oder verfrühter Winter, nicht Gletscher oder Firn.
Erstfeld-Göschenen
Ob wir auch schon die Berglokomotive vorgespannt haben, beginnt doch das eigentliche Gebirge erst hinter Amsteg. Einstweilen fahren wir hinter Erstfeld noch immer durchs untere Urital, wenngleich ein weniges ansteigend, wobei wir unvermerkt an dem altehrwürdigen Silenen vorübergleiten, jenem Silenen, welches einst mit Altdorf und Bürglen den Kern von Uri bildete. Ich sage ‹unvermerkt›. Denn es hält wirklich schwer, es aufzuspüren. Nicht als ob wir es nicht zu Gesicht bekämen, im Gegenteil, wir fahren mitten hindurch. Doch die einzelnen Teile liegen so auseinandergruppiert, daß man weder einen Anfang noch eine Mitte noch ein Ende wahrnimmt, zumal auch die Kirche abseits vom Dorfe, links oben unter den Obstbäumen gesondert liegt. Hier sieht man vor lauter Häusern das Dorf nicht. Silenen zu enträtseln stelle ich mir immer wieder zur Aufgabe, so oft ich über den Gotthard fahre.
Offenbar hatte einst Silenen mit der größern Volkszahl und Wichtigkeit auch mehr Zusammenhang und Einheit. Es reichte ohne Zweifel bis an Amsteg hin, welches ja zur Zeit der alten Eidgenossenschaft aus einer einzigen Herberge bestand, die wir uns etwa wie das Wirtshaus oben am Lungenstutz im Maderanertal denken müssen. Während wir darüber nachdenken, jagt ein Stationshäuschen vorüber, auf welchem mit großen Buchstaben der Name ‹Amsteg› ruft. Lassen Sie sich nicht irreführen. Das wirkliche Amsteg liegt noch reichlich zwanzig Minuten Weges von der Station ‹Amsteg› entfernt; es wird erst erscheinen, wenn wir aus dem Windgällentunnel ausfahren und Station ‹Amsteg› schon längst wieder vergessen haben.
Dagegen überrascht uns bei der Station ‹Amsteg› eine stattliche, turmartige, mit Efeu überwachsene Ruine. Und bald darauf, da wo die Poststraße sich plötzlich in die Tiefe um einen Hügel herum senkt, den Hügel isolierend, erscheint auf der Höhe dieses Hügels, in beherrschender Lage, ein kleines, unansehnliches Steintrümmerhäufchen, das von einem modernen, unschönen, viereckigen Hause teilweise maskiert wird.
Wenn wir in der Urschweiz solchen Ruinen begegnen, dürfen wir sie nicht als Zwingburgen fremder Tyrannen deuten, selbst dann nicht, wenn ihnen nachträglich der Volks- oder Gelehrtenmund schreckliche Namen oktroyiert hat, heißt doch die zweite der oben genannten Ruinen, die kleinere, kaum bemerkbare, ‹Zwing-Uri›. In Wirklichkeit gehörten die Burgen, von welchen diese Ruinen die Überreste darstellen, friedlichen, zum Teil höchst patriotischen Privatpersonen: Verwaltungsbeamten der Klöster, einheimischen Halbadligen, bäurischen Freien, Dienstrittern, Meiern und Ammännern. Jeder Meier und Ammann, jeder Ritter und begüterte Freie hatte sein ‹Steinhaus› – so nannte man die Burgen –, und jedes Steinhaus, das sich einigermaßen respektierte, hatte seinen Turm. In Bürglen, Schattdorf, Seedorf, Attinghausen, Erstfeld, Göschenen und so weiter sind oder waren bis vor kurzem Reste solcher Türme zu sehen, der Mehrzahl nach den Klostermeiern von Zürich, andere den Klosterammännern von Wettingen oder privaten Herren gehörend. Die Burg der Herren von Attinghausen, der Mitbegründer der schweizerischen Eidgenossenschaft, eine Tyrannenburg zu nennen, wird wohl niemand einfallen. Nun, die beiden Burgen, deren Ruinen wir zwischen Silenen und Amsteg sehen und von denen die eine Zwing-Uri heißt, waren Wohnsitze einer nicht minder patriotischen Urnerfamilie, nämlich der Klostermeier, später Ritter von Silenen, von denen einer als Landammann von Uri beim ältesten Schweizerbund an erster Stelle mitwirkte, an der Seite des Siegelbewahrers Attinghausen.
Sobald wir in den Windgällentunnel eingefahren sind, empfiehlt es sich, auf der linken Wagenseite Platz zu nehmen und das Auge bereitzuhalten, um beim Austritt aus dem Tunnel den Einschnitt des Maderanertals nicht zu übersehen, für welchen bloß wenige Sekunden übrig sind. Denn jenseits der Brücke fahren wir gleich wieder in den Berg. Gleichzeitig erscheint zur Rechten, unten in der Tiefe, Dorf Amsteg mit der ersten Aufwärtswindung der Gotthardstraße. Beides zu sehen, die Maderanertalschlucht und Amsteg, hält bei der Kürze der Zeit schwer, ja ist wohl überhaupt nur in der Weise möglich, daß man links sitzend zuerst das Maderanertal erschaut und hernach, sobald dieses verschwunden ist, unverzüglich nach der rechten Wagenseite hinübereilt, um auf Amsteg zurückzublicken, solange wir noch nicht in den Bristentunnel oder, um den genauem Namen zu nennen, in den Bristenlauitunnel einfahren. Amsteg, noch im vorigen Jahrhundert einfach ‹am Steg› oder ‹zum Steg› geschrieben, präsentiert sich gegenwärtig als ein schmuckes, ansehnliches Dörfchen. Seinen Aufschwung verdankt es teils dem im siebzehnten Jahrhundert dort funktionierenden Bergwerke der Familie Madrano in der Kerstelenschlucht (daher ‹Maderanertal‹), teils dem Gotthardpaß oder genauer gesagt der Poststraße zu Anfang unseres Jahrhunderts, welche das in großartiger Landschaft gelegene Örtchen den Naturfreunden erschloß. Schließlich kam noch die Anziehungskraft des neuentdeckten Maderanertals hinzu, mit welchem wohl hinfort das Schicksal Amstegs verflochten bleiben wird.
Der Name Bristenlauitunnel ist bedeutsam. Nämlich ‹Laui› heißt Lawine. Wir reisen in der Tat unter einer mächtigen Lawinenstraße dahin. Um der Lawine willen, welche hier mit großer Regelmäßigkeit jedes Frühjahr heruntergleitet – es ist eine Rutschlawine, keine Sturzlawine –, müssen wir den Weg durch den Berg statt außen um den Berg nehmen. Der Tunnel wird durch eine Lücke in zwei Teile getrennt. Wer im Frühjahr, etwa im März oder April, über den Gotthard fährt, kann, falls er Glück hat, die Lawine selbst erblicken, wenn er nach dem Verlassen des Bristenlaui-Doppeltunnels bei der Biegung der Bahn zurückschaut.
Gegenwärtig gilt die Bristenlawine für gänzlich harmlos. Früher, vor Jahrhunderten, soll sie einmal dreihundert ‹französische Recrues› mit einem Schlage vernichtet haben. ‹Französische Recrues›: das will offenbar sagen: Schweizer, die sich zum französischen Söldnerdienst hatten anwerben lassen. Doch klingt die Notiz, die ich in einem schweizerischen Sammelwerk aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts finde, ein bißchen fabelhaft.
Jetzt folgt bis Gurtnellen jene schaurig-schöne Partie, um derentwillen eine Fahrt mit der Gotthardbahn zu den großartigsten Schauspielen der Erde gehört. Nicht mehr als ein Viertelstündchen Fahrzeit, nicht länger als acht Kilometer Bahnstrecke, aber in diesen wenigen Minuten mehr bietend als in den übrigen Stunden zusammengerechnet.
Die Ausfahrt aus dem Windgällentunnel mit dem Blick auf die Maderanertalschlucht und Amsteg war das Vorspiel. Jetzt, sobald wir aus dem Bristenlauitunnel tauchen, rücken die Hauptszenen heran. Zunächst die schwindelhafte Überfahrt auf freier Brücke über den grausigen Schlund der Reuß nach der jenseitigen Gebirgskante. Das Übersetzen auf das andere Ufer empfahl sich den Technikern deshalb, weil die diesseitigen Gebirge (also diejenigen des rechten Reußufers, mit andern Worten diejenigen, die für den Aufwärtsfahrenden zur Linken liegen) weiter oben, in der Gegend von Wassen, noch mehr Lawinen gebären als die entgegengesetzten. Einmal drüben, geht es im Verein mit der alten Poststraße jene wundersamen Halden von Intschi und Zgraggen hinan, welche mit ihren grünen Alptriften und freundlichen Obstgeländen in wonniger Lieblichkeit über den schaurigen Wasserkesseln der Reuß hangen. Zur Rechten brausen Quellen und stürzen Wasserfälle aus den Nischen der Alpweiden; links unten in der Kluft, bald ein Stockwerk höher, bald tiefer unter uns, einen Augenblick verschwindend, dann wieder aufleuchtend, schäumt zwischen finstern Tannen die grüne Reuß. Wo soll man nun sitzen, wohin schauen? Das häuft sich so reich, das drängt sich so eng zusammen, das blitzt so schnell an beiden Seiten vorüber, daß jeder Blick nach der einen Seite auf der andern Seite Unersetzliches verliert. Weil indessen die Empfänglichkeit für das Sensationelle allgemeiner ist als die für sanftere, malerische Landschaftsbilder, kann ich den Rat der Reisehandbücher, links zu sitzen, bestätigen; denn zur Linken tobt die Reuß.
Bei Zgraggen verläßt uns die Poststraße, indem sie zum Fluß hinunter und von dort am andern Ufer gegen Meitschlingen hinauf in den Wassener- oder Wylerwald biegt. Am Trennungspunkt von Straße und Bahn leuchtet an dem gegenüberliegenden Felsen in langem, auffallendem Silberstreifen, blendend wie Schnee im Sonnenschein, der Teiftalbach (‹teif› dialektisch für tief). Später erscheint der romantische Fellibach, leider durch den Wald, namentlich zur Sommerszeit, zum größten Teil verdeckt.
Schon eine geraume Strecke herwärts der Station Gurtnellen laufen Reuß und Bahn wieder auf der nämlichen Höhe. Das Wasser fließt ruhiger, der Wald lichtet sich, das Tal wird weiter, der Pflanzenwuchs spärlicher und einförmiger, die Gegend öder. Von Gurtnellen an ist es weniger die Großartigkeit der Natur als diejenige der Bahnkonstruktion, welche die Aufmerksamkeit beansprucht. Nicht zwar, daß es an Naturschönheiten gebräche; wie wäre das auch überhaupt am Gotthard möglich? Der wiederholte Rückblick auf den klassisch schönen Bristenstock und die klotzige Windgälle, die erst hier, aus der Ferne, zur Vollwirkung gelangen, ferner die zweimalige, eigentlich sogar dreimalige Überbrückung der entzückenden Meienreußschlucht würden, an irgendeine andere Bahnlinie versetzt, das größte Aufsehen wecken. Allein die Überraschungen treten von nun an nicht mehr in fortlaufender Kette, sondern vereinzelt in längern Zwischenräumen auf. Dazu kommt die Verwöhnung durch die vorhergehende Verschwendung und die Abstumpfung der Aufnahmefähigkeit. Denn diese hat eine Grenze; sie heißt Ermüdung.
Aber auf die Meienreußschlucht möchte ich doch ausdrücklich aufmerksam machen. Es ist auch nicht überflüssig, da sie dem unvorbereiteten Reisenden meistens entschlüpft. Mitten zwischen den Kehrtunnels, während die Fenster geschlossen sind und die Passagiere sich resigniert zur Ruhe gesetzt haben, flammt ein farbiger Blitz, man sieht eine Schlucht klaffen und Schaum darin springen, man erhebt sich eiligst in froher Ahnung – zu spät! Schon ist das Bild weg, und von neuem umfängt uns schwarze Tunnelnacht. Das zweite Mal, bei der obern Überfahrt, geht es genau ebenso. Da gilt es, vorbereitet zu sein und aufzupassen. Es lohnt sich. Ich kenne überhaupt keine Kluft, die bei Sonnenschein malerisch schöner wäre. Ein schroffer Abgrund, mit schäumendem Gischt erfüllt, von Felsen umklammert, mit Wald bekränzt und von den wonnigsten Farbenspielen durchleuchtet.
Was nun die berühmten Kehrtunnels betrifft, soll ich die tausendundeinmal beschriebenen zum tausendundzweitenmal beschreiben? Die verblüffenden Wurmwindungen der Fahrt? Das ratlose Hin- und Hersuchen der Lokomotive talauf und talab, als hätte sie ihr Schnupftuch verloren? Das plötzliche Auferstehen auf einer höheren Brücke, wo wir, auf die unteren Brücken hinabblickend, nicht mehr wissen, sind wirs oder sind wirs gewesen? Das verwunschene und verwünschte Kirchlein von Wassen, das mit uns Fangmaus spielt, jetzt uns mit wehmütigem Scheidegruß nachblickend, um ein Viertelstündchen später uns unversehens den Kirchturm entgegenzustrecken, spöttisch und triumphierend: «Ich bin schon da!», wie der Swinegel zum Hasen im Märchen?
Ich weiß ein einfaches Mittel, welches wortreiche Erklärungen überflüssig macht. Wer sich denn wirklich um die Kehrtunnels interessiert, der nehme sich doch einmal, ein einziges Mal die Zeit, in Wassen auszusteigen, um von dort, und zwar just von dem verhexten Kirchlein, einen kurzen Blick an das Gebirge hinüberzuwerfen; der wird ihm sofort alles sagen, was das Herz begehrt, und noch mehr dazu. Denn Wassen ist ein reizend gelegenes Nestchen. Wer zu zeichnen versteht, versehe sich mit Papier und Bleistift; das Dörfchen bietet Anlaß dazu. Und wenn dann schon einmal von den Kehrtunneln die Rede ist, haben Sie sich auch jemals die Frage vorgelegt, weshalb gerade die Gotthardbahn und nur sie mit Kehrtunneln gearbeitet hat? Die Antwort lautet: weil der Ingenieur am Gotthard keine Seitentäler vorfand, in welchen sich die Aufwärtswindung hätte über der Erde (mittelst mehrmaliger Brücken) entwickeln können. Anfänglich erschien das als ein großer Übelstand. Nachträglich jedoch hat es sich als ein Vorteil erwiesen, indem jetzt die Bahnlinie, unterirdisch sich wendend, dagegen oberirdisch stets in der Richtung der Haupttalaxe fortschreitend, nicht den Querwinden und daherrührenden Schneeverwehungen ausgesetzt ist, wie das bei jenen Bergbahnen der Fall ist, welche zur Überwindung der Steigung sich in Seitentälern auf offener Linie herumdrehen.
Übrigens verspürt man, bei aller Bewunderung der Kehrtunnels, doch ordentlich etwas wie Erholung, wenn man nach diesen qualmenden Labyrinthen endlich wieder einmal in einen braven, ehrlichen geraden Tunnel einläuft. Ein solcher ist der anderthalb Kilometer lange Naxbergtunnel vor Göschenen, der unter mehreren Lawinenstraßen durchführt.
Bald nachdem wir den Naxbergtunnel verlassen haben, kommen bereits einige Nebengebäulichkeiten des Bahnhofes Göschenen in Sicht, den wir binnen wenigen Minuten erreichen werden. Statt jedoch bei diesem Anblick sich mit seinem Gepäck zu schaffen zu machen oder unruhig umherzujucken, wird der Erfahrene sich an ein Fenster der rechten Wagenseite drücken, um nach dem Dammagletscher zu suchen, welcher erst dann ins Gesichtsfeld rückt, wenn wir schon unmittelbar vor dem Dorfe Göschenen angelangt sind, und nur während weniger Augenblicke sich voll entfaltet. Es ist ein imposantes Schauspiel, das indessen die wenigsten gewahren, weil der Name ‹Göschenen› die Passagiere dermaßen aufzuregen pflegt, daß sie überhaupt nichts mehr bemerken. Ich weiß eigentlich nicht recht weshalb, da man doch dem Zug nicht voraneilen kann, sondern warten muß, bis er hält.
Der Leser wird im Verlauf meiner Arbeit die Beobachtung machen, daß ich kaum jemals einen Gasthof oder eine Wirtschaft empfehle oder auch nur nenne. Ich unterlasse das geflissentlich, aus wohl überlegtem Grundsatz. Teils, weil ich die Frage nach einer etwas bessern oder minder guten Bewirtung nicht für etwas Aufhebens wertes halte, namentlich aber, weil man mit einem einzigen irrtümlichen öffentlichen Urteil mehr Schaden stiftet als mit zwanzig richtigen Urteilen Nutzen, Irren aber menschlich ist. Wenn ich daher hier eine Ausnahme mache, indem ich rate, in Göschenen die Mittagstafel nicht zu verschmähen, so hat das einen besondern Grund, und dieser heißt: die Bergluft. Auf einem Berge soll man tüchtig essen; punktum. Die Bergluft aber macht sich in dem weiten, frischen Speisesaal des Göschener Bahnhofes kräftig geltend. In Göschenen zu Mittag essen ist eine zwar kurze, doch köstliche Luftkur.
Der Gotthardtunnel
Ohne eine gewisse feierlich andächtige Spannung fährt wohl kaum jemand zum erstenmal in den Gotthardtunnel. Und ob auch bei öfterer Fahrt allmählich die Gewohnheit den Eindruck abstumpfe – was stumpfte die Gewohnheit nicht ab! –, so vertraut wird einem der Gotthardtunnel nie, daß er uns nicht wenigstens Achtsamkeit abnötigte. In der Tat, eine halbe Stunde lang im Innern der Erde dahinzudampfen, mit Bergen und Gletschern von Pilatushöhe über dem Kopf, Flüsse und Seen ungerechnet, das ist wahrlich kein alltägliches Gefühl – man müßte denn Bahnschaffner sein. Da sich indessen die erhabenste Tunnelnacht in nichts von einer gemeinen Kellernacht unterscheidet, so fällt die Spannung mangels Nahrung sehr bald ab. Man möchte sich etwas denken, fühlt sich sogar in Anbetracht der bedeutenden Gegenwart dazu verpflichtet, weiß jedoch nicht recht was, um so weniger, als das höllische Kreischen des Gesteins alle zarteren Gedankenfäden zerreißt: «Was geschähe jetzt, wenn jetzt –? Eine Entgleisung mitten im Tunnel zum Beispiel –» oder, wie jene Bäuerin meinte, «wenn sich der Zug unter der Erde ‹verirrte›. so daß er statt nach Italien gegen Österreich führe und unterwegs stecken bliebe, daß man ihn ausgraben müßte wie den Dachs in der Höhle?» Unterdessen gellt das rasselnde Getöse beständig um unsere Ohren, gleich dem metallischen Prasseln eines Erdbebens unsere Nerven daran erinnernd, wie hart die Erde ist und wie weich wir sind mitsamt unseren Kalkknochen.
Die Zigarre will auch nicht recht munden, natürlich; denn erfahrungsgemäß schmeckt die Zigarre nur unter der Bedingung, daß wir den Rauch verfolgen können. Wir rauchen mit den Augen.
Ob auch das Denken nicht geraten will, so gelingt doch das Kritisieren; denn zum Kritisieren ist ja das Denken nicht unerläßlich. Den Gotthardtunnel zu kontrollieren, sich tückisch auf die Lauer zu setzen, die Uhr in der Hand, ob er auch halte, was er verspricht, ob er nicht ein paar Minuten eskamotiere, ist eine Lieblingsbeschäftigung der Gotthardfahrer. Nun, die Hoffnung, den Tunnel auf einer Lüge zu ertappen, schlägt fehl. Es sind richtig wohlgezählte zwanzig Minuten mit dem Schnellzug (nächstens werden es einige Minuten weniger sein), fünfundzwanzig mit gewöhnlichen Zügen.
Hingegen über den Gefühlseindruck, den diese bestimmte und bekannte, sogar zum voraus bekannte Zeitdauer auf den einzelnen gemacht hat, über die Frage, ob einem der Tunnel länger oder kürzer vorgekommen sei, als man erwartet hatte, darüber wird stets die größte Meinungsverschiedenheit herrschen, und zwar so, daß der nämliche Mensch den Tunnel das eine Mal unerwartet lang, ein andermal wieder unerwartet kurz empfindet.
Ohne Prophet zu sein, maße ich mir doch eine Voraussage an. Das erste Mal, daß einer durch den Tunnel fährt, wird er ihn unfehlbar weit kürzer finden, als er erwartet hatte, das zweite Mal länger, das dritte Mal wieder kürzer, und so weiter in regelmäßiger Abwechslung wie gerade und ungerade. Vorausgesetzt, daß die Pausen zwischen den Reisen nicht zu lange sind; denn nach längeren Pausen fängt das Vexierspiel von vorne an. Die Sache erklärt sich leicht. Nämlich das erste Mal macht sich der Reisende unter dem Einfluß des Ruhms, den der Gotthardtunnel wegen seiner Länge (fünfzehn Kilometer) genießt, auf eine erstaunliche Langzeitigkeit, auf eine Art Ewigkeit in Miniatur gefaßt. Allein zwanzig Minuten, wenn man bequem sitzt, mit einem guten Mittagessen im Leib, und vielleicht unvermerkt noch ein paar Minütchen einnickt, das geht glatt vorüber. Das zweite Mal werden wir umgekehrt durch die Erinnerung beeinflußt, wie kurz uns der Tunnel vorgekommen war; folglich unterschätzen wir ihn diesmal und finden ihn dann natürlich unerwartet lang. Und so fort. Immer fälscht ein vorausgehendes Gedankenbild die Erwartung; was Wunder, daß die Erwartung getäuscht wird? Und die Moral dieses Trugspieles? Daß die Phantasie überhaupt kein Maß hat, um räumliche und zeitliche Entfernungen zu messen, noch weniger die Fähigkeit, sie im Gedächtnis zu behalten. So philosophisch das klingt, so ist es doch wahr.
Die Tunnelfahrt würde übrigens unterhaltender verlaufen, wenn wir ungefähr zu erraten vermöchten, wo unter der Welt wir uns jeweilen befinden. Es braucht ja nicht eine förmliche Gewißheit zu sein; wozu denn auch? Aber annähernd wenigstens sollten wir die Strecke, die wir durchlaufen, von Minute zu Minute verfolgen können, das bringt ein bißchen Leben in die Finsternis. Es sei mir daher gestattet, einige Winke in dieser Hinsicht zu erteilen.
Sofort nach dem Eintritt in den Tunnel hinter Göschenen eilen wir unter den linkseitigen Bergen der Schöllenenschlucht dahin, so daß die Schlucht selbst samt Reuß und Poststraße in beträchtlichem Bogen rechtsab liegen bleibt. Nach den ersten Minuten fahren wir in der Nähe der Teufelsbrücke, streifen dann jenseits des Urnerloches, welches fast senkrecht über uns liegt, nochmals die Reuß, lassen Andermatt, dem wir so nahe kommen, daß man eine Zeitlang an eine unterirdische Tunnelstation Andermatt, mit einem Lift, gedacht hat, zur Linken, Hospenthal dagegen weitab zur Rechten und tauchen, während die alte Gotthardstraße sich immer weiter von uns, und zwar meilenweit, nach rechts entfernt, unter den St. Annagletscher und das fast dreitausend Meter hohe Kastelhorn. Das Kastelhorn entspricht ungefähr der Mitte des Tunnels. Allein noch immer steigen wir, mit fünf Promille, und zwar bis zu zwei Dritteilen der Tunnellänge (Tunnellänge rund fünfzehn Kilometer), zunächst unter dem Tritthorn durch, dann unter dem Sellasee, an welcher Stelle wir dem Gotthardhospiz am nächsten kommen; immerhin noch so weit links davon entfernt, daß wir, wenn wir in schnurgerader Linie an die Erdoberfläche steigen könnten, vom Hospiz durch den Monte Prosa getrennt wären. Hier, ungefähr unter dem Sellasee, nachdem wir im Innern der Erde eine Höhe von 1154 Meter über dem Meer erreicht haben, gleiten wir mit zwei Promille Senkung unter den Sella- und Scipsciusalpen und zuletzt unter der kleinen Festung Stuei nach Airolo hinab. 1154 Meter ist mithin der höchste Punkt der Gotthardbahn. Göschenen und Airolo liegen indessen nur wenig tiefer: Tunneleingang bei Göschenen 1109 Meter, bei Airolo 1144 Meter.
Der Tunnel läuft natürlicher- und vernünftigerweise in einer schnurgeraden Linie wie die Bahn von Petersburg nach Moskau, deren Verlauf Kaiser Nikolaus in der Weise bestimmt haben soll, daß er einfach ein Lineal auf die Karte legte. Das Lineal stößt aber oben am Gotthard vor den zweitausend Meter hohen Bergen auf erhebliche Hindernisse.
Da der Tunnel ziemlich genau von Norden nach Süden, das Tessintal bei Airolo dagegen von Westen nach Osten läuft, so galt es, bei der Ausfahrt einen rechten Winkel im Halbbogen zu umschreiben. Zur Entwicklung dieses Halbbogens zwischen der Tunnelausmündung und der nahen Station Airolo war aber kein Raum vorhanden, folglich mußte das Anfangsstück der Kurve ins Innere des Tunnels verlegt werden. Das hat nun zur Folge, daß die Tunnelausfahrt nicht minder desorientierend wirkt als irgendein Kehrtunnel. Frage, wen du magst, nach der Richtung, aus welcher wir gefahren kommen, also nach der Richtung des Tunnels, so wird der eine nach dem Tremolatal, der andere vielleicht gar nach dem Bedrettotal und dem Wallis deuten, schwerlich jemand nach der richtigen Linie, nämlich nach dem Scipscius und dem Sellagebirge. Nicht hinter uns, sondern seitwärts zur Linken liegt der Tunnel.
Airolo-Rodi-Fiesso
Aus dem finstern Tunnel in neues Licht und in eine andere Welt! Wem sollte es da nicht ein bißchen im Herzen jauchzen? Den ersten frohen Gruß bei der Tunnelausfahrt weihen wir dem strahlenden Tag – vorausgesetzt, daß es nicht etwa regnet oder schneit –, den zweiten dem lachenden Süden. Es heißt ja, wir seien jetzt in Südeuropa. Wir wissens und wagens doch kaum zu glauben. Und wenn wirs auch glauben, so fehlt uns eine Schnalle, um die ungeheuerliche Tatsache ins Gefühl und Bewußtsein zu heften. Zu unserer Rechten schnellt ein Gewässer. Sollte das wirklich der Tessin sein? Das Wasser sieht um kein Tröpfchen italienischer aus als jedes andere Wasser. Dennoch ist es der Tessin. Und siehe da, er schickt wahrhaftig seine Wellen programmmäßig an uns vorbei, vorwärts, Italien zu, genau, wie es auf der Karte vorgeschrieben steht. Es ist also kein Märchen: Wir sind in Südeuropa.
Hierauf bemühen wir uns, dem Charakter der Umgegend auf die Spur zu kommen. Befinden wir uns eigentlich in einem Tale oder nicht vielmehr auf einer Hochebene? Die Landschaft ist kompliziert und spricht für beides. Nur eine ganz neue Eigenschaft fällt uns sofort unzweideutig auf: die ungewohnte, bis in alle Winkel zündende Lichtfülle. Der Himmel strahlt, die Luft glänzt, der Boden blendet. Und da der Mensch ein Augentier ist, mithin lichtdurstig, verspüren wir zunächst eine förmliche Exaltation. Um alles möchten wir in diesem Augenblick nicht wieder nach Göschenen, ins finstere Reußtal zurück. Aber immer noch sucht der Blick vergebens nach einem Aufschluß, wie schließlich Airolo und Umgegend von der Natur gemeint sei, hoch oder tief, rauh oder lind, einladend oder öde. Hierauf vermag nur die Erfahrung Auskunft zu erteilen. Ich will es versuchen.
Airolo, die höchste Ortschaft der Gotthardbahn, hat Bergklima wie etwa der Rigi. Als Luftkurort im Hochsommer steht es keinem andern nach, bietet in den Gasthöfen Komfort, mehr als alle übrigen Stationen im Bereich des Gotthard mit Ausnahme von Andermatt, und hat zahlreichen Besuch von Mailand her. Die nächste Umgebung ist schattenlos, dagegen gibt es entferntere Ausflugsziele die Menge: vor allem den Gotthard, dann das Bedrettotal, die Höhen von Altanca, Val Canaria, Val Piora und so weiter. Für ausgiebige, gründliche Erforschung des Gotthard mittelst größerer Exkursionen ist Airolo der natürliche Ausgangspunkt; es bedeutet für den Gotthard im besondern das, was Andermatt für die Zentralalpen bedeutet: das Ausflugszentrum. Ein großer Vorzug von Airolo ist die Stille. Nicht Windstille, denn die Luft zieht, aber Abwesenheit von Geräusch, selbst von Herdengeklingel. In der Nacht ist es so still, daß man meint, die Sterne singen zu hören. Kurz: ein sonniges, ruhiges und frisches Bergdorf.
Im Winter ist Airolo ein wahres Sibirien mit zwanzig Grad Kälte und fabelhaften Schneemassen, solchen Schneemassen, wie sie die Phantasie gar nicht zusammenzudichten vermag. Aber ein gesundes Sibirien, wie ich von den Herren Offizieren der Festung weiß, überhaupt jahraus, jahrein nervenerfrischend; ich schlafe nirgends so gut wie in Airolo. Der Schnee bleibt bis in den Mai liegen und erscheint im Oktober schon wieder, so daß Frühling und Herbst dort oben am sichersten im Kalender zu treffen sind. Während des Winters erreicht der Sonnenstrahl die Tiefe des Tales, also Airolo, kaum, dagegen strahlen die umliegenden Höhen in den wunderbarsten Sonnenspielen; etwas wie Alpenglühen von einer unsichtbaren Sonne. Jahraus, jahrein, bei Sonnen- und Mondenschein gibt es in der Luft über Airolo, an den Bergspitzen, am Himmel, im Gewölke etwas zu entdecken und zu bewundern. Als ob dort oben am Gotthard außer den Wasserquellen noch eine geheimnisvolle unsichtbare Lichtquelle flutete.
Orientieren wir uns endlich noch rasch über die wichtigsten Punkte, die wir sehen. Zur Linken, über dem Bahnhof und dem Städtchen Airolo, erhebt sich der Scipscius, von welchem alljährlich die Lawinen bis nahe an die Ortschaft herunterrollen. Im Winter 1894 auf 1895 wurde sogar ein Endteil von Airolo von der Lawine erfaßt und begraben, wobei mehrere Menschen umkamen. Der Scipscius, wie überhaupt die ganze linkseitige Bergmauer bis zur Blenioschlucht bei Biasca, wird von der Geologie zum Gotthardgebirge gerechnet, nicht jedoch die rechtseitige.
Hinter uns zieht sich der unterste Hang des Gotthard hinan, dessen Poststraße und Festungen das Auge zur Not zu unterscheiden vermag, vorausgesetzt, daß wir über die genaue Lage unterrichtet sind. Rückwärts zur Rechten, das Tal, aus welchem uns der Tessin nacheilt, ist das Bedrettotal, wo die riesigsten Lawinen des ganzen Alpengebietes stürzen sollen. Vor uns in malerischer Enge die Stalvedroschlucht, mit Ruinen, die meines Wissens noch niemand mit Sicherheit historisch zu erklären vermocht hat.
Auch hier bei Airolo gilt es hurtig zu beobachten, denn die Bilder rollen rücksichtslos schnell in die Verschiebungen und Versenkungen, zumal der Blitzzug in Airolo nicht anhält. Der Neuling setzt sich wohl, sobald der Zug Airolo zurückgelegt hat, am Fenster zurecht, um eine zweite Auflage des Reußtales, ins Italienische übersetzt, mit farbigen Illustrationen verschönert, in Empfang zu nehmen. Er würde sich das gefallen lassen. Der Anfang, die romantische Stalvedroschlucht im Raubritterstil, gibt der Erwartung Recht, ja reizt sie noch mehr. Nämlich der Tessinfluß nimmt hier entschieden die Gebärden der Reuß an, grüne Strudel in Fels und Waldschatten bildend. Allein das wird bald anders. Die Stalvedroschlucht bedeutet keineswegs eine erste Probe, eine typische Einleitung in die Leventina (so heißt das obere Tessintal), sondern eine Ausnahme. Vielmehr weitet sich bald das Tal zu einer meilenlangen Hochebene aus, auf deren Fläche wir jetzt geraume Zeit dahinfahren, jenseits des Tessins, dicht unter den Bergmauern zur Rechten. Weder der träge, seichte Fluß, noch seine weidenbesetzten Ufer, noch der nackte Talboden mit der geradlinigen staubigen Landstraße und den armseligen Dörfchen vermögen unsere Aufmerksamkeit zu befriedigen. Nur die steinigen, festungsähnlichen Bergdörfer, die gegenüber hoch oben an den linksseitigen Felswänden kleben, halten notdürftig das Aufsehen wach. Alles in allem geschieht es hier zum erstenmal auf der Gotthardfahrt, daß der Blick des Reisenden gleichgültig zurückkehrt. Wie ganz anders, wenn wir diese in der Zeichnung so einförmig starre, in den Farben so bunte Landschaft, diese aus der Ferne unsichtbaren Felsfluren, diese aromatische, frische und zugleich sonnenglutwarme Gebirgsluft vorher durch Fußmärsche kennen gelernt haben! Ich werde darauf zurückkommen und wohl mehr als nur einmal. Einstweilen will ich mitteilen, daß ich, wenn ich an meine Streifereien im Gotthardgebiet zurückdenke, zuallererst dieses scheinbar so monotone Hochplateau vor Augen sehe. Die Kammer von Airolo gilt mir für die Beletage des Gotthard.
Überaus schön, weich und groß zugleich, an ein Gemälde von Claude Lorrain gemahnend, schließt das Hochplateau hinter Rodi-Fiesso ab. Zur Linken verriegelt der Monte Piottino den Ausgang; von rechts steigt ein sanfter Flügel, dessen Halde das Dörfchen Prato schmückt, dem Monte Piottino entgegen. Daß es dort drüben, in der Talsperre, wo das Auge weder Tor noch Gasse zu erspähen vermag, nicht mit gewöhnlichen Dingen zugehen werde, das sagen uns Sinn und Verstand.
Rodi-Fiesso-Faido-Lavorgo
In der Tat sind wir vor der ersten der beiden gewaltigen Sturztreppen angelangt, welche die Leventina (oder verdeutscht: das Livinental) in drei Stockwerke scheiden. Nämlich nicht in stetiger Flucht wie das Reußtal, sondern mittelst jäher Treppen von je zweihundert Metern sinkt die Leventina in die Tiefe, zwischen den Treppen weite, geräumige, scheinbar völlig ebene, in Wirklichkeit sanft geneigte Kammern eröffnend. Die höchste Kammer der obern Leventina, also das Plateau zwischen Airolo und Rodi, haben wir zurückgelegt; jetzt jagen wir durch zwei labyrinthische Spiraltunnels, wo selbst das aufgeweckteste Spürauge den Kompaß nicht mehr findet, bald unter den diesseitigen, bald unter den jenseitigen Bergen die erste Treppe, den sogenannten Dazio Grande, hinab.
Gleich zu Anfang hinter der Felspforte spritzt uns wilder Wassergischt in hohen Sprüngen entgegen. Weißes Schaumgewoge, jähe Felswände, Schluchten, Talkessel, Brücken, Straßen und Schienenlinien, letztere vermutlich unserer Bahn angehörend, erscheinen und verschwinden in verwirrender Schnelligkeit. Einmal grüßt tief unten mit längerm Blick ein großes, stimmungsvolles Flußtal; die Regel aber bildet dicke Tunnelnacht, durchwirkt mit Landschaftsträumen, die in fieberhafter Hast einander verfolgen. Nicht das begeisterte Entzücken wie jenseits bei den Reußschluchten von Intschi, wo zwar die Bilder ebenfalls blitzschnell vorübergleiten, aber sich dabei, wenn auch nur für einen Augenblick, klar entfalten; hier im Dazio Grande ist es ein großartiges Chaos, in welchem die Natur kunterbunt durcheinander wirbelt, so daß man nicht mehr weiß, was unten und oben, vorn und hinten ist. Der Dazio Grande will zu Fuß durchwandert werden und soll es auch. Denn er ist ein Glanzpunkt des Gotthardgebirges und die großartigste Partie des Tessintales.
Mit dem Eintritt in die mittlere Leventina, den Boden von Faido, gerät zum erstenmal, wonach wir schon lange lüsterten, etwas wie italienische Stimmung. Wir müssen freilich den guten Willen dazu mitbringen, denn es ist immer noch ein sehr mageres Italien. Eine große Kastanienhalde zur Linken, einige Maulbeerbäume um das Städtchen, das ist so ziemlich alles. Immerhin sind die Maulbeerbäume etwas Neues. Ein Besuch des Städtchens würde uns etwas mehr zeigen: italienische Bauart und italienische Sitten, weit ausgesprochener als in Airolo.
Doch nicht darin beruht der Vorzug Faidos, daß es das erste rein italienische Nestchen, sondern daß es der letzte Ort mit alpinem Klima und mit imposanter Gebirgsumgebung ist. Die finsteren Waldberge über dem engen Tal, in welchem der Morgen nie aufhört zu beginnen, der reichliche Schatten, die erhabene Stille, belebt durch einigen Vogelgesang, das verleiht Faido seinen Reiz.
Auf seinen Wasserfall ist Faido stolz, und mit Recht. Denn er ist einer der schönsten des Tessins, und das will viel heißen. Nämlich hinsichtlich der Wasserfälle läuft die Leventina dem Reußtal den Rang ab, das ja eigentliche Wasserfälle vermöge des schrägeren Abfalles der Berghänge kaum kennt. Im Reußtal schäumen die Bäche, im Tessin stäuben sie. Sie sind zahlreich und dabei abwechslungsreich, die Tessiner Wasserfälle. Erfinderisch, möchte ich sagen. Bald ein einziger langer Faden, bald eine Reihe von Sprüngen über Stufen; einmal ist es ein breiter, malerischer Gießbach im Walde (bei Faido), ein andermal wirft sich das Wasser in Winkeln kreuz und quer (bei Biasca).
Nachdem wir Faido hinter uns gebracht haben, geht es auf ebenem, schmalem, fruchtbarem Boden dem zweiten Verschluß und der zweiten Treppe entgegen, während der Schwarzwald des Gebirges die stets enger werdende Talspalte immer mehr überschattet.
Bei Lavorgo begegnen wir zum erstenmal einem großen Steinbruch (dem zweiten später zwischen Osogna und Claro). Die Ausbeutung desselben, sowie überhaupt die Tessiner Steinbruchindustrie im großen Stil, wurde durch die Gotthardbahn recht eigentlich ins Leben gerufen. Nachdem vor elf Jahren nur fünftausend Tonnen Steinmaterial zur Ausnützung und Versendung gelangten, ist jetzt die Ausfuhr auf siebzigtausend Tonnen per Jahr gestiegen. Der Stein ist Granit (die Italiener nennens Marmor, wie sie ja mit dem Worte Marmor überhaupt sehr freigebig verfahren), ein Granit, der an Güte nicht völlig dem Granit von Wassen gleichkommt, aber wegen seiner unerschöpflichen Menge und seiner Billigkeit jedes andere Schweizer Baumaterial bald gänzlich zu überflügeln berufen ist. Vor allem der früher so beliebte Solothurner und Berner (Ostermundiger) Sandstein bekommt die Konkurrenz des Tessiner Granits empfindlich zu spüren. Wenn ich die Wahl habe, ein Gebäude, eine Mauer, eine Treppe zu demselben Preis in unzerstörbarem Granit oder in weichem, brüchigem Sandstein zu erstellen, so werde ich mich natürlich ohne Zaudern für den Granit entscheiden. In der Tat trifft man denn nördlich der Alpen mit jedem Jahr häufiger den Granit an Stelle des Sandsteins. Der neue Bahnhof von Luzern zum Beispiel ist gänzlich aus dem Granit von Lavorgo und Osogna gebaut.
Lavorgo-Biasca-Bellinzona
Die zweite Stufe, die sogenannte Biaschina, wird uns endgültig in das italienische Tiefland führen. Was Wunder, wenn Blick und Aufmerksamkeit sich schärfen, um die ersten Spuren des Südens, der länger zögert, als wir erwartet hatten, endlich zu erhaschen. Denn wie gesagt, die Kastanien- und Maulbeerbäume von Faido sind eher dazu angetan, unsern Hunger zu reizen, als ihn zu stillen.
Zunächst freilich ist wieder einmal Rauch und Qualm Meister. Ein langer, umständlicher Kehrtunnel führt uns zur Abwechslung wieder an der Nase herum, und kaum daß wir ihn verlassen haben, so verschlingt uns alsbald ein zweiter, der seine Aufgabe ebenso gründlich löst wie der erste, ohne sich das mindeste abmarkten zu lassen. Endlich sind sie überwunden. Doch siehe da: statt des geträumten Gartensüdens umfängt uns ein ödes Steingebirge, an dessen untern Wänden sich wollige Kastanien spärlich wie eine versprengte Schafherde hinanziehen; in den Steinen schäumt der Tessin. Das Bild gemahnt eher an eine Tremolaszene hoch oben an der Baumgrenze als an eine italienische Landschaft. Zunächst sträuben wir uns, doch je länger wir fahren, desto deutlicher kommt uns zum Bewußtsein, daß wir in Erwartung dessen, was wir Neues zugewinnen werden, einstweilen viel verloren haben. Schmerzlich vermissen wir mancherlei. Aber was nur? Nun, wir vermissen, und haben es unbewußt schon längst vermißt, die Gletscher, die Alpen (Alp heißt Bergweide), die sauberen, freundlichen Sennhütten, den individuellen Charakter und das ausdrucksvolle Profil der Berge. Um den letztern, gewaltigen Verlust zu ermessen, braucht man nur an die Berge des Reußtales zurückzudenken. Dort hatte jeder Berg sein eigenes Antlitz. Wer auch nur einmal den Bristenstock gesehen, kann ihn weder verwechseln noch vergessen. Dagegen im Tessin gleicht eine Kuppe der andern; es sind gigantische Steinblöcke, Mauern, Wände, einige höher, andere tiefer, aber ohne wesentliche Verschiedenheit. Darum fällt es auch hier niemand ein, nach den Namen der Berge zu fragen; denn nur das Eigentümliche heischt einen Namen. Das alles hatten wir, wie gesagt, schon längere Zeit unbewußt entbehrt, hier in der Biaschina dagegen wird es uns klar, und zwar deshalb, weil noch eine weitere Einbuße hinzukommt, die so auffällig ist, daß wir sie unmöglich nicht bemerken können: der Wald hat uns verlassen. Und zwar auf Nimmerwiedersehen. Ich spreche nur aus, was jeder Reisende fühlt: Der obere Teil des Tessintales ist landschaftlich bedeutender als der untere. Sollten wir uns hierin täuschen? Wir wollen einmal die Probe auf das Exempel anstellen. Wer von Süden her über den Gotthard fährt, wird sowohl an sich als an seinen Reisegefährten die Beobachtung machen, daß das Interesse wächst, die Stimmung sich belebt, das Entzücken sich steigert, je höher wir gegen Airolo kommen. Überhaupt halte ich, um dies beiläufig zu bemerken, die Fahrt von Süden her für die Wertschätzung des Tessintales für zuträglicher. Einmal weil in diesem Fall ein Fortschritt von minderer zu größerer Bedeutung der Gegend stattfindet; dann aber auch, weil der von Norden Reisende im Tessintal in mattem Zustande anlangt, mit abgespannten Nerven und erschöpfter Aufmerksamkeit. Es bedürfte schon ganz außerordentlicher Naturschauspiele, um die Aufnahmelust wieder zu wecken. Solche ganz außerordentliche Naturschauspiele besitzt jedoch die Leventina nicht (mit Ausnahme des Dazio Grande, den wir nicht zu sehen bekommen); demnach finden die wirklich vorhandenen, durchaus nicht zu verachtenden Vorzüge des Tessins schwer die gebührende Teilnahme. Wir reisen, von Norden kommend, durch das untere Tessin unter den Bedingungen eines Publikums im vierten Akt einer großen Oper. So viel haben wir bereits vernommen, so viel genossen, so viel gefühlt, daß es genügt und übergenügt; wir spüren nur noch einen Wunsch, den baldigen Schluß. Die Erschöpfung der Aufnahmefähigkeit, verursacht durch den Überreichtum der Naturgenüsse, tritt so sicher und so regelmäßig ein, daß ich mich anheischig mache, den Ort zu bezeichnen, wo sie sich anmeldet, nämlich spätestens in Faido, meistens noch früher. Es gehört mithin, um die Schönheiten einer Gotthardfahrt zu würdigen, zu der Reise die Rückreise, welche dem Tessin die nötige Frische der Nerven und Bereitwilligkeit der Stimmung entgegenbringt.
Ob nicht vielleicht überhaupt die Gotthardfahrt sich vorteilhafter entwickelt, wenn wir sie von Süden statt von Norden unternehmen? Prüfe ich meine Erinnerungen, so bin ich geneigt, die Frage zu bejahen; denn ich habe stets die Erfahrung gemacht, daß die Hinreise ermüdet, die Rückreise erquickt. Es scheint, der Übergang aus der Tiefenluft des Südens in die frischere Bergluft der Nordseite sage den Nerven besser zu als der umgekehrte Tausch.
Selbst der lahmsten Aufmerksamkeit wird übrigens das üppige Giornico einen Ausruf der Bewunderung ablocken, das am Endpunkte der mürrischen Biaschina plötzlich wie mit einem Zauberschlage dasteht: ein wahrer Garten von Weinreben, Feigen und Pfirsichen. Giornico ist das Weggis der Leventina, ich meine das Obst- und Gemüsedorf. Auch klimatisch noch wenig von Weggis unterschieden. Was in Giornico gedeiht, kommt auch in Vitznau und Gersau vor. Der Stil der Wohnungen und des Gartenbaues mag uns italienisch anmuten, die Vegetation selber, wenn wir genauer zusehen, ist noch nicht südlich. Das Hauptkennzeichen südlicher Vegetation ist die Vorherrschaft edler immergrüner Sträucher und Bäume. Hiervon besitzt aber Giornico nicht nur nicht mehr als der Vierwaldstättersee, sondern sogar viel weniger, nämlich nichts. Reisen wir im Winter durch, so gewahren wir kein grünes Blättchen, keine lebendige Nadel, lauter kahles Baumgerippe zwischen Stein und Schnee, mitunter auch Eis.
Das Eis hat einmal in Giornico historische Bedeutung erlangt. Eines Dezembertages im Jahre 1478, als eben Frostwetter eintrat, ließ in der Nähe von Giornico der Anführer der Schweizer, Frischhans Theiling, den Tessin stauen, so daß er Gefild und Wege überschwemmte und bald eine glatte Eisfläche herstellte. Auf dem Eise vermochten die mailändischen Reiter und Geschütze nicht Stand zu fassen, während die Schweizer mit ihren famosen, in so mancher Schlacht bewährten Steigeisen sich unbehindert fortbewegten. Die Schlacht endete mit der völligen Niederlage der Mailänder.
Vieles erzählt die Geschichte von Giornico. Noch interessanter jedoch ist für viele das, was sie verschweigt oder verhüllt. Denn das gibt willkommenen Anlaß zum Enträtseln. Im besondern für Kunsthistoriker ist Giornico mit seinen uralten kirchlichen Denkmälern eine reiche Fundgrube. Wer hierüber Aufschluß begehrt, findet ihn bei Rahn, der ersten Autorität in tessinischen Kunstaltertümern: «Rahn, Die Kunstdenkmäler des Mittelalters im Kanton Tessin», mit einer amtlichen italienischen Übersetzung von Eligio Pometta; ferner «Rahn, Kunst- und Wanderstudien aus der Schweiz» und andere Schriften. Da Rahn zugleich ein tüchtiger Zeichner ist, erhalten die Illustrationen neben dem sachlichen noch persönlichen Wert.
Auch Giornico bedeutet nicht einen Anfang, sondern eine Oase, nach welcher die nackten Berge wieder das Bild behaupten, womöglich noch kahler als vorher, während gleichzeitig das Flußbett in dem allmählich sich erweiternden Tale sich verflacht; denn schon sind wir ins ebene Land hinabgestiegen und streben der Alpenöffnung entgegen. Den Vordergrund behauptet eine wuchernde Deltavegetation, welche die Feigen und Reben dem Auge entrückt. Zugleich wird die Luft heißer, drückender, dumpfer. Sogar in den Frühlingsmonaten, wo wir die Wärme zunächst als eine Wohltat begrüßen, belästigt sie uns doch in der schwülen Niederung.
Länger, als man erwartet, dauert noch die Fahrt, denn unwillkürlich setzen wir in unserer Einbildung die Ebene als den Endpunkt; in Wirklichkeit jedoch haben wir noch einen ausgedehnten Korridor mit mehreren Dörfern, die sogenannte Riviera, zu durchlaufen, ehe wir die ersehnte Alpenpforte von Bellinzona erreichen. Während wir aber noch nicht erhalten, was wir wünschen, wird uns etwas, worauf wir nicht hoffen. Unmittelbar vor Biasca geschieht ohne jede Vorbereitung ein Ereignis großen Stils: die erste Bresche des Alpengebirges, ein riesiger Durchbruch der Bergmauern von unten bis oben, aus welchem uns in mächtigem Strome Luft und Licht seitwärts entgegenflutet. Ein Bach bricht aus der Lücke hervor; im Hintergrunde zeigt eine vielstufige Perspektive allerlei nahe und ferne Berge, in Kulissen durcheinandergeschoben und mannigfach abgetönt. Das ist die Lukmanierlücke mit dem Bleniotal.
Ein ähnliches Motiv, nämlich eine zweite Bresche, wird ein Viertelstündchen später nach Biasca erscheinen, bei Castione, wo sich das Misoxertal, der Zugang zum Bernardin, enthüllt. Es sind Variationen über dasselbe Thema, die sich nicht wiederholen, sondern ergänzen. Immerhin, wenn wir vergleichen wollen, zaudere ich nicht, der Lukmanierlücke den Vorrang einzuräumen. Die Alpentore des Bleniotales und des Misoxertales sind imposant und auffallend. Sie wurden auch niemals übersehen. Schon die Römer suchten und fanden hier den Weg über den Lukmanier und den Bernardin. Später zogen Könige hier durch; über den Lukmanier fränkische: Pipin der Kleine, der Vater Karls des Großen, 754 auf 755, und später König Karl der Dicke 875; über den Bernardin deutsche: König Sigismund 1413. Wir gelangen also mit Biasca auf uralten historischen Boden.
An Biasca fahren wir vorüber, ohne einen Einblick in das Dorf zu gewinnen; einen erheblichen Verlust erleiden wir dadurch nicht. Station Biasca, ein kleines Viertelstündchen weiter talwärts gelegen, ist der Endpunkt der Gotthardbahn im engern Sinne; die Berglokomotive wird abgespannt und es wird dadurch ein kleiner Halt bedingt, der erste nach Göschenen, wenn wir mit dem Blitzzug fahren. Sie sind nicht zahlreich, die Haltpunkte des Blitzzuges. Je einer an den Endpunkten des Gebirges, Erstfeld und Biasca, und einer oben in Göschenen. Für die Zufahrtslinien sind im Norden Rotkreuz, nächstens jedoch statt Rotkreuz Goldau, im Süden Bellinzona die Ausgangspunkte. Innerhalb des Gebirges, von Tal zu Tal, bleibt mithin Göschenen die einzige Haltstation.
Noch ein Weilchen Geduld oder Ungeduld – es kommt auf dasselbe heraus, die Ungeduldigen langen nicht früher an als die Geduldigen – und wir sind in Bellinzona.
Bellinzona hat zwei Gesichter, ein verdrießliches gegen Norden, ein fröhliches nach Süden. Von Norden gleicht es einer Hauptstadt für Steinböcke, kahl geschorene Trümmer in einer öden Felsenwüste. Von Süden lächeln uns leckere Gärtchen entgegen, winzig, aber erlesen, Kleinodien. Ja, was sehe ich? Gleich bei der Station steht ja schon eine Zypresse!
Dieses entzückende Ausrufungszeichen des Südens versetzt uns mit einem Schlage in eine andere Welt und in eine neue Stimmung. Das ist nicht mehr Gotthardgebiet. Gletscher und Alpen liegen plötzlich weit, weit hinter unserm gegenwärtigen Empfinden, überwunden, verschmäht und vergessen. Dagegen meldet sich jetzt ein wahrer Heißhunger nach der Ankunft an den wundersamen Seen, wo unter dem Schutze des ewigen Schnees die Gärten von Sizilien träumen. Bellinzona ist ein Gruß und die dahinter schimmernde himmelblaue Lücke des Lago Maggiore eine unwiderstehliche Einladung. Wer beides herübersendet, das ist Italien, von welchem uns kein Naturhindernis mehr trennt.
So beiläufig eine Stadt wie Bellinzona zu beschreiben oder gar noch die Hauptzüge ihrer Geschichte zu entwerfen, wird mir wohl niemand zumuten. Ich schweige daher über dieses Thema, nicht weil wenig, sondern weil allzuviel darüber zu sagen wäre. Ich liebe Bellinzona und fahre öfters zu meinem Vergnügen dahin. Denn das will ich doch bei dieser Gelegenheit deutlich aussprechen: Der Ort, nach welchem der Reisende nach der Gotthardtunnel-Ausfahrt so gierig späht, der Ort, an welchem zum erstenmal italienische Vegetation in bemerkenswerter Fülle sich zeigt, ist Bellinzona, mit Gärten, welche trotz ihrer Kleinheit auf Schritt und Tritt unser Staunen, unsere Bewunderung und unsern Neid erregen. Im übrigen, für die Geschichte und Altertümer, verweise ich auf Rahn.
Das ästhetische Übergewicht der nördlichen Gotthardbahnstrecke über die südliche wird, so viel ich weiß, von niemand bestritten.
Wer daher bei beschränkter Zeit die Gotthardfahrt als einen bloßen Abstecher ausführt, von Luzern nach Göschenen hin und zurück, der dürfte sich ruhig damit trösten, die Hauptsache gesehen zu haben, wenn – ja wenn eben der Gotthard kein Paß wäre, mit andern Worten, wenn nicht das Aufsuchen der Gegenseite mit zur Hauptsache gehörte, wenn es einen in Göschenen nicht mit tausend Armen hinüberzöge, wenn es einen nachher nicht ewig wurmte, nicht wenigstens ein Minütchen selbst versucht zu haben, wie der Süden riecht. Ob es einer auch noch so fest glaube oder noch so oft selbst erfahren habe, daß drüben nicht das zu finden ist, was die Phantasie verspricht, es nützt nichts. Denn die Phantasie folgt ihren eigenen Trieben und Gesetzen, die mächtiger sind als die Einreden des Verstandes. Eines der Phantasiegesetze aber gebietet: Vor einem Berge mußt du hinauf und vor einem Passe hinüber. Kurz, zu einer richtigen Gotthardfahrt gehört die Leventina mit, des Gleichgewichtes, der seelischen Proportion wegen.
Flucht vor Kälte und Nebel
Die wunderbare Kürze der Frist, in welcher die Schnellzüge von einem Fuße des Gotthard zum andern fördern – ungefähr drei Stunden –, weckt liebliche Gedanken. Wie wäre es zum Beispiel, an einem unwirschen, trüben, frostigen Tage rasch durch den Tunnel in den warmen Sonnenschein zu flüchten?
Der Gedanke ist so verlockend, leuchtet auch so unmittelbar ein, daß man versucht wird, ihm gerade deshalb zu mißtrauen. Sind es doch die schönsten Gedanken, welche sich am seltensten verwirklichen wollen!
Wir wollen uns indessen nicht von unbestimmten Empfindungen leiten lassen, weder von der Hoffnung noch von der Furcht vor Enttäuschung, sondern die Frage nüchtern untersuchen, prüfend und unterscheidend.
Nahezu sicher werden wir, zu welcher Zeit des Jahres wir auch die Fahrt unternehmen mögen, jenseits einige Grad Wärme mehr treffen. Selbst in jenen Ausnahmewintern, wo die Welt verkehrt, wo Norden mit Süden vertauscht scheint, kehrt sich das Verhältnis bald wieder zurecht. Regel ist, daß schon bei Faido ein Wärmeunterschied gegenüber der Nordseite deutlich gespürt wird und daß uns bei Biasca entweder schwüle, dumpfe Brutluft oder Sonnenhitze empfängt.
Wenn daher des Menschen Wohlbefinden vom Thermometer abhinge, wenn sein Behagen mit jedem halben Grad Wärme wüchse, wie das teilweise bei den Pflanzen der Fall ist, so wäre die Nutzanwendung klar und einfach. Da das jedoch nicht zutrifft, da uns grelle Hitze belästigt, schwüle Luft reizt, da wir ferner unter Umständen bei zwei Grad Kälte mehr frieren als bei sechs Grad Kälte – nämlich dann, wenn die zwei Grad Kälte mit feuchter Luft einhergehen –, so gilt es, vorsichtig die Jahreszeit zu erwägen, damit man sich nicht mit seinem Reischen verrechne.
Im Hochsommer ist selbstverständlich die vermehrte Wärme ein fraglicher Vorzug. Die Hitze in den Eisenbahnwagen wird mit dem Moment, da wir die Tiefe, also Biasca, erreicht haben, höllisch, die Blendung weiter unten im offenen Lande teuflisch. Dagegen haben des Sommers die italienischen Städte trotz der Hitze für manchen einen großen Reiz, nämlich malerischen Reiz; dem oder jenem bekommt sogar ein italienisches Luftschwitzbad körperlich gut. Also so unbedingt verwerfen möchte ich eine Sommerfahrt nach dem Süden nicht.
Was ich vielmehr unbedingt widerrate, ist eine Winterfahrt. Zwar nicht eine Winterfahrt nach Göschenen oder Airolo – im Gegenteil, die befürworte ich von Herzen –, auch nicht einen dauernden Winteraufenthalt an den südlichen Luftkurorten – hierüber steht mir kein Urteil zu –, dagegen den flüchtigen Besuch Italiens im Winter. Frieren in den schlecht geheizten oder gänzlich ungeheizten Eisenbahnen, frieren in den Häusern, frieren auf der Straße – das ist fürs Vergnügen. Für die Gesundheit aber sind drüben während des Winters Krankheiten so wohlfeil wie hüben. Seit ich häufiger italienische Zeitungen lese, mit den Gesundheitsbulletins aus den verschiedensten Städten, komme ich zu dem Schlusse: Der italienische Winter ist tückisch. Überhaupt, im Winter hustet der Mensch am besten zu Hause.
Ja, wenn es sich bewahrheiten sollte, daß Locarno das Privilegium genösse, vor Influenza sicher zu sein, wie die Inserate behaupten! Die Sache scheint mir einer gründlichen Untersuchung und im bejahenden Falle der öffentlichen Bestätigung durch medizinische Autoritäten wert. Denn ein Influenza-Asyl hätte wahrlich keinen geringeren Anspruch auf Beachtung und Begünstigung des Menschenfreundes als ein Lungensanatorium.
Die Jahreszeit, in welcher der Wärmegewinn für ein Reischen nach dem Süden wirklich Vorteil bringt, ist der Spätherbst, Oktober und November, wo meistens die Temperaturerhöhung zugleich durch Sonnenschein verschönt wird, und das Frühjahr: März, besser noch April und Mai. Vollends in schlechten, zu winterlichen Rückschlägen geneigten Frühlingen ist die Wärmedifferenz, überhaupt der Witterungsunterschied zwischen den Ländern nördlich der Alpen und den italienischen Seen ganz unermeßlich, kaum hoch genug anzuschlagen. Da erfährt man geradezu märchenhafte Wunder der Überraschung. Wochenlang kann es in der Nordschweiz im März oder April schneien, während in Locarno, Lugano und Como zur nämlichen Zeit sommerliche Temperatur mit Sonnenschein, Blütenduft und Grillengezirp waltet. Das ist der richtige Augenblick; den benütze, wem es erlaubt ist. Um zehn Uhr vormittags aus dem Winter von Luzern fort, um vier Uhr nachmittags im Sommer von Locarno, welch eine herrliche Möglichkeit!
Von Nebel befreien wir uns mit größter Wahrscheinlichkeit durch eine Fahrt ins Tessin. Nebeltage sind dort selten, und zwar um so seltener, je näher dem Gotthard, um so häufiger und dichter, je näher Mailand. Airolo darf geradezu für nebelfrei gelten. Mögen in Göschenen die Nebel so dick liegen, daß man seine eigene Hand nicht sieht, in Airolo werden wir schwerlich die leiseste Spur davon bemerken. Höchstens daß um die Berge der untern Leventina duftige Wolken schweben. Es regne denn. Nämlich, wenn es regnet, so ist das Regenwetter jenseits genau so trüb und trostlos wie diesseits.
Es regnet aber nicht selten im Tessin, weshalb die Hoffnung, aus nordischem Regen in südlichen Sonnenschein zu geraten, uns öfters verrät. Welchem Reisenden wäre es nicht schon begegnet, in Airolo statt des erwarteten italienischen Himmels Schneegestöber, in Lugano eine Sündflut zu treffen? Wohl bildet ja der Gotthard eine Wetterscheide, wenn auch keine vollkommene (denn der Monte Ceneri kommt ebenfalls in Betracht), so daß mit großer Wahrscheinlichkeit das Wetter jenseits anders sein wird als diesseits; doch anders ist nicht immer besser; man kann auch aus dem Regen in die Traufe reisen. Wohl sind ferner die Sonnentage im Süden zahlreicher als im Norden, allein das schützt im Einzelfalle nicht vor unliebsamen Überraschungen. Wer ein richtiger Pechvogel ist, der weiß die südlichen Regentage schon herauszufinden.
Glücklicherweise gibt es ein Mittel, sich vor tückischen Überraschungen zu schützen: den Telegraphen. Dort am Bahnhof von Luzern steht täglich, auf Grund von Telegrammen, das Wetter sämtlicher maßgebenden Gotthardstationen verzeichnet. Lugano, Locarno, Bellinzona, Airolo, Göschenen, Erstfeld schicken jeden Morgen früh Witterungsdepeschen nach Luzern. Darnach richte man sich, und zwar gläubig, mit blindem Vertrauen, ohne es besser wissen zu wollen. Mag auch über Luzern sich ein fleckenloser blauer Himmel wölben – lautet das Bulletin: ‹Bellinzona trüb, Lugano regnerisch›, so schiebe man seine Reise auf, denn in ein verregnetes Tessin zu fahren ist kein Vergnügen. Heißt es dagegen: ‹Bellinzona schön, Lugano schön, Airolo hell›, dann mache man sich unbedenklich auf, ob auch in Luzern der Regen in Strömen heruntergieße. Vielmehr ist eine derartige Konstellation ein Grund zur Abreise mehr. Denn Göschenen bei Regen zu verlassen, um bei Airolo plötzlich in ein warmes, strahlendes Sonnenmeer hineinzufahren, das gehört zu den überwältigendsten Glücksüberraschungen, die dem Menschen beschieden sind. Die Passagiere schreien vor Seligkeit geradezu auf. Ein Nebelmeer, in horizontale Projektion übertragen; nur daß der Gegensatz noch unvermittelter, die Spannung noch nervöser ist. Denn die lange Fahrt durch den nächtlichen Tunnel, verbunden mit der Ungewißheit, was uns drüben beschert werden wird, erzeugt etwas wie die Weihnachtsbangigkeit der Kinder, die sich beim Anblick des funkelnden Lichtglanzes in Jubel löst.
Licht und Farben
Mit der berühmten italienischen Beleuchtung hat es seine volle Richtigkeit. Auch die Hoffnung, sofort jenseits des Gotthardtunnels die ersten Proben davon zu erhalten, ist keineswegs eitel, ob sie schon öfters durch zufällige Ungunst der Witterung zunichte wird. Nur darf man nichts übertreiben. Es ist lächerlich, an einem schmutzigen Regentage beim Anblick des Luganersees in den Jubel auszubrechen: «Welche Tinten, welche Töne!» Wenn dagegen anderseits der Italiener über uns Nordländer spottet, die bereits in dem sibirischen Airolo italienische Farben zu erblicken vermeinen, so hat diesmal er Unrecht. Denn sie sind wirklich da. Ohne Zweifel sind es noch nicht die Farben von Florenz und Venedig, aber es sind schon nicht mehr die Farben des Nordens. Jenen rosigen, goldenen, purpurnen, violetten Hauch, der schon das oberste Plateau der Leventina umspielt, haben wir diesseits der Alpen einfach nicht oder doch wenigstens nur andeutungsweise. Am ehesten noch in der Westschweiz, vom Genfersee bis zum Bielersee. Etwas Verwandtes bringt vorübergehend auch der Föhn mit seinen Glutfarben hervor, namentlich am Vierwaldstättersee. Indessen hat eine Föhnlandschaft bei aller Farbenpracht doch einen andern Charakter, etwas Schwüles, Unheimliches, ich möchte fast sagen Ungesundes. Jedermann empfindet sofort die farbenstrotzenden Gemälde des Föhns als ‹unnatürliche›. Auch besteht neben manchen Ähnlichkeiten ein Gegensatz zwischen einer Föhnlandschaft und einer südlichen Landschaft. Der Föhn rückt nämlich die Ferne näher, zeichnet die Umrisse schärfer und verzehrt den sichtbaren Luftdunst, während umgekehrt italienischer Sonnenschein einen trockenen, merklichen Hauch selbst um die nahen Gegenstände verbreitet, mithin das Bild in die Ferne schiebend, die Luftperspektive vertiefend, die Linien mildernd. Mit einem Wort: Der Föhn schafft Stereoskopenbilder, Italien Gemälde.
Wer die italienischen Farben der Leventina bestreitet, der stelle sich einmal an einem schönen Spätnachmittage auf die Brennobrücke bei Biasca. Die kaleidoskopischen Farbenspiele, die sich dort abwickeln, werden ihn gründlich bekehren.
Einen unbestrittenen Triumph feiert der südliche Himmel bekanntlich an den italienischen Seen. Hier trägt eben gar manches zu der entzückenden Gesamtwirkung bei: die südliche Breite, die Tiefenlage, der üppige Ufersaum, das Gebirge und vielleicht noch mehr die Gebirgslücken, endlich und hauptsächlich der Wasserspiegel. Welcher der drei Seen nun die schönsten Farbenspiele erzeuge, diese Frage sich zu stellen und zu beantworten, ist eine der genußreichsten Aufgaben für jeden einzelnen, wobei es wenig darauf ankommt, wie er sie entscheide. Denn die Tätigkeit der Vergleichung an sich fördert den Genuß, weil Vergleichung die Beobachtung schärft. Ein köstliches Lichtbild des Südens wird von manchem in der Eile der Reise übersehen. Ich meine die Gletscherreihe, aus südlicher Ferne geschaut. Das ist etwas ganz Neues, Eigenes. Zwar in der Zeichnung an das Gletscherpanorama erinnernd, welches der Standpunkt des schweizerischen Jura zeigt, allein in Färbung und Beleuchtung völlig anders. Die Hochalpen erscheinen, von Süden gesehen, duftiger, der Sockel beraubt, den düstern Vorbergen enthoben, gleichsam aus der Luft wachsend und im blauen Himmel schwebend. Dadurch wird das Alpenpanorama freundlicher, minder überwältigend, aber dafür beseligender. Der König der Gletscher, von Süden betrachtet, ist der Monte Rosa, der seinen Namen mit Recht trägt; denn die Morgensonne bestreut ihn mit Rosen, die Abendsonne mit Gold. Derjenige südliche Stand, welcher die Gletscher am klarsten zeigt, ist die Linie von Mailand bis Turin, zum Beispiel Novara; doch übertrifft wohl zu diesem Zweck Varese, wo der Monte Rosa in die Straßen der Stadt hineinleuchtet, jede andere Stelle und die Landstraße von Varese nach Laveno jede andere Strecke.
Der Fortschritt der Vegetation jenseits des Gotthard
Mag einer sich zu Hause einen Deut um Botanik kümmern, jenseits des Gotthard späht er doch eifrig nach der Vegetation. Es ist eben eine Fahrt nach dem Süden. Den Süden aber liest man am leichtesten an den Pflanzen ab, abgesehen davon, daß der Adel der Pflanzen mit jedem Schritt zunimmt, den wir in der Richtung nach dem Äquator zurücklegen, was ich vom Menschengeschlecht nicht behaupten möchte.
Kamelien, Zypressen, Orangen, Zitronen – die Phantasie ist ja freigebig –, das gaukelt einem nur so im Herzen herum, sobald man den Gotthardtunnel hinter sich hat. Was kommt zuerst? Es ist eine eigentliche Gier, durch den geographischen Süden geweckt, ähnlich wie ja auch der Durst mächtig wächst, sobald wir Wasser in der Nähe wissen.
So eilig hat es freilich die Natur nicht. Erst unten in der Ebene, am Seegestade, werden wir das Inventar des Südens aufstellen können. Immerhin finden sich schon unterwegs längs der Talsohle der öden Leventina mancherlei Andeutungen, und da wir auf steiler Bahn zu Tal fahren, durchlaufen wir in kürzester Zeit die verschiedensten Pflanzenklimate. Es ist mithin ein wirklicher Fortschritt, systematisch, als wollte uns die Natur Botanik dozieren, übrigens ein angenehmer Fortschritt, weil er aus der Armut in den Reichtum führt.
Ich habe mich so wenig wie ein anderer der Verlockung des Beobachtens entzogen. Im Gegenteil, ich ließ mich Zeit und Mühe nicht reuen, einmal ein besonderes Fußreischen von Airolo nach Bellinzona eigens zu dem Zwecke auszuführen, um Schritt für Schritt das erstmalige Auftreten derjenigen Pflanzen zu notieren, welche das jeweilige Vegetationsklima am auffälligsten charakterisieren.
Ich teile hier das Ergebnis meiner Beobachtungen in Kürze mit:
In Airolo, auf 1170 Meter Höhe über dem Meer, steht im Gärtchen des Gasthofs zur Post eine junge Himalajazeder (Cedrus Deodara), die prächtig gedeiht. Die Himalajazeder kommt in Basel und Bern nicht fort, in der Ostschweiz vereinzelt, am Vierwaldstättersee vorzüglich und in Menge. Das Gedeihen derselben hoch oben in Airolo erkläre ich mir aus der ungemein kräftigen Besonnung während des Sommers und aus der Abwesenheit der Wintersonne. Da Airolo im Winter über zwanzig Grad Réaumur Kälte hat, da ferner der Winter dort vom Oktober bis in den Mai dauert, ist der Beweis geliefert, daß es weder die übermäßige Strenge des Frostes noch die übermäßige Dauer der kalten Jahreszeit sein kann, was ihr Fortkommen im Norden verhindert. Es muß vielmehr der nicht hinreichenden Sonnenbestrahlung zur Sommerszeit die Schuld gegeben werden. Hiemit stimmt die Beobachtung, daß die Föhnregionen der deutschen Schweiz, also vor allem der Vierwaldstättersee, die Deodarazeder besitzen. Nämlich Föhnklima bewirkt kräftigere Besonnung. Im übrigen ist Airolo und Umgebung wegen der Sommerflora bemerkenswert. Über der Festung Airolo (Fondo del Bosco) weiße Alpenrosen.
Mit Piotta (rund 1000 Meter) beginnen wieder die Kirschbäume und Roßkastanien. In dem Dörfchen Varenzo (990 Meter) glaube ich, aus der Ferne, die erste Edelkastanie entdeckt zu haben, die zweite am Eingange des Dazio Grande. Die Tiefen des Dazio Grande zeigen schon zahlreiche Edelkastanien, obschon noch zerstreut und vereinzelt. Faido hat zum erstenmal die Edelkastanie in großen Hainen versammelt, die fortan unfehlbar jede Schutthalde der Leventina bekleiden. Außerdem taucht mit Faido zuerst der Maulbeerbaum auf. Bei Lavorgo nimmt der Tannenwald ein Ende.
In der zweiten Hälfte der Biaschina, ein halbes Stündchen vor Giornico, auf dem linkseitigen Berghang, tritt plötzlich der Weinstock auf, und zwar sofort in beträchtlicher Menge. Wie eine Schwadron Husaren, flankiert von Offizieren und Trompetern, steigt das erste Korps von Weinstöcken den Berg hinunter. Giornico hat üppige Obstkultur, darunter Feigen; außerdem Weinreben in großer Zahl. Zwischen Giornico und Biasca begleiten den Wanderer die Maulbeerbäume in ununterbrochenen, doch dünnen Alleen. Biasca ist ein Giornico um eine Nummer südlicher, doch nicht wesentlich anders. Ebenfalls vorherrschend Wein; die Feigen zahlreicher und stattlicher. In der Riviera (so heißt die Ebene zwischen Biasca und Bellinzona) tritt ein scheinbarer Rückschlag ein, weil das Pappel- und Weidenunkraut der flachen Flußufer das Vegetationsbild beherrscht. Zum Eindruck des Südens gehört eben nicht bloß das Erscheinen der Südpflanzen, sondern mindestens ebensosehr das Verschwinden der nordischen. Das ist es ja, was den Eindruck des Rhonetales zwischen Lyon und Avignon beeinträchtigt, trotz der Zypressen: die Pappelwüsteneien.
Bellinzona gehört hinsichtlich der Pflanzen entschieden schon zu Italien, was von der Leventina ebenso entschieden verneint werden muß. Das Verhältnis Bellinzonas zu der Leventina lautet: Die Leventina hat beinahe nichts, Bellinzona beinahe alles. Das Verhältnis zur Nordschweiz: Selbst die geschütztesten Örtlichkeiten des Genfersees und des Vierwaldstättersees werden von Bellinzona bedeutend übertroffen.
Nennen wir die wichtigsten Nummern des Garteninventars von Bellinzona.
Gleich in der Bahnhofhalle erblicken wir einen Evonymushag. Der Evonymus, den eine Ortschaft entweder gar nicht oder dann massenhaft zu haben pflegt, den derjenige verachtet, welcher ihn besitzt, derjenige dagegen aufs schmerzlichste vermißt, welchem er durch das Klima verwehrt wird, ist in Bellinzona gemein. Nun hat ihn ja auch Paris und die französische Schweiz vom Genfersee bis zum Neuenburgersee, immerhin nicht in dieser Fülle und Größe. Unsern trauten Taxus hibernica (fastigiata) und den Podocarpus entdecken wir in Bellinzona wie neue Pflanzen, da sie hier in riesenhafter Größe und Breite auftreten, mächtige samtschwarze Pflanzenmauern bildend. Zedern aller Arten, vornehmlich die Deodarazeder, sind in Bellinzona an jedem beliebigen Standpunkt zu finden. Auch das ärmste Gärtchen hat eine Zeder, wie bei uns eine Thuja. Die feine, zierliche Cryptomeria japonica (Lobbi), die wir schon in Luzern an geschützter Lage vereinzelt und etwas verkümmert antreffen, erreicht in Bellinzona ihre volle schöne Ausbildung. Ebenso selbstverständlich die härtere Cryptomeria elegans, die indessen, wenn ich recht beobachtet habe, in Bellinzona nicht so beliebt ist wie in Luzern. Wenn Araucaria imbricata in Bellinzona seltener ist als jenseits der Alpen, so beruht das einzig auf dem Umstand, daß die edlere Gartenkunst in Bellinzona jungen Datums ist. Wo wir dort ausnahmsweise eine Araucaria sehen, gedeiht sie vorzüglich. Beiläufig möchte ich doch mitteilen, was wenige wissen, daß dieser effektvolle Baum in Luzern in mehreren gewaltigen Exemplaren vorhanden ist. Den Lorbeer hat Bellinzona in allen Arten, ebenso die wunderbare Magnolia grandiflora, den Stolz von Pallanza und Locarno, und die duftende japanische Mispel. Chamaerops excelsa wird im Freien überwintert und erreicht eine Höhe von vier bis fünf Metern. Am Genfersee kommt die japanische Mispel kümmerlich, Chamaerops gar nicht fort. Die feinsten Teerosen brauchen in Bellinzona über den Winter nicht geschützt zu werden, wie übrigens auch nicht am Neuenburgersee. Unter uns gesagt: Man schützt sie meistens doch. Wie ich denn überhaupt an das Nichtschützen zarter Pflanzen im Winter überall nur in dem Maße glaube, als ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Meine Kleingläubigkeit beruht aber nicht etwa auf einer unrespektierlichen Meinung vom Menschengeschlecht, sondern auf dem überraschenden Anblick von allerlei Häuschen und Deckelchen, Strohwischen, Laubbettchen und Bindfäden, der mir neulich zuteil wurde, als ich Bellinzona und Lugano zufällig einmal im Dezember besuchte.
Nun noch das Beste zu guter Letzt: In Villa Farinelli vor Bellinzona gibt es eine beneidenswerte Gruppe von hochgewachsenen Kamelienbäumen; in Villa Gabuzzi beim Bahnhof eine Zypresse. Die Zypresse war früher in Bellinzona häufiger, ist auch nicht etwa ausgestorben, sondern wurde freventlich geschlachtet.
Die Gärten von Bellinzona sind klein und unansehnlich. Man muß sie aufspüren, um sie zu beachten, und muß sich besonders für Gartenbau interessieren, um sie zu würdigen.
Anders in dem nahen Locarno, wo der verschwenderische Reichtum südlicher Vegetation jedermann ohne Ausnahme überwältigt. Der Park des Grand Hôtel von Locarno darf das erste sensationelle Wunder des Südens genannt werden. Über die Vegetation von Locarno und der italienischen Seen zu schreiben, bedürfte es nicht bloß eines besondern Kapitels, sondern eines besondern Buches; auch besonderer Kenntnisse. In Wirklichkeit darin zu schwelgen, ist glücklicherweise auch uns Laien gestattet. Aber die Grenzen des Paradieses darf ich mir doch erlauben zu bezeichnen: im Norden ist es Bellinzona, im Süden Como. Sofort an der Südpforte von Como, gleich hinter Camerlata und dem Baradello, wird Temperatur und Vegetation frostiger, und das nimmt gegen Mailand hin beständig zu. Monza ist die Grenze der Zypresse, die in Mailand trotz allem Schmeicheln der Gärtner nicht mehr durchzubringen ist.
Ein altes Ziel in neuem Stil
Es ist noch nicht lange her, so erforderte der Besuch Italiens eine zeitraubende und kostspielige Reise, die dem Durchschnitt der Menschenkinder ein einziges Mal im Leben erblühte. Kein Wunder, daß männiglich auf seiner mutmaßlich einzigen Italienreise soviel einheimste, als nur irgend in den Rahmen hineinpaßte, meistens noch mehr, als hineinpaßte. Mit Handbüchern und Karten bewaffnet, bis an den Hals mit Vorstudien gestopft, antiquarischen, künstlerischen, topographischen, sprachlichen und was weiß ich noch, so machte man sich auf den Weg, bildungshungrig und museumsüchtig, um dann Stadt für Stadt, Kirchen, Kapellen und Campi santi, Denkmäler und Galerien abzuweiden, methodisch und hastig, gewissenshalber; ob auch Füße und Augen den Dienst versagten, ob Seele und Körper einhellig nach Ruhe lechzten. Das hieß man Genuß und nannte es Belehrung. Über den Genuß läßt sich nicht streiten, aber die Belehrung? Mit dieser sah es oft fraglich aus. «Wo war es doch? war es nicht in Rom? oder war es in Genua? nein, richtig, in Siena wars.» Rom, Genua, Siena, alles ein Cinquecento.
Ich rede in der Vergangenheitsform. Will jemand die gegenwärtige Zeit dafür setzen, so habe ich nichts einzuwenden. Nur muß er sich damit beeilen, denn dieser Stil der italienischen Reise ist dem Verschwinden geweiht, mag auch die Gewohnheit ihn noch ein oder zwei Jahrzehnte ausleben lassen.
Nachdem die Gotthardbahn Italien einer Mehrzahl und zwar der Mehrzahl öfters zugänglich gemacht, nachdem eine Italienreise nicht mehr eine Ausnahme im Leben bildet, nachdem der einzelne hoffen darf, ein späteres Mal nachzuholen, was er das erste Mal mußte liegen lassen, fällt das krampfhafte Abweiden Italiens von selbst dahin, allmählich, aber sicher.
Man wird in Zukunft nach Italien so reisen, wie man auch anderswohin reist, wie der Italiener nach Rom, wie der Schweizer nach Lugano, das Reiseziel beschränkend, das heißt dem jeweiligen Vorrat von Zeit und Kraft und Laune anpassend. Also ausflugsweise. Das ist keine Prophezeiung, sondern eine einfache Schlußfolgerung aus der Logik der neugeschaffenen Verkehrsmittel.
Was sagen Sie aber zu Blitzbesuchen mit den Blitzzügen? Zum Beispiel eine plötzliche Eingebung, heute abend in Genua das Meer rauschen zu hören? oder schnell nach Mailand über den Sonntag? «Parforcetouren.» Es kommt ganz auf Temperament und Gewohnheit an. Dem einen bringen drei Stunden Eisenbahnfahrt schon Migräne, ein anderer fährt Ihnen zweimal vierundzwanzig Stunden zur Erholung. Fragen Sie die Diplomaten und Commisvoyageurs. Und meistens sind es die nämlichen, die nach dreistündiger Bummelei einer Sekundärbahn nervös werden, dagegen mit Leichtigkeit die größten Entfernungen mittelst Blitzzügen zurücklegen.
Was für ein Gewinn oder Genuß dabei herauskomme? Nun, derselbe, wie wenn ich in weite Ferne eile, um einem Bruder die Hand zu schütteln oder um mit einem Freunde einen Abend zu verplaudern. Und schließlich, es gibt auch eine Reiselust, eine Bewegungstriebfeder, einen Mut, in kürzester Zeit Länder und Völker zu durchfliegen, eine Sehnsucht, wieder einmal einen Zitronenhain oder eine Magnolienallee mit eigenen Augen zu schauen – und wäre es auch nur für ein Stündchen –, ein Bedürfnis, die Sonne hinter den nämlichen Hügeln an demselben Punkte untergehen zu sehen, wo einst Raphael oder Cäsar.
Ferne Ziele zu treffen, jenseitige Gegenwart mit diesseitiger im Bewußtsein zu verknüpfen, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen, das ist zeitgemäße Kurzweil im Jahrhundert der Eisenbahnen.
Welches ist die günstigste Jahreszeit für eine Gotthardfahrt?
So ziemlich alle Jahreszeiten habe ich versucht und mich anfänglich bald für diese, bald für jene ausgesprochen, selbstverständlich immer mit jener Bestimmtheit, wie sie mangelhafter Erfahrung eigen ist. Schließlich mußte ich die Beobachtung machen, daß ich so ziemlich alle Monate des Jahres der Reihe nach als die lohnendsten empfohlen hatte, was meine Sicherheit einigermaßen dämpfte.
Das freilich halte ich noch immer fest, daß jene Jahreszeit, welche am meisten zu Gotthardreisen benützt wird, also der Hochsommer, für die Eisenbahnfahrt die ungünstigste ist. Ich sage, wohlverstanden, für die Eisenbahnfahrt, denn für Ausflüge zu Fuß und zu Wagen ist sie nicht bloß die beste, sondern sogar die einzige. Zunächst kommt des Sommers die Überfüllung der Züge durch Mitreisende in Betracht. Auch der wärmste Menschenfreund wird beim Anblick eines übervoll besetzten Wagens nicht an den Menschen ein Wohlgefallen finden. Übervoll ist eigentlich nicht das richtige Wort, denn so viele Menschen, so viele Plätze gibt es immer; und wollte jeder nur das beanspruchen, was ihm gebührt, so könnte uns die Vollzähligkeit gleichgültig lassen. Leider ist das nicht so. Vielmehr gehört Anmaßung von Raum, auf welchen einer keinen Anspruch hat, zu den alltäglichsten Vorkommnissen. Namentlich in der ersten Wagenklasse gelangt man selten ohne gereizten Wortwechsel zu seinem rechtmäßigen Platz. Wenn Sie es etwa noch nicht gewußt haben, daß Ungezogenheit ein Zeichen von guter Erziehung ist, so wissen Sie es jetzt. Das haben nun die Reisenden untereinander auszufechten, solange sie es für weise erachten, erst am Ende der Fahrt zu tun, was sie gleich anfangs tun könnten, nämlich sich leiden und vertragen.
Dagegen fast unzertrennlich von einer Sommerfahrt ist die Belästigung durch Hitze, Rauch und Luftmangel. Die Hitze kann unten gegen Bellinzona und in verstärktem Grade wieder zwischen Chiasso und Mailand bis zu unerträglicher Temperatur steigen; auch die Zufahrtslinien bis Brunnen leisten darin im Hochsommer recht Ansehnliches. Der Hitze lege ich auch die Unannehmlichkeiten zur Last, die man sonst dem Rauch und der Tunnelluft zuschreibt. Wenigstens verspüren wir in den kühlen Jahreszeiten weniger Unbehagen. Vielleicht bewirkt die niedrigere Temperatur vermöge der kräftigeren Gegensätze eine ergiebigere Lufterneuerung.
Es gibt eine Jahreszeit, welche alles verschönt und vergoldet: der Herbst. Das Licht läßt seine schönsten Farben spielen, und was eine Gegend nicht hat, das leiht es ihr; daher ist ohne Frage die Gotthardfahrt an einem klaren Herbsttage unbeschreiblich schön. Allein was wäre da nicht schön? Der Norden, zum Beispiel der Vierwaldstättersee, wohl noch schöner als der Süden.
Der Frühling gibt Vorzüge und Nachteile gemischt, und zwar so, daß er bald die eine, bald die andere Seite des Gotthard begünstigt. Im Vorfrühling treffen wir drüben Lenzeswonne, warme und weiche Luft, rosige Mandel- und Pfirsichblüte um die Dörfer, gelben Ginster an den Bergen, dagegen das diesseitige Tal noch verödet; auf beiden Seiten stehen dannzumal noch die Kastanien kahl, was bei der Häufigkeit der Kastanien im Bereiche der Bahnlinie keine kleine Einbuße bedeutet. Im Spätfrühling fahren wir umgekehrt diesseits durch einen wahren Garten von Blütenschnee, begegnen jedoch drüben dem einförmigen Gelb der jungen Blätter.
Erst im Vorsommer gleichen sich beide Hälften und sämtliche Höhenstufen zu einer stetigen Allee von entzückender Vegetation aus, weshalb ich einen strahlenden Junitag, wenn Kastanien- und Nußbäume in voller, frischer Rundung prangen, für ein sehr empfehlenswertes Datum erachte. Der Schnee, der dann noch die höheren Gipfel des Reußtales krönt, verstärkt durch sein Widerspiel den holden Reiz der üppigen Talsohle.
Vom Winter müssen wir die dunkeln Monate abrechnen, also November und Dezember, die im Kalender der Alpen wohl zu den Wintermonaten gezählt werden müssen; unbeschadet einzelner herrlicher Ausnahmstage, während welcher die Luft oben in milder Klarheit strahlt, indessen unten düstere Nebel herrschen. Abzuraten ist ferner die Reise bei Einfall von winterlichem Tauwetter, und zwar wegen der Lawinengefahr. Freilich geschieht ja zum Schutze der Bahnlinie, was nur immer denkbar ist; auch ist noch kein Unheil zu verzeichnen. Immerhin ist bei Tauwetter zur Winterszeit der Gotthard nicht ganz geheuer. Wir Schweizer reisen unter unheimlichen Umständen (Föhn oder Westwind nach reichlichem Schneefall) nur aus triftigen Gründen durch den Gotthard, das heißt, wenn es sein muß oder sein soll, und auch dann pflegen wir uns erst am Luzerner Bahnhof über die Schneeverhältnisse zu erkundigen. Der Fremde tue also. Hingegen ein bissiger, heller Frosttag, im Januar oder Februar, wenn man sich zu Hause an den Ofen hält, wenn Airolo sechzehn oder zwanzig Grad Réaumur unter Null telegraphiert, das ist ein lohnender Anlaß für eine Gotthardreise. Der Schnee vergrößert die Berge ins Riesenhafte und erhöht zugleich ihre Schönheit, indem er dazu paßt wie das Tüpfchen auf das i. Das in der Sonne blitzende Eis, die glitzernden Fensterscheiben, die blauschimmernden Wasserfälle, die weiten, fleckenreinen Schneeflächen erheitern mit ihrem Lichtglanz das ernste Reußtal. Und es ist etwas Neues, was einem da entgegenschaut, etwas, das den übrigen Gotthardfahrten nicht gleicht. Als Glanzpunkte der Winterfahrt sind zu nennen: Der Pilatus, an dessen Schneetreppen die Morgensonne wie auf silbernen Stufen emporsteigt; der Rigi, der, von Luzern und Küßnacht betrachtet, mit fröhlichen Schneebändern umgürtet, glänzende Duftschleier atmet, von Goldau gesehen, über den dichten Bergschatten eine leuchtende Verdopplung der Kanten zeigt, hinter welchen die Sonne funkelt, sprühende Sterne zündend; der See bei Brunnen, in Bronzefarbe mit Moirézeichnungen spielend unter dem blauen Himmel; die begnadeten Matten von Intschi, welche wie ein Brennspiegel allen Sonnenschein sammeln, während das Reußtal und die übrige Höhe in kaltem Schatten liegen, eine wahre Sonneninsel; endlich Airolo mit seinem gigantischen, fleckenlosen Schneemantel.
Eine Winterfahrt weiter als Airolo auszudehnen, lohnt sich kaum; denn die Leventina ist im Winter geradezu trostlos; besonders der untere Teil, wo sogar die Tannen fehlen; nichts als Schnee und Stein.
Übrigens kommt es nicht allein auf die Jahreszeit an. Wasserüberfluß oder Wassermangel zum Beispiel machen einen ganz gewaltigen Unterschied, was sich übrigens bei den unzähligen Bächen, Schnellen und Fällen der Gotthardtäler voraussetzen läßt. Daneben mancherlei Einflüsse der Temperatur, der Beleuchtung, der Stimmung, die sich nicht fassen und sagen lassen, die aber gleichwohl über unsere Empfindungen entscheiden. Heute reisen Sie durch ein Meer von Schönheit, unter beständigem Entzücken, ohne die mindeste Ermüdung. Morgen, unter anscheinend den nämlichen Witterungsumständen, will nichts klecken. Die Farben wollen nicht malen, die Luft will nicht erquicken, die Nerven sind gereizt, man leidet in der ersten Stunde schon an Kopfschmerz. Wohl erkennt man den Wert des Geschauten, aber die volle Freude darüber will sich nicht einstellen. Da muß man eben Glück haben; wens trifft, der triffts.
Einige Ortsnamen
Wer einen Ortsnamen zum erstenmal vernimmt, sucht unwillkürlich seine Bedeutung zu erraten, in der richtigen Annahme, daß alle Namen ursprünglich etwas sagen wollten. Mitunter ist die Bedeutung eines Namens unmittelbar verständlich (zum Beispiel bei den Namen ‹Altdorf› und ‹Flüelen›), in den meisten Fällen hingegen verschleiert, so daß die Sprachgelehrsamkeit zu Hülfe kommen muß, um ihn zu enträtseln (zum Beispiel ‹Göschenen›, ‹Schöllenen›, ‹Intschi›); in einigen Fällen irreleitend, weil nachträglich entstellt und umgedeutet (zum Beispiel Schwanau statt Schwandau, Riemenstalden statt Reimarstalden, Realp statt Rialp oder Rivalp, Hellprächtig statt Heilprecht oder Hilprecht).
Das Wichtigste und Erste wird immer sein, die Sprache festzustellen, welcher ein Name ursprünglich angehört. Denn solange das nicht feststeht, bleibt den absonderlichsten Irrtümern die Tür geöffnet. Hier nun pflegt es der Laie in der Weise zu versehen, daß er die Erklärung zeitlich zu nahe, in der lebendigen Umgangssprache sucht; Ortsnamen sind aber durchschnittlich unendlich viel älter, als man gewöhnlich meint. Umgekehrt läßt sich der Gelehrte leicht verleiten, die entlegenste Deutung der naheliegendsten vorzuziehen. Liegt doch eine Abhandlung vor mir, welche den Namen Altdorf aus dem Keltischen herleiten möchte!
Mit den keltischen und rätischen Gelehrten ist überhaupt am mühsamsten zu reden, weil wir hier ihnen niemals das Gegenteil zu beweisen vermögen. Oder können Sie vielleicht rätisch?
Für die Deutung der Ortsnamen im nördlichen Gotthardgebiet nun kommen hauptsächlich zwei Sprachen in Betracht. In erster Linie die deutsche und zwar die alemannisch deutsche, in zweiter Linie die römische oder meinetwegen die ‹romanische›. Es wird sich allerdings nicht leugnen lassen, daß auch die keltische Sprache im Hintergrunde spukt (das Wort ‹Alp› und der frühere Name des Pilatus ‹Fracmont› sind wahrscheinlich keltischen Ursprungs), doch sind die keltischen Gespenster schwer, sehr schwer zu greifen. Lassen wir sie daher im Frieden.
Auch die römischen Namen am Vierwaldstättersee erregen zunächst Befremden, da uns die Geschichte nichts von einem römisch sprechenden Volke in dieser Gegend berichtet. Doch befremdend oder nicht, die römischen Namen sind einmal da, und Namen sind selber historische Dokumente und zwar die zuverlässigsten von allen.
Hier nach der Erklärung Oechslis, eines nüchternen und verständig abwägenden Historikers, einige Proben:
Romanische Namen: ‹Schöllenen› von scaliones, Felsstufen. ‹Göschenen› von cascina (casa), Melkhaus. ‹Gurtnellen› von curtinella oder cortinella, kleiner Hof. ‹Intschi›, 1291 Untschinon, von uncia, parzelliertes Land, und so weiter.
Alemannische Namen: ‹Arth› (am Zugersee) von aren, pflügen. ‹Goldau› von Au und Goleten (Goleten will sagen Schutthalde). Da der Name Goldau alt ist, so beweist er, daß schon in alten Zeiten der Roßberg nicht gut tat. Diese Tatsache wird auch durch den alten Namen des benachbarten ‹Steinen› bestätigt. ‹Ibach› und ‹Iberg›; I dialektisch für Au, gleich Bachwiese. ‹Morschach› von Moor und Schachen. Schachen heißt Wald, genauer gesagt Waldgestrüpp auf ehemaligem Wassergebiet. ‹Ingenbohl› von dem Männernamen Ingobald. ‹Sisikon›, 1173 Sysinchon, Hof des Siso. ‹Erstfeld›, 1258 Orzcveld, von arzon, pflügen. ‹Wassen› von wasan, schneiden; also schneidige Gegend. ‹Rütli› von Rüti oder Rüte, das will sagen, eine kleine Strecke ausgerodeten Landes. Die Endung ‹ingen› will jedesmal die Abkunft, die Nachkommenschaft aussagen. Also zum Beispiel ‹Spiringen›: Hof der Nachkommen des Spiro. ‹Meitschlingen›: Hof der Nachkommen des Magili. ‹Attinghausen›: Haus der Nachkommen des Atto.
Leider sind es gerade die berühmtesten Namen, welche sich gegen die Deutung am sprödesten erweisen, die Namen Schwyz, Uri, Ursern, Mythen, Muota. Nicht als ob gelehrte Erklärungsversuche mangelten; im Gegenteil, es gibt deren nur zu viele und zu verschiedene. Allein keiner befriedigt. Auch der Name Gotthard, falls er nicht von der Kapelle des heiligen Gotthard stammen sollte, was ich als das Wahrscheinlichste annehme, wäre unerklärt und wohl auch unerklärlich. Der Name Reuß wiederum ist nur allzu leicht zu erklären. Nämlich da die Silbe ‹rhe› in der Bedeutung von fließen so ziemlich allen Sprachen gehört (sie stammt aus einer Zeit, da wir noch mit den Persern unter einem Zelt wohnten – Sie erinnern sich doch? mir ist, als wäre es heute gewesen) so hält es schwer, das einzelne Volk zu bestimmen, welches der Reuß den Namen gab.
Aus alledem ergeben sich unterhaltende Geduldspiele für artige Philologen in der Sommerfrische bei Regenwetter. Erste Aufgabe: Woher stammen die Namen Schwyz, Uri, Ursern, Muota und Mythen? Zweite Aufgabe: Welches Volk hat dreien der vier lepontischen Flüsse das R oder Rh am Anfange des Wortes geschenkt: Rhein, Rhone, Reuß? Dritte Aufgabe: Da es wahrscheinlich ist, daß das nämliche Volk dem vierten Flusse, dem Tessin, ebenfalls das R wird gegönnt haben, wie hieß der Tessinfluß ursprünglich, damals, als er mit R anfing?
Hinsichtlich der Schreibart wäre, wenn wir genau schreiben wollen, die Orthographie Küßnach statt Küßnacht, ferner Miten und Spiringen statt Mythen und Spyringen vorzuziehen. y und th für i und t rührt bloß von Gelehrttuerei her. Es gab eine Zeit, wo man es für vornehm hielt, alle i in y zu verwandeln. Damals schrieb man ‹frey› für ‹frei› und ‹er sey› für ‹er sei›.
Der Dialekt sollte bei der Orthographie nicht außer acht gelassen werden. Der Urner spricht das u wie ü und das ü wie i, zum Beispiel statt Uri Üri oder gar Iri. Wenn er daher Intschi sagt, so meint er Üntschi oder gar Untschi. Wir müßten daher entweder Üri und Intschi oder Uri und Üntschi oder Untschi schreiben, nicht aber Uri und Intschi.
Das Geschlecht des Berges Rigi ist streitig. Der Urschweizer sagt allerdings ‹die› Rigi, meint aber damit eine Mehrheitsform: ‹die Riginen› (Streifen oder Stufen). Da jedoch einmal die Welt ‹der Rigi› sagt und Brauch in der Sprache Rechtskraft besitzt, da ferner in der Anwendung, ich meine bei der Verbindung im Satz, bei der Deklination der weibliche Artikel weniger sinnverständlich wird als der männliche, da schließlich durch das Hinzudenken des Wortes ‹Berg›, also ‹der Rigiberg›, jedes Gewissensbangen beseitigt wird, so sehe ich nicht ein, warum wir unsere gute alte, bequeme Gewohnheit ‹der Rigi› mühsam umlernen sollten.
Zum Schlusse noch einige Verdeutschungen tessinischer Namen, wie sie zur Zeit der Urner Herrschaft im Tessin im Schwange waren und teilweise noch heute etwa gehört werden:
Airolo hieß auf deutsch ‹Euriels› oder ‹Eriels› oder ‹Ergiels›. Faido: ‹Pfaid›. Giornico: ‹Irnis›. Biasca: ‹Ablentsch›. Das Bleniotal: ‹Polenzertal›. Bellinzona: ‹Bellenz›. Der Monte Ceneri: ‹Montkennel›. Lugano: ‹Lauis›. Locarno: ‹Luggaris› oder ‹Luggarus›'. Das Tremolatal: ‹Trümmelital›. Im letzten Beispiel wird der deutsche Name der ursprüngliche gewesen sein und der italienische bloß eine mißverstandene Übersetzung, wie heutzutage Fiorita für Flüelen. Denn ‹Tremola›, Tal des Schreckens, – so sentimental pflegt das Volk eine Gegend nicht zu taufen. Dagegen ‹Trümmelen›, wenn ein Bach in einem Felskessel trommelt, das ist echt.
Leventina (deutsch Livinen) hat nichts mit Levante (Sonnenaufgang, Osten) zu tun, sondern ist eine Verstümmelung des alten lateinischen Namens ‹Lepontische Alpen› für das Gotthardmassiv. Leventina will mithin sagen: das Tal, welches sich gegen den Gotthard hinaufzieht.
Eine Schreckensbotschaft durchlief in den ersten Tagen des Jahres 1895 die Schweizer Zeitungen: Airolo war von einer Lawine erfaßt worden, einige Häuser weggeblasen und zerschmettert, ein paar Frauen zerquetscht. Das Unglück wurde beklagt, erörtert und über andern Ereignissen vergessen. Inzwischen machte die schwüle Luft, welche das Unheil verursacht hatte, allmählich der Kälte Platz. Gegen Ende des Monats Januar setzte jener beispiellos strenge Winter ein, der uns während fünf Wochen ununterbrochen Frost von zehn bis fünfzehn Grad bringen sollte.
Am Morgen des 29. Januar, wie ich aufstand, zeigte das Thermometer zwölfeinhalb Grad unter Null, ein kalter Nordwind blies über den Vierwaldstättersee, es fielen einige Schneeflocken, und überhaupt versprach der Tag recht ungemütlich zu werden. Da ich nun die Natur gerne homöopathisch behandle, beim Regen baden gehe und im August Mailand aufsuche, beschloß ich, den kalten Tag lieber am Gotthard oben zu genießen, wobei mir allerdings eine alte Sehnsucht nach Airolo im Winter und nach dem Gotthard im Schneeglanze zu Hülfe kam. Umständlicher Vorbereitungen bedarf ich nie, so daß der Entschluß ohne weiteres ausgeführt werden konnte.
Ich gebe hier, in der Überzeugung, daß Schilderungen, die aus frischer Anschauung entsprungen sind, sich nachträglich nicht verbessern lassen, meinen Bericht über jenen Winterausflug wörtlich so wieder, wie ich ihn unmittelbar nach meiner Rückkehr in der ‹Neuen Zürcher Zeitung› veröffentlichte.
Die Wagenfenster der Eisenbahn waren natürlich fest zugefroren, die Sonne noch mit Schneeschleiern verhüllt. Als erste überwältigende Überraschung empfand ich die verschneiten Mythenstöcke. Bei Brunnen dampfte der Vierwaldstättersee wie flüssige Bronze. Seelisberg und das Rütli weiß zu sehen, kommt einem fast widernatürlich vor. Der Urirotstock, dann weiter hinten der Schloßberggletscher, sowie auch später der Dammagletscher verloren in der Winterlandschaft jegliche Bedeutung; inmitten des schimmernden Schneegebirges bildeten ihre verschneiten Eisfelder vielmehr wolkige Trübungen.
Bei Flüelen begann die Sonne durchzudringen, die Fensterscheiben in farbigen Arabesken zu blitzen, auf allen Berggipfeln schwebten Glühwolken, und das Winterbild gestaltete sich überhaupt so verlockend, daß ich der Versuchung nicht widerstand, die blinden Fenster herunterzulassen, trotz der beißenden Kälte. Die Bergfahrt nach Göschenen ist im Winter noch unterhaltender als im Sommer; wer also bei dieser unfreundlichen Kälte sich einen herrlichen Naturgenuß verschaffen will, dem rate ich, meinem Beispiel zu folgen. Der Bristenstock gewinnt noch durch den Schnee, die Bäche jedoch, vor allem die Reuß selbst, büßen durch die Abwesenheit der grünen Färbung viel ein; dazu ist die Hälfte des Bettes verschneit, um so leichter, da gegenwärtig ohnehin wenig Wasser fließt, mitunter das ganze Bett mit Schnee zugedeckt. Jeder Stein trägt unfehlbar seinen Schneehut, so daß die Reuß wie mit Konfekt überzuckert ist, an den Rändern natürlich überall Eisansätze und, je nachdem, Eiszapfen. Aber die Eiszapfen haben noch nicht die schöne blaue Färbung, die sie einige Wochen später haben werden. Also das Wasser spielt jetzt am Gotthard eine Nebenrolle, dagegen sind die Tannenwälder und die Felsschluchten die Königinnen der Landschaft. Besonders pittoresk das Dorf Göschenen, sowie selbstverständlich die Kerstelenbachschlucht bei Amsteg.
Bis Göschenen ist es eine imposante Winterlandschaft, so wie man sie ungefähr vom Gotthard erwartet. In Airolo beginnt das Erstaunen. Da wird der Winter geradezu gigantisch. So viel Schnee kann man sich überhaupt nicht vorstellen und so viel blendendweiße, fleckenlose Reinheit. Die endlosen Schneemassen nivellieren und vereinigen alles; darüber pusten die Berge steilgerade Glanzwolken, als wären es lauter Vesuve, der Wind fegt hoch oben auf den sonnenglänzenden Eisfeldern abenteuerliche Schneesäulen in die Luft, welche kommen und gehen; jenseits gegen Italien zeigt der Himmel strenge graublaue Stahlfarben. Die Luft ist bei aller Kälte so erquickend wie im Sommer.
Die Bäumchen längs der Straße stecken bis zu ihrer Verzweigung im Schnee, ihre völlig schneefreien Arme umfangen unfehlbar einen riesigen Schneebrocken, als wollten sie ihn dem Vorübergehenden präsentieren, ein fröhlicher, fast possierlicher Anblick. Verblüffend wirken die enormen Schneemassen in den Straßen und auf den Dächern Airolos. Es scheint niemand das Bedürfnis zu empfinden, den drei Fuß hohen Schnee von den Dächern zu räumen. Um zu den Haustüren zu gelangen, hat man Schneegäßchen und Schneetreppchen herstellen müssen.
Nun zu den Lawinen. Auf die Frage, wo diese liegen, lautet die Antwort: Das Dorf ist von drei Seiten von denselben eingeschlossen, wobei ein Zipfel, nämlich derjenige, der sich gegen den Gotthard erstreckt, erfaßt und teilweise zerstört wurde. Alle drei Lawinen kamen vom Scipsciusgebirge, welches, von der Station aus gesehen, gerade hinter Airolo liegt und an Lawinen überhaupt so reich ist, daß der unterste Teil desselben im Volksmunde Waläntsch (Lawine) genannt wird. Nur pflegen die Lawinen des Scipscius ungefährlich zu verlaufen. Es lebt in Airolo ein neunzigjähriger Mann, welcher berichtet, daß nicht ein einziges Mal während seines langen Lebens eine Lawine bis zu der diesjährigen Stelle vorgerückt sei. Es waltete eben vor drei Wochen eine besonders unglückliche Vereinigung von Zufälligkeiten; von Sonntagnachmittag bis Mittwochabend ununterbrochener Schneefall auf einen unvorbereiteten Boden, der dem Schnee keinen Halt bot, so daß also einfach der gesamte Neuschnee, statt Boden zu fassen, herunterrutschte. Die Gefahr war vorausgesehen worden; man wußte, daß sie dringender sei als sonst, die Gotthardstraße wurde an dem verhängnisvollen Abend nach Kräften gemieden, das Militär erhielt Befehl, im Fort zu bleiben, allein niemand ahnte, daß die Befürchtungen sich in solchem Grade verwirklichen würden, und niemand kannte die genaue Stelle, wo das Unheil eintreffen sollte. Immerhin ist es dieser Vorsicht zuzuschreiben, daß kein Mensch auf der Straße von der Lawine überrascht wurde.
Selbstverständlich wendet man gegenwärtig den Schritt gegen die Unglücksstätte, zumal dieselbe nur fünf Minuten von der Mitte des Dorfes entfernt und überdies in der lockendsten Richtung, nämlich auf dem Wege nach dem Gotthard liegt. Die zusammenhangende Häuserreihe wird links von dem Hotel Airolo geschlossen, und hier sind wir auch schon im Lawinengebiet. Wie bekannt, wurde eine Wand im Innern des Gasthofs durch den bloßen Luftdruck beschädigt, zwar nicht etwa zusammengeworfen, sondern nur schiefgedrückt. Dieselbe ist bereits repariert. Anderweitige Beschädigungen des Gasthofes kamen nicht vor. Dagegen sieht der dabeistehende steinerne Schuppen bös aus, die Mauern zerrissen, alles verbogen und der Lawinenschnee noch mehrere Meter hoch auf dem Dache. Von hier an auf eine Strecke von zirka hundert Meter ist die ganze Landstraße und was darum und daran liegt von der Lawine erreicht worden. Die kleineren und schwächeren Gebäulichkeiten, falls sie nicht durch einen Zufall oder schützende Gegenstände oder durch die Anlehnung an den Berg gesichert wurden, sind der Lawine zum Opfer gefallen, das heißt einfach rasiert worden, so namentlich die kleinen Ställe. Da sieht man mitten auf dem Wege ein Dach liegen, anderswo klafft eine Grube, welche mit Balken und Heu zum Teil gefüllt ist und die Überreste eines zerstörten Heuhauses vorstellt. Da aber, wo es am schlimmsten zuging, sieht man überhaupt nichts. Jenes Haus, in welchem die drei armen Frauen umkamen, ist spurlos von der Erde verschwunden. Es war abends um fünf Uhr, als die erste Lawine herunterkam, ohne bedeutenden Lärm. Man vernahm gellendes Hülferufen, man eilte von zwei Seiten, vom Fort und vom Dorf zu Hülfe; da wurden diejenigen, die vom Dorf herkamen, durch die zweite Lawine zunächst von der Unglücksstätte abgehalten. Diese liegt am äußersten Ende des Lawinengebietes, an demjenigen Punkte, welcher von Airolo am weitesten entfernt ist; dort steht eine Gruppe von Häusern, von denen das größte durch seine Festigkeit verschont wurde, ein anderes wurde durch die dahinten liegenden Ställe gerettet, welche wie ein Keil die Lawine teilten. Eine Familie verdankt ihre Rettung dem Zufall, daß die Bewohner in einem andern Hause zu Besuch waren. Ein Haus jedoch, wie man weiß, ging samt seinen Einwohnern zugrunde. Erst wurde es vom Luftdruck ein Dutzend Meter weit hinuntergeschoben, umgeworfen und wahrscheinlich auch eingedrückt, und dann klatschte die Lawine selbst darüber, mit solch einer Gewalt, daß Schnee, Balken, Mauern, Dach und menschliche Körper einen einzigen festen Teig bildeten. Die unglücklichen Opfer sollen buchstäblich platt gequetscht worden sein. Die Eisenbahn und der Tessin wurden nicht erreicht; bloß ein einziger Steinblock soll in das Tessinbett gesprungen sein; aber hinter der ganzen Länge des Dorfes Airolo kam die Lawine in bedenkliche Nähe. Bis auf zwanzig Meter liegen die mitgeführten Tannen. Auf der untern Seite, gegen Stalvedro hin, wurden ebenfalls Stallungen weggerissen und kam ein Mensch um. Zu sehen ist auf dieser Seite von der Lawine wenig; sie unterscheidet sich kaum von dem übrigen Schnee.
Während ich so weiter schritt, mit der Absicht, in der Festung Fondo del Bosco einen Besuch abzustatten, fiel mir allmählich auf, daß ich häufiger, als mir lieb und begreiflich war, bald mit dem einen, bald mit dem andern Bein im Schnee versank. Wie sollte ich das verstehen? Ich schritt ja doch auf der breiten Landstraße! Ich tastete mit dem Bergstock, den man mir aufgenötigt hatte, um zu erfahren, wo die Grenzen der Landstraße wären; rechts konnte ich ihn in bodenlose Tiefen tauchen, links ebenfalls. Wo in aller Welt ging ich denn? Hat sich die Landstraße in einen schmalen Fußweg verwandelt? Das Rätsel löste sich mir, als sich ein Haus, das ich von meinen Sommerspaziergängen her kannte und wiedererkannte, anstatt neben mir, unter mir zeigte. Jetzt begriff ich, daß ich zwar allerdings auf der Landstraße marschierte, aber zweieinhalb Meter über ihr, auf dem Schnee, der in der Mitte festgestampft war, aber zu beiden Seiten das Versinken in die Tiefe erlaubte. Die Wahrheit wurde mir durch die Eisstufen bestätigt, welche zu den Haustüren hinunterführten, sowie durch den Umstand, daß die Dächer ungefähr auf dem Niveau der Straße erschienen.
Das änderte nun etwas die Gemütlichkeit. Ich bemerkte überdies, daß kein Mensch ohne Bergstock ging. Ich sah, daß die Artilleristen stets zu zweien gingen, und erfuhr, daß ihnen dies zum Gebote gemacht wurde, damit, wenn dem einen etwas passiere, der andere ihm Hilfe bringen könne. In der Tat läßt sich leicht begreifen, daß ein solches luftiges Marschieren über unbekannten Gegenständen mit obligatem Einsinken in den Schnee nicht völlig gefahrlos ist. Ein gänzliches Versinken scheint zwar ausgeschlossen zu sein, indessen kann der untersinkende Fuß an irgendeinem unsichtbaren Gegenstande Schaden nehmen, und was dergleichen mehr ist. Ich schloß mich daher gerne der Führung einiger heimkehrenden Soldaten an, welche, beiläufig gesagt, wie auch die übrigen, die ich sah, mir einen vorzüglichen Eindruck machten: mutig, frisch und gesund und höflich.
Es war ein prächtiger Spaziergang, blauer Himmel, weiße Erde, goldene und silberne Bergspitzen und leuchtende Schneestürme. Der Alpenstock pfiff und kreischte im Schnee fortissimo, aber bei der Biegung gegen das Bedrettotal sauste der Nordwind so gewaltig über den Gotthard herunter, und die Schneewirbel flogen so crescendo aus dem Boden herauf, daß ich dem Frieden allmählich nicht mehr völlig traute. Bei Nacht über diese lockern Schneebrücken zurückzukehren, möglicherweise durch einen wütenden Orkan, schien mir nicht verständig zu sein. Ich gewann allmählich eine Ahnung, daß mit dem Gotthard nicht zu spaßen sei, und mußte mich fragen, wie es wohl demjenigen ergehen möchte, der zur gegenwärtigen Jahreszeit nach dem Gotthardhospiz vordringen wollte.
Das wurde mir am Abend beim gemütlichen Gespräch klar. Wir Stadtmenschen können es uns nicht vorstellen, daß eine breite Landstraße jemals völlig unkenntlich wäre. Wenn man uns aber sagt, daß das Val Tremola von Lawinen gänzlich verschüttet ist, daß der Schnee während des Sturmwindes zimmerhoch von einer Stelle zur andern hinübergeworfen wird, daß neulich bei Airolo ein Mann in einer halben Stunde vom Schneesturm bis an die Schulter zugedeckt wurde und nur durch schleunige fremde Hilfe gerettet werden konnte, daß die beiden Knechte auf dem Hospiz von der Welt abgeschlossen sind, daß dort oben sogar das Wasser mangelt und die Einsiedler ihren Kaffee mit Schneewasser brauen müssen, daß auch herwärts der Tremola drei Meter hoher Schnee den ganzen Berg bedeckt, Schluchten und Bäche und Straße in eine ebene, schöne, spiegelglatte Fläche verwandelt, dann geht uns das Verständnis auf. Welche Summe aber von Mühen und Geldopfern mag es vormals gekostet haben, um aus dieser Schneemasse einen Postweg herauszuhauen mit Korridoren und Schneedächern?
Jetzt begnügt man sich mit einer primitivern und billigeren Herstellung einer Verbindung. Man wird gerade um diese Jahreszeit, vielleicht in acht Tagen, vielleicht in zwei Wochen, einige mutige, rüstige Männer mit ortskundigen Führern in der Richtung nach dem Gotthard entsenden. Diese waten Schritt für Schritt bis an die Hüfte im Schnee, soweit es die Kräfte erlauben; dann kehren sie auf ihren eigenen Spuren zurück. Das ist der Anfang. Damit ist auf ihren Fußstapfen dem Schnee einige Festigkeit gegeben. Am andern Tag tun andere dasselbe, genau in den nämlichen Spuren, wobei sie schon bedeutend weniger einsinken, und so fort. Das Werk der Menschen wird dann von der Natur vervollständigt, indem die Unterschiede der Temperatur die Festigkeit vermehren. Ähnlich verfährt man mit dem Schlittenweg. Erst wird ein leichter Schlitten entsandt und später ein immer schwererer.
Zum Schlusse möchte ich in der gegenwärtigen Jahreszeit einen Spaziergang durch die Stalvedroschlucht empfehlen. Der Weg ist überaus pittoresk und durchaus gefahrlos; denn die Schneeverhältnisse sind hier ganz anders. Keine Lawine, kein Nordwind, man geht hübsch unten auf der Straße, zwischen den Schneehaufen, statt auf denselben; nur so viel Schnee ist in der Mitte der Straße gelassen worden, daß die Schlittbahn geschont wird. Wenn ich berichte, daß ich trotz der Kälte hier zwei Stunden lang gegangen bin, einfach weil mich die Schönheit der Natur und die erquickende Luft dazu zwang, wenn ich ferner bekenne, daß ich heute schon wieder, nachdem ich erst vor zwei Stunden zu Hause angelangt bin, daran denke, allernächstens nach Airolo zurückzukehren, so habe ich damit wohl deutlich gesagt, daß ich einen Winterbesuch in Airolo für einen Genuß und für eine Erfrischung der Nerven halte.
Hingegen bei zwölf Grad Kälte über den Vierwaldstättersee zu fahren, ist ein fraglicher Genuß. Das habe ich auf der Heimreise erfahren. Da pfeifts.
*
Übersichtliches
Die Eisenbahn in einen feindlichen Gegensatz zur Fußwanderung im Gebirge zu bringen – ein Lieblingsthema moderner Phraseologie –, wird uns nicht einfallen. Wie die Eisenbahn den Alpenfrieden stören soll, kann ich nicht einsehen. Es findet ja jeder, dem sie nicht behagt, reichlich Raum, ihr auszuweichen; sie läuft ihm ja nicht über die Alpen nach, sondern folgt ihren eigenen Geleisen. Übrigens sehe ich die gestrengen Herren vom Alpensport mit ihren Führern und Pickeln gar gerne selber die Eisenbahn benützen, mit welchem Anblick für mich der Streit erledigt ist. Die Eisenbahn erschließt das Gebirge, welches bisher nur wenigen Rüstigen und Bemittelten offen gestanden, der ganzen Menschheit. Überdies befördert sie den Fußwanderer rasch und billig an denjenigen Ort, an welchem er seine Wanderung beginnen will. Was im besondern die Gotthardbahn betrifft, so haben seit ihrem Bestehen schon Tausende den Gotthardpaß zu Fuß erstiegen, welche ohne die Bahn niemals hinaufgelangt wären. Es wurde mir auf dem Hospiz versichert, daß der Touristenverkehr auf der Paßhöhe nie zuvor so lebhaft gewesen sei als seit dem Bahnbetrieb. Das läßt sich begreifen.
Immerhin ist die Gotthardbahn weder eine Bergbahn – denn der Berg ist ihr Ziel nicht, sondern Hindernis – noch eine Vergnügungsbahn, sondern eine internationale Verkehrslinie. Als solche darf sie nur ganz ausnahmsweise auf die Wünsche der Touristen Rücksicht nehmen, wie sie das zum Beispiel durch den kurzen Halt in Flüelen während der Sommermonate tut, doch keineswegs sich überhaupt nach ihnen einrichten. Die Anordnung der Züge und Stationen kommt mithin den Ausflügen nicht zuvor, sondern diese müssen sich vielmehr mit denjenigen Zugverhältnissen abfinden, welche die gebieterischen Anforderungen einer internationalen Linie geschaffen haben.
Übersehen wir nun diese Verhältnisse, so ist vor allem als Hauptergebnis die Tatsache hervorzuheben, daß die Gotthardbahn den Mittelpunkt für Ausflüge verlegt, nämlich von Amsteg nach Göschenen vorgeschoben hat. Alle diejenigen Strecken der alten Poststraße und alle diejenigen Seitengassen des Gebirges, welche im Umkreis von Göschenen liegen, sind gegenwärtig geschwind und leicht zu begehen, die übrigen mit größerem Aufwand von Zeit und Kombination, so daß zum Beispiel das Gebiet von Wassen und Amsteg rückwärts von Göschenen her muß gewonnen werden und daß das um mehrere Meilen näher liegende Maderanertal für den Ausflug weiter abseits gerückt ist als das hohe, ferne Göschenertal. Wer Göschenen sagt, sagt Andermatt. Andermatt wird schließlich derjenige Ort des nördlichen Gotthardgebietes sein, welcher von der Gotthardbahn den unmittelbarsten Vorteil wird gezogen haben, was sich nach Vollendung des Trams Göschenen-Andermatt noch deutlicher erweisen wird. Wenigstens für den Sommerverkehr; im Winter und Frühjahr werden wohl die Lawinen der Schöllenenschlucht nach wie vor ein Wörtchen mitreden wollen.
Als zweiten Hauptausflugspunkt bezeichnen sowohl die Örtlichkeit als die Zugsordnung Airolo. Immerhin mit dem wichtigen Unterschied, daß jeder, selbst der kleinste Ausflug, den ein aus Luzern Reisender von Airolo aus zu unternehmen gedenkt, schon zwei Tage Zeit statt eines einzigen erfordert. Göschenen und Umgebung bis Andermatt hinauf oder bis Amsteg hinab ein Tag, Airolo zwei Tage – das ist der erste Satz, den sich derjenige zu merken hat, welcher Wanderungen nach dem Gotthard plant. Sie mögen sich noch so sehr gegen diese Wahrheit sträuben, in dem Bewußtsein, daß Airolo kaum eine halbe Fahrstunde von Göschenen entfernt ist, sie werden sie bestätigt finden, wenn sie den Fahrplan in die Hand nehmen.
Nun kommt allerdings die jenseitige Abdachung, also der Kanton Tessin, für Fußmärsche ohnehin weniger in Betracht, wenigstens was die Wanderung talabwärts auf der Landstraße betrifft. Hauptsächlich weil das Klima dem Fußmarsch nicht günstig ist. Ich lasse mirs einmal nicht nehmen: drüben in italienischer Luft bringt Spaziergang und Spaziermarsch nicht dieselbe körperliche Erquickung wie auf der Nordseite der Alpen, und zwar gilt dies schon von Faido. Bloß das oberste Plateau der Leventina, die Hochebene von Airolo mit den umliegenden Bergen und Tälern, nehme ich aus.
Nehmen wir einleitungsweise die wenigen kurzen Strecken der alten Poststraße voraus, welche mir jenseits des Gotthard für den Fußmarsch empfehlenswert scheinen. Ich kenne deren, vom Gotthardpaß abgesehen, nur zwei: den Dazio Grande und die Biaschina. Ich wiederhole: Jede dieser Strecken für sich verlangt für den aus Luzern Reisenden zwei Tage Zeit, beide vereint drei Tage, hin und zurück gerechnet.
Der Dazio Grande
Der Dazio Grande, das heißt die steile Felsentreppe des Tessins, die aus der obern Leventina in die zweihundert Meter tiefer gelegene mittlere Leventina hinunterführt, Fluß und Straße übereinander in eine Spalte des Monte Piottino eingeklemmt, ist ein Seitenstück der Schöllenenschlucht, und zwar meiner Meinung nach ein ebenbürtiges, ja, wenn wir allein nach dem landschaftlichen Wert urteilen, vielleicht sogar ein überlegenes. Jedenfalls ist der Dazio Grande zuverlässiger in der Wirkung, indem sein Eindruck weniger von Zufälligkeiten der Beleuchtung abhängt als die Schöllenen.
Seine Großartigkeit beruht nicht sowohl auf der absoluten Größe der Berge und der Schlucht – alles ist hier im Vergleich zur Schöllenenschlucht viel kleiner –; aber die Verhältnisse von Wasser, von Kluft und von Felswand sind günstiger, die Wirkung ist deshalb malerischer. Der Dazio Grande hat eine engere Schlucht; die Landstraße läuft unmittelbarer über den Strudeln, die Wasser tosen lauter, der Fluß überwirft sich in stürmischerem Gischt. In der eingezwängten Klus liegt tieferer Schatten. Dazu kommt noch die schöne grüne, mit milchigem Schaum überrahmte Farbe des Tessin. Kurz, eine entzückende Naturszene, die auf niemand ihren Zauber verfehlen wird. Ich halte den Dazio Grande einer Reiseunterbrechung, welche allerdings einen nächtlichen Aufenthalt in Airolo oder Faido erheischt, für wert.
Um den Dazio Grande zu besuchen, verläßt man in Göschenen den Schnellzug und fährt nach dem Mittagessen mit dem ersten langsamen Zug – zirka drei Uhr – bis Rodi-Fiesso, wo man ungefähr ein Viertel nach vier Uhr ankommt. Hier steigt man aus und erreicht, der Landstraße folgend, in wenigen Minuten den Eingang der Schlucht. Das weitere ist ein entzückender Spaziergang, den man so weit verfolgen mag, als man Lust hat. Schwer trennt man sich von dem einsamen, donnernden Hexenkessel und bringt eine unvergeßliche Erinnerung mit heim. Aber auch die paar Minuten von der Station bis zur Schlucht sind wundervoll. Nämlich die Gebirge von rechts und links, indem sie, sich berührend, das oberste Plateau des Tessintales verriegeln, lassen zur Rechten eine stimmungsvolle Lücke, von einer sanften, fruchtbaren und mit Häusern garnierten Hügellehne besetzt, über welche ein mildes, gebrochenes Licht herunterflutet.
Nach der ersten halben Stunde weitet sich die Schlucht zu einer großen und tiefen Landschaft aus und verliert allmählich an Bedeutung. Der Weg nach Faido ist weit und in den letzten zwei Dritteln nicht sonderlich lohnend. Es bleibt indessen kaum etwas anderes übrig, als ihn bis Faido fortzusetzen, um ein behagliches Nachtlager zu finden. Wer das nicht will, muß unterwegs umkehren und auf der Station Rodi-Fiesso drei oder vier Stunden lang auf den Zug warten, der um neun Uhr von unten her ankommt und einen um zehn Uhr nach Airolo bringt. Dazu braucht es einige Geduld, aber das schlimmste Schicksal ist es nicht. Denn die Luft da oben in Rodi auf tausend Meter Höhe über dem Meere ist ebenso weich als erfrischend.
Eine dritte Lösung, vielleicht die richtigste, wäre noch die folgende: Man fährt mit dem zweiten Schnellzug, der in Airolo hält (was der erste nicht tut), bis Airolo, steigt aus, läßt sich in irgendeinem Gasthof einen Wagen anspannen, fährt damit bis zur Station Rodi-Fiesso, läßt den Wagen dort warten, besucht zu Fuß den Dazio Grande, soweit und solang man mag, und läßt sich, wann es einem beliebt, mit dem Wagen nach Airolo zurückführen, wo man ein komfortables und ruhiges Nachtquartier finden wird.
Die Biaschina (Lavorgo-Giornico)
Eine Merkwürdigkeit, eine überwältigende Wirkung darf man sich von der Biaschina nicht versprechen. Im Gegenteil sagt die Gegend bei der Fußwanderung kaum viel mehr, als sie bereits bei der Eisenbahnfahrt gesagt hatte. Stets ein und dasselbe Bild einer großen, weiten Gebirgseinöde, durchrauscht von dem hier schon ziemlich breiten Tessin, dessen Schnellen sich nicht im entferntesten mit dem Dazio Grande vergleichen lassen. Die Eingangspforte bei Lavorgo erweckt großartige Erwartungen, die der erste steile Abfall der Straße unterhält; doch bald verflacht sich die Talsohle, und der Marsch wird einförmig. Die Kastanien am Anfange, der Wein und die Feigen am Schlusse gegen Giornico hin, erregen wohl einige Aufmerksamkeit, gewähren jedoch keinen genügenden Ersatz für den mangelnden Wechsel der Szenerie. Überhaupt, was man unterwegs verspürt, sieht einer Enttäuschung ziemlich ähnlich.
Aber es liegt doch Stimmung in dem fremdartigen, wilden Steinkessel: zunächst die märchenhafte Einsamkeit, eine Einsamkeit, wie man sie sich nicht einsamer vorstellen kann, Ausgestorbenheit, verziert mit Unheimlichkeit; Räuber denkt man sich gerne da hinein, aber, bitte, unschädliche Operettenräuber. Kurz, eine Salvator-Rosa-Szenerie. Und dann, hauptsächlich, ganz wundervolle Luftfarben; was der Monte Piottino und Faido andeuten, ist hier schon vollendet. Wenn ich an meinen Spaziergang durch die Biaschina zurückdenke, ein Stündchen alles in allem, so schaue ich ein wahres Kaleidoskop von purpurnen Abendschatten, überglänzt von goldenem Licht, ein violettes Gemälde.
Schon früh am Nachmittag nämlich zieht sich die Sonne aus dem Tale nach den Höhen zurück, die sie jetzt viele Stunden lang mit glühenden Farben malt. Das ist mir unvergeßlich geblieben. Man sollte die Biaschina in kleiner intimer Gesellschaft besuchen, besser noch zu Wagen als zu Fuß und zwar in einem zweisitzigen Wagen. Eine geborene Landschaft für eine Hochzeitsfahrt.
Begeben wir uns jetzt auf die andere Seite, in das Zentrum der kürzeren Ausflüge, nach Göschenen.
Die Schöllenen
Der einfachste, bequemste und zugleich der populärste aller Ausflüge mit der Gotthardbahn ist zweifellos der Weg durch die Schöllenen bis zum Ursernboden gegen Andermatt. Die günstige Zeit der Ankunft und des Abganges der Züge, die vielen Wagen, die in Göschenen jederzeit bereit stehen, die Berühmtheit der Gegend mit den inhaltsreichen Namen ‹Teufelsbrücke› und ‹Urnerloch› erklären die Bevorzugung dieser Strecke. Man hat einen der sensationellsten Punkte der Gotthardroute gesehen, wenn man von hier zurückkommt; und, was für manchen den Ausschlag gibt, es nimmt sich gut aus, später zu Hause, im Reisebericht, die Teufelsbrücke besucht zu haben.
Mit der Schöllenen hat es freilich eine eigentümliche Bewandtnis. Die Unterlage, worauf ihr Ruhm sich gründete, das Grausen, ist abhanden gekommen. Wo Gasthofomnibuskarawanen vorbeirasseln, zweispännige Kutschen fahren, Kristallhändler betteln, Edelweißbuben plärren, da hört das Grauen auf. Die neue Teufelsbrücke ist eine Brücke wie hundert andere; und das ehemalige Weltwunder, das Urnerloch, lockt uns Modernen, die wir an die Axenstraße und die langen Eisenbahntunnels gewöhnt sind, nur ein mitleidiges Lächeln ab. Man glaubt an einen schlechten Scherz, wenn die kurze Galerie, die aufhört, ehe sie recht anzufangen begonnen hat, sich als das berühmte Urnerloch erweist.
Damit will ich die Großartigkeit der Schöllenenschlucht keineswegs herabsetzen. Es bleibt ja nach wie vor die Riesenhaftigkeit der starren Felsgebirgswände – ein wahres Totental –, die jähen Straßenwindungen, der steile Abfall der Straße, das Toben des Flusses, das Stäuben des Wassers an Fels und Straße empor, oben in der Enge bei der Teufelsbrücke und die plötzliche Verwandlung der Szene jenseits des Urnerlochs. Alles das vereint ist auch heutzutage noch befähigt, einen überwältigenden Eindruck hervorzurufen. Allein es bedarf dazu günstiger Umstände, welche der Fremde, der die Schöllenen am frühen Nachmittag mit aufs höchste gespannter Erwartung von unten her aufsucht, am allerseltensten trifft. Die Schlucht muß, wenigstens zum Teil, im Schatten liegen, denn bei grellem Sonnenlicht ist sie ein staubiger, übelriechender, poesieloser Korridor. Sie sollte besser talwärts als bergwärts zurückgelegt werden; der einzige Gewinn des Aufstiegs vor dem Niederstieg ist die plötzliche Erschließung des Urserntales. Die Reuß muß viel Wasser haben, und schließlich die Hauptsache: man müßte von der überraschenden Szenerie auch wirklich überrascht werden. Das aber ist die Bedingung, welche für uns Schul- und Bildungsmenschen, die wir bereits alles Einzelne aus Büchern und Bildern genau studiert haben, ehe wir die Wirklichkeit aufsuchen, am schwierigsten erhältlich ist. Deshalb geht es den meisten mit der Schöllenenschlucht wie mit dem Rheinfall bei Schaffhausen. Man fühlt sich nicht völlig befriedigt, nicht weil man weniger gefunden hätte, als man erwartete, sondern weil man genau das findet, was man erwartet hatte, nichts darüber oder daneben. Führe aber einen Unwissenden oder Unvorbereiteten zu günstiger Stunde von Andermatt nach Göschenen, so wird er eine ähnliche staunende Bewunderung kundgeben wie unsere Vorfahren.
Jetzt von Göschenen in entgegengesetzter Richtung talwärts. Ein tüchtiger Läufer legt wahrscheinlich die ganze Strecke Göschenen-Amsteg auf einmal zurück und erreicht noch den letzten Zug, um am nämlichen Tag nach Luzern heimzukehren. Nichtsdestoweniger trenne ich die einzelnen Teile des Weges, jeden als besondern Ausflug behandelnd. Einmal, weil bei so großer Fülle von Sehenswürdigkeiten, wie sie auf dieser Straße einem beschert werden, die Einteilung zu besserer Übersicht verhilft, und dann, weil ich immer in erster Linie an schwächere Kräfte denke. Ich habe nämlich beobachtet, daß nicht immer die besten Fußgänger die liebenswürdigsten und nicht notwendiger Weise die schlechtesten Fußgänger die schlechtesten Menschen sind; warum sollte ich also nicht gutartigen Menschen mit kleinen Füßen gleich den übrigen den Genuß eines Spaziergangs in der herrlichen Gegend wünschen und mit meinem Rat, so viel ich vermag, erleichtern?
Wenn in einer Freundesgesellschaft Wanderer von ungleicher Kraft sich zusammengefunden haben, so sind es die schwächsten, nach welchen man den Schritt bemißt. Ich tue dasselbe. Sowohl meine Ausflugsempfehlungen als meine Entfernungsangaben sind immer von dem Gesichtspunkte aus beherrscht: Kommt auch jeder mit? Wird es niemand zu schwer? Ich ertrage leichter den Gedanken, daß noch so viele trainierte Fußgänger mich belächeln, als daß ein einziger Rekonvaleszent mich verwünsche.
Hätte ich keine Abneigung gegen Motto und Schnörkel, so würde ich dem Titel meines Buches beigefügt haben: Der Gotthard ‹für alle› oder ‹für verwöhnte Stadtleute›.
Göschenen-Wassen
Wie gröblich man irren kann, wenn man vom Wagenfenster der Eisenbahn aus urteilen will, ob sich eine Fußwanderung lohne oder nicht, habe ich gelegentlich dieses Weges erfahren. Spät und ungerne, lediglich der Vollständigkeit zuliebe, entschloß ich mich, wieder einmal nach langer Zeit diese Strecke, die mir nur undeutlich im Gedächtnis haftete, zu begehen. Ein fadengerader Weg, wie mit dem Lineal gezogen, in seiner ganzen Länge vom Zug aus zu überschauen, schattenlos, in der Mitte zwischen Berg und Berg abfallend – es scheint nahezu unmöglich, daß die Fußwanderung hier einen Reiz haben könnte. Wie angenehm wurde ich enttäuscht! Kaum, daß man aus dem Dorf ins offene Tal getreten ist, so grüßt einen das mutige Brausen der Reuß. Es ist weder ein wildes Tosen noch ein schläfriges Rauschen, sondern – ich kann es nicht genauer bezeichnen – ein mutiges Brausen. Frisch sprudelnd und springend wie Quellwasser. Die Luft hat Reinheit und Weichheit; kein Wunder: elfhundert Meter über dem Meere! Vor uns senkt sich die Straße kühn, doch nicht allzu steil zu Tal, das Ganze die köstlichste Einladung, auszugreifen. Einen Wettlauf möchte man anheben; etwas wie Jubel liegt in der Luft. Dazu kam, als ich den Spaziergang ausführte, noch ein flatternder Wind, mit kurzen Stößen schiebend und das Brausen des Wassers mit hörbaren Schlägen begleitend. Wie mit Segeln beschwingt läuft sichs so zu Tal, unter dem Konzert von Wind und Wasser, dem einzigen Laut in dem stummen Hochtale. Und das geht nun so ein Stündchen fort, bei rasch sich mehrender Vegetation, die das Tal allmählich lieblicher gestaltet.
Ein Viertelstündchen herwärts Wassen gibt es eine entzückende Überraschung: zur Linken jenseits der Reuß ein schäumender Wasserfall, während rechts hart an unserer Straße mancherlei Gießbäche und sprudelnde Wässerlein aus den Bergnischen hervorspritzen. Das gießt und sprüht, daß es eine Lust ist zu sehen und zu hören. Da gleichzeitig die Straße sich krümmt und die Umrisse der Hütten sich von der freien Luft abheben, entsteht zudem ein hübsches Zeichenmotiv. Überhaupt ist Wassen, ohne im mindesten eine eigentliche Sehenswürdigkeit zu besitzen, eine der anmutigsten Stellen der Gotthardstraße, lieblich, idyllisch, trotz der Lawinenwildnis ringsum, der erste Gruß germanischer Kultur und Poesie für den vom Süden Wandernden, ungefähr was Faido für den Südenfahrer. Wassen und Faido, zwischen diesen beiden Nestchen ist der Gegensatz von germanischer und italienischer Art schon rein und fertig vollzogen.
Göschenen-Wassen ist der kürzeste aller Ausflüge, die sich mit der Gotthardbahn überhaupt ausführen lassen: wenn einer mit dem Blitzzug um zwölf Uhr in Göschenen anlangt und einige Minuten vor Schluß des Mittagessens, das süße Gericht preisgebend, aufbricht und rüstig ausschreitet, so kommt er gerade recht, um in Wassen den Zug nach Luzern zu treffen, der aber, ja nicht zu vergessen, scheinbar bergaufwärts steuert, das Gesicht gegen Göschenen gewendet, gemäß den bizarren Launen der Kehrtunnels. Ein Verfehlen des Zuges wäre übrigens auch kein sonderlicher Übelstand; es gälte einfach, zwei Stunden auf die nächste Fahrgelegenheit zu warten, das heißt mit Spaziergängen auszufüllen. Heißt es für einen Reisenden: ‹entweder – oder›, dann möchte ich nicht die Verantwortung auf mich nehmen, Wassen-Göschenen an Stelle der Schöllenen anzuraten. Die enttäuschten Augen, die zornigen Ausrufe, die das geben würde, die spüre ich voraus! Ich wiederhole vielmehr: Die Strecke Wassen – Göschenen bietet nichts, gar nichts, als ein bißchen Poesie, von welcher man überdies die Hälfte selber mitbringen muß.
Hingegen wer die Schöllenen schon kennt, den wird der Versuch schwerlich reuen, ob ihm das Stückchen Bergfreiheit mit Wind- und Wassersymphonien nicht Leib und Seele erfrische. Auf die Einwendung aber, daß die nämlichen Eindrücke auf jeder anderen Höhe von elfhundert Metern zu haben wären, entgegne ich: Die Landstraße haben Sie hier voraus, das heißt den ausgeglichenen und ausgleichenden Weg, also die Möglichkeit eines fröhlichen Marschierens, den Kopf hoch, die Blicke lustig umherschweifend, statt beständig auf den Tritt achten zu müssen, wie beim Abstieg von andern Bergen. Vom Rigi springt oder stolpert einer zu Tal, fortgerissen und stemmend; nur auf fahrbaren Pässen gerät ein Abstieg im Marschtempo.
Gurtnellen-Amsteg
Die kurze Strecke Wassen-Gurtnellen mit dem Pfaffensprung – eine starke halbe Stunde – übergehe ich. Ich könnte sagen, wegen ihrer verhältnismäßigen Unwichtigkeit, und würde mich darin schwerlich täuschen. Doch will ich lieber den wahren Grund angeben: wegen des zufälligen Umstandes, daß ich trotz öfterem Vorsatz nicht dazu kam, diesen Weg in den letzten Jahren wieder aufzusuchen, meine früheren Erinnerungen aber für eine Schilderung und Würdigung nicht mehr deutlich genug sind. Diese kleine Lücke ist ein Fehler, und Fehler gesteht man am besten ehrlich ein. Das immerhin weiß ich noch, daß ich einst an der Szenerie des Pfaffensprungs Vergnügen fand, zudem habe ich mich neulich auf einem Spaziergang von Wassen davon überzeugt, daß auch das erste Viertelstündchen gegen Gurtnellen, der jähe Abfall der Straße mit der Mündung der Meienreuß, Genuß bringt. Der übrige Verlauf der Straße, die man bis nach Gurtnellen überschaut, erscheint nichts weniger als verlockend, aber auf den Schein ist kein Verlaß, abgesehen davon, daß ich an reizlose Strecken des Gotthard, zumal auf der Nordseite, überhaupt nicht glaube. Ich möchte daher ja nicht davon abraten und empfehle, der Zugsordnung entsprechend, diese Strecke im Anschluß an diejenige von Göschenen nach Wassen mitzunehmen, mit andern Worten, den Spaziergang von Göschenen bis nach Gurtnellen auszudehnen. Man gelangt dann immer noch an demselben Abend nach Luzern, obschon natürlich nicht mehr mit dem früheren Zuge, den wir in Wassen überholten, der uns aber seinerseits zwischen Wassen und Gurtnellen überholen wird.
Nun also Gurtnellen-Amsteg. Es ist das eine der altberühmtesten, meistbewunderten Partien des ganzen Gotthardpasses. Zugleich jene, die auch gegenwärtig bei der Eisenbahnfahrt von jedermann ohne Ausnahme als der Glanzpunkt der Gotthardlinie gepriesen wird. Wie man der Versuchung widerstehen kann, den immerhin lückenhaften Ausblick aus dem Zug durch die Fußwanderung zu ergänzen, ist mir auch dann noch rätselhaft, wenn ich die Eile und Zeitbeschränkung der meisten Reisenden in Betracht ziehe. Vielleicht gelingt es meiner Schilderung, diesen oder jenen zu diesem Spaziergang anzuregen.
Oder wäre es die etwas umständliche Kombination, die dieser Marsch erfordert, was manchen abhält? Wohl möglich. Nun, dann wollen wir diesem Übelstande gleich zum voraus abhelfen. Um unsern Ausgangspunkt, nämlich Gurtnellen, zu erreichen, gilt es, da kein Schnellzug in Gurtnellen hält, erst mit dem Blitzzug nach Göschenen zu fahren: Ankunft in Göschenen einige Minuten nach zwölf. Hierauf nach dem Mittagessen benützt man den ersten langsamen Nachmittagzug, der in umgekehrter Richtung, also gegen Luzern fährt, und steigt in Gurtnellen aus. Der Marsch von Gurtnellen nach Amsteg erfordert zwei Stunden, wozu noch der Weg von Amsteg nach Station Amsteg (zwanzig Minuten) zu rechnen bleibt. Bei ruhigem, keineswegs übereiltem Schritt kommt man früh genug in Amsteg an, um einen kleinen Imbiß zu nehmen und sich mit einem Gasthofwagen zur Station befördern zu lassen, wo einen der letzte Zug noch nach Luzern zurückführt. (Ankunft in Luzern um neun Uhr.) Das liest sich etwas umständlich, macht sich jedoch in Wirklichkeit ganz leicht. Und es lohnt sich fürwahr reichlich. Denn da gibt es mehr und Schöneres zu schauen als in der Schöllenen, eine ganze Kette von entzückenden Bildern, in ihrer Gesamtheit den Szenen oben am Paß an Wert mindestens ebenbürtig, zugleich an Charakter völlig verschieden.
Von der Station Gurtnellen geht es zunächst über ein Brücklein auf das andere, rechte Reußufer, zwischen den paar Häusern des Dörfchens Wyler hindurch, auf die Landstraße. Ich sage Wyler, nicht Gurtnellen, denn das weit größere, verhältnismäßig stattliche Gurtnellen, welches der Station den Namen gegeben, liegt hoch oben hinter einer Hügelwelle verborgen und kommt erst später zu Gesicht. Wir stehen also bei Wyler und folgen talwärts der Straße. Die erste Viertelstunde bietet nichts; im Gegenteil mag mancher auf der schattenlosen und reizlosen Straße wohl ungeduldig werden. Doch muß man das mit in den Kauf nehmen; wir werden für die geringfügige Belästigung bald verschwenderisch entschädigt werden. Nämlich sobald wir die ersten Vorläufer des Waldes erreichen, erfolgt eine entzückende Überraschung nach der andern. Vor allem wird der kräftige Tannenwald selbst, der Wassener- oder Wylerwald, mit seinen Lichtspielen, mit seinem Dufte, mit seinen Beeren und Blumen in uns eine merkwürdig starke Befriedigung erzeugen. Denn hier, wie auch auf andern Gebieten, bewährt es sich, daß man meist erst dann bemerkt, daß man etwas entbehrte, wenn man das unbewußt Entbehrte wieder gefunden hat. Die Pflanzenwelt, vor allem der Wald, ist uns unentbehrlicher, als wir ahnen, und das an das kahle Hochgebirge gewöhnte, ich möchte sagen pflanzenhungrige Auge begrüßt den ersten schwarzgrünen, duftenden, blumigen Hochwald mit wahrem Frohlocken.
Er ist übrigens auch an sich von hervorragender Schönheit, der Wassener- oder Wylerwald. Hören wir zum Beispiel die begeisterten Sätze, welche Hardmeyer in seinem zwar knappen, aber kenntnisreichen und in jeder Beziehung vorzüglich geschriebenen Büchlein «Die Gotthardbahn» dem Wassenerwald widmet: «Der Wassenerwald», schreibt Hardmeyer, «ist einer der prachtvollsten Bergwälder, die sich in den Alpen finden. Uralte Tannen, an deren Äste sich ehrwürdige Flechtenbärte angesetzt haben, stehen zwischen kolossalen, in abenteuerlichster Weise durch- und übereinander geworfenen Felsblöcken und bilden ein undurchdringliches Schattendach. Rote Flechten überziehen die Felstrümmer, zwischen welchen da und dort Pflanzen aus der höhern Alpenregion erblühen, deren Samen oder Wurzelkeim von den Bergbächen zu Tale gespült worden sind.»
Soweit Hardmeyer. Ich erwähne seine Worte zum Beweis, daß ich mit meiner hohen Wertschätzung des Wassenerwaldes nicht allein stehe. Doch verlassen wir uns wieder auf die eigenen Augen.
Bald fällt auch die Reuß neben uns zur Linken in Kessel und Tobel, die Waldesstille mit ihrem Brausen erfüllend und hie und da zwischen den Bäumen aus der Tiefe emporglitzernd. Schon wandelt uns die Lust an zu weilen, zu genießen und zu träumen; doch das ist alles noch bloß ein Vorspiel. Plötzlich biegt die Straße zu einer kühnen Schleife rechts in den Waldberg hinein und sofort wieder zurück. Aus dem Walde herunter saust aus jäher Höhe ein heftiger Wildbach, der Fellibach, tief unter der Landstraße, das heißt natürlich unter einer Brücke derselben durch und in die Reuß; alles innerhalb des dunkeln Waldes, der uns rings umgibt. Dies ist vielleicht von allen Punkten der ganzen Gotthardstraße der allerschönste. Jedenfalls ist er der schönsten einer; denn Schönheit zu numerieren und genau zu taxieren hat ja weder Zuverlässigkeit noch Zweck. Kurz, hier möchte man halbe Tage weilen. Die Unlust, aus dieser großen, stimmungsvollen Waldeinsamkeit herauszutreten, steigert sich bis zur Feindseligkeit gegen das allmählich stärker hereinbrechende Licht und die in der Ferne hoch oben am Himmel auftauchenden Berggipfel. Aber wenn nun das neue Bild sich mehr und mehr aufrollt, kühne Gebirgszüge zu beiden Seiten, in der Mitte grünes, lachendes Hügelland mit Wiesen und Obsthalden und dahinter, in der Tallücke, der blaue Himmelsduft, unter welchem wir das Dasein eines Sees erraten, dann werden wir bald mit dem Tausche versöhnt.
Jetzt führt die Straße entschieden nach unten, der Reuß zu, in den offenen grellen Gau. Und ein zweitesmal nehmen wir bedauernd und zögernd Abschied. Die Kapelle bei Meitschlingen scheint das letzte Ende der Naturschönheiten zu bezeichnen. Denn vor uns erblicken wir auf eine längere Strecke die staubige Landstraße, welche über die Reuß auf das linke Ufer zurückführt und von dort eine sonnige Halde hinansteigt. Doch das ist nur eine Pause. Oben auf der Halde, wo jetzt die Landstraße die Eisenbahnlinie berührt und eine geraume Zeit unzertrennlich mit ihr dahinläuft, erscheint plötzlich wieder ein ganz neuartiges Gebirgsbild. Eine jubelnde Rigilandschaft, ganz mit Licht und Glanz und Farbe übergossen, saftige Alpen, mit sprudelnden Bächen und schäumenden Wasserfällen, mit Wäldern und Herden, Hütten und Weilern, zur Rechten aber die Reuß, in ungeahnte Tiefen stürzend, und der tosende Abgrund, mit gartenähnlichen Hainen von Birnbäumen und Nußbäumen bestanden. Vorn mehr und mehr emportauchend der Reußboden und das Ganze von den beiden riesigen Talwächtern beherrscht, der klotzigen Windgälle und dem vornehmen Bristenstock mit seiner feinen Pyramide. Das ist die gesegnete Höhe von Intschi. Und ein drittes Mal fühlt man sich durch den Schönheitszauber festgebannt und zürnt der Straße, die uns von hier wegführt. Glücklicherweise währt dieser lachende, lichtumflutete Höhenspaziergang länger, als wir vermuteten, nämlich wohl ein halbes Stündchen. Der ersten malerischen Einsenkung folgt eine zweite, dem Quellbach folgt ein Gießbach und dem Gießbach ein Wasserfall. Schließlich nimmt die wonnige Zauberlandschaft doch ein Ende. Amsteg erscheint unten. Dahinter der imposante Eingang ins Maderanertal, und zum drittenmal nehmen wir Abschied.
Indessen auch jetzt noch zu früh. Nämlich der Rest, so kurz er ist, bringt wieder etwas Neues, den ersten Laubwald, von dem wir gleichfalls erst jetzt merken, daß wir ihn entbehrten, mit allem, was dazu gehört, Unterholz, das heißt Gebüsch, blühenden Hecken, Rosensträuchern, Singvögeln, Käfern und Schmetterlingen. Nach der Rigilandschaft eine Juralandschaft.
Es wird wohl die Wahrheit nicht umzustoßen sein, welche unsere Väter und Vorväter schon kannten und priesen, die Wahrheit, daß die Hauptsumme von landschaftlicher Schönheit der Gotthardstraße sich eng um Amsteg sammelt, daß der Gotthard an seinem allerersten Anfang unten am Fuße der Nordseite am abwechslungsreichsten ist, daß Amsteg von der Natur zu einer Hauptausflugsstation des Gotthard berufen ist, nicht minder als Brunnen für den Vierwaldstättersee.
Bei dem Worte ‹Tal› denken wir Stadtleute an sanfte Wege, welche allmählich, fast unmerklich, steigen und fallen. Dieser Vorstellungen müssen wir uns in den Alpen entwöhnen.
Was uns als der Inbegriff eines Tales erscheint, also zum Beispiel die Strecke von Amsteg nach Flüelen oder von Hospental nach Andermatt, das gilt dem Urner überhaupt nicht als ein Tal, sondern als ein ‹Boden› oder ‹Schachen›. Ein Tal fängt erst da an, wo es herzhaft bergan geht, und hört erst dort auf, wo die Mauern senkrecht werden und die Bäche stäuben. Je steiler, desto besser.
Man lasse sich doch beim Vorüberfahren das Erstfeldertal zeigen, das auf eine Länge von bloß drei und einer halben Stunde zwölfhundert Meter hinansteigt, sage zwölfhundert Meter! Also genau die Neigung und Steigung des Rigi von Weggis nach Rigi-Staffel oder von Goldau nach Rigi-Scheidegg. Wie gefällt Ihnen der Rigi unter dem Namen eines Tales? Nun, wenn der Rigi irgendwo am Gotthard stände, von überragenden Felsstöcken eingezwängt und mit Gletschern gekrönt, so würde er ein Tal heißen.
Kurz, ‹Tal› bedeutet steigen und zwar, am Gotthard wenigstens, kräftiges Steigen. Auf mindestens sechshundert Meter, also auf einen Höhenunterschied wie zwischen Weggis und Rigi-Felsentor, muß man sich überall gefaßt machen. Das braucht indessen niemand abzuschrecken. Als ziemlich verwöhnter Stadtmensch werde ich den Leser nicht über Gletscherschründe oder in unwegsame Einöden und Wildnisse verleiten. Wohin kein erträglicher und gefahrloser Pfad führt, mit einer menschenwürdigen Herberge zum Übernachten, da darf man mich nicht suchen. Ich ziehe Weißbrot dem Schwarzbrot, frisches Fleisch dem anrüchigen und ein sauberes, gutes Bett dem Heuboden entschieden vor. Entbehrungen aber und übermäßige Anstrengungen empfinde ich als Körperstrafen und zwar, wie ich mir schmeichle, als unverdiente, weswegen ich mich ihnen einfach entziehe.
Wem dies Bekenntnis zur Beruhigung noch nicht genügt, dem teile ich ferner mit, daß ich alle meine Fußreisen in Gesellschaft meines achtjährigen Töchterchens unternehme, dem sich etwa noch ein liebenswürdiges Gespielchen freundlich zugesellt, wenn Gelegenheit und Ferien günstig sind. Also, da ich meines Wissens kein Rabenvater bin, sondern von den artigen kleinen Dingerchen Ermüdung, Entbehrung und Unlust nach Kräften fernhalte, glaube ich, wo die hingelangten, unter fröhlichem Singen und Springen, dahin darf ich jedermann unbedenklich nachweisen. Für die unwegsameren Täler verweise ich auf die Schrift: «Die nördlichen Täler der Gotthardroute», von Karl Eichhorn.
Wenn wir also einverstanden sind, diejenigen Täler, welche nicht auf den Besuch von Vergnügungsreisenden mit städtischen Gewohnheiten und Bedürfnissen eingerichtet sind, einstweilen außer Betracht zu lassen, so kommen kaum mehr als vier Gotthardtäler in Frage: das Maderanertal, das Schächental, das Göschenerreußtal und Val Piora, die freilich durch den Reichtum und die Verschiedenartigkeit der landschaftlichen Schönheiten jedesmal eine kleine Welt für sich vorstellen. Denn das vor allem verleiht ja der Schweiz ihren einzigartigen Wert für den Wanderer, daß hier die Natur auf Schritt und Tritt individualisiert erscheint. Dies gleicht nicht jenem, und eines ersetzt niemals das andere.
Aber Namen haben nicht bloß ihre Bedeutung, sondern auch ihren Klang und mit dem Klange eine beträchtliche Suggestivkraft, welche mitunter irreleitet. ‹Schächental›, wem tauchen bei diesem Worte nicht unheimliche oder mindestens unfreundliche Vorstellungen auf? Man denkt unwillkürlich an schauerliche Wüsteneien. Nun, das Schächental ist das freundlichste und wohnlichste aller Gotthardtäler. ‹Val Piora›, wem wird dabei nicht italienisch zu Mute? Man sieht in der Phantasie üppige, lachende, farbige Auen. In Wirklichkeit aber ist Val Piora eine strenge, kahle Paßhöhe, dem Gotthardhospiz ähnlicher als dem Lago Maggiore. Also vor Vorurteilen, die der Namensklang suggeriert, haben wir uns hier zu hüten.
Beginnen wir jetzt von unten her, immer von einem niedriger gelegenen Tale in ein höheres hinaufsteigend.
Das Schächental
Das niedrigste, das nächste und das bequemste aller Gotthardtäler, das einzige, welches eine Fahrstraße und eine Postwagenverbindung hat, ist das Schächental. Man kann bis zuhinterst ins Schächental spazierenfahren, wie man ins Muotatal fährt, ja nächstens werden die Wagen sogar über den Klausenpaß ins Glarnerland vordringen.
Wird vielleicht das Schächental gerade deshalb, weil es so bequem daliegt, von den Vergnügungsreisenden vernachlässigt? Sehr wohl möglich. Ich erlaube mir jedoch die Bemerkung, daß die Vergnügungsreisenden Unrecht haben. Übrigens, wenn sie wüßten, was sie dort erwartet, so würden sie sich jedenfalls eifrig hinbegeben; denn das Schächental ist vom Anfang bis zum Schlusse eine wahre Fundgrube von Naturschönheiten jeder Art und jeder Stimmung: Lieblichkeit und Fruchtbarkeit bei der Gletscherwelt, Obstbäume in der Nähe von Alpenrosen. Man denke sich eines der bewohnteren thüringischen Bachtäler mit Dörfchen, Weilern und Sägen in eine Lauterbrunnenlandschaft hineingetrieben, so hat man ungefähr den Gesamteindruck des Schächentales, wie es sich mir in der Erinnerung spiegelt. In die Mitte darf man noch einen Goldauer Bergsturz setzen. Und das alles wird auch zu Fuß mit geringer Mühe und gänzlich ohne Verdruß und Langeweile erreicht. Anstatt nämlich, daß wir zu den Gletscherlandschaften hinaufklimmen müßten, kommen diese zu uns herunter; denn die sechshundert Meter Steigung, die wir von Altdorf her zurücklegen, berechtigen nicht zu Hochgebirgshoffnungen. Es ist mithin lauter Gnade und Überraschung, was uns dort hinten zufällt.
Verhältnismäßig unbedeutend wie die Steigung ist die Entfernung. Ich rechne von Altdorf bis zum Gasthof Unterschächen drei starke oder, vorsichtiger gesagt, vier kleine Stunden. Eine Entfernung, die man sich überhaupt als die regelmäßige für die Gotthardtäler merken mag; bloß das Göschenertal streckt sich noch um eine Stunde weiter. Da die Post, in Gestalt einer kleinen einspännigen Chaise, zu günstiger Zeit in Altdorf abfährt, nämlich am frühen Nachmittag, um zwei Uhr herum, so kann sie von solchen, die lieber ihre Bequemlichkeit als ihre Gesundheit pflegen, je nach Bedürfnis ganz oder teilweise benützt werden. Nur nicht jetzt, wo das Sträßchen repariert wird, denn da geht es mitunter über bedenkliche Provisorien, bei denen man sich am besten seinen eigenen Beinen anvertraut.
Da der erste Schnellzug nicht in Altdorf, sondern nur in Flüelen hält (übrigens auch in Flüelen bloß während der Sommermonate), müssen wir an letzterer Station aussteigen. Ob Altdorf oder Flüelen, bleibt sich indessen gleich, da die Entfernung von Station Altdorf nach dem Flecken Altdorf nicht viel geringer ist als von Flüelen nach Altdorf. Von beiden Stationen ist der Weg nach dem Flecken wegen der Sonnenhitze und mehr noch wegen der Sonnenblendung lästig, weshalb die Nachricht, daß sowohl die eine wie die andere Station nächstens eine Tramwayverbindung mit Altdorf erhält, von jedermann mit Freuden begrüßt werden wird.
Von Altdorf steigt man nach Belieben entweder durch die mit schattigen Alleen besetzte Landstraße oder durch Hintergäßchen neben schmucken Miniaturgärtchen und sprudelnden Bächlein gegen Bürglen hinan und erhält im Vorbeigehen den Eindruck, daß Altdorf nicht der letzte Ort wäre, den man sich zum Sommeraufenthalt auslesen möchte. Ein Städtchen, und wäre es noch so winzig und primitiv, inmitten der Gebirgsnatur, hat immer seinen Reiz. Und zwar, wohlverstanden, auch malerischen Reiz, da die satten Farben der Gartenblumen und die kräftigen kühlen Schlagschatten der Häuserreihen durch keine Naturfarben und durch keinen Baumschatten zu ersetzen sind; unbeschadet aller Wertschätzung des Naturkolorits, gegen welches ich wahrlich nicht blind bin.
Kaum haben wir Altdorf endgültig verlassen, so liegt auch schon Bürglen über uns, das wir jetzt in kurzer, jäher Straßenwindung erreichen. Bürglen mit seiner holzduftenden Säge, mit seinen natürlichen Wasserspielen und seiner weithinschauenden Kapelle kann als anziehender und, beiläufig gemeldet, außerordentlich billiger Sommeraufenthalt empfohlen werden. In der Tat pflegt es Jahr für Jahr mit anspruchslosen Kurgästen so besetzt zu sein, als es der beschränkte Raum erlaubt.
Hinter Bürglen geht es durch Obsthalden hinan und hinunter, an St. Loretto vorbei, über den Fätschbach und den Schächenbach, die sich hier vereinigen, aufs jenseitige Ufer. Der reinste Spaziergang. Bedeutsam öffnet sich allmählich die Ferne, der wir entgegenwandeln; die Schächentaler Windgälle kommt mehr und mehr zur Geltung; bald, unverhofft bald, schauen auch schon ein paar duftige Gletscher aus dem Innern des Tales hernieder. Die Proportionen des Tales sind günstig, das heißt, die Weite im Verhältnis zur Höhe der Umgebung ist weder zu eng noch zu breit, und endlich, eine Hauptsache: der Weg wickelt sich in kleinen Windungen ab, so daß man stets auf Neuigkeiten gespannt bleibt. Die Spannung wird erhöht durch die vorspringenden Kulissen der Berge, Felsen, Wiesen und Gehölze, zwischen denen man wie durch Gardinen ab und zu einen Blick aus der innern Talkammer erhascht. Kurz, man sagt sich: Wenn das so weiter geht, so kann man sichs gefallen lassen. Und es geht in der Tat so weiter: das Schächental hat keine reizlose oder einförmige Strecke.
Zweite Etappe: von der Brücke bis Weiterschwanden. Eine malerische Bachpartie im Jurastil, immerhin im Verlauf nicht so gewinnend, wie es der reizende Anfang verspricht. Bei Weiterschwanden erscheint hoch oben auf einem Hügel ein Kirchlein: das ist Spiringen, dort müssen wir hinauf. Das Poststräßchen umgeht in vielen Windungen den Hügel, um das Dorf von hinten anzugreifen; es ist also klar, daß ein Fußweg ganz beträchtliche Abkürzung gewähren würde. Es gibt auch einen Fußweg, und zwar einen hübschen, der zwischen schattigem Gebüsch hinansteigt, nur hat man Mühe, den Punkt zu erkennen, wo er von der Landstraße abzweigt. Erfragen läßt sich so etwas unterwegs schwer, weil das Landvolk hier wie überall aus lauter Respekt dem Städter die Fußwege verhehlt. Die Leute glauben nämlich, für unsereinen schickten sich bloß die ‹guten› Wege, das heißt die Fahrstraßen. Daß wir bei der Wahl den Fußweg bevorzugen würden, setzen sie niemals voraus, und wenn sies sehen, schütteln sie den Kopf. Übrigens bedeutet die Fahrstraße bei Spiringen nicht einen reinen Verlust gegenüber dem Fußweg, im Gegenteil. Deshalb möchte ich raten, auf dem einen Weg hin-, auf dem andern zurückzugehen.
Spiringen mit seinem Hinterlande bis Unterschächen hatte in alten Zeiten, vor dem Schweizerbund, eine große Wichtigkeit für Uri. Hier, nicht unten in Altdorf und Bürglen, wohnte die freie Mannschaft. Während das übrige Land wenigstens theoretisch diesem oder jenem Kloster oder Herrn Untertan war (der größte Teil dem Frauenkloster Zürich), soll das hintere Schächental stets unabhängig gewesen sein. Von der ehemaligen Blüte des Schächentales vermag sich der Besucher bei der heutigen stark zusammengeschmolzenen Bevölkerung schwer eine Vorstellung zu machen. Höchstens, daß uns noch der Volksschlag dort durch sein offenes und höfliches Benehmen eigentümlich traulich anmutet, wie ein Gruß aus einem fernen Zeitalter, ähnlich wie auch der Schwyzer Volksschlag auf den benachbarten Alpen des Muotatales gegen Glarus.
Dennoch steht die einstige hohe Bedeutung des Schächentales außer allem Zweifel. Die Herren von Spiringen, von einheimischer und zwar ursprünglich wohl von bäurischer Abkunft, nennt Oechsli neben den Freiherren von Attinghausen die bedeutendste Familie des alten Uri. Sie hatten zeitweise die oberste politische und richterliche Gewalt, das Amt des Landammanns. Die Blütezeit des Schächentals fällt in die Generation vor dem ersten Schweizerbunde. Damals war es auch, daß Spiringen, das ursprünglich zum Kirchspiel Bürglen gehörte, eine eigene Filialkirche erhielt (1290). Die noch vorhandene, in der Kirchenlade von Spiringen aufbewahrte Gründungsurkunde dieser Filialkirche bildet ein wertvolles, viel zitiertes Dokument für die Geschichte des Kantons Uri und der Schweiz.
Doch kehren wir zur Gegenwart zurück.
Spiringen ist der Mittelpunkt und zugleich der Höhepunkt des Weges. Wir haben hier die Beletage erreicht und schlendern fortan an der linksseitigen Berglehne bequem auf ebenem Wege weiter, Rank um Rank dem Schwung des Berges folgend und tief in die Winkel der Halden einbiegend, welche ab und zu einen frischen, kühlen Bach heruntersenden. Freundliche Wiesen um uns her, rechts unten, in mäßiger Tiefe, der frei vor unsern Augen liegende Talgrund mit dem Schächenbach, jenseits ein gewaltiges Bergsturzgebiet.
Endlich erschließt sich vor uns, aber nicht etwa auf einer Höhe, sondern in einer Versenkung, des Tales Kern: ein ruhiger, breiter und langer Boden, rings von hohen Bergen umschlossen, hinten mit einer steilen Wand verriegelt, an welcher ein großer, weithin sichtbarer Staubbach herunterweht. Das Bild beruhigt und befriedigt. Aber die Hauptsache erscheint erst, wenn wir vor der Haustüre des Gasthofes stehen. Nämlich rechts öffnet sich im Berge ein Spalt, und durch den Spalt schaut einer der prächtigsten und riesigsten Gletscher wie von einem Amphitheater herunter. Eine Überraschung größten Stils, die uns hinfort das Schächental mit andern Augen anschauen läßt. Bisher hatten wir das Idyll; mit dem Ruchengletscher erscheint die Größe. Ich bin kein Freund von Überschwenglichkeit, aber den Ruchen, wie er dort aus dem Brunnital herunterblickt, kann ich nicht anders als unsagbar herrlich nennen. Es steht einem vor Bewunderung der Atem still, wenn man ihn plötzlich und unvermutet gewahrt.
Und hier, Auge in Auge mit dem Gletscher, dürfen wir weilen; hier steht der Gasthof. Die Nachtruhe wird durch den allzunahe vorüberrauschenden Schächenbach vielleicht gestört werden; dennoch werden wir uns mit dem ersten Sonnenstrahl aufmachen, um dem Brunnital einen Besuch abzustatten. Ein nicht genug zu preisendes Tal, das sich da zwanzig Schritte vom Gasthof öffnet! Fast den ganzen Weg im Schatten, frisch und kühl, mit Wäldern und Alpen, Felsen und Gletschern, übrigens schmal, ein Stockwerk über das andere getürmt. Einsam, feierlich und doch freundlich, ein Heiligtum Äskulaps. Von dem Brunnital kann man sich kaum trennen.
Wenn wir nun noch den Staubbach und die Balmwand und den Klausenpaß dazu rechnen, so ergibt sich für einen Aufenthalt in Unterschächen (so heißt das Örtchen, wo der Gasthof liegt, die Heimat des Walter Fürst) eine außerordentliche Summe von Abwechslung. Mir gaukelt angesichts der seltenen Vereinigung von Lieblichkeit mit Größe folgender Name für das Schächental im Kopf herum: das Tal der vier Jahreszeiten. Das aber merke man sich: Wer in Luzern nach einem Gletscher begehrt, der findet ihn am nächsten und leichtesten im Schächental. Unzweifelhaft findet er die Gletscher in Engelberg imposanter und namentlich zahlreicher, allein nach Engelberg braucht es ein Reischen zu Wagen durch ein weites, sonniges und, offen gesagt, langweiliges Tal; nach Unterschächen dagegen spaziert man fröhlich zu Fuß. Wie leicht und mühelos, dafür ein Beweis. Ich bin mit den Kindern, nachdem wir abends zu Fuß angekommen, am andern Morgen mehrere Stunden im Brunnital herumgeklettert und gleich darauf zu Fuß bis Bürglen in einem Strich hinuntermarschiert, bei fortwährender Frische und Fröhlichkeit.
Werfen wir zum Schlusse noch rasch einen vergleichenden Blick nach dem danebenliegenden Muotatal, durch welches ehemals der vom Gotthard herabsteigende Fußreisende vom Schächental her in die Schweiz eintrat. Im ganzen betrachtet, werden wir dem abwechslungsreichen, bergansteigenden, mit Gletschern flankierten Schächental unbedingt den Vorrang vor dem topfebenen, einförmigen, düstern und mürrischen Muotatal zuerkennen. Immerhin hat das Muotatal eine imposante Eingangspforte, um derentwillen es niemals aus dem Programm des Touristen gestrichen werden wird. Auch das innere Ende des Tales bewährt seinen eigentümlichen, ich möchte sagen geheimnisvollen Stimmungswert stets von neuem. Ich bin letzten Sommer wieder dort gewesen und habe meine alte Vorliebe durchaus nicht gegenstandslos gefunden. Da kann ich nur raten, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Ins Muotatal fährt einer mit Eisenbahn und Post von Luzern in einem Tage hin und zurück. Die Anfangsstrecke des Muotatales wenigstens sollte man sich nicht entgehen lassen. Dagegen von einem Tal ins andere hinüber zu klettern, kann insofern nicht empfohlen werden, als man in derselben Zeit in der nämlichen Gegend lohnendere und weniger mühsame Pässe überwinden kann.
Nun eine kleine Stufe höher, in das weltberühmte Maderanertal.
Das Maderanertal
Beim Maderanertal unterscheide ich den Weg und das Ziel. Den Weg kann ich bei aller Größe der umschließenden Gebirge nicht als lohnend bezeichnen, weil er stets das nämliche Bild zeigt und zugleich bedeutende und andauernde Anstrengungen erfordert; das Ziel dagegen erachte ich von märchenhafter Schönheit. Wie auf einem Feenthrone steht das Kurhaus auf dem schwarzen Waldhügel, umweht von Wasserfällen und bedient von Gletschern, welche diskret hinter dem Tannenvorhang hervorblicken.
Ungeachtet seiner Nähe nimmt das Maderanertal für den Besucher mehr Zeit in Anspruch als jedes andere Tal diesseits des Gotthard, und zwar wegen folgender Umstände: Es läßt sich der Aufstieg wegen der im Maderanertal besonders lästigen Sonnenhitze nicht wohl am Nachmittag bewerkstelligen. Am Abend kommt man zu spät. Bleibt also der Morgen, und zwar kann man nicht früh genug von Amsteg aufbrechen. Erste Vorbedingung ist also das Übernachten in Amsteg, wohin man mit einem langsamen Zuge fahren muß, weil die Schnellzüge nicht in Amsteg halten. An dem nämlichen Tage hinauf und hinunter zu marschieren, wäre für Durchschnittskräfte entschieden eine zu große Aufgabe. Folglich muß auch im Maderanertal übernachtet werden. Summa: ein Ausflug, welcher zweimaliges Übernachten bedingt, wenn man ihn verständig ausführen will.
Groß und kräftig setzt der Weg unmittelbar bei Amsteg ein, im steilen Zickzack die Tannenwaldschlucht hinauf, wie man das ja von der Bahn aus sehen kann. Wenn wir oben aus dem Wald heraustreten, gespannt auf die Überraschung, so erleben wir eine Enttäuschung. Zunächst stehen wir im vollen, unerbittlichen Sonnenschein, mögen wir auch schon um vier oder fünf Uhr in Amsteg aufgebrochen sein. Ein großer, breiter und langer Talkessel, der sich ziemlich geradlinig in die Ferne streckt und stundenweit übersehbar ist, liegt vor uns. In der Tiefe desselben krabbeln die Menschen und Tiere, der unbarmherzigen Sonne ausgesetzt, vorwärts. Keine Schluchten, keine Windungen. Mehrere Weiler, durch welche wir werden schreiten müssen, überschauen wir gleichzeitig. Die umgebenden Berge, einen fortlaufenden Korridor bildend, sind gewaltig, aber einförmig und klotzig, ohne eindrucksvolles Profil, Tannenwälder zu beiden Seiten, bis zu den Berggipfeln hinauf, aber nicht in der Talsohle, durch welche wir ziehen werden. Gletscher keine. Trotz der Fernsicht vom Ende des Tales und dem Kurhaus keine Andeutung. Die Färbung des Bildes ist schwarzgrün um und um, das ganze Tal macht den Eindruck eines bäurischen Haupttales, nicht eines Seitentales.
Unmittelbar bei St. Antoni, auch solange wir durch die Dörfchen Vorder- und Hinterbristen ziehen, ist die Gegend noch spannend, besonders schön die Wehribrücke über den Kerstelenbach. Dann aber wirds erst langweilig und bald auch beschwerlich. Brücken führen wieder über den Kerstelenbach, die uns nichts angehen. Dann kommt eine, über welche wir hinüber müssen, die sogenannte Talbrücke. Hier sollte unbedingt ein Wegweiser stehen, sonst schwenkt der Tourist, wenn nicht gerade zufällig eine Karawane von Pferden und Führern ihm den Weg zeigt, nach der Golzerenalp, da er ja nicht die genaue Richtung nach dem unsichtbaren Kurhaus kennt und folglich den scheinbar begangenern und breitern Weg einschlägt. Der aber führt, wie gesagt, auf die Golzerenalp.
Nun kommt der mit Recht gefürchtete Lungenstutz, ein langer, steiler und schattenloser Abhang über dem Lungenbach, von welchem er den Namen hat. Nach meiner Ansicht die beschwerlichste Partie des ganzen Gotthardgebietes, soweit es sich um wegsame Gegenden handelt, den Gotthardpaß nicht ausgenommen. Wer freilich den Lungenstutz bei abwesendem Sonnenschein erreicht, der wird ihn spazierend hinansteigen, wie irgend einen andern Hügel auch; aber bei Sonnenschein am späten Vormittag ist der Lungenstutz ein Höllenkessel, und da der Tourist selbstverständlich schönes Wetter auswählt, da ferner der Lungenstutz in der Mitte des Tales liegt, kommt man eben meistens mit der Mittagshitze dort an.
Zugleich bietet jedoch der Lungenstutz unten an seinem Anfange die größte Naturschönheit, welche der Weg ins Maderanertal überhaupt enthält, jene malerischen, stäubenden Bachschnellen, die man überall abgebildet sieht. Oben über dem Lungenstutz stehen zwei tröstliche Wirtshäuschen, eine seltene Erscheinung in den Gotthardtälern, was sich durstige Leute merken mögen; anderswo gilt es meist, das ganze Tal zurückzulegen, ohne einzukehren. Die zweite, obere Hälfte des Tales wäre für den Fußreisenden lauter Vergnügen, wenn er nicht schon ermüdet oben am Lungenstutz ankäme: duftender Waldboden, bedeutender Rückblick auf den Krönten und die Spannörter, bald auch der reizende Anblick der waldigen Balmenegg mit dem Gasthof und dem dahinterliegenden Düßistock. Endlich, bei der Säge, müssen wir noch einmal steigen und die Kräfte auf die letzte Probe stellen.
Aber einmal angekommen, sind wir zu beneiden und noch mehr die Kurgäste. Die Sehnsucht, ich möchte sagen, der Durst nach Tannenduft ist wohl jedem erwachsenen Menschen eigen. Ein Monopol auf denselben hat Gott sei Dank keine Gegend. Mag sich desselben jeder da erfreuen, wo er ihn findet. Nach meiner Erfahrung sind Thüringen, der Schwarzwald (dieser aber vielleicht mehr noch in der Phantasie als in der Wirklichkeit), der Jura bei Solothurn, dann wieder Bern damit besonders begnadet. Indessen scheint die Bergsonne den Duft noch kräftiger zu entwickeln, was derjenige bestätigen wird, welcher Rigi-Felsentor und Rigi-Kaltbad kennt. So mächtig aber wie hinten im Maderanertal beim Kurhaus Balmenegg habe ich ihn nirgends gefunden, und ich bin doch weit in der Welt herumgekommen. Jeder Atemzug ein Genuß, jede Minute eine Erholung. Dazu die reine Bergluft (ungefähr Rigi-Kaltbad-Höhe, etwas weniger), die Gletschernähe, die Abwesenheit jeder Blendung, das herrliche Symphoniekonzert der Bäche und Wasserfälle, welche nahe genug sind, um deutlich vernommen zu werden, und weit genug, um den Schlaf nicht zu stören, abgesehen von den Ausflügen in die Hochgebirgswelt – wahrlich, der Ruhm des Maderanertales als eines Luftkurortes ist in vollstem Maße begründet.
Allein, wie gesagt, ein flüchtiger Besuch kostet verhältnismäßig mehr Zeit, Geld und Anstrengung als anderswo. Vor dem Unterfangen, an einem und demselben Tage hinauf und hinunter zu marschieren, warne ich nochmals, denn auch der Talmarsch ist anstrengend. Am richtigsten stellt man sich den Besuch des Maderanertales als eine Expedition vor, welche am besten zu Pferde ausgeführt wird. Auf die Beförderung zu Pferde ist man in Amsteg eingerichtet, vielleicht sogar etwas zu gut eingerichtet.
Jetzt einen zweiten Sprung aufwärts und zwar einen gewaltigen, vom Fuße des Gotthard auf seine Schulter, nach Göschenen durchs Göschenerreußtal auf die Göscheneralp.
Das Göschenertal
Aus den finstern, aber wohnlichen Tannenregionen gelangen wir hiemit in die einsamste, wildeste Hochgebirgswelt, in das eigentlichste Urgebiet der Gletscher und Lawinen. Lawinen von Schutt, von Stein, von Staub, von Schnee, Lawinen in allen Farben und Tonarten sind im Göschenertal zu Hause und zwar vom ersten Anfang des Tales bis zum letzten Ende. Ein riesiger Gletscher, das Seitenstück zu dem am jenseitigen Dache lagernden Rhonegletscher, schaut uns von Anfang an entgegen, am Talesende umfängt uns ein ganzer Kranz von Firnen, wie in Engelberg, nur daß die Gletscher noch bedeutend näher und tiefer liegen, weil wir um achthundert Meter höher stehen als in Engelberg, nämlich nahezu auf Rigi-Kulm-Höhe.
Mit der Höhe, der Einsamkeit und der Wildheit wächst jedoch keineswegs die Beschwerlichkeit. Im Gegenteil, was man nicht glauben sollte und was auch ich keineswegs zu hoffen gewagt hatte: der Weg von Göschenen nach der Göscheneralp ist trotz seiner beträchtlichen Steigung und seiner außerordentlichen Länge – die Bücher melden drei und eine halbe, ich rechne wenigstens vier und eine halbe Stunde – ein bloßer Spaziergang; zwar ein langer Spaziergang, welcher Gesundheit und Rüstigkeit voraussetzt, immerhin ein Spaziergang, das heißt ein solcher Marsch, bei welchem das Auge fortwährend so lebhaft unterhalten und die Wanderlust so oft von neuem aufgefrischt wird, daß die Anstrengung nicht empfunden wird. Die Höhe des Taleinganges (Göschenen selbst elfhundert Meter) und die Nähe der gewaltigsten Gletscher läßt die Sonnenhitze weniger spüren, überdies zieht sich die erste bedeutende Steigung durch entzückenden Waldschatten. Ich erlaube mir auch hier wieder Kinderbeinchen und Kinderherzchen als Beweise aufzuführen. Kein anderes Gotthardtal wurde von meinen beiden kleinen artigen Begleiterinnen so leicht, so spielend und so fröhlich überwunden wie das wilde Göschenertal. Ja, beim Anstieg blieb noch Kraft, Mut und Lust zu allerlei Allotria übrig. Fußbäder, Fröschefang, Polonaisentänze mit Ziegenherden und dergleichen überflüssiger Spuk mehr. An einem Nachmittag hinauf, am andern Morgen wieder herunter und selbigen Tags noch, zur Belohnung und süßen Nachkost, mit der Eisenbahn an den Lago Maggiore und über den Berg nach Lugano, alles ohne die mindeste Ermüdung, in fröhlichster Laune.
Auch der Zeitaufwand steht im Gegensatz zur Entfernung von Luzern, zu der Höhe des Tales und zu der Länge des Weges. Ein günstigeres Zusammentreffen von Ankunft und Abgang der Eisenbahnzüge mit der zu diesem Ausflug erforderlichen Zeit und Tageszeit ließe sich gar nicht denken. Es ist, als ob die Gotthardschnellzüge eigens für das Göschenertal eingerichtet worden wären: Mit dem ersten Schnellzug nach Göschenen, wo man um zwölf Uhr ankommt; dort findet man die Tafel zum Mittagessen gedeckt vor, macht sich um ein Uhr auf die Beine, steht in fünf Minuten mitten im Tal und ist am andern Morgen um zwölf Uhr wiederum zum Mittagessen da, wonach man mit dem Zweiuhrschnellzug nach Luzern zurückfahren kann. Also von Luzern auf die Göscheneralp und zurück erfordert nicht ganz zwei Tage, von zehn Uhr morgens bis fünf Uhr abends andern Tages.
Warum weiß der Fremde davon nichts? Warum ist das Göschenertal unbekannt, den meisten sogar dem Namen nach unbekannt? Die Antwort lautet einfach: Weil erst seit dem Sommer 1894 ein menschenmögliches Gasthäuschen dort steht, in welchem man übernachten kann. Hiemit wird sich nun die Sache bald ändern, wie denn auch in der Tat dem Schweizer Bergwanderer seit jenem Sommer der Name Göscheneralp recht geläufig ist. Die Göscheneralp ist für den Touristen eine der wichtigsten Novitäten des Jahres 1894.
Ehe ich indessen einige Worte der Schilderung versuche, glaube ich mich verpflichtet, eine eindringliche Warnung vorauszuschicken. Das Tal ist völlig einsam und der Weg weit, kein Haus steht am Wege, wahrscheinlich wird uns kein Mensch begegnen; daher heißt es am frühen Nachmittag aufbrechen. Sonst kann einer in die Nacht hineingeraten und in der Nacht, in den Hochalpen, auf primitiven Wegen, ohne genaue Ortskenntnis, da ist ein Beinbruch wohlfeil. Man gehe also bei Zeiten von Göschenen fort, lieber um ein Uhr nach dem ersten Schnellzug, als um halb drei Uhr nach dem zweiten. Ich weiß wohl, daß die Bewohner von Göschenen mitunter noch später, um vier Uhr oder sogar um halb fünf Uhr nach der Göscheneralp wandern; allein die kennen den Weg, die sind das Bergsteigen gewohnt, die ziehen überhaupt ganz anders aus als wir Städter.
Auch rastet ja der Älpler niemals, während wir im Gegenteil das Verweilen bei schönen Naturszenen als Hauptgenuß eines Ausfluges schätzen.
Ein Führer ist, bei Tag und gutem Wetter, völlig unnötig, der Weg ist überall leicht erkenntlich, überdies auch mit Wegweisern versehen. Als natürlicher Wegweiser dient zudem der Dammagletscher, der uns von Anfang entgegenblitzt und uns kaum wieder verläßt, es sei denn auf wenige Minuten.
Erste Szene: Von Göschenen nach Abfrutt. Heuduftende Wiesen mit freundlichen Häuschen im Rigistil. Neben uns, ruhig und eben dahinfließend, die Göschenerreuß, gegenüber das stattliche Waldgebirge, welches uns von der Schöllenenschlucht trennt, der ‹Göschenerwald›, durchsetzt mit mächtigen Felsplatten, die jenen für das Gotthardgebirge so charakteristischen Silberblick entsenden; es ist nicht bloß ein Leuchten oder Glänzen oder Glühen, es sind völlige Strahlensonnen und Blitzbüschel, wie von einem riesigen Blendspiegel übers Tal geworfen. Und vor uns blendet der Dammagletscher um die Wette; vor lauter Lichtfülle kaum zu sehen. Das Bild wird wohltuend durch eine Tannengruppe abgeschlossen, welche sich vom jenseitigen Walde in den Fluß hinein verirrt. Ein Plätzchen zum Ruhen und zum Schauen. Lauter liebliche Wiesen vor unsern Blicken, denen man die Lawinen nicht anspürt, welche im Frühjahr da heruntersausen.
Zweite Szene: Eine Reihe entzückender Verwandlungen, gruppiert um den Weiler Wicki. Während früher der Weg, wie ich den Karten und Beschreibungen entnehme, von Abfrutt bis ins Wicki stets die Reuß zur Linken ließ, geht er jetzt, seit ein Kurhaus auf Göscheneralp steht, über den Bach (Wegweiser); wahrscheinlich der größeren Sicherheit wegen, da auch hier Lawinen niederfahren, vielleicht zugleich, um den Wald zu benützen. Jedenfalls können wir uns mit der Neuerung einverstanden erklären. Eine reizende Bachschlucht romantischen Stils, aus welcher das Wasser zwischen Wald und Fels ruhig hervorquillt, empfängt uns, eine Szenerie wie aus dem rasenden Roland entlehnt. Von da führt uns ein mitternächtiges Wäldchen – ‹Zauberwald› tauftens die Kinder, die Älpler nennens prosaischer ‹Bohnenwald› – auf steilem Pfade links hinan. Oben erscheint auf dem gegenüberliegenden Ufer Wicki, dahinter öffnet sich eine Talspalte, die sogenannte Kaltbrunnenkehle mit der Voralperreuß.
Und nochmals geht es durch den Wald hinan, über Brücken hin und her, zunächst über die Bohnenbrücke hinüber, dann über die Lochbrücke herüber, auf hohem Steg über tosenden Wasserkesseln. Diese köstliche Waldpartie mit ihrem herrlichen Schatten und ihrem entzückenden Bachintermezzo benimmt jede Ungeduld und Müdigkeit; man schreitet jetzt voran, als ob man Lustgas geatmet hätte.
Nachdem wir den Wald endgültig verlassen, stehen wir am Fuße einer abenteuerlichen Geröllhalde, durch welche die Reuß in weißem Gischt herunterstrudelt, Schaumregenbogen um sich werfend, oben am Horizont staubsprühend, unmittelbar darüber, durch den leuchtenden Dunst, der glitzernde Dammagletscher. Links und rechts schroffe Wände, von denen bisweilen, wie mir versichert wurde, nicht ganz ungefährlicher Steinschlag herunterprasselt. Man vermeide deshalb womöglich, die Göscheneralp unmittelbar nach anhaltendem Regen zu besuchen. Die Halde hat einige Ähnlichkeit mit dem Lungenstutz im Maderanertal, ist jedoch bei weitem nicht so beschwerlich, dafür aber auch nicht so malerisch.
Dritte Szene: Das ‹Gwüest›. Ein weites, fast kreisrundes und vollkommen flaches, ödes Steinmeer, einem Delta gleich vom Gewässer in mannigfachen Bächen und Kanälen durchzogen und auf der einen Seite von wohnlichen grünen Alpen überragt. Auf den ersten Blick erkennt man, daß die Verheerung nicht durch Lawinen und Rüfenen, sondern durch Überschwemmung muß verursacht worden sein. Noch in unserem Jahrhundert grünten an der Stelle des heutigen ‹Gwüest› saftige Alpenmatten. Ein freundlicher Wegweiser, dessen Entfernungsangabe indessen mehr der wohlmeinenden Absicht, Mut zu erwecken, entspricht, als der Wirklichkeit, zeigt uns durch das wilde Labyrinth den gangbaren Pfad, auf welchem wir wie in einem Wohnzimmer eben und ohne Hindernis hinüberspazieren.
Jenseits scheint die Welt ein Ende zu haben. Ein unheimliches Steinlawinengebirge versperrt mit seinem Schutt und seinen riesigen Felsklötzen das Tal. Wo das Trümmerfeld aufhört, erheben sich glatte Felsen in der schmalen und tiefen Kluft. Zwischen Wildnis und Fels tost die Reuß. Der Weg weicht dem Trümmergebiet in einem großen Bogen aus, von hinten her an den Felsen herauf und dann weiter am andern Rande der Flühe, ein paar Dutzend Meter über den Abgrund. Das hat den Vorteil, vor den Steinlawinen einen absolut sichern Schutz zu gewähren, aber zugleich den Nachteil, daß einige Stellen passiert werden müssen, bei welchen einem dem Schwindel Unterworfenen nicht ganz behaglich zu Mute wird.
Vierte und letzte Szene: Die Göscheneralp. Ein grüner, ebener Alpboden im Talgrunde, von ununterbrochenen Gletschermassen auf drei Seiten umschlossen, wobei freilich die rechtseitigen durch die Felsmauern des Bratschiberges verdeckt werden. Aber es ist auch an den übrigen genug. Vorn der Kehlegletscher, der Dammagletscher, der Wintergletscher, links der Alpligengletscher und die Eisfelder der ‹Spitzberge›, ein ungeheures, überwältigendes, aber auch starres Panorama. Nur am Bratschiberg einiger spärlicher Baumwuchs, sonst nichts als Schnee und Eis von oben bis unten und um und um. Über den grünen Alpboden sausen im Frühling die Schneelawinen, zum Vorteil des Graswuchses, wie man mir versichert. Vor ihnen haben sich die menschlichen Wohnungen an die zwei einzigen Punkte zurückgezogen, welche lawinensicher sind oder es wenigstens zu sein scheinen. Am Anfang des Alpbodens steht das Dörfchen, am Ende desselben, zunächst bei den Gletschern, unter dem Moosstock, welcher den Kehlegletscher und den Rotfirn vom Dammagletscher trennt, das Kurhäuschen ‹Dammagletscher›. Ein bescheidenes und an Raum sehr beschränktes, doch freundliches Obdach, mit allem Nötigen versehen, so daß niemand davor zurückzuschrecken braucht, dort eine Nacht zuzubringen. Was läßt sich nun von der Wirkung der riesigen und gespenstischen Umgebung sagen? In die Bewunderung mischt sich Verwunderung, fast Verblüffung. Es ist nicht bloß Einsamkeit, sondern Totenstarre. Eine gigantische Eisgrube ohne Ton, ohne Leben, ohne Farbe, nichts als der hypnotisierende Blick des glänzenden Eises. Wo ein Fenster, wo eine Tür sich auftut, vorn wie hinten, oben wie unten im Hause, schaut einem ein Firn entgegen; herrlich im glänzenden Sonnenschein, noch schöner im schimmernden Mondlicht. Ob sich an einem solchen Platze eine Kurstation zum längern Verweilen wird entwickeln können? Das Klima jedenfalls würde es nicht verwehren, denn die Göscheneralp ist im Verhältnis zur Höhe mild; hier erweist sich der Föhn als segensvoll. Einstweilen empfehle ich die Göscheneralp als ein erhabenes Ausflugsziel und den Weg dahin als einen nicht eben mühseligen und dabei reizvollen Spaziergang. Man hat etwas Neues gesehen und erlebt, wenn man von dort zurückkommt.
Nun nochmals eine Stufe höher, zu den Murmeltieren und Adlern, diesmal jenseits des Gotthard nach Val Piora.
Das Pioratal
Da das Pioratal unsichtbar und der Weg dahin undeutlich ist, so merke man sich vor allem den Orientierungspunkt. Es ist das Dörfchen Altanca. Dort müssen wir hinauf. Altanca liegt ungefähr in der Mitte zwischen den Stationen Airolo und Rodi-Fiesso, oben auf halber Höhe an der linksseitigen Bergwand. Der natürlichste, nächste und bequemste Weg nach Altanca und Val Piora geht von dem Dörfchen Piotta. Ein zweiter, ziemlich längerer, aber ebenfalls verhältnismäßig leichter von Ambri. Da es nun keine Station Piotta gibt, sondern bloß eine Station Ambri (amtlich ‹Ambri-Piotta› genannt), so bleibt für den Touristen, der die Eisenbahn benützt, die Station Ambri (‹Ambri-Piotta›) der gegebene Ausgangspunkt. Allein in Ambri-Piotta halten die Schnellzüge nicht, Ambri ist überdies ein so primitives Dörfchen, daß es nicht zur Unterkunft dienen kann. So pflegt man den noch größern Umweg von Airolo her über Madrano und Brugnasco zu wählen. Ich billige es, Airolo zum Absteigequartier zu nehmen: es ist überhaupt das einzig mögliche weit und breit bis Faido hinunter; allein jetzt, da ich die verschiedenen Wege kenne, möchte ich raten, es wo möglich doch lieber so einzurichten, daß man sich entweder mit einem Wagen von Airolo nach Piotta befördern läßt oder mit einem langsamen Zug bis Ambri fährt. Denn der Weg von Airolo nach Altanca ist zwar im höchsten Grade pittoresk, aber ein bißchen schauerlich. Ich füge sogar mit reiflicher Überlegung nach langem Vorbedacht hinzu: nicht ganz ungefährlich. Gefährlich nenne ich einen Weg, wenn ein Straucheln oder ein Taumeln oder sonst ein leichtes Versehen den Sturz in die Tiefe nach sich ziehen kann. Da hält sich nun der Weg von Airolo nach Altanca eine lange Strecke hindurch nahe an der Grenze der Gefährlichkeit. Jedenfalls wird es nicht möglich, sich dem Landschaftsgenuß harmlos hinzugeben, man muß beständig auf seine Füße bedacht sein. Das muß man schon deshalb, weil die Beschaffenheit des Weges von fabelhafter Steinigkeit ist; das ist schon mehr ein Zyklopenpfad oder eine Ziegentreppe als ein Weg. Saumtierpfad – das Wort wäre ein Euphemismus. Man sieht zwar wohl Pferde hinaufklimmen und Menschen darauf sitzen; aber an den schlimmsten Stellen sitzen die Reiter ab und klettern zu Fuß weiter. Abgesehen hievon verdient freilich der Weg von Airolo nach Altanca lauter Preis und Bewunderung.
Man denke sich ein schmales Gesims außen an der Bergwand, das Gesims allmählich bis dreihundert Meter über dem Boden ansteigend, während unten das Tal sich gleichzeitig mehr und mehr senkt. Unter uns die immer blauer duftende Tiefe, mit dem Tessinfluß und den emsigen Eisenbahnzügen, fern für das Auge, dem Ohr nahe; man hört jedes Geräusch. Gegenüber die trotzigen Bergkuppen des rechten Tessinufers, vorn im Grunde bei Rodi-Fiesso der reizende Talschluß des Monte Piottino, darüber gegen Italien eine Bergkulisse hinter der andern, die einen in rosenfarbiger, die andern in goldiger, die dritten in purpurner Färbung. Denn wir stehen ja bereits südlich vom Gotthard, wo das Licht mit sattern Farben malt. So öde, so steinig, so baumlos, so trostlos wie im Tessin gibt es an der Nordseite überhaupt keine Gegend; aber fällt ein Sonnenstrahl darauf, so geschehen Wunder. Das Gestein verwandelt sich in Metall. Aus Bronze, Erz, Silber und Gold scheint das Gebirge gebaut, und der Ziegenpfad blitzt und funkelt unter unsern Füßen wie eine Schatzkammer. Man glaubt durch ein Eldorado zu wandern, und immer von neuem mußte ich an die Truppen des Cortez und Pizarro denken, welche in jedem spiegelnden Berge Gold zu erblicken vermeinten. Seit ich die Südseite des Gotthard kennen gelernt, halte ich eine solche Täuschung nicht mehr für unmöglich. Was übrigens dem Kanton Tessin an Baumschlag fehlt, das bringt er teilweise durch den Sommerflor wieder ein; sobald man sich in der nötigen Nähe befindet, um die kleinen Gegenstände zu erkennen. Jene scheinbar so kahlen Bergmauern des linken Tessinufers zwischen Airolo und Rodi-Fiesso, jene steilen Wände, von welchen die Dörfchen Madrano, Brugnasco, Altanca, Ronco, Deggio und so weiter herunterschauen, sind über und über mit Feldblumen bedeckt. Und alle Jahreszeiten blühen da gleichzeitig. Man wandert also in einer hohen Steinwüste zwischen Blumengirlanden über Schutt, welcher sich in Edelgesteinschlacken verwandelt. Man tue noch Insektenschwärme hinzu, lärmende Heuschrecken und Grillen, flatternde Apolloschmetterlinge und unnütze Fliegen, zur Seltenheit etwa einen Menschen oder eine Ziege, einmal auch einen schönen Kiefernwald mit riesigen Ameisenhaufen, so kann man sich ungefähr den Weg vorstellen.
Aber unmöglich kann man sich die Dörfchen vorstellen, ehe man dergleichen selbst gesehen hat. Kleine Festungen, erst bombardiert, dann verwüstet und endlich verbrannt, so ungefähr sehen sie aus. Ruinen, in welchen wir nicht einmal Hunde und Kleinvieh, geschweige denn Gesinde unterbringen würden. Die Dörfchen in der Tiefe, Ambri und Piotta, machen beim erstmaligen Anblick einen über die Maßen ärmlichen Eindruck; sieht man sie dagegen nach einem Besuch der umliegenden Bergnester wieder, so erscheinen sie einem fast luxuriös. In diesen zerrissenen, löchrigen Steinställen haust übrigens ein liebenswürdiges und, soweit ein Urteil nach flüchtigen Gesprächen erlaubt ist, zugleich intelligentes Völkchen. Nichts von dem stupiden Staunen, das wir sonst so häufig in abgelegenen Orten treffen, wo uns auf eine Frage statt der Antwort ein dummer, mißtrauischer Blick wird, wo wir den Leuten erst durch mehrmaliges lautes Rufen das Ohr öffnen müssen, bis die Aufmerksamkeit und der Gedanke schließlich zu erwachen belieben. Kein Gruß bleibt ohne freundliche Erwiderung, das Befremden drückt sich in verständigem, höflichem, hübschem Lächeln aus, sobald wir zuvorkommend das Signal dazu geben, jede Frage wird flink und sicher beantwortet, trotz unsern italienischen Sprachschnitzern, trotzdem, daß die Leute Dialekt sprechen. Und eine Hauptsache: jede Auskunft ist zuverlässig. Mag es ein Bübchen, ein Kind sein, welches uns Richtung, Weg und Entfernung angibt, die Angaben erweisen sich als richtig. Kurz, ein urbanes Völklein. Damit will ich sie nicht als kreuzbrav in jeder Beziehung rühmen; weiß der Himmel, ob sie sich nicht unter einander das Leben so sauer machen, wie sie nur können, und ob nicht die Politik auch diese Armut vergiftet. Das mag also sein, wie es will: gegen den Touristen jedenfalls sind sie von gewinnender Höflichkeit.
Das ist der Weg von Airolo nach Altanca. Der weitere Verlauf dieses Weges würde uns, wenn wir nicht nach Piora abschwenkten, am Bergeshang, stets zwei- bis dreihundert Meter über dem Tal, weiter über manche Dörfchen – Ronco, Deggio, Catto und so weiter – bis nach Faido hinunterführen, bei jedem Dorf einen Pfad nach dem Tessintale entsendend. Hinter Altanca verliert dieser Weg seinen wildromantischen Charakter, gewinnt dagegen an malerischer Schönheit und an Üppigkeit der Umgebung.
Alles wohl verrechnet, ziehe ich den Weg von Altanca über Ronco, Deggio und Quinto nach Ambri demjenigen von Airolo nach Altanca noch vor, und die Fortsetzung bis Faido spare ich mir als ein besonderes Vergnügen auf den nächsten Sommer auf.
Von Altanca nach Piora aber geht es noch gegen fünfhundert Meter in die Höhe, und zwar so steil, als man sichs nur vorstellen kann. Oben am Himmel trotzt wieder so ein Steinnest; noch höher am Horizont erscheint ein kleiner Wassersturz; das ist der Ausfluß des Ritomsees. Dort soll sich eine uralte Inschrift finden, ein Beweis dafür, daß längst vor Eröffnung des Gotthardpasses ein Paß aus der Leventina nach dem Lukmanier über Santa Maria führte. Ich habe die Inschrift nicht gefunden, allerdings auch nicht gesucht. Hinter diesem Wasserfall nun liegt das Kurhaus verborgen. Kaum haben wir den First der achthundert Meter über dem Tal sich erhebenden Bergwand endlich erreicht, so taucht schon ein Dach und einige Schritte weiter das Kurhaus aus der Tiefe. Stände es wenige Meter höher, so würde es vom Tal aus weitester Entfernung sichtbar sein wie Rigi-First.
Da liegt es nun vor uns, das Val Piora, wie ein Teller unter dem Himmel, Murmeltier-Berge ringsum, aber keine Gletscher, alles Stein. In der Mitte, unmittelbar hinter dem Kurhaus, der große Ritomsee, jenseits, in der Richtung nach dem Lukmanier, die Kapelle San Carlo, an welcher der Paß nach dem Lukmanier vorbeiführt. Statt der Wiesen und Weiden Alpenrosenfelder. Am rechten Seeufer hart beim Kurhaus einiger spärlicher Baumwuchs, eine Art Wäldchen, das von anspruchslosen Kurgästen mit dem anspruchsvollen Namen ‹Paradies› getauft worden ist. Alles in allem ein Bild, das an die Gotthardpaßhöhe erinnert.
Man kann sich zunächst nicht vorstellen, worin der Reiz dieser Gegend, die von den Kurgästen mit wahrer Begeisterung gerühmt wird, liegen soll. Doch schon nach vierundzwanzig Stunden erhalten wir, wenn anders das Wetter günstig ist, Aufschluß. Es ist die Lichtfülle, die Luftmalerei, die Klarheit der geliehenen Farben, die ununterbrochene Verwandlung des Kolorits durch Duft, Sonne und Wolkenschatten. Zu dem Metallglanz, den auch hier das Gestein aussendet, gesellt sich eine gewisse, wenn auch spärliche Blumigkeit der Gründe, die zur Alpenrosenblütezeit in leuchtendstem Rot prangen müssen; und das ganze Bild wiederholt sich in dem spiegelklaren See, welcher auch das kleinste Wölkchen haarscharf abzeichnet. Die fröhliche, ungezwungene Gesellschaft, welche hier den lieben Gottestag vertrödelt und die liebe Gottesnacht vertanzt, mag das ihrige beitragen.
Während ich in das mit Metallfarben leuchtende Gemälde den Blick versenkte, mußte ich fragen: Wo in aller Welt hast du das schon gesehen? Richtig, in der Mailänder Nationalausstellung, in den Sälen, wo die Ölgemälde hangen. Unersättlich berauschen sich die italienischen Maler immer wieder an dem märchenhaften Morgen- und Abendsonnenglanz, wie er in solchen himmelhohen Steintälern am südlichen Alpenhang zu schauen ist. Da habe ich auch das Val Piora neben manchen seiner Verwandten gesehen. Was aber Maleraugen bemerken, das darf bemerkenswert heißen.
Da meine Schilderungen einen praktischen Zweck haben, den Zweck, den am Gotthard gänzlich Unerfahrenen mit meiner bescheidenen Erfahrung zu leiten, so will ich mein Urteil über die soeben beschriebenen Täler noch einmal zusammenfassen. Zu einem kurzen Ausflug empfiehlt sich vor allem das Schächental und das Göschenertal, jenes als ein behaglicher, dieses als ein rüstiger Spaziergang, jenes in ein inniges Gletscheridyll, dieses in riesige Gletscherwüsteneien führend. Ins Val Piora klettere, wem der Gotthardpaß noch nicht steil und beschwerlich genug ist. Ein kurzer Besuch des Maderanertales scheint mir überhaupt keinen rechten Sinn zu haben. Umgekehrt liegt die Sache, wenn es sich nicht um einen Ausflug, sondern um einen Aufenthalt handelt. Da kommt in allererster Linie das Maderanertal, hierauf das Schächental in Betracht. Das Val Piora wird je nach der Vorliebe des einzelnen über oder unter die Genannten gestellt werden. Wer Hochalpen begehrt, wer sich auf einer Höhe von nahezu zweitausend Metern wohler und frischer fühlt als auf geringerer Höhe und wem der Arzt es erlaubt – der wird das Val Piora allen andern Stationen vorziehen; wer dagegen eine solche Höhe nicht verträgt oder nicht liebt, wem dunkle Gründe und Wälder Bedürfnis sind, der wird das Val Piora aus seinem Programm streichen müssen. Die Göscheneralp als Kurort zum längern Aufenthalt kann ich mir einstweilen kaum vorstellen, es müßte denn für Alpenklubisten sein.
Denken Sie sich ein Kreuz von vier Tälern und in der Mitte des Kreuzes einen gewaltigen Gebirgsknorpel, der oben selber wieder eine tiefe Einsenkung hat. Zwei der Täler laufen nach Osten und Westen, zwei nach Norden und Süden. Wenn Sie diese vier Täler mit Wegen verbinden, so erhalten Sie zwei Verbindungslinien oder mit andern Worten zwei Pässe, einen nordsüdlichen und einen westöstlichen, welche sich in dem Gebirgsknorpel schneiden und zwar in dem Punkte, wo der Knorpel seine Vertiefung hat. Falls sich an den Abhängen des Zentralknorpels rundum Quellen bilden, werden diese Quellen das Wasser nach den vier Weltgegenden senden.
Das ist das Bild des Gotthardmassivs im weiteren Sinne oder der Lepontischen Alpen, wie sie Julius Cäsar nennt. Nennen wir nun die Namen zu dem Bilde: Die Täler nach Süden und Norden heißen Leventina und Uri, diejenigen nach Osten und Westen Graubünden-Disentis und Wallis. Die Flüsse: Tessin und Reuß, Rhein und Rhone. Die Einsenkung des zentralen Gebirgsknorpels ist das Urserntal; die erhabenen Ränder des Knorpels heißen: Oberalp, Gotthard, Furka mit ihren Anhängseln. Von den beiden Verbindungslinien oder Pässen ist der nordsüdliche, also der Gotthardpaß, geographisch der wichtigere, aber historisch der zurückgesetztere, da er um nahezu tausend Jahre jünger ist als der ostwestliche (über Oberalp und Furka). Die alten Ansiedelungen im Urserntal (Hospenthal und Andermatt) sind mithin als Stationen der Graubündner- und Walliserpaßlinie entstanden und als solche zu verstehen, ursprünglich nicht als Stationen der Gotthardlinie. Die Geschichte des Urserntales läuft denn auch im Altertum mit der Geschichte Bündens und des Wallis zusammen, nicht mit der Geschichte Uris. Ja selbst Ethnographie und Geologie verknüpfen das Urserntal mit den westlichen und östlichen Nachbartälern, nicht aber mit dem nördlichen (Uri) oder mit dem südlichen (Leventina).
Wenn wir daher heutzutage vom Urner Reußtal durch die Schöllenen hinaufsteigen, so erklettern wir, historisch betrachtet, mittelst eines neuen, steilen Querpfades die Höhe einer uralten Landstraße. Wenn wir ferner vom Urserntal über den Gotthardpaßrücken nach Airolo hinabsteigen, so schneiden wir auf einem kürzeren, direkteren Wege die alte Lukmanierstraße ab, welche im Altertum die Verbindung zwischen der Nordseite und der Südseite des Gotthardmassivs, also zwischen Disentis und dem Tessintal hergestellt hatte.
Die letztere Abkürzung, diejenige über den Gotthard, hat eine ganz unbedeutende Steigung, etwas zu sechshundert Meter von Hospenthal bis zur Gotthardpaßhöhe, so daß die Ersteigung des Gotthard vom Urserntal her ein wahres Kinderspiel heißen darf, selbst schwache Kräfte nicht überanstrengend.
Lassen wir das Urserntal als ein interalpines, das in einen andern Zusammenhang gehört als in eine Schilderung des Gotthard, beiseite. Wer sich näher für dasselbe interessiert, dem möchte ich mehr noch als dieses oder jenes Buch den mündlichen Aufschluß eines ausnehmend berufenen Mannes empfehlen, des Herrn Müller auf der Furka, welcher, in Ursern daheim und zu Hause, beiderlei Kenntnisse vereinigt: die Kenntnis der Schriften und die Kenntnis des Lebens.
Während an den meisten andern Orten der Alpen ein zwei- bis dreistündiger Marsch eine Menge der verschiedensten Eindrücke erzeugt, ist zwischen Hospenthal und der Gotthardpaßhöhe das Gegenteil der Fall: ein langgestrecktes Einerlei, das nur an seinem ersten Anfang über Hospenthal und hierauf wieder gegen das Ende hin, bei der Rodontbrücke, wo vom Lucendrosee her die Reuß unsern Weg kreuzt, markante Gegenständlichkeiten aufweist. In der Zwischenstrecke Einförmigkeit. Indessen nicht langweilende Einförmigkeit; dazu ist die Gegend viel zu eigenartig. So eigenartig, daß jeder sich erstaunt bewußt wird, dergleichen nirgends gesehen zu haben. Nicht schön, nicht überwältigend, sondern verblüffend. Eine Wildnis ohne landschaftliche Größe, eine Einsamkeit ohne Andacht, lauter Wirrsal und Wüste, Morast und Moräne, Zerfall und Zerstörung. Die denkbar vollständigste Leblosigkeit; Abwesenheit von allem, was anderswo als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Auch nicht der gespenstische Todesschauer wie in der Tremola oder in der Schöllenen, der Tod selbst scheint hier eingeschlafen zu sein. Ein Gleichnis der Verwesung, eine Leichenstätte der Natur.
Angesichts dieser verwitterten Gebirgsruine, wo sogar der Granit wurmstichig erscheint, schaut man verdutzt nach einer Erklärung aus. Diese erteilt uns die Geologie: Der Gotthardberg ist ein Greis, älter als die benachbarten Gebirge, gebrochen und zusammengesunken. Nicht als ob ich aus eigener Weisheit schöpfte; ich gebe mich keineswegs für einen Geologen aus – das würde mir auch schlecht anstehen –, ich berichte nur, was ich gelesen habe, und zwar in einer meisterhaft geschriebenen Abhandlung, dem «Itinerarium» des Schweizerischen Alpenklubs vom Jahre 1871. Dort findet sich auch eine bewunderungswürdige Schilderung der Physiognomie des Gotthardgebirges. Und da ich dem Grundsatze huldige, nicht schlechter sagen zu wollen, was andere schon besser gesagt haben, will ich die bezeichnendsten Worte aus der erwähnten Schrift anführen. Der Verfasser betrachtet den Gotthard von oben, von den Gipfeln, welche die Paßhöhe überragen; gewiß ist dieser Standpunkt kein ungünstiger, im Gegenteil. Der anonyme Verfasser schreibt: «Ernst und alt, grau und zerfallen sehen die meisten Kämme aus. Fast durchweg steigen die Halden stufenlos von den höchsten Kämmen steil in die Talschluchten hinab; die Terrassen, die sicher früher nicht fehlten, sind längst durch die Verwitterung abgenutzt und verschwunden. Fast durchweg sind die Kämme, ja oft ganze Gebirgsmassen in riesige Blockhaufen aufgelöst, welche den Gang sowohl auf den Gräten wie den Halden entlang oft überaus mühsam und zeitraubend machen. Alles spricht von außerordentlichem Alter dieses Gebirges im Vergleich zu vielen, die vielleicht beim ersten Anblick weit mehr imponieren.
Sogar die beweglichen und lebendigen Ingredienzien einer Landschaft, Wasser und Vegetation, sind nicht geeignet, diese ernsten Bilder zu beleben oder zu erheitern.
An Wasser fehlt es keineswegs. Im Gegenteil sagen die zahlreichen großen Wasserrinnen und noch vielmehr die fast zahllosen Seen, welche hier reichlicher als irgendwo in der Alpenwelt ausgestreut sind, in jedem Tal, in jeder kleinen Schlucht bis hoch an die Kämme hinauf verborgen, ja an einzelnen Stellen direkt auf der Wasserscheide liegend, vernehmlich genug von den großen Strömen, welche der Gotthard nach vier Meeren aussendet. Aber auch diese Wasserbecken schauen alt und einsam aus. Meistens von ausgedehnten Mooren umgeben, welche auf früher viel größeren Umfang und selbst auf viel größere Zahl dieser Seen hinweisen, spricht ihre dunkle, stille Fläche den Reisenden fast unheimlich an. Es sind nicht die lachenden Augen einer fröhlichen Landschaft, es sind die einsamen Wassersammler, in welchen seit unabsehbaren Erdepochen die Dünste sich ruhig sammeln, welche das südliche Meer dem Nordmeer oder umgekehrt über diese vielleicht älteste Wasserscheide Europas zusendet. Sogar grüne Alptriften sind hier nicht gerade häufig. Sind auch im Hochsommer die südlichen Abhänge des Gebirges, die Alpen von Val Canaria, Val Piora und so weiter, mit reichlichem Graswuchs bis hoch an die Kämme hinauf bekleidet, so ist die Vegetation auf dem ganzen Nordabhang eine relativ kümmerliche. Die Zerrüttung des Gesteins bedeckt die Abhänge mit stundenlangen Schutthalden und läßt in den Vertiefungen durch die unablässige Durchsickerung des Bodens meist nur Torfmoore sich ansammeln. Wälder steigen in die Einsamkeit des Gotthard nicht empor. Alpenrosen, Bergerle, Vogelbeeren sind das einzige, was an größeren Hochgewächsen und wenigstens an der Nordseite gegen den Zentralkamm anzusteigen sucht; aber selbst diese bleiben bald ob Hospenthal zurück, während in Graubünden Arven und Lärchen in größerer Höhe als der Gotthardpaß noch kräftig gedeihen und die Legföhre noch weit höher steigt. Wenn die Wälder am Südabhange im Val Piora sich einst bis in die Höhe vom Lago Ritom, am Lukmanier bis auf die Paßhöhe hinauf gewagt, so ist dort nun alles abgestorben, auch der Wald ist abgelebt und grau, ein schattenloses Gewirr erstorbener Stämme und weißgelblicher Äste.»
Eine solche, auf wissenschaftlichem Grunde fußende Schilderung läßt uns, was wir sehen, auch verstehen.
Und da ich doch einmal mit dem Plündern fremden Gutes beschäftigt bin, will ich auch noch ein besonders treffendes Bild zur Kennzeichnung der Seen beim Hospiz anführen: «Sie glänzen in ihrem schwarzen Moorbett wie dunkle Kristallspiegel» (Eichhorn, Die nördlichen Täler der Gotthardroute).
Kein Zweifel und auch kein Streit: die südliche Hälfte des Paßrückens, also die Strecke vom Hospiz nach Airolo, ist der nördlichen landschaftlich unendlich überlegen. Indem ich nun meine persönlichen Eindrücke über die Südseite des Gotthardpasses mitteilen will, erheben meine Worte bloß den Anspruch von Anmerkungen zu einem berühmten Text.
Nehmen wir zu diesem Zwecke jetzt unsern Standpunkt in Airolo, so daß wir den Paß von beiden Seiten werden angegriffen haben.
Auch der Südseite ist die Kahlheit, die Starrheit und die Aussichtslosigkeit vorgeworfen worden, und mit vollem Recht. Die Schattenlosigkeit ist sogar, mit Ausnahme der Anfangspartie beim Fondo del Bosco, noch gründlicher als auf der Nordseite. Nicht so viel Schatten, um die Stirn zu kühlen. Ein wahrer Glutkessel.
Warum zieht es mich nun von allen Punkten des Gotthard gerade dahin sehnsüchtig zurück? Warum behalte ich vor allem immer den Paßrücken und namentlich die Südseite des Passes in beseligender Erinnerung? Ich finde hiefür nur eine einzige Erklärung, freilich eine triftige: die außerordentliche Lichtfülle.
Man kann beobachten, daß eines jeden Menschen Sehnsucht nach derjenigen Gegend reist, in welcher er das meiste und kräftigste Licht und die sattesten Farben wahrgenommen hat. Nordische Künstler und Dichter mögen sich, wenn sie einmal Italien oder den Orient kennen gelernt haben, mit den heimatlichen Naturfarben nicht mehr zufrieden geben; die südliche Sonne scheint ihnen zeitlebens im Gemüt. Reisende, die aus den Tropen zurückkehren, beklagen sich unaufhörlich über die Mattigkeit des europäischen Himmels. Im hohen Norden – um das Exempel umzukehren – verspüren wir Mitteleuropäer bei längerem Aufenthalt ein eigentliches Farben- und Lichtheimweh. Das ist es auch, was den freien Gipfeln, den Gletschern, den Aussichtspunkten, den Seen und Meeren ihre besondere Anziehungskraft verleiht; das ist es, was den Rigi vor jedem andern Berge auszeichnet: die Lichtfülle.
Nun stellt die oberste Tessiner Talstufe, also die Ebene von Airolo bis Rodi-Fiesso, die einem auf den ersten Blick so reizlos erscheint, die man aber je länger, desto lieber gewinnt, ein wahres Lichtreservoir vor, der darüber liegende Gotthardhang ist ein blendender Reflektor, die Paßhöhe bei klarem Wetter ein Leuchter.
Es schadet auch dem Eindruck nichts, daß er mit Mühseligkeit, buchstäblich im Schweiße des Angesichts, muß gewonnen werden. Wer hat doch gesagt, man reise nicht zu seinem gegenwärtigen Vergnügen, sondern um entzückende Erinnerungsbilder einzuheimsen? Müdigkeit und Ärger gehen vorüber, die Erinnerung bleibt. Im blendendsten Sonnenschein eines heißen Sommermorgens bin ich den Bratofen der Tremolaschlucht hinangestiegen, schwörend: «Einmal und nicht wieder.» Und siehe da, gerade dorthin zieht es mich zuerst zurück.
Unvergeßlich ist schon gleich die erste Ausbiegung der Straße gegen das Bedrettotal. Dann kommen, beim Fort Airolo (Fondo del Bosco), jene tannenbestandenen, mit Wolfsmilch übersäten Halden, durch welche der Fußpfad hinaufklimmt. Auf dieser Halde im Schatten einer Tanne auszuruhen oder auch einfach zu faulenzen, über sich den Gotthard, unten die duftige Leventina mit den neuartigen Luftfarbenspielen und um und um eine Sommerflora, die nicht mehr diejenige des neblichten Nordens ist, das habe ich mir damals beim ersten Aufstieg auf das künftige Reiseprogramm gesetzt, und diese Programmnummer wird wohl am öftesten wiederholt werden.
Vielleicht ist meine Vorliebe für jenen Abhang persönlich und wird nicht allgemein geteilt werden, muß ich doch gestehen, daß eine Landstraße im Hochgebirge schon an sich einen Reiz für mich hat. Was aber auf niemand den überwältigendsten Eindruck verfehlen wird, das ist das Tremolatal oder, wenn man lieber will, die Tremolaschlucht. Wie da in weltentrückter Einsamkeit in dem riesenhaften, öden Felsverließ einem die grünen Steinmauern der abschließenden Tremolawand gespenstisch mit metallischem Glanze entgegenblitzen, das ist ein erhabenes und zugleich phantastisches Bergwunder, wie es kein Traum abenteuerlicher erfinden könnte. Das Tremolatal ist das Trumpf-Aß des Gotthard.
Indessen auch der Paßhöhe, also dem ehemaligen Hospiz und seiner Umgebung, kann ich trotz der eingezwängten Lage nach meiner Erfahrung nur Gutes nachsagen. Es mag ja sein, daß zu einem beträchtlichen Teil die Befriedigung, die man dort verspürt, dem Gedanken entlehnt ist, hoch oben auf der beherrschenden Zentralstelle zwischen Norden und Süden, auf der Wasserscheide zwischen Reuß und Tessin und Rhein und Rhone, auf dem Trennungspunkt der germanischen von den romanischen Völkern zu stehen; – ist übrigens eine Befriedigung, die dem Gedanken entstammt, etwa weniger wirklich als eine materielle? –; immerhin erklärt das nicht alles. Die größere Himmelsnähe, die dünnere Luft, die Lichtfülle, die Farbenklarheit und der funkelnde Steinglanz haben auch ihren Teil an dem körperlichen und seelischen Wohlbehagen. Das trenne nun, wer da kann und mag.
Wie steht es um einen längern Aufenthalt oben auf dem Gotthard? Dazu scheint die Paßhöhe nach dem Urteil Erfahrener weniger zu taugen, wenigstens nicht für empfindliche Naturen. Nämlich die Paßhöhe ist windig und blendend; auch fehlt Erholungsbedürftigen im Gasthof, wo bei jeder Tages- und Nachtstunde Touristen entweder anlangen oder aufbrechen, die erforderliche Ruhe. Für einen längern Aufenthalt findet man, was man auf dem Gotthard sucht, besser im Val Piora, welches den nämlichen Naturcharakter, dieselbe Höhe und dabei eine geschütztere Lage, folglich ein milderes Klima hat. Für einen Ausflug würde ich die Paßhöhe entschieden dem Val Piora vorziehen, für einen längern Aufenthalt indessen ebenso entschieden Val Piora dem Gotthard. Damit will ich keineswegs jemand ein mehrtägiges Verweilen auf dem Gotthard widerraten oder verleiden; ich habe selbst viele genußreiche Stunden dort zugebracht und bin nur ungern von der leuchtenden Höhe geschieden.
Vom Gotthardhospiz zu reden, ohne der legendären Bernhardinerhunde zu erwähnen, würde Brauch und Sitte widersprechen. In den Ruhm derselben einzustimmen vermag ich freilich nicht. Es sind zwar stattliche, aber nichts weniger als gutmütige Bestien, nützlich, vielleicht sogar nötig, aber nicht für die Gäste. Auch erhöhen sie nicht die Nachtruhe. Einer treibt sich des Nachts auf der Straße herum, der andere im Hausgang des Gasthofes, von wo sie nun jeden vorbeiziehenden Wanderer mit doppelstimmigem Löwengebrüll begrüßen, begleiten und verabschieden. Man gewinnt dabei allerdings das tröstliche Gefühl, ruhig schlafen zu können; allein aufgeweckt zu werden, um zu erfahren, daß man ruhig schlafen könne, darauf würden wir verzichten.
Schließlich noch ein praktischer Rat. Wer zu Fuß von Airolo nach dem Hospiz begehrt, der kann der Hitze und Blendung wegen nicht zu früh am Morgen aufbrechen; sieben oder sechs Uhr ist schon viel zu spät; man sollte das Tremolatal erreichen, noch ehe einem die Sonne auf den Nacken brennt. Ein außergewöhnlich guter Läufer mag wohl auch eine späte Nachmittagsstunde zum Aufbruch wählen, eine fröhliche Gesellschaft meinetwegen sogar eine Mondnacht. In der Zwischenzeit von sieben Uhr morgens bis vier oder fünf Uhr nachmittags dagegen ist der Fußmarsch von Airolo auf den Gotthard bei schönem Wetter der Hitze wegen eine wahre Qual. Wagenpartien, auf welche sowohl Airolo als Hospenthal und Andermatt vorzüglich eingerichtet sind, sind natürlich weniger an die Tageszeit gebunden; doch fährt man von Airolo meistens am Abend auf den Gotthard, und solch ein Brauch hat gewöhnlich seine trefflichen Erfahrungsgründe. Man schließe sich ihm also an.
Während man vielfach anderswo im Zweifel schweben kann, ob die Fußpfade auch wirklich die gehoffte Abkürzung bringen, so ist diese Frage zwischen Airolo und dem Hospiz nachdrücklich zu bejahen. Die Abkürzungen sind hier ganz beträchtlich, sie mögen einem wohl einen Viertel, vielleicht sogar einen Drittel des Weges ersparen. Überdies gewährt der Fußpfad in der Anfangspartie mehr Schatten und Abwechslung; und auch später, bei den Windungen der Tremolaschlucht, ist der Fußweg, wie abscheulich er auch scheinen mag, vorzuziehen, wenigstens beim Aufwärtssteigen, wo die Gefahr des Strauchelns im Schutt und Geröll geringer ist als in umgekehrter Richtung. Nämlich das zeitweilige Umtauschen der Landstraße gegen einen noch so schlechten Weg gewährt dem Fuß Erholung, indem dabei andere Muskeln in Anspruch genommen werden.
Auf dem Nordabhang (also zwischen dem Hospiz und Hospenthal) gibt es keine erheblichen Abkürzungen durch Fußwege, begreiflich, da bei der geringen Steigung die Landstraße selber meist geradlinig läuft.
Immer von neuem muß man darüber nachsinnen, warum der kürzeste und direkteste aller Alpenpässe (also der Gotthard) zuletzt entdeckt und benützt worden ist, ein Jahrtausend später als die übrigen. Hatten denn die Römer, hatten die Longobarden und Alemannen eine Binde um die Augen, daß sie den Gotthard nicht sahen? Den Gotthard nicht zu sehen, wäre jedenfalls ein Kunststück gewesen. Namentlich für jene, welche an seinem Fuße, ja auf seinen Schultern saßen. Bellinzona war eine römische Truppenstation. Den Lukmanier, welcher seitwärts am Gotthard vorbeiführt, kannten die Römer so gut wie wir. Stalvedro und Airolo, unmittelbar am Südfuße des Gotthard gelegen, waren schon vor Karl dem Großen da, Airolo hatte sogar ein Kloster. Aus nächster Nähe von Airolo führten zwei uralte Pässe über Val Piora und Val Canaria, beide geologisch zum Gotthardgebirge gehörend. Val Piora ist aber weit schwerer zu entdecken, als der eigentliche Gotthard, da es hinter einer steilen Bergmauer verborgen liegt, während der Gotthard sich unmittelbar hinter Airolo mit einer breiten, bequemen Halde einladend emporzieht. Ebenso war seit uralten Zeiten die Nordseite des Gotthard, das Urserntal, bevölkert. Dort zogen ja von jeher die Wanderer aus dem Wallis und dem graubündischen Rheintal durch, über die Furka und die Oberalp. Dort gründeten zum Beispiel die Römer ein Furkahospiz: Hospitaculum, jetzt Hospenthal. Dort finden wir auch eine der ältesten Kirchen, Andermatt. Hospenthal liegt aber womöglich noch näher am Gotthard als Airolo, beinahe auf dem Gotthard. Von Hospenthal bis zur Gotthard-Paßhöhe sind es nicht einmal drei Stunden, in einem ziemlich breiten Tobel, mit einer sanften Steigung von nicht einmal halber Rigihöhe.
Was einem gehört, was einer besitzt, das pflegt er auch zu untersuchen. Der Gotthardberg gehörte zu seinem größten Teil zu Ursern, hieß auch einfach Ursernberg bis gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts. Und ihren eigenen Ursernberg sollten die Ursener nicht gekannt haben? Was aber die Ursener kannten, das konnte der übrigen Welt nicht verborgen bleiben in Anbetracht der Unzahl von Wanderern, welche das Urserntal durchzogen.
Kein Zweifel, der Gotthardberg war den Alten bekannt, stand ihnen offen und wurde von ihnen zum Übergang von der oberen Leventina nach Ursern (und umgekehrt) benützt. Und da er zu diesem Zweck keinen Konkurrenten hatte, wird sogar ein Pfad hinübergeführt haben, primitiv, aber gangbar, etwa in dem Zustande, wie heute der Pfad ins Val Piora. Kein Zweifel aber auch, daß es keinem Menschen im weiten römischen Reich und außerhalb desselben einfiel, den Gotthard als einen internationalen Paß, als einen Weg von Italien nach der Schweiz und Deutschland, als eine Brücke zwischen Nordeuropa und Südeuropa zu benützen, wie etwa den Lukmanier oder Septimer oder Splügen oder den Simplon. Warum nicht? Hiefür sind Erklärungen gesucht und auch gefunden worden. Ich will sie mitteilen.
Für die Römer kamen die Alpenpässe in erster Linie als Militärstraßen in Betracht. Der Gotthard aber ist eine Sackgasse für eine Armee, solange keine Axenstraße von Flüelen ins offene Land leitet. Das hat zweitausend Jahre später Suworow erfahren. Zu einer Axenstraße jedoch hatten die Römer keinen Anlaß, da die Zentralschweiz sie nicht interessierte. Das Mittelalter wieder, in der Straßenkonstruktion des Himmels und der Hölle besser bewandert als in der irdischen Zementierkunst, bediente sich auf Erden lieber der vortrefflich erhaltenen, solid gemauerten Heidenstraßen, als daß es neue versucht hätte. Mithin benützten sie auf dem Wege durch die Schweiz nach Italien die alten Graubündner- und Walliserpässe. Endlich, nicht zu vergessen, der Gotthard war und ist und bleibt der gefährlichste aller Alpenpässe, wovon freilich keine Ahnung erhält, wer gegenwärtig auf der glatten Poststraße eines schönen Sommermorgens von Hospenthal nach dem Hotel Prosa spaziert. Allein erkundigen Sie sich einmal in den Unfallsregistern. Der Gotthardpaß hat jedes Jahrhundert mehr Menschenleben gekostet als der Goldauer Bergsturz. Förmliche Katastrophen: hundert, ja Hunderte von Wanderern auf einmal von Lawinen erschlagen, das ist gar keine so große Seltenheit. Noch in der allerletzten Zeit des Postverkehrs, in der sichersten Zeit, als längst die Poststraße mit allen erdenklichen Schutzvorrichtungen bestand, geschahen in einer einzigen Novemberwoche des Jahres 1874 folgende Unglücksfälle allein zwischen Hospenthal und Airolo: Ein Mann in der Nähe des Hospizes erfroren aufgefunden. Ein Postkondukteur in der Tremola von einer Lawine erschlagen. Hundert Italiener zwischen Hospiz und Hospenthal von einer Lawine weggerissen, davon fünfundneunzig wieder heil herausgezogen, fünf tot. Solches innerhalb zehn Tagen auf einem begrenzten Teil des Gotthardpasses. Und Osenbrüggen, der uns das meldet, setzt hinzu: «Solche Fälle erregen kaum großes Aufsehen». Sie waren demnach etwas ziemlich Gewöhnliches. Übrigens beschränkte sich die Gefahr keineswegs auf den Gipfel, auf den Paßrücken. Vielmehr war dem Gotthardpaß eigentümlich, daß er während drei Tagereisen fast ununterbrochen durch Gefahren, Schrecknisse und entmutigende Mühseligkeiten verlief, nämlich von Giornico bis Amsteg. Denn auch einzelne Strecken der Leventina galten für schlimm, zum Beispiel die Biaschina, das heißt der Steinkessel zwischen Giornico und Lavorgo, der noch in einer Urkunde des Jahres 1560 ‹gefährlich› genannt wird. Nun findet der Mensch wohl leicht den Mut, an einer oder an einigen Stellen der Gefahr zu trotzen; dagegen eine dreitägige Schlacht des wehrlosen Menschen mit der Natur, die heimtückisch aus dem Hinterhalte droht, die schlägt selbst dem Mutigsten auf die Nerven. Das alles erklärt viel. Nur eines nicht, die Hauptsache.
Es erklärt nicht, warum nicht schon im Jahre 200 oder 600 oder 1100 eintrat, was im Jahre 1200 eingetreten ist: nämlich die Benützung des Gotthardpasses trotz allen Hindernissen und Gefahren. Es gibt ja einen Stand, der die Gefahr überhaupt nicht in Anschlag bringt (namentlich die Gefahr anderer), den Handelsstand. Geben Sie meinetwegen hundert Lawinen mehr und dafür fünf Prozent Frachtspesen weniger, so wird der Verkehr zunehmen. Nun waren die lombardischen Städte Norditaliens von alters her Handelsstädte, welche kaufmännische Verbindungen mit den Städten am Rhein, später sogar mit Luzern unterhielten und deren politisches Machtgebiet bis dicht an den Gotthard reichte. Warum benützten auch diese nicht den Gotthardpaß?
Das werden Sie sofort einsehen, wenn Sie sich die Frage stellen: Wohin führt denn eigentlich von Natur der Gotthardpaß? Etwa nach Uri und dem Vierwaldstättersee? Warum nicht gar! Sondern nach Ursern und von dort über die Furka ins Wallis oder über die Oberalp nach Graubünden. Zwischen Ursern an der Matt und Uri ist ja die Welt mit Mauern verriegelt, so daß höchstens die Reuß in einer engen Spalte sich hindurchzuzwängen vermag, an einer Stelle, wo ihr das kein Mensch nachmacht. Das ists; das ist die einfache Erklärung des Gotthardrätsels. Nun sehen Sie leicht ein, warum der Gotthardpaß keine andere Bedeutung haben konnte als eine örtliche. Denn da der Gotthard auf einem großen Umweg nach Disentis oder Brig führte, so hatte es keinen Sinn, den Umweg dem direkten Weg vorzuziehen, namentlich, wenn der direkte Weg eine schöne Straße vorstellte, der Umweg dagegen einen schlechten Pfad. Ich werde doch nicht, wenn ich aus dem Tessin bequem über den Lukmanier direkt nach Disentis gelangen kann, erst über den Gotthard nach Ursern klettern und hernach noch über den Oberalppaß? Oder wenn ich auf guter Straße über den Simplon direkt nach Brig komme, erst die ganze Leventina hinaufsteigen, dann über den Gotthard, dann über die Furka und schließlich das Wallis hinab? Ja, wenn einmal jene Wand zwischen Ursern und Uri fiele oder überwunden werden könnte, so daß Uri zugänglich würde, dann wäre es mit einem Schlage etwas ganz anderes. Dann wäre der Gotthard ein internationaler Paß von Süden direkt nach Norden. Dort am Bätzberg und Teufelsberg bei Ursern an der Matt, dort lag das Gotthardproblem. Dort befand sich das Tor. Allein das Tor war von der Natur geschlossen, und die Natur hatte den Schlüssel nicht daneben gelegt. Den mußten Menschenwitz und Menschenkunst erst ausklügeln und anfertigen. Viele Jahrhunderte wollte das nicht gelingen. War denn das Hindernis nicht irgendwie zu umgehen? Gewiß. Aber nur auf solchen Umwegen, welche unendlich viel mühsamer, zeitraubender und gefährlicher waren als der Gotthard selbst, zum Beispiel von Realp über die mehr als 2700 Meter hohe Alpligenlücke nach der Göscheneralp, oder links von der Reuß um den Bätzberg herum, oder rechts über den Teufelsberger Gütsch in die Schöllenen hinab.
Ausnahmsweise, wenn irgend eine Not zwang, dann gings schon. In vorhistorischen Zeiten haben ganze Völker auf der Wanderschaft einen Durchschlupf über die Berge zwischen Ursern und Uri gefunden, im Suworowzug russische und französische Regimenter. Dasselbe werden zu jeder Zeit Boten mit dringender Botschaft vermocht haben oder Hirten auf der Suche nach einem Arzt oder Priester, wahrscheinlich auch einzelne Pilger. Aber eine Möglichkeit ist noch lange kein Weg. Und einen Weg von Andermatt nach Göschenen über die Schöllenen kann es nicht gegeben haben, nicht einmal den primitivsten Pfad, sonst wären nicht die Schicksale von Uri und Ursern so gesondert gelaufen, als lägen beide in verschiedenen Weltteilen. Wie durch ein Weltmeer geschieden entwickelten sich Uri und Ursern völlig unabhängig von einander, obschon nur eine Wand sie trennte.
Nun können wir uns leicht vorstellen, daß Ursern je länger desto lebhafter den Wunsch verspüren mußte, die von der Natur verwehrte direkte Verbindung mit Uri zu erzwingen. So lange freilich Uri nur spärlich bevölkert war, also etwa bis gegen das Jahr 1000, mochte die Trennung verschmerzt werden. Als sich jedoch nach und nach unten im Reußtale eine volkreiche Genossenschaft mit Dörfern und Kirchen ausbildete und die Ansiedelungen bis nach Göschenen hinaufdrangen, mußte der Wunsch sich gebieterischer regen. Nachbarn nicht ausstehen zu können, ist menschlich, dagegen vom Nachbarn gänzlich abgesperrt zu bleiben, das erträgt der Mensch auf die Dauer nicht. Endlich – es wird wahrscheinlich im zwölften Jahrhundert gewesen sein – fand Ursern den Rank, in die Schöllenen zu dringen. Und zwar sogleich den richtigen, der hinfort im Prinzip beibehalten worden ist bis heute und bis in alle Zeiten, weil er der natürlichste war. Göschenen liegt dreihundert Meter tiefer als Andermatt. Die bisherige Auskunft, im Notfall über einen Berg zu klettern, um die Tiefe zu gewinnen, war unnatürlich. Wie, wenn man das Beispiel der Reuß nachahmte, welche sich einfach in den Trichter der Schöllenen hinunterstürzt? Das hatte immer unmöglich geschienen. Aber jetzt bei dem dringenderen Bedürfnis nach einer Verbindung wußte mans zu ermöglichen. Da ein Pfad zur Seite der Reuß von vornherein ausgeschlossen war, weil der Reußkatarakt den Felsenspalt ausfüllt und mit wilden Wirbeln sich überwälzend die Mauern peitscht, da es ebenso unmöglich war, in den jäh zur Tiefe fallenden Strudeln ein Gestell zu gründen, da ferner die Kunst, einen Weg durch den harten Felsen zu hauen, also der Tunnelbau, damals noch nicht verstanden und geübt wurde, so blieb nur das eine, und dieses eine wurde ausgeführt: in der Luft über der Reuß um die Felsen herum, Haken in den Felsen gerammt, Ketten daran und zusammengefügte Balken in die Ketten. Also, wenn man will, eine Brücke, nur mit dem Unterschied, daß diese Brücke nicht von einem Ufer zum andern führte, sondern mit dem Flusse über dem Wasser lief, und zwar auf eine beträchtliche Strecke, der Länge der Felsklus entsprechend, wahrscheinlich gegen hundert Fuß oder noch mehr. Dabei spritzte der Gischt, Dampf und Staub der tobenden Wirbel von unten her bis über die Brücke, weshalb sie die ‹Stiebende Brücke› getauft wurde. Mit der Stiebenden Brücke war Uri geöffnet; denn das Innere der Schöllenen bot verhältnismäßig geringe Schwierigkeiten. Eine Anzahl Brücken mußte selbstverständlich erstellt werden, um die Windungen zu gewinnen, welche der steile Stutz erheischte. Einige Stege werden übrigens schon vorhanden gewesen sein von Uri, speziell von Göschenen her, Brücken mit allerlei Namen und Doppelnamen, die mit der Zeit wechseln: ‹Vordere Brücke›, ‹Länge Brücke›, ‹Sprengibrücke›, ‹Teufelsbrücke›, Brücken wie alle Brücken, nicht widerspenstiger als andere. Lassen Sie sich durch den grusligen Namen ‹Teufelsbrücke› nicht imponieren. Es ist ein Name aus zweiter Hand, ein abgefärbter Name. Es gibt dort einen Teufelsberg und allerlei Teufelstäler, die allerdings teuflisch genug aussehen. Die Felsteufel nun haben der Brücke zu Gevatter gestanden, nicht ein besonderer Brückenteufel. ‹Teufelsbrücke› will nichts anderes sagen als die Brücke unterhalb des Teufelsberges. Nachträglich wurde dann natürlich ein Volkssäglein zum Namen hinzugetüftelt, ein nüchternes klapperdürres Legendlein ohne den mindesten poetischen Wert, wie das Pfaffensprunganekdötchen. Darf ich eine Vermutung wagen, wer solche Pfaffensprünglein und Teufelsstückchen ersonnen haben mag? Die Führer und Träger, Säumer und Strahler, welche gescheit genug waren, zu merken, wie gierig die Fremden nach Lokalgesetzlein angelten, und pfiffig genug, zu erraten, daß ein gekurzweilter Reisender splendider löhnt als ein gelangweilter.
Die Teufelsbrücke war zwar eine sensationelle Szenerie, wo einem bei der Nähe der donnernden Reuß Hören und Sehen vergehen mochte, aber sie war weder schwierig zu erstellen noch gefährlich zu passieren. Selbst die alte, die untere nicht. Die Reuß ist dort äußerst schmal; über schmales Wildwasser aber einen Steg zu schlagen, das haben selbst die primitivsten Völker zu allen Zeiten verstanden. Wollen Sie einen überzeugenden Beweis von der Harmlosigkeit der Teufelsbrücke? Als Suworows Truppen die Teufelsbrücke von den Franzosen zerstört fanden, sprangen sie einfach ins Wasser und kletterten aufs andere Ufer. Vollends im Vergleich zur Stiebenden Brücke ist die Teufelsbrücke gar nicht der Rede wert. Es war auch gar nicht von ihr die Rede, solange die Stiebende Brücke bestand. Wenn Sie trotzdem soviel Aufhebens von der Teufelsbrücke gehört und gelesen haben, so kommt das daher, daß alle ausführlichen Reiseschilderungen aus einer Zeit stammen, da die Stiebende Brücke bereits verschwunden war und der Name Teufelsbrücke schon falsch ausgelegt wurde.
Es ist wahrscheinlich, daß die Stiebende Brücke ursprünglich bloß dazu dienen sollte, Ursern mit Uri zu verbinden. Allein da mit der Verbindung dieser beiden Täler zugleich dem Ursernberge ein Ausgangstor nach Norden geschaffen wurde, erlangte der Ursernberg jetzt plötzlich eine ungeahnte Bedeutung: als eine Brücke zwischen Norden und Süden. Damit war er zu einem internationalen Paß berufen. Und dieser Paß war auch schon fertig, da ja sämtliche Einzelstrecken desselben mit Ausnahme der Schöllenen von jeher gangbar waren und auch begangen wurden. Wie ein Gürtel, dem nur die Schnalle gefehlt hatte. Die Schnalle wurde gefunden, und sofort tat der Gürtel seinen Dienst. Wir können demnach ohne Übertreibung sagen: Die Stiebende Brücke hat den Gotthardpaß erfunden. Und die schauerliche Tremolaschlucht? überhaupt der Paßrücken? hat sich dort keine Schwierigkeit gezeigt? Es scheint dies wirklich nicht der Fall gewesen zu sein, weder anfangs noch später. Das schließe ich daraus, daß uns zwar unendliche Lamentationen über die mühseligen Wegreparaturen in Uri und in der Leventina aus den geschichtlichen Urkunden entgegentönen, dagegen keine über die Wegreparaturen in der Tremola.
Nun wüßten wir gerne etwas Näheres über Zeit und Umstände der Erbauung der Stiebenden Brücke. Zu unserm Bedauern meldet uns die Geschichte hievon nichts, auch nichts von den übrigen wichtigsten Anfangsmomenten des Gotthardpasses, nichts von der Gründung der Kapelle auf der Paßhöhe, nichts von dem Datum, da der Ursernberg seinen Namen in Gotthardberg umtauschte, nichts davon, welche Generation sich zuerst des neuen Passes bediente. Unversehens finden wir die vollzogene Tatsache eines internationalen Gotthardpasses vor, ohne daß uns gemeldet würde, wie und wieso und seit wann. Ohne Sang und Klang, ja sogar ohne die kleinste Notiz in den Annalen tritt der Gotthardpaß ins Dasein. Das hätten wir besser gemacht, nicht wahr, wenn wir damals gelebt hätten? Was für pompöse Eröffnungsfeierlichkeiten hätten wir in Szene gesetzt! was für ‹zündende Reden› abgefeuert! was für begeisterte Toaste geschleudert! was für eine Unmasse abstrakter Substantive verpufft! Ehrenjungfrauen und Blechmusiken wären aufmarschiert zwischen den Flaggen aller Nationen auf der mit Alpenrosen und Edelweiß aufgeputzten Paßhöhe. Das Ganze hätte in ein riesiges Bankett gemündet, wo der Lorbeer wohlfeil war und der Ehrenwein gratis, und die ‹Festwogen› wären ohne jeden Zweifel ‹hoch gegangen›. Das alles entbehrte also der junge Gotthardpaß. Wenn mich etwas über den Verlust tröstet, so ist es das: Wir hätten unfehlbar den Gotthardpaß ‹eine Bürgschaft des Friedens› genannt und hätten damit eine fürchterliche Dummheit gesagt; denn der Gotthardpaß wurde der Kriegspfad der Eidgenossen. In Ermangelung einer Ehren-Eröffnungs-Erinnerungs-Festmedaille oder vielmehr Eröffnungsfest-Erinnerungs-Ehrenmedaille – oder wie sagt man eigentlich? – kurz: in Ermangelung einer Medaille, auf welcher wir die Jahreszahl ablesen könnten, sind wir darauf angewiesen, das Anfangsdatum des Gotthardpasses mit Gedankenketten auszurechnen, folgendermaßen:
Irgend einmal – das kann nicht fehlen – muß der Gotthardpaß zufällig in der Geschichte zum erstenmal erwähnt werden. Diese erstmalige Erwähnung zu finden ist natürlich kinderleicht. Die Frage ist nur die: Wie lange wird der Paß schon benützt worden sein, ehe er zufällig erwähnt wurde? Bei den alten römischen Pässen (Simplon, Splügen, Septimer, Lukmanier, Furka, St. Bernhard und so weiter) ist es möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß sie schon viele Jahrhunderte vorher benützt wurden, bevor wir etwas von ihrer Benützung erfahren. Beim Gotthard im Gegenteil muß die erstmalige Erwähnung mit der erstmaligen Benützung nahe zusammenfallen, gerade weil der Gotthard sich der Menschheit verspätet aufschloß. Denn wenn die tatsächliche Eröffnung eines Passes in eine späte Epoche Europas fällt, wo schon auf beiden Seiten der Alpen volkreiche, hochentwickelte Kulturstaaten aus gediehen sind, die einen lebhaften Verkehr untereinander über die Alpen pflegen, so muß der unerwartete Aufschluß eines neuen zentralen Verkehrsweges ein gewisses Aufsehen erregen. Das Ereignis muß sich rasch herumsprechen, und eine Menge verschiedener Interessen wird sich unverzüglich hinzudrängen. Die Benützung kann keine zaudernde, langsame, allmähliche gewesen sein, Tröpflein um Tröpflein, hernach Bächlein zu Bächlein bis zum Strom, sondern so, wie wenn die Ameisen unverhofft ein neues Loch zur Speisekammer erspüren: sofort in stetigem Zuge. Ein stetiger Verkehrszug großen Stils, ein europäischer, internationaler Verkehrszug kann wieder nicht Jahrhunderte lang, ja nicht einmal manche Jahrzehnte lang bestehen, ohne Verkehrsinstitutionen (Herbergen, Krankenhäuser, Kapellen und so weiter), Verkehrsorganisationen und neue Rechtsverhältnisse ins Leben zu rufen, mit andern Worten, ohne Spuren oder Dokumente in der Geschichte zu hinterlassen. Folglich kann die Erschließung des Gotthardpasses kaum ein Menschenalter früher geschehen sein als damals, da wir zum erstenmal eine Spur des Passes entdecken.
Die erste Spur von dem Vorhandensein eines internationalen Gotthardpasses ist nun die Gründung des Lazaristenhauses in Seedorf, denn man stellt keine großartige Pilgeranstalt an einen Ort, wo keine oder nur vereinzelte Pilger durchziehen. Die Gründung des Lazaristenhauses fällt vor 1250. Das Jahr ist unbekannt. Da nun eine fromme Stiftung nicht zugleich mit dem Bedürfnis darnach zur Hand zu sein pflegt, sondern auf sich warten läßt, so wird ein bedeutender Pilgerverkehr schon einige Zeit vor dem Lazaristenhaus stattgefunden haben. Folglich datiert der Anfang des internationalen Gotthardverkehrs, mit andern Worten die tatsächliche Eröffnung des Gotthardpasses, in die ersten Jahrzehnte des dreizehnten Jahrhunderts. Das muß aber zugleich das Datum der Stiebenden Brücke sein, weil sie ja den Gotthardpaß aufschloß. Dieser Gedankenrückschluß wird als richtig gelten dürfen, wenn sich in der angenommenen Anfangszeit noch andere Spuren zeigen und wenn diese Spuren sich fortan rasch mehren und klären. Und das ist allerdings der Fall. Im Jahre 1236 wird uns schon eine Art primitiver Bädeker des Gotthardpasses beschieden. Ein norddeutscher Abt nämlich erteilt Anweisung, wie man von Bellinzona nach Luzern gelange, und sagt ausdrücklich: über den Ursernberg. Vier Jahre später, also anno 1240, reist eine Deputation Schwyzer, wahrscheinlich mit kriegerischer Mannschaft, über den Gotthard nach Italien zum Kaiser, und zwar im Winter und ohne daß von der Reise Aufhebens gemacht würde. Es kann mithin im Jahre 1240 der Weg über den Gotthard nicht mehr eine Neuigkeit oder ein außerordentliches Wagnis gewesen sein.
Sie sehen also, die Annahme des Jahres 1200 oder etwas später für den Anfang des Gotthardpasses stimmt vortrefflich. Gegen das Ende des dreizehnten Jahrhunderts ist dann der Gotthardpaß bereits eine weltbekannte Tatsache, zugleich ein Faktor, mit welchem die Handels weit rechnet. Wir hören jetzt von Warenballen, die von italienischen Kaufleuten über den Gotthard dirigiert werden sollen (1291). Wir vernehmen, daß die Habsburger Lokalzölle auf dem Gotthardwege schon erkleckliche Summen abwerfen.
Unter solchen Umständen konnte der Gotthard schließlich nicht mehr anonym bleiben. Denn ‹Ursernberg› war ja kein Name, sondern nur ein Notbehelf. Im Jahre 1303 erscheint wirklich der Name. Und zwar lautet er, wohlbemerkt, sofort ‹Sankt› Gotthard, stammt also von dem Heiligen, dem die Kapelle auf der Paßhöhe geweiht war. Jede andere Erklärung des Namens ‹Gotthard› ist demnach unstatthaft, obwohl wir nicht begreifen können, wieso der fremde, im Jahre 1131 kanonisierte Mönch zu der Ehre gelangte, einer Kapelle auf dem Ursernberge als Schutzpatron zu präsidieren.
Glauben Sie an das Anekdötchen, daß die Kapelle von einem gichtkranken Azzo Visconti von Mailand zur Linderung seiner Fußschmerzen gestiftet worden sei? Sie wird vielmehr von dem Kloster stammen, dem der Ursernberg gehörte, von dem Kloster, welches auch die Lukmanierkapelle Santa Maria erstellte, von dem Kloster Disentis. Eine Kapelle ist übrigens noch kein Hospiz. Das Gotthardhospiz entsteht erst mehrere Jahrhunderte später.
Nachdem der Paß zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts einen Handelsverkehr, einen Namen, einen Heiligen und eine Kapelle gewonnen hatte, fehlte ihm zur offiziellen Sanktion nur noch eines, eine Steuer. Die erschien denn auch bald (1313) in der Gestalt eines Reichszolles in Flüelen. Nunmehr war der Paß perfekt. Überhaupt fängt man im vierzehnten Jahrhundert an, den Paß finanziell auszubeuten. Es entsteht eine Fremdenindustrie nach allen Regeln, in welcher Urner, Ursener und Liviner miteinander wetteifern. Unter diesen hatten anfänglich die Ursener einen Vorsprung, da sie seit vielen Jahrhunderten schon, infolge des Verkehrs vom Wallis nach Graubünden, im Transportdienst geübt waren. Ohne Zweifel waren sie die Lehrmeister der Transitorganisation, wie sie nun nach dem Muster der alten Bündner Portengemeinschaften von einem Fuße des Gotthard bis zum andern eingeführt wurde. Da war alles geordnet, vorhergesehen, monopolisiert und tarifiert: der Preis der Waren, die Personentaxen, die Grenzen des Wirkungskreises jeder ‹Teilergesellschaft› und so weiter. Alles spielte einander einträchtig in die Hände – bis es Streit gab, wobei bekanntlich Uri nach und nach mit Hilfe der Eidgenossen die anderen Täler niederzwang, so daß es schließlich als der alleinige Gotthardkanton dastand. Die Organisation hatte für den Paßverkehr den Vorteil, eine Kostenvorausberechnung zu ermöglichen, eine der wichtigsten Vorbedingungen des Handels. Überdies verbürgte sie Sicherheit der Personen und Waren, wenigstens in normalen Zeiten. In Kriegszeiten mochte es freilich auf dem Gotthardpaß weniger pünktlich und geheuer zugehen. Und da der Gotthard bald den Eidgenossen zu periodischen Kriegszügen nach dem Süden diente, mag das den Gotthardverkehr kaum gefördert haben.
Immerhin hören wir nicht viel von Stockungen oder Beraubungen. Im Gegenteil werden idyllische Charakterzüge gerühmt. Die Pferde der Reisenden durften längs der Straße grasen, und den Trägern und Führern war verboten, Trinkgelder zu fordern. Ein sympathisches Verbot, das mich jedoch nicht rührt. Gibt es doch so viele Mittel, ein Trinkgeld derart nicht zu fordern, daß es von selbst kommt! Übrigens mit oder ohne Trinkgelder: die vortreffliche Organisation des Gotthardverkehrs hatte von Anfang an einen Hauptfehler: sie war viel zu teuer. Sei es nun wegen der zu hohen oder wegen der zu vielen Auflagen, die teils ihren Grund, teils ihren Vorwand in den Unterhaltungskosten der Wege und Brücken hatten. Von Anfang an bis zum Ende seines Bestehens vermochte der Gotthardpaß niemals auf die Dauer die Konkurrenz der Bündnerpässe im Warenverkehr zu bestehen, deshalb, weil die Bündnerpässe billiger spedierten. Ja selbst im Personenverkehr wurde er bis in unser Jahrhundert regelmäßig überflügelt. Nur in den kurzen Pausen, wenn aus politischen Gründen die Bündnerpässe vorübergehend gesperrt waren, rückte der Gotthardpaß in den ersten Rang. Darum nimmt die weitere Geschichte des Gotthardtransites folgenden typischen Verlauf: Uri kommt bei der Tagsatzung um Erhöhung der Zölle nach in Anbetracht der kostspieligen Wegkorrektionen. Die Tagsatzung spricht dagegen ihre ernsten Bedenken aus, da zu befürchten stehe, der ohnehin spärliche Gotthardverkehr möchte nach Erhöhung der Zölle vollends fortbleiben. Unter solchen Umständen entstanden periodische Gotthardkrisen, wo Gewaltanstrengungen nötig wurden, um den Transit wieder herbeizulocken. Einer solchen Geschäftskrisis verdankt das berühmte Urnerloch seine Entstehung. Das ging so zu: Uri hatte gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts wieder einmal seine Zölle erhöht und zwar herzhaft, um nahezu hundert Prozent (von sechs ein halb Gulden auf zwölf). Ein erschreckender Zusammenfall des Verkehrs war die Folge. Daraufhin ermahnte eine Konferenz der katholischen Orte zu Luzern im Winter 1695 auf 1696 den Stand Uri, darüber zu beraten, wie dem Gotthardtransitverkehr wieder aufgeholfen werden könne. Jetzt griff Uri tief in die Tasche und erbaute das Urnerloch. Nämlich die Stiebende Brücke, einst eine geniale Auskunft, wurde nach Verlauf von fünfhundert Jahren als ein schwerer Übelstand empfunden. Einmal verschlang sie, weil sie immer von neuem repariert werden mußte, alle paar Jahrzehnte beträchtliche Summen. Bavier berichtet, daß der Stiebenden Brücke alles Gehölz des Urserntales zum Opfer fiel. Sodann erschwerte die Stiebende Brücke den Übergang von einem Saumpfade zu einem Reit- und Fahrwege. Denn Pferde bekunden einen ausdrucksvollen Widerwillen gegen stiebende Brücken. Da überdies damals soeben eine reitende Briefpost über den Gotthard eingeführt worden war, so werden die Herren Posthalter von Muralt in Zürich und Fischer in Bern wohl das ihrige beigetragen haben, um die Unzweckmäßigkeit einer stiebenden Brücke für die Kavallerie darzutun. Kurz, Uri zog eine einmalige Gewaltausgabe dem ewigen hölzernen Provisorium vor, und da inzwischen die Straßentechnik den Tunnelbau erlernt hatte, wurde jetzt der Weg durch den Felsen geführt, statt in der Luft außen herum. Also ein Tunnel nach allen Regeln; die damalige Zeit aber nannte es deutscher und kräftiger ‹Loch›. Das Urnerloch war das Weltwunder des vorigen Jahrhunderts, das bestaunt wurde, wie wir jetzt unsern Eisenbahn-Gotthardtunnel bestaunen. Das Urnerloch ist ungefähr fünfundsechzig Meter lang, unser Eisenbahnloch ungefähr fünfzehntausend Meter – kein übler Fortschritt.
Eine andere Konkurrenzgefahr veranlaßte zu Anfang unseres Jahrhunderts die schöne Poststraße, mittelst welcher der Gotthard zum erstenmal die Bündnerpässe im Personenverkehr dauernd überholte. Indessen erst die Eisenbahn vermochte es, dadurch, daß sie die Gefahren bis auf einen kleinsten Rest beseitigte, daß sie den Verkehr auf alle Jahreszeiten und auf Güter wie Personen gleichmäßig verteilte, daß sie ungleich billiger spedierte als jede Post, daß sie zum erstenmal den klassischen Vorzug des Gotthardpasses, nämlich seine Kürze, ausnützte, indem sie die Nähe der beiden Endpunkte in Schnelligkeit umsetzte, erst die Eisenbahn vermochte es, dem Gotthard denjenigen Rang zu erwirken, der ihm zufolge seiner geographischen Lage gebührt und den ihm hinfort keine Konkurrenz mehr rauben wird: den Rang des wichtigsten aller Alpenpässe.
Wie mag sich wohl ein Gotthardreischen im Mittelalter oder zur Reformationszeit gestaltet haben? War der Paß eigentlich fahrbar? oder wenigstens reitbar? oder mußte man zu Fuß hinüber? Wir wollen die Toten fragen. Tschudi im Jahre 1538 berichtet wörtlich:
«Von Uri über den Gotthard ist eine vornehme, stäts brüchliche Landstraß, die Kaufmannsgüter Sommer und Winter zu fertigen jeder Zeit gewesen und annoch.» Das ist klar und bündig. Schade, daß die Notiz ein kleines Gebrechen hat: sie lügt. Das kann dem redlichsten Manne passieren, wenn er mehr sagt, als er weiß.
Nehmen wir statt dessen ein unanfechtbares Zeugnis. Ein polnischer Prinz (er hieß natürlich Ladislaw) reiste im Jahre 1624 mit Gefolge zu Pferd über den Gotthard. Jetzt wissen wir doch wenigstens mit Sicherheit, nicht wahr, daß der Gotthardpaß damals reitbar war. Gemach! Lesen Sie den Reisebericht. Da steht, daß der Prinz allerdings zu Pferde hinüberzog, indessen «mehr zu Fuß als reitend». Überdies mußte ihn öfters der Führer unterm Arm fassen und ihm hinüberhelfen. Also der Gotthard war im Jahre 1624 hauptsächlich zu Fuß reitbar. Später, in der Zeit des Urnerlochs, wurde viel geritten. Vor allem die Post ritt. Vorn schaukelte der Briefpostillon, und hinter ihm durften die Passagiere trotten. Das nannte man im vorigen Jahrhundert die Gotthardpost. Sie fragen mich nach dem Zweck, mit dem Postillon zu reiten? Nun, weil die Postpassagierreiter überall Postpferde zum Wechseln vorfanden. Auf privatem Wege reiste man ums Doppelte oder Dreifache langsamer. Der Ritt mit dem Briefboten stellte demnach den Blitzzug vor.
Die Post bedeutete eine wichtige Neuerung für den Gotthardverkehr. Bisher hatte man nur auf die Kosten gesehen, jetzt wurde auch die Zeit in Betracht gezogen. Und die Zeit ist ein mächtiger Verbündeter des Gotthardpasses, da er ja der kürzeste Paß ist. Zweimal in der Woche zu bestimmter Stunde ging es hinüber, zweimal herüber.
Wie wurden die Waren befördert? Jedenfalls auf eine gemischte Weise, welche von Ort zu Ort anmutig wechselte, damit weder Säumer noch Träger noch Fuhrhalter zu kurz kamen. Während oben in der Schöllenen das Urnerloch den schwierigsten Teil des Gotthardpasses schon fahrbar gemacht hatte, blieb unten bei Intschi immer noch eine enge Stelle, wo mit Not die Pferde mit den kleineren Bündeln durchschlüpften. Merkwürdig, wie solche enge Stellen mit Vorliebe da vorkommen, wo Träger, Führer und Säumer in der Nähe wohnen. Plötzlich, im Jahre 1755, wackelt eine herrschaftliche Kutsche über den Gotthard. Wer meinen Sie wohl, daß darin saß? Selbstverständlich ein Engländer. Damit ist bewiesen, nicht wahr, daß der Gotthardpaß damals zur Not auch fahrbar war? Man sollte es wenigstens glauben. Man glaubt es jedoch nicht mehr, wenn man vernimmt, daß der Engländer achtundsiebzig Kerle mit sich schleppte, um die Kutsche auseinanderzuschrauben und wieder zusammenzuleimen. So leistet uns das Fahrzeug den besten Beweis für die Unfahrbarkeit des Passes. Nein, fahrbar wurde der Gotthardpaß erst durch die Poststraße im Jahre 1830.
Fassen wir das Ergebnis zusammen. Zur Zeit der Stiebenden Brücke, also fünfhundert Jahre lang, von 1200–1700, war der Gotthardpaß gangbar und nur stellenweise reitbar. In der Zeit des Urnerlochs, 1707, bis zur Poststraße, 1830, also im vorigen Jahrhundert, war er reitbar, streckenweise auch fahrbar.
Die Mitteilung von den chronischen Konkurrenznöten des ehemaligen Gotthardpasses wird Sie wahrscheinlich befremdet haben. In der Tat will sie zu dem alten Ruhm des Gotthard nicht recht stimmen. Allein der Ruhm eines Passes und seine Beliebtheit in der Handelswelt sind verschiedene Dinge. Der schönste Paß für den Kaufmann ist die Ebene, garniert mit einem dicken, schläfrigen Strom. Der Ruhm des Gotthard stammt denn auch nicht von den Kaufleuten, sondern von den Gelehrten und Poeten. Vergessen wir nicht, daß der Gotthard Jahrhunderte lang ein naturwissenschaftliches Problem war, da er aus verschiedenen Gründen für den höchsten Berg der Welt galt. Julius Cäsar hatte die Lepontischen Alpen, das will sagen das Gotthardmassiv, die höchsten Alpen genannt. Ein lateinischer Spruch aber war für die weltlichen Gelehrten der Reformationszeit so unanfechtbar wie ein Bibelspruch für die Theologen. Dann setzte man als selbstverständlich voraus, daß derjenige Gebirgsknoten, welcher vier große Flüsse nach vier Weltgegenden sendet, der höchste sein müsse, weil das Wasser erwiesenermaßen von oben kommt. Endlich erblickte man in dem Namen Gotthard eine Bestätigung, indem man den Namen fälschlich mit Gott in Zusammenhang brachte, als ob Gotthard den Gott unter den Bergen bedeuten wollte. Dieser Gallimathias beginnt mit Ägidius Tschudi im Jahre 1538 und dauert bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts. Noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde in einem Alpenpanorama des Vierwaldstättersees der Titlis für den Gotthard ausgegeben, und zwar von einem Gelehrten von Ruf. Der Herr urteilte logisch vollkommen richtig: Wenn der Gotthard der höchste Berg ist, so muß der höchste Berg der Gotthard sein. Erst Saussure, der Besteiger des Montblanc, kam der Wahrheit auf die Spur. Zum Gelehrtenruhm gesellte sich nach Rousseau, dem Entdecker der Gebirgsschönheit, der ästhetische Ruhm. Jetzt wurde der Gotthard, welcher früher allgemein ‹scheußlich›. ‹gräßlich›. ‹wehmütig›. ‹trostlos› geheißen hatte, plötzlich ‹erhaben›. ‹herrlich›. ‹wundervoll›.
Die Anfangsperiode des Gotthardpasses fällt mit der Zeit der Gründung der schweizerischen Eidgenossenschaft zusammen und zwar auffallend genau zusammen, indem eine der ersten historischen Spuren des Gotthardpasses zugleich eine der wichtigsten Etappen der schweizerischen Freiheit ist, ich meine den Zug der Schwyzer über den Gotthard nach Faenza, jenen Zug, der den Schwyzern einen kaiserlichen Freiheitsbrief einbrachte; indem ferner sämtliche Urkunden über den jungen Gotthardpaß sich um die Zeit der beiden Waldstätterbünde gruppieren. Sollte vielleicht gar ein innerer Zusammenhang zwischen der Erschließung des Gotthard und der Entstehung der schweizerischen Eidgenossenschaft obwalten? Ein Zusammenhang von Ursache und Wirkung, von Motiv und Tat? Der Gedanke erscheint kühn, schwindelhaft kühn. Aber er läßt sich nicht von der Hand weisen. Vielmehr neigen je länger, desto zuversichtlicher die Schweizer Historiker dahin, ihn zu bejahen.
Noch ist Widerspruch nicht ausgeschlossen, noch ist eine Reaktion gegen die heutige Anschauung von der staatenbildenden Bedeutung des Gotthardpasses möglich, ja wahrscheinlich. Aber irgend einen inneren Zusammenhang wird hinfort niemand bestreiten können. Und hiemit ist eine Perspektive eröffnet, von welcher die frühere Geschichtsschreibung keine Ahnung hatte, eine Perspektive, welche dem Gotthardpaß zu seinen alten Ruhmestiteln plötzlich noch einen neuen verleiht, und zwar vielleicht den wichtigsten von allen.
Der Föhn und die Nerven
Während der Fremde, unter dem Eindrucke sensationeller Schilderungen des Föhnschreckens (Feuer- und Wassergefahr), die keineswegs übertrieben, aber rhetorisch aufgeputzt sind, den Föhn durchaus als einen Feind der Alpenbewohner betrachtet, als einen Gesinnungsverwandten der Lawinen, Überschwemmungen und Bergstürze, erweist er sich bei umsichtiger Nachforschung an Ort und Stelle vielmehr als der wohltätige Schutzpatron der nördlichen Alpentäler. Es ist wahr, daß er den Feuerfunken aus dem Herd stöbert und über die Dächer schleudert – wenige Alpendörfer, die nicht schon einmal bei Föhn zusammenbrannten –, es ist wahr, daß er unvorsichtige Boote an den Klippen zerschellt; allein es ist nicht minder wahr, daß er es ist, der mit seinem Gluthauch überall auf seinem Wege Fruchtbarkeit verbreitet. Dem Föhn verdanken der Vierwaldstättersee, der Zugersee, der Rigiberg, das Schwyzertal und der untere Urnerboden ihr gesegnetes Klima, dem Föhn die Fremden die glänzendsten Sonnentage und die klarsten Ausblicke (gibt es doch Sommer, in welchen nur bei Föhn gutes Wetter gedeiht), dem Föhn die höhergelegenen Bergtäler ihre Wohnbarkeit. «Ohne den Föhn wäre das Göschenertal ein Sibirien.» «Ohne den Föhn würde der Herrgott über den Winter niemals Meister.» So urteilt der Urner, und er urteilt richtig. Der Schnee würde sich in den Hochsommer hinüberschleppen, mit Firnbildung, der Vierwaldstättersee wäre ein feuchtes Regen- und Nebelloch, Uri und wohl auch Schwyz hätten wie manche andere Gebirgstäler statt des Sommers einen grünen Winter. Der Föhn aber saugt wie ein Schwamm allen Schnee hinweg und taucht Berg und Tal in Sonne.
Dagegen übt er auf das Nervensystem des Menschen eine üble Wirkung aus, die der Reisende, vor allem der Fußreisende, kennen muß, um sie in Rechnung zu setzen und sich mit ihr abzufinden, eine Wirkung, die ich mit einem leichten Influenza-Anfall vergleichen möchte. Nämlich er drückt auf die Stimmung, er ‹deprimiert›, reizt und ermattet. Die Urner haben ein eigenes Wort für diesen nervösen Zustand: ‹Föhnsucht›. Selbst an den äußersten Grenzen seines Gebietes, zum Beispiel in Luzern, verspüren besonders Empfängliche Unruhe und Kopfschmerz und allerlei Unbehagen. Eine Föhnnacht im eigentlichen Föhngebiet (zum Beispiel Altdorf und Amsteg oder Meiringen und Brünig oder Glarus) bringt keinen erquickenden Schlaf, ein Spaziergang bei Föhn keine Lust, ein Marsch bei Föhn erschöpft bereits in der ersten Stunde. Man fühlt sich abgeschlagen, spürt Migräne, glaubt sich alt und schwach: eine ausgesprochene Hinfälligkeit. Kein Schatten erquickt, keine Ruhe labt, keine Höhe hilft. Flüchte bis zu den Gletschern, sie erfrischen nicht.
Wo hat man nun den Föhn zu gewärtigen und woran ihn zu erkennen? Er beginnt hoch oben bei den Gipfeln und Pässen der nördlichen Alpenseite, nimmt an Heftigkeit talabwärts rasch zu, erreicht seine stärkste Gewalt unten in den Pforten des Gebirges, fällt strichweise stürmisch darüber hinaus, da, wo er eingeengt wird, zerstreut sich dagegen fast plötzlich, wo er freien Raum findet. Im besondern der Gotthardföhn erreicht seine größte Heftigkeit zwischen Amsteg und Flüelen, rast noch ungebrochen über den Urnersee, bedroht noch bei Brunnen die Schiffe und die Küste, dann teilt er sich. Ein Strom saust durch das Schwyzertal, über den Zugersee, dessen Wogen er aufwühlt und über das Ufer stürzt; jenseits des Zugersees verflüchtigt er sich, wird aber noch in Zürich gespürt. Ein zweiter Strom schneidet mit deutlich sichtbarer Grenzlinie im Wasser die Gersauer Seekammer, noch in Gersau Bäume knickend, dann verschwindet er herwärts der Vitznauer Nase plötzlich, fast spurlos, durch weite Streuung. Ein dritter Strom nimmt seinen Weg über die Höhen, Frohnalp, Rigi und so weiter. Die Ufer des Vierwaldstättersees zwischen Bürgenstock und Luzern erhalten nur noch einen verhältnismäßig schwachen, zerteilten Föhn, sei es vom Gotthard oder vom Haslital her, gerade genug, noch seinen Segen zu erfahren, nicht hinreichend, ihn fürchten und hassen zu müssen. In Luzern donnert er noch und mitunter recht kräftig, stiftet aber nicht mehr den mindesten Schaden; in Zürich ist er schon ohne merklichen Einfluß auf Klima und Vegetation, wohl aber übt er solchen auf die Nerven und auf die Dachziegel, die er herunterschmeißt.
Seine Physiognomie ist im äußern Streuungsgebiet, also etwa bei Zug und Luzern oder auf dem Rigi, für den Fremden nicht so auffällig, daß dieser etwas Besonderes wittert. Tausende fahren bei Föhn auf den Rigi, ohne etwas anderes wahrzunehmen als die ausnehmend weiche Luft und den von keinem Makel befleckten, glanzstrahlenden, tiefblauen Himmel. Der Einheimische dagegen erkennt den Föhn auf den ersten Blick, ja er spürt ihn und schnuppert ihn. Folgendes ist sein Signalement für den Luzerner Horizont: Der fleckenlose, blaue Himmel verfärbt sich in der Gegend von Flüelen, also über den Bauen, grünlich. Das dauert lange Stunden. Dann erscheinen schwere Wölklein, kleinen Gewitterwolken ähnlich, in der nämlichen Gegend, die Berglinien verschleiernd. Dann plötzlich verfärben sich Rigi und Bürgenstock tief violettblau, in den Schatten schwarz, indem sie zugleich mit einem Schlag näher gerückt scheinen. Jetzt verfärbt sich auch der See, und zwar in prächtigen Palettfarben, entweder zu wundervollem, aber unheimlichem Metallgrün oder zu herrlichem Ultramarinblau; das Wasser, sichtlich von einer schweren Last verdrängt, wälzt Wellen in langen Zügen aus einer Richtung, von welcher sonst keine Wellen anlangen, nämlich von Süden: der Föhn ist da. Der währt dann so lange er mag, bis er unversehens, sobald ihn der erste kühle Luftstrom trifft, in Regen umschlägt. Denn oberstes Gesetz: Nach Föhn kommt Regen.
Unzweideutiger offenbart sich der Föhn in seinem Urgebiet, also zum Beispiel in Altdorf oder Erstfeld; ihn dort nicht zu erkennen, ihn mit einem gewöhnlichen Orkan zu verwechseln, dazu gehört schon eine völlige Unbekanntschaft mit seiner Existenz und seiner Art. Kein beständiges Stürmen, Heulen und Fegen, sondern, von längern Pausen unterbrochen, während welcher die Atmosphäre lautlos zittert, einzelne dumpfe Donnerschläge wie von Artilleriesalven oder ein hastiges Luftlawinengepolter, das sich in wildem Crescendo überkollert, jauchzend und knallend, oder jähe Stöße, so plötzlich, so ungestüm, so rasant, wie aus der Kanone geschossen. Und, was den Flachlandbewohner am meisten befremdet: zwischen den starren, unbeweglichen Bergmauern und über dem wolkenlosen oder gleichmäßig verdüsterten Himmel sieht man den Föhnsturm nicht, hört auch kaum begleitende Geräusche des Klirrens und Rasselns, weil die Bauart der Häuser vorsichtig vermeidet, was dem Föhn zum Angriffspunkt dienen könnte. Es hört sich an wie eine hohe Luftschlacht, bei welcher die Erde neutral bliebe. Nur, wenn etwa zufällig ein herrenloser Gegenstand wie auf Schwalbenflügeln turmhoch über die Dächer jagt, vermögen unsere Sinne die tolle Wut des Föhnsturmes zu ermessen.
Nach dem Gesagten ist es rätlicher, bei Föhn die Füße ruhen zu lassen und lieber die Blicke allein nach dem farbenstrotzenden Föhngemälde spazieren zu führen. Doch ist mit diesem Rat denjenigen Reisenden, die wenig Zeit und viele Pläne haben, schlecht gedient, zumal hinter dem Föhn noch der Regen abzuwarten bliebe. Solchen weiß ich eine Auskunft: entweder passive Ausflüge, Dampfschiff oder Eisenbahn oder Wagen, oder, wenn es eine Fußreise sein soll, rasch mit dem Schnellzug durch den Gotthard hinüber ins Tessin. Denn obschon die Theorie auch einen Tessiner Föhn aufzählt (Tedesco heißt er dort), so ist er doch drüben selten, spielt keine wichtige Rolle und, die Hauptsache, tritt niemals zu der nämlichen Zeit auf wie sein nordischer Bruder. Föhn diesseits ist die zuverlässigste Bürgschaft für Föhnlosigkeit jenseits. Ich habe übrigens persönlich niemals etwas wie Föhn im Tessin verspürt.
Schließlich: ein dringender Unterlassungsgrund für Fußreisen ist der Föhn ja nicht; Gefahr bringt er keine, die Ermattung geht vorbei, die Erinnerung bleibt; aber die Rückzugslinie muß man sich vorsichtig offen behalten, um nicht eingeregnet zu werden.
Zweien vorzüglichen Föhnkennern, Herrn Präsident Suidter in Luzern und Herrn Dr. Stierlin auf Rigi-Scheidegg, verdanke ich noch folgende Beobachtungen über den Föhn:
Der Schall dringt bei Föhn bedeutend weiter als sonst; man hört bei Föhn auf fabelhafte Entfernungen.
Es tritt bei Föhn eine Lichtbrechung ein, vermöge deren die Berge des Hintergrundes über die Berge des Vordergrundes nicht bloß scheinbar, wie ich meinte, hervortreten, sondern tatsächlich tiefer hinunter gegen ihren Fuß gesehen werden.
Die charakteristische Form des Föhngewölkes, also diejenige Form, welche die Föhnwolke von der kleinen Gewitterwolke unterscheidet, ist die längliche, ‹zigarrenförmige› Gestalt.
Das Gebirgsvolk nennt alles Föhn, wofür es im Augenblick keinen Namen oder keine Erklärung weiß. Seit ich über kalten und warmen, über Süd-, West-, Ost- und Nordföhn belehrt worden bin, beginnt mein Glaube zu versagen. Es ist mir nachgerade ein bißchen zu viel des Föhns. Sicher ist nur das: sobald Föhn eintritt, so prophezeit jedermann ohne Ausnahme Regen binnen spätestens vierundzwanzig Stunden. Nun ereignet es sich aber gar oft, daß statt dessen acht oder vierzehn Tage lang das prächtigste Wetter herrscht. Dann heißt es nicht etwa: «Wir haben uns getäuscht»; sondern man drückt es so aus: «Das war der unechte Föhn.» Woran unterscheidet man jedoch den echten vom unechten Föhn? Daran, daß es nach dem echten regnet, nach dem unechten nicht. Mit andern Worten: Wenn es geregnet haben wird, so wird es der echte, wenn es nicht geregnet haben wird, der unechte gewesen sein. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Logik einleuchtet, jedenfalls ist sie ein starker Trost für Wetterpropheten.
Wagenfahrten
Wenn eine Gegend so beschaffen ist, daß der Fußmarsch früher ermüdet als er fördert, mit andern Worten, daß nach stundenlangem Wandern noch ungefähr das nämliche Landschaftsbild vor Augen steht wie am Anfange des Marsches, dann eignet sie sich nicht zu Fußspaziergängen, wäre sie auch die schönste der Welt. Hier ist die Wagenfahrt angezeigt, falls sich eine dazu geeignete Straße vorfindet. Das aber wird meistens der Fall sein, weil es hauptsächlich die Ebenen und die Talsohlen sind, welche solche Verhältnisse bieten. Und zwar sind die Talsohlen zwischen großen Bergen meist noch einförmiger als die eigentlichen Ebenen, welche oft unterwegs durch ungeahnte Stimmungsmotive überraschen. Nämlich die Ebene hat vor dem breiten und langen Talboden einen wichtigen Vorzug voraus: das weite, freie Licht und die unendlich abgestufte Luftperspektive auf der Erde wie am Himmelsgewölbe.
Jedermann kennt solche Strecken. Ich erinnere beispielsweise an den Talboden zwischen Stans und Engelberg bis Grafenort, wo trotz der erfreulichen Gegend der Fußmarsch gründlich langweilt. In gewissen Gebirgen sind solche Strecken die Regel, zum Beispiel im Schwarzwald. In anderen sind sie häufig, zum Beispiel in den Alpen. Wieder in anderen kommen sie überhaupt nicht vor, zum Beispiel im Jura.
Ebenso können besondere klimatische Verhältnisse derart ermattend auf die Nerven des Menschen einwirken, daß längere Fußmärsche nicht erlaben, möge selbst die Szene genügend rasch wechseln. Das ist besonders im Süden der Fall; schon im Kanton Tessin ist die Wagenfahrt, da wo sie möglich ist, dem Fußmarsch vorzuziehen.
Was nun den Gotthard betrifft, so möchte ich folgenden Rat erteilen.
Unbedenklich ist die Wagenfahrt dem Fußmarsch vorzuziehen:
Zweifelhaft sind, das heißt je nach den Umständen, bald für den Fußmarsch, bald für die Wagenfahrt zu empfehlen:
Unter allen Umständen würde ich den Fußmarsch vorziehen: zwischen Göschenen und Amsteg.
Der Leser hält mir vielleicht verwundert entgegen, ich hätte so ziemlich die ganze Gotthardstraße mit wenigen Ausnahmen der Kutsche überantwortet? Das entspricht allerdings meiner Überzeugung: die Talsohlen im Wagen, die Berghänge, Hügel und Wälder zu Fuß.
Über Naturgenuß
Eigentlich sollten wir die ‹Natur› (richtiger gesagt: die Landschaftsbilder) nicht untätig genießen, einzig unsere Sinne spannend und mit dem Geiste auf Beobachtung zielend. Bei absichtlichem Ansehen, wie es der Tourist übt, bemerkt er zwar vieles, aber schaut wenig. Denn die Hauptsache beim Schauen ist ein seelischer Vorgang. Es kommt vor allem darauf an, daß die photographische Platte richtig vorbereitet sei, welche das Bild aufzunehmen hat; auch ist es vorteilhafter, wenn das Bild sich unvermutet auf ihr spiegelt, als wenn wir es mit dem Wunsch und dem Willen herbeirufen.
Fragen Sie sich doch selbst. Welche Naturbilder haften am gründlichsten, am deutlichsten und am nachhaltigsten in Ihrem Gedächtnis? Etwa jene, welche Sie als Tourist bewundernd anstaunten? Keineswegs. Mögen Sie noch so aufmerksam hingesehen haben, es bleiben Veduten, die sich entweder rasch verflüchtigen oder die, falls es Ihnen auch gelingt, sie mit der Erinnerung zu wiederholen, doch des inneren Gehaltes, mit andern Worten, der Beziehungen zu Ihnen entbehren. Dagegen jene Naturszenen, in welchen Sie Glück oder Leid erfuhren, jene Örtlichkeiten, wo Sie als Kind spielten, wo Sie als Jüngling etwas wollten, wo Sie als Mann etwas taten, ferner jene, wo Sie eine wichtige Nachricht erhielten, kurz jene, in deren Rahmen sich Ihnen etwas ereignete, die glühen mit unauslöschlichen Farben über unverwischbarer Zeichnung.
Man muß die Natur erleben. Sie darf nur die Szene abgeben, in welcher Sie Geist und Gemüt regen. Der Tätige hat den vollkommensten Naturgenuß, der Arbeiter, der während der Arbeit aufblickt, der Künstler oder Denker, der sorgenvoll seinen Plänen nachsinnt, der Gelehrte, der Entdecker, der etwas sucht. Sie sehen ungleich weniger als der müßige, aufmerksame Wanderer, aber sie sehen das Wenigere unendlich mehr.
Da der Mensch indessen nicht dazu ins Gebirge reist, um seine Sorgen und Beschäftigungen spazieren zu führen, im Gegenteil, und Erlebnisse nicht auf dem Rundreisebüchlein vorausbestellt werden können – die unangenehmen würden wir uns ohnehin verbitten –, muß ich die Frage gewärtigen, wie ich mir einen ‹tätigen› Naturgenuß, der zugleich Erholung bringen soll, als möglich und empfehlenswert denke.
Ich antworte: auf dem Wege kameradschaftlicher Reisen. Ich sage nicht Gesellschaft, sondern Kameradschaft, und meine damit die Begleitung eines Menschen, mit welchem uns ein näheres geistiges und gemütliches Verhältnis, kurz ein Freundschaftsverhältnis verbindet. Teils die Gespräche, teils die gegenseitige Fürsorge, die sich unter den genannten Bedingungen während der gemeinschaftlichen Reise entwickeln, schaffen eine gehobene Seelenstimmung, welche die Landschaftsszenen besonders rein widerspiegelt, zunächst in der Gegenwart, später in der Erinnerung. Man erinnert sich am besten zu zweien, selbst in Abwesenheit des zweiten; und durch ein befreundetes Herz geschaut, sieht die Welt schöner aus als bei direkter Beobachtung von Auge zu Stein.
Neulich, oben bei Intschi, zwischen den sprudelnden Bächen über der tosenden Reuß, begegnete ich einer wandernden Mädchenschule. Mit Tornistern und Bergstöcken bewaffnet, mit Alpenrosen verblümt, eskortiert von Lehrern und Lehrerinnen, schwatzend, lachend und singend. Der Direktor, an der Spitze schreitend, stieß ab und zu in ein Hifthorn, um seine Herde zu sammeln. Nichtsdestoweniger schleppte ein Züglein nach, weit hinter den übrigen, um einen jungen Lehrer geschart, dessen Worten sie eifrig lauschten. Keines sah sich um; auch vermute ich, daß von allem eher die Rede war, als von der Geographie und Ästhetik des Reußtales, vielmehr schien mir, als ob sich da ein Romänchen anzettle. Allein glauben Sie nicht, jener Lehrer und jene Mädchen, obschon sie die meiste Zeit mit nichten die Landschaft, sondern ihres Nächsten Angesicht betrachteten, werden zeitlebens die Szenerie des Reußtales tiefer im Herzen eingegraben behalten, als wir achtsamen, beflissenen Naturgucker?
Jenes zerstreute Schulkonglomerat habe ich beneidet. So sollte man eigentlich reisen.
Sirenen und Seeschnaken
Wenn die Ausleger recht haben, so war es italienische Küste, wohin die klassischen Sirenen, die Sirenen Homers lockten. Den Gesang hat auch das nordische Mittelalter vernommen, und das Echo ist heute noch nicht verstummt. Vielmehr dringt es durch den Gotthardtunnel mit frischer Deutlichkeit; ich höre es von meinem Zimmer.
Da gilt es nun zu widerstehen. Wohl jeder, der Italien besucht, stattet dem herrlichen Klima seinen Sehnsuchtsseufzer ab. «Glücklich, wem in diesem gesegneten Lande zu wohnen vergönnt ist.» Die meisten lassen es dabei bewenden; manchem jedoch schmeichelt sich der Gedanke enger ums Herz, und dieser oder jener brütet gar ein Prospektchen, ob und wie etwa mit der Zeit der Traum sich in Wirklichkeit umsetzen lasse. Die Sache nimmt sich, je länger man sie überdenkt, um so vernünftiger aus: ein beneidenswertes Klima, eine Welt der Kunst und der Geschichte, ein liebenswürdiges Volk, ein spottbilliger Haushalt – warum also nicht?
Und dennoch nicht! Nach Italien reisen, je öfter desto besser. Ich halte mit, ich gehe sogar voran, da ich leichter und öfter vom Vierwaldstättersee an die italienischen Seen gelange als nach Basel oder Zürich und mir das harmlose Privatvergnügen gestatte, Luzern eine Vorstadt von Mailand zu nennen.
Aber übersiedeln, sich bleibend jenseits niederlassen – das ist ein ernster Entschluß. Übersiedeln in eine andere Nation bedeutet allemal den Bruch mit der Vergangenheit, die Trennung von Heimat und Freunden und Verwandten, den Verzicht auf traute Sprache und Sitte, den Tausch des Bekannten gegen das Unbekannte. Unermeßlicher Verlust ist sicher, ein Ersatz fraglich. Angenommen selbst, das Hineinleben in die neuen Verhältnisse gelinge – es gelingt in der Tat nirgends leichter als in Italien –, wer verbürgt mir, daß nicht die Verpflanzung die edelsten Kräfte, zum Beispiel die Energie, die Tätigkeitsfreude, das Schaffensvermögen schädigt? Ist erhöhtes Daseinsbehagen diesen Tausch wert? Übrigens ist selbst die Rechnung auf vermehrtes Wohlbefinden keineswegs zuverlässig. Je näher man sich den italienischen Süden ansieht, desto mehr Schnee entdeckt man darin; nur daß die Öfen dazu fehlen. Der Süden ist immer da, wo man noch nicht hingekommen ist; er flieht vor uns. Es ist schon bezweifelt worden, ob Europa überhaupt einen Süden habe, das will sagen, einen Winter, der kein Winter sei.
Der Maler, dessen wahre Heimat der Sonnenschein ist, mag mit Nutzen für Leib und Seele Italien gegen sein Vaterland eintauschen; wir andern sollen es nicht ohne einen tiefen Grund und einen schweren Entschluß.
Gefährlicher noch – indessen bloß für reiche Leute – sind die Seeschnaken. Irgend ein Krösus in Diminutivausgabe erlebt, während er eines purpurnen Abends über den Lago Maggiore oder Comer- oder Vierwaldstättersee schaukelt, eine plötzliche Offenbarung: «Hier und an keinem andern Orte will ich leben». Architekten und Gärtner werden in Bewegung gesetzt, die Sache hat weiter keine Schwierigkeit (außer daß der Bau natürlich dreimal so viel kosten wird, als er kosten sollte). Nach zwei Jahren prangt das Landhaus herrlich am Ufer da, ein Gegenstand sehnsüchtiger Bewunderung für Dampfbootpassagiere. Das ist nun schön und gut. Fragen Sie jedoch in fünf Jahren nach, so werden Sie vernehmen, erstens, daß das Landhaus des Entzückens unbewohnt und zweitens, daß es feil ist. Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Ein beträchtlicher Teil der Uferparadiese steht leer und ist zu haben. Warum? weil es eine Torheit ist, die eigentlich keinem denkenden Menschen passieren sollte, aus Begeisterung zu bauen. Stimmungsgedichte, meinetwegen; aber Stimmungskäufe und Stimmungsbauten, das ist eine kostspielige Lyrik. Statt Genuß kommt Verdruß und endlich der Überdruß. Wer aber dann nicht kommt, das ist der Käufer. Nämlich darauf ist ja so sicher zu rechnen wie auf das Amen in der Kirche: Wer aus Stimmung baut, wird auch aus Stimmung das Haus bald gründlich satt bekommen; denn Stimmungsmenschen sind Launenmenschen, und Launen schlagen um. Krösus sehe sich also vor, daß er nicht dereinst Solon rufe, und lerne deshalb Seeschnaken von Offenbarungen unterscheiden. Hiemit möchte ich beileibe nicht eine verständige, überlegte Niederlassung an einem herrlichen Seegestade widerraten. Warum auch nicht lieber an einem schönen Platze als an einem unschönen? Nur muß einer seiner selbst sicher sein, ob ihm nach Jahren noch behagen werde, was ihm heute behagt, und ob er das Haus genügend mit Freundschaft und Liebe zu füllen vermag, um etwas Einsamkeit zu ertragen; denn das Glück kauft man nirgends an, das muß man schon selber mitbringen.
Phantome
Ich kenne kein traulicheres Denkmal der Vergangenheit als eine verlassene Straße. Sie redet nicht von Tod, sie schweigt von buntem, vielgestaltem Leben, das einst Jahrhunderte lang in endloser Reihe hinwärts und herwärts wallte, um plötzlich wie mit einem Zauberschlage auszusetzen.
Die Straße aber, nach wie vor zum Empfang gerüstet, schaut verwundert in die Welt, mit dem stillen Staunen eines verwunschenen Schlosses, das der Erlösung harrt. Inzwischen ziehen die Geister verblichener Wanderer auf den alten Geleisen, großäugige, gedankenvolle Völker von Schatten und Schemen, die dem einsamen Wanderer begegnen und die ihm von dem tiefsinnigen Märchen der Wahrheit erzählen. Ich bitte, diese Sätze nicht für eine poetische Stilübung zu halten. Sie geben genau eine Tatsache der seelischen Erfahrung wieder, die sich bei jedem Wanderer bewährt. Oder sagen Sie selbst, haben Sie nicht auch Ihrerseits auf Ihren Spaziergängen solche Phantome der alten Bergstraßen gesehen? Den verzagenden Handwerksburschen, der die wunden Füße nicht mehr weiter schleppt? Die hungrigen Kinder, die einander in rührendem Wettstreit das letzte Stückchen Brot aufnötigen? Den italienischen Auswanderer, der, das Herz voll Heimat, Musik und Sonnenschein, im Schneesturm versinkt? Den treuen Postkondukteur, der nach einem Menschenalter opfermutiger Diensterfüllung sich endlich, von Alter und Gicht überredet, zur Ruhe setzt und nun, unten im behaglichen Tal, am warmen Ofen sich an die gefahrvolle Stätte der Lawinen zurücksehnt, wo er jung war und wirken durfte? Und tun Sie ja nicht etwa Ihren Visionen unrecht, indem Sie sie für eitlen Hirnspuk halten. Die Phantasie ist die schönste Tochter der Wahrheit, nur etwas lebhafter als die Mama. Während ich diese Aufsätze schrieb, kamen eines kalten Januartages zwei italienische Kinder in Luzern an, Brüderchen und Schwesterchen, Schuhe und Strümpfe durchgelaufen, die Kleider in Fetzen. Wo kommt ihr her? «Von Turin.» Auf welchem Weg? «Zu Fuß über den Gotthard.» Allein? «Allein.» Weshalb und wozu? «Vater und Mutter sind gestorben; man drückte uns ein paar Lire in die Hand, drehte uns das Gesicht nach Norden und sagte: ‹Geht nach der Schweiz, dort wohnen gutherzige Menschen›. Und so sind wir denn gekommen.» Mildtätige Frauen verschafften den Kindern Unterkunft und Arbeit. Nach wenigen Tagen waren sie wieder verschwunden, heimlich auf und davon.
Andere Straßen, andere Phantome; andere Menschen, andere Halluzinationen.
Dasjenige Bild, das mich auf dem Gotthardpaß mit hypnotischer Gewalt heimsucht, dessen schwermütiger Stimme ich immer und immer wieder lauschen mag, ohne mich jemals satt zu lauschen, warum sollte ich es nicht zeichnen dürfen?
Ich sehe die Hochzeitswagen vom Hospiz nach der Tremolaschlucht hinunterbiegen, die Insaßen gut vor Liebesglück, umträumt von Erwartungen, die sich nie erfüllen werden, voll Sehnsucht nach einem paradiesischen Lande, das sie Italien nennen und mit durstigen Blicken in der Ferne suchen, während sie es mit sich führen. Hinter ihnen im Wagen aber sitzt eine schwarze Gestalt, die sie nicht sehen, die sich ihnen jedoch einmal vorstellen wird, nach ihrer Rückkehr, vielleicht früher, vielleicht später, aber sicher.
Ich bin kein Menschenfreund, wenigstens kein professioneller, und sentimental schon gar nicht. Aber für mich hat der Gotthard, wegen der Tausende von zweistimmigen Wünschen und Hoffnungen, die auf seinem kahlen Wege blühten, wegen des jungen Glückes und Glaubens, die seine starren Mauern segneten, eine wehmütige Heiligkeit. Es ist die Straße der Illusionen. An keinem andern Passe hängt so viel Gemüt. Das kann man nur noch dort oben ablesen, den Dahingeschwundenen zum Gruß, die es hinterließen.
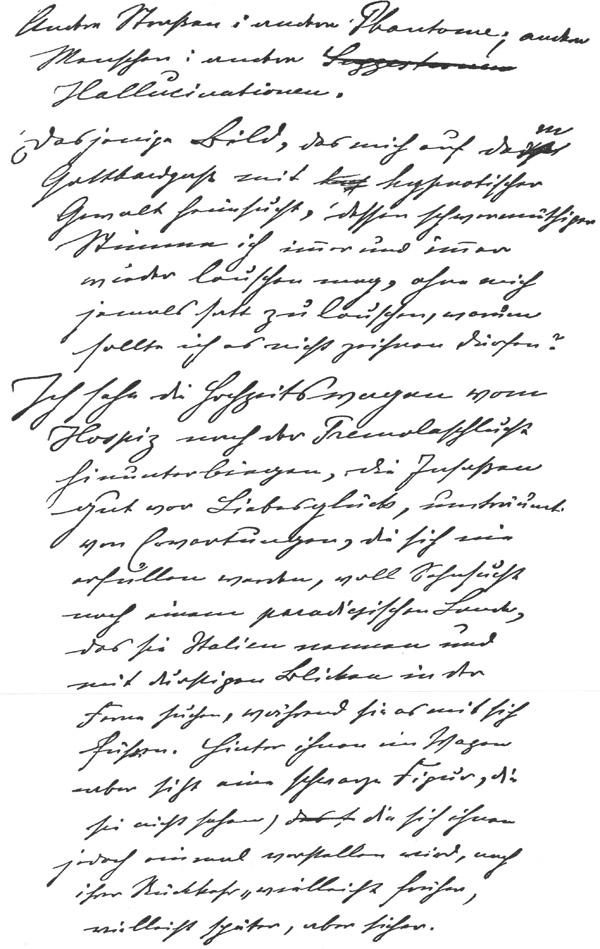
Aus dem letzten Kapitel «Phantom» des Manuskriptes «Der Gotthard» (1896).
(Gotthardbahn-Archiv. Im Besitz der Schweizerischen Bundesbahnen, Kreis 11)