
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

5. Pan und Apollo. Antike Marmorgruppe. Vatikanisches Museum, Rom
Ein Versuch
Die gesamten Wissenschaften haben seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts die ungeheuersten Fortschritte gemacht. Gerade deshalb aber zeigen sich dem auf das innere Wesen der Dinge und auf das Erkennen des gesetzmäßigen Geschehens gerichteten Blicke des Kulturhistorikers heute vielleicht noch viel mehr ungelöste wissenschaftliche Aufgaben als je. Gerade deshalb. Denn dadurch, daß die Wissenschaft ungeheure Fortschritte gemacht hat, hat sie notgedrungen zu den tiefgehendsten Umwälzungen in der Anschauung der Dinge geführt, und überall, wo man nachprüft, ergibt sich eine nicht zu umgehende Notwendigkeit zur grundstürzenden Revision seither anerkannter und vielfach für richtig gehaltener Erklärungen.
Das gilt vor allem von den historischen Wissenschaften. Jede Art und jeder Teil der Geschichte war bis dahin immer mehr oder weniger Apologetik; sowohl im Positiven wie im Negativen. Man rechnete mit allen sozialen Erscheinungen als mit gegebenen Größen, und vor allem als mit einer im Wesen ewigen und unwandelbaren Ordnung der Dinge, an der es höchstens Schönheitsfehler gibt. Freilich kann man gegenüber dieser Stellung zu den Dingen nicht einmal von Tempi passati sprechen. Wenn man in der Naturwissenschaft auf Grund der Erkenntnis der Gesetze der Entwicklung längst dahin gelangt ist, anzuerkennen, daß in allen lebenden Organismen eine stete Weiterentwicklung zu immer höheren Formen am Werk ist, so hat man in der Gesellschaftswissenschaft ebenso geflissentlich von dieser Logik abgesehen. Und wenn man es auch nicht geradezu wagt, zu leugnen, daß innerhalb der sozialen und politischen Organisationsformen der menschlichen Gesellschaft derselbe Prozeß sich vollzogen hat, so hat man wenigstens die Logik einer weiteren Entwicklung zu wiederum völlig neuen und auch höheren Gesellschaftsformen beharrlich ignoriert. Gewiß geschah dies zum großen Teil aus wissenschaftlicher Unklarheit, aber diese wurde stets auch von einem wohlverstandenen Interesse genährt – jeder herrschende Zustand will im Interesse der Sicherheit seines Bestandes den Gipfel aller Entwicklungsmöglichkeiten darstellen. Wurde damit die Tatsache, daß es auch hier kein »bis hierher und nicht weiter« gibt, natürlich trotzdem nicht aus der Welt geschafft, so hat es doch dazu geführt, daß auf sämtlichen Gebieten, die ins Bereich der historischen Wissenschaften gehören, immer noch die krauseste Unlogik das Zepter schwingt. Alles das gilt in vollem Umfang auch von dem Teil der Historie, von dem wir hier eine Seite untersuchen wollen, von der Kunst und Kunstgeschichtsschreibung.
Die Entschleierung der alles geschichtliche Geschehen endgültig bestimmenden Gesetze ist die große Errungenschaft auf dem Gebiete der historischen Wissenschaften. Es steht heute, und zwar durch die bahnbrechenden Forschungen von Karl Marx, fest, daß es in letzter Linie immer die allgemeinen wirtschaftlichen Interessen sind, die den gesellschaftlichen Lebensprozeß der einzelnen Völker und Klassen bedingen, und daß infolgedessen einzig die jeweilige ökonomische Grundlage einer Gesellschaft – das sind die Art und Höhe ihrer Produktionsverhältnisse, ihrer Gütererzeugung, ob dies feudalistisch, zünftlerisch, manufakturistisch, großindustriell usw. geschieht – deren politische und geistige Formen bestimmt. Mit anderen Worten: Religion, Philosophie, Rechtsanschauungen, Sittlichkeitsbegriffe, Künste einer Zeit usw. sind nur das ideologische Widerspiel der ökonomischen Basis der betreffenden Zeit und wechseln darum – das ist die entscheidende Logik! – folgerichtig auch mit dieser. Für jene, die sich auf diesen wissenschaftlichen Standpunkt stellen, ist jede Art geschichtlicher Apologetik beiseite geschoben, denn für sie ergibt sich als einzig mögliche Überzeugung, daß ein ungleich tieferer Sinn in der Geschichte steckt, als von allen Apologetikern angenommen wurde und angenommen wird. Diese Überzeugung lautet: Es ist zwar jede historische Epoche im Sinne der Hegelschen Dialektik »vernünftig«, aber eben nur, indem sie niemals mehr ist als eine Station auf dem Wege zum nächsten Ziele. Daraus aber, daß jede Entwicklung zu vielgestaltigeren und damit eben zu höheren Lebenserscheinungen führt, ergibt sich weiter, daß das Höchste niemals in der Gegenwart erreicht ist, noch weniger hinter ihr, sondern stets vor ihr steht.
Den letzten Satz möchten wir besonders unterstreichen, und zwar deshalb, weil er, auf das Gesamtgebiet angewandt, von dem wir hier eine Seite untersuchen wollen, zu einer Reihe wichtiger Konsequenzen führt. Die wichtigste dieser Konsequenzen sei hier gleich vorweggenommen: Wenn wir uns in der geschichtlichen Betrachtung der Kunst auf den prinzipiellen Standpunkt stellen, daß das Höchste stets vor der Menschheit steht, so brauchen wir uns bei aller staunenden Bewunderung gegenüber der grandiosen Schöpferkraft vergangener Heldenzeitalter der Kunst, wie z. B. die Renaissance eines war, niemals mit einem resignierten »das war einmal« zu bescheiden, wir brauchen weiter nicht deprimiert zu folgern: Damals sind Götter über die Erde gewandelt, die für alles die bleibend besten Lösungen geschaffen haben, sondern wir können getrosten Mutes und selbstbewußt sagen: Die Kunst von heute hat uns hundert Erfüllungen gebracht, die in den verschiedensten Richtungen weit über das hinausführen, was die Renaissancekunst erreicht hat, und die Kunst der Zukunft muß wiederum unbedingt das Höhere bedeuten.

6. Opferbecken von drei Priapen getragen. Bronze. In Pompeji gefunden. Original im Museo nazionale, Neapel
Aber nicht nur seitherige Anschauungen und Erklärungsmethoden zu revidieren, lehren uns die umwälzenden Ergebnisse der modernen Wissenschaft, sondern die Entschleierung der dem geschichtlichen Geschehen Gestalt gebenden Faktoren gibt uns noch häufiger die erste Möglichkeit, die inneren Zusammenhänge aller kulturellen Erscheinungen zu enträtseln und dadurch überhaupt erst ihre Grundmauern vor unserer Vorstellung aufzubauen. Das gilt für die Kulturgeschichte in ihrer Gesamtheit wie für alle ihre Einzelgebiete, als da sind: Religionsgeschichte, Sittengeschichte, Rechtsgeschichte usw. Natürlich nicht minder gilt es für die Kunst. Die Grundmauern sind auch in der Kunstgeschichte noch zu errichten. Auch hier sind die inneren Zusammenhänge zwischen der Grundlage jedes einzelnen Zeitalters und seiner spezifischen Kunst, also ihre historische Bedingtheit, erst noch nachzuweisen.
Mancher wird ungläubig den Kopf schütteln und sagen: Was, auch in der Kunstgeschichte, dem bearbeitetsten Gebiete der modernen Literatur, sollten solche Voraussetzungen noch fehlen? Jawohl, auch hier. Man kann dreist den Satz aussprechen: In der Riesenbibliothek, die bis heute über die Kunst zusammengeschrieben worden ist, fehlt sogar noch das Allerwichtigste, nämlich eine systematische Naturgeschichte der Kunst. Die selbstverständliche Folge davon ist, daß wir darum auch noch keine nach modernen wissenschaftlichen Grundsätzen geschriebene Kunstgeschichte haben.
Was wir haben, und zweifellos in Fülle und Überfülle haben, sind durchweg Untersuchungen und Analysen über das »Wie« der Kunst – Bearbeitungen des ästhetischen Problems. Auf diesem Gebiete bewegt sich z. B. auch durchweg das Gute von dem, was die letzten Jahre hervorgebracht haben.
Was wir dagegen nicht haben, ist eine wissenschaftlich haltbare Analyse des »Warum« in der Kunst – Bearbeitungen des kulturgeschichtlichen Problems, das die Kunst darstellt. Wenn wir näher spezialisieren wollen, was wir unter diesem Warum verstehen, so müssen wir sagen: Wissenschaftlich noch kaum untersucht, geschweige denn ausreichend analysiert, sind Fragen wie: Welche Faktoren zeugen und formen die Kunst? Was ruft die Kunst ins Leben, was führte sie zu den gewaltigen Höhen, die sie zuzeiten eingenommen hat, was läßt sie zum reichsten Teppich der Kultur werden, auf dem je nachdem tausend Wunderblumen aufsprießen? Welche Faktoren bedingen andererseits ein bloßes durchschnittliches Vegetieren der Kunst, welche ihren Untergang, das Versiegen ihrer Kraft, ihr Sterben? Wie entsteht ein Stil?
Diese und ähnliche Fragen umfassen jedoch nur die eine Seite des Fehlenden. Dieser einen Seite steht noch eine zweite, und zwar gleich wichtige gegenüber, nämlich die Frage über das Lebensgesetz der Kunst, die Analyse dessen, was sich eigentlich in der Kunst manifestiert. Diese zweite Seite näher spezialisiert lautet: Welches ist der Hauptinhalt der Kunst? Worin besteht ihr Feuer? Was kreist in ihren Adern, was erfüllt und belebt sie? Welches Element ist es im letzten Grunde, das nicht nur am Tage des Entstehens eines Kunstwerkes die Beschauer berauscht, sondern das dieses zu ewigem Leben erhebt und mitunter noch nach Jahrhunderten die Beschauer mit denselben Schauern durchrieselt?

7. Venus Kallipygos. Museo nazionale, Neapel
Man wird zugeben müssen, daß alle diese Fragen nichts weniger als untergeordneter Natur für die Kunstgeschichte sind. Freilich wird man uns auch gleichzeitig einwenden, daß die Beantwortung dieser Fragen anderen Leuten obliegt als den Ästhetikern, nämlich den Historikern und Psychologen. Diesen Einwand werden besonders diejenigen erheben, die zur Kunstbetrachtung ausschließlich als Genießende stehen, für diese – und das ist ja zweifelsohne die große Mehrzahl aller derer, die sich mit der Kunst kritisch beschäftigen – wird das Wie immer die Hauptsache bleiben. Freilich auch für die blanke Oberflächlichkeit wird das Wie das einzig und auch das am meisten Interessierende bleiben, denn auf keinem einzigen anderen Gebiete des geistigen Kulturlebens läßt sich mit einem ähnlich bescheidenen Kapital an positiven Kenntnissen so leicht auskommen wie auf dem der ästhetisierenden Kunstkritik. Jeder kann hier mitreden, und jeder redet hier mit, denn hier genügt als ausreichende Legitimation im Notfall eine einzige Formel: man ist – individuell. Die mißbrauchteste Phrase, die es gibt, denn keiner von den allzuvielen hat je versäumt, auf diese Legitimation zu pochen. Trotz alledem muß aber die Richtigkeit des Einwandes zugegeben werden, daß die Entschleierung der die Kunst im letzten Grunde bestimmenden Gesetze in erster Linie die Aufgabe der Kulturhistoriker ist. Aber wenn man dieses auch zugibt, so bleibt doch noch eines bestehen, nämlich die Indolenz der meisten Ästhetiker gegenüber den Problemen des Warum; die Tatsache, daß nicht wenigstens diese Leute immer und immer wieder auf diese Lücke und auf die Notwendigkeit der Beantwortung dieser Fragen hinweisen. Diese Tatsache beweist, daß man entweder keine Ahnung von dem Fehlen der wichtigsten Grundlage der Kunstgeschichte hat, oder daß man von der grundlegenden Bedeutung, die die wissenschaftliche Beantwortung der oben genannten Fragen für eine richtige und tiefe Erfassung jedes einzelnen ästhetischen Problems hat, eine sehr bescheidene, wenn nicht gar keine Vorstellung besitzt. Wir selbst gehen noch weiter, indem wir behaupten, daß eine ästhetische Analyse überhaupt erst dann zu wirklich stichhaltigen und erschöpfenden Urteilen und Resultaten gelangen kann, wenn sie sich auf Grund der vollen Kenntnis der Naturgeschichte der Kunst aufbaut; erst dann werden sich die tiefsten Geheimnisse der Kunst auftun. Ohne eine solche Naturgeschichte der Kunst, und bis wir eine haben, bleibt das meiste von dem, was über so wichtige Fragen wie z. B. der Einfluß der Kunst eines Landes auf die eines anderen Landes, oder das Nackte in der Kunst und Ähnliches gesagt wird, mehr oder minder hohles Geschwätz. Erst dann, wenn man imstande ist, zu erkennen, auf Grund welcher Faktoren sich Umwälzungen in der Kunst vollziehen, was ihren Zeitpunkt bedingt und was sich dabei vollzieht, vermag man diese Erscheinungen auch ästhetisch richtig zu charakterisieren.

8. Aus einem Bacchuszuge. Nach einem Freskogemälde in der Casa Vettii, Pompeji
Man wird nun fragen: Ja, wo ist denn der Beweis für diese Behauptung, daß ohne eine solche Entschleierung der vorhin genannten Probleme nur Halbheiten herauskommen können? Auf diese Frage könnte man einfach mit dem Hinweis darauf antworten, daß das nun eben einmal die innere Logik aller Dinge ist; daß man auf allen Gebieten immer erst dann zu richtigen Erkenntnissen gelangt, wenn man in ihre Naturgeschichte eingedrungen ist, wenn man ihre historische Bedingtheit kennt, wenn man die Gesetze erfaßt hat, die sie entstehen und vergehen lassen usw. Aber wir wollen uns mit diesem Hinweis nicht begnügen, sondern wir wollen mit einer Gegenfrage antworten, indem wir zugleich dieses »Warum« in der Kunst an zwei willkürlich herausgegriffenen Problemen illustrierend spezialisieren wollen. Erstens: Wie kam es, daß die Renaissance in Deutschland gerade im ausgehenden 15. Jahrhundert so kräftig einsetzte, und wie kam es andererseits, daß sie in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts fast unvermittelt wieder abbrach? Zweitens: Warum ist der deutsche Norden, abgesehen von den Hansastädten, bis in unsere Gegenwart herein künstlerisch gänzlich unproduktiv geblieben?
Dies sind nur zwei Fragen, man könnte ebenso leicht Hunderte aneinanderreihen, und bei allen würde man ebenso vergeblich nach einer wissenschaftlich befriedigenden Antwort Ausschau halten. Selbstverständlich legen wir den Nachdruck auf das Wort wissenschaftlich, denn aufgedrängt haben sich diese Fragen ja immer schon, und man hat sie im Vorbeigehen auch hie und da beantwortet. Aber eben wie! Man denke als Beispiel gerade an die Antwort, mit der man das Problem des jähen Ausklanges der deutschen Renaissance durchgehend abgetan findet: »um jene Zeit war die schöpferische Kraft in Deutschland erloschen«, – so kann man tatsächlich Hunderte Male lesen. Ebenso charakteristisch ist die Art, wie man sich irgendeinen auffälligen Umschwung in der Grundstimmung der Kunst erklärt. Einer der verdienstvollsten und am meisten gelesenen Kunsthistoriker der Gegenwart – der Name tut hier nichts zur Sache, denn wir polemisieren nicht gegen einzelne Personen, sondern gegen eine fehlerhafte und ungenügende Art der Geschichtsbetrachtung – leitet z. B. den Umschwung, der sich an der Wende des 16. Jahrhunderts, von Florenz ausgehend, in der Kunst vollzog, die jähe Rückkehr zur Askese von dem tiefwirkenden Eindruck der gewaltigen Bußpredigten Savonarolas her. »Was hat Savonarola aus diesem Geschlecht gemacht!« heißt es. Und dann wird der Umschwung in der Florentiner Kunst jener Jahre geschildert, die heidnische Sinnenfreude, die vor dem Auftreten Savonarolas die Werke dieser Künstler erfüllte, die christlich-zerknirschte, selbstquälerische Asketik, die nach seinem Auftreten darin lebte. »Für den einen [Künstler] ist Savonarola der böse Dämon, für den anderen der heilige Geist. Dem raubt er seine Ideale, jenem verhilft er dazu, sich selbst zu entdecken.«
Solche Erklärungen – und dieser Art sind sie fast alle, denen man in den landläufigen kunstgeschichtlichen Darstellungen begegnet – sind ganz roh empirisch. Sie behandeln die Dinge einfach als gegebene Tatsachen und stellen dann zwischen ihnen auf Grund ihres anscheinenden äußerlichen Zusammenhanges einen Kausalnexus her.
Dem, der das Wesen der Dinge begreifen will, ist mit solchen Erklärungen natürlich nicht gedient, er will mehr wissen. Auf die Antwort: »die schöpferische Kraft war erloschen«, repliziert er sofort mit der anderen Frage: Ja, warum war sie denn gerade in Deutschland um jene Zeit erloschen, und warum in Holland nicht und in Venedig nicht? Und erst in der Beantwortung dieser Frage wird er das ursächliche, das wirklich bestimmende, das immanente Gesetz erblicken. Und dieses immanente Gesetz will er entschleiert haben und nicht bloß eine verbindende Brücke. Dieses Gesetz systematisch zu entschleiern, ist aber das, was man unter einer Naturgeschichte der Kunst zu verstehen hat, und diese allein kann auch, wie schon gesagt, die Antwort auf alle die oben aufgeworfenen und bis jetzt als unbeantwortet bezeichneten Fragen geben. Diese Naturgeschichte aber kann wiederum, weil die Kunst ein integrierender Bestandteil der Geschichtswissenschaft ist, nur dann zu haltbaren Resultaten führen, wenn sie auf Grund der oben (S. 2) genannten Methode konstruiert wird, die überhaupt erst die geschichtliche Wissenschaft begründet hat, und das ist der historische Materialismus.

9. Silen (Die Potenz). Pompejanische Bronze
*
Den Mangel einer systematischen Naturgeschichte der Kunst empfindet man am stärksten, wenn man bei irgendeiner besonderen Seite der Kunst den Dingen auf den Grund gehen will. Darum trat uns auch dieser Mangel auf Schritt und Tritt entgegen, als wir das Problem, das das erotische Element in der Kunst darstellt, nicht nur als Erscheinung schildern, sondern auch in seiner Bedingtheit ergründen wollten. Es ergab sich uns sehr bald, daß man ohne eine solche Naturgeschichte, auf die man als auf etwas Feststehendes verweisen kann, überhaupt zu keinem Resultate kommt, ja daß ohne sie alle Schlüsse in der Luft hängen. Aus diesem Grunde blieb gar nichts anderes übrig, als nachzuholen. Natürlich im engsten Sinne des Wortes; sozusagen in der Form eines provisorischen Notgerüstes. Denn es würde den Rahmen dieser Arbeit – aber auch unserer Kräfte, was wir sehr wohl wissen – weit überschreiten, wollten wir hier die noch fehlende Naturgeschichte der Kunst zu konstruieren versuchen. Was wir aber tun wollen und uns auch anmaßen dürfen, das ist: Bohrversuche zu machen und zu schürfen, und wir wollen zufrieden sein, wenn es uns gelingt, so weit durch den äußeren Schein zum inneren Wesen vorzudringen, daß man das den wechselnden Erscheinungen des künstlerischen Geschehens zugrunde liegende letzte Bewegungsprinzip wenigstens in den Hauptlinien zu erkennen vermag …
Wenn man bei solchen Untersuchungen von jenen Irrwegen fern bleiben will, auf die man sofort abirrt, sobald man auch nur im geringsten zugibt: die Kunst habe ihre Sondergesetze, denn sie hat deren ebensowenig wie die Geschichte der Erfindungen und Entdeckungen, die Geschichte der Philosophie usw. solche hat, so muß man ebenso vorgehen wie bei der Erforschung der die Gesamtgeschichte bestimmenden Gesetze. Das heißt, man muß gewissermaßen in derselben Weise verfahren wie der Physiker bei der Feststellung physikalischer Gesetze. Um grundlegende Gesetze zu gewinnen, abstrahiert der Physiker bei der von ihm zu untersuchenden Erscheinung alle die störenden Einflüsse, die in der Wirklichkeit nie fehlen. Genau so muß der Historiker verfahren. Nur muß bei ihm an Stelle der Präzisionsinstrumente, der Wage, des Mikroskops, des künstlich geschaffenen luftleeren Raumes usw. die Abstraktion treten. Karl Kautsky hat dieses Verfahren einmal folgendermaßen trefflich analysiert und begründet:

10. Pompejanische Bronzelampe mit Liebesszene
Ein jedes naturwissenschaftliche oder gesellschaftliche Gesetz ist ein Versuch, Vorgänge in der Natur oder in der Gesellschaft zu erklären. Aber kaum einer dieser Vorgänge wird durch eine einzige Ursache bedingt. Die verschiedensten und verwickeltsten Ursachen liegen den verschiedenen Vorgängen zugrunde, und diese Vorgänge selbst spielen sich nicht unabhängig voneinander ab, sondern durchkreuzen sich in den verschiedensten Richtungen. Der Erforscher der Zusammenhänge in der Natur oder Gesellschaft hat daher eine doppelte Aufgabe. Er muß erstens die verschiedenen Vorgänge voneinander sondern, sie isolieren; er muß zweitens die Ursachen, welche diesen Vorgängen zugrunde liegen, voneinander sondern, die wesentlichen von den unwesentlichen, die regelmäßigen von den zufälligen. Beide Arten der Forschung sind nur möglich durch die Abstraktion. Durch die Abstraktion gelangt der Forscher zur Erkenntnis eines Gesetzes, das den Erscheinungen, die er erklären will, zugrunde liegt. Ohne dessen Kenntnis können die betreffenden Erscheinungen nicht erklärt werden; aber keineswegs genügt dies eine Gesetz allein, um diese Erscheinungen völlig zu erklären. Eine Ursache kann durch eine andere Ursache geschwächt, ja in ihrer Wirkung völlig aufgehoben werden; es wäre jedoch falsch, aus einem solchen Falle schließen zu wollen, daß die Ursache überhaupt nicht bestehe. Die Gesetze des Falles gelten z. B. nur im luftleeren Raume: hier fallen ein Stück Blei und eine Feder gleich schnell zu Boden. Im mit Luft erfüllten Raum ist das Ergebnis ein anderes, wegen des Widerstandes der Luft. Trotzdem ist das Fallgesetz richtig.
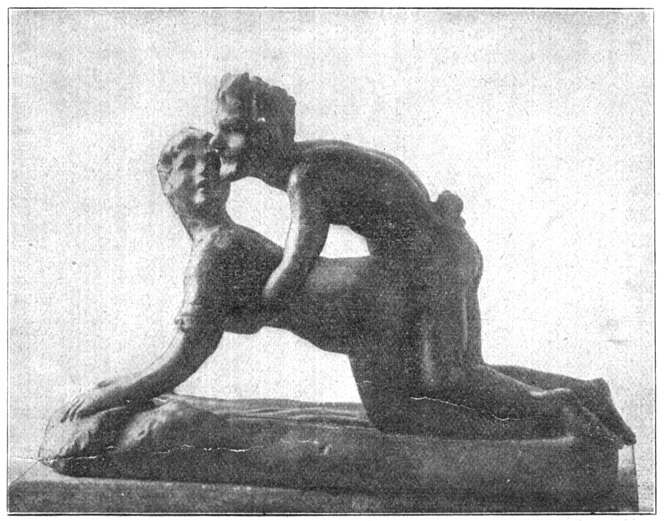
11. Faun und Nymphe. Bronzegruppe aus Pompeji. Museo nazionale, Neapel
Das gleiche gilt ohne Einschränkung sowohl vom künstlerischen Geschehen als Erscheinung als auch vom Entschleiern seiner Gesetze. So wenig sich im gesellschaftlichen Leben ein einziges Gesetz rein durchsetzt, ebensowenig ist es in der Kunst ein einziger Faktor, der diktiert und formt. Im Gegenteil, eine ganze Reihe von Faktoren wirken hier bestimmend und beeinflussend. Das künstlerische Geschehen ist wie jedes andere geistige oder moralische Gebiet, wie Literatur, sittliche Anschauungen, Rechtsbegriffe usw. nur das Schlußergebnis vieler sich gegenseitig beschränkender, einander durchkreuzender oder einander in ihrer Wirkung sich beeinträchtigender Gesetze. Es kann also auch hier niemals ein einziges Gesetz rein zur Geltung kommen. Nichtsdestoweniger ist es aber auch gegenüber dem künstlerischen Geschehen unerläßlich, analytisch nach den reinen, nach den absoluten Gesetzen zu forschen. Denn einzig auf diesem Wege gelangt man dahin, das im letzten Grund entscheidende zu finden, und das nur mitbestimmende und untergeordnete in seiner nur beeinflussenden Bedeutung zu erkennen. Auch bei der Kunst gelten die gleichen geschichtlichen Erfahrungstatsachen wie bei allen anderen Gebieten des Lebens, und deren allerwichtigste ist die, daß das Grundgesetz, die immanente Tendenz sich schließlich, wenn auch noch so modifiziert, immer wieder Geltung verschafft. Auch die leichteste Federflocke fliegt nicht ewig, losgelöst von aller Erdenschwere und allen Gesetzen des Falles zum Trotz, durch das Weltall. And die Kunst ist nichts weniger als eine Federflocke, wenn sie auch häufig nur aus Duft und Schimmer gewoben zu sein scheint.
Um in der Erforschung der im letzten Grunde bestimmenden Gesetze des künstlerischen Geschehens nach der oben akzeptierten Methode zu verfahren, muß man selbstverständlich auch davon absehen, isoliert zu untersuchen; man darf nicht von künstlerischen Einzelindividuen ausgehen, sondern muß immer die Kunst in ihrer Gesamterscheinung während einer bestimmten historischen Epoche ansehen und prüfen; infolgedessen darf nur das Gemeinsame einer bestimmten Phase die Anhaltspunkte liefern.
Oben (S. 2) ist gesagt worden, daß es die jeweiligen ökonomischen Grundlagen einer Gesellschaft sind, die ureigentlich die gesellschaftlichen Lebensformen bedingen, d. h. daß diese Lebensformen sich immer wandeln, entsprechend den Wandlungen, die die ökonomische Grundlage infolge der nie rastenden Entwicklung durchmacht, und daß Religion, Philosophie, sittliche Anschauungen, Rechtsanschauungen einer Zeit usw. nur den ideologischen Überbau über dieser Basis darstellen; sie sind der veränderte geistige Ausdruck veränderter materieller Bedürfnisse. Daraus folgt, daß alle diese und ähnliche Faktoren nicht die Ursachen der innerhalb der menschlichen Gesellschaft vor sich gehenden Umwälzungen sind, sondern eben nur die Wirkungen darstellen. Wenn also in der Religion, in der Philosophie, in den sittlichen Anschauungen, den Rechtsbegriffen usw. Veränderungen zu konstatieren sind, so ist das nur der Beweis dafür, daß in der Basis, im Gesamtkomplex der ökonomischen Struktur wichtige Umwälzungen sich anbahnen oder vorausgegangen sind.
Das gleiche gilt von der Kunst. Und zwar ohne die geringste Einschränkung. Auch sie ist niemals in dem hier in Frage kommenden Sinn Ursache, sondern stets Ausfluß, stets Resultante. Sie ist nur die edelste Form des ideologischen Kristallisierungsprozesses, der besonderen Bedürfnisse einer Zeit. Wenn aber alles künstlerische Geschehen ebenfalls der Ausfluß der allgemeinen ökonomischen Grundlage der Gesellschaft ist, so müssen von dieser Voraussetzung folgerichtig auch die wesentlichen Details abhängen: Entstehen, Blühen, Reichtum, Verkümmern. And ebenso die Formen, in denen sich dieses künstlerische Leben zum Ausdruck ringt und manifestiert. Das heißt: Diese Formen können nicht ein bloßes »auch« sein, sie müssen eine der Hauptsachen sein, denn in der Veränderung, in der Weiterentwicklung der künstlerischen Formen kommt in erster Linie die in den Grundfesten sich ständig vollziehende Umwälzung zum Ausdruck.

12. Priapstatue Aus Marmor Original in Neapel
Um nun durch den äußeren Schein, zu dem die Kunst beherrschenden Bewegungsprinzip vorzudringen, muß man damit anfangen, bis zu den Geburtsstätten des individuellen Kunstschaffens zurückzugehen. Bei diesem Bemühen stößt man als erstes auch schon auf die wichtigste Tatsache, nämlich auf den Umstand, daß es zu einem individuellen Kunstschaffen in der gesamten Geschichte erst beim Vorhandensein einer Städtekultur kommt, daß es erst mit dieser in die Geschichte eintritt und daß seine gesamte Entwicklung mit der Entwicklung der Städtekultur zusammenfällt, daß es mit dieser steigt, mit dieser stagniert und mit dieser fällt. Künstlerische Betätigung als solche entsteht natürlich schon früher, sie setzt ein, sowie die Menschen Muße haben; also freie Kräfte zur Verfügung stehen, die nicht zur Gütererzeugung notwendig sind. Anders ist es mit dem individuellen Kunstschaffen. Das individuelle Kunstschaffen seht logisch einen individuellen Besteller voraus. Das Vorhandensein eines solchen ist aber an das Vorhandensein der Geldwirtschaft geknüpft. Entstehung der Geldwirtschaft und Städtebildung ist aber dasselbe. Zur Städtebildung kommt es überall dann und dort, wo der Produktionsprozeß den naturalwirtschaftlichen Rahmen verläßt, weil er in seiner Entwicklung allmählich zur Arbeitsteilung geführt hat. Arbeitsteilung im Produktionsmechanismus aber führt zu Handel, und Handel bedeutet Geldwirtschaft und erfordert gleichzeitig ein Ansammeln von Menschen an solchen Plätzen, die seinen Zwecken besonders günstig sind – so entsteht die Stadt. Ist man sich darüber klar, so ist es auch unschwer zu begreifen, daß nur in der Stadt das individuelle Kunstschaffen entstehen kann. Außerdem ist ja das individuelle Kunstschaffen auch nichts anderes als die Spezialisierung des Arbeitsprozesses auf dem Gebiete des Künstlerischen.
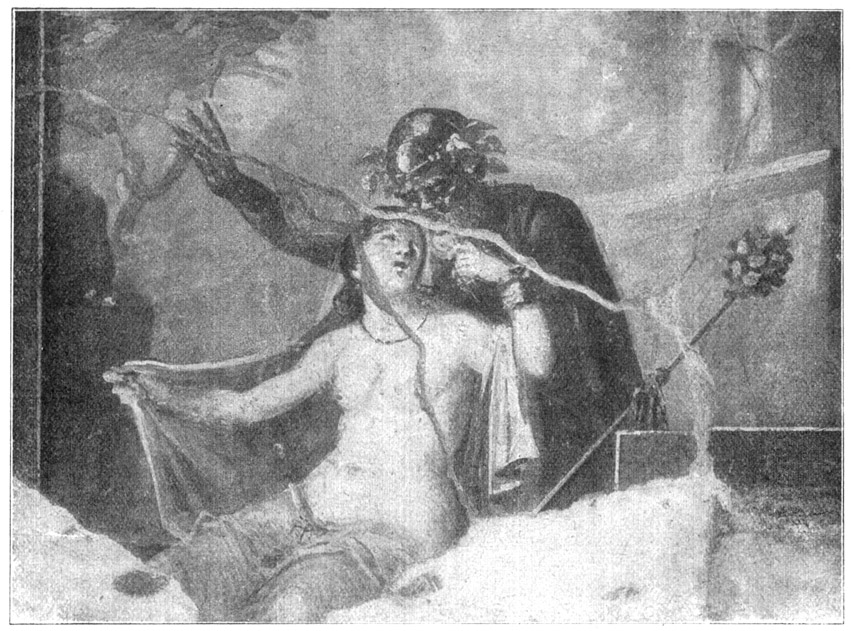
13. Silen und Hermaphrodit. Freskogemälde in der Sasa Vettii, Pompeji
Aber damit ist die Frage doch erst zur Hälfte beantwortet, daß das individuelle Kunstschaffen nur in der Stadt entstehen kann. Es bleibt noch die Frage offen, warum das individuelle Kunstschaffen auch unbedingt in der Stadt entsteht. Mit der Möglichkeit des Entstehens eines individuellen Kunstschaffens allein ist es nämlich noch nicht getan. Diese Möglichkeit ist nur die unerläßliche Voraussetzung. Um zu künstlerischen Ergebnissen zu führen, und gar, um das Kunstschaffen zu starker Entfaltung zu bringen, müssen noch andere Faktoren hinzutreten; nämlich die äußeren Antriebskräfte. Diese Antriebskräfte bilden die Bedürfnisse nach Kunst.
Und auch diese werden mit der Stadt geboren. Aber erst mit der stärkeren Entwicklung der Städte, wenn das neue ökonomische Prinzip, die Geldwirtschaft, das die Stadt verkörpert, bereits zu den ihr eigentümlichen gesellschaftlichen Formationen geführt hat, zu einem größeren Kreise von Geldbesitzenden und damit zur Klassenscheidung. In diesem Stadium und erst in ihm entsteht das Bedürfnis nach Kunst und entwickelt sich das individuelle Kunstschaffen, denn jetzt sind zu den Entstehungsmöglichkeiten auch die Antriebskräfte hinzugekommen. Diese Antriebskräfte bestehen in folgendem: Mit dem leichteren Erwerb und mit dem Wachstum an Besitz in dem Maße, daß er ständig über das hinausgeht, was man zum normalen Lebensunterhalt braucht, entstehen neue Bedürfnisse, und zwar in Form von Wünschen nach einem größeren Maße von Lebensgenüssen; man will sein Dasein verschönern. Diese Wünsche werden zuerst und vielfach roh befriedigt, also z. B. durch übermäßiges Essen und Trinken, oder durch den Genuß seltener und teuerer Speisen und Getränke. Aber auch hier schlägt bei einem gewissen Grade der Entwicklung die Quantität in die Qualität um. Mit der fortschreitenden Entwicklung der Geldwirtschaft wachsen die gesamten Resultate, die Qualität und Schönheit der technischen Erzeugnisse wird vollendeter: der Bau der Häuser, die Kleidung usw., alles wird luxuriöser; und alles dieses wird Mittel gesteigerteren Lebensgenusses. Die letzte und vornehmste Spitze des gesteigerten Verlangens nach Lebensgenuß wird schließlich die Kunst. Zu dieser Spitze führt die Kultur um so häufiger, je ausgeprägter und intensiver die Kapitalsanhäufung in einer Stadt vor sich geht und je umfangreicher der Kreis von Geldbesitzenden ist.
Aber die Kunst als sozusagen indifferentes Mittel gesteigerten Lebensgenießens ist doch nur eine der Antriebskräfte, nur die eine Bedürfnisquelle. Es kommt noch ein zweiter, gleich wichtiger Faktor hinzu: Die Kunst wird in der Stadt noch außerdem den Interessen der Klassenherrschaft dienstbar gemacht, und zwar in der Weise, daß sie zum Klassenunterscheidungsmittel erhoben wird.
Immer, wo es verschiedene Klassen innerhalb einer Gesellschaft gibt und dabei die eine kraft ihrer materiellen Machtmittel über die andere herrscht, ist es ein Bestreben der herrschenden Klasse, sich zu unterscheiden; den Blicken der Mitmenschen die höhere Position, auf der man auf der sozialen Stufenleiter steht, augenfällig zu machen. Natürlich geschieht dies nicht tendenzlos, sondern im wohlverstandenen Interesse der eigenen Klassenherrschaft, um den Einfluß und die Macht, die man besitzt, dadurch, daß man sie zeigt, ständig zu steigern und somit immer mehr zu befestigen. Speziell zu diesem Zweck wurde früher die Klassenscheidung besonders in den äußeren Formen streng durchgeführt. Und als bevorzugtestes Mittel diente in allen Anfängen kapitalbildender Zeit der Luxus. Der Reiche und Mächtige erschien öffentlich stets in besonders kostbaren Kleidern, und ständig von einem Troß Bedienten umgeben, die ebenfalls aufs kostbarste gekleidet waren. Der Reiche gab große und öffentliche Gastmähler, die kraft der Verschwendung, die dabei getrieben wurde, überall von sich reden machten. Außerdem aber hielt man täglich offene Tafel, an der jeder vornehme Fremde, der durch die Stadt kam, sich ohne weiteres selbst zu Gaste laden durfte. Als Wohn- und Herrschaftssitze errichtete man sich stolze Gebäude, Paläste, die protzig aus den dürftigen Wohnstätten der minder Bemittelten emporragten usw. usw. Auf diese Weise sollte der Reichtum und die Macht, über die man gebietet, aller Welt überzeugend vor Augen geführt werden. Alles das ist aber von vornherein eng und dauernd mit der Kunst verknüpft: Der Kunst bedurfte man zum Entwurf schöner Kostüme, der Kunst bedurfte man zum wirkungsvollen Arrangement der Feste, ihrer bedurfte man beim Bau und Schmuck der Läufer, kurz bei allen möglichen Gelegenheiten.
Aber nicht nur dazu rief man die Kunst auf den Plan. Sie war außerdem ein für sich selbst benütztes Mittel, und zwar eines der bevorzugtesten, weil sie zu dem Zwecke, die Klassenscheidung zu markieren, in ganz besonderem Maße geeignet war. Jede herrschende Klasse hat das Bedürfnis, ihre Herrschaft nicht nur als die natürliche Ordnung der Dinge darzustellen, sondern sie überdies zu glorifizieren. Weil aber die Kunst die höchste geistige Ausstrahlung jeder Kultur darstellt, ist sie in allen Zeiten das gegebene und wirkungsvollste Glorifizierungsmittel. Es liegt auch auf der Hand, daß man durch nichts so beredt die Macht und die Größe des Reichtumes verkünden lassen konnte als durch das Sprachrohr der Künste. Alles konnte durch ihre Mittel im strahlendsten Lichte erscheinen: eine Ahnengalerie festigte das autoritative Ansehen – man ist gleichsam von der Vorsehung zur Herrschaft vorausbestimmt; besondere Taten, die von dem einen oder anderen der Vorfahren vollbracht worden waren, konnten im Heldengedicht oder im symbolisierten Gemälde mit der Gloriole höchsten Heldentumes umwoben werden; als Stifter von Kirchengemälden betätigte man sich als Förderer von Allgemeininteressen, wobei man fürsorglich der eigenen Verherrlichung nicht vergaß, indem man sich als Stifter oder sonstwie ebenfalls darauf abbilden ließ. Damit sind natürlich noch lange nicht alle Formen erschöpft, in denen man die Kunst direkt im Interesse der Steigerung der eigenen Machtstellung in seine Dienste stellte, dies sind nur die wichtigsten und nächstliegenden. Wer die Geschichte der Künste kennt, weiß, daß es nicht zu den Seltenheiten gehört, daß als Motiv bei irgendeiner künstlerischen Bestellung der Satz wiederkehrt: es möge alle Sorgfalt darauf verwendet werden, »auf daß unser Ruhm glänze durch alle Zeiten«.
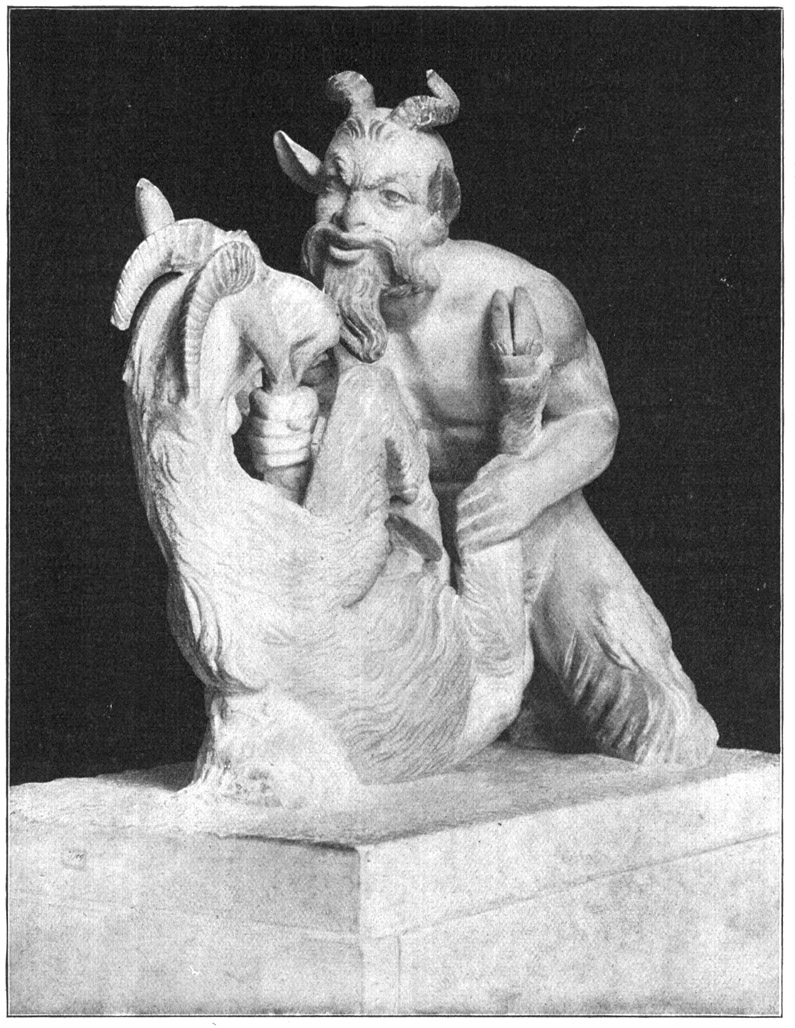
14. Satyr und Ziege. Marmorgruppe aus Herkulanum. Original im Museo nazionale. Neapel
Um dieses Gebaren, dem man in dieser ausgesprochenen Weise nur in den Anfängen der kapitalbildenden Zeit begegnet, und das in unserer Gegenwart ganz wesentlich modifiziert in Erscheinung tritt, ganz zu verstehen, muß man jedoch bis zur letzten Wurzel vordringen; diese besteht in dem Unterschiede zwischen der heutigen Form der Geldwirtschaft und der von damals. Heute ist die Hauptaufgabe, die sich der Kapitalist stellt, die Akkumulation, die Anhäufung von Kapital, um Betriebe zu vergrößern, neue zu errichten, die Konkurrenz zu überflügeln. Darin besteht seine Macht und sein Einfluß. Diese werden nicht im geringsten vermindert, wenn er das einfachste Leben führt, wenn ihn äußerlich nichts vom Minderbemittelten unterscheidet, so wenig wie sie wachsen, wenn er Unsummen vergeudet, verjeut, verbaut, mit Weibern verpraßt –; im Gegenteil, das letztere schwächt heute in den meisten Fällen seinen Einfluß. Ganz anders lagen die Dinge zur Zeit der einfachen Warenproduktion. In jenen Zeiten konnte der Reiche sein Einkommen nicht in Aktien und Staatspapieren anlegen; bestand es in Naturalien, so konnte er es nur zum Konsum verwenden – daher die offene Tafel, daher die Mildtätigkeit der Klöster in Form von Speisung der Firmen –, bestand es aber in Gold, so gab es keine andere Form der Anlage als in der eines Schatzes, bestehend aus Schmuck, Edelsteinen, Bauten, Kunstgegenständen usw. Kunstschätze sammeln war eine der damaligen Formen der Kapitalanhäufung.
Dieser fundamentale Unterschied in der Geldwirtschaft von heute und der von damals ist die im letzten Grund entscheidende Ursache für den ungeheuren Luxus, der früher von den Reichen und Mächtigen getrieben wurde. Da nun aber weiter, wie wir ebenfalls gezeigt haben, gerade die Kunst einer der Hauptbestandteile größerer Luxusbetätigung ist, so haben wir in diesem Unterschiede der Geldwirtschaft von damals und heute zugleich auch den Schlüssel für die reiche Kunstproduktion jener Zeiten. Nur durch diesen Schlüssel erschließt sich uns die Erkenntnis, warum in jenen Jahrhunderten das goldene Zeitalter für die Kunst herrschen konnte und auch herrschen mußte. –
Eine Erscheinung, die derart von der Entwicklung der Gesellschaft abhängig ist, muß von denselben Faktoren auch ihre äußere Form diktiert bekommen. Die innere Notwendigkeit dieser Behauptung läßt sich ebenfalls historisch begründen.
Jeder politische Gesellschaftszustand bedarf nach außen seiner sittlichen Rechtfertigung. Und jedes Zeitalter liefert denn auch diese sittliche Rechtfertigung, indem die herrschende Gewalt ihre Herrschaftsrechte, sowohl juristisch als auch moralisch begründet. Ein Bestandteil der moralischen Begründung ist die ideologische Verklärung des herrschenden Zustandes. Diese ideologische Verklärung ist die Aufgabe der zeitgenössischen Kunst. Die Künste der Vergangenheit erfüllen diese Aufgabe stets auf das prompteste, gleichsam wie einen diktatorischen Befehl. Und das ist selbstverständlich, weil die Kunst damit nur ein Naturgesetz erfüllt. Ebenso selbstverständlich ist freilich auch, daß diese Aufgabe durchaus unbewußt erfüllt wird.
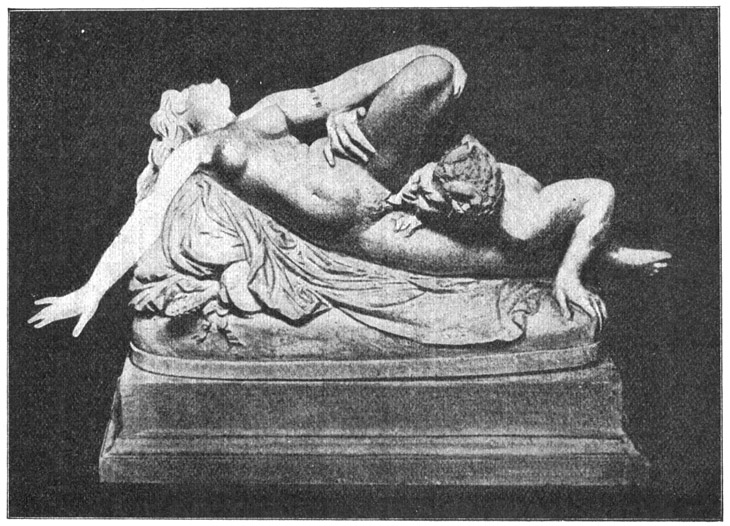
15. Faun und Nymphe. Bronzegruppe. Original ehemals im Vatikanischen Museum, Rom
Bei der Beweisführung, wie die ideologische Verklärung eines herrschenden Zustandes vor sich geht, kommt es nun darauf an, zu zeigen, daß es sich beim künstlerischen Gestalten nicht um etwas von der Erscheinungswelt Unabhängiges und deshalb Willkürliches, sondern eben um die Erfüllung eines Naturgesetzes handelt, daß, wie schon gesagt, die Formen der Kunst den allgemeinen Bedürfnissen und nicht umgekehrt: die Bedürfnisse den Formen der Kunst folgen; daß also auch hier »das gesellschaftliche Sein das Bewußtsein und nicht das Bewußtsein das gesellschaftliche Sein formt«.
Was wir weiter oben als das Wesen aller Klassenanschauungen bezeichnet haben, daß jede in sich die Spitze der Entwicklung erreicht sieht, gilt in gleicher Weise von jedem einzelnen Zeitalter. Jedes Zeitalter sieht in sich gewissermaßen den Zweck der Menschheit erfüllt, oder zum mindesten sieht jede herrschende Klasse in ihrer Herrschaft die natürliche Ordnung der Dinge. Weil man aber die Dinge dermaßen anschaut, so entwickeln sich unbedingt in der geistigen Gesichtswelt der betreffenden Zeit unwillkürlich jene Eigenschaften zum Ideal, auf denen die Existenz der betreffenden Zeit aufgebaut ist, also jene, die ihr die spezielle Physiognomie geben. Das ist z. B. im mittelalterlichen Feudalstaat der Ritter: die Eigenschaften der persönlichen Kraft und Entschlossenheit; im 16. Jahrhundert der weltbeherrschende Kaufmann: die Eigenschaften weitschauender ruhiger Überlegung; im Zeitalter des persönlichen Regimentes, des Absolutismus: das Majestätische, die Eigenschaften der gottähnlichen Unnahbarkeit usw. usw. Diese Eigenschaften sind in der Tat jeweils die Ideale der betreffenden Zeiten. Indem sie aber gleichzeitig den künstlerischen Typ, den künstlerischen Stil der betreffenden Zeiten überhaupt repräsentieren, und indem sie weiter in der Kunst immer erst im Augenblicke des Wirklichkeitwerdens der betreffenden gesellschaftlichen Formen auftreten und ihr nicht vorangehen – was doch alle Welt weiß –, so gibt es daraus nur eine einzige vernünftige Schlußfolgerung, und diese lautet: Nicht die zufällig im Kopfe des Künstlers entstandene Linie wird zum Stil einer Zeit, sondern: der künstlerische Stil eines Zeitalters ist nichts anderes als ihr formgewordenes Lebensgesetz. Oder in den Worten ausgedrückt, die zu beweisen waren: Es ist die jeweilige ökonomische Grundlage der Gesellschaft ins Künstlerisch-Formale umgesetzt. Das gilt uneingeschränkt freilich nur von jenen Zeiten, in denen es noch keine zum vollen Bewußtsein gewordenen Klassenscheidungen innerhalb der Gesellschaft gibt. Das Lebensgesetz einer Zeit, das in Wahrheit meist nur das Interesse einer einzelnen Klasse, nämlich der herrschenden, stützt, kann nur so lange zum künstlerischen Allgemeinstil einer Zeit werden, und in einer sogenannten Stileinheit resultieren, als die sämtlichen anderen Klassen den gegebenen historischen Zustand für einen in seinem Wesen unverrückbaren halten; die Kritiker dürfen höchstens Schönheitsfehler an ihm finden. Also nur so lange entsteht Stileinheit in der Kunst, als noch keine Klassen in Aktion sind, die bewußt die Dinge im Prinzip ändern wollen. Woher es denn kommt, daß es z. B. im 19. Jahrhundert keine ähnliche Stileinheit in der Kunst mehr gibt wie im Altertum, im Mittelalter, in der Renaissance und im Rokoko. Heute rechnet die größte Klasse, die Arbeiter, mit der bürgerlichen Gesellschaftsordnung und dem Privatkapitalismus, auf dem sie aufgebaut ist, nicht mehr als mit etwas Unabänderlichen, und die Kräfte, die danach drängen, daß die allgemeine historische Situation prinzipiell geändert wird, sind außerdem bewußt am Werke.

16. Mänade vor einer Priapsstatue. Gemme
17. Nymphe und Priap. Gemme
18. Triumphzug des Priap. Gemme
19. Faun und Nymphe. Gemme
20. Leda und der Schwan. Gemme
Diese Voraussetzung führt zu einer weiteren nicht unwichtigen Konsequenz. Weil jedes Zeitalter in der Herrschaft einer bestimmten Klasse gipfelt – Kirche, ritterliche Gesellschaft, Handwerksmeister, Kaufmann, absolute Monarchie, Kleinbürgertum, Bourgeoisie usw. – und weil eben stets speziell diese herrschende Klasse in dem Kunststile der Zeit ihre Glorifikation erlebt, so ergibt sich daraus, daß es niemals Kunst im allgemeinen geben kann, sondern stets nur Klassenkunst. Der Typ der anderen Klassen gestaltet sich im Zeitbilde stets gemäß der Logik der herrschenden Klassen, die sich einzig auf deren Herrschaftsinteressen aufbaut. Vulgär ausgedrückt: Man schaut die Dinge niemals absolut richtig, sondern eben stets mit den Augen »seiner Zeit« an. Die Augen »seiner Zeit« sind aber stets die Augen der jeweils herrschenden Klasse. Denn jede herrschende Klasse zwingt ihre Ideologie ihrem Zeitalter als die allgemein gültige auf.
Natürlich muß auf Grund derselben Bedingungen der Stil in derselben Weise sich verändern, in der sich die ökonomische Basis der Gesellschaft ändert. Und auch das belegt jede vergleichende historische Kontrolle. Das ist eine ganz außerordentlich wichtige Tatsache, denn aus ihr folgt eben gerade die historische Notwendigkeit, daß jeder neuen Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung ganz bestimmte neue Kunstformen entsprechen. Beide Faktoren sind organisch miteinander verwachsen und untrennbar. Darum kann man auch stets von dem einen auf das andere schließen. Also nicht nur von dem ökonomischen Inhalt einer Zeit auf den Stil, sondern auch umgekehrt. Und darum ebenso auch von einer sich vollziehenden Veränderung des Stils auf die Tatsache, daß in der ökonomischen Grundlage der betreffenden Gesellschaft prinzipielle Veränderungen vor sich gehen oder schon bereits vor sich gegangen sind.
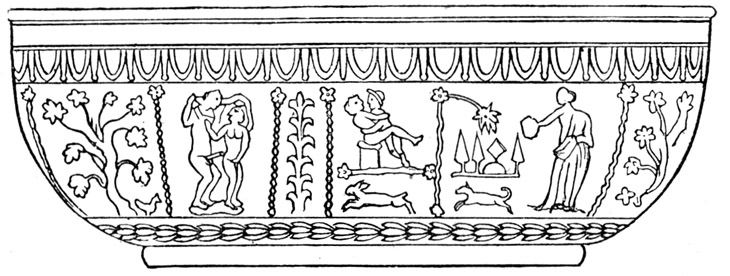
21. Schale aus Terrakotta mit erotischen Darstellungen Von der Insel Samos
*
Bis jetzt haben wir aus den ökonomischen Untergründen des gesellschaftlichen Lebensprozesses die folgenden Probleme, die die Naturgeschichte der Kunst stellt, hergeleitet: Die notwendigen Voraussetzungen der Entstehungsmöglichkeit individuellen Kunstschaffens, die Antriebskräfte, die bei vorhandener Entstehungsmöglichkeit zur Kunstproduktion führen, und drittens: die Frage des Stils in der Kunst. Mit anderen Worten, wir haben begründet, was wir oben sagten: Entwickelte Geldwirtschaft ist die Voraussetzung für das Entstehen des individuellen Kunstschaffens, aber nicht nur Voraussetzung ist sie, sie ist auch sein Gesetzgeber und diktiert ihm von nun ab alle seine Formen.
Nun bleibt uns noch ein letztes Problem aus diesen Untergründen zu erklären übrig. Und zwar die historisch-ökonomische Bedingtheit des besonders jähen und gewaltigen künstlerischen Aufstieges zu gewissen Epochen einerseits und des zu anderen Zeiten ebenso periodisch in der Geschichte auftauchenden l'art-pour-l'art-Standpunktes andererseits.
Bei der Untersuchung dieses Problems ist das erste, was einem in die Augen fällt, daß die größten Kunstepochen – man denke hier z. B. nur an die verschiedenen Abschnitte der Renaissance oder an die Geburt der modernen Kunst Frankreichs im 19. Jahrhundert – stets mit den bedeutsamsten Revolutionsepochen der Gesamtgeschichte zusammenfallen. Dieses stete gegenseitige Verbundensein von allgemeiner Revolutionierung der Gesellschaft und hoher Kunstepoche zwingt uns zu der Annahme, daß hier innere Zusammenhänge vorhanden sein müssen. Und das ist denn auch tatsächlich der Fall. Die Untersuchung des Problems, über das Wesen der revolutionären Bewegungen, liefert uns darum auch die Entschleierung des Geheimnisses, das jene gewaltigen Kunstepochen darstellen.
Also müssen wir fragen: Was sind Revolutionen, was geht in ihnen vor, in was besteht ihre Wirkung? In den politischen Kinderstuben der ideologischen Weltbetrachtung macht man sich die Antwort sehr leicht, indem man den Begriff Revolution fast immer im Heugabelsinn übersetzt, man verbindet damit nur die Vorstellung von willkürlich aufgehetzten, sich empörenden, blutgierigen und blutvergießenden Volksmassen. Solche Vorstellungen sind Kinderstubenweisheit. Gewaltsame Eruptionen, Volksaufstände, Straßenkämpfe usw. sind gewiß häufig Bestandteile einer vor sich gehenden Revolution und mitunter auch sehr wichtige Bestandteile, aber eben doch nur Bestandteile, und darum erschöpfen sie niemals das Wesen einer Revolution, so wenig wie der Geburtsakt als solcher die Entstehung und das gesamte Werden eines neuen Lebewesens in sich faßt und erschöpft. Volksaufstände bei einer Revolution sind genau wie der Moment der Geburt nur ein einziger Akt in einem sehr langen Drama. Und weiter: Wie nur unter bestimmten anormalen Voraussetzungen ein Geburtsakt mit schweren Komplikationen verbunden ist, so sind Gewaltsamkeiten bei einer Revolution ebenfalls nur unter bestimmten krankhaften gesellschaftlichen Voraussetzungen ein historisches Fatum. Nicht wenige tiefgehende Revolutionen, die das Antlitz der Menschheit von Grund aus veränderten, haben sich vollzogen, ohne daß auch nur ein einziger Tropfen Blut dabei geflossen wäre.
So einfach ist also dieses Problem nicht. Man muß viel weiter greifen, wenn man den Begriff Revolution richtig fassen will. Revolutionen, oder richtiger: revolutionäre Epochen, umspannen geradezu die bedeutsamsten Abschnitte des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses, nämlich die Herausbildung neuer ökonomischer Mächte, die schließlich zu einer völligen Neubildung der Gesellschaft führen. Revolutionäre Epochen sind jene geschichtlichen Perioden, in denen sich das Gesetz der Entwicklung konzentriert. Das Wesen ist dieses: Der Gang der wirtschaftlichen Fortentwicklung in der Richtung zu immer höheren Formen macht trotz aller Einsichtslosigkeit in diese Tatsache niemals Halt. Er vollzieht sich zwar in einem verschiedenartigen Tempo, bald schneller, bald langsamer, aber er ist gleichwohl stetig und unaufhaltsam. Die Wirkung dieser Fortentwicklung ist, daß sich stets neue Kräfte, und zwar im gleichen Tempo im Schoße der Gesellschaft entwickeln. Diese neuen Kräfte gehen aus neuen Bedürfnissen hervor, die mit dem Reicher- und Vielgestaltigerwerden der Kultur entstehen. Ein solcher Vorgang muß unbedingt auch zu Wirkungen führen, und diese Wirkungen bestehen darin, daß die neuen Kräfte, entsprechend ihrem fortschreitenden Wachstum, die Gesellschaft innerlich umbilden. Indem sie aber dies tun, erfordern sie bei einem bestimmten Grade der Entwicklung für den veränderten Inhalt neue, andere, dem veränderten Zustand entsprechende gesellschaftliche Organisationsformen. Das ist der allgemeine Gang der Menschheitsgeschichte. Zu einer revolutionären Epoche gestaltet sich diese Entwicklung von dem Zeitpunkt an, an dem die freie Entfaltungsmöglichkeit der neuen Kräfte dermaßen zum Lebensbedürfnis der Gesellschaft wird und damit der Kampf um eine neue, diesen neuen Mächten entsprechende gesellschaftliche Organisationsform als wichtigster Punkt auf die Tagesordnung der Zeitgeschichte kommt. Den Ablauf einer revolutionären Epoche stellt jener Zeitpunkt dar, an dem sich die neuen Mächte endgültig durchgesetzt, und adäquate politische und soziale Ausdrucksformen gefunden haben.
Wenn eine sich vollziehende Umwälzung eine fundamentale ist, wenn also eine völlig neue Wirtschaftsordnung an Stelle der seitherigen tritt, so bricht stets ein ganzes Zeitalter der Revolutionen an. Das war z. B. im 15. und 16. Jahrhundert in Italien, Deutschland und Frankreich, im 17. Jahrhundert in England, im 18. Jahrhundert wiederum in Frankreich der Fall.
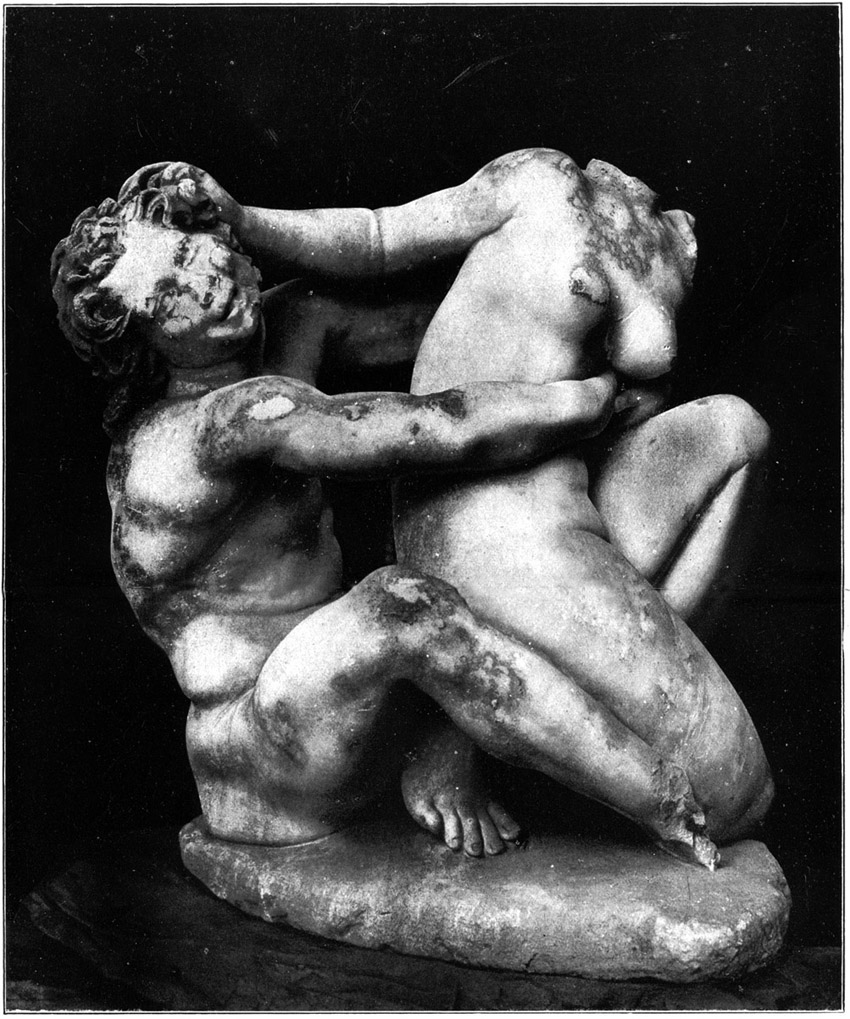
Liebespaar. Antike Marmorgruppe
Natürlich erschöpfen sich derartige Wendepunkte in der Geschichte der Völker niemals bloß in der politischen Sanktionierung des historisch gewordenen neuen Gebildes und der offiziellen Ausschaltung der gleicherweise geschichtlich überlebten und überwundenen Mächte – dieser Vorgang ist ja nur die im Äußerlichen bedingte Form, sondern derartige revolutionäre Epochen sind stets von der tiefgehendsten Bedeutung für alle Formen des gesamten Lebens, und darum sind sie für alle Geistesgebiete die Perioden des Schöpferischen in der Geschichte der Menschheit. Weil hier neue Kräfte ins Dasein treten, konzentriert sich in ihnen sozusagen das gesamte schöpferische Vermögen. Nichts gibt es, was in solchen Zeiten nicht von Kraft strotzte, und nichts, was nicht in Blüte stünde. Indem mit der alten Form die engenden Schranken, die Wälle, durch die das Neue in seiner naturgemäßen Bewegung künstlich gestaut worden war, niedergelegt werden, werden tausend Kräfte plötzlich lebendig und expansieren. Diese Schöpferkraft steigt im selben Maß, in dem die wirtschaftliche Umwälzung tiefer und fundamentaler ist, wenn es sich nicht bloß um eine Korrektur handelt, die am Wesen nichts ändert, sondern um das Aufkommen eines ganz neuen Prinzips. Geht eine solche vollständige Umformung der Gesellschaft vor sich, so erreicht das schöpferische Vermögen seine höchste Expansionskraft. Die Menschheit fühlt sich dann wie neugeboren; ein Siegergefühl, ein Triumphgefühl geht durch die gesamte Menschheit. Hindernisse werden mit einer Leichtigkeit überwunden, von deren Überwindung man vorher nicht einmal zu träumen gewagt hatte. Tausend Arme recken sich und dehnen sich, wo sich vorher kaum eine einzige Hand erhoben hatte, denn bis zu einem gewissen Grade wird dieser neue Zustand allen bewußt. Jeder hat tausend Hoffnungen, und jeder sieht die Erfüllung vor sich. Jeder einzelne ist von dem Drang erfüllt, sich zu betätigen, will sozusagen mitwirken am neuen, am schöneren Aufbau der Gesellschaft. Die Produktivkraft des einzelnen und die der Gesamtheit steigert sich in diesen Zeiten ins Ungeheure; Taten werden vollbracht, für die, solange man die Ursache nicht kennt, jedes Verständnis fehlt. In diesen Zeiten erstehen folgerichtig auch die großen Erfinder und vor allem die großen Utopisten. In den Köpfen der fortgeschrittensten Geister spiegeln sich die Möglichkeiten und Ausblicke, deren Erfüllung erst viel späteren Zeiten vorbehalten ist; die neue Epoche entschleiert ihnen schon ihr Endziel, wohin sie führen muß – die Logik der Tatsachen. Aber auch die großen genialen Erfüller erstehen in diesen Zeiten, denn die Menschheit stellt sich immer nur solche Aufgaben, die sie zu lösen imstande ist. Das folgt aus der wichtigen Tatsache, daß die Aufgabe zur Lösung überhaupt erst dann und dort entspringt, »wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozeß ihres Werdens begriffen sind« (K. Marx).
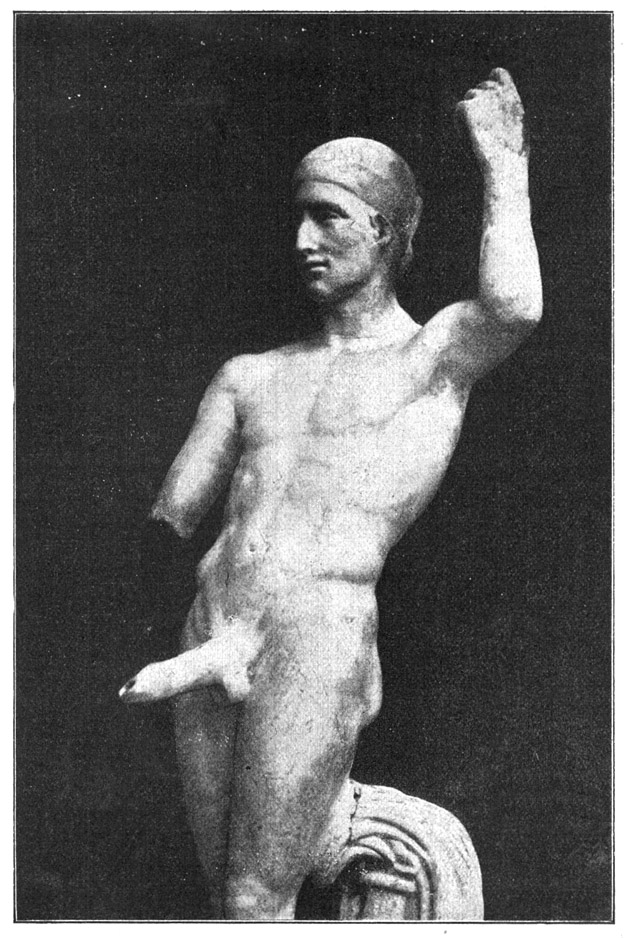
22. Priapische Brunnenfigur. Aus der Casa Vettii, Pompeji
Diese ungeheure Expansionskraft revolutionärer Epochen, die stets zu den ungeheuersten und darum erstaunlichsten Einzelleistungen führt, ist es aber auch hauptsächlich, was zur ideologischen Geschichtserklärung, zum Irrtum über Ursache und Wirkung verführte. Weil in solchen Epochen stets grandiose Persönlichkeiten – Wissenschaftler, Staatsmänner, Philosophen, Dichter, Künstler – auf der Weltbühne erschienen sind, erblickte man in diesen irrtümlicherweise statt eines Ergebnisses, statt einer Folgeerscheinung die Ursache der tiefgehenden Umwälzung. Auf Grund dieser fehlerhaften Logik mußte man andererseits auch zu der Ansicht kommen, daß nur im zufälligen Fehlen solcher bedeutender Persönlichkeiten die entscheidende Ursache zu suchen sei, warum es da und dort nicht zu ebensolchen großen Umwälzungen gekommen ist. Die Ideologie konstruierte somit eine Launenhaftigkeit der Natur und erhob diese zum Weltgesetz.

23. Phallusopfer. Gemme
Gerade an dieser Stelle dürfte es angebracht sein, das Fehlerhafte in der ideologischen Geschichtsbetrachtung, die die Dinge aus dem Kopfe, statt den Kopf aus den Dingen erklärt, nicht nur zu konstatieren, sondern auch etwas eingehender zu begründen. Denn damit stehen oder fallen nicht nur alle Schlußfolgerungen, die wir aus dem Problem der revolutionären Epochen für unsere Materie ableiten, sondern überhaupt sämtliche Schlußfolgerungen, zu denen wir hier gelangen.
Der Irrtum der ideologischen Geschichtsbetrachtung läßt sich am klarsten an der Geschichte der Entdeckungen und Erfindungen nachweisen. Die ideologisch-landläufige Ansicht geht dahin, daß alle Entdeckungen und Erfindungen rein und zufällig aus dem schöpferischen Gehirne besonders begnadeter Menschen entsprungen sind, und daß darum durch sie allein die gewaltigen technischen und sozialen Umwälzungen hervorgerufen worden sind. Diese Ansicht erweist sich in jeder Richtung als falsch. Die Ansicht, daß Erfindungen und Entdeckungen zufällig und aus dem schöpferischen Gehirn einzelner entspringen, wiederlegt sich schon durch die eine feststehende Tatsache, daß es nicht eine einzige Erfindung gibt, die einer einzelnen Person gehört. Mit spielender Leichtigkeit läßt sich nachweisen, daß bei allen Erfindungen Tausende an ihrer Lösung gearbeitet und mitgewirkt haben. Das gilt, um nur einige anzuführen, von der Erfindung der Buchdruckerkunst ebenso bedingungslos wie von der der Röntgenstrahlen, oder der des lenkbaren Luftschiffes, – bei allen mußten tausend Voraussetzungen dazu kommen und zusammenwirken, um die Lösung des Problems zu ermöglichen. Mit anderen Worten: Jede Erfindung ist nur das Endergebnis der Tätigkeit der Gesamtheit. Ebenso einfach erweist sich das Irrtümliche der Behauptung, daß Entdeckungen und Erfindungen die gesellschaftlichen Umwälzungen hervorrufen. Umgekehrt stimmt es: Gesellschaftliche Umwälzungen bedingen Entdeckungen und rufen Erfindungen hervor oder entwickeln frühere Erfindungen zu epochaler Bedeutung. Das klassische Beispiel ist die Entdeckung Amerikas. Amerika war schon lange vor Kolumbus entdeckt, aber man kümmerte sich gar nicht darum. Und warum nicht? Nun, ganz einfach: man hatte dort nichts zu holen, kein Interesse, kein gesellschaftliches Bedürfnis trieb dahin! Das Interesse für Amerika entstand erst in dem Augenblick, als die Anfänge unserer kapitalistischen Entwicklung das Bedürfnis nach Edelmetallen, nach neuen Märkten und neuen Arbeitskräften hervorrief. Jetzt erst, als es sich darum handelte, den kürzesten Weg nach den sagenhaften Goldländern der Alten zu finden, wurde die Entdeckung Amerikas eine historische Notwendigkeit und die schließliche Lösung dieser Aufgabe durch Kolumbus ein wichtiger Hebel der Umwälzung. Ganz dasselbe gilt auch von allen technischen Erfindungen. Die Webmaschine war z. B. bereits im Anfang des 16., das Dampfschiff bereits am Anfang des 18. Jahrhunderts erfunden worden. Aber wie alle Welt weiß: Zu wichtigen Faktoren innerhalb der gesellschaftlichen Umwälzung wurden beide Erfindungen erst Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, sie wurden erst an dem Zeitpunkt exploitiert, als die gesellschaftliche Entwicklung die Massenfabrikation von Stoffen und sowohl geregelte als auch schnellere Verkehrsmöglichkeiten notwendig machte. Wäre die ideologische Erklärung, daß die Entdeckungen und Erfindungen die Umwälzungen hervorrufen, richtig, dann hätte die technische Revolution des 18. Jahrhunderts bereits im 16. Jahrhundert stattfinden müssen. Da dies aber nicht der Fall gewesen ist, so ist damit das erwiesen, auf was es hier ankommt: daß der menschliche Geist nicht der Urheber, sondern der Vollstrecker der in der Geschichte sich ständig vollziehenden gesellschaftlichen Revolutionen ist.

24. Priapsfest. Aus »Poliphilo«. 15. Jahrhundert
Wenn wir diese verschiedenen Gesichtspunkte auf die künstlerische Manifestation des Menschengeistes anwenden und dabei alles das mit zugrunde legen, was wir oben über das Wesen des individuellen Kunstschaffens gesagt haben, dann haben wir auch die Umstände aufgedeckt, die zu großen Höhepunkten und zu neuen Epochen der Kunst führen können und unter bestimmten Voraussetzungen auch führen müssen. Wir haben weiter aufgedeckt, daß der ganze Inhalt der Kunst in solchen Zeiten revolutionär, d. h. neu sein muß; und nicht nur dieser, sondern auch die Form. Und weil mit der Umgestaltung des gesamten gesellschaftlichen Organismus tausend neue Probleme auftauchen, so sind damit schließlich auch die Erklärungen dafür gegeben, warum in diesen Zeiten schon technische Probleme auftauchen und künstlerische Möglichkeiten im Schauen sich auftun, die erst Jahrhunderte später künstlerisches Tagesprogramm wurden. Von den großen Künstlern solcher Epochen gilt nämlich dasselbe wie von den großen Utopisten: Sie sind Schauer in die Zukunft, denen sich die Logik der Tatsachen, zu denen der Weg schließlich einmal führt, schon an seinem Beginn offenbart. Das Genie verkörpert dadurch die Gesetze der Entwicklung sozusagen in umgekehrter Reihenfolge. Wenn jeder Mensch im embryonalen Zustand in abgekürzter Weise alle Entwicklungsstadien wiederholt, die die gesamte Menschheit in der Kette der Entwicklungen durchzumachen hatte, um zu der Stufe zu gelangen, die sie jetzt einnimmt, so nimmt das Genie, das am Anfang einer neuen Entwicklungsreihe der Menschheit steht, gewissermaßen alle Entwicklungsphasen vorweg, die die Menschheit innerhalb dieser neuen Entwicklungsreihe durchwandern wird. Aus diesem Wesen des Genies erklärt sich auch, daß es in seiner Zeit selten voll gewürdigt wird. Das Genie kann nämlich in seiner Zeit gar nicht voll begriffen werden, denn es ist im Wesen der Sache bedingt, daß nur die fortgeschrittensten Geister das Ziel schon am Aufgang des neuen Tages zu erkennen vermögen. Die Logik der Tatsachen, das wäre hier das Mitgehen aller Zeitgenossen, scheitert nicht an der vielgelästerten Dummheit der Massen, sondern an der noch unentwickelten Wirklichkeit. Diese in der Geschichte ewig wiederkehrende Verständnislosigkeit der Zeitgenossen, die sich in den ebenso sprichwörtlichen Undank der Mitwelt umsetzt, ist gewiß häufig sehr tragisch für jene großen Wegweiser, die am Beginn einer neuen Epoche auftauchen, aber diese Tragik ist aus der Geschichte niemals auszutilgen, weil die erst am Anfang stehende Entwicklung außerdem noch gar kein Bedürfnis für die letzte Logik der Tatsachen hat, die eine Entdeckung, Erfindung oder künstlerische Tat darstellt, und die genialen Köpfen bereits am ersten Tage der neuen Geschichtsperiode zur Erkenntnis kommen kann.

25. Hauptgruppe aus dem Gemälde Trionfo di Venere von Francesco Cossa. Original im Palazzo Schifanoja in Ferrara. 15. Jahrhundert
Schließlich erklärt uns die Entschleierung des Wesens revolutionärer Epochen noch das wichtigste Problem der Kunstgeschichte: daß alle Anstiege zu neuen Höhen der Kunst und alle Gipfel der Kunstentwicklung sich nur an solche geschichtliche Epochen knüpfen können, in denen ein ökonomischer Umwälzungsprozeß innerhalb der Gesellschaft vor sich geht, weil eben nur in diesen Epochen das Schöpferische sich derart konzentriert. Man durchstöbere von diesem Gesichtspunkt aus unsere gesamte europäische Kultur- und Kunstgeschichte, und jeder einzelne und auch jeder beliebige Abschnitt wird im Positiven wie im Negativen diese Tatsache belegen. Daß jedes Blütezeitalter der Kunst außerdem immer nur mit einem Zeitalter des wirtschaftlichen Aufschwunges zusammenfallen kann, hängt mit alledem ebenfalls zusammen.
Erklärt uns das Wesen revolutionärer Epochen das Entstehen neuer Kunstzeitalter und den jähen Aufstieg zu gewaltigen Höhen in der Kunst, so erklärt uns das Verebben der revolutionären Antriebskräfte in der Geschichte und die Tendenzen, die hinfort in der Gesellschaft herrschend werden, einerseits den Niedergang der Kunst, andererseits den l'art-pour-l'art-Standpunkt, dem wir gleichfalls immer wieder begegnen.
Die geschichtliche Entwicklung vollzieht sich nach Ablauf einer revolutionären Epoche ungefähr folgendermaßen: Hat eine revolutionäre Bewegung ihre historische Aufgabe erfüllt, dann ist stets das Bestreben der neuen zur Herrschaft gelangten Klasse – denn in dem Herrschaftsantritt einer neuen Klasse gipfelt ja die jeweilige revolutionäre Tendenz der Zeit, sofern sie siegreich ist – ihre konsolidierte Herrschaft nun auch in ihrem Interesse zu exploitieren; sie will die Früchte ihres Erfolges in die Scheunen bringen, und zwar so umfassend wie nur möglich. Diesem edlen Bemühen winkt aber nur dann ein voller Erfolg, wenn die neue herrschende Klasse gleichzeitig ihr Bestreben darauf richtet, alsbald und gründlich alles das aus dem öffentlichen Leben auszuschalten, was nicht nur ihre Herrschaft gefährden, sondern was sie überhaupt bei ihrer exploitierenden Tätigkeit irgendwie stören könnte. Störend ist aber vor allem der eigene revolutionäre Inhalt der Forderungen, die man an die Zeit gestellt hat, und zwar deshalb, weil es im Wesen einer jeden revolutionären Forderung bedingt ist, entsprechend der nie rastenden Entwicklung zu immer neuen Konsequenzen zu gelangen. Die Propagierung dieser Tendenz ist aber gleichbedeutend mit ständiger Unruhe. Da man nun in der Unruhe den die erfolgreiche Exploitierung störendsten Faktor erkennt, so ist noch immer das erste gewesen, was nach dem Siege geschah, daß eine siegreiche Klasse den revolutionären Inhalt ihrer Forderungen preisgibt. Manchmal schon an: Tage nach dem Siege. Man verzichtet. »Im Interesse der Ordnung« lautet die übliche Form dafür; so sagte man im 16., im 17., im 18. Jahrhundert usw., und so sagte man in jedem Land, – es geschah aber stets und überall nur im wohlbegriffenen Eigeninteresse, in dem der erfolgreichen Exploitierung der errungenen Macht. Damit kehrt der Pendel des öffentlichen Geistes zur Ruhe zurück, er bewegt sich nicht mehr mit derselben Energie, die ihm vordem eigentümlich gewesen ist, um zu den äußersten Polen zu gelangen, sondern er bewegt sich hinfort nur noch innerhalb der banalen Logik vom Erreichbaren. Gewiß ringen sich im Schoße jeder neuen Gesellschaft sofort wieder neue revolutionäre Mächte los, die prinzipiell über den in der betreffenden Zeit geschaffenen Zustand der Gesellschaft hinaustreiben, aber diese Mächte können noch nicht wirkend werden, weil in der Wirklichkeit die Möglichkeiten der Erfüllung noch nicht entwickelt sind.
Diesen Umschwung können wir bei jeder weltgeschichtlichen Bewegung verfolgen. Ob es sich um eine Klassenbewegung im nationalen Rahmen handelt, oder um eine solche im großen Rahmen weltgeschichtlicher Herrschaftsverschiebungen, wodurch die seitherige Vormachtsstellung eines Landes hinfort von einem anderen übernommen wird. Und dieser Umschwung ist auch innerlich vollauf begründet, er ist tatsächlich »die natürliche Ordnung der Dinge«. Jede Klasse vermag eben nur einen bestimmten Entwicklungsgrad der wirtschaftlichen Entwicklung zu repräsentieren, indem jede Klassenherrschaft nur die politische Formel für einen bestimmt begrenzten Zustand ist. Treiben die revolutionären Tendenzen der ursprünglich aufgestellten programmatischen Forderungen über diesen Zustand hinaus, so würde eine entsprechende Anpassung neue Organisationsformen bedingen und damit ein Sichselbstaufgeben. Niemals in der Geschichte gab sich aber eine Klasse selbst auf, sondern jede suchte sich im Gegenteil in ihrer Herrschaft so lang als möglich zu erhalten. Sowie es darum einer siegreichen Klasse zum Bewußtsein kommt, daß die Dinge über sie selbst hinausführen würden, soferne sie alle Konsequenzen ihres Programms zöge, tritt der oben geschilderte Umschwung bei ihr ein.
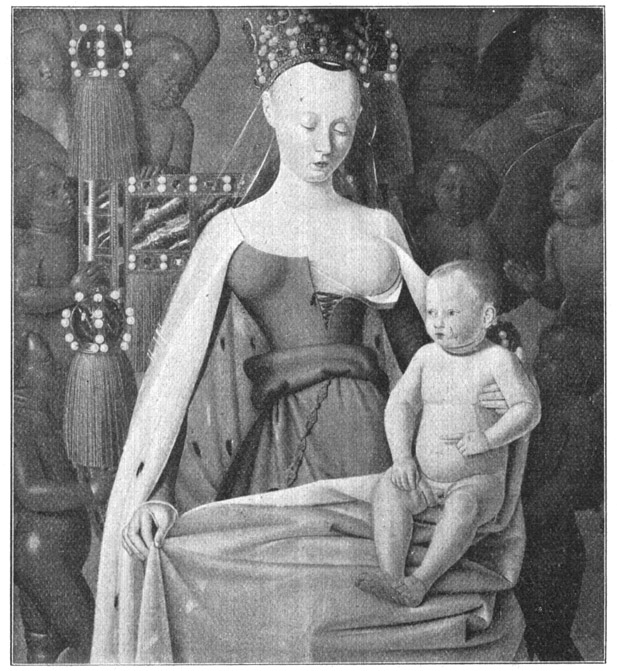
26. Jean Foucquet: Agnes Sorel, die Maitresse Karls VII., als Jungfrau Maria. Original im Museum zu Antwerpen. 15. Jahrhundert
Natürlich vollzieht sich dieser Umschwung nie von heute auf morgen. Aber sowie er zur herrschenden Tendenz geworden ist, muß sich gemäß den früher entwickelten Faktoren auch das Wesen der geistigen Physiognomie der Zeit ändern, – ihre revolutionäre Linie muß ebenso verschwinden. Und sie verschwindet denn auch meistens binnen kurzem.
Im selben Maße wie aus dem Leben das fieberhafte und waghalsige Bemühen, des Lebens höchste Gipfel zu erklimmen – was auch meist mit des Lebens höchsten Gefahren verknüpft ist – ausschaltet, im selben Maße verebbt das Schöpferische. Und naturgemäß auf allen Gebieten des geistigen Lebens. Überall erwacht auch hier die Tendenz des Exploitierens. In der Kunst setzt sich diese Tendenz in die Entwicklung der technischen Probleme der Kunst um, und damit tritt dann auch von selbst die besondere Wertschätzung der Form auf, die sich schließlich zu einem förmlichen Kultus der Form steigert, dem l'art-pour l'art-Standpunkt. Form über alles. Diesem Standpunkte nähert man sich stets in dem gleichen Tempo, in dem eine herrschende Klassenbewegung sich dem Nullpunkt ihrer revolutionären Energie nähert. Ist dieser Nullpunkt erreicht, so ist das l'art pour l'art die ästhetische Kampfparole auf der ganzen Linie, und alles, was ihr widerspricht, wird nicht nur nicht begriffen, sondern auch befehdet. Und auch das ist gemäß des oben entwickelten Gesetzes die natürliche Logik der Dinge: Weil es eben niemals Kunst an sich gibt, die außerhalb der Zeit und ihrer Bedingnisse steht, sondern nur Klassenkunst, darum kann sie auch jetzt nichts anderes als Erfüllerin der neuen Lebensbedürfnisse und Lebenszwecke der Klasse sein, die durch sie ideologisiert wird. Und diese neuen Aufgaben löst sie eben, indem sie das l'art pour l'art auf ihre Fahne schreibt. Man will nicht mehr kämpfen, sondern genießen, und zwar genießen nicht in robuster Weise, wie der Hungrige genießt, sondern in raffiniertester Weise, wie der Satte und Übersättigte, dem die Delikatesse am höchsten steht. Das ist der Ausgang jeder Kultur …
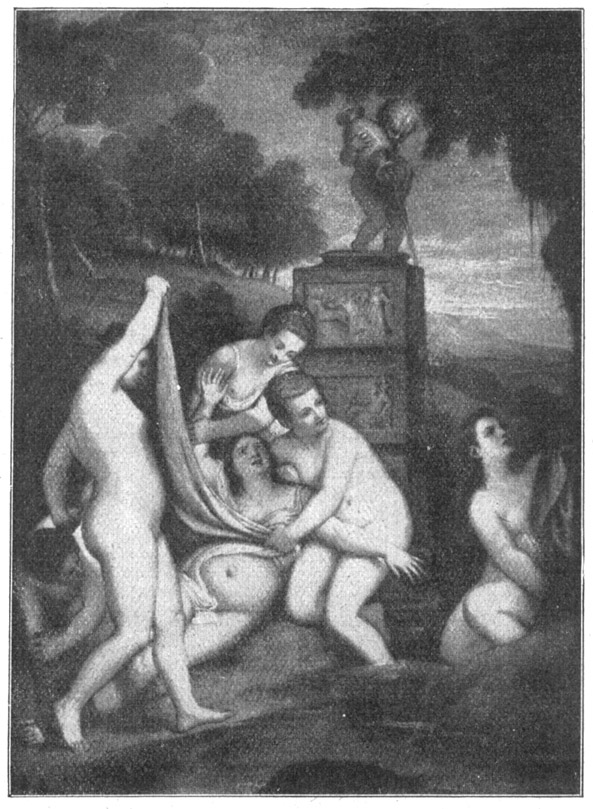
27. Tizian: Kallysto und die Nymphen Galerie Sankt Luca, Rom
Es ist oben gesagt worden, daß es sich an dieser Stelle selbstverständlich nicht darum handeln könne, die noch fehlende Naturgeschichte der Kunst zu schreiben, sondern nur darum, die großen Umrißlinien zu ziehen. Diese Aufgabe hoffen wir erfüllt zu haben. Aber so skizzenhaft unsere Ausführungen sich auch darstellen, so wagen wir doch die Behauptung davon abzuleiten, daß diese Umrisse es sind, die man zu den Grundmauern erweitern muß, und daß diese wiederum einzig und allein eine sichere Basis für die Möglichkeit, das »Warum« in der Kunst zu erschließen, abgeben. Ebenso wagen wir daraus zu folgern, daß an ihnen vorbei zu sehen, nichts anderes bedeutet, als der Lösung aus dem Wege zu gehen, – es führen eben nicht alle Wege nach Rom.
*
Die hier gewonnenen Gesichtspunkte an der Wirklichkeit nachzuprüfen, oder umgekehrt, die Wirklichkeit durch sie zu erklären, muß jetzt unsere Aufgabe sein. Freilich in demselben beschränkten Umfang. Wie es sich im vorstehenden nur um die Entschleierung der groben Umrißlinien handeln konnte, so hier bei der Anwendung auch nur um eine kleine Reihe beweiskräftiger Stichproben.
Wir haben mit der Behauptung angefangen, daß das individuelle Kunstschaffen an eine bestimmte Höhe der Entwicklung der Geldwirtschaft gebunden sei. Die Richtigkeit dieses Satzes läßt sich an der Entwicklung jedes einzelnen Landes nachprüfen.
Um in der Neuzeit zu bleiben, braucht man z. B. nur zu fragen, wo die Entwicklung der Städtekultur am Ausgang des Mittelalters zuerst am intensivsten einsetzte. Die Antwort wird lauten: In Norditalien. Hier entwickelte sich das Städtewesen in Europa zuerst, zu seiner stolzesten Blüte. Hier flossen aber auch alle Faktoren zusammen, die zu einer starken Städtebildung führen müssen. Norditalien war von Norden her jahrhundertelang die Durchgangsroute für den gesamten Fremdenverkehr nach Rom; Norditalien bildete ebenso für die zahlreichen Kreuzzüge die wichtigsten Sammelpunkte. Hier entwickelte sich infolgedessen überaus früh ein reicher Kaufmannsstand. Hier etablierten sich außerdem die Bankiers der Päpste, denn die Päpste hatten in den norditalienischen Städten häufig viel zuverlässigere Bundesgenossen als in Rom selbst, wo die verschiedenen Spekulanten auf die Papstkrone die politische Situation, den status quo, oft bedenklich in Gefahr brachten. Also brachte man seinen Besitz besser auswärts in Sicherheit. Norditalische Bankiers spielten damals sozusagen dieselbe Rolle wie im 19. Jahrhundert die Bank von England. Aus allen diesen Gründen erlebte die Geldwirtschaft in Norditalien zuerst ihre mächtigste Entfaltung. Sowie man nun die zweite Frage stellt: Wo begegnet man am frühesten in Europa den gewaltigen Denkmälern der Kunst, wo strebten zuerst die stolzesten Bauwerke in die Höhe, wo setzte die Frührenaissance zuerst ein? – nun, so wird die Antwort ebenfalls lauten: In Norditalien. Die rasch und mächtig aufblühenden Städte Norditaliens sind durchweg Geburtsorte der Renaissance.

28. Corregio: Jupiter und Io. 16. Jahrhundert. Kaiserliche Gemäldegalerie Wien
Was Italien erweist, erweist jedes andere Land. Ob wir uns nach Spanien, nach Frankreich oder Deutschland wenden, überall knüpft die Entstehung der Kunst an die Entstehung und Entwicklung der Städte an, und sie blühte nur dort, wo das Kapital, der Wesensfaktor der neuen Wirtschaftsordnung seine Hochburgen aufrichtete. Schauen wir nach Deutschland, so sehen wir die Städte Köln, Straßburg, Basel, Nürnberg, Ulm, – die große Handelsroute vom Norden nach dem Süden, die Knotenpunkte des Handels, wo der neue, der weltbeherrschende Stand, der Kaufmann, seine Handelskontore auftat – dort strebten ebenfalls am frühesten die gewaltigen Dome in die Höhe, dort stoßen wir heute auf die ältesten Kunstdenkmäler des neuen Zeitalters. Außer diesen Städten finden wir nur noch an solchen Stellen ähnliche Dokumente, wo ehemals die natürlichen Quellen des Reichtums flossen. Also z. B. in Sachsen. Hier hat der Bergsegen die Kunst gezeitigt. Und was der Bergsegen in Sachsen ins Leben rief, das hat er überall dort gezeitigt, wo ihn fleißige Hände zutage förderten. Der böhmische Bergsegen hat im 14. Jahrhundert die hundert Türme von Prag gebaut und die alte böhmische Kunst ins Dasein gerufen. Dasselbe hat er in Tirol zustande gebracht. Warum gab es einst im 15. und 16. Jahrhundert eine spezifische Tiroler Kunst und heute nicht mehr? Nun, Tirol spielte damals ökonomisch und darum auch politisch eine wesentlich bedeutendere Rolle als heute. Auch hier vereinigten sich verschiedene wichtige Faktoren. Tirol war das nördliche Einfallstor für den Handel mit Italien und die wichtigste Durchgangsstraße nach Rom. Außerdem aber blühte damals der Tiroler Bergbau, der nächst dem böhmischen und sächsischen der damals am höchsten entwickelte in Europa war. Es muß hier daran erinnert werden, daß es in der damaligen Warenproduktion vor allem zwei Industrien waren, die zu Reichtum und somit zu politischer Macht führten, nämlich die Wollenweberei und der Silberbergbau.
Eine weitere Kontrolle für die Tatsache, daß sich die Kunst auf der Städteentwicklung aufbaut und einzig in ihr den Nährboden hat, bildet die Tatsache, daß überall dort, wo man streng abgeschlossen von der Städtekultur blieb, wie z. B. in den weltabgeschiedenen Klöstern, sich auch am längsten der mittelalterliche Stil erhielt. In den weltabgeschiedenen Klöstern herrschte in der Kunst oft noch die ganze mittelalterliche Asketik, während draußen in der Welt, jenseits der Berge, schon alles vom strahlenden Wirklichkeitssinn und der strotzenden Daseinsfreude vergoldet war. Da sich eine scharfe Abgrenzung zwischen Stadt und Kloster bei den unentwickelten Verkehrsverhältnissen des Mittelalters ganz von selbst ergab und ebenso natürlich sich außerordentlich lange erhielt, so haben wir darin auch die einfache, historisch-ökonomische Erklärung, warum es im 14. und 15. Jahrhundert geradezu eine alltägliche Erscheinung war, daß zwei schon durch enorme Entwicklungsweiten voneinander getrennte Kunststile immer noch Seite an Seite auftraten. Das überaus lange Weiterblühen der mittelalterlichen Kunst war auch ökonomisch ganz folgerichtig, es war in den erst primitiven Verkehrsverhältnissen begründet, die eine allgemeine und gleichzeitige Umwälzung unmöglich machten. Bildlich gesprochen kann man sagen: Das neue Wirtschaftsprinzip hieb sich zuerst nur große Verbindungsstraßen durch den Urwald der Naturalwirtschaft hindurch, um jene Orte miteinander zu verknüpfen, wo die natürliche Entwicklung ebenfalls zu dem neuen Prinzip, zur Geldwirtschaft geführt hatte, und nur langsam strahlte seine Wirkung nach den Seiten aus. Die mittelalterliche Kunst, die ihre Wurzeln im feudalen Boden der Gesellschaft hatte, konnte infolgedessen noch üppig blühen und brauchte nicht abzusterben, weil der feudale Boden links und rechts ebenfalls noch in voller Gesundheit weiterexistierte. Wo aber die ökonomischen Bedingungen kraft der geographischen Lage zum Neuen gegeben waren, entwickelte sich dieses, ohne das Alte, Feudale in seinem Bestande zu gefährden, weil dieses gar nicht mit ihm zusammenstieß. Fand dann aber irgendwo ein Zusammenstoß statt, so unterlag das Alte ebenso jäh, und die sanften Übergänge fehlten, weil man bereits etwas Fertiges vorfand, etwas das gar nicht mehr erst entwickelt werden mußte.

29. Raffael: Badende Nymphe von einem Faun belauscht
Auf den etwaigen Einwurf, daß in der Stadt nicht nur die Kapitalmächte als Antriebskräfte der Kunst auftraten, sondern z. B. auch das Kleinbürgertum, die Handwerksmeister, wäre zu erwidern: Gewiß, das Handwerk hat ebenfalls als starke Antriebskraft der Kunst gewirkt, aber wohlgemerkt, es war hier nicht der einzelne, sondern die Zunft, die bei ihm als Auftraggeber auftrat, und darum war es ebenfalls die Kapitalmacht, denn das ist im Wesen doch ganz dasselbe. Organisation bedeutet nichts anderes als die Zusammenfassung der, solange sie isoliert sind, schwachen Einzelkräfte zu einer durch die Konzentration machtvoll und leistungsfähig werdenden Gesamtkraft.
Ein ebenfalls durchschlagender Beweis dafür, daß eine ausgeprägte Städteentwicklung die Mutter des intensivsten individuellen Kunstschaffens ist, ergibt sich auch auf negativem Wege. Wenn die Kunst mit der Städtebildung zusammenhängt, und wenn die Kunstentwicklung immer analog des vorhandenen mobilen Kapitals ist, sich also um so mächtiger entfaltet, je umfangreicher dieses ist, so muß eine andere Folge die sein, daß überall dort, wo die Städteentwicklung am spätesten einsetzte und die Geldwirtschaft am primitivsten geblieben ist, der Städter also mehr Ackerbürger als Kaufmann war, immer auch am spätesten von einer selbständigen Kunstentwicklung die Rede sein kann. Und auch dieses ist die allgemeine Signatur der betreffenden Länder. Es läßt sich geradezu spielend nachweisen, daß man dem individuellen Kunstschaffen niemals in Ländern mit reiner Naturalwirtschaft begegnet. Ja nicht einmal in Ländern mit vorwiegend agrarischem Charakter begegnete man ihm. Man kann direkt sagen: Je mehr und je länger der agrarische Charakter in einem Lande vorherrschte, in um so bescheidenerem Maß entwickelte sich die Kunst. Beispiele: Rußland, Ungarn, Norwegen, Norddeutschland: Agrarländer – kunstlose Länder. Die triste Kunstlosigkeit des deutschen Nordens vermögen so viele Leute gar nicht zu fassen. Nun, das eben Gesagte ist seine Erklärung. Im Norden Deutschlands herrschte am längsten die Naturalwirtschaft und kam es am spätesten zu einer intensiven Geldwirtschaft. Das ist die einzige, aber auch die ausreichende Erklärung, daß diese Gebietsteile Deutschlands – von den Hansastädten selbstverständlich abgesehen – niemals eine maßgebende Rolle in der allgemeinen Kunstentwicklung spielten, daß man dort herzlich wenig von einer Kunst merkte, daß dort überhaupt erst im 18. Jahrhundert kärgliche Kunsttriebe sich entwickelten, und daß diese Triebe überdies bis ins 19. Jahrhundert hinein spärlich und kümmerlich geblieben sind.
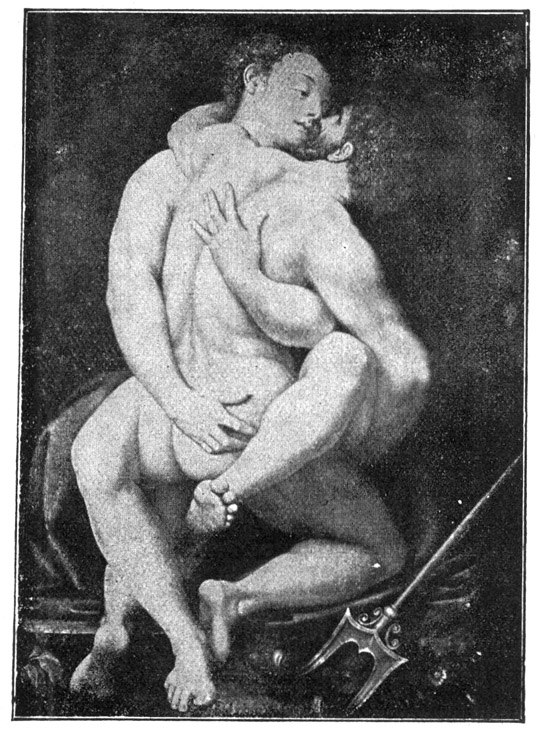
30. Barend van Orley: Neptun und Nymphe. 16. Jahrhundert. Original in Privatbesitz
Ebenfalls in der negativen Richtung erhält man den schlüssigsten Beweis für die Richtigkeit unserer zweiten Behauptung: Daß zu der Entstehungsmöglichkeit des individuellen Kunstschaffens auch die Antriebskräfte in der Form der Bedürfnisse hinzukommen müssen. Sind Klassenscheidungen und der in deren Gefolge auftretende Luxus eine wichtige Antriebskraft für das Blühen und Gedeihen der Kunst, so ist eine selbstverständliche Folge, daß die Kunst überall dort verschwinden und versagen muß, wo die Tendenz vorherrscht, die Klassenscheidung aufzuheben und den Luxus auszumerzen. Wenn wir in der Geschichte in dieser Richtung Ausschau halten, so zeigt sich denn auch, daß sich diese Logik überall dort bestätigt, wo wir auf solche Bewegungen stoßen. Um dieses zu belegen, kann es sich selbstverständlich nur um solche Bewegungen handeln, die eine größere Herrschaft erlangt haben und über eine längere Zeitdauer große Gebietsteile und zahlreiche Massen ihren Gedankengängen unterjocht haben. Solche Bewegungen sind die Wiedertäufer- und die Hussitenbewegung gewesen.
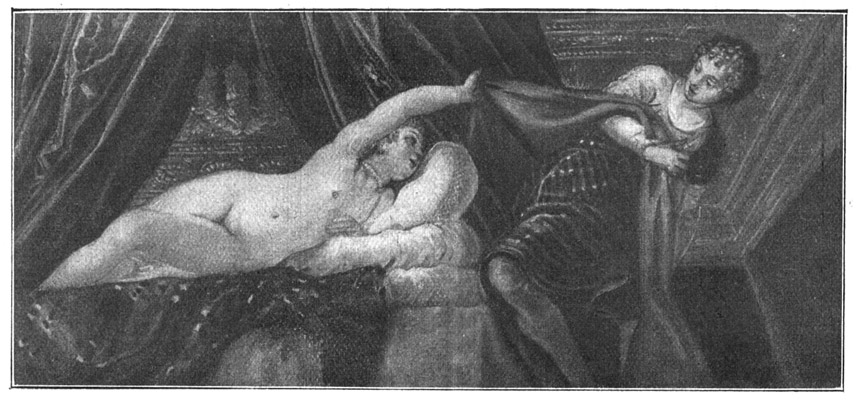
31. Tintoretto: Joseph und die Potiphar. Original im Prado, Madrid
Die Haupttendenzen dieser beiden Bewegungen bestanden in der praktischen Betätigung des christlichen Kommunismus. Dieser forderte: Die Lebenshaltung aller soll zugunsten aller eingeschränkt werden, keiner soll mehr haben als der andere, auf daß keiner Not leide. Bei diesem Programm mußte nichts so sehr verpönt werden wie der Luxus. Und in einer Zeit der noch unentwickelten Warenproduktion – aber auch nur in dieser! – war eine Verpönung des Luxus auch absolut folgerichtig, weil hier Luxus eben nur auf Kosten der Gesamtheit möglich war. Notwendigerweise mußte die Verpönung zuerst und am ausgesprochensten die teuerste Form des Luxus, die Kunst, treffen. Das historisch nachweisbare Ergebnis dieser Tendenzen ist denn auch, daß keinerlei künstlerische Taten von der Existenz dieser Bewegungen und von ihrer teilweise ziemlich langen Herrschaft zeugen. Diese Bewegungen, sofern uns Bilder von ihrem Dasein heute noch Kunde geben, leben bildlich nur in den satirischen Anklagen weiter, die sie wider ihre Gegner geschleudert haben, oder höchstens in Bildern, die von ihren Gegnern ausgegangen sind. Was in diesem Punkte die Hussiten- und Wiedertäuferbewegungen erweisen, bestätigen alle derartigen Bewegungen; in allen ohne jede Ausnahme war die Kunst tot. Mitunter schlug man sie sogar tot, und zwar in Form der bekannten Bilderstürmerei. Und auch das ist logisch. Aber in einem anderen Sinne wie man gemeinhin annimmt. Oberflächliche Beurteiler dieser Erscheinung sind immer auf den grotesken Unsinn verfallen, daß sich darin ein Sieg der Unkultur über die Kultur erwiesen habe. Nichts ist sinnloser als das. Die Vernichtung der Kunst war diesen Bewegungen niemals der eigentliche Kampfzweck, sondern nur eine Kampfparole. Die Kunst wurde derart radikal bekämpft, weil sie eben als Hauptattribut des Luxusbedürfnisses die auffälligste Begleiterscheinung der von den Reichen vertretenen Tendenz der Klassenscheidung war, und weil sie obendrein im direkten Gegensatze zu den eigenen Bedürfnissen stand.
Hierher gehört auch der bekannte Vorwurf der Kunstfeindlichkeit der Reformation. Es ist gewiß nicht zu bestreiten, daß die Reformation alles andere, nur nicht befruchtend auf die Kunstentwicklung eingewirkt hat. Aber auch hier handelte es sich um keine prinzipielle Kunstgegnerschaft, sondern nur um eine solche im übertragenen Sinne. Die sogenannte protestantische Phantasielosigkeit war rein ökonomisch bedingt durch den wirklichen Inhalt der Reformationsbewegung. Diese ist aber im letzten Grunde niemals etwas anderes gewesen als der Kampf der ausgebeuteten Masse gegen den Ausbeuter Papsttum; diese Tatsache haben übrigens die Zeitgenossen viel besser begriffen als die Mehrzahl der späteren Historiographen der Reformation. Wenn man nun bei diesem Kampfe die Heiligenbilder bekämpfte, so bekämpfte man nur die Ausbeutung, die mit dem Bild als Firma des päpstlichen Säckels getrieben wurde. Also auch hier ist die Kunstfeindlichkeit nicht Kampfzweck, sondern ebenfalls Kampfparole. Das die eine Seite. Die andere Seite ist die: Indem man die Kirche materiell schwächte, und indem man das Programm aufstellte, in erster Linie der materiellen Übermacht der Kirche ein Ende zu bereiten, entzog man ihr damit auch die Mittel, Auftraggeberin der Kunst zu sein. Die reformierte Kirche wurde sozusagen die Kirche der Armen, im Gegensatze zur katholischen Kirche, die in gewissem Sinne die Kirche der Reichen blieb. Also nicht aus mangelndem künstlerischen Impuls, weil die Religiosität auf seiten der Protestanten weniger intensiv gewesen wäre, verschwanden die religiösen Bilder aus ihren Kirchen oder blieben die künstlerischen Verherrlichungen der Reformation aus, sondern einfach infolge des Versagens der materiellen Antriebskräfte. Das eine bedingte eben das andere: die Beschneidung des Säckels resultierte in der Einschränkung der Luxusbetätigung. Die Not wurde zum Programm, zur Tugend. –
Wenn es von dem Vorhandensein von Bedürfnissen abhängt, ob überhaupt Kunst entsteht, so muß die Tendenz der betreffenden Bedürfnisse folgerichtig auch bestimmen, welche Art Kunst in einem Land entsteht; die wirtschaftliche Organisation einer Nation muß Inhalt und Gefühlswerte der Kunst bedingen. Es ist in der Tat stets so gewesen.
Eine bekannte Tatsache ist z. B. das Vorherrschen des sogenannten echten deutschen Familiensinnes in der Kunst der deutschen Renaissance. Die Kunst keines anderen Landes hat derart innig das Familienleben gestaltet, wie dies in den deutschen Darstellungen von Maria und Joseph der Fall gewesen ist. Das ist aber nichts anderes als die künstlerische Resultante des damaligen gesellschaftlichen Seins in Deutschland. Das Kleinhandwerk war der damalige Typ der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands, und kein einziges anderes Land hatte eine ähnlich ausgeprägte kleinbürgerliche Physiognomie. Kleinbürgerliche Verhältnisse resultieren aber stets in einem innigen Familienleben, weil ein solches für sie eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist.
Eine andere bekannte Erscheinung, die sich über die Kunst aller Länder erstreckt, ist die, daß der Teufel auf den Bildwerken des Mittelalters, überhaupt in dessen gesamter Vorstellung durchweg ein ganz harmloser Geselle ist, sozusagen eine Art Possenreißer, während der Teufel der Renaissance im Gegensatze hierzu sich als ein mitleidsloser furchtbarer Peiniger darstellt. Auch dieser Unterschied ist nichts anderes als das getreue Widerspiel der veränderten sozialen Lebensbedingnisse, die die neue Wirtschaftsordnung den Menschen brachte, weil auch die Religionsvorstellungen niemals etwas anderes als Ideologisierungen des wirklichen Lebens sind. Das Elend, die Not der Menschen – ihre Hölle – war im Zeitalter der Naturalwirtschaft durchweg harmlos. Anders wurde es in der Renaissance. Die neue Zeit, die mit der neuen Wirtschaftsordnung anbrach, verhängte über die Massen alle Greuel und Schrecken des Massenelends. Jetzt konnte die Hölle und ihr oberster Herr kein Kasperltheater und kein froher Hanswurst mehr sein, die Hölle konnte nur einen Ort der greulichsten Qualen bedeuten, und der Teufel mußte den Menschen als der roheste und raffinierteste Folterknecht erscheinen.
Eine dritte Tatsache ist, daß mit dem 15. Jahrhundert überall das profane Porträt in der Kunst auftaucht. Bis dahin wurden nur Könige abgebildet, und auch diese waren meist Typen. Mit dem 15. Jahrhundert erschienen in der Kunst die Bilder von Kaufleuten, Bürgermeistern, Dichtern, Künstlern usw. Auch dies ist nur der Ausdruck des veränderten gesellschaftlichen Seins. Die Entstehung des Bürgertumes und sein Aufstieg zur herrschenden Klasse brachte die Entfesselung der Einzelindividualität und führte zum Individualismus. Also trat auch in der Kunst an Stelle des Typischen, das Merkmal der Kunst des Mittelalters, das Individuelle. Die Typen wandelten sich zu Porträts. Und zwar zuerst in der Form der sogenannten »Stifterporträts«. Auf den Bildern, die man der Kirche stiftete, trug stets einer der Anbetenden die Züge des Stifters des Bildes, daher der Name. Man wollte jetzt nicht mehr bloß die Sache glorifizieren, wie einst die klösterlichen Maler, sondern noch mehr sich selbst.

Albrecht Dürer: Die Versuchung des heiligen Antonius. Nach einer Rötelzeichnung

32. Mantegna: Urteil des Paris. Holzschnitt. 15. Jahrhundert
Wie sehr die Vorherrschaft bestimmter Kunsttechniken innerhalb eines Landes vom jeweiligen gesellschaftlichen Sein der Massen bestimmt wird, belegt klassisch die deutsche Kunst des 16. Jahrhunderts durch eine ihr speziell eigentümliche Eigenart. Es ist eine auffällige Erscheinung, daß damals kein Land eine ähnlich große Zahl von Kleinmeistern besaß, und daß vor allem der Holzschnitt in keinem anderen Lande eine derart große Rolle spielte wie gerade in Deutschland. Kein italienischer, französischer oder spanischer Künstler von Bedeutung hat ähnlich viel Mühe und Arbeit auf den Holzschnitt verwendet wie die Mehrzahl der deutschen Meister, von denen es nur wenige in jener Epoche gibt, in deren Lebenswerk nicht auch der Holzschnitt eine nennenswerte Rolle spielte. Diese auffällige Eigenart wurde durch die historische Rolle bedingt, die Deutschland damals gezwungen war, zu spielen. Und damit wird diese wichtige Rolle des Holzschnitts auch vollauf erklärt. Deutschlands ökonomische Losreißung von Rom war der Hauptzweck der gesamten Reformation. In Deutschland wurden infolgedessen auch im 16. Jahrhundert die entscheidenden politischen und religiösen Kämpfe ausgefochten. Diese großen Kämpfe mußten aber durch die Massen entschieden werden; das bedingte sowohl die neue Wirtschaftsweise, als auch der Umstand, daß es sich nicht um die Befreiung einzelner, sondern um die Losreißung der großen Volksmassen aus den Klammern der päpstlichen Ausbeutung handelte. Also galt es, diesen die private und öffentliche Moral, die politischen Interessen der Zeit so deutlich wie möglich vor Augen zu führen, ebenso den religiösen Bedürfnissen die plastischste Gestalt zu geben. Weiter galt es, überall den seitherigen Ansichten den Boden zu entziehen, sie zu verdammen oder andere wieder mundgerecht zu machen und zu verherrlichen. Und das Tag für Tag und bis in den abgeschiedensten Winkel Deutschlands hinein; denn überall hatte doch die alte Zeit ihre Agenturen. Um aber zu den Massen wirkungsvoll sprechen zu können, bedurfte es eines besonderen, leicht verständlichen und leicht zu handhabenden Agitationsmittels, eines Mittels, durch das die Objekte des Streites so popularisiert werden konnten, daß ihr Inhalt und ihre Bedeutung dem geringsten Bauern ebenso verständlich waren wie dem Städter. Dieses wichtige Mittel bot der Holzschnitt. Er war damals überhaupt das einzig vorhandene Mittel für eine fortwirkende Agitation. Man darf bei der Beurteilung jener Zeiten nie aus den Augen lassen, daß das Volk in seiner Mehrzahl des Lesens unkundig war. Der Holzschnitt war darum also nichts weniger als die allen verständliche Sprache dieser Zeit. Gewiß verzichtete man auch damals weder auf das gedruckte noch auf das gesprochene Wort. Aber wenn das erstere von der großen Mehrzahl nicht enträtselt werden konnte, oder diese sich begnügen mußte, es vorgelesen zu bekommen, so verhallte das zweite, und wenn auch nicht so schnell wie heute, so doch relativ rasch. Und darum bedurften beide einer Ergänzung, die obendrein den Kern der Sache in sich sammelte und dadurch auf die einfachste Weise agitatorisch wirkte. Diese nötige Ergänzung bot die illustrative Behandlung der strittigen Tagesfragen, das Bild. Dieses Bild aber mußte jedermann zugänglich, jedermann ständig unter den Augen sein, und das ermöglichte eben die Einführung des Holzschnittes. Durch ihn konnte jeder Gedanke verhundertfacht und ihm außerdem ein fortwirkendes Leben verliehen werden. Er war das einfachste und billigste Reproduktionsverfahren für Bildzwecke. Die Einführung des Holzschnittes war somit in Deutschland das oberste Bedürfnis dieses Zeitalters, und darum mußte er in Deutschland eine ungeheuere Entwicklung erleben. Das ist die ganz einfache ökonomische Erklärung seiner Blüte. Kein Wunder, daß der künstlerische Niedergang des Holzschnittes auch zur selben Stunde eintrat, als die Hauptschlacht geschlagen war, was übrigens außerdem mit dem Erlahmen der Kaufkraft der Massen in Deutschland, d. i. des Bürgertums zusammenfiel.
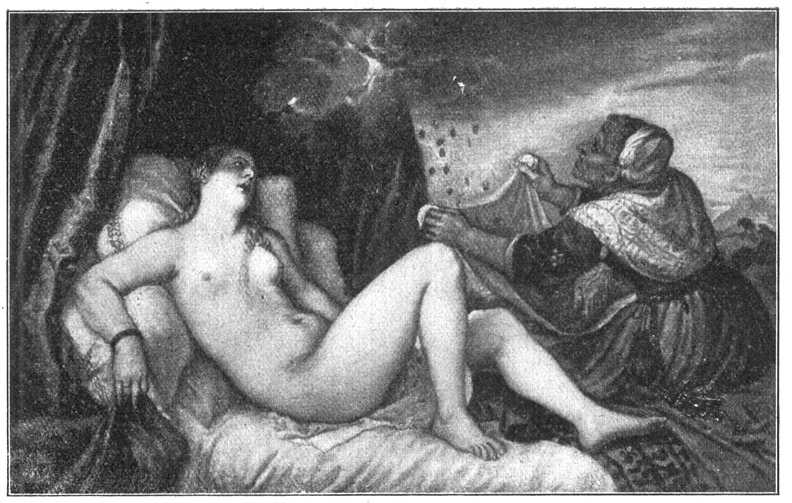
33. Tizian: Danaë
Ein Blick auf Frankreich belegt in entgegengesetzter Weise das gleiche. In Frankreich spielte im 16. Jahrhundert der Holzschnitt eine ungleich geringere Rolle. Und das ist ebenso logisch. Frankreich war einerseits nicht dermaßen abhängig von Rom wie Deutschland, weil die absolute Fürstengewalt dort schon viel weiter entwickelt war, andererseits konnte infolge dieser stärkeren Entwicklung des Absolutismus in Frankreich von keinem ähnlich starken Einflusse der Massen auf das öffentliche Leben die Rede sein wie in Deutschland. Wo aber in Frankreich – und das gilt auch von allen anderen Ländern – ähnliche reformatorische Bewegungen wie in Deutschland sich herausbildeten, begegnen wir ebenfalls einer stärkeren Entwicklung des Holzschnittes.
Daß diese politischen Zeitaufgaben nicht nur von untergeordneten Künstlern erfüllt wurden, sondern daß auch die großen deutschen Meister unausgesetzt für den Holzschnitt tätig waren, erklärt sich noch außerdem aus der geringeren ökonomischen Leistungsfähigkeit Deutschlands. In Italien waren die großen Familien der Mediceer, die Herzöge von Ferrara, der päpstliche Hof mit seinen Tausenden im Gold fast erstickenden Trabanten, die Auftraggeber für die schaffenden Künstler. Dort konnten also auch die Künstler ständig aus einem lawinenartig auf Italien heranflutenden Goldstrome schöpfen. Anders in Deutschland. Da waren nur die Fugger, die Pirkheimer und einige wenige andere Geschlechter die wirklich zahlungsfähigen Auftraggeber. Die ewig in der Geldklemme seufzenden kleinen Fürsten, jene armseligen Schlucker, für die die Reichstage nur Markttage waren, wo sie ihre Stimme zwar nicht zum Wohle des Vaterlandes, sondern zu dem ihrer leeren Taschen an den Meistbietenden verkauften, kamen für die Kunst nur wenig in Betracht. Unter solchen Umständen war in Deutschland sogar der Kupferstich schon eine aristokratische Kunst. Und daß er das tatsächlich damals war, erhellt auch daraus, daß man in ihm relativ viel häufiger als im Holzschnitte der Verwendung von antiken Motiven, also den Denk- und Ausdrucksformen der Gebildeten begegnete. Da aber gleichwohl ein Massenbedürfnis an Kunst vorlag, so entstand das Heer der sogenannten Kleinmeister.
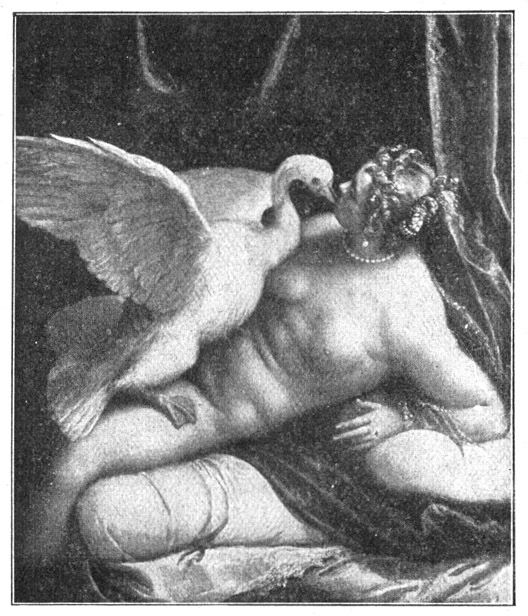
34. Paolo Veronese: Leda und der Schwan
Die in einer Zeit in Aktion tretenden Antriebskräfte liefern uns auch den Schlüssel dafür, warum jeweils ganz bestimmte Motive in der Kunst eines Zeitalters wiederkehren und eine auffallend starke Rolle spielen. In der Renaissance ist ein solches Motiv z. B. die Apokalypse gewesen. Die Apokalypse steht nicht nur im Holzschnittwerke Dürers an oberster Stelle, sondern auch zahlreiche andere Künstler haben sie künstlerisch gestaltet. Freilich nicht nur in den zeichnenden Künsten spielte die Ausbeutung und Behandlung dieses religiösen Motives eine Hauptrolle, sondern auch in den Schriften der deutschen Reformatoren. Man denke hierbei nur an Thomas Münzer. Immer und immer wieder knüpften die Reformatoren an die Apokalypse an und deuteten sie aus, d. h. verwendeten ihre Deutungsfülle im Interesse ihrer aktuellen politischen Reformbestrebungen. Diese häufige Verwendung des Motives der Apokalypse entspricht aber bei allen, den Künstlern sowohl wie bei den reformatorischen Kämpfern, denselben historisch-ökonomischen Bedingungen: Die Zeit war voll des Zündstoffes, und die Zeit hatte die Aufgabe, revolutionäre Probleme komplizierter Art zu lösen. Indem nun aber alle Probleme dieser Zeit nicht in ihrer nackten realen Gestalt vor die damalige Menschheit traten, sondern stets in ideologisch-religiösen Formen sich durchsetzten, so mußte auch jede einzelne Kampfformel ebenfalls an die Bibel anknüpfen. Und dort natürlich wiederum da, wo die größte Deutungsmöglichkeit im Interesse der aktuellen Fragen gegeben war. Und das war sicher in den kühnen Kapiteln der Apokalypse der Fall, die sich selbst wie eine Art kühner Revolutionspredigt anhört. Wenn man im einzelnen nachprüft, so ist es wiederum erklärlich, daß gerade Blätter wie »Die vier Reiter« von Dürer einen besonderen Ruhm erlangten. Dieses Blatt ist der direkte künstlerische Niederschlag der neuen Wirtschaftsordnung. Wie ein unwiderstehliches Heer wilder Reiter, so hielt sie tatsächlich ihren Einzug in die Welt. Tod und Verderben überall hintragend, alles vernichtend, alles mit Greuel und Schrecken erfüllend, wo die Hufe ihrer Rosse den Boden berührten.
Derselbe Gesichtspunkt ergibt, daß neben der Apokalypse mit zwingender Notwendigkeit der Marienkultus stehen mußte. Vergeblich klopfte man an die Tore der Zeit: die Zeit entschleierte ihre Rätsel nicht – die Sphinx blieb stumm. Was man erlebte, erschien daher der gesamten Mitwelt als ein unerbitterliches, erbarmungsloses Schicksal, und was man erlitt, das nahm man als die verdiente Strafe für begangene Sünden hin. Daß es eingebildete Sünden waren, daß der schwarze Tod, die Lustseuche und die Massenarmut auf keinem persönlichen Verschulden beruhten, begriff man nicht, ebensowenig, daß man einem geheimen Lebensgesetze folgte, wenn das Blut kräftiger pulsierte und sich dementsprechend unbändiger manifestierte, – man konnte es auch nicht begreifen, weil ein neuer Zustand der Gesellschaft eben erst bei einer gewissen Höhe der Entwicklung seine Geheimnisse preisgibt. Aber weil man das Wesen der Zeit und ihre inneren Notwendigkeiten nicht begriff, darum hielt man sich für besonders sündig. Es blieb also jedem scheinbar nichts übrig, als in der brünstigsten Weise beim Himmel um Gnade zu flehen, daß die Strafe, die so furchtbar schwer auf die Menschen herniedersauste, gemildert würde. Die Inbrunst des Gebetes entwickelte sich in demselben Maß, in dem man fühlte, daß man diesen Sünden nicht zu entrinnen vermochte. Schließlich fühlte man, je mehr das Elend trotz alledem hereinbrach, daß man nicht mehr allein auskam: man mußte einen Fürsprecher am Throne Gottes haben. Dieser Fürsprecher wurde somit die allerwichtigste Figur im damaligen Leben, denn auf sie kam es ja an. Da dieser Fürsprecher in der Religion aber die Jungfrau Maria war, so mußte dies zu einer Steigerung und Vertiefung des Marienkultus ins Unermeßliche führen: ihr alle Ehren, ihr alle Liebe, ihr alle Inbrunst …
Schon diese wenigen Beispiele, die man aber ins Ungemessene erweitern könnte, erweisen die fundamentale Tatsache, auf die es hier ankommt: daß die Kunst niemals als etwas Zufälliges im Rahmen einer Zeit steht, sondern daß sie mit allen ihren Fasern von der Entwicklung der Gesellschaft, d. h. von ihren ökonomischen Tendenzen abhängig ist. –
An dieser Stelle ist nun noch eine andere Erscheinung, die sich aus denselben Ursachen ergibt, und die nur eine logische Weiterführung der bisher entwickelten Gedanken darstellt, zu analysieren.
Weil die Kunst stets dem Aufstieg und dem Abstieg der jeweils herrschenden Klasse folgt, so muß man sagen, daß sie sozusagen stets den Weg der historischen Logik begleitet, und daß sie wiederum nur jene Bewegungen begleitet, aus denen das Wesen der Zeit resultiert. Das kann aber zu nichts anderem führen, als daß eine bestimmte Kunst sich in dem Augenblicke erschöpfen muß, in dem diese Bewegungen und Tendenzen historisch überwunden sind. Das ist eine nicht unwichtige Logik, denn damit enträtseln sich eine ganze Reihe Erscheinungen. Aus diesem Umstande resultiert z. B. die Tatsache, warum wir heute nirgends, in keinem einzigen Lande mehr, eine selbständige religiöse Kunst haben, weder in katholischen noch in protestantischen Ländern, sondern überall nur eine ausgesprochen bürgerliche Kunst. Dieser Umstand begründet, daß alle die vielen Versuche, die darauf hinausliefen, eine solche ins Leben zu rufen, fehlschlagen mußten, und daß es trotz der verschiedensten Anstrengungen nicht ein einziges Mal gelungen ist, einen neuen, echten und lebenskräftigen Gefühlston der alten Skala einzufügen; daß alles nur Kopie ist, und daß man nur neue Töne fand, nicht indem man die heutige ökonomische Situation religiös ideologisierte, sondern indem man die neuen Begriffe religiös taufte. Dieselbe Logik führt auch dazu, zu verstehen, warum wir bis heute ebensowenig eine sozialistische Kunst haben, trotzdem der Sozialismus die ausgedehnteste Volksbewegung ist, die die Weltgeschichte bis jetzt gesehen hat. Ist die Religion nicht mehr die Ideologie für eine herrschende Wirtschaftstendenz, so ist es der Sozialismus bis heute noch nicht, sein wirtschaftliches Prinzip hat noch nirgends gesiegt. Kunst kann zwar nur von der Masse getragen werden, aber diese Masse muß, um aus sich heraus selbständige künstlerische Werte hervorbringen zu können, bereits eine völlige Unabhängigkeit von der Denkweise jener Klassen erlangt haben, die sie hinfort abzulösen drängt, sie muß geistig ganz auf eigenen Füßen stehen. Außerdem muß sie aber auch bereits ein beherrschender wirtschaftlicher Faktor sein. Mit einem Wort: sie muß bereits eine neue Kultur repräsentieren und diese nicht erst ankündigen. (Vgl. auch, was oben S. 16 über die Entstehung des Stils gesagt ist.)
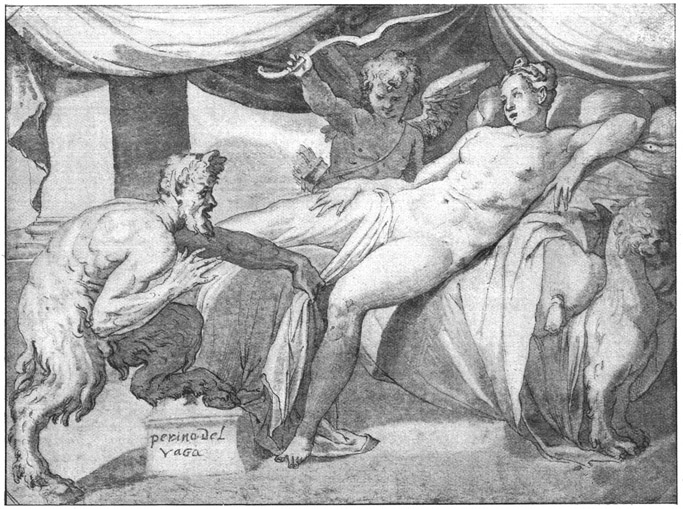
35. Perino del Vaga: Der lüsterne Faun. Original im Kupferstichkabinett München, 16. Jahrhundert
Daß ein neues wirtschaftliches Prinzip bereits gesiegt und sich politisch und gesellschaftlich durchgesetzt hat, ist das Entscheidende. Darum kann eine neue Kunst, die sich durch spezifisch neue Kunstformen offenbart, niemals schon im Stadium der Vorbereitung einer neuen Zeit erscheinen, darum kann weiter eine neue Kunst auch nicht Ouvertüre sein, geschweige denn die Fanfare bilden, die das neue Stück auf der Weltbühne einführt. Sie kann nur das Siegesdokument sein, und darum begegnet man ihr immer erst im zweiten Akt. Um dies an einem bestimmten Kunststile zu kontrollieren, sei auf das Barock verwiesen. Das Barock war die Kunstform, die jener ökonomischen Kräfteverteilung entsprach, die politisch als die absolute Fürstengewalt sich darstellte, und die am Ausgang des 16. Jahrhunderts die Renaissance ablöste. Das absolute Fürstentum existierte freilich nicht erst seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts, sondern schon bei Beginn des 16., aber damals war es noch eine revolutionäre Macht, die, wenn es in ihrem Interesse lag, sich nicht abhalten ließ, jeden Tag mit einer anderen revolutionären Macht sich zu koalieren und dieser entsprechende Konzessionen zu machen. Aus diesem Grunde konnte der Absolutismus die ihm adäquaten Kunstformen am Beginne des 16. Jahrhunderts noch nicht ausbilden, sondern diese konnten sich erst in dem Augenblicke klar herausentwickeln, als das absolute Fürstentum die einzig bestimmende Gewalt geworden war, und das war erst vom Ausgange des 16. Jahrhunderts an der Fall. Von da ab war der fürstliche Absolutismus der stärkste Begriff der Zeit, er war deren sichtbarste Realität. Und in der Tat begegnet man auch erst von da ab dem Barock in der Kunst. Richard Muther sagt: Die Kunst kann nur auf der Basis einer ruhigen, abgeschlossenen Kultur sich erheben. In diesem Satz ist Ähnliches ausgesprochen, denn eine abgeschlossene Kultur ist nichts anderes als der zweite Akt des historischen Dramas, das der Kreis einer neuen Wirtschaftsordnung umspannt, der Sieg eines neuen Wirtschaftsprinzips auf der ganzen Linie. Daß aber eine neue Zeit in Vorbereitung ist, und in welcher Richtung diese sich entwickeln wird, das läßt sich trotzdem in den Künsten sehr lange vor dem Siege der neuen Mächte erkennen, und zwar an dem Auftauchen und der beharrlichen Wiederkehr bestimmter neuer Motive. Kann eine neue Wirtschaftstendenz noch keinen neuen Stil entwickeln, so vermag sie doch die Wahl der Gegenstände der künstlerischen Behandlung zu beeinflussen. Ihre Kampfparolen treten in der Kunst auf, und vor allem die Repräsentanten, von denen die kommende Zeit getragen sein wird. Der Heilige als Motiv tritt auf, der Ritter, der Kaufmann, der Hofmann, die Bourgeoisie, das Proletariat – in dieser Weise setzt jede neue Epoche der Kunst ein, das sind ihre Anfänge. Außerdem aber auch in der besonderen Unruhe, die in den Stil einer Zeit kommt, kündet sich die Umformung an. Das Rokoko z. B. ist ein prickelndes Gemisch von all dem Luxus dieser Zeit, immer mehr aber auch von all den neuen Ideen, die bereits im Schoße der Gesellschaft gärten.
Weil man einer fertigen neuen Kunst immer erst dann begegnet, wenn eine Umwälzung schon völlig vollzogen ist, so erklärt sich daraus auch die bekannte historische Erscheinung, daß die allerhöchsten künstlerischen Ergebnisse einer Zeittendenz nicht selten sogar erst als Finale, also in den Zeiten des Niederganges auftauchen. In den Zeiten des Niederganges, wenn eine bestimmte Entwicklungstendenz sich erschöpft hat und damit die absteigende Linie anfängt, sodaß die Altersschwäche zum Bewußtsein kommt, – in diesem Stadium erwacht, ob es sich nun um Völker, Klassen oder Einzelindividuen handelt, stets die Sehnsucht nach der Jugend, nach der Zeit der stolzesten Manneskraft, dann stehen die Ideale der Vergangenheit – »die gute alte Zeit« – stets am strahlendsten vor der Phantasie. Und zwar um so strahlender, je weniger die Gegenwart befriedigt, je weniger sie die Erfüllung des einst Erhofften ist und je geringer gleichzeitig der Glaube an die Zukunft. Hieraus erklärt sich auch, daß jede Art Romantik, von jener angefangen, die das unvergleichliche Colleonedenkmal hervorbrachte, bis heraus zu unserer Zeit, häufig erst aus der Schwelle, auf die bereits die neue Zeit siegreich ihren Fuß gesetzt hatte, ihre wundersamsten Blüten erschlossen hat. –
*
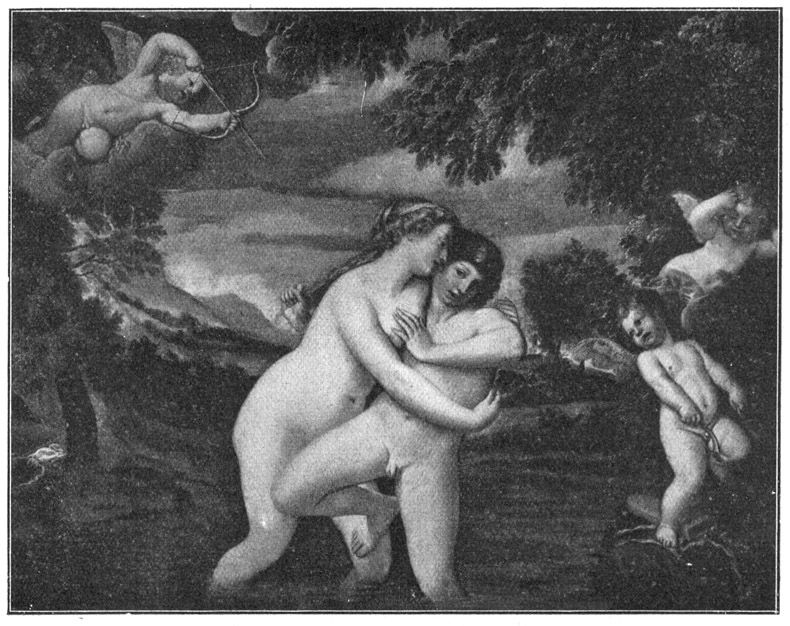
36. Francesco Albani: Salmacide respinta da Ermafrodito Original Königliche Pinakothek, Turin
Wenn man im jeweiligen Kunststiel das formgewordene Lebensinteresse eines Zeitalters, den künstlerischen Reflex ihrer ökonomischen Haupttendenz erblickt, so wird man dadurch zu zwei wichtigen Schlußfolgerungen geführt. Die erste ist diese: Je klarer sich eine bestimmte Wirtschaftsform durchsetzt, und je länger diese in ihrem Grundwesen unbeeinflußt von anderen ökonomischen Interessen und daraus resultierenden Ideen bleibt, zu einem um so charakteristischeren und um so einheitlicheren Kunststil muß das betreffende Zeitalter gelangen (S. 16). Die zweite Schlußfolgerung ist das Gegenteil hiervon: Je widerspruchsvoller eine Zeit in ihrer wirtschaftlichen Tendenz ist, je mehr wirtschaftliche Mächte um die Oberhand miteinander streiten, um so verschwommener, das ist um so stilloser, muß die Kunst der betreffenden Epoche sich präsentieren. Kommen in den ökonomisch klar ausgeprägten Epochen die großen Kunststile auf, wie Gotik, Renaissance, Barock usw., so wuchert in den anderen stets der Eklektizismus empor, der im Grunde nichts anderes ist als das künstlerische Widerspiel dafür, daß die vorbereitende Zeit sich noch nicht klar durchgerungen hat. Dem Eklektizismus und der Stillosigkeit begegnet man daher vornehmlich in allen Übergangszeiten. Der Hinweis auf zwei ebenso bekannte wie charakteristische Epochen mag dies belegen.
Für jene wirtschaftlichen Konstellationen, die zu einem klaren Kunststil führen müssen, sei auf das Holland der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts verwiesen. Es gibt kein Land, in dem der ökonomische Grundgedanke der neuen Zeit, die auf dem Handel beruhende Geldwirtschaft, derart unbeeinflußt von anderen wirtschaftlichen Tendenzen in gesellschaftliche Formen sich umsetzte wie gerade im damaligen Holland. Ganz Holland wurde im Verlaufe dieser Umwälzung zu einer einzigen Handelsstadt, aus der die Naturalwirtschaft gänzlich ausgetilgt war. Dieser Klarheit und Einheitlichkeit der neuen Wirtschaftsmächte entsprach die Art der Umwälzung und das schließliche Resultat, in das die holländische Kunst auslief. Nirgends sonstwo war die Umwälzung in der Kunst eine so kühne und radikale, nirgends sonstwo erwuchs ein derart einheitlicher Kunststil wie dort. Und so jäh und elementar der Siegesweg Hollands in die bürgerliche Welt hinein war, ebenso elementar und ebensowenig irritiert von fremden künstlerischen Einschlägen war darum der künstlerische Aufstieg Hollands in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Als Beispiel für eine Periode der Stillosigkeit und ihres Zusammenhanges mit widerstreitenden Tendenzen im Wirtschaftsleben verweisen wir auf die deutsche Kunst der Jahre 1860 bis etwa 1885. Diese Periode repräsentiert unzweifelhaft eines der stillosesten Zeitalter der gesamten deutschen Kunstgeschichte. Hier wurde der Reihe nach alles versucht, alles probiert und alles im bunten Durcheinander: Gotik, Renaissance, Barock. In dieser Weise verfuhr man auf sämtlichen Kunstgebieten, in der Baukunst, in der Malerei, in der Möbelindustrie usw. Die ungeheuerlichste Zweckwidrigkeit verursachte niemandem irgendwelche Skrupeln. Wie verhält sich dazu nun die wirtschaftliche Physiognomie dieser Zeit? Es ist jedem Wirtschaftshistoriker bekannt, daß gerade diese Zeit von den widerstreitendsten ökonomischen Mächten bewegt war, und zwar derart, daß auch hier ein förmliches Chaos dem Blick sich darbietet. Zweifellos war die Haupttendenz unserer Zeit, die Entwicklung zur Großindustrie und damit zum Großkapitalismus, längst unaufhaltsam geworden. Weil aber Deutschland erst sehr spät in die moderne großindustrielle Entwicklung hineingerissen worden ist, und weil es durch die Erbschaft aus seiner politischen Vergangenheit, durch die Feudalherrschaft so lange künstlich gehemmt worden war, so existierten überall noch ganz ungeheure Mittelschichten, die sich dieser Entwicklung mit aller Gewalt entgegenstemmten. Das Kleinhandwerk spielte noch eine außerordentliche Rolle; und wenn auch nur als absterbende Produktionsschicht, so doch noch als diejenige, die immer noch den gesamten Komplex der geistigen Vorstellungen der Massen beherrschte. Einen nicht unwichtigen Einschlag lieferte außerdem das Agrariertum, das besonders in Preußen seine noch absolut unbestrittene Domäne hatte. Diese heterogenen ökonomischen Tendenzen, die kraft ihrer inneren Unversöhnlichkeit einen Kampf auf Leben und Tod miteinander führten, schufen im gesamten Wirtschaftsleben eine geradezu heillose Unordnung. Und dieser Zustand konnte sich wiederum nicht anders durchsetzen als in einer ebenso totalen Verwirrung der Politik, der Rechtsanschauungen, der sittlichen Begriffe usw. Was denn auch der Fall war. Denn dem Großbetriebe, wo tausend Arme nebeneinander sich regen, entsprechen ganz andere Rechtsbegriffe, ganz andere sittliche Normen wie dem patriarchalisch geleiteten Kleinhandwerk und dem Feudalbetriebe der Landwirtschaft. Aber was für diese Ideologien gilt, gilt auch für die Kunst. Und so bedingte der innere Widerspruch, der zu einer derartigen allgemeinen Unordnung führte, notgedrungen in der Kunst dasselbe Resultat. Die noch herrschenden Schichten der Handwerker und Agrarier suchten ihr Heil aus der Zeiten Nöte in der Vergangenheit – die Kunst mußte dieselben Wege wandeln, also schwärmte man für Romantik, für Gotik und Barock.

37. Paolo Veronese: Das verliebte Paar, original Alte Pinakothek. München

38. Lukas Cranach d. Ä.: Lukretia Alte Pinakothek, München. Aus der Kollektion Hanfstaengl, München
Die landläufige Erklärung für das Tohuwabohu in der Kunst in dieser und in anderen Zeiten ist freilich eine andere. Die Ideologie schiebt die Schuld gewöhnlich auf das angeblich unter allen Umständen fehlerhafte Zurückgreifen auf alte Kunstformen, und in dem zitierten Fall auf die angeblich willkürliche Anlehnung an die Gotik, das Barock usw. Rein äußerlich betrachtet, scheint dieser Vorwurf berechtigt zu sein, er ist aber gleichwohl absolut falsch. Man muß sich nämlich darüber klar sein, daß jedes neue Zeitalter, in dem neue ökonomische Mächte die ihnen adäquaten gesellschaftlichen Formen herausbilden, stets zu alten, fertigen Denk- und Ausdrucksformen zurückgreift. Man sucht nach Formen, in denen die neuen Probleme sozusagen schon gelöst sind. So griff bekanntermaßen die Renaissance zum Altertum zurück, die Romantik zur biederen Ritterzeit usw. Dieses Zurückgreifen auf alte Formen ist also etwas Selbstverständliches; es ist gleichsam eine Art Suchen nach Bundesgenossen, nach Unterstützungsmitteln zur leichteren Durchführung dessen, was man, freilich meistens unbewußt, anstrebt. Und wie es etwas Selbstverständliches ist, so ist es auch nicht ohne weiteres etwas Fehlerhaftes und Verwirrendes; gerade so wenig freilich unter allen Umständen etwas Förderndes, – es kann beides sein. Was es aber in dem besonderen Fall ist, hängt nicht vom bloßen Zufall ab, sondern von der inneren Verwandtschaft der jeweiligen Gegenwart mit jener Zeit, auf die man zurückgreift, andererseits von der Unvereinbarkeit der Tendenzen, von denen die beiden miteinander in Beziehungen gebrachten Zeiten erfüllt sind. »Überlieferte Ideen, welche in früheren Gesellschaftszuständen entstanden sind, können hemmend und können fördernd auf spätere Zustände einwirken, je nachdem sie das Erkennen der neuen wirkend gewordenen Tendenzen erschweren, oder ihnen schon fertige, brauchbare Formeln im Recht, im Handel usw. bieten.« Die Geschichte erweist auf Hunderten von Seiten und für die verschiedensten Gebiete die Richtigkeit dieses Gesetzes. Beim Ausgange des Mittelalters wirkten die aus der Antike überlieferten Ideen fördernd auf die bürgerliche Entwicklung, das Zurückgreifen auf sie wurde zu einem wertvollen revolutionären Hebel. Und das war logisch. Die wirtschaftliche Basis war in beiden Epochen dieselbe, nur daß sie sich in der Renaissance auf einer höheren Stufenleiter der Entwicklung befand. Beide basierten auf dem Warenhandel. Indem man also in der Renaissance auf das Altertum zurückgriff, entlehnte man Denk- und Gefühlsformen, die von denselben wirtschaftlichen Voraussetzungen entwickelt worden waren. Damit erklärt sich einem auch sofort die ungeheure Begeisterung der Renaissance für die Antike. Dort fand man scheinbar bereits fertig, wonach man suchte und strebte. Und darum kehrte sich auch in der Kunst und in der Wissenschaft die Psyche ganz von selbst zur Antike; der Christengott wandelte sich zum Jupiter, Maria zur Juno, Magdalena zur girrenden Venus. Ganz anders war es, als man im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zu den Formen der Renaissance zurückgriff. Gewiß war diese Anknüpfung rein äußerlich nicht ganz unlogisch; insofern, als man wähnte, es sei für Deutschland ein neues Zeitalter der Renaissance angebrochen. Das Unlogische und darum Fehlerhafte bestand aber darin, daß man sich gründlich im Wesen der Zeit täuschte. Wohl handelte es sich in beiden Zeiten um aufsteigende Perioden der kapitalistischen Entwicklung, aber die Basis, die kapitalbildenden Mächte waren bei beiden völlig verschiedene. War es in jenem Abschnitte der Renaissance, dessen Formen man entlehnte, wie vorhin gesagt wurde, ausschließlich der Handel, der zur Kapitalbildung führte, so jetzt die Großproduktion. Nicht auf der Exploitierung der Masse als Käufer, sondern in erster Linie als Verkäufer, und zwar als Verkäufer der Ware »Arbeitskraft« beruhte jetzt das Wesen der Kapitalbildung. Das sind zwei grundverschiedene Faktoren, und darum konnte das Zurückgreifen auf die Renaissance nicht auslösend, sondern mußte verwirrend auf die Kunstentwicklung wirken. Die alte Form vermochte sich mit dem jetzigen Inhalte der Geschichte nicht zu decken. Ähnlich verhielt es sich mit dem Zurückgreifen auf das Barock, kurz mit jeder Anlehnung an alte Kunstformen: für die moderne Großindustrie gab es in früheren Jahrhunderten keine Analogie. Wo man daher auf Vergangenes nicht zurückgriff, und wo das neue Prinzip nicht im Kampfe mit alten Wirtschaftsmächten lag, wie z. B. in Amerika, da entstanden auch alsbald die der neuen Zeit entsprechenden Linien; roh und brutal zwar, aber eben doch adäquat.

39. Albrecht Dürer: Lukretia Alte Pinakothek. München
Wenn früher an den Grenzgebieten der verschiedenen wirtschaftlichen Epochen kein ähnlich großes Tohuwabohu in der Kunst entstand wie bei dem Übergang von der kleinbürgerlichen Kunst Deutschlands zur modernen Kunst, die sich mit jedem Tage mehr als der adäquate Ausdruck unserer siegreich gewordenen großindustriellen Entwicklung zeigt, so hauptsächlich deshalb, weil die Umformung der wirtschaftlichen Basis der Gesellschaft früher wesentlich langsamer vor sich ging als heute. Das Neue wuchs ganz allmählich aus dem Alten heraus. Darum kann man in früheren Epochen so einfach gliedern: Frührenaissance, Hochrenaissance, Spätrenaissance, frühes Barock, spätes Barock usw. Außerdem herrschte niemals ein solches Chaos in den Ideen – aus der Einheit des Bewußtseins ist heute infolge der bewußt geführten Klassenkämpfe, wie mehrfach betont ist, eine Vielheit geworden – wie in unserer Gegenwart, die obendrein mehr wie jede andere Zeit die Erfüllung der gesamten Vergangenheit ist. Nun da die Zeit endlich erfüllt war, entstand das Maschinenalter mit seiner kolossalen Entwicklung, wie wir es heute vor uns haben, nicht mehr vorsichtig und langsam tastend, sondern es sprang gewissermaßen wie Minerva aus dem Kopfe des Zeus in die Wirklichkeit, es war da von gestern auf heute und auf der ganzen Welt. Wo vor wenigen Jahren noch die Ölfunzel brannte, strahlt heute die tausendkerzige Bogenlampe; ob Petroleum oder Gas, darüber wurde gar nicht mehr erst diskutiert – das ist das abgekürzte Verfahren historisch reifer Epochen.
An dieser Stelle ist es nicht unangebracht, auch einige Worte über das Problem des Epigonentumes in der Kunst, über seine im Wesen der Dinge bedingten unfruchtbaren Resultate und Wirkungen zu sagen. Auch sie erklären sich auf demselben Wege, denn sie sind von denselben Faktoren bedingt. Weil Kunst nur dann lebendig und organisch wirkt, wenn das die betreffende Zeit beherrschende Grundprinzip gestaltend sich in ihr manifestiert, darum können Epigonen, also jene, deren Programm darin besteht, die Formel eines bestimmten Meisters, die zu ihrer Zeit organisch war, als die für alle Zeiten alleinseligmachende und richtige zu proklamieren, nur Schablonierer sein. Der ökonomische Inhalt der Zeit ist nicht mehr derselbe, und darum ist die alte Form nicht mehr organisch. Aus diesem Grunde muß zur bloßen Konstruktion werden und zusammenhanglos selbst dasjenige in der Zeit stehen, was kurz zuvor Geist der Zeit und lebendige Form des Geistes der Zeit gewesen ist.
Aus derselben Ursache erklärt sich auch der Widerwille, den man in einer neuen Kunstepoche nicht selten in besonderem Maße gerade gegenüber der eben überwundenen Epoche empfindet. Dieser Widerwille tritt immer um so stärker auf, je weniger die neue Zeit eine Weiterführung derselben Tendenzen, sei es im guten, sei es im schlechten Sinne, darstellt. Das beste Beispiel in der Kunstgeschichte ist der allgemein bekannte Widerwille, der sich in der Kunst des 17. Jahrhunderts gegen die Schöpfungen der Hochrenaissance immer und immer bemerkbar machte und oft bis zur gehässigen Verlästerung ausartete. Dieser Widerwille war nichts anderes als die künstlerische Ausstrahlung der dahin veränderten Wirklichkeit, daß der neue historische Zustand der Dinge sich in gar keiner Weise mehr mit dem des 16. Jahrhunderts deckte. Und da das 17. Jahrhundert keine höher entwickelte Weiterführung der geschichtlichen Notwendigkeiten war, sondern direkt in Widerspruch zu diesen trat, so mußte sich auch die Kunst dieser Zeit in ebenso intensiven Widerspruch mit der des 16. Jahrhunderts setzen. –
*
Wir kommen nun zu dem Problem, das große Kunstepochen darstellen, und wollen zum Zwecke der Nachprüfung die Renaissance – natürlich als Gesamterscheinung – heranziehen. Nur wenn wir bei dieser gewaltigsten Kunstepoche, die die europäische Kunstgeschichte seit dem Ausgange der Antike kennt, das zugrunde legen, was wir oben über das Wesen der Revolution gesagt haben, wird uns diese Epoche in allen ihren Teilen begreiflich. Gleichzeitig wird sie uns dadurch aber auch in ihrer gewaltigen Expansion, mit ihren ebenso grandiosen Resultaten zu einem förmlichen kategorischen Muß der Geschichte.
Man datiert den Beginn der Renaissance gewöhnlich auf die Mitte des 15. Jahrhunderts. Um diese Zeit hatten sich die neuen Formen der Kunst soweit klar herausgebildet, daß man deutlich zwischen mittelalterlicher und neuer Kunst unterscheiden kann. Das ist die Zeit der Frührenaissance. Die große Blütezeit dieser Epoche, die Periode der sogenannten Hochrenaissance, datiert man etwa auf die Jahre 1490 bis 1530. In diesen vier Jahrzehnten lebten und gestalteten die allergrößten Meister jener Kunstepoche. Die Spätrenaissance und schließlich der Ausgang der Renaissance – abgesehen von der holländischen Etappe, für die Rembrandt und Hals die strahlenden Gipfel wurden – erfolgte ein halbes Jahrhundert später.
Das ist auch der Radius der neuen Wirtschaftsepoche, die damals in die europäische Geschichte eintrat. In der Mitte des 15. Jahrhunderts begann die revolutionäre Epoche der neuen wirtschaftlichen Mächte, es begann der letzte Entscheidungskampf zwischen der historisch überwundenen Naturalwirtschaft und den neuen Mächten der Geldwirtschaft, und damit auch der unaufhaltsame Siegeszug der letzteren über die gesamte Kulturwelt.
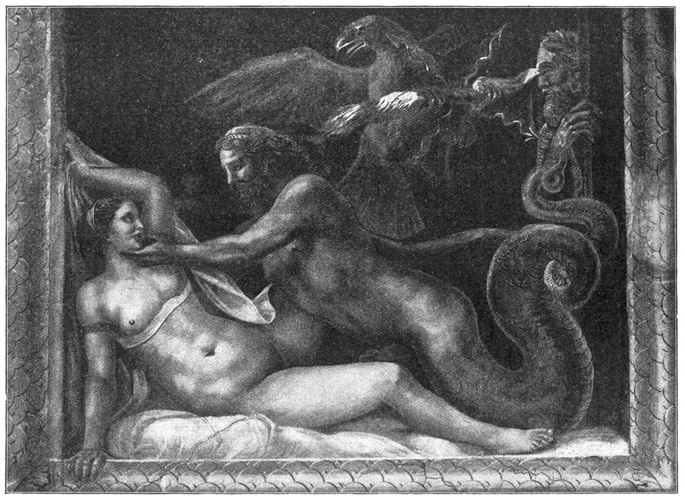
40. Giulio Romano: Zeus als Drache bei Olympia. Freskogemälde in Pavia. 16. Jahrhundert
Was sich damit vollzog, war die größte, die gewaltigste, die tiefeinschneidendste ökonomische Revolution, die die europäische Geschichte nicht nur bis dahin, sondern bis zum heutigen Tag überhaupt durchgemacht hat. Ein völlig neues Prinzip kam jetzt auf. Nicht bloß um einige Korrekturen oder um die Ausmerzung einiger störender Schönheitsfehler am alten Gesellschaftsbau handelte es sich dieses Mal, sondern die gesamte europäische Kulturmenschheit wurde auf einen völlig neuen Boden gestellt; einen Boden mit völlig neuen Lebensbedingungen und neuen Gesetzen. Der Kapitalismus wurde geboren. Sämtlichen Organisationsformen des Mittelalters war damit das unwiderrufliche Todesurteil gesprochen, alle waren darum der Auflösung verfallen, und alle waren darum in Auflösung begriffen. Das Abtreten der alten Mächte war aber nichts weniger als ein freier Verzicht, ein geduldiges Sichbescheiden, sondern in den furchtbarsten Kämpfen mußte die neue Zeit die alten gesellschaftlichen Gebilde beiseite räumen. Die historische Logik davon war, daß alles in dieser Zeit revolutionierte, und daß alles auch revolutioniert wurde. Neue Klassen entstanden. Aus dem Bürgertum erwuchs nach oben die Bourgeoisie, nach unten schied sich das Proletariat, und was das Wichtigste ist: Besitzende und Nichtbesitzende wurden Massenerscheinungen, die sich zu klar voneinander geschiedenen Klassen formten und Träger neuer wirtschaftlicher Kämpfe und Tendenzen wurden. Klassenscheidungen bedingen aber stets Klassenkämpfe. Klassenkämpfe entbrannten darum auf der ganzen Linie. Und zwar nicht nur zwischen den neuen Mächten untereinander, sondern auch mit den alten Mächten, die sich bald mit dieser, bald mit jener Gruppe, die die neue Zeit herausbildete, koalierten, je nachdem ihr Interesse es vorteilhaft erscheinen ließ. In Deutschland z. B. führte der Kleinadel seine Entscheidungsschlacht gegen die aufkommende Fürstengewalt. Er unterlag, weil er historisch überwunden war. Sein Untergang war nicht aufzuhalten, er bekam nur eine heroische Folie, weil so stolze Erscheinungen wie Hutten und Sickingen seine Bannerträger in diesem Kampfe waren. Andererseits konnte es den Sieg der neuen, der absoluten Fürstengewalt nicht schmälern, daß meistens ganz klägliche Kreaturen die Vormachtskämpfe für sie führten. Siegreich ist eben immer die historische Logik, und diese Logik war auf der Seite des absoluten Fürstentumes, das damals, wie oben schon erwähnt wurde, eine revolutionäre Macht darstellte. Und wie der Kleinadel, so rebellierten die geknechteten Bauern, die infolge ihrer Zwischenstellung in erster Linie die Kosten bei diesem Entscheidungskampfe zu tragen hatten. Auch die Bauern unterlagen; trotz ihres heroischen Widerstandes. Sie aber nicht, weil ihre Tendenzen der Logik der Tatsachen widersprachen, sondern sie unterlagen, weil sie die Vorkämpfer einer neuen Zeit waren, für deren Sieg die Bedingungen in der Wirklichkeit noch nicht entwickelt waren. In den Städten kam es ebenfalls zu Kämpfen und Streiten. Wenn auch weniger zu blutigen Auseinandersetzungen, so zu um so tiefgehenderen und um so bedeutsameren organisatorischen Gebilden: Es entstand die erste Organisation der Arbeit. Die Gesellen formten sich zu Verbänden, daraus erwuchsen die Gesellenbewegungen, deren erstes und wichtigstes Kampfobjekt naturgemäß das Koalitionsrecht sein mußte. Und wie die sämtlichen Klassen untereinander in Kampf und Bewegung waren, so die verschiedensten Länder widereinander. Das Eintreten neuer wirtschaftlicher Mächte und Konstellationen in die Geschichte führte zu den wichtigsten Korrekturen der politischen Länderkarte. Die blutigen und Jahrhunderte währenden Kämpfe zwischen Spanien und Frankreich um die Weltherrschaft setzten ein. Wenn sich diese Kämpfe auch hauptsächlich in der ideologischen Form von religiösen Streiten durchsetzten, so ändert das daran nichts, daß ihre letzten Wurzeln in den wirtschaftlichen Interessen der betreffenden Völker bestanden.
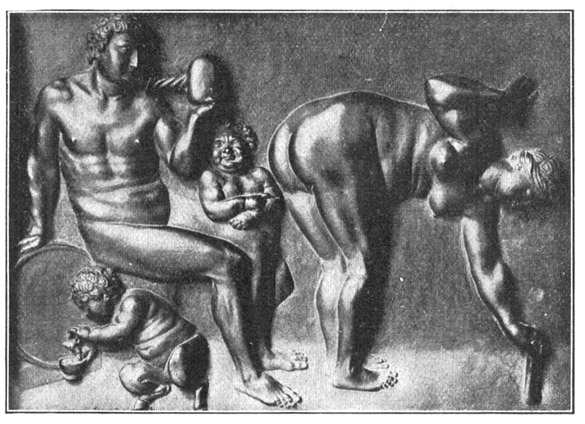
41. Peter Flötner: Erotisches Holzrelief. Kaiser-Friedrich-Museum, Berlin

42. Peter Flötner: Die Geschichte des verlorenen Sohnes. Silberne Dolchscheide
Also alles war in Gärung, alles war in Revolution, alles expansierte. Unter diesen Umständen mußte gemäß den Gesetzen, die wir oben entwickelt haben, auch die geistige Physiognomie der Völker eine von Grund aus neue werden, denn daß die seitherige Welt umgekrempelt wurde, kam allen zum Bewußtsein. Und die geistige Physiognomie wurde im gleichen Schritt eine neue, in dem diese Umwälzung siegreich sich durchsetzte. In der Wissenschaft weist es der Humanismus, in der Kunst die Renaissance.
Der Höhepunkt der revolutionären Flutwelle war um die Wende des 16. Jahrhunderts erreicht. Dadurch erhielt alles Wollen und Streben auch gerade um diese Zeit eine feste Gestalt. Die Entdeckung Amerikas wurde zu einem wichtigen, alle Tendenzen auslösenden Hebel in der Entwicklung. Zwar war nicht der Seeweg nach Ostindien gefunden, aber die Bedingungen, deren die neue Zeit zu ihrer wirtschaftlichen Expansion bedurfte, um das zu erlangen, dessen man bedurfte, waren gegeben: Arbeitskräfte, Märkte, Metallschätze usw. Dem Handel, der dazu geführt hatte, waren mit einem Schlag ungeahnte und ungeheuerliche Möglichkeiten erschlossen, und sie wurden alsbald mit tausend gierigen Händen aufgegriffen und exploitiert. Die phantastischsten Märchen wurden Wirklichkeit.
Auf dieser Basis erwachte der Hoffnung der weiteste Spielraum, der ihr jemals erschlossen worden war. Die Phantasie wurde mit tausend Schwingen beflügelt, denn das Leben versprach jetzt tausend neue Genüsse, neue ungeahnte Wonnen, neue ungekannte Seligkeiten. Alles wurde infolgedessen farbig, leuchtend und strahlend, wie wenn eine neue Sonne über die Erde aufgegangen wäre. Farbig, prunkend wurde die Kleidung. Farbig prunkend, strahlend in leuchtender Herrlichkeit mußte auf diesem Untergrund auch die Kunst werden. Die höchste Form der Expansion in der Kunst war jetzt eine selbstverständliche Folge: Die Kunst mußte einen grandiosen monumentalen Stil entwickeln, denn einzig das Grandiose, das Heroische entsprach den neuen Lebensbedingungen der Zeit. Weil alles explodierte, weil alle Pulse rascher schlugen, Kraft, Kühnheit das Oberste und Selbstverständlichste waren, darum mußte jetzt jeder Pinselstrich den Eindruck erwecken, als seien in jener Zeit die Farben mit Feuer gemischt worden. Es muß selbst dem ungeschultesten Auge auffallen, daß hier mit einem ewigglühenden, nie verglimmenden Feuer gemalt worden ist. Die Künstler gestalteten ihre Zeit. Sie gaben den treibenden Kräften Gestalt, ob sie Menschen in Stein nachformten, ob sie die Züge ihrer Zeitgenossen im Bilde festhielten, ob sie Landschaften nachbildeten, Tierstücke malten, oder ob sie ihr gewaltiges Empfinden im Aufbau der gigantischen, wie von Zyklopen getürmten Paläste Form gaben.
Freilich nur in diesem Hauptzuge beruht die künstlerische Einheitlichkeit dieser Zeit und besteht eine strenge Geschiedenheit von der mittelalterlichen Kunst. Wenn man das künstlerische Gesamtbild dieser Epoche in seine Einzelheiten zerlegt, gleicht es nichts weniger als einer Linie ohne Abweichungen. Und dies konnte auch nicht anders sein, denn der Siegeszug der neuen wirtschaftlichen Mächte war ja in den meisten Ländern von den widerstreitendsten Interessen beeinflußt. Wo das letztere einmal nicht der Fall war, wie z. B. in Holland in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, wo die Haupttendenz der wirtschaftlichen Entwicklung, der Triumph des Handelskapitals, relativ ungehemmt auf der ganzen Linie sich durchsetzen konnte, da ist auch das Gesamtbild der Kunst ein erstaunlich einheitliches. Auf diese bereits erwähnte Epoche der holländischen Kunst, ihr zweites Heroenzeitalter, müssen wir hier übrigens nochmals, und zwar eingehender zu sprechen kommen, weil sie in jeder Richtung ein besonders geeignetes Schulbeispiel für die Zusammenhänge zwischen Kunst und Wirtschaft abgibt.
Die Basis für den Handel im 16. und 17. Jahrhundert war gemäß der oben erwähnten Faktoren, die die Entdeckung Amerikas sozusagen zu einem Programmpunkte der Geschichte machten, die Kolonialentwicklung. Durch die Verlegung der Handelswege, die mit der Entdeckung Amerikas und mit dem Niedergange Spaniens vor sich ging, entwickelten sich die holländischen Häfen zu den Hauptstützpunkten des gesamten internationalen Handels, und Holland selbst entwickelte ebenfalls infolgedessen zuerst das Kolonialsystem am intensivsten. In der Mitte des 17. Jahrhunderts stand Holland im Brennpunkte seiner Handelsblüte, die Geldwirtschaft hatte hier ihre Metropole. In Holland entwickelte sich daher der stolzeste, selbstbewußteste und protzigste Kaufmannsstand. Da aber der Kaufmann sozusagen die Verkörperung der Geldwirtschaft ist, so repräsentiert er auch am reinsten den Typ des Bürgertumes. Daraus folgt, daß sich in Holland zwar nicht zuerst das Bürgertum in seiner allgemeinen Form entwickelte, wohl aber, daß es sich dort zuerst in einer modernen und in seinen Hauptzügen heute noch gültigen Prägung herausentwickelte. Das Italien der Renaissance war demgegenüber aristokratisch, das Deutschland der Renaissance kleinbürgerlich, denn in Italien gab das Adelsregiment, in Deutschland das kleinbürgerliche Zunftwesen das Gepräge. Wohl lebten seinerzeit in Nürnberg die Pirkheimer und in Augsburg die Fugger usw., aber das war städtischer Adel, der trotz seiner ungeheueren Machtmittel froh war, wenn man ihn zu Hofe zog und er den Fürsten den Fußschemel bieten durfte. Die holländischen Kaufleute repräsentierten demgegenüber eine ganz andere Formation. Gewiß waren sie schon deshalb selbstherrlicher, weil sie eben erst die spanische Monarchie in einem furchtbaren, jahrzehntelangen Kampf überwunden hatten und somit die Sieger in der ersten modernen bürgerlichen Revolution repräsentierten. Aber sie unterschieden sich noch mehr dadurch, daß sie nicht bloß als Einzelerscheinungen reich und mächtig waren, wie einst die Augsburger Fugger und Nürnberger Pirkheimer, sondern vor allem als Klasse. Es handelte sich in Holland nicht bloß um eine Kolonie des Merkantilismus, in der es nur einen oder zwei Geldkönige gab, sondern um die großartigste Form des neu aufkommenden Handelszeitalters. Die Handelskontore Hollands waren die Herrschaftssitze dieses kleinen Landes. Ja sogar noch viel mehr: Die ganze Welt wurde von hier aus beherrscht, denn in diesen Kontoren wurden die Rechnungen der ganzen Welt saldiert. Und es handelte sich hier um wahrhaft kühne Rechner, die frei waren von jeder Art sentimentaler Rücksicht. An die Geldschränke der holländischen Kapitalisten mußten die mächtigsten Potentaten der Welt demütig anklopfen. Die Bourgeoisie, repräsentiert durch den Kaufmann, war somit die politisch herrschende Klasse. Der Adel war völlig ausgeschaltet und ebenso der nichtbesitzende Teil des holländischen Volkes, das in seiner Masse eines der unterdrücktesten jener Zeit gewesen ist. Im selben Maß aber wie das feudale Schloß als Machtbegriff aus der Vorstellung verschwand, rückte an seine Stelle das Bürgerhaus, d. h. das Haus des reichen Handelsherrn. Gerade diese spezielle Eigenart mußte darin resultieren, daß in Holland eine bürgerliche Kultur in dem Sinn entstand, was wir heute noch darunter verstehen.

Mönch und Nonne. Nach einem holländischen Gemälde um 1600. Original im städtischen Museum zu Haarlem

43. Faune und Nymphen. Anonymer italienischer Kupferstich. 16. Jahrhundert
Von alledem legt die holländische Kunst jener Zeit ein deutliches Zeugnis ab. In ihrer Entwicklung wie in allen ihren Einzelschöpfungen kommt diese einheitliche wirtschaftliche Situation zum Ausdrucke. Hier tauchte zum ersten Mal eine neue Kunstideologie auf, die sich nicht mehr alter Einkleidungen bediente. Man begegnet am Beginne dieser Epoche keinem einzigen Einschlag von höfischer Kunst; es verschwand immer mehr die pompös kirchliche Kunst; die religiösen Motive wurden rein menschlich, d. h. bürgerlich-menschlich aufgefaßt, verächtlich und komisch wirkten in der Darstellung stets die niederen Volksmassen, der Bauer und das arbeitende Volk. Dagegen in höchster Glorie und im herrlichsten Glanz erstrahlte der neue Herr der Welt. Für ihn allein mußte also die Kunst schaffen. Kunst für das Haus, Schmuck für seine Stube, das mußte sie allein sein. Indem aber hundert Könige an Stelle eines einzigen traten, denn jeder Handelsherr war in dieser Republik ein Mitregent, mußte auch das Porträt vor allem hier blühen und sich entwickeln wie nie zuvor. Ein kühner und großartiger Porträtmaler, Franz Hals, steht denn auch am Anfange der holländischen Kunst jener Periode. Und ebenfalls im Porträt haben die meisten, die auf ihn folgten, einen großen Teil des Bedeutendsten geschaffen, was diese Zeit an Kunst hervorgebracht hat.
Hierzu kam dann noch ein anderer wichtiger Faktor. Der Sieg der niederländischen Revolution war ein vollständiger, denn er war auf der ganzen Linie erfochten worden. Die Sieger brauchten nicht zu fürchten, daß der errungene Erfolg ihnen wieder entrissen werden konnte, sondern sie konnten in ungestörter Ruhe alle Resultate des Sieges genießen. Das entwickelte ein Geschlecht von sorgenlosen Genießern. Für solche ist aber stets die Welt, in der sie leben, die schönste, die es geben kann. Es ist die beste der Welten überhaupt. Der letzte Grund, sehnsüchtig mit Hilfe der Phantasie in eine bessere sich zu flüchten, ist für den sorglosen Genießer verschwunden, und das Jenseits ist ihm darum nur noch ein Trostschnuller für die armen Leute. Infolgedessen hat auch die religiöse Kunst nur einen ganz untergeordneten Platz im Kunstschaffen dieser Zeit. Eine um so größere Aufgabe ersteht der Kunst aber darin, dieses Leben in allen seinen Wonnen und in allen seinen Genußmöglichkeiten auszuschöpfen. Die neue Kunst mußte ein Wühlen und Schwelgen in den neuen Schätzen sein, die dem Sieger in den Schoß gefallen sind, und die sich mit der Zunahme seiner Macht und Größe stetig vermehren. Und wie diese Schätze unerschöpflich sind, wie immer neue Berge von Reichtümern sich auftürmten, so mußte auch die Kunst unerschöpflich sein. Reich und strotzend von einer Lebenskraft und Fülle wie dieses Leben, das sie wiedergab. So kühn wie dieses neue Geschlecht als Rechner auf dem internationalen Weltmarkte sich bewährte, so kühn mußten auch die Probleme sein, die sich die Kunst stellte, und weil es sich um keine übertragenen Begriffe, sondern um das Real-Wirkliche bei allem handelte, so mußte es auch dazu führen, daß in der Kunst das Reale, das Wirkliche in dieser Zeit am tiefsten, am kühnsten und dabei immer bürgerlich-menschlich in jedem Zug ausgeschöpft wurde. Die Expansion konnte weder in der Richtung der Qualität, noch in der der Quantität eine Grenze finden. Und das ist denn auch das Bild, das die holländische Kunst während eines vollen halben Jahrhunderts – bis die wirtschaftlichen Verhältnisse und die politischen Machtfaktoren andere wurden! – klar und deutlich in jedem Zuge darstellt. Es war die einheitlichste Wirtschaftsepoche – es war die einheitlichste Kunstkultur, die es in der neueren Zeit jemals gab.

44. J. Metsys: Lot und seine Töchter. Flämische Schule. 16. Jahrhundert. Museum in Brüssel
An dieser Stelle ist eine Beziehung auf die Gegenwart angebracht. Weil es sich bei der damaligen bürgerlichen Entwicklung Hollands um die im Wesen ausgeprägteste bürgerliche Kultur handelte, so mußte es nach der Überwindung des absolutistischen Zwischenaktes in Europa dazu kommen, daß das Ansehen eines Rembrandt, eines Hals überall in dem Maße wuchs, in dem sich die bürgerliche Gesellschaftsordnung nicht nur beherrschend, sondern vor allem klar in ihrem Wesen durchsetzte. Und darum ist das Ansehen und der Einfluß Rembrandts auf die Kunst auch niemals so groß gewesen wie in der Gegenwart. Selbstverständlich mußte in gleicher Weise der Einfluß der italienischen Klassikerkunst, ihre Einschätzung als die einzig wirklich große Kunst zurückgehen. Freilich gilt das bis jetzt nur für die Künstler und auch da noch mit großen Einschränkungen. Die Masse der Gebildeten dagegen verharrt noch unentwegt in ihrer seitherigen Unreife und Verschwommenheit, für die es keinen klassischeren Beweis gibt als den, daß nicht etwa ein Michelangelo, sondern Raffael ihr Gott ist. Aber auch das ist folgerichtig. Eine Gesellschaftsordnung wie die heutige, die sich fast überall nur durch einen Kompromiß mit den alten geschichtlichen Mächten durchsetzt, muß auch in der Kunst den zum Gott erheben, der in seinem gesamten Werke den Kompromiß personifiziert, den, der es am besten verstand, die kühnen, gewaltigen Zacken, die die neue Zeit in ihrer unbändigen Schöpferkraft entwickelte, sanft umzubiegen. Und das war eben Raffaels Verhältnis zu Michelangelo …
Ist die großartige und einheitliche Entwicklung des holländischen Wirtschaftslebens nach der siegreichen Überwindung der spanischen Herrschaft die Ursache, daß es dort zu einer ganz einzigartigen Kunstentwicklung kommen konnte, so ist die wirtschaftliche Umwälzung, die kurz zuvor in Deutschland vor sich ging, ein nicht weniger klassischer Beweis dafür, wie ebenso folgerichtig mit dem Aufhören und dem Verschwinden der materiellen Antriebskräfte ein Versagen der Kunst verknüpft ist. Mit anderen Worten: Der jähe Ausklang der deutschen Renaissance in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts findet seine volle Erklärung in der Veränderung, die zur gleichen Zeit im wirtschaftlichen Leben Deutschlands vor sich ging.
Die Basis, auf der sich die wirtschaftliche Blüte Deutschlands im 15. und 16. Jahrhundert aufbaute, war in der Hauptsache der Zwischenhandel. Deutschland bildete den Rhein entlang und durch Süddeutschland hindurch die große Handelsstraße, auf der die Produkte des Nordens nach dem Süden und umgekehrt vermittelt wurden. Dieser Zwischenhandel beruhte auf der Entwicklung Italiens, Frankreichs usw., die am Ausgange des Mittelalters in rapider Weise vor sich ging, und erreichte im 15. und 16. Jahrhundert eine geradezu erstaunliche Höhe. Endlose und gewaltige Wagenzüge schoben sich in ununterbrochener Reihenfolge die deutschen Landstraßen entlang. Nürnberg, Augsburg, Ulm, Basel, Straßburg waren Stapelplätze oder Knotenpunkte, an denen sich sozusagen alle Herrlichkeiten der Welt auftürmten, um sich wiederum von hier aus in aller Herren Länder zu ergießen. In die Geldschränke der reichen Handelsherren flossen ohne Unterbrechung mächtige Goldströme, und der nicht zu bergende Segen knüpfte einerseits den großen politischen Einfluß an die Namen der berühmtesten dieser Handelsfirmen und befruchtete andererseits in all den Städten, durch die er floß, den Boden mit den Segnungen einer stattlichen bürgerlichen Kultur, so daß diese selbst aus dem dürrsten Erdreiche blühend emporsproßte. Gegenüber diesem Umfange, den der Zwischenhandel besaß, spielte der Handel mit eigenen Produkten gar keine Rolle, geschweige denn, daß er in nennenswerten Betracht gegenüber den Erträgnissen gekommen wäre, die der Zwischenhandel für Deutschland abwarf. Die Produktionsweise bewegte sich in Deutschland noch durchweg in kleinhandwerklichen Rahmen. Die Wollenweberei, wie schon gesagt, die wichtigste Industrie jener Zeit, war nur sehr wenig entwickelt, so daß eigentlich nur der sächsische Silberbergbau damals eine größere Bedeutung hatte. Aber gerade dieser ließ um jene Zeit in jäher Weise nach; um die Wende des 16. Jahrhunderts begannen die sächsischen Stollen sich zu erschöpfen.

45. A. Carraci: Jupiter und Juno Freskogemälde im Palazzo Farnese. 16. Jahrhundert

46. Beukelaer: Der verlorene Sohn. 16. Jahrhundert. Museum in Brüssel
Ist man sich über dieses Wesen der damaligen wirtschaftlichen Basis Deutschlands klar, so ist eine unumgängliche Folgerung daraus, daß Deutschlands Entwicklung in derselben Weise fortschreiten oder fallen mußte, in der der Zwischenhandel stieg oder fiel. Eine andauernde Entwicklung nach oben mußten seine dauernde Blüte, das Aufhören des Zwischenhandels mußte seinen Untergang bedeuten. Und dieses welthistorische Schicksal, das Aufhören des Zwischenhandels, war damals Deutschland beschieden. Die Entdeckung Amerikas hat ihren ungeheueren Einfluß auf die allgemeine wirtschaftliche Konstellation binnen wenigen Jahrzehnten dadurch geoffenbart, daß die seitherigen Handelswege sich völlig verschoben. Der Seeweg wurde vom Süden nach dem Norden verlegt, von Venedig und Genua nach Amsterdam. Damit aber war Deutschlands Rolle als Zwischenhändler gänzlich ausgeschaltet; die großen deutschen Handelsstraßen wurden in kurzer Zeit ebenso einsam und verödet, wie sie vordem belebt gewesen waren. Die Warenzüge, die ehedem nicht endigten, hörten auf, und auf den Plätzen der berühmten deutschen Handelsstädte, auf denen einst Tag für Tag die Hufe von Hunderten von Rossen scharrten, wuchs das Gras. Damit versiegten natürlich auch die Geldströme, die bis dahin in die Taschen und Geldschränke der Handelsherren geflossen waren. Ihre Handelskontore verödeten ebenfalls, und nicht wenige blühende Firmen gingen binnen kurzer Zeit zugrunde. Das war auch das Todesurteil für die deutsche Renaissance, denn ihre Antriebskräfte waren damit völlig ausgeschaltet: Das Bedürfnis nach Kunst. Nicht die schöpferische Kraft des deutschen Volkes war erloschen, nein, nur jene Faktoren waren ausgetilgt, die vordem das künstlerische Schaffen auf seine gipfelnde Höhe emporgetrieben hatten. Es gab keine Auftraggeber mehr, darum mußte die deutsche Kunst um jene Zeit verebben und verdorren. Das ist die einfache, aber auch einzige Lösung des Rätsels, warum die Entwicklung der deutschen Renaissance in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts so ganz plötzlich abbrach. Den besten Prüfstein für den inneren Zusammenhang dieser beiden Erscheinungen, den wirtschaftlichen Zusammenbruch Deutschlands und das Aufhören der Renaissance, hat man übrigens in der Tatsache, daß überall dort, wo die alte Handelsherrlichkeit weiterblühte, wenn auch nicht so großartig wie ehedem, man denke z. B. an Venedig, – daß auch dort die Renaissance noch sehr lange neue Blüten trieb. –

47. Lukas Cranach: Der lüsterne Alte
*
Wir haben oben im ersten Abschnitte gesagt, daß man nicht an der einzelnen künstlerischen Individualität anknüpfen darf, wenn man das dem künstlerischen Geschehen zugrunde liegende immanente Gesetz aufdecken will, sondern daß man die Kunst einer bestimmten Epoche als Gesamterscheinung und nach der ihren einzelnen Bestandteilen gemeinsamen Tendenz anschauen muß. Daraus darf jedoch nicht gefolgert werden, daß das Schaffen des einzelnen Künstlers den hier entwickelten Gesetzen widerspräche, und daß sein Wesen und seine Eigenart aus anderen als den hier entschleierten Untergründen zu enträtseln wäre. Eine solche Folgerung wäre durchaus verkehrt, und vor allem wäre sie gegenüber dem Wesen derjenigen Persönlichkeiten verkehrt, die den Hauptangelpunkt für jede Epoche bilden, gegenüber den genialen Erfüllern. Es gibt in der Kunst nirgends eine unbefleckte Empfängnis, alles ist organisch und vollzieht sich natürlich. Und wenn Figuren wie die ganz Großen scheinbar isoliert dastehen, so eben nur, weil man infolge ihrer Größe und der Lichtfülle, die sie ausstrahlen, das Kleinere neben ihnen, selbst wenn es im Wesen gleichartig ist, gar leicht übersieht; ebenso leicht übersieht man die Linie, die zu ihnen führt. Gerade das Wesen des Genies ist auf Grund der hier entwickelten Gesetze zu begreifen und zu enträtseln möglich.
Wenn darum diese Gesetze etwas bis zur Evidenz erweisen, so eben das, daß nichts falscher ist als die Annahme: wenigstens im Genie handle es sich um die ewige Ausnahme von der Regel. Eine solche Annahme erhält nur Stützpunkte, wenn man derartige Erscheinungen isoliert ansieht. Sobald man dagegen die nötige historische Distanz einnimmt, widerspricht das Genie den hier entwickelten Gesehen so wenig, wie ein wildzerklüftetes Gebirg der Kugelgestalt der Erde widerspricht. Im Gegenteil, gerade das Genie ist die auffälligste Bestätigung der von uns als bestimmend bezeichneten Gesetze. Und es ist eines der wichtigsten Ergebnisse der hier angewandten Methode, daß man einsehen muß, daß man zum Genie am allerwenigsten durch etwas Willkürliches, durch etwas von der Mitwelt Losgelöstes, etwas was einzig in der betreffenden Persönlichkeit seine Ursache hätte, erhoben wird. Die historisch-materialistische Geschichtsbetrachtung enthüllt, daß gerade der Umstand zum Genie erhebt, wenn in einer Persönlichkeit das gipfelt, was sich als die oberste und die konsequenteste Entwicklungsnotwendigkeit einer Zeit darstellt. Genie ist nichts anderes als die ausgeprägteste Erfüllung und somit die konsequenteste Bedingnis der Zeit. Das Genie steht sogar viel weniger isoliert in seiner Zeit wie jedes andere Individuum. Und weil dies der Fall ist, darum wächst eine geniale Erscheinung an Umfang und historischer Bedeutung vor allem durch die Größe und Bedeutung der in seiner Zeit fälligen Aufgaben und Probleme; der einzige Namen Napoleon beweist dies. Eine leicht begreifliche Konsequenz dieser letzteren Tatsachen ist, daß man deshalb auch den genialsten Erscheinungen der Geschichte stets und ausnahmslos an den gewaltigen Wendepunkten der Geschichte begegnet. Das gilt von allen Genies ohne Ausnahme, wo sie auch auftreten. Die großen Genies stehen stets auf dem Gipfel revolutionärer Flutwellen der Entwicklung: Michelangelo, Tizian, Dürer, Thomas Morus, Shakespeare, Spinoza, Rembrandt, Rubens, Kant, Goethe, Beethoven, Napoleon I., Marx. usw. Sie beweisen das eben Gesagte in ihrer Gesamtheit, sie beweisen es jeder einzelne für sich allein. Daraus folgt aber auch, warum wir heute z. B. keinen Shakespeare und auch keinen Napoleon I. haben, oder richtiger: warum wir sie nicht haben können. Sie kommen alle zu ihrer Zeit, die Großen, die Kleinen und der Durchschnitt. Mit anderen Worten: Einzig das jeweilige gesellschaftliche Sein einer Zeit entscheidet, ob Zyklopen oder nur tüchtige Kärrner oder beide zugleich auf der Erde wandeln.

48. Jupiter und Europa. Holzrelief. Meister unbekannt
Das Genie ist die Konzentration der jeweiligen Entwicklungsmöglichkeit in einer einzelnen Individualität. Wenn man dies akzeptiert, erkennt man auch alsbald das Schiefe in der landläufigen Beurteilung des Wesens der Wirkung eines Genies. Man hört z. B. sehr häufig: Seit dem Auftreten von dem und dem herrscht dies oder herrscht jenes vor. Gewiß ist dies richtig, offenbart darum aber trotzdem einen falschen Gedankengang, die schiefe, die ideologische Betrachtung der Dinge. Der geistreichste und scheinbar kühnste Gedanke bleibt unfruchtbar und wird von der Mitwelt niemals übernommen, wenn er nicht den historischen Bedingnissen entspricht. Er wird aber fruchtbar, sowie dies der Fall ist. Das läßt sich auf jeder Seite der Geschichte nachweisen. Auf diesem Weg offenbart sich auch die Lächerlichkeit der Anschauung, die in der gesamten Kunstgeschichte über das Entstehen oder die Übernahme neuer Kunstformen aus einem anderen Lande herrscht. Nicht weil Max Liebermann Manet und Cezanne kennen lernte, kam in Deutschland der Impressionismus in der Kunst auf, sondern deshalb, weil wir jetzt in Deutschland diejenige Gesamtentwicklung erreicht haben, für die der Impressionismus in der Kunst der adäquate Ausdruck wurde. Wir kamen dazu, weil der Impressionismus heute die in der Zeit bedingte künstlerische Entwicklungsnotwendigkeit darstellt. Wenn die Entstehung einer Kunstbewegung einzig davon abhängig wäre, daß man Kenntnisse von einer Sache bekommt, so müßte der Impressionismus bereits zwanzig Jahre früher in Deutschland sich entwickelt und seine Blütezeit erlebt haben, denn bereits vor dreißig Jahren hingen Liebermanns Bilder, Rahmen an Rahmen neben denen von Manet im Pariser Salon. Der Impressionismus wurde damals aber nicht übernommen, weder von Liebermann noch von anderen deutschen Künstlern, – es fehlte eben in der historischen Entwicklung Deutschlands die Voraussetzung, mit einem Worte die Bedingnis. Es ist dies das gleiche Gesetz, das die historische Rolle von Erfindungen und Entdeckungen bedingt (S. 20-22).
Eine derartige Auffassung vom Genie ist absolut keine Degradation des Genies, wie manche vielleicht wähnen, im Gegenteil eine Erhöhung. Es gibt keine höhere Wertschätzung einer Persönlichkeit, als wenn man in ihr die Erfüllerin und den Ausdruck der wichtigsten historischen Notwendigkeiten sieht. Dagegen ist die ideologische Erklärung des Genies, die in ihm stets einen Zufallsblock der Geschichte sieht, in hohem Maße verkleinernd. An unserer historischen Erklärung des Wesens des Genies ändert der Umstand natürlich nichts, daß das Genie als individuelle Erscheinung trotzdem eines der kompliziertesten Rätsel ist und darum in dieser Richtung ein noch ungelöstes Problem darstellt. Wir wissen nicht, warum der eine Sohn einer Familie eine hochragende Persönlichkeit wurde und nicht der andere. Warum der Wolfgang und nicht der Emil mit besonderen musikalischen, dichterischen oder zeichnerischen Fähigkeiten von der Natur ausgestattet wurde. Aber dieses ungelöste Problem darf uns nicht verführen, nun auch die andere Seite der Erscheinung zu verkennen, die wir sehr wohl zu enträtseln vermögen. Und das ist eben die Tatsache, daß wir sowohl imstande sind, die historische Möglichkeit und Bedingtheit des Genies nachzuweisen, als auch, daß wir imstande sind, zu begründen, warum andere Epochen keine ähnlich genialen Persönlichkeiten zu entwickeln vermocht haben.
Was die Zeit dem Genie beisteuert und was sie ihm verweigert, und wie es gerade dadurch die prägnanteste Erfüllung einer Zeit ist, wollen wir an dem Größten der Großen der italienischen Renaissance, an Michelangelo, kurz demonstrieren. In Michelangelo erfüllte sich sozusagen die ganze Zeit. Weil seine schöpferische Potenz alle Weiten umspannte, lebte diese ganze Zeit in ihm, nicht nur einige ihrer Besonderheiten, sondern ihr ganzer Komplex; die höchste Steigerung ihrer elementaren Wucht und die ganze Zerrissenheit ihres Wesens. Die neue Wirtschaftsordnung trat im 15. und 16. Jahrhundert geradezu mit zyklopischer Expansion in Erscheinung. Dem entspricht die künstlerische Kraft, Zyklopen zu gestalten, und im Reiche der Kunst werden Zyklopen geboren: Michelangelo gestaltete nur Zyklopen. Michelangelo gestaltete aber die ganze Wesenheit der damaligen bürgerlichen Weltordnung in seinen Werken nach, und wie deren Kräfte durch die Fesseln der unentwickelten Wirklichkeit noch überall gehemmt sind, so sind auch alle seine künstlerischen Gestalten gefesselte Titane, grollende Sklaven, die im Drange nach Freiheit die Glieder verrenken; sein gesamtes Schaffen erscheint wie der gefesselte Prometheus, der mit tausend Ketten an die unentwickelte Wirklichkeit gefesselt ist. Das Gehäuse des Willens, des mächtigen Wollens geht in der Renaissance an der absoluten Unmöglichkeit des restlosen Erfüllens unerbittlich in Trümmer – das gilt vom gesamten Bilde dieser Zeit. Und es gilt in genau demselben Maße von den künstlerischen Werken Michelangelos. Die Renaissance konnte gemäß der noch unentwickelten Wirklichkeit wohl die Logik der Tatsachen entwickeln, sie konnte alle die großen Probleme aufwerfen, aber sie vermochte nur die wenigsten gelöst der Nachwelt zu hinterlassen. Von Michelangelos großen Plänen ist kein einziger zur Vollendung gereift. Weder das Juliusgrab, noch die Mediceergräber, noch der gigantisch mächtige Bau der Peterskirche. Von dem Statuenwald des Juliusgrabes existiert ein einziger Quader, der Moses. Freilich in diesem einen offenbart sich auch schon die ganze gewaltige Schöpferkraft, die mit dem neuen Prinzip in die Welt gekommen ist. Der Moses des Michelangelo ist die neue Gottheit der Zeit, der neue Mensch, das Symbol des selbstherrlichen Menschen, wie er in der Renaissance erstand, den kein Herrgott mehr gängelt, und der nicht mehr demütig jedem Wink von oben gefügig ist.

49. H. S. Beham: Das Liebespaar hinter dem Zaune. Holzschnitt. 16. Jahrhundert
*
Dem Kultus der Form und auch seiner Steigerung bis zum l'art-pour-l'art--Standpunkte begegnet man zu verschiedenen Zeiten. Es ist nicht verwunderlich, daß dieser Kultus aber gerade am Ausgange des 19. Jahrhunderts eine seiner konsequentesten Entwicklungen erlebte. Die wirtschaftliche Entwicklung hatte im 19. Jahrhundert endlich überall zur ausgeprägten Form der bürgerlichen Gesellschaftsordnung geführt. Freilich in der äußeren politischen Organisation tritt dieses Gepräge nicht einheitlich, sondern im Gegenteile sehr mannigfaltig in Erscheinung: in England, Frankreich und der Schweiz hat der bürgerliche Inhalt sich auch in der politischen Organisation klar durchgesetzt, in Deutschland und Österreich dagegen ist die bürgerliche Kultur noch stark absolutistisch verbrämt. Aber wenn auch die äußere politische Organisationsform zahlreiche Spielarten aufweist, so ist im Wesen das Bild doch überall genau das gleiche. Es dominiert überall die moderne bürgerliche Gesellschaftsordnung, denn alle Staaten bauen sich heute ausschließlich auf dem ökonomischen Prinzip auf, dem die moderne bürgerliche Gesellschaftsordnung entspricht, der Großindustrie und dem Großkapital.
Ebenso einheitlich wie das Bild der modernen Entwicklung in seinem Grundwesen, ebenso gleichartig ist das, worauf es hier ankommt: der Grad der historischen Entwicklung des Bürgertums. In jedem Land Europas ist die revolutionäre Epoche des Bürgertums völlig und seit langem abgeschlossen, nirgends mehr tritt daher das Bürgertum revolutionär auf. Überall ist es seit langem in das Stadium getreten, in dem es ausschließlich seine Herrschaft exploitiert. Und da dies sein oberstes Gesetz ist, so schließt es, einzig von diesem Interesse geleitet, seine Kompromisse mit anderen politischen Mächten. Und diese Kompromisse werden logischerweise häufiger nach rechts als nach links geschlossen, weil eben jeder Kompromiß nach links zwar die bürgerliche Gesellschaftsordnung momentan kräftigt, gleichzeitig aber doch wiederum unaufhaltsam über sie hinaustreibt. Und diese Gefahr ist drohender als der Vorteil, den ein Kompromiß nach links der bürgerlichen Gesellschaftsordnung einbringt. Das gilt für sämtliche europäischen Staaten. Und wenn sich der Kompromiß nach rechts auch nicht in jedem Land in gleich klaren und gleich offenen Formen abspielt, so ist er doch die überall zum Prinzip erhobene Tendenz. Das gilt für Süddeutschland geradeso wie für Preußen, trotz der Konzessiönchen, die dem Liberalismus dort hin und wieder gemacht werden, und für England genau so wie für Frankreich oder Österreich – es ist eben die historische Linie der Entwicklung, die in dem Augenblick einsetzen mußte, in dem die revolutionäre Epoche in der bürgerlichen Entwicklung abgeschlossen war, und die bürgerliche Revolution auf der ganzen Linie ihre historische Aufgabe, die moderne bürgerliche Gesellschaftsordnung zu begründen, erfüllt hatte.

50. Georg Pencz: Joseph und die Potiphar Deutscher Kupferstich. 1564
Bei diesem Stadium der Entwicklung mußte in der Kunst der oben (S. 26) skizzierte Umschwung eintreten: die Erhebung der technischen Probleme zur wichtigsten Aufgabe, und damit Hand in Hand die Unterjochung des Stofflichen, des Inhaltes der Kunst. Wenn man die verschiedenen Länder kontrolliert, so findet man, daß dieser Umschwung heute überall eingesetzt hat. Man findet aber auch noch ein zweites: daß dieser Umschwung sich in ganz derselben Reihenfolge vollzog, in der man sich in den verschiedenen Ländern dem Nullpunkte der revolutionären Energie innerhalb der bürgerlichen Klassenbewegung näherte. Darum in England zuerst, denn hier war die bürgerliche Entwicklung am frühesten abgeschlossen; darum in Deutschland zuletzt, denn hier gelangten die wirtschaftlichen Mächte, die die moderne bürgerliche Gesellschaftsordnung bedingen, am spätesten zur schrankenlosen Entfaltung. Daß der Impressionismus also am spätesten in Deutschland als Kunstform erschien, ist klare historische Bedingnis. Die Entwicklung zum Kultus der Form und zur schließlichen Einmündung in den l'art-pour-l'art-Standpunkt ging naturgemäß ebenfalls in derselben Reihenfolge vor sich, in der der Nullpunkt der revolutionären Energie des Bürgertumes in den verschiedenen Ländern nicht nur erreicht war, sondern auch noch unter diesen herunterging.

51. Moderno: Liebesszene. Italienischer Silberguß. 18. Jahrhundert
Solche Zeitalter sind übrigens absolut nicht unfruchtbar für die Kunstentwicklung und vor allem nicht für die allgemeine Kunsterziehung. Die wunderbaren Ausschöpfer der ehedem erschlossenen künstlerischen Möglichkeiten, die Manet, Cezanne, Sisley, Liebermann, Slevogt, Trübner usw., kommen in ihnen zur Entwicklung und Reife. Bei diesen ist im letzten Grunde alles Form. Nicht den revolutionären Inhalt der Zeit gilt es ihnen zu schöpfen, sondern die Kunst als höchste Blüte einer Kultur zum delikatesten Genußmittel zu steigern, und darum stehen ihnen instinktiv die technischen Probleme obenan. Aus demselben Grund ist es aber auch eine innere Notwendigkeit, daß die Großen im Reiche der modernen Kunst beim Zurückgreifen auf die Vergangenheit in erster Linie an die großen Meister der Farbe anknüpfen, an Velasquez und Rembrandt. Und weiter ist es innere Notwendigkeit, daß z. B. von dem Werke des Rembrandt der alte Rembrandt im höchsten Ansehen bei ihnen steht. Velasquez und der alte Rembrandt verkörpern in ihrem Schaffen dieselbe gesellschaftliche Entwicklungsphase, zu der wir heute wiederum gelangt sind, nur daß wir uns auf einer höheren Stufenfolge befinden. Der Umstand, daß die Anknüpfung an diese Meister der Farbe historisch logisch, also organisch ist, ist auch die Ursache, daß sie nicht verwirrend wirkt, wie einst die Anknüpfung an die Renaissance vor zwanzig und dreißig Jahren, sondern eine starke Antriebskraft ist und zu so bedeutsamen Resultaten führt, wie wir sie in den Werken der vorhin genannten Meister vor uns haben. Gut im höheren Sinn ist immer nur die organische Anknüpfung und Weiterführung.