
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Im Glauben der Japaner hat das Geschlechtliche einmal eine große Rolle gespielt und die letzten Spuren dieses Glaubens sind heute noch nicht verschwunden und werden auch sobald nicht verschwinden. Denn was man etwas grob als Phalloskult bezeichnet, ist im Denken und Fühlen des ganzen Volkes seit unvordenklichen Zeiten so fest verankert, daß alle Bemühungen der Regierung, im Anschluß an westliche, d.h. europäische Sitten solche »rückständigen« Anschauungen auszurotten, lediglich einen äußeren Erfolg haben konnten. Mit anderen Worten: in der Öffentlichkeit sieht der Fremde heute nichts mehr vom sogenannten Phalloskult.
Wenn der Kult der Geschlechtsteile auch aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, so haben sich doch beim Landvolk in abgelegenen Gegenden Überbleibsel genug erhalten.

Phallisches Heiligtum vom Konsei-Paß, Provinz Todligi (nach Nishioka).
Zum Beweis dafür wollen wir die Berichte einiger Augenzeugen beibringen, die den alten Kult in der letzten Zeit seines offiziellen Daseins noch aus eigener Anschauung kennen gelernt haben. Dr. Sinclair Coghill hat Japan in den Jahren 1864 und 1869 besucht und ist über die Fortdauer der alten »Sinnbilderverehrung« sehr erstaunt gewesen. Es fühlten sich damals immer noch viele Gläubige zu diesen Heiligtümern hingezogen, trotzdem sonst eine ziemlich materialistische Religion in Japan aufgekommen sei. Coghill besuchte den Tempel dieses Kultes auf einer kleinen Insel bei Kamakura, der alten Hauptstadt Japans. Der Phallos war der einzige Gegenstand der Verehrung in diesem Tempel. Er war in verschiedener Größe vorhanden, darunter ganz kolossale in mehr oder weniger naturgetreuer Darstellung. An der ziemlich naturgetreuen Darstellung mancher Stücke hätte Coghill sehen können, daß die Auffassung dieser »Sinnbilder« bei den Gläubigen doch etwas anders sein mußte, als er sich vorstellte. Denn für die Gläubigen waren es eben gar keine Sinnbilder, sondern diese Gegenstände waren eben wirklich der Gott. Die Frauen, die Coghill vor diesen Phallen inbrünstig beten sah, hatten gewiß kein Sinnbild vor sich und legten die Votivphallen sicherlich vor keinem Sinnbild nieder. Diese Votivphallen waren zum großen Teil sehr einfach aus einem Stück Holz aus dem benachbarten Wald geschnitzt. Coghill machte noch eine sehr merkwürdige Beobachtung: Er sah, wie zusammengeballtes feines Seidenpapier, das die frommen Frauen vorher an ihre Geschlechtsteile gedrückt hatten, dem Priester überreicht und von diesem unter Gebetemurmeln in einem großen Becken vor dem Götterbild verbrannt wurde. Der Reisende war überrascht, wie ernst es bei diesen Handlungen zuging.

Cunnischer Stein in Kyoto (nach Takahashi).
Sicherlich ist der Kult der Geschlechtsteile älter als der Shintoglaube und der Buddhismus, denn die Bekenner beider Glaubensrichtungen kommen in der Not zu den alten Göttern. Coghill sah den Phallos noch an öffentlichen Wegen von Hecken umgeben, und zwar sehr häufig. Er berichtet auch, daß er gesehen hat, wie ein Phallos, der bemalt war, aufrecht in den Straßen von Nagasaki umhergetragen wurde, ohne daß jemand ein anderes als ehrfürchtiges Benehmen zeigte. Das sieht doch so aus, als wenn sich dieser Glaube damals noch nicht in die abgelegenen Gegenden zurückgezogen hätte. Bei dem Tempel auf der kleinen Insel handelt es sich offenbar um einen angesehenen Kultort und die Frauen werden wohl Wallfahrerinnen gewesen sein, die durch ihre symbolische Handlung Kindersegen erflehen wollten.
In Japan müssen phallische Götter also einmal in sehr hohem Ansehen gestanden haben, wie die Anzahl der Tempel beweist, die ihnen einst gedient haben, von großen bis zu den kleinsten, den bäuerlichen Stiftshütten, die eigentlich weiter nichts als ein Regendach waren. Manche waren schon vergessen, wenn sie in abgelegenen Gegenden, in den Bergen oder in Wäldern lagen, wenn auch gerade diese einsamen Heiligtümer einmal die angesehensten gewesen sind. Dann werden diese verfallenen Kultstätten unheimliche Orte, denen man aus dem Weg geht, weil man aus den guten Geistern, die einst dort herrschten, im Laufe der Zeit hat böse werden lassen. Einen solchen alten Tempel mitten im Walde fand ein französischer Marineoffizier und hat aus ihm einen Phallos mitgebracht, der 29 cm lang war und 14 cm Umfang hatte. Die Bewohner fürchteten sich in seine Nähe zu kommen, namentlich nachts.
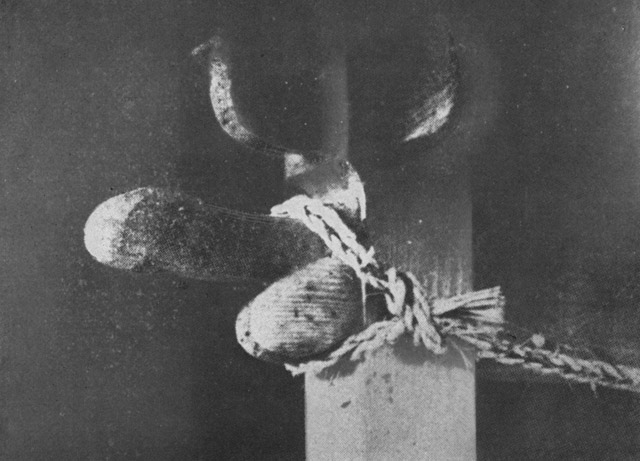
Balkenvorsprung in Gestalt eines Phallus an der Säule eines Schreines, Provinz Okayama (nach Nishioka)
Verschiedentlich wurden phallosförmige Steine aus der späten Jomon-Periode (ca. 2000–1000 v. Chr.), sogenannte Sekibo, als Fruchtbarkeitssymbole gedeutet. Augenscheinlich wird der sexuelle Charakter allerdings erst bei einigen Haniwa-Figuren aus der wesentlich späteren Kofun-Zeit.
Heute sind Phallostempel in Japan verboten; sie liegen, wenn auch noch wohl erkennbar, in Trümmern. Aber die Phallen sind noch überall anzutreffen, eigentlich in jedem Hause; sie werden dort in der Nähe des Hausaltars, der in keinem Hause fehlt, aufgehoben. Auch Votive und Weihegaben haben ihre alte Form beibehalten, wenn auch in der Öffentlichkeit meistens ein Pilz aus ihnen geworden ist, wie wir noch sehen werden, oder Holzstücke von der Form der japanischen Schachfiguren (
![]() ). Wie Prof. Dr. Haberer berichtet, opfert die Mutter schon bei Beginn des kindlichen Lebens solche Holzstücke, im Glauben, dadurch die Gefahren der Geburt leichter überwinden zu können. Aber wenn auch in der neuen Ära in Japan der alte Kult verboten ist und verfolgt wird, so sind solche Ersatzstücke des Phallos doch nicht überall gebräuchlich und Prof. Haberer hat selbst in Fischerdörfern gesehen, daß man bei verhältnismäßig primitiven Menschen den Phallos in deutlicher Nachahmung seines Urbildes vorzieht. Zu gewissen Zeiten trägt ein Japaner das Emblem dieses Kultes, einen aus einem großen Rettich geschnitzten und bemalten Phallos, in Begleitung der Hausbewohner in den Zimmern, der Küche, dem Abort umher, indem er einen Spruch dazu sagt und den Phallos dabei schwingt. Die Begleiter, beiden Geschlechtern angehörend, erwidern mit lauten Rufen unter Gelächter.
). Wie Prof. Dr. Haberer berichtet, opfert die Mutter schon bei Beginn des kindlichen Lebens solche Holzstücke, im Glauben, dadurch die Gefahren der Geburt leichter überwinden zu können. Aber wenn auch in der neuen Ära in Japan der alte Kult verboten ist und verfolgt wird, so sind solche Ersatzstücke des Phallos doch nicht überall gebräuchlich und Prof. Haberer hat selbst in Fischerdörfern gesehen, daß man bei verhältnismäßig primitiven Menschen den Phallos in deutlicher Nachahmung seines Urbildes vorzieht. Zu gewissen Zeiten trägt ein Japaner das Emblem dieses Kultes, einen aus einem großen Rettich geschnitzten und bemalten Phallos, in Begleitung der Hausbewohner in den Zimmern, der Küche, dem Abort umher, indem er einen Spruch dazu sagt und den Phallos dabei schwingt. Die Begleiter, beiden Geschlechtern angehörend, erwidern mit lauten Rufen unter Gelächter.

Votivtäfelchen (ema) aus einem Schrein in Kawazaki, Provinz Shinagawa (nach Nishioka).
Es ist kein Zufall, daß der große Rettich, Raphanus sativus, japanisch Daikon, als Phallos zurechtgemacht wird. In der Umgangssprache bezeichnet man den männlichen Geschlechtsteil als Daikon und in der Volksüberlieferung wird erzählt, daß der Fuchs oft die Gestalt eines hübschen jungen Mannes annimmt, wenn er eine Frau, namentlich bei der Feldarbeit, hintergehen will. Er bezaubert die Frau so, daß er mit ihr den Geschlechtsverkehr ausübt, wobei er oft den großen Rettich benutzt, den die Frau in ihrer Einbildung für den Penis ihres Geliebten hält, aber von der Steifheit und Größe dieses Penis ohnmächtig wird. Satow sieht in dieser Volkserzählung einen Beweis dafür, daß die Bauernmädchen den großen Rettich zur Selbstbefriedigung benutzen und berichtet, daß ihm sein vor zwei Jahren gestorbenes Dienstmädchen erzählt habe, daß es ihr etwa im Alter von 17 Jahren widerfahren sei, daß ihr der Fuchs einen solchen Rettich in den Geschlechtsteil eingeführt habe.
Hier würde sich ausnahmsweise einmal ein böser Geist des Phallos bedienen, während er sonst als Glücksbringer und Vertreiber der bösen Geister gilt. In diesem Sinne spielt der Phallos bei dem von Professor Haberer berichteten Vorgang seine Rolle. Wir können dies aus einer ähnlichen Reinigungszeremonie schließen, die bei Frühlingsanfang vorgenommen wird und die uns vielleicht einen Fingerzeig bietet für die Formel, die beim Schwingen des Phallos hergesagt wurde, wenn auch hier an Stelle des Phallos der Kteis getreten ist. Aber bei Abwehrzauber sind beide ja als gleichwertig anzusehen.
Wenn der Winter in den Frühling übergeht, mit anderen Worten, in der Nacht vor Frühlingsanfang, etwa der dritte Tag des zweiten Monats, japanisch risshū, ist die Zeit Setsubun. In dieser Nacht wird das Mamekaki vorgenommen. Dieser Brauch besteht darin, daß man in einem Hause getrocknete Bohnen umherstreut, um die bösen Geister zu vertreiben. Dabei schreit man so laut als möglich: »Fuku wa uchi, oni wa soto!« »Glück, komm herein! Teufel, geht hinaus!« Nach dem alten Stil wurde diese feierliche Handlung an der Jahreswende, entweder am Abend des letzten Dezember oder am frühen Morgen des ersten Januar vorgenommen, während sie jetzt auf Setsubun verschoben ist. An der Bedeutung des Brauches ändert sich dadurch nichts, und auch nichts an der Bedeutung der Bohnen, die als Sinnbild oder vielmehr als Stellvertreter des weiblichen Geschlechtsteils zu gelten haben.
Sinngemäß bezeichnet man es in der Gassensprache als Mamekaki, Bohnenstreuen, wenn eine Frau hinfällt und dabei ihren Geschlechtsteil entblößt. Denn Mame (japanisch Bohne und Erbse) ist ein häufig gebrauchtes Wort für den Kteis. Aber mit Mame bezeichnet man auch die sogenannte Fica, d. h. wenn man eine Faust macht und den Daumen zwischen dem zweiten und dritten Finger hindurchsteckt, und diese Geste bedeutet auf der ganzen Erde den weiblichen Geschlechtsteil, den Cunnus, und gilt überall als Abwehrzauber. Im Japanischen sagt man auch für die Fica: Menigiri (wörtlich als »der Frauengriff« zu erklären; me, Frau, kann auch die Vulva in der Volkssprache bezeichnen). In der Provinz Sagami herrscht der Aberglaube, daß man umhersprühendes Feuer beruhigen kann, wenn man mit dem Menigiri darauf zugeht und die Zauberformel spricht: »Yama de no koto wo wasure ta ka?« (Hast du das Vorkommnis auf dem Berge vergessen?) oder: »Yama ni iru koto wo wasureta ka!« (Hast du vergessen, daß du auf dem Berge bist?). Die Bedeutung dieser Fragen scheint vergessen zu sein. In der Provinz Kyūshū macht eine Frau, die in der Nacht auf der Straße einem betrunkenen Mann begegnet, heimlich die Fica in ihrem Ärmel, um sich gegen unvernünftige Angriffe desselben zu schützen.
In den oben erwähnten beiden Fragen an das Feuer kommt das Wort Yama vor und, wenn auch der Sinn dieser Fragen heute vergessen ist, so kann man doch vermuten, daß gerade das Wort Yama in irgendeiner Beziehung zu der Geste der Fica stehen muß.
Yama ist ein Berg oder Hügel. Ein Yama-no-kami würde dann zunächst ein shintōistischer Berggott sein, ist aber nach dem Sprachgebrauch eine Berggöttin und im übertragenen Sinne bedeutet Yamano-kami: Virago, Mannweib, ein derbes, stämmiges Frauenzimmer, eine Xanthippe, und schließlich ist Yama-no-kami die Bezeichnung für ein gewöhnliches Weib. Ein Senryū besagt:
»Yama-no-kami arete Omatsuri nobiru nari.« »Wenn das Weib böse ist, wird der Koitus verschoben.« Die »Berggöttin« ist also hier lediglich als Geschlechtswesen aufgefaßt, es liegt aber der alte Begriff der Berggöttin noch insofern darin, daß er in Beziehung zu einem Omatsuri, einem Fest, gebracht ist. Ein ganz unbefangener Mensch, der dies Schnadahüpfel singen hört, könnte darunter weiter nichts verstehen, als: »Wenn die Berggöttin böse ist, wird das Fest (ihr Fest) verschoben!«, weil er nicht an Omatsuri = Koitus denkt.
Wir können vermuten, daß allen diesen Berggeistern etwas von den alten Fruchtbarkeitsdämonen anhaftete. Anders ist es nicht zu erklären, wenn Yamabushi, die Bergbewohnerin, heute ein Gassenwort ist, das den Cunnus bedeutet. Im Volke halten sich ja solche alten Überlieferungen am längsten. Als Beweis hierfür mögen einige Senryūs dienen:
»Yamabushi e yona yona mimau Dai-Tengu.« »Ein dicker langnäsiger Kobold besucht eine Bergbewohnerin jede Nacht.« Dieser Kobold, der Tengu, wird auf Bildern mit einem frischen, roten Gesicht, mit einer sehr langen Nase und einem Paar Flügel dargestellt. Die Gestalt des Tengu geht wahrscheinlich auf den indischen Garuda zurück und gelangte über die chinesische Zwischenform des T'ien-kou (d. i. Himmelshund) nach Japan.
Das Volk glaubt, daß der Tengu auf Bergen und in Wäldern wohnt und häufig Leute nach heimlichen Stellen verschleppt. Er ist also ein richtiger alter Berggeist, der jedenfalls einmal ein kräftiger Zeugungsdämon oder Fruchtbarkeitsgott war, als der Glauben noch solche Gestalten für das Gedeihen der Natur nötig hatte. Die Menschen, die vom Tengu entführt werden, bezeichnet das Volk als »Tengu-no-Jōrō«, als Buhlerin des Tengu oder als Ganymed des Tengu, denn dieser Kobold macht dem Glauben nach zwischen männlich und weiblich keinen Unterschied, er verschleppt in seinen einsamen Wald Männlein oder Weiblein, wen er gerade erwischt. Sein Name ist heute ein Gassenwort für einen erigierten Penis geworden und so fristen die Namen der Yamabushi und des Tengu heute als Cunnus und Penis ihr Dasein.
Aber der Tengu ist auch sonst in der Anschauung des Volkes noch verankert. An seine lange, ungeheure Nase, die auf den Bildern ihre Penisähnlichkeit deutlich zeigt, knüpft der alte Volksglaube an, daß ein Mann, der eine große Nase hat, sehr wollüstig und in geschlechtlichen Dingen sehr leistungsfähig ist. Hierüber gibt es eine launige Erzählung mit dem Titel »Mudabana«, d. h. »Eine Blüte, aus der keine Frucht wird, die nutzlose Blüte«.
»Eine Witwe, die keine ausreichende geschlechtliche Befriedigung finden konnte, ganz gleichgültig, wen sie sich als Genossen aussuchte, traf eines schönen Tages auf einen Mann, der eine sehr große Nase hatte. Mit vieler Mühe gelang es ihr schließlich, diesen hübschen Kerl an ihr Herz zu ziehen und ihn auf die Bühne der Liebe zu bringen. Aber das äußere Aussehen dieses Mannes hatte gelogen, denn sie fand eine sehr armselige Waffe, die man höchstens mit einer roten Pfefferschote vergleichen konnte. Die Frau geriet in Zorn, zwickte den Mann in die Nase und machte die Feststellung: ›Das ist eine nutzlose Blüte!‹ ›Mudabana, mudabana!‹«
Eine besondere Rolle spielt im Volksleben die Maske des Tengu, Tengu-no-men. Es ist eine Maske mit einer langen, penisähnlichen Nase, wie sie auch die Bilder des Tengu zeigen. In der Gassensprache bedeutet Tengu-no-men einen erigierten Penis.

Okame-Maske.
Okame-no-men ist die Maske der Okame, eines lächelnden Gesichts mit vorspringender Stirn, dicken Backen und kleiner Stumpfnase, das im Volksglauben als glückbringend gilt. Satow hält dieses glückbringende Gesicht für nichts anderes als die Hüften einer Frau, von hinten gesehen. Diese Bezeichnung als Hüften ist aber lediglich ein beschönigender Ausdruck für Hintern; wir hätten also in der Okame-Maske die dicken Hinterbacken einer Frau vor uns, wie sie das nebenstehende Bild sehr deutlich zeigt. Sprachlich schließt sich Okame ungezwungen an Okama an, denn Okama ist gleich shiri, d. h. Hinterbacken. Die Maske der Okame oder Ofuku geht wohl auf die Gestalt der Göttin Uzume der frühen japanischen Mythologie zurück, der es durch ihre Possen gelang, die Sonnengöttin Amaterasu aus der Felsenhöhle herauszulocken, in die sie sich beleidigt zurückgezogen hatte. Der Ausdruck Okame wird gewöhnlich mit »häßliche alte Frau« oder »Mondgesicht« übersetzt. Auf die Tatsache, daß es der Uzume gelang, der Welt das Sonnenlicht wiederzugeben, mag auch die glückbringende Bedeutung der Okame-Maske zurückzuführen sein. Glück zu bringen und das Böse abzuwehren sind aber nur zwei Aspekte ein und desselben Phänomens, und es ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, daß ja auch der nackte Hintere Abwehrkraft bösen Einflüssen gegenüber besitzt. Daß man mit dem Okame-no-men böse Einflüsse abhalten will, steht außer Zweifel, denn man bringt es an dem Maidama (Entstellung der Umgangssprache aus Mayudama) an, das zu Beginn des neuen Jahres in der Nähe der Tempel als glückbringendes Zeichen verkauft wird. Das Mayudama ist ein Weidenzweig, an dem Reisbällchen (Mochi-Bällchen) befestigt sind. Das nebenstehende Bild stammt aus einem von Tamada Somando zusammengestellten Liederbuch »Toujiura Otsuebushi« (Glückbringende Wanderlieder). Es zeigt ein Mayudama, aber eines aus der guten alten Zeit, denn neben der Okame-Maske sieht man das Engi, den glückbringenden Phallos, angebracht. Übrigens trugen die Verkäufer der Engi, der mit Zuckerwerk gefüllten Phallen, die an Festtagen verkauft wurden, meistens ein Okame als Maske.
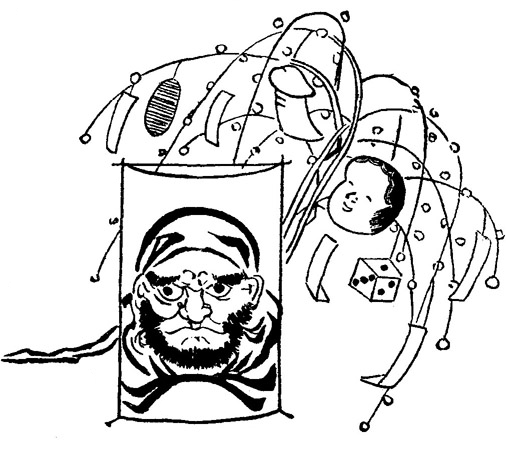
Mayudama.
Daß man von der Tätigkeit des Tengu im Volke noch eine deutliche Vorstellung hat, beweist das nachfolgende scherzhafte Geschichtchen:

Tengu-no-men.
»In dem Ema-dō Das Ema-do ist eine Tempelhalle, wie sie jeder Shintotempel besitzt, in der die Emas, die als Weihegaben gestifteten Bilder von Pferden, aufgehängt sind. Ema sind Votivbilder ursprünglich nur von Pferden, später auch von anderen Gegenständen, die wahrscheinlich auf ein tatsächliches Pferdeopfer zurückgehen. Kompira (pop. für kotohira, von sanskrit kumbhira) wird auf der Insel Shikoku in einem großen im 9. Jh. gegründeten Tempel als Gott der Seefahrer verehrt. des Kompiraheiligtums gibt ein Mann seiner Geliebten seinen erigierten Penis in die Hand, um ein Chon-no-ma (einen Koitus in aller Eile) von ihr zu erhalten. Der Frau war das ganz recht und sie steckte sich den Penis in ihre Scheide. Dabei sagte sie: ›Sieh mal an, was du für ein großes und prächtiges Ding hast! Das ist ja beinahe so groß, wie die Nase von dem Tengu dort!‹ Dabei zeigt sie auf das an die Wand des Ema-dō gemalte Bild. Der Tengu blickte mit einem neidischen Auge herab und sagte zu ihr: ›Ich bin ganz unglücklich, aber wenn du wieder einmal allein hierherkommst, dann werde ich dir ein Ersatz für ein Harikata sein!‹«
Das Harikata ist das bekannte Werkzeug zur Selbstbefriedigung der Frauen, und Satow meint, daß das Geschichtchen ein Beweis dafür wäre, daß Frauen zuweilen eine Maske des Tengu als Stellvertreter für einen nachgemachten Penis bei einsamer Selbstbefriedigung benutzen. Das umstehende Bild scheint eine dahingehende Anspielung zu enthalten; es kann aber auch bedeuten, daß die Frau sich gegen den Angriff des Mannes wehrt und ihn dabei an der »großen Nase« packt. Wir haben es jedenfalls mit einer sinnbildlichen Darstellung, die eine scherzhafte Anspielung auf den Penis enthält, zu tun. Es ist das Titelbild eines gegen Ende der Yedo-Periode (1867 u. Z.) erschienenen Rätselbuches »Warai no Kado«, Anlaß zum Lachen oder Tor des Lachens.
Daß die immer lüsternen Berggeister auch als Bezeichnung der Dirnen herhalten müssen, ist nicht weiter verwunderlich. Ein Senryū besagt das in unzweideutiger Weise:
»Kurōto no Yamabushi
Hitai nuite iru!«
»Eine gewerbsmäßige Bergbewohnerin (d. h. eine Dirne) beseitigt das Stirnhaar,« mit andern Worten: sie entfernt das Schamhaar. Über die Depilation werden wir später noch einiges zu sagen haben, hier würde es sich um die Frage handeln, ob die Entfernung der Schamhaare einen Hintergrund hat, der auf Glaubensansichten schließen läßt. Es mag irgendwie eine Furcht vor bösen Geistern hineinspielen, vielleicht auch die Ansicht, daß die Schamhaare dem Wesen des Kteis als Abwehrmittel gegen diese bösen Geister widersprechen. Der Kteis ohne Schamhaare wird so auch seinem glückbringenden Stellvertreter, der Muschel, ähnlicher. Darüber werden wir noch zu reden haben.
Daß die Bergbewohnerin, die Yamabushi, auch beim Menschen noch etwas von ihrer alten Macht behalten hat, könnte aus dem folgenden Senryû hervorgehen:
»Mizu-kagami Yamabushi ni sase Taue nari.«
»Sie bepflanzt ein Reisfeld, wobei sich ihr Cunnus im Wasser spiegelt.« Satow gibt zwar keine weitere Erklärung hierzu, aber man könnte doch auf den Gedanken kommen, daß diese Spiegelung des Cunnus im Wasser des Reisfeldes beabsichtigt ist. Bei der Wichtigkeit des Gedeihens der Reisfelder muß es von besonderem Wert sein, böse Geister, die der Entwicklung der jungen Pflanzen schaden könnten, fern zu halten und hier greift der Mensch auf ein uraltes Zauberabwehrmittel zurück, für das sich noch aus unserer Zeit für die verschiedensten Gegenden Beispiele beibringen ließen.
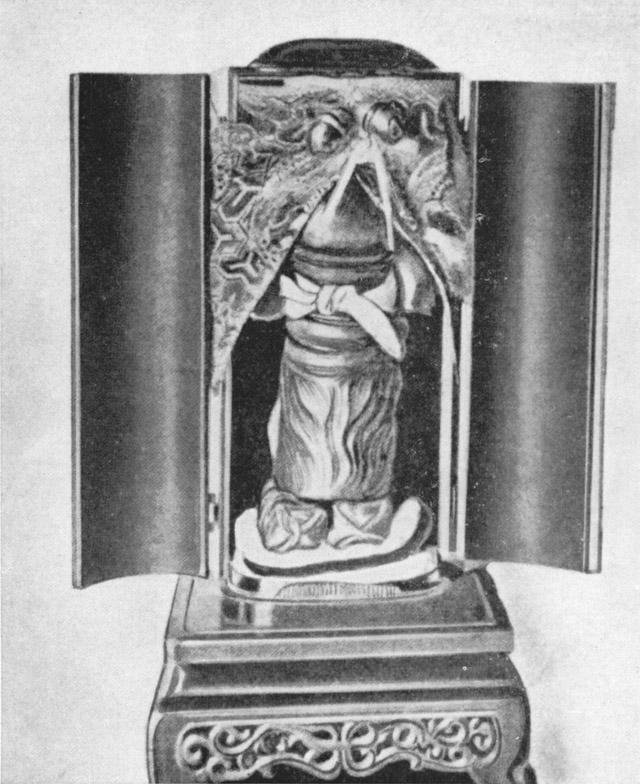
6. Phallusschrein für den Hausaltar (Sammlung J. Schedel).
Nebenbei sei bemerkt, daß die wandernden Priester der Shingonsekte gleichfalls Yamabushi genannt werden. Diese »Bergbewohner« sind wohl die letzten Nachkommen ehemaliger Zauberpriester, die als Vertreter der Wachstumsgeister bei Vertreibung böser Einflüsse Hilfe leisteten. Noch heute werden sie bei vielen Gelegenheiten zum »Besprechen« herbeigerufen und wir werden einem solchen Yamabushi noch in einer Geschichte begegnen.
Daß dem Wort Yamabushi in seiner alten Bedeutung noch ein in der Überlieferung begründetes Verstehen anhaften muß, zeigt die Verbindung, in die es häufig mit dem Tokko gebracht wird. Tokko ist heute ein Gassenwort für den Penis, obwohl es eigentlich ein sehr heiliges Sinnbild der Buddhisten ist. Im Sanskrit heißt das Tokko »Vajra« und das ist der Donnerkeil, der als Demantkeule in der indischen Götterlehre seit den ältesten Zeiten eine große Rolle gespielt hat und diese Rolle in der heutigen indischen Glaubensphilosophie noch spielt. In der lamaistischen Religion ist das Dordsche, wie hier der Donnerkeil heißt, geradezu zu einem Abzeichen eines Lamas geworden, der ohne sein Dordsche nicht zu denken ist. Es ist allerdings meistens zu einem Zierstück aus Messing geworden, dem niemand mehr die ursprüngliche Bedeutung ansieht. Und doch ist dieser heilige Gegenstand, mag er nun Vajra, Tokko oder Dordsche heißen, weiter nichts als ein Phallos in seiner ursprünglichsten Bedeutung. Und wenn heute Vajradhara, »der Träger der Demantwaffe«, im buddhistischen Tantrismus eines der vornehmsten Symbole ist, »mit denen der Stand der Vollendung, die reine Leere« bezeichnet wird, so ist dieser Vajradhara doch nur eine Abwandlung des Schiva. Und Schiva ist der Phallos und seine Gattin, die Schakti, ist der Kteis. Und Vajradhara mit seiner Schakti, die bekannten Darstellungen Yab Yum Chud Pa, der Vater, der die Mutter umarmt, sind weiter nichts, als eine ungeschminkte Wiedergabe des Koitus zweier Menschen.
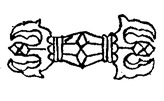
Tokko.
Das Tokko, der Donnerkeil der buddhistischen Priester in Japan, ist auch für diese, wie für Teufelsaustreiber und Geisterbeschwörer, eine Art Zepter, das die unwiderstehliche Kraft des Gebetes, der Meditation und der Beschwörung versinnbildlicht. Und da dieses Tokko in Japan noch seine verhältnismäßig einfache Gestalt beibehalten hat, entnimmt das Volk aus dieser äußeren Gestalt ein Wort für den Penis und bringt damit das zum Ausdruck, was den Priestern vielleicht gar nicht mehr bewußt ist: Das Tokko ist weiter nichts als ein Phallos und ist niemals etwas anderes gewesen. Dies kommt in den beiden folgenden Senryûs deutlich zum Ausdruck:
»Yamabushi wo ijirase
Tokko nigiraseru.«
»Laß den Mann mit der Yamabushi spielen und laß sie sein Tokko in die Hand nehmen.«
»Yamabushi wa Tokko wo nonde
Hedo wo tsuki.«
»Die Yamabushi erbricht sich, nachdem sie das Tokko verschluckt hat,« mit anderen Worten: Der Cunnus speit den Samen aus, nachdem der Koitus vorüber ist. Diese Redensart findet sich in der Folklore vieler Völker in ganz gleicher oder ähnlicher Weise.
Ein eigentümliches Schicksal hat eine alte Berggöttin gehabt, indem ihr Andenken in einer Weise festgelegt wurde, die ihrem innersten Wesen sicher niemals entsprochen haben kann. Die Mädchenuniversität zu Tôkyô;, Tôkyô Joshi Daigaku, hat den Spitznamen »Oba-sute-Yama«, d.h. Der Hügel, auf dem die Tante verlassen wurde. Unter »Tante« sind hier die Mädchen zu verstehen, die an der Universität studieren, weil man allgemein von ihnen behauptet, sie hätten wegen ihrer Häßlichkeit auf dem Heiratsmarkt nicht rechtzeitig Absatz gefunden. Dies soll die Veranlassung sein, daß in der Gassensprache die Universität der Frauen als »Oba-sute-Yama« bezeichnet wurde. Nach Murray's Handbook of Japan läßt sich dieser merkwürdige Name durch eine Legende erklären, die uns berichtet, »daß die verlassene Frau Ôyama-bime die Tante von Ko-no-hana-saku-ya-Hime, der lieblichen Göttin von Fuji war, die Ninigi-no-Mikoto, den Urahnen der kaiserlichen Familie von Japan heiratete. Diese Ôyama-bime war so häßlich, bösartig, neidisch und heimtückisch, daß keiner von den Göttern sie als Frau haben wollte. Ihr Neffe und ihre Nichte, die in Verzweiflung waren, daß Ôyama-bime's schlechte Veranlagung ihrem Glücke im Wege stand, suchten vergebens, eine Besserung bei ihr herbeizuführen. Schließlich wies die jüngere Göttin darauf hin, daß vielleicht eine Wanderung durch die wunderschöne Gegend von Shinano einen besänftigenden Eindruck machen würde, wenn Ôyama-bime von irgendeinem himmelanstrebenden Berggipfel aus den Mond betrachten könne. Sie machten sich zusammen auf und kamen schließlich an jenen Platz, nachdem sie unzählige steile Berge überwunden hatten. Saku-ya-Hime stieg auf einen Stein und sagte zu ihrer Tante, indem sie mit dem Finger in die Gegend zeigte: ›Dort ist ein Felsen! Klettere hinauf und schau ruhig um dich und dein Herz wird rein werden!‹ Die Tante, die von der langen Bergfahrt ermüdet war, schmolz unter dem sanften Einfluß des Vollmondes dahin. Sie drehte sich nach ihrer Nichte um und sagte: ›Ich will für immer auf dem Gipfel dieses Hügels bleiben und mich mit dem Gott von Suwa zur Beschützung dieses Landes verbinden!‹ Und mit diesen Worten schwand sie in den Mondstrahlen dahin. – Diese Legende wird zwar in bezug auf Shintô-Gottheiten erzählt, ist aber wahrscheinlich buddhistischen Ursprungs«.
Es würde zu weit führen, wenn man dem Inhalt dieser Legende folkloristisch nachgehen wollte, namentlich der Wirkung des Mondes und der Mondstrahlen. Der Hinweis möge genügen, daß wir es bei beiden Göttinnen, die in der Legende eine Rolle spielen, mit Fruchtbarkeitsgeistern zu tun haben. Denn der Name Ôyama-bime bedeutet: Herrscherin des Berges schöne oder gute Frau. Die Legende will also anscheinend erklären, wie aus einem bösartigen Geist ein gütiger geworden ist. Ko-no-Hana-saku-ya-Hime ist eine Zusammensetzung aus: Blume des Sees Fürstin des Erntehauses. Letzteres ist mir zweifelhaft; jedenfalls steckt in saku die Bedeutung des Blühens und Gedeihens. Nebenbei sei bemerkt, daß Oyama (mit kurzem O) ein Freudenmädchen bezeichnet. Der Zusammenhang der »heiligen Huren« mit dem Gedeihen der Natur läßt sich im Glauben vieler Völker nachweisen. Im Zusammenhang mit den Besucherinnen des Tōkyō Joshi Daigaku sei noch darauf hingewiesen, daß die Studentinnen im allgemeinen als gleichgeschlechtlich veranlagt gelten, wovon wir noch sprechen werden.

8. San-o no Daigongen (Provinz Gumma): Weibliche Figur, deren Geschlechtsteile von leidenden oder kinderlosen Frauen mit roter Farbe bestrichen werden (nach Deguchi).
Welche Rolle eine Bergfrau in den folgenden Angaben spielt, ist mir nach dem mir zur Verfügung stehenden Stoffe nicht ganz klar. Eine chinesische Legende berichtet, daß der Kaiser Yang von Ch'u einstmals nachts in seinem Schlafzimmer von einer Frau träumte, die zu ihm kam und ihm erzählte, daß sie die Frau des Berges Wu Shan wäre, und ihn bat, sie in demselben Bett schlafen zu lassen. Der Kaiser gab ihrem Wunsche nach und sie schliefen zusammen. Bei ihrem Weggange sagte sie zu ihm, daß sie in Zukunft unter der Gestalt von Wolke und Regen zu ihm kommen würde. Diese Legende lebt im japanischen Volke fort als »Fuzan-no-yume«, der Traum des Fuzan (sinojapanisch für Wu-shan) und dieses Wort bedeutet in der Gassensprache den Koitus. Man sagt auch dafür »Sodai-no-Ame«, der Regen des Sodai, wofür keine Erklärung zu erlangen war. Ebenso gebraucht man den Ausdruck »Fuzan-no-Tawamure«, das Vergnügen des Fuzan, und »Fuzan-no-Un-U«, Wolke und Regen des Fuzan, für den Geschlechtsverkehr; statt Fuzan-no-Un-U sagt man kurz »Un-U«, Wolke und Regen, offenbar, weil man mit Fuzan nichts rechtes anfangen kann. Die Legende ist vergessen, so daß man Fuzan von Fuzakeru, schäkern, scherzen, flirten, necken usw., ableiten wollte, wobei man aber an die Auslegung von Wolke und Regen nicht gedacht hat. Es wird sich wohl um die letzte Erinnerung an einen alten Fruchtbarkeitszauber handeln, vielleicht um einen Koitus in den Feldern, der Wolken und Regen herbeizwingen wollte. Andernfalls wäre die volkstümliche Bezeichnung des Koitus als »Wolke und Regen« kaum zu begreifen. Wir werden noch von dem Tanz Ame-shobo, der Regenschauer, sprechen, der ein letzter Anklang an solch einen Regenzauber zu sein scheint.
Die höchsten Regengötter waren die himmlischen, und in diesem Sinne sind auch Izanagi und Izanami aufzufassen, deren Legende in dem heiligen Buch der Shinto-Religion, dem Kojiki, ausführlich aufgezeichnet ist. Für uns kommt hier in Betracht, daß nach der Überlieferung der Shinto-Gelehrten Izanagi-no-mikoto, »Seine erhabene Herrlichkeit Izanagi«, der in der Legende erwähnte himmlische, mit Edelsteinen besetzte Speer ist, während Izanami-no-mikoto, »Ihre erhabene Herrlichkeit Izanami«, eine ausgedehnte Wasserfläche ist, die gewöhnlich als Ozean bezeichnet wird. Die Legende erzählt uns, wie der Gott den Speer herunterläßt und in dem Ozean damit herumstochert. Diese Legende ist als Ganzes wohl nie volkstümlich gewesen; man hielt sich an den Speer, der als »Ame-no-Sakahoko«, »der nach unten gekehrte himmlische Speer«, eine Bezeichnung des männlichen Zeugungsorgans wurde. Man sagt dafür auch ganz einfach »Sakahoko«, »der umgedrehte Speer«, oder »Sakaboko«. Zuweilen sagt man auch »Ame-no-Nûhoko«, »der himmlische Speer«. In einem Gesang des »Ryogi-mai« (der Tanz der beiden Urgründe der Natur, des aktiven und des passiven, d.h. des Himmels und der Erde) des Okuni Kabuki Das Okuni Kabuki war ein Theater, das eine Schauspielerin Izumo-no-Okuni gegründet hatte. Sie hieß Izumo-no-Okuni, weil sie früher eine Zauberin des Izumo-Heiligtums gewesen war. Es ist anzunehmen, daß diese Zauberpriesterin die Legende genau kannte. kamen folgende Verse vor:
»Umare kishi Ame-no-Sakahoko shitatari te
Hito no inochi wa Tsuyu to narikeri.«
»Geboren aus dem umgedrehten himmlischen Speer, der tröpfelte, schwindet das Leben der Menschheit dahin, wie der Morgentau.«
»Unabara ya Hoko no shitatari nakari seba
Kono mayoi aru mi towa umareji.«
»Wenn es keine weite See und die Tropfen des Speeres gäbe, würden wir nicht wie verirrte Schafe geboren werden.« Diese Verse entsprechen vollständig der Legende, denn die weite See ist der Cunnus und die Tropfen des Speeres sind die aus dem Penis herauskommende Samenflüssigkeit. Denselben Gedanken bringt das Volk in einem Senryû ganz kurz zum Ausdruck:
»Sakahoko no shitatari
Ogyâ ogyâ nari.«
»Die Tropfen des umgedrehten Speeres erzeugen ein Kind.« Ogyâ ogyâ bedeutet das Geschrei des Säuglings, so daß das Senryû eigentlich in launiger Weise besagen will: Den Tropfen des umgedrehten Speeres haben wir das Kindergeschrei zu verdanken.
In dem Kapitel »Innô Shin« (betrifft die Hoden) des Buches »Shokuya Bunko« (die Nachtlampenbücherei) heißt es: »Zwischen einem engen Tal ziehen sie sich vom tätigen Leben zurück; ihnen gegenüber ruht das Ama-no-Sakahoko und hinten behalten sie sich den tief gebohrten Brunnen des Kôbô-Daishi vor.« Kôbô-Daishi ist der Name des buddhistischen Priesters, der die Shingon-Sekte gegründet hat; nach der Überlieferung im Volke soll er auch der Gründer des Shûdô, des Weges der Päderastie, sein. Der poetische Ausdruck »der tief gebohrte Brunnen des Kôbô-Daishi« bedeutet also lediglich den Anus. Das Shokuya Bunko ist ein erotisches Buch, das in dichterischer Sprache lediglich besagen will, daß bei dem auf dem Rücken schlafenden Mann der Hodensack zwischen den Schenkeln vor dem Anus liegt und der Penis auf dem Hodensack ruht. Ama ist ein Wort der Schriftsprache für Himmel, das gewöhnliche Wort ist Ame. Beide bedeuten gesprochen auch »Regen« (die Schriftzeichen sind anders), so daß man annehmen kann, daß das Volk, das von der alten Legende wohl keine sehr deutliche Vorstellung hat und sich die Wörter nach seine Art umdeutet, sich das Ame-no-Sakahoko auch als umgedrehten Regenspeer erklärt hat; es ist ja auch, wie wir in dem Senryû; gesehen haben, mit dem einfachen Sakahoko, dem umgedrehten Speer, zufrieden, worunter es sich ohne weiteres den Penis vorstellen kann. –
Im Kojiki stehen die beiden Gottheiten Izanagi und Izanami auf der treibenden Brücke, während Izanagi mit dem umgedrehten Speer den Ozean umrührt. Diese himmlische treibende Brücke, Amano-Ukihashi, spielt in manchen Redensarten eine Rolle, ein Beweis dafür, wie diese alte Legende in dem Denken und Fühlen des Volkes ihre Spuren zurückgelassen hat. Von Bedeutung für unseren Gedankengang ist zunächst der Spruch, der als Senryû im Umlauf ist:
»Ukihashi wa Nipponkoku wo yose hajime.«
Dies bedeutet zunächst nur: »Die himmlische treibende Brücke bringt alle Gegenden Japans zusammen.« Im Volke nimmt man aber an, daß Izanagi und Izanami auf dieser Brücke ihre Hochzeit gefeiert haben, mit anderen Worten: daß Phallos und Kteis sich vereinigt haben, so daß die obige Redensart zu einem bildlichen Ausdruck für die geschlechtliche Befriedigung geworden ist. Noch deutlicher kommt dieser Gedanke in dem folgenden »Sprichwort« (einem Senryû) zur Geltung:
»Sakahoko no saki e Nihon ga yoru gotoshi.«
»Es scheint, als ob alle Gegenden Japans auf die Spitze des umgedrehten Speeres zulaufen.« Das heißt klar und deutlich: Im ganzen Leben ist der Penis die Hauptsache. Damit ist dem Speer seine ursprüngliche Bedeutung wiedergegeben. Für diese beiden Senryūs gibt es in der Umgangssprache auch »harmlose« Fassungen, denen man zunächst gar nicht ansieht, daß sie als umschreibende Ausdrücke für die geschlechtliche Befriedigung Verwendung finden:
»Nippon-Jū-ga-Hitotsu-ni-yoru.«
»Alle Gegenden Japans laufen in einem Punkt zusammen,« d. h. jeder Mensch strebt nach seiner geschlechtlichen Befriedigung. Noch einfacher besagt dies die folgende Redewendung:
»Nipponkoku ga issho ni naru.«
»Alle Gegenden Japans sind miteinander vereinigt.« –
Wenn die Sonnengöttin Amaterasu Omikami (die am Himmel leuchtende große erhabene Gottheit; kami bedeutet, daß sie zum Shintō-Glauben gehört) sich in die Felsenhöhle des Himmels für einige Zeit zurückzieht und verbirgt, macht sie die Welt ganz dunkel. Auf diese Weise erklärt sich der Glaube an eine Sonnenfinsternis. Der Eingang zu dieser Höhle wird als »Ama-no-Iwato«, das Felsentor zur himmlischen Höhle, bezeichnet und damit bezeichnet man heute in der Gassensprache die weiblichen Geschlechtsteile; man sagt auch kurz: »Iwato,« die Höhle. Wir werden dem Ausdruck »Ama-no-Iwato« im Abschnitt »Schaustellungen« in einem Volkslied wieder begegnen.
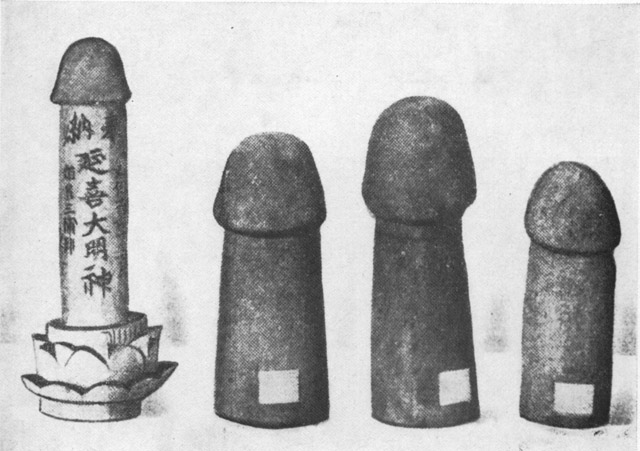
9. Steinphallen als Weihgabe (hono).
Die folgende Geschichte zeigt das Eingreifen der Götter in das Geschick der aufrichtig Gläubigen. Allerdings stoßen wir dabei auf einen humoristischen Hintergrund, der aber lediglich beweist, daß der Verfasser selbst kein Gläubiger mehr ist, sondern eine überlieferte Legende für seine Leser ausgeschmückt hat. Die Geschichte finden wir in dem von Sawada Meisui verfaßten Buche »Ana-Okashi« (Wie lustig!), das handschriftlich frühestens im fünften Bunsei-Jahr (1822 u. Z.) bekannt war; näheres in dem Verzeichnis der Quellenschriften.
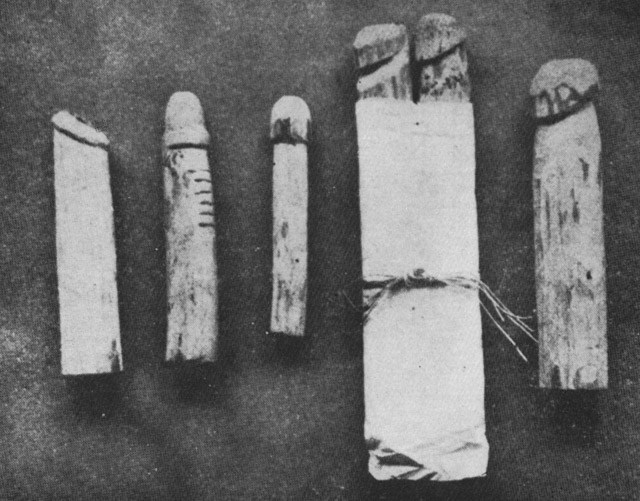
10. Holzphallen als Votivgaben (hono) aus der Provinz Chiba (nach Nishioka).
»Die Bezeichnung ›Hodo‹ Hodo bedeutet Feuerplatz, Herd, Kamin und ist ein altertümliches Wort für den Cunnus. wird seit sehr alter Zeit für die geheimen Teile einer Frau gebraucht, aber in Azuma, den östlichen Provinzen Japans, nennt man diesen Körperteil Bobo (davon später). Nun fließt in der Provinz Musashi ein Strom namens Sumida, auf dessen Ufern ein Tempel der Kannon Kannon oder Kwannon, sanskrit: Avalokiteshvara, ist die Göttin der Gnade. Sie wird mit lieblichem Gesicht dargestellt, verleiht alle guten Tugenden und hat Mitleid mit den Sündern. Sie ist daher zum Sinnbild der Frau in geschlechtlicher Beziehung geworden und schließlich gebrauchte man den Namen dieser lieblichen Göttin als ein Gassenwort für den Cunnus. stand. Zu diesem Tempel, dem man die wunderbarsten Kräfte zuschrieb, zogen fortwährend aus den entlegensten Gegenden eine Menge Menschen, die eine fromme Pilgerfahrt unternehmen wollten. Irgend einmal machte eine Frau, die in Kamida in derselben Provinz wohnte, eine Pilgerfahrt mit sechs anderen befreundeten Frauen. Auf dem Wege nach dem Tempel tauchten plötzlich zehn junge Leute auf und schleppten ein Mädchen, das etwa vierzehn Jahre alt war, aus der Gruppe der Frauen weg. Ihre Mutter und ihre Schwester, die dabei waren, liefen erschrocken den jungen Leuten nach, aber es war vergebens, da sie in einer dichten Baumreihe, die zu dem Tempel führte, nicht mehr zu sehen waren. Sie standen eine furchtbare Angst aus, was aus der Sache werden würde, denn die Tochter konnte vielleicht von den Schurken getötet werden. Aber nach gar nicht so langer Zeit kam das Mädchen unverletzt zurück. Sie wurde mit allen Ausdrücken der Freude laut begrüßt und ausgefragt, wie es denn käme, daß sie ohne jeden Schaden zurückkomme. Das Mädchen erzählte nun folgendes:
›Diese jungen Leute schleppten mich bis an das Ufer eines Flusses und dort stießen sie mich um, so daß ich auf den Rücken fiel. Und gerade in dem Augenblick, als sich etwas sehr Ernstes ereignen sollte, erschien eine junge Frau von etwa zwanzig Jahren und sagte zu ihnen: ›Ihr dürft ein so kleines Mädchen, das noch gar keine Erfahrungen in den Dingen der Liebe hat, nicht vergewaltigen. Laßt sie laufen, ich werde an ihrer Stelle hier bleiben und Ihr könnt mit meinem Körper anfangen, was Ihr wollt!‹ Das gefiel den jungen Leuten sehr und während sie sich um die junge Frau stellten, konnte ich mich in Sicherheit bringen.‹
Als die Mutter diese Geschichte gehört hatte, wischte sie sich die Tränen aus den Augen und sagte zu ihrer Tochter: ›Das ist sicherlich eine Verkörperung der Göttin gewesen, zu der du jeden Tag betest. Sie hat dich vor großem Leid bewahrt. Nun nimm dein Amulett von der Brust und sprich ein Dankgebet!‹ Dann nahm die Mutter das Amulett aus einem Brokatbeutelchen heraus und betrachtete die herabhängende Papierrolle. Da sah man nun, daß der Schweiß von der dampfenden Rolle heruntertropfte. Die Frauen stellten sich alle dazu und sahen, daß an der Stelle, an der sich das Schriftzeichen ›Bo‹ befand, die vierte Silbe in dem Ausdruck ›Kwan-ze-on-bo-satsu‹, ganz besonders feucht war und ein Loch von etwa einem Zoll Durchmesser aufwies. Das war ein ganz sonderbares Abenteuer und alle Leute sahen das Amulett voll Freude an.«
Der Ausdruck bedeutet: Die gütige Göttin Kwannon. Der Verfasser der Handschrift hat nun in diese zweifellos ernst zu nehmende Legende einen Witz hineingetragen, indem er das Schriftzeichen Bo, Bo-no-Ji, als eine Abkürzung des Wortes »Bobo«, eines Gassenwortes für den Cunnus, hinstellen wollte, so daß die Leser, die die Anspielung in einem erotischen Buche sofort verstanden, gewiß lachten, wenn sie sich vorstellten, daß das »Bobo« des jungen Mädchens durchstoßen worden war. Damit verlor natürlich die Legende alles Wunderbare und auch der Sinn des naßgewordenen Amuletts war klar. –
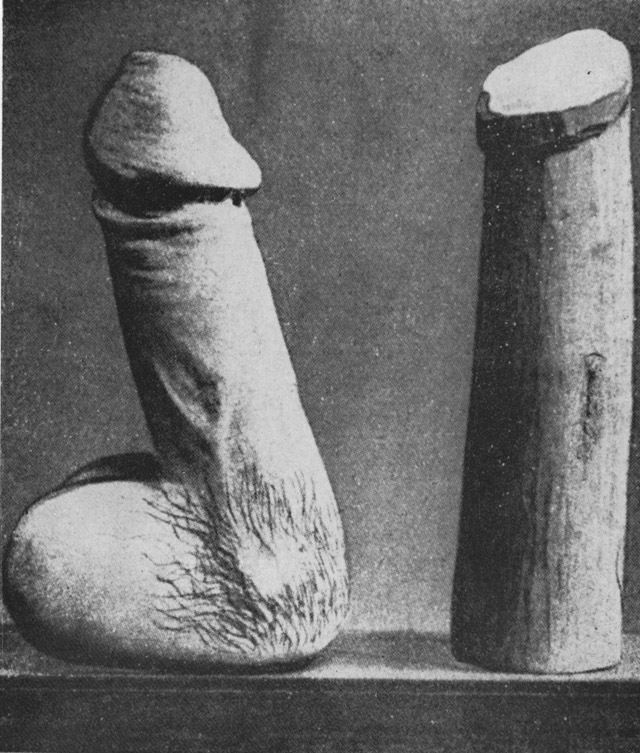
11. Phallen als Votivgaben aus dem Heiligtum am Konsei-Paß, Provinz Tochigi, (Links: aus bemaltem Ton, rechts: aus Holz geschnitzt).
Eine ganz merkwürdige Rolle spielt in Japan der Donnergott, den man aus irgendeinem Grunde zum Nabel in eine Beziehung bringt, die zunächst schwer zu erklären ist. Man hat darüber eine Redensart: »Kamiiiari ni Heso wo torareru,« d.h. Der Nabel, der vom Donner ergriffen wird. In Japan gibt es einen Aberglauben, daß der Nabel vom Donnergott gepackt wird, wenn jemand nackt ist, wenn der Donner rollt. Darüber werden viele Geschichten erzählt, von denen die folgende aus der Folklore der Provinz Izu Nagaoka berichtet, wie der Donnergott es besonders auf den Nabel einer jungen Frau abgesehen hat.
»Zu irgendeiner Zeit haben einmal zwei Bauernmädchen in einer heißen Quelle ein Bad genommen. Die eine von ihnen war sehr hübsch, aber die andere war es nicht so sehr. (Es wird auch manchmal erzählt, daß die eine eine junge Frau und die andere ein altes Weib gewesen sei.) Es war im Frühling und besonders schönes Wetter. Aber während die beiden über viele und, verschiedene andere Dinge plauderten, wurde der Himmel plötzlich dunkel und es zog eine schwarze Wolke heran, die das Fenster des Badehauses aufstieß. Der Donnergott stürmte herein, wodurch die zwei Frauen heftig erschraken und laut aufschrien. Sie konnten jedoch nicht weglaufen, da sie beide nackt waren. Der Donnergott aber nahm dem hübschen Mädchen (nach der anderen Fassung: der jungen Frau) den Nabel weg, so daß das hübsche Mädchen, der der Nabel geraubt worden war, sich in dieser Weise bei dem Donnergott beklagte: ›Oh! Donner! Oh! Donner! Das ist aber sehr eigennützig von dir, daß du mir meinen einzigen Nabel wegnimmst!‹ Der Donnergott erwiderte ihr: ›Der Nabel der anderen Frau sieht doch nicht hübsch aus und wird auch einen unangenehmen Geschmack haben!‹ Nach anderen Fassungen hat der Donnergott gesagt: ›Der Nabel einer alten Frau schmeckt nicht gut, weil er keine Feuchtigkeit hat!‹«
In dem oben angeführten Ausdruck ist das Wort »Heso« mit Cunnus zu erklären, wodurch auch der Sinn der Geschichte für jeden deutlich ist, der ihn noch nicht erfaßt haben sollte. Eine Redensart der Umgangssprache gibt den Sinn von Heso noch deutlicher wieder: »Heso kara umareru«, d.h. aus dem Nabel geboren. Diese verschämte Bezeichnung für den Cunnus ist allgemein üblich. Wenn ein Kind seine Mutter fragt: »Mutter, woher bin ich gekommen?«, dann antwortet sie ganz bestimmt: »Ei nun, du bist aus dem Nabel geboren!« und kein Japaner wächst heran, ohne daß er diese Worte gehört hat. Den Erwachsenen braucht man wohl nicht zu erklären, was der Nabel ist, »aus dem wir geboren sind«, oder der Nabel, »den der Donnergott an sich genommen hat«. Aber es gibt doch Geschichten, deren Witz auf dieser Zweideutigkeit beruht. Als Beleg hiefür möge eine launige Erzählung aus der Yedo-Periode dienen:
»Es war einmal eine Frau, die nahm an der Hintertür ihres Hauses ein heißes Bad, als sich plötzlich der Himmel mit einer schwarzen Wolke füllte, aus der ein Blitz herniederzuckte, dem ein lautes Donnergerumpel folgte, ›Oh! wie schrecklich!‹ murmelte die Frau und schickte sich an, in das Haus zu laufen. Da fällt der Donnergott mit einem furchtbaren Getöse herunter, so daß sie auf der Stelle ohnmächtig wurde. Nun ging der Donnergott an die Frau heran und berührte ihre Geschlechtsteile, worauf er zu sich selbst sagte: ›Ei, wie ist das so zart und so niedlich!‹ und er begann mit den Fingern daran zu spielen. Da rief ihm sein Sohn, der aus der Wolke herunterguckte, ganz laut zu: ›Aber, Vater! Bist du denn blind geworden? Siehst du denn nicht, daß der Nabel viel höher angebracht ist?‹«

Kaminari ni Heso wo Torareru.
Der Sohn des Donnergottes hat also dieselbe Belehrung erhalten, wie die Menschenkinder. Für ihn ist Heso der Nabel, aber es gibt auch eine Bezeichnung für den weiblichen Geschlechtsteil, die ihn unter Verwendung des Wortes Heso deutlicher zu erkennen gibt: »Heso-no-shita,« d. h. das unter dem Nabel befindliche. In dieser Fassung ist der Begriff Cunnus in der folgenden Volkserzählung verwertet. Sie führt den Titel: »Kaminari no Bento,« d. h. das Frühstück des Donnergottes.
»Eines schönen Tages ging der Donnergott mit seinem kleinen Sohn hinaus, um sich an seine Arbeit zu machen. Nachdem er eine Zeitlang heftig gerumpelt hatte, sagte sein Sohn zu ihm: ›Papachen, ich habe Hunger!‹ Da gab ihm der Vater Donnergott zur Antwort: ›Ach ja! Es ist Zeit zum Frühstücken! Wir wollen uns gleich daran machen!‹ Als er sein Jūbako aufmachte, kam ein Heso-no-Tsukudani (d. h. ein in Sojabohnentunke eingemachter Nabel) zum Vorschein. In diesem Augenblick guckte sein Sohn in eines von den unteren Kästchen. Da wurde der Vater Donnergott ganz aufgeregt und sagte: ›Hör' einmal! In die untere Schachtel hast du nicht hineinzugucken!‹«

12. Phallus aus Pappmache (engi). Solche Phallen werden mit Zuckerwerk gefüllt auf Jahrmärkten verkauft.
Unter Jūbako versteht man gewöhnlich einen Satz ineinander passender Kästchen. Zum Verständnis der obigen Geschichte müssen wir uns vorstellen, daß das Jubako, der Frühstückskasten des Donnergottes, nach Art unserer Essenträger aus mehreren übereinander angebrachten Kästchen bestand und daß der eingemachte Nabel sich in dem obersten befand. Nun sagte der Donnergott zu seinem Sohn: »Du hast nicht Heso-no-shita (unter den Nabel) zu sehen!« Darin liegt im Japanischen der Witz, denn die Zuhörer verstehen darunter: »Du sollst dir den Cunnus nicht betrachten!« Das nebenstehende Bild stammt aus dem erotischen Buch »Kōshoku Tabimakura«, Wollüstiges Reisekissen, d. h. Erotisches Lesebuch zur Unterhaltung auf einer Reise. Es zeigt den Donnergott, der ein nacktes Ehepaar beim Koitus überrascht hat und nun bei der Frau den weglaufenden Ehemann ersetzt, indem er ihr den »Nabel« nimmt. Es ist eines der seltenen Bilder, auf denen das Paar ganz nackt ist, aber es mußte nackt sein, weil sonst nach dem Volksglauben der Donnergott keine Macht über die Frau gehabt hätte.

7. Daikoku, der Gott des Reichtums, in Gestalt eines Phallus (nach Nishioka).
Daikokuten, der Gott des Reichtums, wird in der Umgangssprache Daikoku genannt. Satow sieht in ihm lediglich eine Umgestaltung des Phallos, der in seiner glückbringenden Eigenschaft auch sonst im Volksleben eine große Rolle spielt. In der Gassensprache bezeichnete Reikoku während der Yedo-Periode sowohl den Koitus, als auch den Penis und den Cunnus; die wörtliche Bedeutung von Reikoku ist »das Ding da«. Damit würde Daikoku »das große, starke, mächtige Ding« sein, also als Gott des Reichtums nur als Phallos erklärt werden müssen. Daß koku aber auch als Cunnus angesehen wird, beweist die Bezeichnung der Beischläferin oder Geliebten eines buddhistischen Priesters als »Daikoku«. In diesem Falle sieht »das große, starke, mächtige Ding« mehr als ein spöttischer Volksscherz aus.
Daß Daikokuten wirklich als Phallos dargestellt wurde, geht aus einem Phallosschrein hervor, den Josef Schedel von einem Antiquitätenhändler in Tôkyô erworben hat. »Der Schrein, außen schwarz lackiert, innen vergoldet, enthält einen geschnitzten, braun polierten Phallos von 25 cm Höhe, mit verschiedenen Attributen Dai-koku-tèns (Gott des Reichtums), wie Säcke, Mütze, Leibbinde.«
Daikokuten hat am ersten Rattentag
Die Ratte ist eines der noch jetzt gebrauchten zwölf Kalenderzeichen und eines der früher gebrauchten zwölf Richtungszeichen, der Jû-ni-shi. Jû-ni bedeutet zehn-zwei, also zwölf; es sind aus dem Chinesischen entnommene Zahlwörter. Diese zwölf Zeichen werden auch als Zeitzeichen verwendet, man kann sie mit den zwölf Bildern des Tierkreises vergleichen. Die Jû-ni-shi haben folgende Namen:
ne, die Ratte; uma, das Pferd
ushi, die Kuh, das Rind; hitsuji, das Schaf, die Ziege
tora, der Tiger; saru, der Affe
u, das Kaninchen; tori, die Henne, der Vogel
tatsu, der Drache; inu, der Hund
mi, die Schlange; i, das Wildschwein
Die Ratte, ne, ist also gleich eins; der erste Rattentag der Erste eines Monats; der zweite Rattentag der Dreizehnte usf. Im alten Kalender war ne no toki, die Zeit der Ratte, d.h. der ersten Stunde, soviel wie 0-2 Uhr nachts. Ne no hô die Richtung der Ratte, war der Norden; ne no hi, der Rattentag. Die japanische Stunde ist gleich zwei unserer Stunden. des zehnten Monats ein Fest, das Nematsuri genannt wird. Das Volk hat sich das Wort Nematsuri nach seiner Weise ausgelegt und so ist daraus ein Gassenwort für den Koitus geworden. Man hat die wörtliche Bedeutung
»Rattenfest«, d. h. Fest am ersten Tag des Monats, verdreht zu »Sich zum Koitus hinlegen«, denn »Ne«, verkürzt aus neru, bedeutet sich hinlegen, und Matsuri, das Fest, ist ein Gassenwort für den Koitus. Ne, eigentlich die Wurzel, ist obendrein ein alter Name für den Penis, und Matsuri, oder mit der Höflichkeitssilbe O, Omatsuri, paßte auch in diese Verbindung, denn dann könnte man das Wort auch als Penisfest erklären. Manche wollen Matsuri von Matsurigoto, die Verwaltung der Staatsangelegenheiten, die Regierung, ableiten, aber die eigentliche Bedeutung bleibt doch immer: ein Fest, eine Feier. In einem Volksliede heißt es:
»Tonari zashiki no rampu ga kieta,
Itete ka, netete ka, homma ka e,
Oya, Omatsuri ka, Ake nakya don don!«
»Im Nebenzimmer ist die Lampe ausgegangen. Seid ihr da? Ihr schlaft gewiß? (Da der Fragende keine Antwort bekommt, fährt er fort:) Oh! Dann seid ihr jetzt beim Feiern! Aber ich kann darüber kein Urteil abgeben, wenn die Tür nicht aufgeht! Bumm, bumm!« Das soll bedeuten: Er stößt gegen die Tür, um sie aufzudrücken.
Ein Senryū lautet:
»Matsuri mae kibakari sekikomu Chōchin wa.«
»Nur ein alter Mann ist schon vor dem Koitus außer Atem.« Hier ist das Wort Matsuri doppelsinnig gebraucht, man hat die Wahl zwischen Fest und Koitus. Chōchin ist die kleine Papierlaterne, die bildlich für den Penis eines alten Mannes oder für einen Impotenten gebraucht wird, worüber an anderer Stelle mehr zu sagen sein wird. Der Sinn des Senryūs ist also der, daß bei einem alten Mann alle Aufregung vergebens ist: er kann doch kein Fest mehr mitmachen.
Hier mögen noch zwei Senryūs folgen; von einem dritten, in dem das Wort Omatsuri vorkommt, wird später die Rede sein.
»Ningyō no shosa wa
Omatsuri mae no koto.«
»Man kitzelt ihr immer mit den Fingern den Cunnus, ehe man den Geschlechtsverkehr beginnt.« Dies ist ein feststehender Brauch bei den Japanern, von dem wir noch sprechen werden. Zur Erläuterung des Senryū möge folgendes dienen: Ningyō bedeutet eine Puppe und ist eine Abkürzung von Yubi-ningyô, eine Finger-Puppe, oder, wie wir sagen würden, eine Marionette. Man betrachtet also gewissermaßen das Befingern der weiblichen Geschlechtsteile als ein Marionettenspiel und deshalb würde das Senryû auch lediglich bedeuten können: »Man läßt jedesmal schon vor dem Feste die Puppen tanzen!«

14. Tönerne Grabfigur (haniwa) aus einem Hügelgrab der Provinz Gumma, Konfun-Periode (nach Kidder).
»Omatsuri ni naku wa
Kigen no yoi no nari.«
»Wenn eine Frau beim Koitus laut seufzt, dann drückt sie damit aus, daß sie sich sehr wohl fühlt.« Man könnte das Senryû auch so verstehen: Wenn eine Frau bei einem Feste sehr laut ist, dann zeigt sie, daß sie viel Freude hat. Von Ningyô wird in einem späteren Abschnitt noch die Rede sein.
Zum Schluß wollen wir darauf hinweisen, daß Daikokuten, der Gott des Reichtums, sonderbarer Weise als mißgestalteter Zwerg dargestellt wird, mit einem dicken Kopf, ungeheuren Ohren, einem lustigen, gutmütigen Gesicht; gewöhnlich trägt er einen Hammer und einen Sack oder einen kleinen Reisballen. Man legt diese Dinge dahin aus, daß der Hammer als Werkzeug der Bergleute, und der Reisballen als Vertreter des Reises, die Sinnbilder der beiden hauptsächlichsten Quellen des Reichtums von Japan sind. Das mag die Auslegung der Gelehrten sein; das Volk sieht in den Reisbällchen ein Glückszeichen, wie wir bei der Beschreibung des Maidama sehen, und der Hammer ist ein Phallos, wie die Verwendung des Wortes für den Penis zeigt. Obendrein besitzt das Musée Guimet einen Daikoku aus Steingut aus der Provinz Satsuma, der zum Überfluß noch einen großen Rettig, einen Daikon, trägt, der als Sinnbild des Phallos den Hammer an Ähnlichkeit mit dem Gegenstand, den er darstellen soll, bedeutend übertrifft. Daß man den Rettich als Phallos zurechtschnitzt und bemalt, um damit böse Geister zu vertreiben, haben wir oben gesehen und dabei darauf hingewiesen, daß der männliche Geschlechtsteil im Volksmunde als Daikon bezeichnet wird. Wir wollen hier noch nachtragen, daß man im Volksmund den Penis eines alten Mannes als ein Hoshi-Daikon, als einen vertrockneten Rettich, bezeichnet, mit derselben Bedeutung, wie das oben erwähnte Wort Chôchin. Ein Senryû erwähnt den vertrockneten Rettich in folgender Weise:
»Shinzô wa hoshita Daiko ni
Yori wo kake.«
»Die junge Frau mühte sich mit dem ganz vertrockneten Rettich vergebens ab,« mit andern Worten: es war der jungen Frau nicht möglich, den alten Mann zu einem Koitus zu bringen. Hier kann man unter einer Shinzô eine junge Frau verstehen, die zu einer Oiran, einem Freudenmädchen mit staatlicher Genehmigung, gehört, das Gastmahl geschickt zurechtmacht und für den Zeitvertreib der Zecher im Hause der Oiran sorgt. Manchmal gewähren solche Shinzôs auch heimlich ihre Gunst gegen Bezahlung. Shinzô bedeutet sonst »jüngst, kürzlich gebaut« und bezeichnet eine junge Dame; bei Personennamen ist es etwa Miss, Madame. –
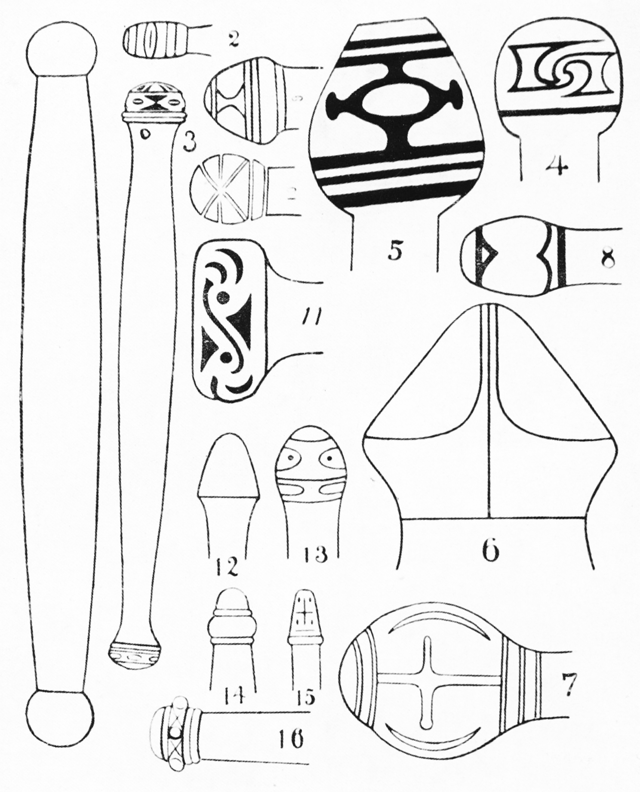
13. Prähistorische Steingeräte (sekibö) der späten Jnnion-Periode (ca. 2000-1000 v. Ch.). denen verschiedentlich phallische Bedeutung zugeschrieben wurde (nach Kanda, Yagi und Ono).
Ein richtiger Phallosgott ist Kanamara-Daimyôjin, »der große ruhmreiche Eisenpenis«, wie die wörtliche Übersetzung seines Namens lautet. Er war ursprünglich ein Phallos, der in einem kleinen Tempel stand, späterhin aber in ein Götterstandbild umgeändert wurde. Dieser Phallosgott wurde zu Makibori, Bezirk Iwate in der Provinz Rikuchû verehrt. Sein Bild bestand aus Bronze. Nach der Überlieferung der Bewohner dieses Dorfes bekommt ein Mädchen, das 13 bis 14 Jahre alt ist, das Alpdrücken; mit anderen Worten: der Gott kommt als Nachtmahr zu ihr, weil ihm eine Beleidigung zugefügt worden ist. Im Mittelalter soll irgendein guter Geist mit dem Vorgehen des Kanamara nicht einverstanden gewesen sein und band das Abbild des Gottes mit einer eisernen Kette fest an. Aber seine Angriffe hörten trotzdem nicht auf und man sagt, daß er auch weiterhin häufig umgegangen ist. Dieser Glaube oder Aberglaube hängt anscheinend mit dem Eintritt der ersten monatlichen Reinigung der jungen Mädchen zusammen. Wahrscheinlich hat man früher die erste Blutung als eine Verletzung durch den Phallosgott angesehen und das hat die Überlieferung festgehalten, als schon längst der Phallos durch ein menschenähnliches Götterbild ersetzt war. Daß der Eintritt der ersten Blutung als etwas Dämonisches angesehen wird, das man mit bösen Geistern oder Fabelwesen in Verbindung bringt, läßt sich aus der Folklore vieler Völker nachweisen.
Ob in der nachfolgenden Legende der Glauben an den Nachtmahr eine Rolle spielt, wie es nach der Auffassung Satows der Fall ist, wage ich nicht zu entscheiden. Tebara-Mura, ein Dorf in der Provinz Omi, hieß in alten Zeiten Tehamari-mura, das Dorf, in dem ein menschlicher Arm geboren wurde. Die Überlieferung besagt, daß dort einstmals ein Mann lebte, der sein Weib in die Obhut eines Freundes gab, als er eine weite Reise antreten mußte. Drei Jahre waren verstrichen, aber der Gatte kehrte nicht von seiner Reise zurück. Da die Frau jung und hübsch war, war der Freund in steter Angst, sie möchte mit einem andern Manne Ehebruch treiben. Deshalb legte er jede Nacht, wenn sie zusammen zu Bett gingen, der Frau seine Hand auf den Leib. Diese Frau aber brachte nach zehn Monaten einen menschlichen Arm zur Welt. Und seit jener Zeit nannte man das Dorf Teharami-mura. Den beiden Namen (Tebara-mura läßt sich deuten als: Das Dorf, in dem eine Hand an den Tag kam) kann irgendein wirkliches Ereignis zugrunde liegen, vielleicht die Geburt einer Mole, die irgendwie einer Hand ähnlich war. Im Volke sucht man zu allem Auffallenden eine Erklärung und auf diese Weise wird die Sage entstanden sein. –
Ein phallisches Fest, über dessen Einzelheiten wir leider nicht unterrichtet sind, war das Tanabata-Matsuri, das Fest der Weberin, auch kurz Tanabata, das Webermädchen genannt. Die Weberin ist der Stern Vega, dessen Fest in der Nacht des siebenten Tages des siebenten Monats gefeiert wurde. Man weiß nur, daß in alten Zeiten fünf farbige Tanzakus (oder Tanjakus, das sind schmale Papierstreifen, auf die Verse geschrieben wurden) mit dem Bild eines Phallos an ein Sasa (Zweige einer kleinen Bambusart, Arundinaria japonica, Zwergbambus) geheftet wurden. Dieses Sasa stellte man auf ein Brett, das für die Verehrung der Weberin in dieser Nacht besonders angefertigt worden war. In dieser Nacht des siebenten Tages des siebenten Monats sollen die Weberin und ein Viehhirte (der Stern Altair) auf der Milchstraße ein Stelldichein gehabt haben. Die Milchstraße sei zu diesem Zwecke von Elstern besonders erbaut worden, weshalb sie auch Kasasagi no Hashi, die Elsternbrücke heißt. Der Sinn des Brauches ist klar: Der Phallos an den Bambuszweigen weist auf einen Abwehr- oder Fruchtbarkeitszauber oder auf beides hin. Tanabata läßt sich als das Brett oder Sims des Webers (Tana-hata) erklären, so daß es sich um die Flachs- oder Hanfernte handeln kann oder vielleicht auch um die Zucht der Seidenraupe. Mit der Sage von der Weberin und dem Kuhhirten hat das ursprünglich nichts zu tun gehabt, ist aber wahrscheinlich nach der Abschwächung des alten Glaubens der Weberin zuliebe zu Vorgängen am Himmel in Beziehung gebracht worden. Jukichi Inouye sagt, daß das Fest der Weberin in Tôkyô noch ganz vereinzelt gefeiert werde, indem man der Weberin einige Opfergaben darbringe. Nach seinen Angaben lautet die Sage so, daß die Nacht des 7. Juli die einzige Nacht im ganzen Jahr ist, in der die Weberin mit ihrem Geliebten zusammenkommt. Elstern fliegen dann herbei und breiten ihre Schwingen aus, so daß über den himmlischen Fluß, wie die Milchstraße genannt wird, für die Liebenden eine Brücke entsteht, auf der sie zusammenkommen. Home Life in Tôkyô, Tôkyô 1910, S. 300. Damit wäre der Zeugungsvorgang, den der Phallos der Bambuszweige auf der Erde darstellt, an den Himmel verlegt. Der Kuhhirte weist darauf hin, daß das Tanabata auch einmal für die Haustiere Bedeutung gehabt haben muß. Für Stadtbewohner, die heute noch die alte Überlieferung pflegen, wird es sich wohl um Kindersegen handeln. Die schließliche Übertragung auf den nächtlichen Himmel zeigt deutlich, daß das alte Fest auch zur Nachtzeit gefeiert worden ist.
Ein Überlebsel eines phallischen Kultes ist auch ein Yomatsuri (eine nächtliche Feier) zu Iwakadoyama in der Nähe von Nihonmatsu in der Provinz Shinshû. Um Mitternacht gehen beide Geschlechter auf einen Berg und opfern dort Hammai (Reis für den Hausgebrauch). Bei Tagesanbruch am folgenden Tage steigen sie dann wieder vom Berge herunter. Jeder, der an dieser Feier teilgenommen hat, bringt als Erinnerung ein Suzu (Glöckchen oder Schelle) aus Ton mit nach Hause. Dieses Glöckchen wird an die Sehne eines kleinen Bogens gehängt. Der Bogen kann kein willkürlich ausgewähltes Mittel sein, um das Glöckchen daran zu befestigen, sondern er ist offenbar die letzte Erinnerung an eine heilige Handlung auf dem Berge, die Glück bei der Jagd bringen sollte. Auffallend ist der Umstand, daß man auch einen künstlichen Phallos zur Selbstbefriedigung der Frauen an einem solchen Bogen befestigt und mit ihm den Phallos in der Scheide hin und her zieht. Dies ist die sogenannte Schießbogenmaschine, das Yumi-Shikake. Wir werden im Abschnitt Harikata ein Bild davon bringen. Das japanische Glöckchen ist eine geschlossene Kugel mit einer Öffnung, so daß solch ein Suzu mit der Peniseichel eine gewisse Ähnlichkeit hat. In der Gassensprache des Volkes heißt deshalb die glans penis »Suzuguchi«, d.h. die Öffnung des Glöckchens. (Siehe die Abbildung.) Man nennt die Eichel auch einfach »Suzu«, das Glöckchen. Die Spitze des Penis heißt in der Volkssprache »Suguchi«. Dies Wort ist eine Verstümmelung von Suzuguchi; es konnte aber auch eine Anspielung auf die Mündung einer Feuerwaffe, einer Kanone usw. sein, die im Japanischen Suguchi heißt. Die Abbildung ist eine sinnbildliche Darstellung der Peniseichel; sie stammt aus der zu Osaka erscheinenden Zeitung »Kokkei Shimbun« (etwa: Lustige Blätter), Nr. 110 vom 15. Juni des zweiten Taishô-Jahres (1913 u. Z.). –
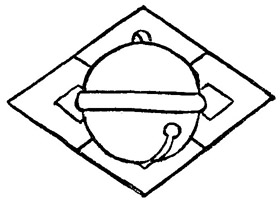
Suzuguchi.
Ein ganz sonderbares göttliches Wesen, für das ich kein weiteres Beispiel kenne, ist Mae-Dashi Jizô, d.h. Jizô, der einen Cunnus offen herzeigt. Jizô (sanskrit: Kshitigarbha) ist ein sehr beliebter buddhistischer Gott, der mitleidige Helfer in allen Nöten, der Beschützer der Reisenden, der schwangeren Frauen und der Kinder. Aber der Mae-Dashi Jizô hat eine besondere Eigentümlichkeit, über deren Ursprung das Buch »Shimpen Kamakura Shi« (eine neue Geschichte von Kamakura) folgende Auskunft gibt:
»Im Westen von Yonemachi, Kamakura, in der Provinz Sagami, befindet sich ein buddhistischer Tempel der Jôdo-Sekte, der Emmeiji genannt wird. Das vornehmste Götterbild dieses Tempels ist ein Jizô-bosatsu (ein Bôdhisattva Kshitigarbha). Dieses Götterbild ist vollkommen nackt und hat einen Cunnus, der aber an gewöhnlichen Tagen mit einem Schurz bedeckt ist; es steht auf einem Puffspielbrett. An einem Kaichô (d.h. an einem Tage, an dem die Vorhänge vor den buddhistischen Götterbildern weggezogen werden) zeigt dieser Jizô seinen Cunnus her und deshalb wurde er Mae-Dashi Jizô genannt. Die Überlieferung besagt, daß vor langen Jahren einmal die Frau des Hôjô (Oberpriesters) Tokiyori (des fünften Oberbeamten in der Regierung des Kamakura-Shôgun, der im dritten Jahre des Kôchô, d.h. 1263, starb) mit ihren Gefährtinnen Sugoroku Sugoroku ist ein altes Brettspiel, das mit zwei Würfeln gespielt wurde. spielte. Als Einsatz sollte jede von ihnen, die verlor, sich splitternackt ausziehen. Und das Unglück wollte, daß sie in dem Wettstreit beim Spiele verlor. In diesem Augenblicke rief sie den Jizô um Beistand an und gelobte ihm Leben und Seele. Da trat Jizô an ihre Stelle. Alle Leute hielten dies für etwas Geheimnisvolles und man stellte im Tempel ein Standbild auf, das genau in der Gestalt geschnitzt war, in der sich der Gott in jenem Augenblick verkörpert gezeigt hatte.«
Daraus könnte man die Schlußfolgerung ziehen, daß das Standbild des Jizô als ganzer Körper einer Frau dargestellt war. Das vorhandene Bild ist aber offenbar, bis auf den zu gewöhnlichen Zeiten verhüllten Cunnus, ein Mann und das entspricht auch ganz dem Wesen des Jizô-Kshitigarbha als Schutzpatron der Reisenden. Wahrscheinlich ist er eine aus zwei verschiedenen Gottheiten zusammengeflossene Gestalt des Glaubens, deren Standbild halb männlich und halb weiblich war, wofür sich eine spätere Zeit eine Erklärung suchte. Seinem weiblichen Teil hat er jedenfalls seine Stellung als Schutzpatron der schwangeren Frauen und Kinder zu verdanken. Die Einzelheiten über dieses sonderbare Standbild werden wohl nie aufzuklären sein. Auffallend ist jedenfalls, daß Mae, der weibliche Geschlechtsteil, zunächst »die Vorderseite« bedeutet und erst im übertragenen Sinne den Schamteil der Frau bezeichnet, daß aber das Wort in diesem Sinne fast nur von den Frauen gebraucht wird, und zwar seit der Yedo-Periode, also etwa seit 1600 u.Z. Heute gebrauchen die Frauen in Tôkyô fast ausschließlich dieses Wort, wenn sie von ihrem eigenen Geschlechtsteil reden. Ebenso gebrauchen die Frauen auch die Ausdrücke »Mae-no-Ana«, das Loch, die Höhle oder die Grube der Vorderseite, und »Mae-no-Ke«, das Haar der Vorderseite. Noch züchtiger klingt der in der Umgangssprache beliebte Ausdruck »Mae-no-Mono«, das Ding auf der Vorderseite; eigentlich ein unnötiges Wortgedoppel, da der Frau für das »Ding« im Japanischen genug Worte zur Verfügung stehen, wie wir noch sehen werden. Ebenso überladen ist der Ausdruck »Mae-Jiri«, das Unterteil der Vorderseite oder der Unterkörper der Vorderseite. Dieses nicht ganz salonfähige Wort wird in einem Kyôka (einem kleinen komischen Gedicht) verwertet:
»Ki no chigau hito koso
Fuben shigoku nare
Doko tomo iwazu
Idasu Maejiri.«
»Es ist sehr unpassend für eine Verrückte, wenn sie ihren Cunnus herzeigt, ohne zu sagen, warum und weshalb.« Mit anderen Worten: Wenn eine Frau erst einmal ihren Cunnus hergezeigt hat, dann ist sie verrückt, wenn sie nicht sagt, warum und weshalb. In einem ähnlichen Sinne gebraucht man die Redensart: »Kichigai onna no omanko e hachi ga haitta yô,« d. h.: als wenn eine Wespe in die Vulva einer wahnsinnigen Frau gekrochen wäre. Mit diesen etwas derben Worten soll gesagt werden, daß jemand vollständig verwirrt ist, ohne die Ursache davon angeben zu können.
Wir dürfen annehmen, daß das sonderbare Standbild des Jizô weithin bekannt ist und daß es besonders in der Provinz Sagami, in der der Tempel Emmeiji liegt, sich eines großen Ansehens erfreut. Daher ist es leicht verständlich, daß sich das Volk auch außerhalb des Tempels mit ihm beschäftigt. Ein Senryû lautet:
»Gejo mamori honzon
Maedashi-jizô nari.«
»Das Amulett der Dienstmagd ist der den Cunnus herzeigende Jizô.« In diesem Senryû ist auch zum Ausdruck gebracht, daß der Jizô das Hauptgötterstandbild (honzon) des Tempels ist. Wenn man dies Senryû verstehen will, muß man wissen, daß in der Yedozeit die jungen unverheirateten Frauen aus der Provinz Sagami nach Yedo (dem heutigen Tôkyô) kamen und ihre Dienste als Magd für die geringeren Arbeiten anboten. Sie wurden hauptsächlich in den Geschäftshäusern verwendet und waren dafür bekannt, daß sie sehr geil und wollüstig veranlagt waren. Sie traten mit den männlichen Bediensteten, manchmal auch mit ihren Brotherren, in geschlechtliche Beziehungen, so daß Sagami, als Abkürzung von Sagami onna (eine Frau aus der Provinz Sagami) ein allgemein üblicher Ausdruck für ein geiles, wollüstiges Dienstmädchen wurde. Man sagte auch »eine Sôshû«, nach einem anderen Namen für die Provinz Sagami. Weiterhin sagte man »eine Jsehara« oder »eine Kotsubo«, nach den Namen zweier Dörfer in der Provinz Sagami. Satow hat aus der Meiwa-Anyei-Periode (1764–1780) Senryû gesammelt, die diese eigenartigen Verhältnisse getreu wiederspiegeln
»Te wo toru to Gejo
Hanaiki wo areku suru.«
»Wenn er ihre Hand hält, fängt bei der Dienstmagd sehr bald ein schweres Schnaufen an.« Dieses Senryû sagt ganz kurz und bündig: »Du brauchst sie nur bei der Hand zu fassen und schon beginnt das schwere Atmen durch die Nase, das ein sicheres Zeichen der geschlechtlichen Erregung ist,« ein Beweis, daß die Japaner sehr scharfe Beobachter sind.
»Suki na Gejo tokoro wo kikeba
Kotsubo nara.«
»Wenn wir die geile Dienstmagd nach ihrem Geburtsort fragen, dann antwortet sie: sie stamme aus Kotsubo.« Die Antwort ist zweideutig; ich vermute, daß es sich um ein Wortspiel mit Kotsubo, dem Kindertopf, oder der Gebärmutter handelt. Die Verfasser der Senryûs wollen ja Scherze machen!
»Chôhô na Ana no aiteru
Sagami Gejo.«
Ana ist ein nicht gerade feiner Ausdruck für den weiblichen Geschlechtsteil; eigentlich bedeutet es Loch, Höhle, Grube, Grab. Chôhô ist ein kostbares und seltenes Ding, bedeutet aber auch zugleich Nützlichkeit. Das Senryû läßt sich daher nicht in seinem vollen Sinn übersetzen. Etwa so: »Die Dienstmagd aus Sagami hat ein sehr nützliches Loch.«
»Sôshû no jû Matagura no
Midareyaki.«
»Die einheimischen Mädchen aus Sôshû haben eine Midareyaki-Naginata zwischen ihren Schenkeln.« Midareyaki ist eine besondere Art, eine Waffe zu härten, wodurch unregelmäßige Wellenlinien auf der Klinge usw. entstehen. In obigem Senryû handelt es sich um eine Hellebarde, die deshalb in die Übersetzung eingeschoben ist, um den Sinn verständlich zu machen. Das Naginata ist eine Hellebarde, die in einen sichelartigen Ansatz endigt. Es ist ein Gassenwort für den Cunnus, den man auch Naginata-Kizu, »die durch die Hellebarde verursachte Wunde«, nennt, wozu wohl das Äußere des Cunnus die Veranlassung war. Wenn man annimmt, daß die Midareyaki-Waffen etwas Kostbares waren, bringt dieses Senryû denselben Gedanken zum Ausdruck, wie das vorhergehende.
»Isehara wo oita de
Mise ga kongai shi.«
»Bei den Kaufleuten entstand ein großes Durcheinander, als die Dienstmagd aus Isehara ihre Stelle angetreten hatte.« Hierzu ist wohl keine weitere Erklärung erforderlich. Wir müssen nur diesen Stegreifdichter bewundern, der es fertig bringt, mit acht Worten in geradezu überwältigend einfacher Weise die Situation in dem Geschäftshause zu schildern, als die Dienstmagd aus der berühmten Provinz Sagami aufgetaucht war. Man ist fast versucht, nach dem oben beigebrachten Stoff den Jizô, der den Cunnus herzeigt, als das Wahrzeichen der ganzen Provinz Sagami anzusehen. Es ist nur schade, daß wir die Laufbahn dieses sonderbaren Schutzpatrons der Reisenden, der schwangeren Frauen und der Kinder nicht nach rückwärts verfolgen können.
Der Glaube an die Zauberkraft des Jizô ist heute noch nicht verschwunden. Wenn ein Kind am Keuchhusten erkrankt ist, holt man in einem der Tempel, die dem Jizô geweiht sind, zwei heilige Holzklötzchen; diese Holzklötzchen werden zusammengeschlagen, wenn das Kind hustet, d.h. man vertreibt durch das Klappern die bösen Geister, die es belästigen. Ist das Kind geheilt, dann bringt man das Klötzchenpaar in den Tempel zurück, gleichzeitig aber ein neues Paar, auf dem der Name des Kindes eingeschnitten ist. Jukichi Inouye, Home Life, S. 226.
Wir haben oben von dem Kaichô gesprochen, von dem Festtage, an dem vor den buddhistischen Götterbildern die Vorhänge weggezogen werden. Kaichô bedeutet eigentlich: die öffentliche Ausstellung einer Tempelreliquie oder eines Götterbildes, d.h. das Götterbild wird sichtbar gemacht, indem man einen Vorhang wegzieht oder einen Wandschirm wegnimmt, der das Bild oder den Gegenstand zu gewöhnlichen Zeiten den profanen Augen verbirgt. Man versteht darunter auch das Öffnen eines Schreines, in dem das Götterbild oder der Gegenstand außerhalb der Festtage den Blicken entzogen wird.
In der Volkssprache bedeutet Kaichô: den Cunnus herzeigen. Das Wort wird dann im übertragenen Sinne für ein kleines Mädchen gebraucht, das seine Geschlechtsteile sehen läßt, ohne daß eine Absicht vorliegt. Bei erwachsenen Frauen bezeichnet es aber den Geschlechtsteil selbst. In Mitteljapan ist Kaichô jedoch mundartlich ein Wort für den Koitus. In dem Kibyôshi (Lustiges Buch), das den Titel hat: »Rifujin Tsûshi Sen« (Eine Blütenlese von maßgeblichen Versen) und von Akera Kwankô während der Yedo-Periode veröffentlicht worden ist, findet sich folgende Auslegung des Wortes Kaichô: »Eine Frau, die in nachlässiger Weise dasitzt, stellt oft (ihren Cunnus) zur Schau, während eine Frau, die sorgfältig auf ihre Haltung beim Sitzen achtet, (ihren Cunnus) nur alle dreißig Jahre zur Schau stellen wird.« Alle dreißig Jahre bedeutet: sehr selten. Ein Senryû sagt uns folgendes:
»Kaicho wo ura kara Yuban oganderu.«
»Der Badejunge betet den Cunnus von der Rückseite der Frau her an.« Hier klingt also noch der Begriff von etwas Heiligem, zum Tempel gehörigen, durch. In der Kindersprache kommt Kaichô als Okaichô vor und gilt dann als ein höflicher, anständiger Ausdruck. Dies liegt lediglich an der Silbe o, die wir bei vielen japanischen Wörtern vorgesetzt finden, um das Wort in ein höfliches zu verwandeln.
Es wäre möglich, daß man in dem Worte Kaichô an sich schon den Begriff des Cunnus gefunden hat. Awabi-Kubo bedeutet wörtlich die Höhlung der Ohrmuschel, ist aber ein altertümlicher Ausdruck für den Cunnus. Awabi ist zunächst eine Muschel, zoologisch Seeohr oder Haliotis genannt; ihren Namen hat sie von ihrer Gestalt, die, flach und schüsselförmig dem menschlichen Ohr gleicht. In dem Buche »Ansai Zuihitsu« (Ansai's Vermischte Schriften) ist auf den äußeren Zusammenhang zwischen Cunnus und Muschel hingewiesen. Der Verfasser sagt: »Awabi-Kubo ist der Cunnus; nach dem Wamyô-shû (Erklärendes Wörterbuch der japanischen Sprache) ist das chinesische Schriftzeichen Kai (die Öffnung) als Wort für den Cunnus im Gebrauch. Dieses Schriftzeichen hat aber dieselbe Aussprache wie das Schriftzeichen für Kai, Muschel; es scheint also, als ob man dieses Wort – Awabi-Kubo – zu einem Wort für den weiblichen Geschlechtsteil gemacht hat, weil das Fleisch der Ohrmuschel flach ist und eine Höhlung hat.« Diese Erklärung klingt wohl ganz einleuchtend, aber die Muschel ist an sich schon in vielen Gegenden der Erde ein uraltes Sinnbild oder vielmehr eine Stellvertreterin des Cunnus. Wir haben auch Arten, wie die Venusmuschel und die Kaurimuschel, die dem Cunnus sehr ähnlich sehen, so daß der Umweg über die Ohrmuschel gar nicht in Frage kommt. Wir werden noch sehen, daß die Muschel ein sehr beliebter Vergleichsgegenstand für den Cunnus ist. Kubo als Höhle, der Gehörgang des Ohres in dem Wort Awabi-Kubo, ist auch an sich schon ein veralteter Ausdruck für den Cunnus. In den Gesängen eines Saibara, einer opernartigen Aufführung in früheren Zeiten, kommen folgende Verse vor:
»Kubo no na wo nani toka iu
Kubo no na wo nani toka iu
Tsubitari, Kefukunou tamoro
Hi no naka no Hitsugime
Kefukunou tamoro.«
»Die Höhle, die wir Hitsugime nennen, die ist Tsubitari. Oh, gebt mir dieses haarige Weizenbrötchen, damit ich in diese Höhlung hineinstechen kann und so meine Befriedigung habe!« Hitsugime ist ein altes Wort für den Cunnus; es wird wohl zusammengesetzt sein aus Hi, geheim, und Tsugime, die Fuge oder die Naht. Hi no naka no Hitsugime bedeutet also »der Schlitz in der geheimen Naht«. Tsubitari ist gleichfalls ein alter Name für den Cunnus; Satow hält ihn für gleichbedeutend mit Tsuratari, »das, was vom Hemd bedeckt wird«.
In dem von Matsuoka Yuzuru verfaßten Buche »Immei-Kô« (etwa: Sonderabhandlung über die Namen der Geschlechtsteile) ist angegeben, daß das Wort Awabi-kubo die Geschlechtsteile einer alten Frau bezeichnet.
Im Volksglauben spielt die Awabimuschel eine große Rolle und sie ist gewissermaßen auch im Shintô-Glauben eine offizielle Einrichtung. In Kande werden vor dem Phallos Awabimuscheln niedergelegt. Auch in den Tempeln sieht man solche von unfruchtbaren Frauen niedergelegte Muscheln.
Der Vorhang, der vor den buddhistischen Götterbildern hängt, heißt Mitochô; im übertragenen Sinne das Lendentuch der Frauen, das in dieser Auffassung also als Tempelvorhang gilt, der vor etwas Heiligem hängt. In dem oben erwähnten Volkslied, in dem das Wort Ama-no-Iwato, die Felsenhöhle der Sonnengöttin, vorkommt, ist der Ausdruck Ama-no-Iwato no Mitochô dahin aufzufassen, daß der Vorhang vor der Felsenhöhle, dem Gassenwort für den Cunnus, hängt, so daß er, wie es die Schaustellung, von der wir noch sprechen werden, von der Darstellerin verlangt, jederzeit hinweggezogen werden kann. Das Mitochô kann auch ein kurzes Röckchen, eine Art Schamröckchen sein, so daß die Darstellerin den Vorhang hochziehen würde. Siehe oben: Shimpi-no-Tobari.
Hinter einem Vorhang ist auch das Allerheiligste verborgen und so darf es uns nicht wundernehmen, daß in der Volkssprache Okuno-In, das Sanctum Sanctorum, den Cunnus bezeichnet, namentlich die inneren Teile desselben. In diesem Sinne ist Okû-no-In, wörtlich: der zuhinterst liegende Raum des Tempels, seit Beginn der Yedo-Periode gebräuchlich. Ein Senryû lautet folgendermaßen:
»Katahiza wo tatete
Ibitsu na Oku-no-in.«
»Wenn das eine Knie in die Höhe gehoben wird, bekommt der Cunnus ein schiefes Aussehen.« Der Scherz liegt darin, daß wörtlich übersetzt die Stelle lautet: »... wird das Allerheiligste schief«; das Allerheiligste ist aber in Wirklichkeit ein viereckiger Raum. Zur weiteren Erläuterung dieses Senryû soll hier eine launige Geschichte aus der Yedo-Periode folgen, deren Titel »Sankaku«, Das Ding mit drei Ecken, lautet:
»Zwei Männer sprachen eines schönen Tages miteinander über die Geschlechtsteile der Frauen. Der eine sagte, sie haben eine runde Gestalt, wogegen der andere behauptete, sie seien viereckig. Sie konnten mit ihrer Auseinandersetzung zu keinem Ende kommen, so daß sie sich schließlich dahin einigten, ihren Streit dadurch zu beenden, daß sie sich das wirkliche Ding einmal anschauten. In diesem Augenblick war glücklicherweise das Kindermädchen einer Familie vorbeigegangen, mit der sie beide bekannt waren. Sie riefen das Mädchen in das Haus herein, erzählten ihr den Streitfall und verlangten von ihr, sie solle ihnen ihr Allerheiligstes zeigen, wofür sie ihr einen Ryô als Belohnung geben würden. Das Kindermädchen führte sie daraufhin zu einem Baumweg, da sie sich schämte, es ihnen im Hause zu zeigen. Dort hob sie nun die Kleider hoch, zeigte ihren Schoß her und sagte: ›Nun kommt und betrachtet es!‹ Die beiden Männer beschwerten sich jedoch darüber, daß ihr Geschlechtsteil mit einem übermäßigen Haarwuchs bedeckt sei, so daß sie den Ausgang des Heiligtums nicht deutlich genug in Augenschein nehmen könnten. Als das Kindermädchen dies hörte, erwiderte sie: ›Dann werde ich es eben so machen!‹, wobei sie den Schlitz mit beiden Händen auseinanderzog. Und da sahen die beiden Männer eine dreieckige Öffnung.«
Hier sind noch einige weitere Senryû:
»Oku-no-in Suzu furi tatete
Ogamu nari.«
»Er betet das Allerheiligste mit einem steifen Penis an.« Mit anderen Worten: Wenn jemand nach dem Cunnus guckt, bekommt er einen steifen Penis. Von Suzu, dem Glöckchen, d.h. der Eichel des Penis, haben wir oben schon gesprochen. Im vorliegenden Senryû bedeutet Suzu den ganzen Penis, aber doch in der Auffassung als Glöckchen, das ja bei den heiligen Handlungen beim Allerheiligsten eine große Rolle spielt.
»Oku-no-in Gejo ogamaseru
Ne-han-zô.«
»Die Dienstmagd zeigt im Schlafe das Allerheiligste, das Bild des Nirwana.« Mit andern Worten: Während die Dienstmagd schläft, läßt sie ihren Cunnus von den anderen begucken. Etwas nüchterner, wie das obige, bringt das folgende Senryû denselben Gedanken zum Ausdruck:
»Oku-no-in Hibutsu mo misete
Gejo hirune.«
»Die Dienstmagd zeigt ihr Allerheiligstes her, während sie ihr Mittagsschläfchen hält.« Siehe das Bild, das aus »Ôtsue Bushi«, einem Buch mit Wanderliedern stammt, dessen Verfasser und Erscheinungsjahr unbekannt sind. Was die Heiterkeit des Mannes erregt, ist aber weniger das Allerheiligste, als das Papier, das die japanischen Frauen beim Koitus benutzen und das sich die Magd vorsorglicherweise bereitgelegt hat.

Oku-no-in.
Wie das Mitochô, der Vorhang, im Tempel, und das Oku-no-in, das Allerheiligste, hat auch das Tori-i, das Tor eines Shintô-Tempels ein geschlechtliches Sinnbild abgeben müssen. Es lag nahe dieses stets offene Tor als ein Sinnbild für den weiblichen Geschlechtsteil zu benutzen.
Das Wort für den Vorhang im Tempel, Mitochô, ist vielleicht aus einem Anklang an das Wort Mito heraus zu seiner Bedeutung als Vorhang vor dem weiblichen Geschlechtsteil, als Lendentuch, gekommen. Denn Mito ist ein altertümliches Wort, das in Verbindung mit Maguhai, als »Mito-no-Maguhai« im Kojiki (Geschichtsbücher der alten Sitten und Gebräuche) die Geschlechtsteile bedeutet. Maguhai ist als »lagern, sich lagern, lagern lassen«, also als aktiv oder passiv aufzufassen. Magu oder Maku, ebenso wie Maguhai, Magubai oder Makubai, sind altertümliche oder veraltete Bezeichnungen für den Koitus. Mito bedeutet eigentlich ein Ehrentor, so daß man sich anscheinend die ersten Menschen aus einem solchen steinernen Ehrentor hervorgegangen dachte. In diesem Sinne kommt Mito in dem veralteten Worte Mito-Atawashi vor, das den Koitus bedeutet, wörtlich aber als »durch das Ehrentor verkehren« zu erklären ist, wobei schon in Ata eine altertümliche Bezeichnung für den Cunnus enthalten ist.
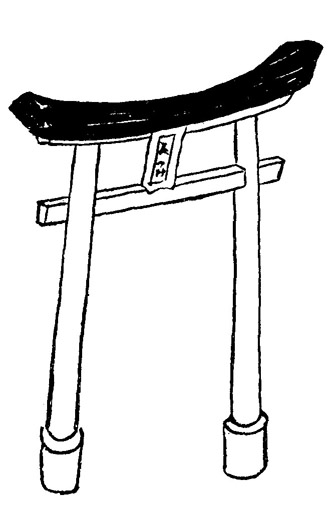
Tori-i.
Das Wort Maguhai ist in seinem alten Sinne in dem folgenden Senryû erhalten:
»Okkanai Maguhai wo suru
Ise no rusu.«
d.h.: während der Gatte eine Wallfahrt zum Ise-Heiligtum macht, leistet sich seine Frau zu Hause einen Koitus mit ihrem Geliebten.
Am Rande sei in diesem Zusammenhang auf einen alten Kult hingewiesen, der zu dem Geschlechtskult in enger Beziehung steht. Es handelt sich hier um die Verehrung der Schamhaare der Shichinan, die als Shichinan-ga-sosoge bezeichnet werden. Der Überlieferung nach soll diese Shichinan eine Zauberin, d.h. eine Zauberpriesterin gewesen sein. Anscheinend weiß man von diesen heiligen Überresten nicht viel und die Zauberin wird wohl in alten Zeiten eine gütige Göttin gewesen sein, auf alle Fälle aber eine himmlische Riesin, denn ihre verehrten Schamhaare sind länger als drei Meter! Nach dem Buche »Sanyô Zakki« (Sanyôs Vermischte Schriften, verfaßt von Yamasaki Yoshinari und veröffentlicht im elften Tempôjahr (1840), wurde solches Shichinan-ga-sosoge als kostbarer Schatz in folgenden Tempeln aufbewahrt: zu Hakone-Gongen in der Provinz Izu, im Tôkôji von Iwashita-mura, Bezirk Toyodagun in der Provinz Shimôsa; im Togakushi Jinja von Tokakushiyama in der Provinz Shinshû und im Heiligtum der Benten von Chikubujima, Enoshima.
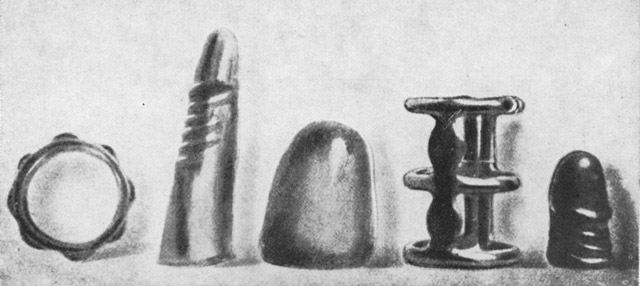
15. Verschiedene Typen von Penisaufsätzen aus Metall. Von links nach rechts: Reizring (rin no wa), Penisaufsätze (kabutogata), Penisstütze (yoroigata) usw.)
Verschiedentlich werden bestimmte Tiere und Fabelwesen in der Vorstellung der Japaner mit der Sexualität in Zusammenhang gebracht, so ist z.B. der Kawauso (Fischotter) nach der Volksüberlieferung ein geiles Tier, das die Rolle eines Nachtmahrs spielt und sich als Incubus betätigt. In dem erotischen Buch »Gokuhi Tebake no Soko« (Ganz geheim auf dem Boden des Putztischkastens aufzubewahren), verfaßt von Hata Genshun und erschienen im vierten Jahr der Temmonzeit (1535 u.Z.), findet sich im Abschnitt »Yume ni Chigiru koto« (Über die Heirat im Traum) folgende abergläubische Angabe: »Der Fischotter ist ein sehr wollüstiges Tier und immer, wenn er einer Frau begegnet, wird er ihren Leib umarmen. Obendrein nimmt er zuweilen die Gestalt eines Mannes an und kommt so zu den Frauen.«
Das Volk fürchtet sich sehr vor solchen Träumen mit allen ihren Nebenerscheinungen und man hat verschiedene Mittel, um sie fernzuhalten und glückliche Träume herbeizuführen. Das einfachste Mittel ist das Takarabune, das Schatzschiff, d.h. das Bild eines Schiffes mit den sieben Glücksgottheiten, den Shichifukujin, darauf. Ein solches Bild legt man in der Nacht des zweiten Tages des ersten Monats, d.h. des Januar, unter das Kopfkissen, dann wird man immer gute Träume haben. In der Gassensprache ist das Wort Takarabune zu einer Bezeichnung für den Cunnus geworden. Unsere Abbildung gibt ein solches Takarabune in sinnbildlicher Darstellung wieder; dieses »glückhafte« Schiff ist mit phallischen und cunnischen Zeichen geradezu überladen, als wenn man den Abwehrzauber gegen die bösen Geister, die im Schlaf zu uns kommen, gar nicht stark genug machen könnte. Auch der Kranich am oberen Rande ist ein solches Abwehrsinnbild. Neben ihm ist folgendes geschrieben: »Nagaki mara Bobo no kegiwa e mina hairi nami yori futoki kokochi yokiyana.« Das bedeutet: »Ein langer Penis ist bis zu den Haaren des Cunnus eingeführt worden; er ist sehr dick und gibt ein viel besseres Gefühl als gewöhnlich.« Darin liegt wohl eine Ankündigung an den Incubus, daß er hier eigentlich nichts mehr zu suchen hat, da nach dem Zauberspruch des Takarabunebildes die Stelle, die er suchen könnte, bereits besetzt ist.

Takarabune.
Ein Fabelwesen, das nach dem Volksglauben die bösen Träume auffrißt, führt den Namen Baku. Die Zoologen verstehen darunter den Tapir, auch Wasserschwein genannt. Nach der Ansicht des Volkes hat dieses Tier aber die Gestalt eines Bären, den Kopf eines Löwen, den Rüssel eines Elefanten, die Augen des Rhinozeros, den Schwanz einer Kuh und die Tatzen eines Tigers. Die Einbildungskraft des Volkes hat also dieses Fabelwesen, das Träume frißt, gar nicht stark und wehrhaft genug machen können, um es für seinen Kampf gegen die bösen Geister auszurüsten. Auch das Bild dieses Baku wurde in der Nacht unter das Kopfkissen gelegt, und zwar häufiger, besonders aber in der oben angegebenen Nacht des zweiten Januar. Man kann auch Unglück von sich fernhalten, wenn man das Bild des Baku bei sich trägt. In bezug auf diesen Glauben, daß das Baku die bösen Träume frißt, wird morgens eine Zauberformel oder ein Fluch ausgesprochen: »Baku kurae baku kurae!« wörtlich: »Baku iß! Baku iß!« d. h.: Ich hätte es gern, wenn der Tapir meinen Traum aufäße! Hier folgen zwei Senryu, die sich mit dem Baku beschäftigen:
»Mōzō wa sakari no tsuita Baku ga kui.«

Mōzō.
»Eine wilde Einbildung kann nur von dem erregten Tapir aufgefressen werden.«
»Futsuka no yo Baku mōzō ni kuiakiru.«
»In der zweiten Nacht (des Januar) wird der Tapir müde beim Auffressen der wilden Einbildungen,« weil er nämlich in dieser Nacht, wo man mit Vorliebe seine Bilder unter das Kopfkissen legt, besonders in Anspruch genommen wird.
Das oben vorkommende Wort »Mōzō«, das mit »wilde Einbildung« wiedergegeben wird, ist gewissermaßen ein fester Begriff für Phantasiebilder geworden, wie sie im Traume entstehen oder von Künstlern erdacht werden. In dem erotischen Buch »Nenchū Kōgō Koji« (Fabeln vom Koitus das ganze Jahr hindurch), verfaßt von Inrakū-Dōjin und erschienen in der Kayei-Zeit (1848–1853), finden wir das Bild eines Mōzō, das der Maler Sasenasai Marumaru gezeichnet hat. Zu diesem Bild wird folgende satirische Erklärung gegeben:
»Nach dem ›Chinkai Ibutsushi‹ (Die Naturgeschichte des geheimnisvollen Cunnus) sollen diese Tiere im Tale von Inyō San (Berg männlichen und weiblichen Geschlechts) leben. Sie halten sich aber getrennt voneinander an verschiedenen Plätzen auf, tragen jedoch großes Verlangen, einander zu treffen. Deshalb träumen sie auch wilde Phantasien und während dieser Zeit rufen sie ›Mō, mō!‹ Deshalb nennt man dieses Tier auch ›Mōzō‹.«
Zu den Fabelwesen, von denen die Menschen belästigt werden, gehört auch das Kappa, das Wasserkind. Es hat die Gestalt und das Gesicht eines etwa zehn Jahre alten Kindes, kann aufrecht gehen und die Sprache der Menschen sprechen. Mitten auf dem Kopf hat es eine Höhlung, die gewöhnlich mit Wasser gefüllt ist. Bei Sonnenuntergang kommt es aus dem Wasser heraus und stiehlt auf den Feldern Melonen, Eierpflanzen (Solanum esculentum oder Solanum melongena), Getreide usw. Das Kappa ist ein großer Liebhaber des Ringkampfes und sobald es einen Mann trifft, fordert es ihn zu einem Wettstreit der Kräfte auf. Wenn ein solcher Mann klug ist, beugt er den Kopf herunter und schüttelt ihn mehrere Male hin und her. Das Kappa ahmt diese Bewegung nach; dabei fließt das Wasser aus der Höhlung des Kopfes heraus, wodurch das Kappa seine Stärke verliert und sterben muß. Im Volk hat sich aber die Überlieferung erhalten, daß es den mutigsten Mann niederzwingt, solange es das Wasser in seinem Kopfe hat. Obendrein hat es noch den Vorteil, daß seine Arme sehr leicht aus den Gelenken herausgehen und dabei sehr schlüpfrig sind, so daß sein Gegner so leicht nicht mit ihm fertig wird. Das Kappa hat die Gewohnheit, ein Pferd oder eine Kuh in den Sumpf zu ziehen und ihnen von dem Loch des Hintern aus das Blut auszusaugen. Man hat heute die Auffassung, daß es sich um ein Wassertier handelt, das in den Sümpfen von Kyūshū sehr häufig vorkommt. In der Folklore dieser Provinz finden wir folgende Erzählung:
»Die Frau eines Arztes, namens Takatori Unshōan, der in Fukuoka lebt, ging eines schönen Tages auf den Abtritt. Dort fühlte sie auf einmal, daß jemand ihre Hinterbacken sanft mit der Hand streichelte. Da schlug sie diese Hand mit einem Schwert ab. An demselben Abend kam ein Kappa unter das Fenster ihres Hauses und bat sie, ihm doch seine Hand zurückzugeben, da es diese gern an seinen Körper wieder ansetzen möchte. Da sagte ihr Gatte Unshōan zu ihm, er werde ihm die Hand zurückgeben, wenn es ihm dafür als Gegenleistung die Kunstgeheimnisse des Knocheneinrichtens überlasse. Das Kappa erklärt sich mit diesem Verlangen einverstanden und hat den Arzt von der Außenseite des Fensters her in den Kunstgriffen unterrichtet. Und Unshōan hat diese Kunst an die nachfolgenden Geschlechter weitergegeben unter dem Namen des ›Erblich überlieferten Knocheneinrichtens‹.«
Wir werden Bildern des Kappa als Karikatur später bei einer Gelegenheit begegnen, die darauf schließen läßt, daß man das Kappa auch als Kinderfresser ansah, was vielleicht mit der Sage, daß es Pferden und Kühen vom After her das Blut aussaugt, in Verbindung zu bringen ist. Das Kappa ist dann wohl auch ein böser Geist gewesen, mit dem man unartige Kinder fürchten machte. Ein Märchenbild zeigt das Kappa in seiner Auffassung als Kinderfresser, der in die Kinderstube eingedrungen ist. Im Kopf sieht man die Höhlung, die das Wasser enthält, von dem das Leben des Kappa abhängig ist. Der Sinn dieses Wasserloches liegt wohl darin, daß es sich um ein Wassertier handeln mag.
Eine solche Kinderfresserin war auch Kishi-mo-jin oder Kishibojin, die Mutter der bösen Geister, als Harītī eine buddhistische Göttin, die von Shakiamuni, dem Buddha, bekehrt wurde. Mit andern Worten: Der Buddhismus hatte diese in Japan einheimische Göttin übernommen und sie in eine gute Göttin verwandelt, da er sie als bösen Geist in seiner Glaubenslehre nicht unterbringen konnte. Dies ist natürlich schon vor vielen hundert Jahren gewesen, aber im Volke hat sich doch die Überlieferung erhalten, daß diese Kishi-mo-jin früher einmal eine Kinderfresserin gewesen ist, obwohl sie heute sogar als eine Schutzgottheit der Kinder verehrt wird, die schwangeren Frauen beisteht und unfruchtbaren zu Kindern verhilft. Sie hat auch eigene Tempel, die natürlicherweise in erster Linie von Frauen aufgesucht werden, die unter den angegebenen Umständen bei der Harītī Beistand und Hilfe suchen. Ein Senryū lautet:
»Otsuke takusan ga Doyadoya to Kishi-mo-jin.«
Das bedeutet wörtlich: »Jung verheiratete Frauen beten laut im Tempel die Hariti an.« Es steckt aber in dem Verschen etwas mehr, als man ihm auf den ersten Blick ansieht. Denn Otsuke takusan bedeutet eine Frau, deren Geschlechtsteil reichlich Flüssigkeit absondert, wofür man auch »Oshiru-takusan« oder »Shiru-dakusan« sagt; das Wort zeigt schon deutlicher, worum es sich handelt; wir übersetzen es mit: »Die eine sehr Saftige hat.« Beides sind Ausdrücke des niederen Volkes, aber die Gassensprache liebt ja keine Umschreibungen. Vielleicht will das Senryū zum Ausdruck bringen, daß solche Otsuke takusan oder Oshiru takusan lieber etwas anderes tun sollten, als beten, so daß der Sinn wäre: »Weshalb beten diese Frauen eigentlich im Tempel der Harītī?« –
In japanischen Geistergeschichten kommt häufig das Momongā vor, ein haariges Ungeheuer, vor dem sich die Kinder sehr fürchten. Sonst bezeichnet man mit Momongā das fliegende Eichhörnchen oder Flughörnchen; weshalb dieses harmlose Tier zu einem Ungeheuer geworden ist, könnte man höchstens auf seine nächtliche Lebensweise zurückführen. Man kann auch schon erschrecken, wenn dieses Tier mit ungeheurer Schnelligkeit seine Flüge, oder vielmehr Sprünge mit ausgebreiteter Flughaut, fast lautlos ausführt. Dieses Momongā ist zu einem Gassenwort für einen besonders haarigen Cunnus geworden. Momongā hat man zu Momonjī verderbt und daraus einen Kobold gemacht. In dem Buche »San In Ron« (Drei Abhandlungen über die Geschlechtsteile) steht folgendes zu lesen:
»Kodomo wo osorete Momonjï; to iu.«
»Kinder fürchten ihn sehr und bezeichnen ihn mit dem Namen des Flughörnchens.« Auch die folgenden beiden Senryūs beschäftigen sich mit dem Momonjī, aber in dem übertragenen Sinn als Cunnus:
»Uba kokowa Momonjī ka to
Ashi wo ire.«
»›Sag' mir, Amme! Ist dies das furchtbare Ding?‹ frug das Kind, als es das Momonjī mit der Zehe berührte.« Der Sinn der Frage liegt darin, daß das Kind an dem Momonjī der Amme (des Kindermädchens) offenbar gar nichts Furchtbares fand, wovon man ihm erzählt hatte, und dies durch seine Frage zum Ausdruck bringt.
»Furisode ni niawanu toko wa Momonjī.«
Das Furisode ist ein Gewand mit langen Ärmeln, das junge Damen tragen. Das Senryū will sagen: »Obwohl sie noch sehr jung aussieht, hat sie doch schon einen sehr reichlichen Haarwuchs auf ihrem Mons Veneris.« Unsere Abbildung zeigt, wie der Künstler alle Begriffe zusammengefaßt hat, die in dem Wort Momongā vereinigt sind. Die Haltung des Ungeheuers ist die eines fliegenden Hörnchens, dem er aber menschliche Gestalt mit dem reichbehaarten Cunnus statt des Gesichtes gegeben hat, während die herabhängenden Schamhaare an den buschigen Schwanz des Flughörnchens erinnern. Das Furchtbare, das dem Momongā anhaftet, ist in wunderbar grotesker Weise zum Ausdruck gebracht. Das Bild stammt aus dem Buch »Hakki Yakyo Yōkai no Zu« (Bilder der nachts umherstreifenden Gespenster). –
Wir haben oben von Mae-Dashi-Jizō, dem den Cunnus herzeigenden Jizō gesprochen und dabei erwähnt, daß es schwer fällt, dieses eigenartige Standbild eines Mannes mit einem Cunnus zu erklären. Ein Gegenstück zu dem Mae-Dashi-Jizō ist der Affe mit den weiblichen Geschlechtsteilen, von dem zwei Standbilder bekannt sind. Im Mitsuki Jinja, dem Shintōtempel zu Saitamaken, Kumagaya, steht ein Standbild des Sannō-no-Osaru-san, des Affen von Sannō, von dem wir gleich sprechen werden. Von diesem Heiligtum gingen früher Ofudas aus; darunter versteht man Papierstückchen die mit Zauberformeln beschrieben sind und als Amulette dienen. Diejenigen des Mitsuki Jinja von Saitamaken, Kumagaya, enthielten neben dem Zauberspruch noch das Bild eines weiblichen Affen, dessen Schamteile mit roter Farbe besonders hervorgehoben waren. Diese Äffin stellte wohl ungefähr das Tempelbild dar.

Momongā oder Bobongā.
Das Hauptstandbild des Affen, der die weiblichen Geschlechtsteile zeigt, stand im Sannō, dem Shintōheiligtum zu Akasaka, Tōkyō. Es war ein aus Holz geschnitztes Bild eines weiblichen Affen, der zusammengekauert so dasaß, daß man die Geschlechtsteile sehen konnte. Dieses Standbild wird von Männern oder Frauen angebetet, wenn sie an einer Geschlechtskrankheit leiden. Während der Anrufung bringt man eine schminkenartige rote Farbe (beni gara, bengara, roter Ocker) auf den Cunnus des Affen; dadurch will man eine Heilung seiner eigenen Krankheit erzielen. Dieser eigentümliche Brauch war der Anlaß zu einem Temariuta, einem Liedchen, das die Mädchen singen, wenn sie beim Handballspiel den Ball mit der Hand hochschlagen:
»Sannō no osaru san wa
Akai o-bebe ga dai osuki,
tete shan, tete shan!«
»Der Herr Affe von Sannō hat ein rotes Kleid sehr gern! Tete shan, tete shan!« Diese letzten Worte bedeuten das Zusammenschlagen der Hände beim Beten; dieses Klatschen hatte wohl ursprünglich den Zweck, die Aufmerksamkeit des Gottes oder seines Abbildes auf sich zu lenken. In dem Spielliedchen ist es in eine launige Beziehung zum Ballspiel gebracht. Schließlich bedeutet das Senryū lediglich, daß der weibliche Affe gern viele Verehrer hat, denn dann wird sein Bebe häufig mit der roten Farbe beschmiert und dann hat er ein rotes Kinderkleidchen (Bebe) an. Das Senryū enthält eben ein nicht übersetzbares Wortspiel, in dem im Japanischen zugleich der Scherz des Verschens enthalten ist.
Beim Shintōtempel von Sannō wurde am 15. Juni ein berühmtes Fest gefeiert, über dessen Einzelheiten unsere Unterlagen keine Auskunft geben; es wird aber wohl seinem Wesen nach zu dem ebenso berühmten Hauptstandbild des Affen in Beziehung gestanden haben. In Tōkyō ist das Fest des Sannō heute noch das bedeutendste der örtlichen Gottheiten.
Jedenfalls bezeichnet man den Koitus mit dem Wort »Roku-gwatsu-no-Jūgonichi«, d. h. der fünfzehnte Tag des sechsten Monats, also der 15. Juni. Wie wir oben gesehen haben, ist auch das Wort »Omatsuri«, das Fest, an sich schon ein Gassenwort für den Koitus. In der folgenden scherzhaften Geschichte ist nun die doppelsinnige Bedeutung der beiden Worte verwertet. Diese Geschichte steht im ersten Band einer Liebeserzählung »Kyōgwai Zokubun Musume Shōsoku« (etwa: Harmloser Austausch von Gesprächen unter Mädchen), verfaßt von Sammonsha Jirakū (Kyoku Sanjin) im siebenten Tempō-Jahr (1836 u. Z.); sie ist in der Form eines Gespräches gehalten:
» Toku (ein Mann): Ach! Du willst also nach Hause gehen! Dann will ich mal die Gasse beobachten!
Ohatsu (seine Geliebte): Aber jetzt kann ich doch noch nicht nach Hause gehen!
Toku: Was soll denn das heißen? Eben sagtest du doch noch, du wolltest heimgehen?
Ohatsu: Gewiß habe ich das gesagt; aber, mein Lieber, da ist doch noch etwas, was du vergessen hast!
Toku: Ach ja! Eine schön verzierte Haarnadel (kanzashi), nicht wahr? Die werde ich dir morgen abend holen!
Ohatsu: Nein, nicht das! Ich sagte doch » etwas«! Du hast etwas vergessen, weil du einen kleinen Schwips hast!
Toku: Nein, nein! Ich bin nicht betrunken! Gi-i-i-pu! (Er rülpst.) Ja, im Wein liegt Wahrheit nur allein, wie ich schon erwähnte, und der Monat und der Tag, und meinem Gedächtnis ist nichts entfallen.
Ohatsu: Ach, was du nicht alles sagst! Spiele doch nicht den Unwissenden! Sicherlich hast du etwas vergessen! Erinnerst du dich denn gar nicht an » jenes Ding«?
Toku: An jenes Ding? Da möchte ich doch gern von dir erfahren, was das ist!
Ohatsu: Ach, weshalb spielst du denn nur den Unwissenden in dieser Weise? Du stellst meine Geduld auf eine harte Probe! Jenes Ding ist eben »jenes Ding«! (Sie zwickt ihn heftig ins Knie.)
Toku: Au! Das tut mir aber weh! Ich habe doch nichts Böses getan, wofür du mich so zwicken müssest!
Onaka: (Die Begleiterin der Ohatsu): Aber Herr Toku! Was ist denn eigentlich los? So kommen Sie doch endlich zu sich! Wenn Fräulein Ohatsu sagt »jenes Ding«, so meint sie eben damit ... den fünfzehnten Juni!
Toku: Den fünfzehnten Juni? Wenn es der fünfzehnte März wäre, dann hätten wir den Gedenktag für Ume-waka! Jawohl! Jawohl! Dann muß der fünfzehnte Juni ein buddhistischer Feiertag sein!
Ohatsu: Weh mir! Es ist doch nicht schön von dir, daß du das nicht verstehen willst! Der fünfzehnte Juni ist doch ein Rätselwort für ein Omatsuri!
Toku: Aha! Jetzt verstehe ich es! Erst legt man mir ein Rätsel vor mit dem Wort »Jenes Ding« und die Auflösung ist dann »der fünfzehnte Juni«, und das bedeutet dann wieder so eine Art »Festordnung«! Das ist ja ganz reizend! Ha-ha-ha-ha! Wissen Sie, Fräulein Onaka, ich bin zwar ein guter Taktschläger, aber der Gesang (kiyari) dieses Mädchens erschallt nach allen Richtungen!
Ohatsu: So, nun ist es heraus! Das ist gelogen! Wenn ich ... Weshalb machst du so spöttische Bemerkungen?«
Kiyari ist der rhythmische Gesang der Arbeiter, wenn sie etwas Schweres heben oder fortbewegen müssen, um ihre Kräfte in bestimmten Augenblicken zusammenzufassen, wie es bei uns Eisenarbeiter und überhaupt alle Schwerarbeiter durch gewisse feststehende Rufe machen. In der Gassensprache gebraucht man kiyari als Abkürzung für »Ki wo yaru«, d. h. den Samen ausspritzen (beim Mann) oder: Orgasmus haben (bei der Frau, wobei aber auch der Nachdruck auf den Absonderungen aus der Scheide liegt). Der Herr Toku verrät also dem Fräulein Onaka die intime Tatsache, daß seine Geliebte Ohatsu sehr starken Orgasmus hat und gewissermaßen nach allen Richtungen »spritzt«. Ohatsu ärgert sich natürlich über diese Taktlosigkeit des guten Taktschlägers und erklärt die Äußerung für eine Lüge. In diesem unerwarteten Schluß liegt der Witz der Geschichte. Ihr Hinweis auf den erwarteten Koitus ist verpufft.
Ki hat in der Umgangssprache mehrere Bedeutungen: Die Wollust, die sinnliche Begierde, wie in dem Ausdruck »Ki wo harasu«, die sinnliche Begierde im Zaum halten. Oder: Der männliche Samen, beziehungsweise: der Orgasmus, wie in den Ausdrücken »Ki ga ikū«, das Ausspritzen des Samens fühlen; »Ki wo yaru,« den Samen ausspritzen, in der oben erwähnten zweifachen Bedeutung.
Der in dem Gespräch angeführte Gedenktag des Ume-waka bezieht sich auf das Kind einer adligen Familie in Kyōto, das von einem Sklavenhändler verschleppt worden war und an einer abgelegenen Stelle des Ufers des Sumidaflusses bei Mukōjima starb. Ein gutmütiger Priester fand die Leiche und begrub sie. Ein Jahr später kam die Mutter des Knaben an diesen Platz, nachdem sie im ganzen Land nach ihrem Kind gesucht hatte. Unter einem Weidenbaum erblickte sie ein niedriges Grab, an dem Dorfbewohner weinten. Als sie nach dem Namen des Toten frug, entdeckte sie, daß es niemand anders war, als ihr eigener Sohn, der ihr in der Nacht als Geist erschien und mit ihr sprach; als aber der Tag graute, war nichts weiter zu sehen, als die wehenden Zweige des Weidenbaumes, und statt der Stimme des Knaben hörte sie nur das Seufzen des Windes. Am 15. März wird heute noch ein Gedenkgottesdienst abgehalten, und wenn es an diesem Tage regnet, sagt das Volk, daß die Regentropfen die Tränen des Ume-waka seien.
Das in dem oben angeführten Spielballiedchen gebrauchte Wort o-bebe ist in der Kindersprache ein Wort für ein Kleidchen, zugleich aber auch ein Gassenwort für den Cunnus; das vorgesetzte O ist die übliche Höflichkeitssilbe. Das ursprüngliche Wort ist Bebe, womit die Kinder ihr Kleidchen bezeichnen, so daß wir in dem Gebrauch von Bebe = Kinderkleidchen für die Vulva ein scherzhaftes Wort vor uns haben. In einigen Provinzen Japans versteht man darunter die Vulva eines kleinen Mädchens, in der Provinz Shinshu (Nagano-ken) bezeichnet es aber den Cunnus einer erwachsenen Frau. In dem Buche »Saezurigusa« (Rauschendes [plauderndes] Gras) von Hayashi Jakuan sagt der Verfasser folgendes hierüber:
»In den Provinzen Okuwu und Hokuetsu oder Owari nennt man die Vulva »Bebe«, obwohl die Leute von Kantō und von Kansai die Kinderkleidchen so nennen und sich gar nichts auffallendes dabei denken. Dagegen bezeichnen nun wieder die Leute von Echigo ein Kind als Bobokko und finden das keineswegs sonderbar.«
Um diese Anspielung zu verstehen, muß man wissen, daß Bobokko in der Sprache des niederen Volkes ganz allgemein den Cunnus bezeichnet. Es ist eine Ableitung von dem ebenso allgemein gebrauchten Wort Bobo, das gar keine Nebenbedeutung hat, also ein vollkommen eindeutiges Wort ist. Die Silbe kko in Bobokko ist lediglich lautlicher Zusatz und hat keinen besonderen Sinn. Mit Bobo werden wir uns noch ausführlich beschäftigen. Bobokko findet im folgenden Senryū Verwendung:
»Bobokko no danjiki wo suru Matsugaoka.«
»Die Frauen des Matsugaoka enthalten sich der Speise,« mit anderen Worten: sie lassen in den geschlechtlichen Beziehungen eine Unterbrechung eintreten. Dieses Senryū hat folgenden Anlaß: Matsugaoka, eigentlich Tōkeiji, ist ein buddhistisches Kloster, das in Matsugoka, Kamakura, steht. In der Yedozeit ist eine gewisse Frau, die nicht mehr mit ihrem Manne zusammen leben wollte, in dieses Kloster entlaufen und hat drei Jahre darin zugebracht. Dann kehrte sie zurück zu ihrem Gatten; nach einer anderen Nachricht ließ sie sich scheiden.
Zu dem Worte Bebe können wir noch das nachfolgende Senryū beibringen:
»Inaka mori Bebe wo kisero ni kyoro kyoro shi.«
»Das Kindermädchen vom Lande verdreht die Augen, wenn ihr gesagt wird: ›Ziehe das Kind an!‹« Sie versteht in ihrer Mundart »Bebe wo kiseru« als »Mach' deinen Cunnus fertig!« und sieht sich ganz aufgeregt um.
Mundartlich wird in der Provinz Tōhoku im nord-östlichen Japan statt Bebe auch Hehe für den Cunnus gebraucht und dieses Wort soll später zu Bebe verderbt worden sein. –
Die Affengottheiten im Buddhismus haben einen bestimmten Tag, der ihrer Verehrung besonders gewidmet ist, das Kōshimmachi, der sogenannte Affentag, dessen Nacht von den Gläubigen schlaflos zugebracht wird. Im Volk herrscht der Aberglaube, daß eine Frau, die in dieser Nacht mit ihrem Manne in demselben Bett schläft und schwanger wird, ein Kind gebären wird, das sich in Zukunft zu einem Dieb oder einem Räuber entwickelt. Aus diesem Aberglauben heraus entstand der Brauch, diese Nacht ohne Schlaf zuzubringen. –
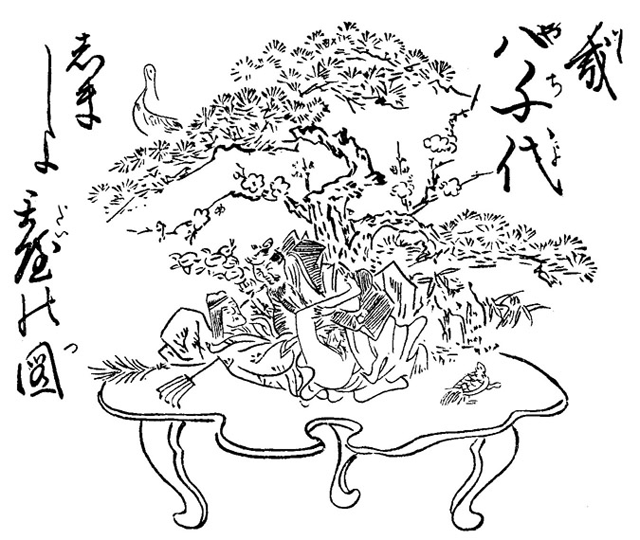
Shimadai.
In den besprochenen alten Standbildern, wie des Jizō und des Affen von Sannō, haben wir in erster Linie wundertätige Bilder zu sehen, die ihr Ansehen dem uralten Glauben an die Zauberkraft des Cunnus verdanken. Diese Zauberkraft äußert sich neben unmittelbaren Wirkungen noch in der Abwehr böser Geister, bei der auch der Phallos wirksam ist, so daß wir auf Amuletten usw. beide Bilder vereinigt finden. Auch den Sinnbildern spricht man dieselbe Kraft zu, und den bereits angeführten Beispielen können wir noch das Shimadai hinzufügen, das namentlich bei ehelichen Anlässen als Wahrzeichen der Keuschheit, des Glückes und des langen Lebens gilt. Shimadai bedeutet wörtlich: das Inselgestell oder der Inseltisch; weshalb gerade die Insel erwähnt wird, war nicht festzustellen, wenn man nicht an eine Legende der glücklichen Insel denken will. Das Shimadai ist ein kleiner Tisch, auf dem Kiefern-, Bambus- und Pflaumenbaumzweige aufgebaut sind, zusammen mit kleinen Figuren von Kranichen und Schildkröten. Die Hauptfiguren sind aber ein altes Ehepaar, im Volksmund als Iō und Uba (der alte Mann und die alte Frau) bezeichnet und als die Geister eines alten Kiefernbaumes erklärt. Besonders bei Hochzeitsfeiern sollen diese Tische Glück bedeuten und Glück bringen. Die Erklärung der Sinnbilder wird kaum nötig sein, da sie als phallisch und cunnisch genugsam bekannt sind. Mit dem Shimadai soll dem jungen Ehepaar Glück und langes Leben, vor allen Dingen aber eine dauernde Freude im Geschlechtsleben bis in das hohe Alter gewünscht werden. Dies kommt in unserer erotischen Abbildung durch die Darstellung eines Koitus des alten Ehepaares sehr deutlich zum Ausdruck. Die japanischen Schriftzeichen sind folgendermaßen zu lesen: »Ikuyachiyo Shimashō Dai no zu,« d. h. »Bild eines Tisches des Laßt-uns-einen-ewigen-Koitus-machen!« Dies ist also die Hauptsache im ganzen ehelichen Leben. Das bei Hochzeiten aufgebaute Shimadai zeigt natürlich die alten Leute nicht in dieser Situation.
Wie diese zwei alten Baumgeister Jō und Uba zu der Rolle kommen, die sie als Glücksbringer bei Hochzeitsfeiern im Shimadai spielen, geht aus einer alten Sage hervor, die sich an zwei aus einer Wurzel hervorgewachsene Kiefernbäume auf der Insel Takasago knüpft. Es wird wohl noch mehr solcher Zwillingsbäume gegeben haben. Folgendes Senryū verwertet den Kiefernbaum in scherzhafter Weise:
»Yarikuri ni Matsuyani wo dasu
Jō to Uba.«
»Während des Koitus lassen Jō und Uba das Kiefernharz fließen.« Yarikuri bedeutet eigentlich: schieben, stoßen und ist im übertragenen Sinne ein Gassenwort für den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau. Das Senryū scheint den Koitus von Jō und Uba in demselben alten Kiefernbaum geschehen zu lassen, wie sich auch der Volksglaube die beiden Baumgeister in einem Baume vereinigt denkt. Dies entspräche ja auch dem Gedanken, den das Shimadai zum Ausdruck bringen will. Und daß das Harz noch bei alten Leuten fließen möge, ist in dem Senryū sehr drastisch zum Ausdruck gebracht.
Inwieweit die nachfolgende Sage zu Jō und Uba in Beziehung steht, ist aus den Unterlagen nicht zu ersehen. Aber ein gewisser Zusammenhang scheint vorhanden zu sein. Die Sage ist aufgezeichnet in dem Buche »Hitachi Fūdoki« (Die Volkskunde von Hitachi):
»Es war einmal ein Jüngling mit Namen Nakasamuta-no-Iratsuko und eine Jungfrau mit Namen Unakamiaza-no-Iratsume. Sie waren beide an ihrem Geburtsorte durch ihre Schönheit bekannt. Diese beiden jungen Leute begegneten einander ganz unvermutet bei einem Kagai und verliebten sich in einander. Während der ausgelassenen nächtlichen Feier (Kagai) gingen sie in einen einsamen Kiefernwald und plauderten dort zusammen bis zum Anbruch des nächsten Tages. Da sie es für unmöglich hielten, jetzt noch zu ihrem alten Platz zurückzukehren oder aber auch in dem Walde zu bleiben, schämten sich beide sehr wegen ihres Verhaltens und verwandelten sich in Kiefernbäume.«
Ein solches Kagai war eine Feier mit Singen im Wechsel mit Musikbegleitung und Tanz; eine Art Tanzball, der in früheren Zeiten bei den höheren Klassen sehr beliebt war. Es handelt sich anscheinend um die letzten Überreste einer Art heiliger Orgien. Deshalb ist es merkwürdig, daß die alte Sage in dem Geschlechtsverkehr der beiden jungen Leute etwas Anstößiges findet; man hatte offenbar den Sinn des Festes, bei dem Ausschweifungen eigentlich selbstverständlich waren, schon längst vergessen. Satow sieht in der Erzählung eine sinnbildliche Erklärung eines Scheidenkrampfes (Vaginismus), bei dem die jungen Leute ihr Leben verloren, weil sie die im Koitus vereinigten Leiber nicht mehr auseinanderbringen konnten. Damit wäre die Verwandlung in einen Kiefernbaum zu deuten; die Sage hebt aber gerade diesen Punkt nicht hervor. Jedenfalls hat die Sage, bis auf das Verwandeln in Kiefernbäume, sozusagen jedes Übernatürliche fallen lassen, das den alten Baumgeistern Jō und Uba immerhin noch anhaftet. Daß diese beiden einmal zum eigentlichen Geschlechtsleben in enger Beziehung gestanden haben, könnte man aus den Namen schließen: Uba ist auch die Amme.
Das Kagai, als Überreste heiliger Orgien aufgefaßt, könnte damit zugleich als Erinnerung an das »goldene Zeitalter« erklärt werden, an jene glücklichen Tage, bei denen auch der regellose Geschlechtsverkehr zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehörte. Die letzten Spuren solcher Sitten finden wir in dem Kagai-no-Matsuri, auch Kakai-no-Matsuri genannt, das früher auf dem Tempelgebiet von Tsukuba-Myōjin des Tsukuba-san, eines Berges der Provinz Hitashi, gefeiert wurde. Kagai-no-Matsuri heißt: das Fest des Kagai und mit diesem Worte Kagai scheint man eine ganz bestimmte Vorstellung verbunden zu haben, die aus der nachfolgenden Ode (Satows Bezeichnung) hervorgeht. Diese Ode wird als außerordentlich alt bezeichnet; wir geben sie nach der englischen Übersetzung in Murray's Handbook of Japan wieder:
»Wo so viele Adlerweibchen ihr Nest bauen,
Auf Tsukubas Bergeshöhen,
Da versammeln sich Männer und Maiden,
Und dieses Lied singen sie zusammen:
›Ich bin willens um deine Liebste zu werben!
Dafür kannst du meine auch nehmen und lieben!
Denn die Götter, die auf diesem Berge thronen,
Werden niemals diesen uralten Brauch verleugnen:
So schließ deine Augen für heute wenigstens
Und tadle nichts, wie wir auch miteinander scherzen!‹«
In diesem alten Lied ist alles gesagt, was wir bei diesem Fest nach der Sage von den beiden Liebenden, die in Kiefern verwandelt wurden, vermuten konnten. Aber diese Sage enthält vielleicht doch noch etwas, woran man zunächst nicht denkt: Die beiden Liebenden haben sich durch ihre Absonderung von der Gruppe der Feiernden eines Verstoßes gegen die alte Sitte, die nach dem Liede unter der Aufsicht der Berggötter steht, schuldig gemacht und sind deswegen mit der Verwandlung in Kiefernbäume bestraft worden. Denn die alten Berggötter, wohl ursprünglich Baumgeister und damit Fruchtbarkeitsdämonen, rächen sich für Verletzungen ihrer Bräuche, die ja heilige Handlungen zu ihrer Verehrung waren, sie aber gleichzeitig günstig stimmen sollten. Auf dieser Anschauung beruhen viele Sagen aus allen Gegenden der Erde. Daß heute diese alte Feier verschwunden, mit andern Worten, unterdrückt worden ist, läßt sich begreifen, wenn man an die ungeheuer rasche Anpassung der Japaner an die »westliche Gesittung« denkt.
Das Laternenfest, Urabon, Urabon-e, Urabon-gue, oder kurz Bon genannt, ist heute gewissermaßen ein Fest der abgeschiedenen Geister, die ihren Angehörigen jedes Jahr in der Mitte des siebenten Monates einen Besuch abstatten, der als das wichtigste Ereignis des Monates betrachtet wird. Dieses Fest hat jedoch so viele alte Züge aufbewahrt, daß man ohne weiteres erkennen kann, daß es sich ursprünglich um ein Fruchtbarkeitsfest oder einen Fruchtbarkeitszauber gehandelt haben muß. Früher empfing man gewiß in dieser Zeit die Fruchtbarkeitsgeister, heute sind es die Familiengeister. Aber zum festlichen Empfang dieser Gäste hängt man am Hausaltar Guirlanden von Fadennudeln auf, an die man Hirseähren der verschiedenen Arten und getrocknete Früchte anheftet, während man um den Altar eine kleine Hecke von der japanischen Zeder, der immergrünen Kryptomerie, aufstellt. Am 13. Juli abends verbrennt man Hanfstengel in einem irdenen Topf am Haustor, weil man glaubt, daß dann die Geister die Wohnung betreten. Am 14. Juli bringt man am Hausaltar Opfergaben dar und manche lassen einen Priester kommen, der Gebete hersagt. Am Abend des 15. Juli endigt der Besuch der Hausgeister und man verbrennt wieder Hanfstengel, angeblich, um die Geister zur Eile anzutreiben. An diesem Feuer der Hanfstengel stecken die Leute ihre Pfeifen an und rauchen sie als Abwehrzauber gegen Mundkrankheiten; sie schreiten über die glühende Asche, um sich gegen alle Krankheiten der unteren Körperteile zu schützen. Das Ganze ist also ein Erntezauber und Abwehrzauber gegen böse Geister, die irgendwie und irgendeinmal zu den Geistern der Vorfahren in Beziehung getreten sind. Aber die ganze alte Aufmachung ist verdächtig, und das Räuchern mit Hanfstengeln sieht das erstemal nicht nach Begrüßung aus und beim Abschied kann man fast von einem Hinauswerfen reden. Hier schimmert das Vertreiben der bösen Geister noch deutlich durch. Daß es sich früher nicht um die Familiengeister gehandelt hat, zeigt das heute fast ganz ausgestorbene Bon-odori, das Tanzen am Bon-Fest, das am Abend des 15. Juli früher allgemein stattfand und heute wohl nur noch in abgelegenen Gegenden ausgeführt wird. In früheren Zeiten versammelten sich an diesem Abend beide Geschlechter, alt und jung, an bestimmten Plätzen und sangen zu ihren Tänzen bestimmte Lieder, die Bon-odori-uta, die Bontanzlieder. Leider sind wir über die Art dieser Lieder und die Art der Tänze nicht unterrichtet, dafür steht aber fest, daß an diesem Abend eine gewisse Geschlechtsfreiheit herrschte, so daß Burschen und Mädchen, die einander gefielen, still in den Büschen verschwanden und geschlechtlich miteinander verkehrten. Das nannte man »Bon-Bobo«, Geschlechtsverkehr am Bon-Feste. Es sind gewiß Überreste früherer Orgien oder ritueller Beischlafshandlungen, denn das Bon-Bobo war in seiner abgeschwächten Form eine »alte Sitte«.
In der gleichen gemilderten Form haben sich noch andere Feste erhalten, die man ohne weiteres als Fruchtbarkeitszauberhandlungen erkennt und die auch die Überlieferung noch als solche betrachtet, obgleich die urtümlichen Züge verschwunden sind.
Beim Jinja (Shintōtempel) von Iwakura in der Provinz Kyōto wurde am Vorabend des fünfzehnten September eine Feier abgehalten, bei der man die jungverheirateten Frauen des Dorfes zusammensuchte. Sie mußten auf dem Tempelgebiet in ihren Hochzeitskleidern erscheinen und trugen auf dem Kopfe die Dinge, die den Göttern geopfert werden sollten. Sobald diese jungen Ehefrauen das Tempelgebiet betraten, schlugen die jungen und alten Dorfbewohner ihnen mit Baumzweigen auf die Hüften (Hinterbacken). Die Frauen liefen hin und her und suchten sich den Streichen der Auspeitscher zu entziehen, während die Dorfbewohner ihnen nacheilten und sie auf die Hüften schlugen. Nach der Meiji-Ära hörte dieses Fest auf. In alten Zeiten wurde ein solches Fest auch beim Iseheiligtum zu Ise in der Provinz Settsu abgehalten; dort nannte man es »Yome tataki«, das Brautschlagen. Es wurde im Januar gefeiert.
Im nordöstlichen Teil von Japan wird eine ähnliche Feier am 15. Januar auf dem Tempelgebiet des Dōsoshin, eines zweifellos phallischen Gottes, abgehalten. Der Stock, den man an diesem »heiligen Abend« verwendet, heißt »Hoitake Bō«, der Phallos-Stab. Satow hält diese Feier für das Überbleibsel des »Kayu Tsue« (der Stock, mit dem man dünnen Reisbrei umrührt). In alten Zeiten war es Brauch, die Hüften der Frauen mit diesem Stock zu schlagen, wenn man sie durch einen solchen Zauber fruchtbar machen wollte. Nun wurde dieses »Kayu Tsue« auch »Kayu no Ki« genannt, d. h. Holz, das man braucht, wenn man dünnen Reisbrei macht; dieses Kayu no Ki ist aber das Feuerholz, das man am fünfzehnten Januar verwendet, um das Kayu, den dünnen Reisbrei, zu kochen. Dieses Feuerholz schneidet man zu einem Stab zurecht, wenn das Kayu gekocht worden ist. Es herrscht der Aberglaube, daß eine Frau ganz gewiß mit einem Knaben schwanger wird, wenn man mit einem solchen Stab auf ihren Leib schlägt. In der Yedo-Zeit gehörte die Ausübung des Kayu Tsue-Brauches zu den regelmäßigen Verpflichtungen des kaiserlichen Hofes. Der Kaiser hat als Sohn des Himmels durch einen Schlag mit dem Phallos die Frauen fruchtbar gemacht. Daß man dazu das angebrannte Holz nahm, mit dem man den Reisbrei gekocht hatte, ist wohl ein alter Überrest aus vergangenen Zeiten gewesen, in denen man zunächst in dem Reiskochen an dem Festabend die Hauptsache sah. Das phallische Aussehen der Äste mag dann die Veranlassung gewesen sein, daß man die angebrannten Stöcke zurechtschnitt und phallosähnlich machte. Inwieweit noch der Glaube an die durch das Feuer gereinigte Kraft der Baumzweige oder die Macht des Baumgeistes selbst hier hereinspielt, ist heute nicht mehr aufzuklären. Jedenfalls zeigt die Bezeichnung des heute verwendeten Stockes als »Phallosstab« deutlich, daß der alte Glaube noch fortlebt.
Eine eigentümliche Abänderung der fruchtbarmachenden Schläge hat dieser Brauch im Shimotodachi no Matsuri, im Fest des Auspeitschens, gefunden, das auch etwas deutlicher als Shiri-Uchi-Matsuri, das Fest, an dem die Hüften (eigentlich: der Hintere) geschlagen werden, bezeichnet wird. Es fand beim Usakajinja, dem Shintōtempel von Usakamura, Fukigun, Toyamaken in der Provinz Etchū, statt, und zwar am 23. Juli des alten Mondkalenders in früheren Zeiten; heute wird es am 16. Juni abgehalten. Früher wurden an diesem »Feste« die Hüften (der Hintere) derjenigen Frauen geschlagen, die während des vergangenen Jahres unerlaubten Geschlechtsverkehr gehabt hatten. Die Schläge wurden von der Hand des Negi ausgeteilt, eines Shintōpriesters der zweiten Klasse oder zweiten Ranges, der mit der Überwachung der nationalen Heiligtümer beauftragt war. Die Anzahl der Schläge richtete sich nach der Anzahl der Fehltritte der Frau; es scheint also eine Art Beichte vorausgegangen zu sein. Der Brauch hat heute aufgehört; statt dessen schlägt man mit dem Stock auf das Hinterteil eines heiligen Pferdes, das an die Stelle des Hintern der Frauen getreten ist. Man nennt dieses Fest, das man eigentlich als einen Sühnebrauch bezeichnen muß, auch nach dem Tempel »das Usaka-Fest« schlechthin. Wie aus dem Schlag mit der »Lebensrute« eine Strafe für Ehebrecherinnen geworden ist, wird nicht leicht zu erklären sein. Man könnte in diesen Schlägen allenfalls eine Lossprechung von den »Sünden« sehen, womit für die Frau die Angelegenheit erledigt war. –
Daß man sich Eigenschaften der Geister oder Kobolde durch Erlernen aneignen könne, war eine abergläubische Meinung des Volkes. Ein solcher Zauberer, von dem das Volk anscheinend sehr viel wußte, war Kume Sennin, der Genius Kume, auch Kume no Sennin oder manchmal abgekürzt Kume-sen genannt. Der Sennin ist ein Wesen der Einbildungskraft, dem man geheimnisvolle Kräfte zuschreibt, durch die er in den Himmel fliegen kann. Der Überlieferung nach scheint Kume eine Art Faust gewesen zu sein. Er war zu Soegami in der Provinz Yamato geboren und lernte die Künste eines Sennin tief drinnen in den Bergen. Mit diesen geheimen Künsten konnte er Tote auferwecken, auf der Luft reiten usw. usw. Während er eines schönen Tages auf der Luft umherritt, sah er eine hübsche Frau, die im Yoshinogawa, einem Fluß des Bezirks Yoshinogame in der Provinz Yamato, ihre Kleider wusch. Während des Waschens ließ sie ganz unbekümmert ihre weißen Schenkel sehen. Kume guckte ganz neugierig nach diesen Schenkeln, verlor dabei seine geheimnisvollen Kräfte und fiel aus der Luft herunter. Er soll dann diese Frau geheiratet haben und lebte mit ihr friedlich bis ans Ende seiner Tage. Das Bild ist dem Buch »Kaidan Hana no Kumo« (etwa: Ausgesuchte Gespenstergeschichten) entnommen.

Kume Sennin.
Aus dieser Volksüberlieferung entstand das Gassenwort »Kume-sen« oder »Kume-no-sennin« für einen liederlichen, unzüchtigen Menschen. In einem Volksliede heißt es darüber:
»Asa no nemaki de nomi toru sugata
Kume no sennin shinu darō.«
»Wenn ihre Gestalt morgens früh, wenn sie im Nachtgewand einen Floh fängt, vom Genius Kume neugierig betrachtet wird, dann muß er sicherlich auf der Stelle sterben.« Und ein Senryū beschäftigt sich mit dem oben erwähnten Mißgeschick des Kume in folgender Weise:
»Sennin mo Furusato wo
Boji gataku ochi.«
»Selbst ein Sennin konnte seine Geburtsstätte nicht vergessen und fiel vom Himmel herunter.« Furosato bedeutet Heimat im Sinne des Ortes, wo jemand geboren ist. Damit ist dieser Begriff der Geburtsstätte, Furusato, zu einem Gassenwort für den Cunnus geworden. Daher sagt ein Senryū ganz deutlich:
»Furusato wa mina
Kusa bukai tokoro nari.«
»Gewöhnlich ist die Geburtsstätte des Menschen eine sehr haarige Gegend.« Der Scherz liegt darin, daß »mina Kusa« »mit viel Gras bewachsen« bedeutet, in der Gassensprache »Gras« aber die Schamhaare der Frau bezeichnet. Wir werden dem Wort Kusa noch in anderen Senryūs begegnen.
Etwas, das in der Sage und in den zwei ersten Senryūs sehr deutlich in die Erscheinung tritt, obwohl es nicht ausgesprochen ist, weil der Gedanke wahrscheinlich den Verfassern der Senryūs nicht mehr geläufig war und sie sich an die Erzählung vom Zauberer Kume hielten, das ist die Zauberabwehrkraft des Cunnus. In der Sage ist zwar nur von den weißen Schenkeln der waschenden Frau die Rede; wenn wir uns aber die Haltung der Frau vorstellen, die am Flußufer kniet und ihr Kleid über den Rücken geschlagen hat, um es nicht naß zu machen, so werden wir begreifen, daß Kume neben den weißen Schenkeln noch den Cunnus gesehen hat. Und die Abwehrkraft des Cunnus war stärker, als die geheimnisvollen Kräfte, so daß Kume aus der Luft herunterfiel. Im ersten Senryū oben bringt der Anblick des Cunnus dem Kume no sennin sogar den Tod, denn das Nachtgewand ist weiter nichts als ein loser Umhang, der gewiß nicht ohne Absicht erwähnt ist, um die unvermeidliche Entblößung begreiflich zu machen. Das zweite Senryū zeigt aber ganz deutlich, um was es sich handelt, wenn Kume durch seinen Anblick vom Himmel herunterfiel. Dem Verfasser schwebt allerdings ein anderer Gedankengang vor, denn er will anscheinend die Sehnsucht nach der irdischen Heimat zum Ausdruck bringen, da ihm von der Zauberkraft des Cunnus nichts mehr bekannt war. Für ihn scheint aus der Zauberabwehrkraft eine Anziehungskraft geworden zu sein. –
Ein bösartiger Geist, der nur in einer bestimmten Weise dem Menschen schadet, ist der Kamikiri, der Haarabschneider. Das plötzliche Ausfallen des Haares, genau unter dem Schopf auf der Mitte des Kopfes, wird im Volke übernatürlichen Einflüssen zugeschrieben. In dem Buche »Shokoku Rijin Dan« (Volkserzählungen aus verschiedenen Gegenden) steht folgendes:
»Beim Beginn der Genroku-Zeit (1688–1703) wurden Leute, die nachts auf den Straßen gingen, sehr häufig vom Kamikiri angegriffen und Männer und Frauen sahen ihr Haar genau in der Form, wie es zuvor auf ihrem Kopfe war, nun zu ihren Füßen liegen. Sie wußten nicht, wann es ihnen abgeschnitten worden war. Es wird uns berichtet, daß sich dieser wunderbare Vorgang in verschiedenen Provinzen ereignete. In Yedo hatten einige Leute ihr Haar durch den Kamikiri verloren und namentlich zu Matsukaka in der Provinz Ise kam es sehr häufig vor.«
Was sich da ereignet hat, wenn der Bericht wirklich zutreffend sein sollte, können wir heute nicht mehr beurteilen. Es müßte sich um eine Art Zopfabschneider gehandelt haben, die den bösen Geist spielten. Heute glaubt man nicht mehr an den Kamikiri; das Wort bedeutet im übertragenen Sinne eine Witwe, die sich das Haar abschneidet und es kurz trägt, wenn ihr Gatte gestorben ist; dies gilt als ein Zeichen, daß sie keusch bleiben will. –
Ein alter Aberglaube, den wir bei vielen Völkern treffen, ist der von doppelgeschlechtlichen Wesen. Teils liegen ihm Sagen über die Entstehung des Menschen zugrunde, teils wird man wohl an wirkliche Mißgeburten angeknüpft haben, die ja für den Menschen immer etwas Unheimliches gewesen sind. Auch das Wechseln des Geschlechts, an den das klassische Altertum glaubte, hat man in Japan für möglich gehalten und die Einbildungskraft des Volkes hat sich im Futanari ein solches Wesen geschaffen. Futanari bedeutet wörtlich: zweierlei Gestalten oder zweierlei Aussehen; medizinisch werden die Zwitter so genannt. Aber das Volk glaubt, daß der Futanari die Geschlechtsteile beider Geschlechter besitzt. Dieser Aberglaube wird in dem Buche »Hitori-ne« (Wenn du allein schläfst, d. h. dann kannst du dieses Buch lesen; wörtlich: Alleinschlafen) des Ryū-Rikyō so erklärt, daß ein solcher Futanari sein Geschlecht halbmonatlich wechselt, so daß er in der ersten Hälfte des Monats männlich ist und einen Penis hat, und in der zweiten Hälfte des Monats weiblich aussieht und eine Vulva hat. Deshalb nennt man ein solches Wesen auch Hangetsu, d. h. halbmonatlich, oder Haniwari, ein halber Monat. Daß das Volk aber auch wußte, daß es Menschen gibt, über deren Geschlecht man zweifelhaft sein konnte, zeigen die folgenden Liedchen und ein Senryū:
»Futunari no Wakashu ni Seki no hito hyōgi.«
»Die Grenzwächter hielten eine Beratung ab, als sie einen jungen Mann herausgefunden hatten, der ein Futanari war.« In der Yedo-Periode war bei Hakone eine Schranke oder ein Schlagbaum, an dem die Grenzwächter die Reisenden durchsuchten und durch Aufheben der Kleider eine körperliche Besichtigung vornahmen, um festzustellen, ob sie einen Mann oder eine Frau vor sich hatten. In einem »Kocha-ē Bushi« (Kocha-ē-Lied; Kocha-ē ist ein Ausruf der Überraschung, des Schmerzes oder der Angst) wird darüber gescherzt:
»Noboru Hakone no Osekisho de chotto makuri,
Wakaishi mo mono dewa uketoranu;
Kocha Onna ja naika to chotto Mishima.
Kocha-ē! Kocha-ē!«
»An der Schranke von Hakone, durch die wir hindurchgehen, mußt du dein Kleid etwas in die Höhe heben! Das Dingelchen eines Jünglings ist nicht sehr wichtig. ›Du bist doch nicht etwa eine Frau?‹ sagt der Grenzwächter und wirft einen Blick darauf. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott!« Hierbei muß man selbstverständlich an die altjapanische Kleidung denken, bei der auch die Männer weite, schlafrockähnliche Gewänder tragen, die durch einen Gürtel zusammengehalten werden. Da in diesen Gewändern keine Taschen waren, wird der oberhalb des Gürtels befindliche Teil des Gewandes zum Aufbewahren aller Gegenstände benutzt, die man bei sich führen wollte. Das Aufheben der Gewänder hatte doch wohl in erster Linie den Zweck festzustellen, ob in dem großen Bausch oberhalb des Gürtels nichts geschmuggelt wurde. Dies wäre nach Art der Kleidung auch bei Frauen möglich gewesen. Es konnte sich aber auch darum handeln, verkleidete Verbrecher festzustellen. In einem »Komuro Bushi« (ein Lied aus Komuro) heißt es über dieses Lösen des Gürtels:
»Hakone nā, Hakone bansho de, yare, yare,
Obi toke toke to yō;
Daite nā, daite neru ki ka, yare, yare.
Seki no toga yō.«
»Ihr wißt ja, in Hakone, an der Schranke von Hakone! Gott, steh mir bei! ›Den Gürtel auf! Den Gürtel auf!‹ Um mich zu umarmen, nicht wahr? Hat er (der Grenzwächter) die Absicht, mich zu umarmen und mit mir ins Bett zu gehen? Gott, steh mir bei! Das wird ein Verbrechen des Grenzwächters geben!« Diese Grenzwächter scheinen in keinem guten Geruch gestanden zu haben und ließen sich anscheinend manche Übergriffe zuschulden kommen.
In früheren Zeiten gab es in Japan viele solcher Sekishos, eigentlich Grenzwachen, an denen Wächter die Personenausweise prüften. Da bei der fast gleichen Kleidung leicht eine Verwechslung von Männern und Frauen möglich war, namentlich, wenn z. B. Verbrecher dies beabsichtigten, so wurden anscheinend Plätze, an denen große Menschenansammlungen stattfanden, wie bei Tempelfesten usw., besonders scharf beaufsichtigt. So sagt ein Senryū über das berühmte Ise-Heiligtum:
»Gorishō wo sekisho de miseru
Ise maeri.«
»Der Pilger zum Ise-Schrein zeigt an der Schranke seinen Penis vor!« Der Witz liegt darin, daß dieser Pilger wegen geschlechtlichen Unvermögens zum Ise-Tempel geht, wo er Heilung sucht, da gerade dieser Tempel einen großen Ruf in geschlechtlichen Dingen hatte. Das Senryū bringt also folgenden Gedanken zum Ausdruck: »Das Vorzeigen des Penis an der Schranke wird dir nicht viel helfen, denn beim Grenzwächter bist du ja nicht beim Priester des Ise-Schreines!«
Statt Futanari sagt man auch »Omechin« in der Umgangssprache, d. h. einer mit männlichen und weiblichen Geschlechtsteilen, wörtlich: eine Zumptfrau. Chin ist ein sehr beliebtes Wort für den Penis, kommt aber für sich kaum vor, weil es hauptsächlich der Kindersprache angehört und infolgedessen allen möglichen Abwandlungen unterworfen wird. Weiteres hierüber in dem Abschnitt »Der Penis im Volksmund und im Schrifttum«. –
Die Schlange ist auf der ganzen Erde als Sinnbild verwendet worden und fast immer als etwas Penisähnliches, auch als der Penis selbst angesehen worden. Für diese Anschauung findet sich in Japan kein unmittelbarer Beweis, obwohl in dem folgenden Sprichwort doch eine Andeutung enthalten ist, daß die Schlange zu Frauen in Beziehungen tritt.
»Hebi no ana e onna ga shoben suru to mikomareru.«
»Wenn die Frau auf die Höhle einer Schlange pißt, dann wird sie von der Schlange besessen werden.« Satow hat mehrere Berichte gesammelt, in denen ernstlich behauptet wird, daß Bauernmädchen von Schlangen besessen worden sind. Es wird angegeben, daß Bauernmädchen, die nach schwerer Feldarbeit ein Schläfchen machen, um ihre Müdigkeit los zu werden, manchmal träumen, daß ihnen eine kleine Schlange zwischen die Schenkel kriecht. Wenn sie davon plötzlich wach werden, merken sie, daß der größere Teil des Schlangenleibes in ihrer Vagina verborgen ist, so daß man von außen nur die Schwanzspitze sehen kann. Man hat verschiedene Verfahren ausgedacht, um die Schlange aus dem Leibe einer solchen Frau herauszuholen. Bei einem dieser Verfahren spaltet man den Schwanz der Schlange in zwei Teile, streut dann einige Früchte des Sanshō, des japanischen Pfefferstrauches (Xanthoxylon japonicus) dazwischen, dann wird die Schlange wegen der Schmerzen aus dem Vaginalgang herauskriechen. Man kann aber zum Entfernen der Schlange auch das auf dem Lendentuch der Frauen aufgenähte kleine Tuchstück benutzen, das ganz leicht befestigt ist, so daß man den Bindfaden ohne weiteres herausziehen kann. Dieses Tuchstückchen wickelt man um den Schwanz der Schlange, bindet es rasch mit dem Bindfaden fest, dann kann man damit die Schlange, die in die Vagina gekrochen ist, ganz langsam herausziehen.
Ein uraltes Fest, dessen eigentlicher Sinn anscheinend verloren gegangen ist, wurde beim Tsukuma Jinja (Jinja = Shintō-Tempel) zu Tsukuma in der Provinz Omi gefeiert, und zwar zu Ehren des Miketsu- no-kami (des Gottes der Küche). Bei dem feierlichen Umzug an diesem Fest gingen alle Frauen des Bezirks hinter dem mikoshi (der Sänfte mit dem tragbaren Tempelchen) her, wobei sie auf dem Kopf Töpfe oder Pfannen trugen, deren Anzahl sich nach der Zahl ihrer Ehen richtete, d. h. so oft sie verheiratet gewesen waren. Daher hatte das Fest, das sonst nach dem Namen des Ortes »Tsukuma-no-Matsuri«, das Fest von Tsukuma, hieß, auch die Bezeichnung »Nabe-kamuri-no- Matsuri«, das Fest, bei dem man Pfannen auf dem Kopf trägt, erhalten. Heute tragen die Frauen aus Papier nachgemachte Töpfe oder Pfannen auf dem Kopfe. –
Im folgenden wollen wir einiges zur Sage von der Fraueninsel beibringen. Diese Fraueninsel heißt im Japanischen Nyogo-no-Shima, was »die weibliche Insel« bedeutet. Diese sagenhafte Insel wird nur von Frauen bewohnt. Nach der Überlieferung des Volkes klettern die Frauen dieser Insel auf einen Felsen in der Nähe der Meeresküste und werden hier schwanger, indem sie ihren entblößten Cunnus dem Südwind aussetzen. In dem Buche »Nyogo-no-shima Ko« (Eine Untersuchung über die Fraueninsel) ist angegeben, daß diese Insel Hachi-jo-jima in der Provinz Izu ist, da diese Insel diejenige Gegend sei, in der die Frauen die Herrschaft führten. Von dem befruchtenden Südwind abgesehen, gibt es noch eine Volksüberlieferung, die sich ganz an die Wirklichkeit hält. Man erzählt sich nämlich, daß auf der Fraueninsel Nyogo-no-Shima die Zōri, die in Japan üblichen Strohsandalen, von den Inselbewohnerinnen nahe an die Meeresküste gestellt wurden, damit sie sich unter den Schiffbrüchigen einen Gatten suchen konnten. Denn der Mann, der die Strohsandalen, die einer bestimmten Frau gehörten, angezogen hatte, war nach dem alten Brauch der Insel gezwungen, diese Frau zu heiraten. Dieser Brauch kommt heute noch auf den Lu-tschu-Inseln (Riu-kiu-Inseln) vor; deshalb nehmen neuzeitliche Folkloristen an, daß das sagenhafte »Nyogo-no-shima«, die Fraueninsel, eine Insel der Lu-tschu-Gruppe gewesen ist. Die Volksüberlieferung scheint sich allerdings nicht darum zu bekümmern, daß auf der Insel ohne Männer durch die Schiffbrüchigen, die sich mit den Frauen verheirateten, doch fortwährend Männer auf der Insel gewesen sein müssen. In der grotesken Bilderreihe sehen wir allerdings, daß für gewöhnlich keine Männer auf der Insel gewesen sind, da die ihren Frauen entlaufenen Männer froh sind, wieder heimzukehren, weil die Bewohnerinnen der Fraueninsel zu hohe Anforderungen an ihre Manneskraft stellen.
Die oben erwähnten Zōri, die Strohsandalen, sind nicht zufällig in die Geschichte der Fraueninsel verflochten worden. In alten Zeiten wurde auf der Insel Hachijō-jima, die manche nach der obigen Angabe für die Fraueninsel halten können, eine solche Strohsandale als eine Art Liebesbrief verwendet; weil die meisten Frauen nicht schreiben konnten, setzt der vernünftelnde Erklärer hinzu. Wenn ein Mann einer Frau seine Liebe erklären wollte, dann schickte er ihr eine kleine Strohsandale, die in Papier eingewickelt war, das man mit verschieden gefärbten Fäden zugebunden hatte. Nimmt die Frau die Werbung an, dann behält sie die Strohsandale. Wenn sie mit dem Liebhaber nichts zu schaffen haben will, schickt sie die Strohsandale dem Absender zurück.
Da diese Strohsandalen klein hergestellt werden, also nicht für den Gebrauch bestimmt sind, kann es sich nur um Sinnbilder handeln. Schedel berichtet, daß in Matsugaharamura (das Dorf mit dem Bild des Phallos an der Kiefer?) ein Teil der Wurzel eines Matsu (Kiefer) beim Tempel des Hachiman (der Kriegsgott) eine phallosähnliche Gestalt hat, ebenso der Stumpf eines Astes. Dieser Zufälligkeit scheint der Baum ein besonderes Ansehen zu verdanken, denn Pilger hängen Votivtäfelchen an ihm auf und legen phallosartig gestaltete Steine nieder. Auch Waragi (das sind Zōri, Strohsandalen) findet man dort aufgehängt. Die Gottheit, die man hier in dieser Gestalt (also als Phallos) verehrt, heilt nach dem Volksglauben Gonorrhoe, Lues usw. In derselben Provinz steht noch eine zweite Kiefer, die ebenso verehrt wird. Wenn der Phallos von Männern niedergelegt wird, die an einer Geschlechtskrankheit leiden, dann dürfen wir annehmen, daß die Strohsandalen von Frauen aufgehängt worden sind. Das beweist deutlich, daß es sich um ein Sinnbild des Cunnus handelt und damit wären die Strohsandalen auf der Fraueninsel und auf der Insel Hachijo-jima zwanglos erklärt.

Engi.
Ein Zeichen von guter Vorbedeutung war das Engi, die Nachbildung des männlichen Gliedes aus Papier oder Ton. Engis wurden früher am Neujahrstag auf den Straßen verkauft, meistens mit Zuckerwerk gefüllt und die Verkäufer trugen, wie wir oben gesehen haben, meistens die Maske der Okame, die ebenfalls als glückbringendes Zeichen galt. In den Häusern der Freudenmädchen wurden diese Engis auf dem Engi-dana, dem Wandbrett des Glückes, aufgestellt und, wie man sagt, als glückbringendes Zeichen verehrt. Es ist zu vermuten, daß trotz des fast sechzigjährigen Kampfes der Behörden gegen den Phalloskult solche Engis heute noch, wie auch in den Bürgerhäusern, in den Häusern der Freudenmädchen nach altem Brauche aufbewahrt werden.
Heutzutage hat man das Engi durch das Matsutake oder Matsudake, den Pilz, ersetzt, aber immer noch heißt das Glückszeichen »Engi-no-Matsudake«, das wir deutsch sehr gut mit »Glückspilz« wiedergeben können. Es ist jedenfalls kein Zufall, daß der Pilz an die Stelle des Phallos getreten ist, denn das Matsudake ist seiner Gestalt nach phallos-ähnlich und dieser Pilzname war schon längst ein Gassenwort für den Penis. Es wird sogar erzählt, daß auf dem Lande die Bauersfrauen und Mädchen diesen Pilz, wenn er noch jung ist, zur einsamen Selbstbefriedigung benutzen. Im Volke wird behauptet, daß bei einem jungen Pilz, sobald er in die Scheide eingeführt wird, durch die innere Hitze der Kopf sehr bald angeschwollen ist und die Frau eine große Befriedigung davon hat. Aber bei der Sache ist auch eine unangenehme Seite, wenn nämlich die Zeit kommt, daß das Matsudake herausgezogen werden soll. Dann geht der Kopf oft von der Wurzel ab und bleibt im Scheidenkanal stecken. Diese Angabe sieht aus, als ob sie eine Warnung vor dem Gebrauch des Pilzes sein sollte, um von der Selbstbefriedigung abzuhalten. Denn die Verwendung des Matsudake scheint allgemein bekannt zu sein, selbst bei jungen Mädchen, wie aus der folgenden scherzhaften Erzählung hervorgeht:
»Die Tochter eines gewissen Gemüsehändlers sagte eines schönen Tags zu ihrer Mutter: ›Mama, dieser Pilz ist doch gewiß sehr frisch?‹ Die Mutter antwortete: ›Ja, das ist ein sehr guter Pilz! Ein Pilz, der so frisch ist, tut nicht Ochin!‹ (d. h. läßt den Kopf nicht abfallen). Da lachte die Tochter ›Hahaha!‹ und sagte: ›Ja, so ist es! Du hast von Ochin gesprochen; daran dachte ich gleich, da er ja eine ihm so ähnliche Gestalt hat.‹«
Ochin ist eine Abkürzung von Ochinchin und wird in der Kindersprache als Wort für den Penis gebraucht. Der Witz der Erzählung beruht also auf dem Wortspiel mit Ochin (nicht fallen lassen) und der Tochter fällt beim Gleichklang der beiden Worte ein, wozu der penisähnliche Matsudake dienen kann; die Warnung vor der Benutzung des Pilzes, weil der Kopf abfallen kann, war ihr jedenfalls auch geworden.
Noch scherzhafter ist die Verwendung des Matsudake in der folgenden Erzählung, die zugleich ein Beweis dafür ist, mit welcher Unbefangenheit eine Mutter mit ihrer Tochter über geschlechtliche Dinge spricht. Das Geschichtchen ist überschrieben »Rakugaki«, d. h. Kritzeleien auf Mauern und Wänden, die bekannten »Wandmalereien« der Kinder, in der Folklore »Grafitti« genannt. Zwischen Mutter und Tochter wickelt sich folgendes Gespräch ab:
»Mutter! Da hat jemand ein Matsudake an die Wand gekritzelt!«
»Aber, liebes Kind! So etwas darfst du doch nicht sagen! Du sollst dich schämen! Nimm einen Putzlappen und reibe es rasch wieder ab!«
Nach einigen Minuten berichtet das Mädchen: »Mutter! Mutter! Da hat schon wieder einer ein großes Matsudake an die Wand gekritzelt!«
»So etwas darfst du aber nicht so laut sagen,« erwidert die Mutter, »die Nachbarn lachen dich ja aus, wenn sie es hören! Reibe es ganz still ab!«
Wenige Minuten später rief das Mädchen wieder: »Mutter! Mutter! Mutter! Aber diesesmal sehe ich ein ganz großes Matsudake, das über die ganze Wand hingekritzelt ist! Komm her und besieh dir es einmal!«
Da sagte die Mutter zu ihr: »Du bist doch ein ganz törichtes Mädchen! Du bist doch alt genug, um von solchen Dingen etwas zu verstehen! Weißt du denn nicht, daß ein Matsudake jedesmal größer wird, wenn man es reibt?«
Man kann es wirklich als unbefangen bezeichnen, daß die Mutter bei ihrer Tochter solche Kenntnisse in geschlechtlichen Dingen voraussetzt, nicht allein, daß man den Matsudake zur Selbstbefriedigung benutzt, sondern daß man auch beim menschlichen Penis das gleiche erreichen kann, wie bei einem eigentlichen Matsudake. Das Scherzhafte liegt aber auch darin, daß wir im unklaren darüber gelassen werden, was denn der Jemand eigentlich an die Wand gekritzelt hat, etwas Pilzähnliches oder etwas Penisähnliches. Letzteres nimmt die Mutter ohne weiteres an, als sie das Wort Matsudake hört. Auf dem beigegebenen Bild finden wir ein solches Matsudake, das ziemlich deutlich als Penis zu erkennen ist. Das andere Gebilde ist ein Cunnus in der Form, wie wir sie auch bei uns sehen. Der Japaner bezeichnet eine solche Kritzelei als Waraji-Mushi, als Holzlaus, weil in der Gassensprache der Cunnus diesen Namen hat. Diese Wandkritzeleien kleiner Knaben sehen in ihrer rohen Darstellung ungefähr wie eine Holzlaus aus. Auch in der untenstehenden Kritzelei erkennt man nicht ohne weiteres, was sie bedeuten soll. Aber in diesem »Sinnbild« findet man doch bei genauerem Zusehen, das, was in dem Wort »Noshikoshiyama« steckt, mit dem man solche Kritzeleien bezeichnet. No ist die Corona glandis, die Peniseichel, shikoshi der Peniskörper und yama der Hodensack. In einem Senryū muß dieses etwas längliche Wort zu folgendem Scherz dienen:
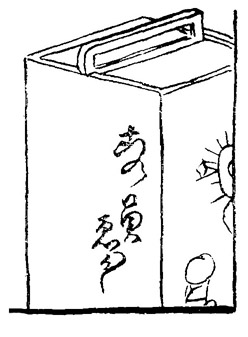
Madsudake und Waraji-Mushi.
»Nagatsubone Noshikoshi bakari
Yama wa nashi.«
»Die Hofdame behält nur das Noshikoshi für sich und hat kein Yama.« Hier ist Noshikoshi als Harikata, als künstlicher Penis, aufgefaßt. Als einheimisches Erzeugnis gibt es in Japan keine vollständigen Godemichés in europäischer Aufmachung. Das Senryū will also besagen: So lange du ein Harikata verwendest, wirst du niemals einen Hodensack zu Gesicht bekommen.

Noshikoshiyama.
Das erste Bild stammt aus dem 5. Band des Buches »Insho Kaikō Ki« (Nachschlagewerk über geschlechtliche Dinge?); das zweite aus dem Buch »Konsei Reimu Den« (Vermischte Bemerkungen über wunderbare Träume).
Zum Schlusse wollen wir aus den abergläubischen Vorstellungen, die zum Geschlechtlichen in Beziehung stehen, noch eine kleine Auslese zusammenstellen. Wenn wir von Aberglauben sprechen, so wollen wir damit, wie wiederholt betont, kein Werturteil abgeben. Abergläubisch soll lediglich bedeuten, daß diese Vorstellungen neben den öffentlich anerkannten Glaubensvorstellungen hergehen.
Von einem sehr weit verbreiteten Glauben, dem Glauben an die Zauberkraft, die geschlechtlichen Handlungen und Dingen innewohnt, werden wir in bezug auf die sogenannten Frühlingsbilder im Abschnitt über die erotischen Bilder und Bücher zu sprechen haben. Hier möge der Hinweis genügen, daß diese Bilder, die Koitusszenen darstellen, nach dem Volksglauben die Kraft hatten oder auch noch haben, böse Einflüsse abzuwehren, Krankheiten fernzuhalten usw.
Zauberhandlungen, mit denen man einer Nebenbuhlerin zu Leibe gehen kann, kennt auch die Japanerin. Die folgende Art ist in der Hauptsache über die ganze Erde verbreitet; es ist ein Analogiezauber, bei dem dem Lebenden das widerfahren soll, was mit seinem Stellvertreter geschieht. Aber die Japanerin macht den Erfolg ihrer Zauberhandlung von einem Gott abhängig, zu dem sie betet. Deshalb nennt man einen solchen Zauber »Ushi-no-Toki-Maeri«, in tiefer Nacht (d. h. um 2 Uhr vormittags, eigentlich: zur Zeit der Kuh; siehe oben bei Daikokuten) einem Gott ein Gebet darbringen. Eine Frau, der die Gunst ihres Mannes oder ihres Liebhabers verloren gegangen ist, bringt einem Gott in der Stille der Nacht ein Gebet dar, indem sie ein Waraningyō, eine Strohpuppe, als Vertreterin ihrer Nebenbuhlerin mit einem Gosun-Kugi, einem fünf Zoll (etwa 15 cm) langen Nagel im Tempelgebiet an einen Baumstamm annagelt, wobei sie ihre Nebenbuhlerin verflucht. Sie hat ein schneeweißes Kleid angezogen und benutzt als Gürtel ein Strohseil; das Haar ist aufgelöst und auf dem Kopf trägt sie einen Dreifuß, in dem drei Lichter brennen; auf der Brust trägt sie einen runden Spiegel, der an einem Strick um den Hals gehängt ist; an den Füßen trägt sie hohe Holzschuhe mit nur einer Stütze. Ein solches Gebet muß einundzwanzig Tage lang durchgeführt werden und in der Nacht der Erfüllung ihres Gelübdes wird ein großer schwarzer Ochse erscheinen, als Verkörperung des Gottes, zu dem sie betet. Dieser Ochse stellt sich ihr in den Weg, als ob er prüfen wollte, ob sie mit der schuldigen Ehrfurcht zu dem Gott kommt, wenn sie beten will. Geht sie ruhig über dieses Tier hinweg, so wird ihr Gelübde erfüllt und ihre Nebenbuhlerin wird sterben. Es wird aber außerdem behauptet, daß ihr Gelübde nicht erfüllt und daß sie selbst in naher Zukunft sterben wird, wenn ihr in der letzten Nacht ihres Gebets irgendein Mensch auf der Straße begegnet.
Die Nachgeburt oder der Mutterkuchen, japanisch Yena oder medizinisch Ena genannt, ist in allen Weltgegenden von jeher als etwas Besonderes betrachtet worden. Man zaubert damit, man benutzt sie als Arznei oder in Liebestränken oder man beseitigt sie unter abergläubigen Gebräuchen. In der Yedoperiode glaubte man in Japan, daß die Nachgeburt eines erstgeborenen Kindes die Kraft habe, einen Menschen zu verjüngen. Im Volk herrscht der Aberglaube, daß man aus der Besichtigung der Nachgeburt eines unehelichen Kindes, nachdem man sie gewaschen hat, den richtigen Vater herausfinden könne. Zur Erläuterung dieses Glaubens möge die nachfolgende lustige Geschichte dienen:
»Es war da einmal ein Mädchen, das war alt genug, um zu heiraten. Die Eltern hatten sie als ihre Lieblingstochter auserkoren. Sie wurde nun ganz zufällig schwanger, aber die Eltern hatten Mitleid mit ihr und forschten sie nicht aus, wessen Kind das wäre. Sie taten, als ob sie von nichts wüßten und sprachen überhaupt nicht über die Angelegenheit. Als ihre Zeit gekommen war, da gebar sie ein Kind von sehr kräftigem Aussehen. Nun dachten die Eltern daran, wenigstens vermittelst der Nachgeburt festzustellen, ob nicht vielleicht auf der Nachgeburt etwas von dem Helmschmuck der Familie des Vaters zu erkennen wäre. Daher ließen sie die Nachgeburt in Wasser säuberlich abwaschen. Aber es war nichts von einem Familienhelmschmuck darauf zu sehen; wohl aber ein Schriftzeichen. Und wenn man dieses Schriftzeichen sorgfältig betrachtete, dann konnte man es lesen als: ›Einer von den jungen Leuten!‹«
Dieses Geschichtchen klingt geradeso, als ob man sich über die Leute, die noch solchen Aberglauben haben, ordentlich lustig machen wolle. –
Die Japaner sind beim Geschlechtsverkehr sehr reinlich, worüber wir noch Einzelheiten bringen werden. Die Filzlaus sieht man als ein Ergebnis der Unreinlichkeit an, denn man glaubt, daß sie aus dem männlichen Samen und der von der Frau abgesonderten Flüssigkeit entsteht, wenn nach dem Koitus beide Teile ihre Geschlechtsteile nicht reinigen. Im Japanischen heißt die Filzlaus Tsubo-Jirami, Tsubu-Jirami oder Tsubi-Jirami; diese drei Wörter bedeuten lediglich: die Laus des Cunnus (Inouye: Shirami). Tsubu ist ein allgemeiner Ausdruck für die Muscheln, die zur Art der Buccinidae, der Wellhörner, gehören. Daraus hat man ein Gassenwort für den Cunnus gemacht; es kommt aber auch in diesem Sinne in der Mundart der Provinz Tajima vor. Tsubo ist ein Topf, ein Becher oder ein Krug (ohne Henkel und Ausguß) und wird in der Umgangssprache allgemein für den Cunnus gebraucht. Man hat damit auch den Ausdruck Tsubo-Utsushi, Übertragung aus dem Topf, gebildet und versteht darunter eine Frau, die ein Geschlechtsleiden von einem Manne an einen andern weitergibt, ohne selbst zu erkranken. Und schließlich Tsubi, das an sich keinen Sinn hat, gilt als verderbt aus Tsubo, wird aber in der Umgangssprache mehrfach in Ausdrücken verwendet, obwohl es als Bezeichnung des Cunnus veraltet ist.
Vom eigentlichen Liebeszauber hört man in Japan wenig. Wir haben oben gesehen, wie man eine Nebenbuhlerin auf magischem Wege töten kann, aber die magischen Handlungen, um Liebe oder den Geliebten herbeizuzwingen, sind ganz harmlos, soweit heute überhaupt noch von solchen die Rede sein kann. Jedenfalls war das, was sich in die neuere Zeit herübergerettet hatte, so abgeschwächt, daß wir kaum noch Schlüsse ziehen können, was sich früher in solchen Fällen zugetragen haben mag.
Zu solchen harmlosen Mittelchen gehört auch das Kami-no- Kawazu, der Papierfrosch. In einem erotischen Liebesbriefsteller (Endō Fumi-no-Shiori), der gegen das Ende der Yedo-Periode erschienen ist, steht folgendes zu lesen:
»Zu der Zeit, wenn du mit deinem Geliebten zusammentreffen willst, ist es doch besser, ihn durch einen Zauber an dich zu fesseln. Dieser Zauber ist folgendermaßen auszuführen: Du faltest dir aus weißem Papier einen Frosch, schreibst den Namen deines Geliebten auf seinen Rücken und steckst mitten in diesen Namen hinein eine Nadel. Dann legst du den Frosch unter das Tatami (die Fußbodenmatte) und betest diesen Zauberspruch her: ›Wenn du mich ihn sehen lässest, dann werde ich dir eine Schale voll Wein auftragen und dich frei lassen!‹ Wenn du Erfolg gehabt hast, so nimmst du den Papierfrosch unter der Matte hervor, ziehst die Nadel heraus und lässest ihn in einem Fluß fortschwimmen, nachdem du ihn vorher in Wein getaucht hast.« Das Bild stammt aus demselben Buch.
Im folgenden geben wir ein weiteres Beispiel für einen solchen Liebeszauber, wie er in den Vierteln der Halbwelt geübt wird:
»Nimm ein Stück von einem Kanzenyori (ein Bindfaden, der aus zwei Papiersträhnen zusammengedreht ist) und mache daraus das Bild einer Wassereidechse (Salamander, Imori) und befestige dieses Ding hinter dem Oberbalken einer Tür, hinter einer Dachschindel usw. mit einem Nagel. Wenn du den Erfolg siehst, dann wirf es in einen Fluß, nachdem du es zuvor in Wein getaucht hast.«

Kami-no-Kawazu.
Wir dürfen vermuten, daß man früher diese Tiere lebendig durchstochen oder angenagelt hat.
In Japan herrscht der Aberglaube, daß der Geschlechtsverkehr mit einer schwangeren Frau den Embryo beeinflußt. Wenn dann das Kind zur Welt kommt, hat es auf beiden Hüften, d. h. Hinterbacken, ein Muttermal. Anscheinend schreibt man diese Erscheinung der Einwirkung des männlichen Samens zu, wie das folgende Senryū annimmt:
»Uwabami no doduke
Akago no shiri e kake.«
»Er spritzt das Gift der Riesenschlange über die Hüften des Kindes.« Uwabami ist die Anakonda oder Boa constrictor nach den Wörterbüchern, im allgemeinen bedeutet es Riesenschlange, vielleicht ist damit eine giftige Natternart gemeint, denn Anakonda und Boa kommen in Japan nicht vor. Wir müssen auch hier wieder daran erinnern, daß es sich in dem Uwabami nicht um ein Sinnbild des Penis als solchen handelt, sondern daß die Schlange wegen ihres Giftes in erster Linie, und dann erst als penisähnlich im Senryū in Betracht kommt. Es ist mehr ein umschreibender grotesker Ausdruck, wenn der Penis als Riesenschlange bezeichnet wird. Der unbekannte Maler des nachstehenden Bildes hat den Gedanken des Uwabami, der Riesenschlange, in grotesker Weise zur Darstellung gebracht, aber da er sich unter dem Uwabami nichts Rechtes vorstellen konnte, einen in der Volkssage begründeten achtköpfigen Drachen daraus gemacht. Und jedem der sieben Köpfe hat der Künstler einen anderen Ausdruck gegeben, während der achte in einen der sechs vor dem Ungeheuer stehenden Töpfe eintaucht. Diese Töpfe, Tsubos, sind gefüllt, aber bei genauem Zusehen sieht man, daß diese Töpfe Vulven darstellen, womit der Künstler, unter Benützung der Bedeutung von Tsubo als Cunnus in der Gassensprache, seinem Drachen das Futter bereitgestellt hat. Von Tsubo als Cunnus haben wir oben gesprochen. –

Uwabami.
Der weit verbreitete Aberglaube, daß der Cunnus unter Umständen in menschlicher Sprache redet, ist auch in Japan verbreitet.
In der Gassensprache nennt man den Cunnus auch Shitakuchi, den unteren Mund; diese Bezeichnung ist aber wohl kaum mit dem Aberglauben, daß dieses Shitakuchi sprechen könne, in Verbindung zu bringen. Das Bild ist dem Buch »Zensei Shichi Fukujin (Gedeihen durch die 7 Glücksgötter) entnommen; es erschien gegen Ende der Yedo-Periode. –
Bei den Freudenmädchen, den Bewohnerinnen der Demimonde-Viertel, ist überall der Aberglaube stark verbreitet, nach dem alten Grundsatz, daß alle Gewerbe und Beschäftigungen, die eigentlich nur dem Zufall irgendeinen Erfolg verdanken, besonders zu abergläubigen Vorstellungen und Gebräuchen neigen, wie Jäger, Spieler usw. Auch die Freudenmädchen gehören dazu, denn sie können nie beurteilen, ob sie eine gute Kundschaft haben werden oder nicht.
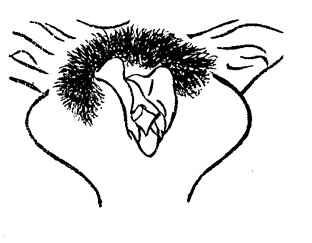
Shitakuchi.
Ein alter Brauch, der aber etwas aus der Mode gekommen zu sein scheint, ist das Tatamizan, das Befragen des Tatami, der Fußbodenmatte. Er besteht darin, daß man ein Kanzashi, eine der bekannten Schmucknadeln für das Haar, auf die Matte wirft und dann bis zu der Stelle, wohin die Haarnadel zufällig gefallen ist, die Kreuzungen der Strohhalme auf der Matte zählt. Bei geraden Zahlen ist die Weissagung gut, ungerade Zahlen deuten auf einen schlechten Ausgang hin.
Es gab noch mehrere andere Arten, das Tatamizan vorzunehmen. In dem Buch »Endō Fumi no Masago« (Liebesbriefsteller), das im dritten Jahr der Ansei-Zeit (1856 u. Z.) veröffentlicht wurde, finden sich die folgenden Angaben:
»Tatamizan ist eine Art Spiel, das seit uralten Zeiten von den Damen geübt wird. Aber man muß fest daran glauben, wenn man einen guten Erfolg erzielen will. Indessen ist die Weise, die Kreuzungen im Stroh eines Tatami zu zählen, als etwas Kindisches anzusehen. Du mußt vielmehr dein Kanzashi auf die Matte werfen, zuvor aber über das Zweifelhafte, das du entscheiden willst, ein Gebet sprechen. Dann kannst du dein Schicksal erraten je nach der Richtung, die von der Spitze der Haarnadel eingenommen worden ist.
Nach Norden: Die Person, die du erwartest, wird sich auf dem Herweg verspäten. – Sein Herz ist aufrichtig gesinnt. – Gehe keine Verabredung ein für 6 Uhr vormittags, 8 Uhr vormittags, 2 Uhr nachmittags, 8 Uhr nachmittags.
Nach Süden: Dein gegenwärtiger Wunsch wird erfüllt werden, und zwar in jeder Hinsicht; aber in Zukunft wird es schief gehen. – Sein Herz ist wankelmütig und du kannst dich nicht darauf verlassen. – Die Person, auf die du wartest, wird kommen, wenn sie in der Nähe ist; sie wird aber nicht kommen, wenn sie weit entfernt ist.
Nach Osten: Je nach deinem Gemütszustand wird der Erfolg gut oder schlecht sein. – Auf die Person, die du erwartest, kannst du dich nicht verlassen; ihr Herz ist wankelmütig. – Deine Anteilnahme wird den Leuten bald bekannt werden und in jedermanns Mund sein.
Nach Westen: Es wird ein für dich glückliches Ereignis eintreten; sei aber vorsichtig. – Die Person, die du erwartest, wird ganz gewiß kommen, und wenn irgendein Versprechen vorliegt, so wird es erfüllt werden. – Sein Herz ist aufrichtig.
Nach Nordosten: Er scheint einen steilen Abhang hinaufzuklettern. – Die Person, die du erwartest, wird nicht kommen. – Dein Wunsch kann durch ihn nicht erfüllt werden; wenn der Wunsch aber in Erfüllung geht, dann in jeder Hinsicht gut.
Nach Südosten: Alles steht gut; er wird aber von einer andern Frau verleitet werden und sich von dir trennen. – Die Person, die du erwartest, wird ganz bestimmt kommen. – Er ist ein gutmütiger Mensch und hat ein aufrichtiges Herz.
Nach Südwesten: Du brauchst auf jemand anders keinen Verdacht zu hegen; alle deine Wünsche werden erfüllt werden. – Die Person, die du erwartest, wird später kommen. – Er ist außerordentlich freigebig, aber liederlich.
Nach Nordwesten: Die Person, die du erwartest, wird kommen und dein Wunsch wird erfüllt werden. – Er ist vollkommen aufrichtig in seinem Herzen und es liegt in keiner Weise ein Hindernis vor. –
Das Tatami ist aus Reisstroh angefertigt, das fest zusammengeknüpft ist; die obere Seite ist mit Binsenmatten belegt, die man »Omote«, d. h. die Vorderseite nennt. Jedes Stück ist 6 engl. Fuß lang, 3 Fuß breit und 2 Zoll dick. Die Ecken sind gewöhnlich hübsch mit Tuch eingefaßt. –
In den Vierteln der Halbwelt ist es Sitte, als Glückszeichen für das Geschäft als Haarband das Higo-zuiki zu tragen. Es sind getrocknete Stengel einer Pflanze, die aus Higo in der Provinz Kyūshū stammen. Diese getrockneten Stengel werden um den Penis gewickelt, um ihn zu vergrößern und der Frau dadurch eine stärkere Befriedigung zu gewährleisten. Wir werden im Abschnitt über die Reizmittel im Geschlechtsleben der Japaner ausführlich darüber sprechen. Hier geht uns nur der Aberglaube der Freudenmädchen an, daß diese Pflanzenstengel, im Haar getragen, Glück bringen. Ob es sich dabei um gebrauchte oder ungebrauchte Higo-zuikis handelt, geht aus der vorliegenden Stoffsammlung nicht hervor. Das erstere ist aber anzunehmen, wenn man sich vorstellt, daß sie mit dem glückbringenden Phallos in Berührung gewesen sind.
Die Anwendung des Higo-zuiki ist nicht ganz einfach, wie wir später bei Besprechung des kunstgerechten Anlegens solcher Bändchen sehen werden. Bei schlechter Bindung kommt es vor, daß sich das Higo-zuiki beim Koitus löst und beim Herausziehen des Penis aus der Scheide das schlecht verwahrte Ende in der Scheide stecken bleibt. Diese peinliche Situation hat zu allerlei Scherzen Anlaß gegeben und wir werden im Abschnitt über die Reizmittel eine »sinnbildliche« Zeichnung sehen, die ein solches durch das Higo-zuiki verbundenes Pärchen darstellt. Man nennt ein solches Pärchen »ein Felsenpaar« in der Bedeutung von Mann und Frau aneinandergefesselt. Ein Senryū hierüber lautet:
»Higo-zuiki tokete
Futami-ga-ura no yō.«
»Das Higo-zuiki hat sich losgelöst und so sieht das nun aus, wie das Felsenpaar von Futami.« Futami-ga-ura ist der Küstenstrich von Futami-machi (die Straße von Futami) an der Ostküste bei Yamada City in der Provinz Uji. Die Japaner betrachten Futami als einen der malerischsten Plätze ihrer Küste und es gibt nur wenige Künstlervorbilder, die beliebter sind, als die Myōto-seki, die Ehepaar-Felsen, zwei Felsen, die ganz dicht an der Küste stehen und die mit einem Strohseil miteinander verbunden sind. Das Shime, das Strohseil, wird gewöhnlich an Neujahr vor Shintō-Tempeln und -Häusern aufgehängt, scheint aber im Falle der Myōto-seki die eheliche Verbindung zu bedeuten. Eine Legende erklärt jedoch das Strohseil in der Weise, daß der Gott Susa-no-o als Dank für erwiesene Gastfreundschaft einen armen Dorfbewohner dieses Platzes dahin belehrte, daß er sein Haus in Zukunft vor jeder Heimsuchung durch den Gott der Pest beschützen könne, wenn er solch ein Strohseil quer vor den Eingang anbringe. Ein sehr kleines Heiligtum, das man Somin shorai no Yashiro nennt, erinnert an diese Legende. Der Brauch, ansteckende Krankheiten dadurch fernzuhalten, daß man ein Strohseil quer über die Landstraße hängt, ist über das ganze Land verbreitet.
Ein Aberglaube, dessen Hintergrund sehr durchsichtig ist, wird als Shitahimo-no-Soradoke bezeichnet, d. h. Das Unterleibchen ist von selbst aufgegangen. Es handelt sich um das Lendentuch, das den Cunnus verdeckt und mit einem Band um den Leib gebunden ist. Löst sich nun dieses Schamtuch von selbst los, dann nimmt die Besitzerin an, daß ihr Geliebter sehr bald in ihr Haus kommen wird. Der Ausdruck Shitahimo-no-Soradoke ist unter den Bewohnerinnen der Demimonde-Viertel allgemein üblich. Der Sinn ist ganz einfach der: Wenn der Geliebte kommt, muß das Lendentuch abgelegt werden, oder vielmehr: Das Lendentuch hat sich gelöst, also muß der Geliebte kommen.