
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der Engländer kehrte mit langen, eiligen Schritten zurück. Er wedelte von Weitem mit den Armen wie mit Windmühlenflügeln. Sein Lachen klang überschnappend wie die Töne einer überblasenen Clarinette, und erst, als er ganz nahe war, verstanden sie die Worte:
»War das – verteufelt, verteufelt! – war das – – hahaha – war das nicht – hihihi – nicht göttlich?«
»Unbezahlbar!« antwortete Steinbach.
»Nicht wahr –? Hihihihihhh! Ohohohohoho!«
Er krümmte sich vor Lachen. Sein Gesicht war zinnoberroth. Es war, als ob er ersticken müsse. Das sah so drollig aus, das die Anderen abermals zu lachen begannen, und es dauerte eine große Weile, ehe der Lachreiz so weit überwunden war, daß man nur einigermaßen ruhig zu fragen und zu antworten vermochte.
»Wir waren erstaunt, Sie hier zu sehen,« sagte Steinbach. »Wie kommen denn Sie hierher?«
»Wie? Natürlich auf diesen meinen Beinen.«
»Sie sollten doch an Bord bleiben!«
»Sollte ich? Ja, ich sollte, ich sollte! Aber ich wollte nicht, verstanden? Ich wollte nicht! Und da machte ich mich auf die Füße und ging hierher. Sie hatten mir den Ort so genau beschrieben, daß ich gar nicht fehl gehen konnte.«
»Welche Unvorsichtigkeit!«
»Unvorsichtigkeit? Was Sie sagen! Es war der allerklügste Gedanke, den ich jemals gehabt habe. Wer weiß, ob mir in meinem ganzen Leben wieder eine so gescheidte Idee kommt!«
»Da es in dieser Weise abgelaufen ist, so mag man es loben. Aber Ihr Leben stand auf dem Spiele!«
»Mein Leben? Ganz und gar nicht! Nicht das meinige, sondern dasjenige dieses arabischen Masters stand auf dem Spiele. Verstanden? So ist es!«
»Natürlich stand es auf dem Spiele und zwar sehr. Er handelte sich ja um ein Massenduell, um einen Kampf mit so vielen Gegnern nach einander.«
»O, das war es nicht! Er sollte erschossen werden.«
»Das wissen wir. Deshalb forderte man ihn ja.«
»Nicht so meine, ich es. Er sollte meuchlings erschossen werden und zwar nicht einmal von hinten, sondern von vorn und dennoch meuchlings.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Haben Sie denn den Schuß aus dem Loche nicht gehört?«
»O doch!«
»Nun, dieser Schuß galt Hilal.«
»Wie? Wirklich?«
»Ja. Dieser verteufelte Arnaute hatte sich in das Loch gesteckt, um Hilal aus diesem Verstecke heraus zu erschießen.«
»Das wäre wunderbar. Hilal hatte doch schon so viele Gegner, daß es eines solchen Anschlages gar nicht bedurfte.«
»Ja freilich. Ich ahnte und dachte es auch nicht, bis der verdammte Kerl den Lauf seines Gewehres zu dem Loche heraussteckte und auf Hilal zielte.«
»Wie sind denn Sie hineingekommen?«
»Ich bin hineingekrochen. Oder meinen Sie vielleicht, daß ich in einem Coupee erster Classe per Courierzug hineingedampft bin, Master Steinbach?«
»Unsinn! Es versteht sich ganz von selbst, daß ich meine Frage nicht in dieser Weise gemeint habe. Wie sind Sie denn auf den Gedanken gekommen, sich in diesem Grabe bei dem Arnauten zu verstecken?«
»Bei dem Arnauten? Ich war eher drinnen als er.«
»Das kann ich mir denken.«
»Ich ging hierher, um vielleicht Hilal einen Dienst zu erweisen. Dies mußte heimlich geschehen. Darum suchte ich mir ein Versteck. Ich fand das Grab, kroch hinein und machte den Stein hinter mir wieder vor. Da kamen die Arnauten. Sie sprachen mit einander; ich konnte es aber nicht verstehen. Dieser Eine kam hinein zu mir. Ich hatte grad noch Zeit genug, so weit hinter zu kriechen, daß er mich nicht bemerkte. Dann hörte ich draußen sprechen, verstand aber wieder nichts. Ich vernahm endlich auch Ihre Stimme, welche ich natürlich sofort erkannte, Master Steinbach, und da dachte ich mir, daß das Duell nun wohl beginnen werde. Es war dunkel in dem Loche, besonders ganz da hinten bei mir. Vorn aber fehlte an dem Steine eine Ecke, und da kam so viel Licht herein, daß ich den Arnauten erkennen konnte. Ich sah, daß er seine Flinte ergriff und den Lauf – derselben an das Loch hielt. Er zielte. Natürlich sagte ich mir, daß er eine Schlechtigkeit beabsichtige, sonst hätte er sich doch nicht versteckt. Ich rückte ihm also leise und heimlich näher. Da hörte ich draußen die Worte »ahad – itnehn –« ich verstehe nicht arabisch, aber so viel weiß ich, daß diese Worte so viel bedeuten wie »Eins – zwei!« Ich konnte mir denken, daß nun »Drei« kommen werde.«
»Da wollte der Mensch schießen?«
»Natürlich! Wo stand Hilal?«
»Fünfzig Schritte dort.«
»Und sein Gegner?«
»In derselben Entfernung zurück.«
»Ah, so ist es mir jetzt klar. Aus dem Grabe heraus war Hilal noch einmal so sicher zu treffen wie von dort her. Die Schüsse sollten zu gleicher Zeit fallen. Man hätte also gar nicht gewußt, woher die tödtliche Kugel eigentlich gekommen wäre. Na, ich merkte, daß es für mich Zeit sei, zu handeln. Noch ehe die »Drei« ausgesprochen wurde, packte ich den Menschen beim Genick.
Er erschrak so, daß er losdrückte; aber ich sehe jetzt, daß die Kugel fehlgegangen ist. Er ließ das Gewehr fallen, stieß den Stein um und schoß hinaus. Wie er gebrüllt hat, das haben Sie ja gehört.«
»Ja. Dann kamen auch Sie.«
»Aber nicht gar zu schnell. Ich mußte vorsichtig sein. Ich guckte erst sacht heraus, um zu sehen, wie meine Actien ständen. Als ich aber Sie erblickte, sah ich, daß ich es wagen könne, hervorzukommen und so fuhr ich denn mitten unter sie hinein und nachher hinter ihnen drein.«
»Das war köstlich, köstlich!«
»Ich glaube, sie haben mich für den Geist des Engländers gehalten, der da drinnen gelegen hat.«
»Natürlich! Das hat grad so wunderbar gepaßt!«
»Sie sehen also, daß Hilal erschossen worden wäre, obgleich Sie ihm zu Hilfe gekommen sind.«
»Das ist wahr. Wer hätte so Etwas denken können.«
»Also ist Lord Eagle-nest doch nicht ganz zwecklos auf die Welt gekommen!«
»Ja. Sie sind heut Engländer, Gespenst, Geist und Schutzengel zu gleicher Zeit gewesen.«
»Schön, daß Sie das einmal einsehen. Merken Sie es sich, und nehmen Sie es zu Herzen. Unsereiner ist auch ein Kerl, der Etwas vermag! Verstanden?«
»Sehr wohl! Ich werde mich seiner Zeit daran erinnern. Jetzt, da ich klar sehe, will ich auch Hilal die Sache erklären, damit er hört, was er Ihnen zu verdanken hat.«
»O bitte! Das ist nicht nöthig. Ich trachte nicht nach solcher Anerkennung. Ich habe mir einen ungeheueren Spaß gemacht und bin damit zufrieden.«
»Schön! Solche Abenteuer scheinen Ihnen besser zu gelingen als die Entführungen aus dem Harem.«
»Ja, ich muß mich nun auf diese Art von Heldenthaten legen, gebe aber trotzdem die Hoffnung, eine Sultana entführen zu können, noch nicht auf. Besser wäre es gewesen, wenn ich verstanden hätte, was sie sprachen. Ich werde mich jetzt auf das Studium fremder Sprachen legen. Ich sehe ein, wie nützlich das ist.«
Steinbach sagte Hilal, daß er habe ermordet werden sollen und erklärte ihm den ganzen Vorgang. Der Beduine hörte ihm ruhig zu und sagte dann:
»So habe ich diesem Engländer mein Leben zu verdanken. Dies war die einzige Weise, in welcher sie mir schaden konnten. Ich hätte sie Alle erschossen!«
»Bist Du Deiner Sache so gewiß?«
»Ja. Das sage ich nicht aus Stolz. Könntest Du mich kennen lernen, so würdest Du es mir glauben.«
»Ich werde Dich kennen lernen.«
»Leider wohl nicht, denn morgen früh reise ich.«
»Ich auch. Ich reise mit Dir.«
»Wohin?« fragte Hilal überrascht.
»Zu den Deinen. Du bist beim Vicekönig gewesen, und in seinem Auftrage werde ich mit Dir gehen, um den Kriegern der Sallah seine Wünsche zu bringen.«
»Allah sei Dank! Als ich zum letzten Male mit ihm sprach, bat ich ihn, einen Boten zu senden, aber er schlug mir die Erfüllung dieser Bitte ab.«
»Ich würde vielleicht auch ohnedies zu den Sallah geritten sein, denn ich hätte Hiluja hingebracht.«
»Hiluja! Du sagtest mir, daß sie Dich hierher gesandt habe, um mich zu beschützen. Gehörst Du vielleicht auf das Schiff, auf welchem sie wohnt.«
»Ja, es ist das Eigenthum dieses Engländers.«
»So bist Du wohl derjenige, der sie aus der Hand der Tuareg gerettet hat?«
»Es gelang mir, sie zu befreien.«
»So wird der Erfolg Deiner Botschaft an ihre Schwester ein glücklicher sein. Die Königin der Wüste hängt mit ganzem Herzen an ihr; der Retter derselben wird unter unseren Zelten willkommen sein wie kein Anderer.«
»Das soll mir lieb sein. Ebenso sehr wünsche ich aber auch, daß Du als Freund an mir handelst. Ich möchte gern alle Verhältnisse des Stammes genau kennen.«
»Ich werde Dir Alles sagen. Ich habe Euch seit jetzt mein Leben zu verdanken. Ich werde Alles thun, was ich zu Deinem Besten zu thun vermag. Nun aber ist es dunkel geworden. Wir müssen gehen. Wo werde ich Dich morgen treffen?«
»Du wirst gleich jetzt mit auf das Schiff gehen und bei uns bleiben. Oder willst Du nicht?«
Hilal dachte an Hiluja. Welche Seligkeit, auf dem Schiffe bei ihr zu sein! Er antwortete also freudig zustimmend und erkundigte sich dann:
»Diese Arnauten haben ihre Waffen weggeworfen. Ich sehe, daß Deine Begleiter sie zusammengeholt haben. Was wirst Du mit ihnen thun?«
»Ich werte sie dem Eigenthümer überantworten, dem Vicekönige. Sie gehören ihm.«
»Wie schade! Wäre es zum Kampfe gekommen, so hätte ich gesiegt und die Gewehre für mich genommen. In der Wüste braucht man Gewehre so nothwendig, und nicht jeder Sohn der Araber besitzt eine gute Flinte.«
»So werde ich ein Wort mit dem Vicekönig sprechen. Vielleicht gelingt es mir. Dir diesen Wunsch in Erfüllung zu bringen.«
Jetzt reichte Hilal dem Engländer, seinem Retter, die Hand. Doch was er sagte, verstand dieser nicht. Steinbach mußte den Dolmetscher machen. Der Lord holte seine Sachen aus dem Grabe, in welchem sie zurückgeblieben waren, und dann wurde der Heimweg angetreten. Als sie das Schiff betraten, war die Freude des Steuermannes, den Lord unversehrt wieder zu finden, groß. Ebenso groß aber stiller war die Freude Hiluja's, als sie erfuhr, daß Hilal gerettet sei.
Im Laufe des Abends begab sich Steinbach in Folge der erhaltenen Einladung zu dem Vicekönige, von welchem er nähere und ausführliche Instructionen empfing. Er erzählte ihm von den Arnauten. Der Khedive ergrimmte über diese Menschen und versprach, sie streng bestrafen zu lassen. Auch die Gewehre erwähnte Steinbach und Taufik Pascha erklärte ihm nach kurzem Besinnen, daß er ihm eine ganze Parthie guter Gewehre als Geschenk für die Königin der Wüste mitgeben wolle, dazu natürlich eine angemessene Quantität der notwendigen Munition.
Als Steinbach auf die Yacht zurückgekehrt war, wurde natürlich nur von der beabsichtigten Reise gesprochen. Er hatte vor dem Engländer ein stilles Bangen gehabt, da er glaubte, dieser werde ihn unter allen Umstünden begleiten wollen. Daher war er freudig überrascht, als der Lord meinte:
»Sie werden mir zürnen, Master Steinbach, aber es geht beim besten Willen nicht.«
»Was?«
»Daß ich mit Ihnen gehen kann.«
»Ah! Sie können nicht?«
»Nein. Ich will eine Sultana entführen, aber unter diesen Beduinen giebt es keine wirkliche, echte Sultana. Außerdem muß ich Arabisch lernen. Der Steuermann will mein Lehrer sein und da muß ich bei ihm bleiben.«
»Das ist mir außerordentlich bedauerlich.«
»Wirklich?«
»Ja. Ich hätte Sie so gern bei mir gehabt, denn ich sage mir, daß mir Ihre Gegenwart von sehr großem Nutzen gewesen wäre.«
»Ja, seit ich heute bewiesen habe, was ich eigentlich zu leisten vermag, ist mein Werth bedeutend gestiegen. Aber ich muß dennoch verzichten. Sie haben übrigens die beiden Masters Normann und Wallert.«
»Es wird nur einer sein, den ich ersuchen werde, mich zu begleiten, nämlich Herr Normann. Tschita muß doch einen Beschützer haben, und da versteht es sich ja ganz von selbst, daß ihr Bruder bei ihr bleibt.«
»Wie Sie wollen. Was mich betrifft, so bleibe ich freilich nicht auf dem Schiffe. Ich suche mir eine Wohnung in der Stadt und zwar in einer stockarabischen Gegend, wo ich gar kein anderes Wort als nur Arabisch höre. Ich habe mir sagen lassen, daß man auf diese Weise am Allerleichtesten in den Besitz einer fremden Sprache kommt.«
Während nun Steinbach, Wallert und Normann ihre Resolutionen trafen, lehnte Hilal auf dem Deck an der Regeling und blickte hinab in die Wasser des ewigen Flusses. Sie kamen weit her, aus dem unerforschten, geheimnißvollen Süden und gingen weiter, um in der ebenso geheimnißvollen Unendlichkeit des Meeres zu verschwinden. Welche Gedanken hatte der Jüngling, als sein Blick an den nächtlich glitzernden Wellen hing? Gar keine. Es ist eigenthümlich und doch so wahr, daß der Mensch in den glücklichsten Augenblicken seines Lebens gar keine Gedanken hat. Er befindet sich in einem traumartigen Zustande, während dessen er zu keinem bewußten, beabsichtigten und controlirten Denken kommt. Er hat das Gefühl keines Glückes, weiter nichts, und das ist ja genug, mehr als genug. Es ist das der erste Buchstabe des Alphabetes der großen Seligkeit, die auch nicht im Denken, sondern nur im Gefühle besteht, im Anschauen Gottes.
Da hört der einsame Träumer einen leisen Schritt in seiner Nähe. Er wendete sich um. Hiluja war auf das Deck gekommen. Es war sternenhell geworden, und im Schimmer des Firmamentes gewannen ihre schönen Züge eine Art überirdischen Ausdrucks, den er noch nie an einem Weibe bemerkt hatte. Sie that, als ob sie an ihm vorüber wolle.
»Hiluja!« sagte er leise, zagend.
»Riefst Du mich?« fragte sie, stehen bleibend.
»Ich wollte nicht, aber ehe ich es mir versah, hatte ich Deinen Namen gesagt. Verzeihe mir!«
»Und ich sah Dich, wollte Dich aber nicht stören. Du warst so tief in Gedanken.«
»Meine Gedanken waren bei Dir. Ich weiß, daß ich auch dieses Dir nicht sagen sollte. Du mußt mir abermals verzeihen.«
»Wie hätte ich Dir Etwas zu verzeihen? Du bist ja mein Retter. Du bist für mich in Todesgefahr gegangen.«
»O, es war gar nicht gefährlich!«
»Das sagst Du, weil Du die Gefahr liebst. Ich habe um Dich gebangt. Noch jetzt weiß ich nicht, wie es Dir da draußen am See ergangen ist. Als ich Dich jetzt erblickte, glaubte ich. Du könntest es mir erzählen.«
»Sehr gern.«
»Wirst Du mir zürnen, daß ich Dir die Effendis hinausgesandt habe?«
»Zürnen? Ich habe Dir vielmehr dafür zu danken. Hättest Du es nicht gethan, so lebte ich nicht mehr, denn man hatte die Absicht, mich meuchlings zu ermorden.«
Er stattete ihr einen ausführlichen Bericht ab. Die Scene, als der Lord aus dem Grabe gekommen war, gab auch ihr unendlichen Spaß, doch wurde sie schnell wieder ernst bei dem Gedanken an die große Gefahr, in welcher Hilal geschwebt hatte.
Von da kamen sie auf die Reise zu sprechen, welche morgen begonnen werden solle. Hiluja erzählte auch von ihren Erlebnissen, von ihrer Heimath, von ihrer Gefangenschaft und der Errettung aus derselben. Sodann erkundigte sie sich:
»So kennst Du also meine Schwester, die Königin der Wüste, ganz genau?«
»So genau, als ob sie meine Schwester sei. Ich war einer der Ersten unseres Stammes, der sie sah und kennen lernte. Ich gehörte zu Denen, die ihr entgegenritten, um sie dann in die Arme des Scheiks zu geleiten. Mein Bruder war der Anführer dieser Schaar.«
»Sie ging nicht gern von der Heimath fort. Sie hatte den Scheik noch nie gesehen; sie wußte nicht, ob sie ihn würde lieben können. Er war bereits alt, dreimal so alt wie sie. Er war berühmt und mein Vater war berühmt. Die Freundschaft der beiden Stämme sollte begründet, besiegelt und gefestigt werden dadurch, daß der Scheik der Sallah die Tochter der Beni Abbas zum Weibe nahm.«
»Hast Du viele Botschaft von ihr erhalten?«
»Nur selten. Dann lud sie mich ein, sie zu besuchen. Ich machte mich auf unter dem Schutze von dreißig unserer Krieger. Sie sind von den Tuareg ermordet worden.«
»Ich werde ihren Tod rächen!«
»Du?« fragte sie verwundert. »Es waren doch nicht Verwandte von Dir!«
»Nein; aber sie waren Deine Beschützer. Wer sie tödtet, der ist mein Todfeind.«
»Du bist ein Held!«
»Und Du ein Engel, vom Himmel herabgestiegen, um verehrt und angebetet zu werden.«
»Ich hätte so gern gewußt, ob meine Schwester an der Seite des Scheiks glücklich geworden ist.«
»Hat sie es Dir nicht wissen lassen?«
»Sie hat keinem Boten ein Wort darüber anvertraut. Sie ist viel, viel zu stolz, so Etwas zu thun. Aber da Du sie so genau kennst, als ob Du ihr Bruder seist, wirst Du es mir vielleicht sagen können.«
»Ich könnte wohl.«
»Aber Du willst nicht?«
»Ich weiß nicht, ob ich darf. Sie wird es Dir selbst sagen, wenn Du zu ihr kommst. Sagte ich es Dir jetzt und Du sprächst davon, so würde sie mir vielleicht zürnen.«
»Sie zürnt Dir nicht. Und wenn sie es thäte, würde ich Dich in Schutz nehmen. Willst Du mir wirklich diese Bitte nicht erfüllen?«
»Wenn Du bittest, so muß ich sprechen. Deine Bitte ist mir so, als wenn der Prophet selbst vom Himmel käme, um mir einen Befehl zu geben.«
»Ich höre schon aus Deiner vorsichtigen Weigerung, daß sie nicht glücklich war.«
»Nein, sie war es nicht.«
»Die Arme! Warum aber nicht?«
»Das ist eine schwere Frage. Weißt Du, im heiligen Buche der Christen steht geschrieben, daß Allah den Menschen zu seinem Bilde geschaffen habe, den Mann zum Bilde seiner Allmacht und das Weib zum Bilde seiner Liebe. Daher kann der Mann nur glücklich werden durch den Erfolg seiner Thaten und das Weib durch den Erfolg seiner Liebe. Der Mann lebt in und durch seinen Willen, das Weib aber in und durch das Gefühl, das Empfinden. Und Badija, die Königin, Deine Schwester, konnte ihren Gemahl nicht lieben.«
»Wie bedaure ich sie! Warum vermochte sie es nicht?«
»Frage ihr Herz. Nur dieses kennt das Warum und Woher. Das Herz ist ein unberechenbares Ding. Es will sehr oft das, was der Kopf nicht will, und es will das nicht, was von ihm gefordert wird. Er war ein berühmter, tapferer, aber auch rauher Mann. Er verstand es nicht, sich Liebe zu erwerben. Weißt Du vielleicht, was Liebe ist?«
»Allah! Du hast bereits geliebt?«
»Ja.«
Er senkte den Kopf tief herab.
»Wen?« fragte er leise und traurig.
»Den Vater, die Mutter und die Schwester.«
Da ging sein Kopf schnell wieder in die Höhe.
»Ah, diese Liebe meinst Du?« erklang es hell.
»Welche soll ich denn sonst meinen?«
»Es giebt noch eine andere Liebe, welche viel, viel seliger macht als die Eltern- und die Kindesliebe.«
»Welche meinest Du?«
»Die – Gattenliebe.«
»O,« lächelte sie, »die kenne ich nicht. Wie sollte ich sie kennen? Ich habe ja keinen Mann!«
»So hast Du noch keinen Mann so geliebt, daß Du gewünscht hättest, sein Weib zu sein?«
»Nein. Aber – aber – aber – –«
Sie stockte.
»Was willst Du sagen?«
»Einmal, ein allereinziges Mal habe ich von Einem gedacht, er sei so, wie ich mir Den wünsche, dessen Weib ich sein soll.«
»Wer ist das?«
»Steinbach Effendi.«
»Ah, Dein Retter?«
»Ja. Er ist so hoch, so stolz, so herrlich. Er ist tapfer, ein Held der Helden, und doch ist er auch so mild, so warm, so freundlich. Du kennst ihn nicht.«
»Nein, aber ich liebe ihn bereits. Also stolz und tapfer müßte der sein, den Du lieben möchtest?«
»Ja; aber nicht das allein. Er müßte auch mild und gütig sein. Und so ist der Scheik der Sallah nicht gewesen?«
»Nein. Er war sogar ein grausamer Mann. Und dazu kam – ich will es Dir sagen: Deine Schwester liebte einen Andern.«
»O Allah! Wie ist das möglich?«
»Frage da wieder ihr Herz!«
»Sie hat es mir ja nie gesagt!«
»Sie lernte ihn erst kennen, nachdem sie Dich verlassen hatte. Er ist ein Beni Sallah. Er war der Anführer Derer, welche der Scheik ihr entgegensandte.«
»Sagtest Du nicht vorhin. Dein Bruder sei dieser Anführer gewesen?«
»Ja, ich sagte es.«
»So ist er es, den sie liebt?«
»Er ist es.«
Sie faltete die kleinen Händchen zusammen und blickte ihn mit einer Bestürzung an, von der sie selbst nicht wußte, ob sie eine freudige oder eine andere sei.
»Deinen Bruder liebt sie! Deinen Bruder! O Allah! Hat denn auch er sie lieb?«
»So lieb, daß es gar nicht zu sagen und zu beschreiben ist. Er ist so, genau so, wie Du vorhin verlangtest, daß ein Mann sein müsse. Er hat die Kühnheit eines Löwen, ja vielmehr eines Panthers und dabei doch das weiche Gemüth eines Kindes. Er ist der berühmteste Krieger des Stammes.«
»Ist er schön?«
»Fast glaube ich es. Er mußte ihr entgegenreiten. Sie sahen sich und liebten sich von diesem Augenblicke an. Aber sie haben es sich nie gesagt und nie gestanden. Sie wissen es, und das ist genug für sie. Nun ist der Scheik gestorben, und nach dem Gesetze des Stammes wird der Krieger Scheik, den die Wittwe des Todten zum Manne wählt.«
»So wählt sie Deinen Bruder?«
»Sie möchte wohl. Aber er ist arm, und der Bruder des Todten hat bereits um sie geworben.«
»O Himmel! Der Bruder des Todten! Sind da Eure Gesetze auch so, daß sie diesen nehmen muß?«
»Ja. Nur der Tod kann dazwischen treten. Es ist Gesetz, daß sie ihrem Schwager gehören muß. Will sie einen Anderen lieben, so muß dieser Andere mit dem Ersteren kämpfen, und das Gesetz fordert, daß dieser Kampf nur mit dem Tode des Einen enden kann.«
»So mag doch Dein Bruder mit dem Schwager meiner Schwester kämpfen.«
Er antwortete nicht. Erst nach einer Weile sagte er:
»Es giebt zwei Worte, welche dies verbieten, nämlich das Wort Falehd und das Wort Blutrache.«
»Das Letztere kenne ich, das Erstere aber nicht.«
»Wie? Du hättest nie von Falehd gehört?«
»Nein. Ist das ein Name?«
»Ja. Falehd ist eben der Bruder des verstorbenen Scheiks, er ist's, der Deine Schwester zum Weibe begehrt. Sie ist nicht nur schön wie eine Huri des Paradieses; sondern sie ist auch ebenso klug. Seit sie Wittwe ist, und als solche den Namen beherrscht, hat er sich unter ihrer Regierung weit ausgebreitet nach allen Richtungen des Himmels. Die Zahl unserer Krieger hat sich verdoppelt, und unsere Heerden weiden in den Oasen, welche wir eroberten. Darum nennt man sie die Königin der Wüste. Falehd will nun der König sein. Ich sagte vorhin, mein Bruder sei der tapferste Krieger des Stammes, und das ist wahr – – –«
»Ja,« fiel sie ein. »Tarik und Hilal werden ja die Söhne des Blitzes genannt!«
Er überhörte das Lob, welches sie ihm selbst in diesen Worten spendete, und fuhr in seiner Rede fort:
»Er ist der Tapferste; Falehd aber ist der Stärkste. Er ist ein Riese an Gestalt. Ich habe keinen Mann gesehen, welcher einen Körper hat, wie der seinige ist. Er besitzt eine Körperkraft, daß man von ihm behauptet, er könne mit einem Löwen ringen, auch ganz ohne Waffen. Kein Mensch wagt sich an ihn.«
»So fürchtet sich auch Dein Bruder, mit ihm um den Besitz meiner Schwester zu kämpfen?«
»Mein Bruder kennt keine Furcht; er weiß aber, daß dies sein sicherer Tod sein würde. In einem Kampfe mit dem Messer oder einer anderen Waffe würde mein Bruder ihn besiegen; Falehd aber würde so klug sein, nur auf einen Kampf mit der Faust einzugehen, und da ist er unüberwindlich. Und selbst wenn Tarik ihn besiegte, würde er den Preis doch nicht erringen. Das ist das Wort Blutrache, welches ich vorhin nannte.«
»Ich verstehe Dich nicht.«
»Nun, wenn mein Bruder Falehd besiegt, so muß er ihn nach dem Gesetze tödten. Dieser Tod aber muß durch Falehd's Verwandte gerächt werden. Wer aber ist die nächste Verwandte?«
»Meine Schwester!«
»Ja. Sie ist seine Schwägerin und zugleich die Königin des Stammes. Sie müßte die Blutrache übernehmen. Sie dürfte nicht ruhen und nicht rasten, bis auch mein Bruder getödtet ist. Kann sie da sein Weib sein?«
»Allah ist groß, aber hier kann selbst er nicht helfen!«
»Allah ist allmächtig; er kann helfen, wenn er will. Ich hatte einen Traum, in welchem mir Allah zeigte, wie Hilfe möglich ist. Als ich erwachte, nahm ich mir vor, dem Rathe meines Traumes zu gehorchen. Ich hätte es gethan, bald, sehr bald, aber – «
Er schwieg und blickte düster vor sich nieder.
»Nun willst Du es nicht thun?« fragte sie.
»Ich möchte; aber ist etwas dazwischen gekommen, wodurch es fast unmöglich gemacht wird.«
»Was träumte Dir?«
»Mir träumte, daß ich mit Falehd ränge, und ich besiegte ihn.«
»O Himmel! Du willst mit ihm ringen?« fragte sie erschrocken.
»Es träumte mir, und ich wollte es thun.«
»Du, gegen die Kraft eines solchen Riesen!«
»Hast Du heute nicht gesehen, als ich mit dem Tschausch kämpfte? Als ich ihm endlich Stand hielt, hat er da meinen Fuß oder meine Hand um ein Haar breit zu bewegen vermocht? Ich glaube, nach Falehd bin ich der Stärkste, obgleich ich nicht als Riese gewachsen bin; ich habe mich geübt, und vielleicht wollte es Allah, daß mir ein glücklicher Umstand im Kampfe gegen den Stärkeren zu Hilfe käme. Ja, ich wollte es wagen; aber seit heute giebt es ein Hinderniß.«
»Mein Leben gehört nicht mehr mir: ich darf es nicht für den Bruder verschenken.«
»Wem sollte es denn gehören?«
»Ich darf es doch nicht sagen!«
»Auch mir nicht?«
»Nein. Dir ganz und gar nicht.«
»Wenn ich Dich nun darum bitte?«
»Auch dann nicht.«
»Du meintest heute, daß Du niemals eine Unwahrheit sagest, und doch hast Du eine gesagt.«
»Ich weiß nichts davon.«
»Du sagtest vorhin, eine Bitte von mir sei ganz so, als ob Allah Dir einen Befehl vom Himmel sende, und nun jetzt behauptest Du, daß Du mir meine Bitte nicht erfüllen könntest.«
»Weil Du mir zürnen würdest.«
»O nein, nein! Dir kann ich niemals zürnen. Also bitte, sage mir, wem Dein Leben gehört!«
»So sollst Du es hören: Es gehört Dir, Dir allein.«
Sie wendete sich schnell ab und schwieg. Ihr Händchen hatte schnell nach dem Herzen gegriffen.
»Siehe, wie Du mir zürnst!« sagte er.
»Nein, ich bin nicht zornig.«
»So verzeihst Du mir?«
»Ja.«
»Aber Du hast Dich von mir abgewandt!«
»Weil ich nicht weiß, warum Dein Leben mir gehören soll. Du hast mich heute erst gesehen. Du hast mir nichts zu verdanken. Ich bin Dir fremd.«
»Fremd?« lächelte er. »Ich kenne Dich schon lange, lange Zeit.«
»Das ist ja ganz unmöglich!«
»O nein. Mein Bruder erblickte Deine Schwester und liebte sie. Auch ich sah sie in all' ihrer Schönheit und Herrlichkeit. Mein Herz wurde weiter und größer. Ich wußte auf einmal, daß Diejenige, für die ich leben solle, ganz so sein müsse wie sie. So hatte ich ein Fikirden; die Franken nennen das ein Ideal. Ich träumte von demselben im Schlafe und im Wachen. Heute sah ich Dich. Du bist wie Deine Schwester, die Königin; Du bist das Ideal, ich gebe Dir mein Leben!«
Er hörte ihren Athem gehen; er sah, daß ihr Busen sich hob und senkte. Da fuhr er schnell fort:
»Verstehe mich recht! Ich weihe Dir mein Leben, ich gehöre Dir; aber Du bleibst trotzdem Dein Eigen.«
»Wie wäre das möglich!« seufzte sie, ohne zu fühlen, was sie damit sagte.
Er holte tief Athem, verschlang die Arme über der Brust und sprach: »Als Dich heute die Arnauten beleidigten und mich nach meinem Rechte über Dich fragten, sagte ich, Du seiest meine Braut; ich küßte Dich sogar, und Du littest es. Nach dem Gesetze der Wüste müßtest Du nun mein Weib werden. Aber Du hast diesen Kuß angenommen, um von diesen Arnauten erlößt zu sein; ich gebe Dir mein Recht zurück. Es soll nie ein Mensch erfahren, daß mein Mund Deine Lippen berührte. Du bist frei, aber ich bin Dein Diener und Dein Sclave. Erlaube mir, Deine Wünsche zu errathen, und Deine Gedanken mir zu deuten! So will ich Dein sein, ohne Ansprüche, ohne einen Dank von Dir! Siehst Du nun ein, daß ich mein Leben nicht für den Bruder hinzugeben vermag?«
Sie schwieg. Sie wußte nicht, was sie antworten solle.
»Du sagst nichts! Stoßest Du mich von Dir?«
»O nein! Wie aber habe ich das verdient?«
»Fragt die Sonne, wie sie es verdient, daß sich Millionen Blicke nach ihr richten? Es ist Allah's Wille, und so muß es geschehen. Nun sage mir noch, ob Du mir zürnst!«
»Ich habe Dir bereits gesagt, daß dies mir ganz unmöglich sei.«
»Ich danke Dir! Allah segne Dich!«
Er ging, langsam und zögernd, als ob er ein Wort von ihr erwarte, welches ihn zum Bleiben auffordere. Sie wollte es sagen, aber das Herz war ihr so voll, so übervoll, daß sie keinen Laut mehr hervorbrachte. Erst als er fort war, legte sie beide Hände auf die Brust und ließ einen nur mühsam unterdrückten Laut hören; war es ein Ruf der Freude, des Glückes?
»Allah, o Allah!« flüsterte sie. »Wie thut mir das Herz so weh! Weh? Ist das wirklich Schmerz? Oder ist es Freude, eine Freude, welche mir das Herz zersprengen will, so daß ich denke, es thut weh? Ich weiß es nicht; ich weiß es nicht!«
Drückende Sonnengluth lag auf der Wüste. Es war wie in dem Bibelworte: »Der Himmel über Dir soll sein wie Feuer und die Erde unter Dir wie glühendes Erz. Die brennenden Strahlen fielen auf den Sand; aber er nahm sie nicht mehr an; er war bereits gesättigt von der tödtlichen Hitze und warf die Strahlen zurück, so daß sie wie ein flüssiges Gluthmeer, dessen Oberfläche in blendenden Lichtern flimmerte, auf der Erde lag.
Durch den tiefen Sand wadeten fünf Kameele, drei Reit- und zwei Lastkameele. Die beiden Letzteren trugen die ausgetrockneten Wasserschläuche, in denen kein einziger Tropfen mehr vorhanden war, und die übrigen Habseligkeiten der Reisenden. Die kleine Gesellschaft bestand aus drei Personen, zwei männlichen und einer weiblichen. Diese Letztere lag in der mit Vorhängen verschlossenen Sänfte, welche auf dem hohen Rücken des Kameeles von einer Seite auf die andere wankte. Diese Insassin war – Zykyma. Neben ihr ritten Ibrahim Pascha und Saïd, der treue Arabadschi.
Dem geblendeten Auge war es unmöglich, weit in die Ferne zu blicken. Der Blick wurde, wenn er in die Weite schweifen wollte, von der auf dem Boden lagernden Gluth förmlich wieder zurückgeworfen.
Ein tiefes, schmerzliches Stöhnen ließ sich von der Sänfte her vernehmen.
»Verfluchte Sandhölle!« knirschte der Pascha. »Da giebt es keine Spur von der Oase, welche so nahe sein soll. Siehst Du etwas, Saïd?«
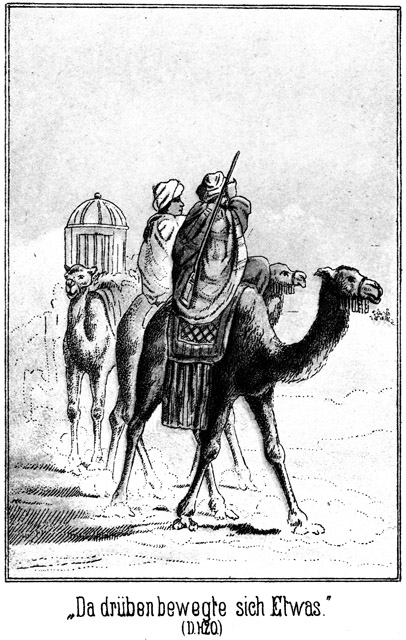
»Nein, Herr. Und doch – – da drüben, links von uns, bewegt sich etwas.«
Der Pascha versuchte, den Blick auf den erwähnten Gegenstand zu fixiren, vermochte es aber nicht.
»Ich kann nichts sehen,« klagte er. »Es ist, als ob die Sonne mir die Augen aus den Höhlen brennen wolle.«
»Mir geht es auch so. Aber es kommt näher.«
»Was ist es.«
»Ich kann es nicht unterscheiden.«
Er hatte recht. In dem Gluthmeere zerflossen alle Conturen und Linien, als ob sie von der Sonne zerstört oder verzehrt würden.
Endlich aber nahm die Gestalt eine größere Deutlichkeit an. Es war ein Reiter auf dem Kameele. Er kam im allerschärfsten Kameeltrabb herbei. Als er die kleine Carawane erreichte, hielt er sein Thier an und musterte sie mit finsterem Blicke.
Er ritt ein riesiges Thier, war aber auch selbst von wahrhaft herculischer Gestalt. Gehüllt war er von oben bis unten in einen weißen Haïk, dessen Caputze er über den Kopf gezogen hatte. Sein dunkles Gesicht war frei. Quer über dasselbe, von einer Wange bis zur anderen, die Nase zerschneidend, zog sich eine Narbe, welche von einer fürchterlichen Verwundung zurückgelassen sein mußte.
»Sallam!« grüßte er kurz und rauh, als er mit seiner Beobachtung fertig zu sein schien.
»Sallam aaleïkum!« antwortete der Pascha.
»Wer bist Du?«
»Mein Name ist Hulam.«
»Und was bist Du?«
»Kaufmann.«
»Hat Allah Dir den Verstand eines Ochsen gegeben, daß Du nicht besser und ausführlicher antwortest? Oder soll ich Dir etwa die Auskunft hier mit meiner Kameelpeitsche abkaufen! Wo bist Du her?«
»Aus Smyrna.«
Der Pascha wagte nicht, auf die groben Worte ebenso grob zu antworten.
»Wo willst Du hin?«
»Zu den Beni Sallah.«
»Zu den Beni Sallah?« lachte der Riese. »Wer hat Dir denn den Weg gezeigt?«
»Mein Führer. Er verließ uns aber; er getraute sich nicht weiter mit, da sein Stamm mit den Sallah nicht in guter Freundschaft lebt.«
»Fürchtet er sich? Er hat auch Grund dazu! Was wollt Ihr bei den Beni Sallah?«
»Gastfreundschaft.«
»Kennt Ihr denn Jemand unter ihnen?«
»Nein.«
»So steht es schlimm mit der Gastfreundschaft, welche Ihr sucht. Der Stamm ist ein sehr kriegerischer und nimmt nicht einen Jeden bei sich auf. Wer sind diese beiden Anderen?«
»Mein Weib und mein Diener.«
»Du bist von der Richtung, welche Dir angegeben worden ist, abgewichen. Wenn Du so fortreitest, reitest Du dem Tode entgegen. Gut, daß ich Euch von Weitem gesehen habe. Kommt mit mir!«
Er lenkte in einem scharfen Winkel nach Süden ab. Die Anderen folgten ihm. Eine Zeit lang verfolgte man die neue Richtung in tiefem Schweigen. Der Pascha betrachtete den Riesen mit unruhigen Blicken. Endlich sagte er:
»Bist Du vielleicht ein Beni Sallah?«
»Ja.«
»Kennst Du Falehd, den Bruder des verstorbenen Scheik's?«
»Warum sollte ich ihn nicht kennen. Willst Du etwa zu ihm?«
»Ja.«
»Nimm Dich in Acht! Er ist kein Menschenfreund!«
Ueber sein Gesicht ging ein höhnisches und doch auch selbstzufriedenes Lächeln. Der Pascha antwortete:
»Du scheinst ebenso wenig einer zu sein wie er.«
»Meinst Du? Warum denkst Du das?«
»Ich sehe es nicht nur, sondern ich höre es auch.«
»Hm! Was willst Du bei Falehd?«
»Viel und wenig.«
»Hölle und Teufel! Hältst Du mich keiner besseren Antwort für werth?«
»Vielleicht antworte ich anders, wenn ich Dich zuvor kennen gelernt habe.«
»Das will ich Dir auch rathen! Da kommt mein Begleiter, den ich verlassen habe, als ich Euch von Weitem erblickte. Vielleicht wäre es besser, ich hätte Euch in das Meer ohne Wasser reiten lassen!«
Sie stießen auf einen anderen Reiter, welcher auch den weißen Haïk trug.
»Dieser Mann ist ein Kaufmann aus Smyrna und heißt Hulam,« sagte der Riese zu ihm.
Erst jetzt betrachtete der Andere den Genannten. Ueber sein Gesicht zuckte eine Ueberraschung.
»Hulam? Pah! Ibrahim Pascha!«
»Graf Politeff!«
»Ist es möglich!«
»Allah ist groß und allmächtig. Er macht selbst das Unmögliche möglich!«
Der Riese stieß einen Fluch aus, schlug mit seiner Reitpeitsche durch die Luft und rief:
»Ibrahim Pascha! Also nicht Hulam?«
»Nein,« lachte der Graf.
»Allah verdamme Dich! Warum belügst Du mich?«
»Mein Name ist nicht für Jedermann hier,« antwortete der Pascha.
»Ibrahim Pascha! Ich kenne keinen!«
»Du sollst ihn kennen lernen,« sagte der Graf. »Er ist mein Freund. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, ihn hier in der Wüste zu treffen. Nun er aber hier ist, bin ich überzeugt, daß er ganz dasselbe will, was auch ich will, nämlich Dein Wohl, Falehd.«
»Falehd!« rief der Pascha.
»Nun ja!«
»Dieser Mann hier ist Falehd!«
»Weißt Du das noch nicht?«
»Nein. Er hat es mir nicht gesagt, trotzdem ich ihm mittheilte, daß ich zum Bruder des todten Scheik will.«
»Du würdest es zur rechten Zeit noch erfahren haben, wer ich bin,« knurrte der Riese. »Kommst Du aus Stambul vom Sultan?«
»Ja. Vorher aber war ich in Tunis.«
»Bei Mohamed es Sadock Pascha? Warst Du auch in Kairo beim Vicekönig?«
»Nein. Mit ihm habe ich nichts zu schaffen. Er will Dir nicht wohl; ich aber komme als Dein Freund.«
»Hast Du Vorschläge für mich?«
»Sogar höchst vortheilhafte.«
»So bist Du mir willkommen. Du sollst zwei Zelte haben, eins für Dich und eins für Dein Weib. Jetzt aber laßt uns eilen. Es kommt die Zeit des Nachmittaggebetes, zu welcher wir im Lager sein müssen.«
Bereits nach kurzer Zeit verdoppelten die Kameele freiwillig ihre Schritte. Sie witterten das Wasser der Oase. Der Sand verschwand und machte einer immer dichter werdenden Grasnarbe Platz. Palmen wuchsen hoch empor; Zelte lagen im Schatten derselben, Heerden weideten ringsum. Der Riese ritt stolz hindurch, keinen Menschen beachtend, von Allen aber mit scheuen, wohl auch finsteren Blicken bemerkt. Dann ließ er auf einem freien, von den Zelten gebildeten Platze halten. Die Umwohner desselben schienen zu den hervorragenderen und wohlhabenden Leuten des Stammes zu gehören, denn diese Zelte waren größer und auch aus theureren Stoffen gefertigt, als die anderen.
Was aber am Meisten auffiel, das war ein auf mächtigen Steinquadern fundirtes, umfangreiches Gemäuer, welches sich seitwärts hoch über das Zeltlager erhob. Wie kamen diese großen, schweren Steine hierher, wo es im Umkreise von vielen Meilen keinen Felsen gab? Jedenfalls war das Bauwerk in jener Zeit errichtet worden, als die Römer Egypten erobert hatten und mit ihrer Cultur sich in die Wüste wagten. Man findet tief in der Sahara noch Ueberreste riesiger Wasserleitungen und massiver Schlösser, heute freilich halb von Flugsand überschüttet, aber Zeugniß gebend von dem Unternehmungsgeiste eines Volkes, welches mit uns unbekannten Mitteln und mit Hilfe riesiger Anstrengung Leben mitten in den Tod der Wüste zu bringen verstand.«
Das erwähnte Gemäuer schien mitten in der Oase errichtet zu sein. Ob es bewohnt sei, konnte man von Außen nicht sehen. Der Anblick, welchen es bot, war ein ruinenhafter; doch hatte es eine bedeutende Ausdehnung, und so ließ sich vermuthen, daß es wohl Räume habe, welche sich noch jetzt zum Aufenthaltsorte von Menschen eigneten.
In jedem größeren Beduinenlager pflegt ein Gastzelt, vielleicht auch mehrere, vorhanden zu sein. So war es auch. Ibrahim Pascha erhielt ein leeres Zelt angewiesen, Zykyma, die er für seine Frau ausgegeben hatte, ein zweites. Beide Zelte waren mit den nöthigen Matten und Decken versehen, und bald wurden die beiden Genannten auch mit allem Anderen versorgt, was ihnen nothwendig war.
Dann, als man dem Pascha Zeit gelassen hatte, sich von dem anstrengenden Ritte auszuruhen, wurde er von Falehd und dem Grafen Polikeff besucht, welche eine so lange Unterredung mit ihm hatten, daß die Sonne im Verscheiden war, als die Beiden wieder aus dem Zelte traten.
Der Graf begab sich nach dem Zelte, welches ihm seit seiner Ankunft zugewiesen worden war. Der Riese aber schritt zwischen den Zelten hindurch nach der Ruine zu. Sein verbranntes Gesicht hatte einen harten, entschlossenen Ausdruck. Es lag wie Hohn und Schadenfreude in den Zügen, welche auf jeden Beschauer einen abstoßenden Eindruck hervorbrachten.
Das Gemäuer lag auf einer Bodenerhöhung, welche steil aus der Ebene emporstieg. Eine breite Treppe führte empor, wie für ein Riesengeschlecht gebaut. Zu beiden Seiten dieser Treppe saßen bewaffnete Araber, Einer auf je einer Seite jeder Stufe. Sie erhoben sich ehrfurchtsvoll, als er zwischen ihnen emporschritt. Die Stufen hatten früher nach einem hohen und breiten Thore geführt, welches aber später so weit vermauert worden war, daß der Eingang nur noch Raum für einen einzigen Eintretenden bot. Dort lehnte ein junger Beduine an der Wand. Er war nur mit Hose und Jacke bekleidet. Ein dünnes, weißes Tuch wand sich als Schutz vor der Sonnengluth um seinen Kopf. In dem kameelhärenen Stricke, welcher ihm als Gürtel diente, steckte ein langes, zweischneidiges Messer, die einzige Waffe, welche er außer der langen Flinte trug, welche neben ihm an der Mauer lehnte.
Dies war ganz dieselbe Bewaffnung, welche auch Hilal in Kairo getragen hatte, und wer in das Gesicht des Beduinen sah, mußte sich über die Aehnlichkeit wundern, welche er mit dem Genannten hatte. Und er war auch in Wirklichkeit kein Anderer als Tarik, Hilal's Bruder.
Als er den Riesen die Treppe besteigen sah, zogen seine Brauen sich unwillkürlich zusammen, doch hatte er Selbstbeherrschung genug, daß sein Gesicht sich schnell wieder glättete. Er trat einen Schritt zur Seite, so daß er nun gerade vor dem Eingange stand. Falehd sah das. Sein Gesicht nahm einen drohenden Ausdruck an. Er blieb auf der obersten Stufe stehen und richtete den Blick zur Seite, über das Zeltlager hinweg, als ob er da draußen, wo die Heerden weideten, nach irgend Etwas suche. Er erwartete, daß Tarik zur Seite treten werde, ohne aufgefordert zu sein. Als dies aber nicht geschah, wendete er sein stechendes Auge dem Jüngling zu und sagte:
»Siehst Du vielleicht, daß ich hier bin?«
In dem Tone seiner Worte lag eine nur mühsam unterdrückte Feindseligkeit. Tarik aber that, als ob er dies gar nicht bemerke. Er zwang sich, in einem verwunderten Tone zu antworten:
»Ich sehe es.«
»Ich bin auch groß genug, um bemerkt zu werden. Nun sage mir aber auch, ob Du klug genug bist, zu errathen, was ich hier will!«
»Ich stehe hier als Anführer der Leibwache der Königin. Ich habe nicht die Pflicht, Deine Gedanken zu errathen. Meine Pflicht ist nur, der Königin zu dienen.«
»So will ich mich herablassen, Dir zu sagen, daß ich zu ihr will. Mach Platz also!«
Wenn er der Ansicht gewesen war, daß Tarik ihm nun den Eingang freigeben werde, so hatte er sich geirrt. Der Genannte behielt vielmehr seine Stellung bei und meinte:
»Ist es nothwendig, was Du ihr zu sagen hast?«
»Hast Du etwa mich darnach zu fragen?«
»Ja.«
»Ha! Weißt Du nicht mehr, wer ich bin!« brauste der Riese auf.
»Ich weiß es,« erklang es ruhig.
»Nun, ich bin der Bruder des Scheiks, der Oberste in der Versammlung der Aeltesten, in Folge dessen also auch der Oberste des ganzen Stammes.«
»Ich weiß bis jetzt nur, daß die Wittwe des Scheiks die Anführerin des Stammes ist. Ich bin der Anführer ihrer Wache und habe also zu thun, was sie mir befohlen hat.«
»Befohlen?« lachte Falehd höhnisch. »Läßt ein freigeborener Beduine sich einen Befehl geben?«
»Ja, von Dem, dem er sich freiwillig unterordnet. Die Königin ist in ihrem Gemache. Sie will sich nur dann stören lassen, wenn dies durchaus nothwendig ist.«
»Es ist nothwendig. Mach also Platz.«
»Verzeihe! Ich werde sie erst fragen, ob sie bereit ist. Dich zu empfangen.«
Da ballte der Riese drohend die Faust, stieß einen Fluch aus und rief in verächtlichem Tone:
»Du? Du willst mir den Eingang verbieten? Was fällt Dir ein! Ich lasse mich von keinem Hunde anbellen und –«
»Halt!« antwortete Tank, ihm schnell in die Rede fallend. »Bedenke Deine Worte, ehe Du sie sprichst! Du stehst keineswegs über mir. Ich bin ebenso wie Du ein freier Sohn meines Stammes und würde jede Beleidigung augenblicklich mit einer Kugel beantworten!«
Er hatte blitzschnell seine Flinte ergriffen und den Finger an den Drücker gelegt. Falehd hatte keine Schußwaffe bei sich. Trotz seiner Körperstärke mußte er erkennen, daß Tarik ihm in diesem Augenblicke überlegen sei. Ebenso wußte er, daß dieser das Recht habe, jede Beleidigung augenblicklich mit einer Kugel zu beantworten. Darum hielt er an sich und sagte in einem scheinbar ruhigerem Tone:
»Soll ich nicht zur Königin?«
»Wenn sie es nicht erlaubt, dann nicht.«
»Sie ist meine Schwägerin!«
»Ein Weib braucht keinen Mann, als den ihrigen bei sich zu empfangen. Keiner kann sie zwingen. Und das Recht, welches sie als Weib hat, hat sie als Königin doppelt.«
»Bei Allah, Deine Ansicht ist eine seltene! Ich soll nicht zu ihr; Du aber willst zu ihr, um sie zu fragen!«
»Ich könnte zu ihr, denn ich bin ihr Beschützer; aber ich thue es dennoch nicht, denn ich achte sie. Dieselbe Achtung erwartet sie auch von Dir.«
Er drehte sich um und stieß einen scharfen Pfiff aus, welcher in den Eingang schallte. Nach wenigen Augenblicken ließ sich von innen eine fragende weibliche Stimme hören.
»Falehd ist hier und hat nothwendig mit der Herrin zu sprechen,« antwortete Tarik.
»Ich werde sie fragen,« antwortete es.
Der Riese horte es. Er trat einen Schritt zurück, stampfte mit dem Fuße und knirrschte:
»Auf diese Weise werden, wie ich gehört habe, die Diener der abendländischen Herrscher empfangen. Ich aber bin kein Diener, kein Sclave. Ich komme, wenn ich will, und gehe, wenn es mir beliebt. Diese neue Sitte, den Aeltesten des Stammes zu empfangen, soll nicht lange mehr geduldet werden. Das verspreche ich Dir!«
Tarik antwortete nicht; er zuckte sehr gleichmüthig mit der Achsel, und horchte dann in den Eingang zurück, wo sich jetzt die betreffende Stimme wieder hören ließ:
»Er soll kommen!«
»Du darfst eintreten,« sagte jetzt der jugendliche Wächter, indem er die Thür frei gab.
»Ich darf! So! Darf ich wirklich?« höhnte der Riese.
»Ja,« lachte der Andere.
Und dieses Lachen hatte etwas so Selbstbewußtes und zugleich Ironisches, daß Falehd die beiden Fäuste erhob und wüthend ausrief:
»Nun, die Zeit, in welcher ich darf, wird bald vorüber sein. Dann wird die Zeit kommen, in welcher ich zu bestimmen habe, was und ob Andere dürfen. Und da wirst Du Derjenige sein, der gar Nichts darf!«
Nach dieser Drohung trat er ein. Er mußte sich bücken, um nicht oben an das Mauerwerk zu stoßen. Auf ihn hätte das Bibelwort gepaßt: »Er ist allein übrig geblieben von den Kindern der Riesen.« Das enge Thor führte durch eine mehrere Ellen starke Mauer, dann gelangte man in einen kleinen, viereckigen Hof, welcher gerad gegenüber eine ähnliche Thür offen ließ. Diese führte in einen ziemlich langen, finstern Gang, welcher in einem kleinen Gemache endete, dessen ganze Ausstattung in einer brennenden Palmöllampe und zwei auf dem Boden liegenden Kokosfaserdecken bestand.
Der Riese wurde hier von einer alten Frau erwartet, dieselbe, welche auf Tarik's Pfiff geantwortet hatte.
»Bleib hier!« sagte sie. »Badija wird gleich kommen.«
Er staunte sie mit blitzenden Augen an.
»Was? Hier bleiben?« fragte er.
»Ja.«
»Warten soll ich! Falehd soll warten! Bei allen Teufeln der untersten Hölle, das ist lustig!« lachte er laut auf. »Willst Du etwa auch hier bleiben?«
»Ich habe bei Dir zu warten, bis sie kommt.«
»Wie herrlich! Wie entzückend! Du, die Liebliche, die Bezaubernde, sollst bei mir bleiben, bis es Deiner Herrin beliebt, zu Falehd zu kommen!« Und mit ausgestreckten Fäusten auf sie zutretend, fuhr er fort:
»Packe Dich, Hexe! Wenn Du nicht augenblicklich verschwindest, werfe ich Dich an die Wand, daß Du mit Leib und Seele daran kleben bleibst als ewiges Beispiel, welch' ein Wagniß es ist, Falehd zu erzürnen!«
Sie kreischte vor Angst laut auf und entfloh durch die dem Eingange gegenüber liegende Thür.
»Allah inhal el bakk!« knurrte er ihr zornig nach.
Das heißt zu Deutsch: Gott verdamme die Wanze. Das Wort Wanze ist der verächtlichste Ausdruck, den der Araber einer weiblichen Person zu geben vermag.
Er hatte nicht lange zu warten, denn kaum war das Weib verschwunden, so trat die Königin der Wüste ein. Bei ihrem Anblicke leuchteten seine Augen verlangend auf. Und er hatte wohl Veranlassung dazu.
Sie war vollständig in feines, weißes Linnen gekleidet. Ihr Gewand bestand nur aus Hose, Hemde und einem kleinen Jäckchen, so daß ihre herrlichen Formen mehr hervorgehoben als verborgen wurden. Eine schönere Rundung, als die Linien ihres Körpers zeigten, konnte es gar nicht geben. Das nackte Füßchen schien einem Kinde anzugehören und war von blendender Weiße. Das allerliebste und doch sehr fleischige Händchen harmonirte vollständig mit demselben. Da, wo die Hose sich um die Taille legte, glitt sie über Hüften, von welchen der Blick nur schwer zu trennen war. Die Jacke, welche oben eng um den wie aus Marmor gemeißelten Hals befestigt war, lief über der Brust auseinander und ließ die von dem Hemde bedeckten Formen eines Busens sehen, so jungfräulich plastisch, obgleich ihn kein abendländischer Schnürleib stützte. Das Gesicht zeigte eine große Aehnlichkeit mit demjenigen ihrer Schwester Hiluja. Es war ebenso weich, aber in seinen Zügen ernster, tiefer, nachdenklicher. Die nicht zu hohe Stirn erhob sich über dunklen Brauen von wunderbarer Zeichnung. In den ebenso dunklen Augen schienen die sämmtlichen Geheimnisse des Morgenlandes zu schlafen, um bei dem ersten Worte einer erwiderten Liebe zu voller Seligkeit zu erwachen. Das Näschen, leicht gebogen, ließ in seinen feinen, rosig angehauchten Flügeln, welche leicht zu zittern schienen, vermuthen, daß Badija's Seele leicht in Erregung zu bringen sei, und die vollen, rothen Lippen, zum Küssen und Geküßtwerden geformt, waren in ihren Winkeln doch ein Wenig nach oben gezogen, ein sicheres Zeichen, daß dieser schöne Mund in letzterer Zeit wohl oft Gelegenheit und Veranlassung zum Zürnen gehabt habe. Das rabenschwarze Haar hing in zwei langen Zöpfen fast bis auf den Boden herab. Es war nicht mit dem mindesten Schmucke versehen, den doch sonst die Beduininnen so sehr lieben. Wozu auch? Es bildete ja selbst den herrlichsten Schmuck der Königin der Wüste, und einen Schmuck zu schmücken wäre ja widersinnig.
Bei dem Anblicke dieses herrlichen Wesens vergaß der Riese seinen Zorn.
»Sallam!« grüßte er. »Allah gebe Dir Friede!«
»Das wünschest Du mir. Du?« fragte sie, den Blick verwundert auf ihn richtend.
»Ja, ich. Du hörst es ja!«
»So stimmen Deine Wünsche nicht mit Deinen Handlungen. Von Dir ist mir noch nie Friede gekommen. Selbst jetzt erschreckst Du meine Dienerin.«
»Sie ist ein dummes Weib, ein Scheusal, welches – –«
»Scheu – – sal – –?!«
Sie richtete ihre Gestalt stolz empor. Der Ton, in welchem sie sein Wort wiederholt hatte, war ein eigenartiger; er konnte nicht beschrieben werden; er war nicht scharf, nicht herrisch, aber es war dennoch nicht möglich, ihm zu widerstehen. Selbst Falehd, dieser stolze, eingebildete und rücksichtslose Mann, sah sich durch ihn zu einer Entschuldigung gezwungen:
»Verzeihe! Sie erzürnte mich.«
»Du verlangst meine Verzeihung und konntest ebenso gut ihr verzeihen. Ich glaube, Du hast sie und nicht sie hat Dich erzürnt. Es klingt selbst für einen Helden rühmlich, wenn man von ihm sagt, daß er höflich sei.«
»Das weiß ich, und ich hoffe, daß Du mir Gelegenheit giebst, höflich gegen Dich zu sein und auch höflich gegen Dich zu bleiben!«
»Ich gebe Niemandem die Veranlassung, die Achtung zu vergessen, welche man der Frau und der Anführerin schuldig ist. Du hast mir sagen lassen, daß Du Notwendiges mit mir zu sprechen habest. Setze Dich!«
Sie deutete auf eine der Decken, welche sich gegenüberlagen. Der Riese bückte sich bereits, um ihrer Aufforderung nachzukommen, richtete sich aber unter dem Einflusse eines plötzlichen Gedankens wieder auf.
»Wirst Du Dich auch setzen?« fragte er.
»Nein. Ich kann Dich stehend hören.«
»So werde auch ich stehend sprechen.«
»Ich erlaube Dir doch. Dich zu setzen.«
»Ich danke Dir! Ich würde mich, wenn es mir beliebte, auch ohne Deine Erlaubniß setzen; aber ich verzichte darauf. Man könnte dann vielleicht sagen, ich hätte meine Kniee vor Dir gebeugt. Falehd beugt sich nie.«
»So bleibe stehen und sprich!«
Sie legte die Arme über der Brust zusammen. Wenn das eine Frau thut, so kann man als sicher annehmen, daß sie Energie und festen Willen besitzt. Er ließ sein Auge über ihre stolze Gestalt gleiten und fragte:
»Kannst Du denn nicht errathen, was ich will?«
Er versuchte, seiner Stimme einen weichen Klang zu geben, aber anstatt weich klang sie heiser. Sie war eines solchen Zwanges nicht gewohnt, weil Weichheit gar nicht in der Natur des Riesen lag. Nachdem Badija auch ihren Blick kalt und forschend über seine Gestalt hatte gleiten lasten, antwortete sie:
»Ich bin nicht hier, um zu rathen. Du hast mit mir sprechen wollen, also sprich!«
»Bei Allah, Du thust, als seist Du wirklich Königin!«
»Ich weiß, daß ich es nicht bin. Ich dulde nur den Namen, den Ihr mir gegeben habt.«
»Du wirst ihn nicht mehr lange tragen. Jetzt noch bist Du die Beherrscherin des Stammes; aber weißt Du, seit welcher Zeit mein Bruder todt ist?«
»Seit einem Jahre; das weiß Jedermann.«
»Seit einem Jahre, ja. Das ist das Jahr der Trauer. Es ist vorüber, Wir brauchen Dir nicht mehr zu gehorchen.«
»So gehorcht Einer oder einem Andern!«
»Das werden wir. Du aber mußt nach den Gesetzen unseres Stammes das Weib dieses Andern sein.«
»Muß ich?«
»Ja, Du mußt.«
»Muß ich wirklich?«
Bei dieser Wiederholung ihrer Frage klang ihre Stimme plötzlich schneidend, und ihr Blick richtete sich wie eine kalte, dünne Dolchspitze auf sein Gesicht. Er zeigte keine Spur von Zorn. Er zuckte nur überlegen die Achsel, schüttelte, wie sich wundernd, den Kopf und antwortete:
»Natürlich mußt Du! Das versteht sich ja ganz von selbst. Du bist die Angehörige und jetzt sogar die Herrin unsers Stammes, und als solche hast Du am Allerersten die Verpflichtung, die Gesetze desselben zu achten.«
»Und wenn ich das nicht thäte?«
»O, das kann ja gar nicht vorkommen!«
»Ich sage Dir, daß es sogar sehr leicht vorkommen kann.«
»So würden wir Dich zwingen!«
Auch er schlang die Arme über der Brust zusammen und lehnte sich hoch aufgerichtet an die Mauer, so wie sie drüben sich angelehnt hatte. So standen sich die Beiden drohend gegenüber, sie ein schwaches Weib und doch so schön, so herrlich, so entzückend, und er, trotz seiner Kraft und Stärke so häßlich, so abstoßend.
»Mich zwingen?« lächelte sie. »Ich möchte Den sehen, der mich zwingen wollte, das Weib eines Mannes zu werden, dessen Weib ich nicht sein will!«
»Jeder, Jeder wird Dich zwingen!«
»Ah! Du wohl auch?«
»Ja, ich auch. Du bist die Unsrige und hast Dich nach unseren Gebräuchen zu richten.«
»Die Eurige?« fragte sie. »Das sagst Du wohl, aber es ist nicht so; ich bin nie die Eurige gewesen!«
Ihre Stimme klang beinahe so, als ob ihr vor Etwas graue. Langsam und stockend fuhr sie fort:
»Dein Bruder begehrte mich zum Weibe; er war alt, er konnte kein Herz erobern. Ich gehorchte meinem Vater, der ihm seinen Wunsch erfüllte. Ich war gewohnt, dem Vater zu gehorchen, und es gab Keinen, dem mein Herz gehörte. Nur darum wurde ich das Weib Deines Bruders.«
»Das war sehr gnädig und barmherzig von Dir gegen uns gehandelt!« höhnte er. »Giebt es vielleicht nun jetzt Einen, dem Dein Herz gehört?«
»Hast Du vielleicht darnach zu fragen?«
»Vielleicht, ja!«
»Laß das ja bleiben! Ich wurde Deines Bruders Weib, aber ich lernte ihn nicht lieben. Ich blieb ihm fremd, und er blieb es mir. Er hat mich nie berühren dürfen.«
»Ja, ich weiß, daß Du noch ganz so Jungfrau bist, wie Du es warst, bevor Du zu uns kamst.«
»Daraus magst Du erkennen, daß ich nicht die Eurige bin. Ich werde nur dem Manne gehören, dem mein Herz gehört. Giebt es hier so Einen, so wird er Euer Scheik sein; giebt es Keinen, so bleibe ich ledig und Eure Anführerin oder, wenn Ihr dies nicht zugebt, gehe ich nach Hause zu den Zelten meines Stammes.«
Er antwortete nicht. Erst nach einer Weile fragte er:
»Schläfst Du?«
»Ich glaube, sehr wach zu sein.«
»Nein, Du schläfst, denn Du träumst. Das, was Du soeben sagtest, kannst Du nur im Traume sagen. Du magst meinem Bruder erlaubt haben oder nicht, Dich zu berühren, so bist Du doch jetzt eine Angehörige der Beduinen des Stammes Sallah. Bei uns gilt das Gesetz, daß eine Wittwe dem nächsten Verwandten ihres verstorbenen Mannes gehört. Der nächste Verwandte meines Bruders bin ich. Du wirst mein Weib sein!«
»Niemals!«
»Ach! Du liebst mich nicht?« lachte er.
»Ich hasse Dich!«
»Das stört mich nicht. Du wirst mich lieben lernen. Ich werde Dich anders behandeln, als mein Bruder. Er war stolz darauf, daß Du sein Weib hießest; ich aber werde dafür sorgen, daß Du es auch wirklich bist.«
»Das wird nie geschehen!«
»Sogar sehr bald. Ich komme ja eben, um Dir zu sagen, daß heute Abend die Versammlung der Aeltesten zusammentreten wird, um über diese Frage zu entscheiden. Das Jahr ist vorüber, und der Entscheidung dieser Versammlung mußt Du Dich fügen.«
»Lieber sterben!«
»Klage jetzt! Du wirst in meinen Armen die glücklichste der Sterblichen sein. Man muß Dich mir zusprechen. Nur ein Kampf auf Leben und Tod könnte Dich zum Weibe eines Andern machen. Und glaubst Du, daß es jemals Einen geben könnte, welcher es wagen möchte, mit mir, mit Falehd zu kämpfen?«
»Ich weiß es, daß Du mit Deiner Stärke trotzest; aber Allah ist mächtig; er kann einem Knaben die Kräfte eines Riesen geben.«
»So wollen wir abwarten, ob er es thut. Nach dem Gebrauche des Stammes muß ich, wenn Du mir zugesprochen wirst, drei Tage lang warten, ob sich Einer findet, welcher mit mir kämpfen will. Ich würde mich freuen, wenn sich Einer meldete; ich würde ihn zermalmen, daß selbst die Fetzen seiner Seele nicht mehr zu finden wären. Am vierten Tage bist Du mein Weib, und Niemand kann daran das Geringste ändern, selbst Du nicht. Es wird Zeit, daß der Stamm wieder einen Scheik bekommt. Die Zeiten sind ernst. In wenigen Wochen wird sich über Egypten das Geschrei des Krieges erheben, und auch unsere Tapferen werden nach dem Nile ziehen, um dem Vicekönige zu zeigen, was wir vermögen.«
»Ihr wollt gegen ihn kämpfen?«
»Was sonst? Ist er unser Freund?«
»Ist er etwa Euer Feind?«
»Er ist der Feind Aller. Er hat dem Sohne der Wüste sein Land genommen; er fordert Steuern und Tribut; er läßt den Fellah, welcher dies nicht bezahlt, von seinen Arnauten peitschen. Heute ist ein Abgesandter des Sultans gekommen, des eigentlichen Beherrschers des Landes; ein Gesandter des Sultans von Rußland ist längst schon hier. Beide werden heute an der Versammlung der Aeltesten mit Theil nehmen. Die ehrwürdigen Männer werden den Krieg gegen den Vicekönig beschließen. Das ist sicher und gewiß!«
»Das verhüte Allah!«
»Du bist ein Weib. Was verstehest Du von diesen Dingen! Das ist Männerangelegenheit!«
»Vielleicht verstehe ich ebensoviel davon wie Du! Der Sultan der Russen ist nie der Freund des Sultans von Stambul gewesen. Wenn sich die Gesandten dieser beiden Herrscher hier bei uns befinden, so spielt wenigstens einer dieser Gesandten eine falsche Rolle. Uebrigens glaube ich kein Wort!«
»Wovon?«
»Daß diese Zwei sich hier befinden.«
»Sie sind hier!«
»So müßte ich es ebenso gut wissen. Du vergissest immer, daß Du ein Weib bist!«
»Ich werde Dir zeigen, daß ich auch Mann bin! Du wirst es heute in der Versammlung erfahren.«
»Ah! Willst Du vielleicht auch kommen?«
»Ja.«
»Ich hindere Dich keineswegs daran; Du wirst ja nur kommen, um Zeuge meines Sieges zu sein. In vier Tagen bist Du meine Frau, mein Eigenthum. Daran kann kein Mensch Etwas ändern.«
»Wenn kein Anderer, so doch ich selbst!«
»Du wirst und mußt Dich fügen! Ich will Dich besitzen, und so werde ich Dich besitzen. Du bist schön, und von mir soll man nicht sagen, daß ich Dich nicht berühren darf. Mein Weib will ich genießen!«
»Es wäre mein Tod oder der Deinige!«
»Du träumst wieder! Was wolltest Du thun? Könntest Du es mir zum Beispiel verwehren, wenn ich Dich jetzt hier umarmen wollte?«
»Ja!«
»Du träumst wirklich!«
»So ersiehst Du daraus, daß es mir selbst im Traume nicht einfallen würde, mich von Dir berühren zu lassen!«
»Und im Wachen wohl noch viel weniger?«
»Ja!«
Er war ihr einen Schritt näher getreten. Seine Augen glühten vor Begierde. Er hatte sie stets nur in der Umhüllung des Mantels, nie aber so gesehen wie jetzt. Er fühlte den Eindruck ihrer Schönheit in seiner unwiderstehlichen Stärke und hatte wirklich die Absicht, ihr jetzt seine Liebkosung aufzuzwingen.
Sie sah das. Sie war bleich geworden, aber dennoch wich sie nicht von der Stelle, auf welcher sie stand. So bohrten sich ihre Blicke in einander, sein glühend verlangender und ihr verächtlich drohender.
»Mir, mir wolltest Du widerstehen?« zischte er.
»Ich fürchte Dich nicht, obgleich Deine Liebe noch entsetzlicher ist als Dein Zorn und Deine Feindschaft.«
»So sage ich Dir, daß ich Dich jetzt küssen werde!«
»Das wäre eine Beleidigung des ganzen Stammes. Ich bin die Wittwe des Scheiks und gehöre noch keinem Andern!«
»Was scheere ich mich um den Stamm!.«
»Die Beleidigung würde augenblicklich gerächt werden!«
»Das wollen wir sehen! Komm in meine Arme!«
Er öffnete wirklich die Arme und trat auf sie zu.
»Zurück, Elender!«
Das klang so befehlend, so unerschrocken, daß er unwillkürlich einen Schritt zurückwich. Er betrachtete sie mit Erstaunen und sagte dann lachend:
*