
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Von – – von – – nun, von – – –«
Er konnte nicht weiter; er stockte. Er sah erst jetzt ein, in welch' eine dumme Gasse er sich verlaufen habe. Auch er wurde roth, doch war er zu geistesgegenwärtig, um sich so leicht verblüffen zu lassen; er fuhr vielmehr sofort und in entschiedenem Tone fort:
»Nein, das ist nichts; das geht nicht. Diese Verwandtschaft ist doch wohl ein Wenig zu eng und zu nahe. Nicht?«
»Ich weiß das nicht, wenn Du es nicht weißt?«
»Ich denke es nur. Wenigstens scheint das zu fehlen, was dazu ganz unumgänglich nothwendig wäre.«
»Was ist das?«
»Die Liebe.«
»Die ist doch wohl bei jedem Grade der Verwandtschaft nöthig. Denkst Du nicht?«
»Ja; aber in verschiedener Menge. Je ferner der Verwandtschaftsgrad ist, desto winziger wird das dazu nöthige Stückchen Liebe. Zwischen uns Beiden aber ist die Liebe doch nur so groß, daß wir höchstens Vetter und Muhme im fünfzigsten Grade sein könnten.«
»Gar nicht ein Bischen näher, Hilal?«
»Wohl kaum. Höchstens im neunundvierzigsten.«
»Ich dachte, im dreißigsten!«
»Das wäre zu nahe, außer Du wünschest es; dann aber wäre mir der zwanzigste doch noch lieber.«
»Mir der zehnte.«
»Oder der fünfte.«
»Oder der zweite.«
»Halt, Hiluja! Merkst Du nicht, daß unsere Liebe ganz außerordentlich schnell wächst? Das ist sehr gefährlich. Wer in einer Minute so viele Verwandtschaften durchfliegt, der – der – – der – – –«
»Nun, der – – –?«
»Der – – höre, Hiluja, ich weiß wirklich nicht, was ich eigentlich habe sagen wollen.«
Nur wer Menschenkenner ist oder selbst eine solche von aller Raffinerie ferne Liebe in seinem Herzen getragen hat, weiß, daß zwei Liebende sich viele, viele Stunden lang in völlig inhaltslosen Worten unterhalten können, ohne die geringste Langweile zu empfinden. Es genügt ihnen vollständig, daß sie bei einander sind, daß sie gegenseitig ihre Stimmen hören. Was dabei gesprochen wird, das ist vollständige Nebensache. Das süße, entzückende Kosen herüber und hinüber, von Mund zu Mund, würde entweiht sein durch die Nothwendigkeit einer Logik, mit welcher nur der Verstand rechnet, von welcher aber die Liebe ihr Glück niemals abhängig macht.
So auch diese beiden natürlichen Menschenkinder hier. Sie hatten keine Ahnung, daß sie wegen ihrer Plauderei von jedem unbetheiligten Zuhörer ausgelacht worden wären. Aber selbst wenn sie es gewußt hätten, so hätte es sie wenig genug gekümmert, wenigstens aber wohl nicht irre gemacht.
Er hielt noch ihre Hand gefaßt. Es war ihm, als ob er dieses kleine, weiche, hellbraune Händchen gar nicht wieder loslassen dürfe. Sie lachte laut auf bei seinen Worten und scherzte:
»Wenn Du es nicht mehr weißt, so hast Du wohl überhaupt gar nichts sagen wollen?«
»O nein! Ich wollte Dir im Gegentheil sehr, sehr Vieles sagen, Hiluja.«
»So sage es doch!«
»Das ist ja unmöglich. Die Zeit ist zu kurz.«
»Ist es denn so lang, was Du sagen wolltest?«
»Ganz ungeheuer lang!«
»Wie lange Zeit brauchtest Du wohl dazu?«
»Mein ganzes Leben.«
»O wehe! Wir können doch nicht bis zu Deinem Tode hier stehen bleiben, um zu warten, bis Du fertig bist!«
»Nein. Wir könnten dabei auch anderswo hingehen. Wir könnten dabei sitzen, reiten, backen, braten, kochen und Vielerlei und Allerlei treiben.«
»Ohne irre zu werden in Dem, was Du mir mitzutheilen hast?«
»Ohne irre zu werden! Ja, es ist sehr leicht und einfach; denn nicht nur ich allein, sondern ein Jeder, der Dich sieht, wird den Drang fühlen, Dir ganz dasselbe zu sagen.«
»Da bin ich doch sehr neugierig. Darf ich denn nicht wenigstens einen kleinen Anfang hören?«
»Ja, gern.«
»Wie lautet er denn?«
»Er lautet: Hiluja, ich bin Dir so un-, un-, unbeschreiblich gut!«
»Dieser Anfang gefällt mir. Kannst Du mir da wohl auch das Ende sagen?«
»Ja. Es heißt: Meine liebe, süße Hiluja, ich bin Dir noch immer so unbeschreiblich gut!«
»Das ist ja das Ende gar nicht!«
»Weil es überhaupt kein Ende hat. Ich bin Dir ja so gut, so unaussprechlich gut jetzt und in alle Ewigkeit. Und die Ewigkeit hat kein Ende.«
»Dann nützt es auch nichts, bis zu Deinem Tode hier stehen zu bleiben.«
»O nein. Darum meinte ich ja auch, daß wir unterdessen verschiedenes Andere treiben könnten.«
»Backen und braten?«
»Ja, und herzen und küssen! So ungefähr!«
Er zog sie warm an sich und legte seine Lippen auf ihren Mund. Sie erwiderte ganz ohne Scheu seinen Kuß, strich leise mit der Hand über die gebräunte Wange und flüsterte:
»Ist es denn wahr, daß Du mir so sehr gut bist?«
»So sehr, daß es gar nicht zu beschreiben ist! Bist Du mir vielleicht bös darüber?«
»O nein, ich bin vielmehr ganz glücklich darüber. Aber, gestern Abend, da draußen, warst Du mir wohl noch nicht so gut?«
»Noch nicht? Warum fragst Du so?«
»Weil Du es mir da nicht gesagt hast.«
»O, ich hatte Angst.«
»Angst? Vor wem?«
»Vor Dir.«
»So muß ich doch ein recht furchterweckendes Wesen sein. Und doch bist Du mir gut? Das ist wunderbar!«
»Ja, ich hatte Angst, gerade weil ich Dich so sehr lieb habe. Heute aber bin ich muthig, sehr muthig.«
»Woher kommt da dieser plötzliche Muth?«
»Ich glaube es ist daher, daß mein Bruder Scheik geworden ist und daß ich nun verwandt mit Dir bin. Der Bruder eines Scheiks darf doch etwas wagen. Nicht?«
»Gewiß. Du bist ein Krieger und Held; das habe ich ja gesehen und an mir selbst erfahren; vor mir aber hast Du Angst gehabt; das läßt sich eigentlich gar nicht mit einander vereinigen.«
»Sehr gut sogar. Ich habe nämlich vor Dir, vor Deiner Person nicht Angst gehabt, sondern nur vor Deinem Munde.«
»Den Du jetzt küssest?«
»Ja, den ich jetzt küsse, jetzt und jetzt wieder. Ich dachte, dieser kleine, rothe, süße, warme Mund könnte mir ein strenges, abweisendes Wort sagen; lieber wollte ich gar nicht sprechen. Siehe, das war meine Furcht und meine Angst. Jetzt aber, nun – – –«
»Nun? Sprich' doch weiter!«
»Nun ist alle Angst vorbei. Jetzt ist dieser Mund mein; jetzt darf er nur das sagen, was ich gern habe.«
»Oho! Wenn er nun nicht will!«
»So küsse ich ihn; dann gehorcht er gern.«
»Oho!«
»Gewiß!«
»Versuche es doch!«
»Ja, ich werde es versuchen. Sage doch einmal zu mir: mein lieber, lieber Hilal!«
»Du wunderlicher, eingebildeter Hilal!«
»So nicht, so nicht! Das war falsch! Warte, jetzt werde ich sofort mein Mittel anwenden. Komm her!«
Er legte seine Hände an beide Seiten ihres Köpfchens, hob ihr Gesicht empor, küßte sie dreimal, vier-, fünfmal auf den glücklich lächelnden Mund und sagte dann:
»Jetzt nun sage es: mein lieber, lieber Hilal!«
Sie legte die Arme um ihn, schmiegte sich an seine Brust und flüsterte leise aber gehorsam:
»Mein lieber, lieber, guter Hilal!«
»Siehst Du, siehst Du, wie so ein Kuß hilft!« sagte er blitzenden Auges. »Jetzt muß ich Dich belohnen.«
Natürlich bestand der Lohn ganz in derselben Münze: Mund auf Mund und Kuß auf Kuß. Hiluja war ganz Hingebung; ihr Gesicht strahlte vor Entzücken. Sie fühlte nur das Glück der still in sich getragenen und nun erhörten Liebe. Und als er fragte:
»Bist Du glücklich, mein Leben?«
Da nickte sie ihm wonnevoll zu und antwortete:
»Ja. Ich hatte nur den Wunsch, von Dir geliebt zu sein. Nun ist er mir erfüllt.«
»So gebe Allah seinen Segen, sonst werden wir niemals vereinigt sein.«
»Wieso?«
»Dein Vater liebt mich nicht.«
»Wie könntest Du dies sagen! Ist er doch nur erst diese wenigen Stunden hier!«
»Und dennoch habe ich es bemerkt. Vorhin, wenige Augenblicke bevor ich zu Dir kam, stand ich an der Mauer und er schritt langsam mit einem der Aeltesten vorüber. Dabei warf er einen kalten, stolzen, finsteren Blick auf mich und sagte, aber in der Weise, daß ich einsehen mußte, es gelte mir:
»Badija ist ihm geschenkt. Mit Hiluja wäre dies unmöglich. Sie ist bereits versprochen.«
»Wie? Das hat er gesagt?« fragte das Mädchen erschrocken.
»Ja. Und dabei hat er mich angeblickt, als ob er mir ganz deutlich sagen wolle: das nimm Dir nur zu Herzen, denn nur für Dich habe ich es ausgesprochen!«
»Unmöglich! Er weiß doch gar nicht, daß wir uns lieben!«
»Vielleicht ahnt er es.«
»Ahnen? Woher?«
»Das kann ich nicht sagen. Aber ist es denn wirklich wahr, daß Du versprochen bist?«
»Ich habe noch kein Wort davon vernommen.«
»Er würde es doch nicht sagen, wenn es nicht wahr wäre!«
»So hat er es ohne mein Wissen gethan.«
»Ja, es giebt Väter, welche ihre Kinder versprechen, ohne nach deren Einwilligung zu fragen.«
»Von meinem Vater aber sollte mich dies sehr wundern, da er mich so innig liebt.«
»Vielleicht hat er es gerade aus Liebe gethan. Derjenige, dessen Weib Du werden sollst, ist vielleicht ein berühmter Scheik oder Krieger.«
»Was geht das mich an! Ich liebe Dich. Nicht die Berühmtheit macht glücklich, sondern nur die Liebe allein.«
»Vielleicht handelt er auch im Interesse seines Stammes.«
»Das gilt mir gleich. Ich liebe Dich; das ist mein Interesse!«
»Wenn er Dich nun zwingen wollte?«
»Ich würde nicht gehorchen, ich lasse mich nicht zwingen!«
Sie sagte das in festem, bestimmtem Tone. Er zog sie mit dem einen Arm an sich, strich mit der anderen Hand liebkosend das reiche Haar und die langen, dicken Zöpfe und sagte in beruhigendem Tone:
»Der Prophet sagt: der Segen der Eltern ist die oberste Stufe zum Paradiese.«
»So meinst Du, daß ich gehorchen soll?«
»Ja, das meine ich.«
Da riß sie sich von ihm los und sagte in zornigem Tone:
»Das kannst Du mir sagen! Du, Du!«
»Ich muß es sagen, meine liebe, liebe Hiluja.«
»So liebst Du mich nicht.«
»Mehr als je, wenn dies überhaupt möglich wäre. Gerade wenn man an die Möglichkeit denkt, sein Allerliebstes aufgeben zu müssen, fühlt man die Liebe in ihrer größten Gewalt und Macht.«
»Wie kannst Du aber so ruhig denken, daß ich einem Anderen gehören soll!«
»Ruhig?« fragte er. »Meinst Du wirklich, daß ich ruhig bin?«
»Ja, ich sehe es doch!«
»Weil ich weder ein Weib noch ein Knabe bin. Man könnte mir das Herz aus dem Leibe reißen, ich würde doch mit keiner Wimper zucken. Ich bebe innerlich bei dem Gedanken, daß ich von Dir lassen müsse, aber ich kann nicht jammern und klagen.«
»Aber zornig werden sollst Du, zornig!«
»Das kann ich nur dann werden, wenn Dein Erzeuger tyrannisch an Dir handelt, nicht aber als Vater.«
»Das thut er doch, wenn er mich einem Anderen giebt.«
»Vielleicht nicht. Wir müssen das Nähere abwarten.«
»So warte Du es ab!«
Sie wendete sich zur Seite und schritt nach der inneren Thür, durch welche er vorhin gekommen war. Schon hatte sie sie geöffnet; schon wollte sie hinaus.
»Hiluja!« bat er.
Sie blieb stehen, ohne sich aber umzudrehen.
»Hiluja!«
»Was?«
»Du willst gehen?«
»Ja.«
»Bleibe noch!«
»Wozu? Du liebst mich doch nicht!«
»An diese Worte glaubst Du selbst doch nicht. Komm her zu mir. Drehe Dich um!«
»Nein!«
»Kennst Du mein Mittel noch, Dich gehorsam zu machen?«
»Gehe!«
»Nein, ich komme vielmehr.«
Er schritt hin zu ihr, umschlang sie von hinten, zog ihr Köpfchen nach sich herüber und küßte sie mehrere Male.
»Hilal, o mein Hilal!« rief sie fast weinend, indem sie sich schnell zu ihm herumwendete. »Ich liebe Dich so sehr, ich mag Dir nicht zürnen; aber wenn ich denke, daß Du mich aufgeben könntest, so möchte ich lieber sterben.«
»Denkst Du, daß ich leben möchte ohne Dich?«
»Du sagtest doch, daß ich gehorchen solle.«
»Ja, das sagte ich, und ich sage es auch jetzt noch. Im Koran steht geschrieben: Wohl dem Kinde, welches dem Vater gehorcht. Gott wird ihm das gebrachte Opfer tausendfach anrechnen.«
»Aber ich spreche nicht vom Koran!«
»Und der Koran spricht nicht von Dir und Deinem Vater. Denke Dir, Dein Vater hätte vor langen Jahren, da Du noch ein Kind warst, sein Wort gegeben.«
»Er kann es zurücknehmen.«
»Wenn er nun beim Propheten oder bei dem Barte seines Vaters geschworen hätte!«
»Oh, Allah! Diesen Schwur müßte er halten! Aber ich bin überzeugt, daß er weder ein solches Versprechen noch einen Schwur abgelegt hat.«
»So denke Dir, daß er durch Deine Verheirathung mit einem mächtigen Manne seinen Stamm zu Ruhm, Ehre und Wohlstand bringen will. Bist Du da dem Stamme nicht schuldig, dem Vater zu gehorchen?«
Sie schwieg.
»Bitte, antworte mir!«
»Warum bist gerade Du es, der mir dies sagt!«
»Weil ich es am Ehrlichsten und Aufrichtigsten mit Dir meine.«
»Und weil Du mich am Wenigsten liebst!«
»Das sagst Du wieder, ohne es zu glauben. Es ist meine Pflicht, Dir dies Alles zu sagen. Aber meine nicht, daß ich Dich ohne Kampf aufgeben würde. Ich werde mit Deinem Vater sprechen – – –«
»Wann? Bald? Heute noch?« fiel sie schnell und in freudigem Tone ein.
»Nein, so schnell nicht. Das wäre übereilt und unvorsichtig. Er soll mich erst kennen lernen.«
»Und wenn er Dich abweist?«
»So werde ich ihn nach den Gründen fragen.«
»Wenn er sich weigert, sie Dir zu sagen!«
»Ich bin ein Mann, dem er wohl Rede stehen wird. Thut er es nicht, so erkenne ich seine Gründe nicht an und nehme Dich zum Weibe gegen seinen Willen.«
»Mein lieber, lieber Hilal!« jubelte sie auf. »Würdest Du das wirklich thun?«
»Ja, ich thäte es.«
»Wenn er Dir aber seine Gründe sagte!«
»So käme es ganz darauf an, ob ich sie anerkenne oder nicht. Im letzteren Falle würde ich nicht von Dir lassen, im Ersteren aber würde ich zu Demjenigen gehen, dem Du bestimmt bist, und mit ihm um Dich kämpfen; Deinem Vater aber würde ich keinen Widerstand leisten.«
»Allah sei Dank! Mein Herz ist wieder leicht.«
»Ja, Du verstandest mich falsch.«
»Jetzt glaube ich wieder, daß Du mich lieb hast.«
»Hast Du denn gar keine Ahnung, für wen er Dich bestimmt haben könnte?«
»Ich könnte mir nur Einen denken.«
»Wer ist das?«
»Der Sohn des Scheik's der Mescheer. Dieser Scheik war vor einem Jahre bei uns im Lager. Er fand Wohlgefallen an mir und erzählte mir sehr viel von seinem Sohne Mulei Abarak.«
»Mulei Abarak? Wehe, wehe!«
»Was ist's? Kennst Du ihn?«
»Ich habe ihn nicht gesehen aber desto mehr von ihm gehört. Er ist als Pilger in Mekka gewesen und hat da mit fremden Weibern das Heiligthum besudelt. Man hätte ihn getödtet, aber man fand ihn nicht, denn er war entflohen. Er hat bereits mehrere Frauen gehabt, sie aber Alle fortgeschickt, wenn er ihrer überdrüssig war. Man sagt von ihm ferner, daß er eine Handelscarawane, welche nach den Schotts von Tunis wollte, irre geführt habe, so daß sie vom Lande ab auf das mit einer dicken Salzkruste überzogene Wasser gelangte. Alle, Alle, Menschen und Thiere, sollen elendlich ertrunken sein. Diesem also sollte Dein Vater Dich bestimmt haben?«
»Ich wüßte keinen Anderen.«
»Davor möge ihn und Dich Gott behüten!«
»Das würdest Du also wohl nicht dulden?«
»Nein. Ich würde mit diesem Mescheer kämpfen. Und wenn ich auch kein Held bin wie Masr-Effendi, so weiß ich doch, daß ich ihn besiegen würde. Horch! Hörst Du die Rufe?«
»O Spott, o Schande, Fluch!« erscholl es von unten herauf selbst in das Innere der Ruine.
»Der Riese zieht ab,« sagte Hilal.
»Das müssen wir sehen. Komm!«
»Erst einen Kuß!«
Er zog sie nochmals an sich. Ihre Lippen vereinigten sich in einem langen, langen Kusse, und dies gab einem Lauscher Zeit, sich unentdeckt entfernen zu können.
Nämlich der Scheik der Beni Abbas, Hiluja's Vater, war nach der Ruine gekommen, um an der Seite Tariks und der Königin Platz zu nehmen, als diesen Beiden die Ovation von Seiten der Lagerbewohner gebracht wurde. Tarik war dann mit der Braut hinabgestiegen, um verschiedene Wünsche seiner nunmehrigen Unterthanen entgegen zu nehmen, der Scheik aber hatte in das Innere der Ruine gehen wollen.
Seine Schritte wurden durch die weichen Sandalen, welche er trug, unhörbar gemacht. Die Thür des Gemaches, in welchem sich Hilal mit der Geliebten befand, war offen stehen geblieben, und so hörte der Vater der Letzteren bereits von Weitem die beiden Stimmen.
Er schlich sich ganz an den Eingang heran, lauschte und wurde Zeuge ihres Gespräches von fast dem ersten bis zum letzten Worte. Der erwähnte Kuß gab ihm Zeit, sich schnell zu entfernen. Als die Beiden in's Freie traten, stand er an der Brüstung, an ganz derselben Stelle, wo wunderbarer Weise in letzter Nacht die beiden Schwestern den beiden Brüdern ihre Liebeserklärungen gemacht hatten.
Er gab sich Mühe, eine möglichst gleichgiltige Haltung und Miene anzunehmen; aber Hilal, dessen Blick ihn forschend überflog, faßte doch Verdacht. Er trat mit Hiluja zu ihm heran und fragte:
»Erlaubst Du, daß ich mit hier stehen bleibe?«
»Wer könnte es Dir verwehren?«
»Du.«
»Ich bin nur Gast.«
»Eben als solcher hast Du mehr Recht als ich, besonders da ich Dich bereits gestört habe.«
»Wieso?«
»Du wolltest zu Hiluja und tratest doch nicht ein, weil ich mich bei ihr befand.«
»Du irrst.«
»Ich hörte Deinen Schritt.«
»Du irrst doch!«
»So ist es ein Anderer gewesen. Wir sprachen von fernen Stämmen, auch von den Mescheer Beduinen und von Mulei Abarak.«
Das war auffällig. Die Stirn des Scheik's zog sich leise in Falten, und sein Gesicht röthete sich.
»Warum sagst Du mir das?« fragte er.
»Ich denke, Du kennst ihn.«
»Das ist noch kein Grund, mir zu sagen, daß Ihr von ihm gesprochen habt.«
»Du hast sehr Recht. Er ist ein Mann, von welchem man überhaupt gar nicht sprechen soll.«
»Ah! Kennst Du ihn so genau?«
»So genau, daß ich vielleicht einmal mit ihm zusammen gerathe.«
»So nimm Dich in Acht!«
»Hilal braucht sich nicht zu fürchten,« fiel Hiluja sehr schnell ein. »Er ist stark und muthig.«
»Weißt Du das so genau?«
»Da er mich beschützt hat, solltest Du nicht zweifeln.«
Dieser Vorwurf traf den Scheik am richtigen Orte. Er war ein braver Mann, und er liebte seine Tochter. Uebrigens hatte die belauschte Unterredung einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Um sich aus der augenblicklichen Verlegenheit zu ziehen, deutete er aus dem Lager hinaus und sagte:
»Ihr habt ihn nicht das Lager verlassen sehen. Dort reitet er. Seht Ihr ihn?«
Ungefähr eine halbe englische Meile vom Lager entfernt, sah man den Riesen traben. Er saß auf dem Reitkameele; die Packkameele folgten demselben, immer Eins an den Schwanz des Anderen gebunden.
Eben jetzt kam Steinbach die Stufen emporgestiegen. Er blieb bei den Dreien stehen, verfolgte den Riesen eine kleine Weile mit dem Blicke und sagte dann:
»Er reitet gerade gegen Nord. Ahnest Du, weshalb er dies thut, Hilal?«
»Nein.«
»So denke darüber nach!«
»Es ist mir gleichgiltig, wohin ein Ausgestoßener sich wendet. Er mag reiten, wohin er will.«
»Mir aber ist es nicht gleichgiltig, wohin Einer sich wendet, der dem Stamme Rache geschworen hat.«
»Ah! Hat er das?«
»Hast Du es nicht gehört? Kennst Du die Gegend, welcher er entgegenreitet?«
»Ich kenne die Wüste viele Tagereisen im Umkreise.«
»Giebt es dort im Norden Oasen?«
»Nein; er müßte denn fünfundzwanzig Tage weit in gerader Richtung reiten.«
»Das kann er nicht. Ich denke, dort gegen Norden liegen die großen Sodasee'n.«
»Sie liegen fünf Tagereisen von hier. An ihrem Ufer wächst kein Halm; in ihrem Wasser giebt es kein lebendes Thier, und von den weißen, salzigen Flächen prallt der Strahl der Sonne so scharf ab, daß er das Auge zersticht. Wer längere Tage dort bleibt, der muß erblinden. Es ist dort ein Thal der Verdammten.«
»Nach dort zu reiten, kann also seine Absicht auch nicht sein.«
»Ganz und gar nicht.«
»Er will uns irre leiten und über seine eigentliche Absicht täuschen. Nach Norden will er sicherlich nicht. Nach Osten, woher ich gekommen bin, kann er auch nicht; er hätte sein Wasser verbraucht lange bevor er an einen Brunnen käme. Wer wohnt im Westen von unserem Lager?«
»Lauter Freunde von anderen Abtheilungen unseres Stammes. Ich habe bereits Boten dahin abgesandt mit der Nachricht, daß Falehd ausgestoßen ist.«
»Sie würden ihn nicht aufnehmen?«
»Sie würden ihn tödten, wenn er es wagte, ihr Lager durch seine Gegenwart zu verunreinigen.«
»Hm! Und wer wohnt im Süden?«
»Die Beni Suef.«
»Ah, die Beni Suef! Ich habe von ihnen gehört. Sie sind räuberische, ruhelose Leute, mit denen Ihr bereits manchen Strauß ausgefochten habt. Ihr lebt auch jetzt noch in Feindschaft mit ihnen?«
»Ja. Wir haben mehrere Bluträcher stehen, bei uns und bei ihnen. Niemand will den Blutpreis annehmen; es muß also Blut fließen.«
»So ist mit Gewißheit anzunehmen, daß Falehd sich zu ihnen wendet.«
»Das ist möglich. Weshalb aber den Umweg?«
»Um uns zu täuschen, wie ich bereits sagte.«
»Das wäre ganz unnöthig. Wir hätten ihn nicht gehalten, selbst wenn er es uns offen gesagt hätte, daß er zu ihnen wolle.«
»Ihr hättet dann gewußt, wo er sich befindet, und Eure Maßregeln treffen können. Da er aber so hinterlistig handelt, folgt daraus die feste Gewißheit, daß er Rache im Schilde führt. Ich möchte wetten, daß er die Absicht hat, die Beni Suef gegen Euch aufzustacheln.«
»Sie sind es bereits; er hat also nicht nöthig, es erst noch zu thun.«
»Du scheinst diese Sache sehr leicht zu nehmen.«
»Nein. Aber wir sind an jedem Augenblicke, bei Tage und bei Nacht von den Beni Suef bedroht, gerade ebenso wie sie von uns. Man wird dadurch diese Gefahr so gewohnt, daß man zwar noch auf sie achtet, nicht aber mehr von ihr spricht.«
»Wie weit lagern die Suef von hier?«
»In zwei Tagen kannst Du sie auf einem Reitkameele erreichen. Ein Lastkameel braucht ganz sicher drei volle Tagereisen.«
»Das ist nahe genug. Nehmen wir uns in Acht!«
»Habe keine Sorge! Du bist sicher bei uns! Du befindest Dich ja hier in unserer Mitte.«
Das klang so selbstbewußt und sonderbar, daß Steinbach laut auflachte und dann fragte:
»Glaubst Du, daß ich vor irgend Jemandem oder vor irgend Etwas Angst haben könnte?«
»Verzeihe, Effendi!« sagte Hilal erröthend.
»Du bist auf einmal ein größerer Held geworden, als Du bereits vorher warst. Wenn der Adler seine Frau zu beschützen hat, fühlt er doppelte Kraft und dreifachen Muth in sich.«
Hilals Gesicht wurde noch viel röther als vorher; es glühte förmlich. Er sah sich von Steinbach durchschaut; auch Hiluja fühlte ganz dasselbe; da sie eben jetzt die Schwester unten erblickte, von Tarik geführt, sagte sie zu dem Geliebten:
»Tarik winkt. Laß uns hinabgehen!«
Tarik hatte nun freilich nicht gewinkt, dennoch gingen sie hinab, so daß der Scheik mit Steinbach allein zurückblieb. Dieser Letztere ergriff sofort die gebotene Gelegenheit. Er blickte den Beiden lächelnd nach und sagte:
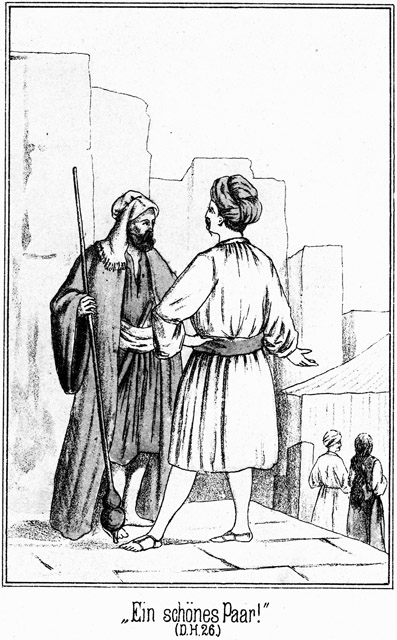
»Ein schönes Paar! Gerade als ob Allah sie für einander bestimmt hätte!«
»Hat er sie für einander bestimmt, so kann kein Mensch widerstehen, auch ich nicht.«
»Sein Wille geschehe!«
»Der wohl auch der meinige ist.«
»Du hassest Hilal?«
»Nein.«
»Fast hat es mir so geschienen.«
»Er ist ein braver Mann. Ich habe ihn belauscht, als er mit meiner Tochter sprach; Du aber wirst ihm dies nicht wieder sagen. Sie sprachen von ihrer Liebe zu einander und daß ich Hiluja wohl bereits für einen Andern bestimmt haben könnte; sie meinte, daß sie widerstreben werde, er aber machte sie auf den Koran und die Worte des Propheten aufmerksam, welche dem Kinde befehlen, dem Vater und Erzeuger Gehorsam zu erweisen.«
»Ah! Das hätte er gethan?«
»Ja. Ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört.«
»Ich habe ihn für einen sehr braven Menschen gehalten, aber eine solche Selbstlosigkeit habe ich ihm doch nicht zugetraut.«
»O, er sprach dann freilich davon, daß er mit dem Mescheer kämpfen wolle. Das thut mir leid, denn ich habe Hiluja dem Mescheer bestimmt, und er wird sie erhalten.«
Er hätte vielleicht weiter über diesen Gegenstand gesprochen, aber unten an den Stufen, an welchen jetzt die beiden Geschwisterpaare mit dem alten Kalaf standen, schien sich eine kleine Scene vorbereiten zu wollen. Nämlich Ibrahim Pascha und der Russe näherten sich dem angegebenen Orte, und es war ihren Mienen anzusehen, daß sie irgend eine Absicht hegten. Darum stieg Steinbach hinab, wo er gleich mit ihnen zu der angegebenen Gruppe stieß.
»Wir hören,« sagte der Pascha, »daß der glorreiche und berühmte Stamm der Beni Sallah einen neuen Scheik erhalten hat, und sind gekommen, ihm unsere Freundschaft und Ergebenheit zu erweisen.«
Dabei konnte er sich nicht beherrschen, einen halb und halb ironischen Blick auf Tarik zu werfen, welcher in seinem unscheinbaren Gewande vor ihm stand, sich aber nicht aus der Fassung bringen ließ, sondern mit der Würde eines Mannes, welcher bereits fünfzig Jahre lang Scheik gewesen ist, antwortete:
»Ihr seid unsere Gäste und thut also wohl daran, uns Eure Aufmerksamkeit und Höflichkeit zu erweisen. Ihr sprecht von Ergebenheit; diese verlangen wir nicht. So hohe Männer, wie Ihr seid, können uns armen Söhnen der Wüste nicht ergeben sein, und was Eure Freundschaft anbelangt, so hoffen wir, daß Ihr sie uns beweisen werdet, auch ohne viel von ihr zu sprechen.«
Das war nun sehr brav gesprochen, das hatten sie diesem Manne, der in alten Linnen, mit einem Stricke zusammengebunden, vor ihnen stand, wohl schwerlich zugetraut. Sie schauten auch ganz verblüfft darein, eine Antwort zu bekommen, die ihnen ein routinirter Diplomat nicht besser hätte geben können. Tarik wendete sich halb ab, zum Zeichen, daß er meine, die Unterredung sei zu Ende; da aber sagte der Pascha:
»Verzeihe! Wir haben das Verlangen, Euch von unserer Freundschaft zu überzeugen, doch hoffen wir, daß uns dies von Euch nicht so sehr wie bisher erschwert werde.«
»Erschwert? Wieso?«
»Ihr habt Euch nicht in Allem als Freunde gegen uns Beide gezeigt.«
»Du siehst mich verwundert! Haben wir Euch nicht aufgenommen, Euch Obdach, Essen und Trinken gegeben? Hungert Ihr? Dürstet Ihr?«
»Nein. Aber Ihr habt mir mein Weib, meine Sclavin genommen!«
»Wir haben sie Dir nicht genommen, sondern sie ist freiwillig zu uns gekommen. Sie ist unser Gast ebenso gut, wie Du es bist, und wir müssen ihren Willen thun, so wie wir den Deinigen thun würden.«
»Ihr habt den Ihrigen, nicht aber den Meinigen gethan.«
»Vergleiche Dich mit ihr, wenn Ihr unsere Zelte verlassen habt. Jetzt wohnt sie unter unserem Schutze.«
»Sie wird Euch niemals zu gleicher Zeit mit mir verlassen. Sie ist für mich verloren.«
»So hast Du es nicht verstanden, ihre Liebe zu gewinnen, wir aber können nichts dafür.«
»Sodann habt Ihr mir meinen Diener genommen!«
»Davon weiß ich nichts. Sprecht hier mit diesem Masr-Effendi, bei welchem sich Derjenige aufhält, von welchem Ihr redet.«
Der Pascha blickte Steinbach erstaunt an. Es war ihm ganz und gar nicht lieb, an diesen gewiesen zu werden. Er fragte in feindseligem Tone:
»Bei Dir ist er? Wirklich?«
»Ehe ich antworten kann, muß ich erst wissen, von wem die Rede ist.«
»Von Saïd, meinem Arabadschi.«
»Der befindet sich allerdings bei mir.«
»Du hast ihn mir abspenstig gemacht?«
»Nein. Er kam zu mir und bat mich, ihn bei mir aufzunehmen. Ich habe ihm diese Bitte erfüllt.«
»Das durftest Du nicht. Er war mein Diener!«
»Kannst Du das beweisen?«
»Ja.«
»Womit?«
»Frage Zykyma, sie wird es mir bezeugen.«
»Das hat sie bereits gethan. Sie hat gesagt, daß er Dein Diener gewesen sei.«
»So schicke ihn zu mir zurück!«
»Er will nicht, und er hat auch keinen Augenblick nöthig, länger bei Dir zu bleiben. Du hast ihm weit über ein Jahr lang keinen Lohn bezahlt.«
»Ich werde ihn bezahlen!«
»Das glaubt er nicht. Er schenkt Dir das Geld und bleibt lieber bei mir. Des kannst Du froh sein.«
»Der Hund!«
»Schimpfe meinen Diener nicht, wenn Du nicht zugleich mich beleidigen willst!«
»Ich durchschaue Dich. Du bist voller Feindschaft gegen uns; Du klagst uns wegen Sachen an, von denen wir gar nichts wissen; Du möchtest uns am Liebsten ganz verderben, wir aber wissen keinen einzigen Grund dazu und sind ganz im Gegentheile erbötig, Dir alle Aufmerksamkeit und jeden Gefallen zu erweisen –«
»Das redet Ihr nur. Ich kenne Euch.«
»Nein! Gieb uns Gelegenheit, Dir einen Gefallen zu thun, so werden wir es sofort machen!«
»Nun wohl, ich will Euch beweisen, daß dies blos Heuchelei ist!« Und sich an den Russen wendend, fuhr er fort: »Du bist natürlich mir ebenso zu Diensten erbötig, wie Dein Gefährte hier?«
»Ja, sehr gern!«
»So beantworte mir die eine Frage: »Wo befindet sich gegenwärtig Gökala?«
Der Graf erschrak. Diese directe Frage hatte er nicht erwartet. Er raffte sich schleunigst zusammen und antwortete, eine möglichst verwunderte Miene zeigend:
»Gökala? Wer ist das?«
»Ah, Du kennst Die nicht, welche mit im Harem des Sultans war, mit der Ihr mich dann fortschlepptet, nachdem Ihr mich getödtet zu haben glaubtet?«
»Du siehst mich im höchsten Grade erstaunt. Von Allem, was Du hier sagst, verstehe ich kein Wort.«
»Pah! Mein Diener ist mit Euch von Konstantinopel bis Alexandrien gefahren; er forscht weiter. Ich habe Dich gefunden, und er wird Gökala finden.«
Ueber das Gesicht des Grafen glitt es wie Schadenfreude und Besorgniß zugleich. Er antwortete:
»Ich verstehe Dich wirklich nicht, aber wenn Alles wirklich so wäre, wie Du sagst, so wäre ich wohl auch der Mann dazu, Gökala dahin zu bringen, wohin Deine Nase nicht riechen dürfte, ohne sich in Gefahr zu befinden, Dir verloren zu gehen. Du bist von einer fixen Idee besessen, und da Du bei Deinen Phantasieen bleibst, so wollen wir uns keine weitere Mühe geben, Dich zu kuriren. Allah ist reich an Gnade und Erbarmen; wenn es ihm beliebt, wird er Dein Gehirn wieder in Ordnung bringen, auch ohne daß wir uns dabei anstrengen.«
Sie wendeten sich ab und entfernten sich. Steinbach blickte ihnen nachdenklich nach. Es stand ihm fern, sich über ihr Verhalten und ihre Worte zu ärgern. Er spielte mit ihnen eine Parthie Schach, bei welcher viel, sehr viel, vielleicht sein ganzes Lebensglück, gewonnen oder verloren werden konnte, und er hatte genug Objectivität, sich selbst durch solche Niederträchtigkeiten nicht aus der Fassung bringen zu lassen.
Indessen war der Kameelszug des Riesen dem Horizonte näher gekommen und hatte bis jetzt die ursprüngliche Richtung nach Nord beibehalten. Steinbach bestieg die Ruine wieder, gefolgt von den beiden Söhnen des Blitzes und von Normann. Die Sonne hatte die größte Strecke ihres Tagebogens zurückgelegt und begann bereits, sich zur Rüste zu neigen. Steinbach beschattete mit der Hand die Augen und verfolgte mit scharfem Blicke den kleinen Zug des Riesen. Dadurch aufmerksam gemacht, thaten die drei Anderen dasselbe. Die Thiere Falehds waren nicht mehr von einander zu unterscheiden; sie bildeten jetzt einen einzigen Punkt, welcher jetzt nur noch die scheinbare Größe einer Erbse hatte und nur von einem höchst scharfen Auge von der grauduftigen Linie des Horizontes zu unterscheiden war. Plötzlich kauerte Steinbach nieder und legte das Gesicht an die Seite eines hohen Steinquaders, dessen eine obere Kante für ihn nun eine feste, unverrückbare Visirlinie bildete, mit welcher er die langsame Bewegung des erwähnten erbsengroßen Punktes vergleichen konnte.
Normann beobachtete ihn dabei und fragte:
»Sie glauben wohl, daß er bereits jetzt von seiner Richtung abweicht?«
»Ich glaube es nicht nur, sondern ich sah es bereits.«
»Da müssen Sie ein ungeheuer scharfes Auge haben.«
»Das habe ich. Nur konnte ich mich irren. Ein Blick aus freier Hand, wenn ich mich dieses Ausdruckes bedienen kann, ist aber der Täuschung unterworfen; darum visire ich, und da bemerke ich denn, daß sich der Riese bereits nach links wendet. Er mag wohl denken, daß wir ihn nicht mehr zu sehen vermögen.«
»Also haben Sie Recht mit Ihrer vorhin ausgesprochenen Vermuthung, daß er uns mit seiner zuerst eingeschlagenen Richtung irre leiten will.«
»Das ist sicher. Aus der Schnelligkeit, mit welcher sich der Punkt jetzt bewegt, ist zu schließen, daß er galoppirt. Er wird das freilich nicht lange aushalten können.«
»Sie meinen, daß seine Lastkameele ermüden?«
»Das nicht. Aber sein Auge ist so beschäftigt, daß sich durch die Anstrengung des Rittes das Wundfieber sehr bald einstellen wird. Dann ist er gezwungen, ein langsameres Tempo einzuschlagen oder gar inne zu halten. Ich habe bedeutende Lust, ihn ein Wenig zu beobachten.«
»Warum?« fragte Tarik.
»Um zu wissen, ob er wirklich, wie wir vermutheten, einen Halbkreis bis nach Süd beschreibt.«
»Das wird er jedenfalls thun. Er geht zu den Beni Suef. Das weiß ich, auch ohne, daß wir ihn beobachten.«
»Und dennoch – – – hm! Ich traue ihm nicht! Er wird diesen feindlichen Stamm jedenfalls aus Rache zu einem Kriegszuge bereden.«
»Dies können wir doch dadurch, daß wir ihm jetzt eine Strecke weit folgen, nicht verhindern.«
»Nein; aber ich habe sehr oft erfahren, daß man in solchen Fällen gar nie zu viel thun kann. Wenn wir auf ihn stoßen und er dadurch erkennen muß, daß wir uns nicht von ihm täuschen lassen, so wird er denken, daß wir vorsichtig sein und uns auch für Weiteres bereit halten werden.«
»Du hast Recht,« sagte Hilal. »Wenn Du reiten willst, werde ich Dich begleiten. Wir nehmen die beiden schnellsten Pferde.«
»Ein überflüssiger Ritt!« bemerkte auch Normann.
»Gar nicht!« antwortete Steinbach. »Ich möchte diesem Kerl zeigen, daß er doch nicht klug genug ist, uns zu täuschen, oder, anders ausgedrückt, daß wir nicht dumm genug sind, uns von ihm täuschen zu lassen. Laß also satteln, Hilal. Wir wollen den Spazierritt unternehmen.«
Der Genannte entfernte sich. Dann fuhr Steinbach fort:
»Ich habe nämlich auch noch einen zweiten Grund, dem Riesen zu zeigen, daß wir ihm auf die Finger sehen. Ich traue ihm nämlich nicht in Beziehung auf den Russen und auf Ibrahim Pascha.«
»Sie meinen, daß er mit ihnen conspirire?«
»Oder bereits conspirirt hat. Sie werden erkannt haben müssen, daß ihre Rolle hier ausgespielt ist. Sie wissen, was sie von mir zu erwarten haben, und es steht zu vermuthen, daß sie auf den Gedanken gekommen sind, das Lager heimlich zu verlassen. Sie wissen, daß wir ihnen nach ihrem Aufbruche folgen werden und daß sie dann wohl verloren sind. Dadurch, daß sie sich heimlich entfernen, bekommen sie einen Vorsprung, den wir wohl nicht leicht einholen würden.«
»Was hat das mit dem Riesen zu thun?«
»Sehr viel, vielleicht mehr, als Sie anzunehmen scheinen.«
»Er darf sich ja nicht blicken lassen! Uebrigens reitet er aller Wahrscheinlichkeit nach zu den Beni Suef, während die beiden Genannten ihr Ziel in Egypten haben.«
»Beides ist richtig; aber diese Beiden müssen sich ja sagen, daß wir dieses ihr Ziel kennen und ihnen also folgen werden. Sie reiten allein, ohne Schutz und Begleitung, werden also voraussichtlich unterliegen, falls wir sie erreichen. Darum steht zu erwarten, daß sie sich nach einer schützenden Begleitung umsehen werden. Und wo finden sie diese?«
»Meinen Sie etwa bei den Beni Suef?«
»Ja, das meine ich.«
»Sapperment! Dieser Gedanke ist gewagt!«
»Aber doch erklärlich. Sie haben mit dem Riesen in dessen Zelte zusammen gehockt. Wovon haben sie gesprochen? Von dem so unerwarteten Ausgange des Kampfes, durch welchen ihre Absichten völlig durchkreuzt worden sind, von ihrem Zorne, ihrer Wuth und – – ihrer Rache. Die größte Sicherheit würde es für sie geben, wenn es ihnen gelänge, mich unschädlich zu machen. Gehen sie zu den Beni Suef, um sie zu einem Ueberfall dieses Lagers zu verleiten, gelingt dieser Ueberfall, so haben sie sich nicht nur gerächt, sondern sie sind auch den Feind los, den sie am Meisten zu fürchten haben – nämlich mich.«
»Hm! Ihre Folgerungen sind nicht unlogisch.«
»Nicht wahr? Ich halte es für sehr möglich, wo nicht für wahrscheinlich, daß sie sich heute Abend oder während der Nacht davonschleichen wollen und mit dem Riesen einen Punkt verabredet haben, an welchem er sie erwarten soll.«
»So muß man sie bewachen!«
»Gewiß. Wollen Sie das übernehmen, während ich mich mit Hilal abwesend befinde?«
»Ja, gern.«
»Uebrigens wird im Laufe des Abends noch eine wichtige Versammlung der Aeltesten stattfinden. Der neue Scheik ist gewählt, und so muß darüber abgestimmt werden, wie sich der Stamm zu dem Vicekönig verhalten will. Die Entscheidung, welche da gefällt wird, werden Beide, der Pascha und der Graf, sicher noch abwarten; dann aber heißt es, ihr Zelt genau und unausgesetzt im Auge zu behalten.«
Jetzt rief Hilal von unten herauf, daß die Pferde bereit seien. Steinbach stieg hinab, nachdem er sich noch für den Ritt bewaffnet hatte, und bald flogen die beiden vortrefflichen Pferde mit der Schnelligkeit eines Eilzuges in die Wüste hinaus, nicht in nördlicher Richtung, wo mittlerweile der Riese am Horizonte verschwunden war, sondern nach Westen zu.
Dort war die Sonne mittlerweile hinabgesunken. Gerade als die beiden Reiter die Oase verließen, ertönten die Schläge des Mueddin und dann seine Worte:
»Auf, Ihr Gläubigen, rüstet Euch zum Gebete, denn die Sonne hat sich in das Sandmeer getaucht!«
Die letzten Strahlen flammten funkelnd über die weite Ebene herein, golden und dick, als ob man sie greifen und festhalten könne. Aber dieses Gold wurde schnell matter; es färbte sich orange, ging in ein helles, kupfernes Roth über, zuckte wie dünnflüssige Bronce über die Wüste, wich dann schnell und schneller zurück, wie eine riesige Aetherbrandung, welche in das Lichtmeer der Unendlichkeit entweicht, sammelte sich dann an dem einen Punkte des Horizontes, unter welchem der Sonnenball zur Ruhe gegangen war, und verlor sich endlich, nach und nach ersterbend, in einen fahlen Dämmerschein, welcher, zuweilen und immer langsamer noch von wenigen helleren Strahlen durchzuckt, in das Dunkel des Abends überging und dem tiefen Blau wich, welches von Osten her über den Himmel zog, von hundert und tausend Sternen übersäet.
Den Riesen jetzt zu sehen, davon war natürlich keine Rede; dennoch wollten sie ihn treffen. Wie aber war das anzufangen? Der Weg, welchen er einschlug, war eine dünne Linie in der Endlosigkeit der Wüste. Aber wer sich bereits in jenen Strecken bewegt hat, der weiß sich zu helfen. Hilal zügelte nach einer Weile sein Pferd zu langsamerem Gange und sagte:
»Jetzt werden wir uns vielleicht da befinden, wo er vorüberkommt.«
»Woraus schließest Du das?«
»Meinst Du, daß Falehd einen größeren Umweg machen werde, als unbedingt nöthig ist?«
»Ganz gewiß nicht.«
»Oder meinst Du, daß er sich so nahe an unser Lager hält, daß er befürchten müßte, entdeckt zu werden?«
»Auch das nicht.«
»So wird er also die Mitte zwischen beiden wählen, nicht zu nahe am Lager und aber auch nicht zu entfernt von demselben. Er kennt hier jeden Schritt breit und er kennt auch unsere Angewohnheiten. Er weiß, daß die Jünglinge nach dem Abendgebete zuweilen noch eine Strecke weit in die Wüste jagen, um die Schnelligkeit der Pferde und die Geschicklichkeit der Reiter zu erproben. Dabei aber gehen sie nie über eine gewisse Entfernung hinaus, denn die Sahara ist voller Gefahren. Diese Entfernung nun ist dem Riesen sehr genau bekannt. Sie bildet einen Kreis von einem ganz bestimmten Durchmesser um das Lager, und gerade auf der Linie dieses Kreises wird er das letztere umreiten, um von Nord nach dem Süden zu kommen.«
»So muß ich mich also auf Dich verlassen.«
»Ja, ich werde Dich führen. Diese Kreislinie ist zwar nicht durch den Sand gezogen, so daß sie zu sehen wäre, man muß sie sich nur denken. Dabei kommt es auf kleine Entfernungen gar nicht an. Es ist still um uns her und wir werden den Schritt der Thiere, welche Falehd bei sich hat, wohl hören. Der Sand ist tief und wenn sie ihn mit den Füßen hinter sich werfen, so giebt er einen Ton, welcher zwar nicht stark ist, dessen metallischen Klang man aber während der Nacht auf eine beträchtliche Entfernung hin vernehmen kann.«
»Wäre es da nicht gerathen, uns zu trennen?«
»Dasselbe wollte ich Dir soeben vorschlagen. Ich glaube, daß wir die richtige Entfernung erreicht haben. Postire Du Dich hier auf, ich reite noch einige hundert Pferdelängen in gerader Linie weiter. Dort steige ich vom Pferde und lasse es sich legen. Wenn Du Dich zu dem Deinen setzest und ihm die Hand auf den Kopf legest, wird es sich nicht bewegen und auch nicht schnaufen, wenn Jemand vorüberreitet. Wenn er kommt, so lässest Du ihn vorbei und giebst mir dann das Zeichen. Ich werde in demselben Falle ganz dasselbe thun.«
»Welches Zeichen?«
»Hast Du schon einen Fennek bellen hören?«
»Ja.«
»Er geht noch weiter in die Wüste als die Hyäne oder der Schakal; es kann also gar nicht auffallen, wenn sich seine Stimme hier vernehmen läßt. Zweimal kurz bellen, das soll für den Anderen das Zeichen sein, daß er kommen soll.«
Der Fennek ist ein kleines, allerliebstes, fuchsähnliches Thierchen mit großen, breiten Ohren, welche in ganz eigenthümlicher Weise an dem Kopfe sitzen. Seine Stimme ist scharf und hell, sie klingt wie ia, ia, das I langgedehnt und gedämpft, das A aber ganz kurz und sehr laut, fast wie man im Deutschen ein recht bekräftigendes, kurzes Ja ausspricht, dessen ersten Laut man vorher lang angehalten hat.
Hilal ritt weiter. Steinbach stieg ab, schlug das Pferd auf die Krupe, bei diesen Thieren das Zeichen, sich zu legen. Es gehorchte. Darauf setzte er sich neben das Thier und legte ihm die Hand auf den Kopf. Sofort schmiegte es den letzteren tief auf den Boden hin und holte noch einmal laut und langsam Athem, als ob es sagen wolle, daß es den Reiter sehr wohl verstanden habe. Von da an lag es ohne Bewegung still.
Minuten um Minuten vergingen. Droben strahlten die Sterne des Südens. Unten zog sich die Strecke grau in die dunkler und dunkler werdende Ferne hinein. Kein Laut war zu hören. Steinbach hatte fast das Gefühl, als ob er in kleinem, schwachem und schwankem Boote im unendlichen Ocean treibe.
Es war kein Laut zu hören, nicht die Spur eines leisen Geräusches. So verging wohl eine halbe Stunde. Dann aber war es dem Lauschenden, als ob sich dort, wohin Hilal sich gewendet hatte, Etwas hören lasse, ganz so, als ob ein leiser Lufthauch durch müde herabhängendes Blätterwerk gehe. War dies vielleicht das Geräusch des Sandes, von welchem Hilal gesprochen hatte? Jedenfalls, denn wenige Secunden später tönte ein bellendes »ia ia« von dort herüber, das Zeichen, auf welches Steinbach gewartet hatte.
Jenes Blätterrauschen war nichts Anderes gewesen, als das Geräusch, welches die Thiere des Riesen im Sande hervorgebracht hatten.
Steinbach gab seinem Pferde die Erlaubniß, aufzustehen, stieg in den Sattel und trabte der Richtung zu, in welcher er den Beduinen wußte. Dieser kam ihm bereits entgegen.
»Ist er vorüber?« fragte der Deutsche.
»Ja, ganz nahe an mir.«
»Ohne Dich zu sehen?«
»Ein Anderer hätte mich gesehen, aber sein Auge ist ja krank, und wenn das eine Auge leidet, so leidet das andere mit. Komm, ihm nach!«
Sie setzten ihre Pferde in Galopp. Die Thiere fegten in dem hohen Sande dahin, daß eine Wolke desselben hinter ihnen emporflog. Bald erreichten sie den Ausgestoßenen. Er ritt in dem bekannten, ausgiebigen Kameelstrotte, welcher die Thiere nicht anstrengt, weil er ihnen natürlich ist, mit dem man aber trotzdem ungeheure Entfernungen zurücklegt.
»Wakkif, wakkif – halt, halt!« rief Hilal.
Der Riese hörte den Ruf und hielt sein Pferd an.
»Wer ist da?« fragte er, nach seinem Messer greifend. Eine andere Waffe hatte er nicht mitnehmen dürfen.
»Wer bist denn Du?« antwortete Hilal, so thuend, als ob er es nicht wisse.
»Komm näher herbei, daß ich es Dir sage!«
»Allah! Diese Stimme sollte ich kennen!«
»Ich die Deinige auch.«
Jetzt waren die Beiden an das vordere Kameel gekommen, welches der Riese ritt.
»Falehd!« rief Hilal, sich erstaunt stellend.
»Hilal! Der Knabe!«
»Wie kommst Du hierher? Wir sahen doch, daß Du nach Norden rittest!«
»Kann ich nicht da reiten, wo es mir beliebt?«
»Das kannst Du. Aber Du darfst nicht vergessen, daß Du vogelfrei bist. Du sollst Dich nicht in der Nähe des Lagers herumtreiben. Weißt Du, daß ich das Recht habe, Dich niederzuschießen!«
»Thue es, wenn es Dir Ehre bringt, einen Wehrlosen und Verwundeten zu tödten!«
»Bis heute hast Du anders gesprochen. Ich werde Dir das Leben schenken, aber mache, daß Du fortkommst! Ein Anderer wäre nicht so gnädig, wie wir Beide es sind.«
»Wer ist dieser zweite Mann?«
»Dein sehr guter Freund Masr-Effendi.«
»Der Teufel mag ihn fressen! Was hat er hier in der Wüste zu suchen?«
»Dich,« antwortete Steinbach jetzt. »Ich wollte Dir nur zeigen, daß ich Dich überall zu finden weiß, wenn es mir beliebt, Dich zu suchen. Reite jetzt weiter und grüße die tapferen Beni Suef von uns, zu denen Du doch gehen willst!«
»Allah verdamme Dich und Euch Alle!« rief der Riese.
Er schlug mit dem Stabe, den jeder Kameelreiter bei sich führt, um sein Thier zu lenken, das Reitkameel zwischen die Ohren, daß es sich sofort in eiligen Lauf setzte; die Anderen folgten ebenso schnell, da sie ja an das erstere festgebunden waren.
Er stieß noch einige laute, kräftige Flüche aus, dann aber zog er es vor, zu schweigen.
Er sah sich durchschaut, wenn auch nicht vollständig, aber doch so weit, daß die Beni Sallah jetzt wußten, wohin er sich zu wenden beabsichtigte. Das ärgerte ihn gewaltig. Die Schande, besiegt und ausgestoßen worden zu sein, brannte wie Feuer in seinem Hirn. Dazu kam der Schmerz, den ihm seine Verletzungen bereiteten. Er hatte nicht nur seine Ehre verloren, sondern auch seine Stellung, seine Habe. Er war ein Verfluchter, der seinem ärgsten Feinde danken mußte, wenn dieser ihn nicht wie ein wildes Thier niederschoß. Alle negativen Gefühle, deren das menschliche Herz fähig ist, wühlten in seinem Inneren. Er befand sich seelisch in einem Zustande, welcher jeder Beschreibung spottet, und körperlich war es nicht viel besser. Die Nase war dick angeschwollen, das Innere seines Mundes war eine einzige Geschwulst, das Auge schmerzte ganz entsetzlich. Er hatte einen Wasserschlauch mit auf sein Reitthier genommen um sich Auge, Mund und Nase fortwährend zu kühlen. Er hätte sich am Liebsten das Messer in das Herz gestoßen, doch hielt ihn der Gedanke, daß er sich ja rächen müsse, fürchterlich rächen, davon ab.
So ritt er weiter, vorsichtig in die Ferne lauschend, um ja nicht wieder eine solche Begegnung zu haben. Und doch sollte er nicht lange allein bleiben. Er sah ganz plötzlich einige dunkle Punkte vor sich in seinem Wege liegen, und noch ehe er sein Thier zu halten vermochte, begannen sie, sich zu bewegen.
Es waren abgestiegene Reiter, welche jetzt in ihre Sättel sprangen und ihn umringten.
»Kimdir, kimdir!« rief ihm der Eine zu.
Dieses Wort heißt Wer da; es ist türkisch, wird aber auch in den Ländern der arabischen Beduinen angewendet. Er glaubte natürlich, wieder Beni Sallah vor sich zu haben, trieb sein Thier also weiter und antwortete:
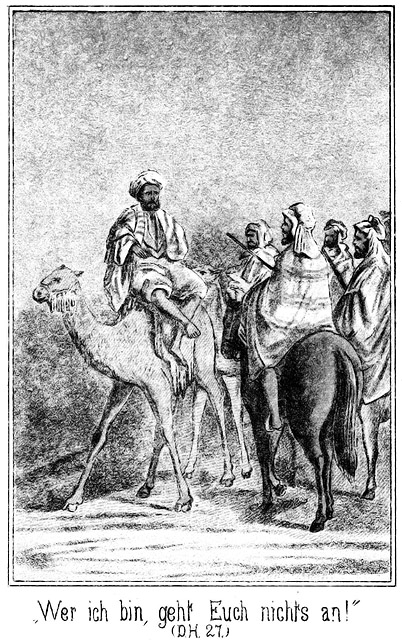
»Wer ich bin, geht Euch nichts an! Laßt mich in Ruhe!«
Die Männer aber galoppirten mit derselben Schnelligkeit neben ihm her, und der vorige Sprecher sagte:
»Halte Dein Thier an, sonst schieße ich Dich herab!«
Die Nacht war sternenhell; der Riese sah den Lauf des Gewehres auf sich gerichtet und mußte gehorchen. Er gab seinem Thiere das Zeichen, zu stehen.
»Fünf Kameele und nur ein Reiter!« sagte der Mann verwundert. »Das begreife ich nicht. Woher kommst Du?«
»Da von Nord,« antwortete Falehd, welcher einzusehen begann, daß er keine Beni Sallah vor sich habe.
»Und wo willst Du hin?«
»Nach Süd.«
»In die Wüste hinein?«
»Ja.«
»Lüge nicht.«
»Ich sage die Wahrheit.«
»Kein Wanderer reitet an einem Lager vorüber, welches ihm so nahe zu erreichen liegt!«
»Welches meinst Du?«
»Willst Du nicht zu den Beni Sallah?«
»Nein. Allah verdamme sie!«
»Sind sie Deine Feinde?«
»Ja.«
»Ah! Welchem Stamme gehörst Du an?«
»Keinem. Ich bin frei.«
»Ein Ausgestoßener etwa?«
»Ja.«
»Das lügest Du wieder. Einem Ausgestoßenen giebt man nicht vier Lastkameele und ein solches Reitthier mit!«
»Glaube, was Du willst, und laß mich in Ruhe!«
»Das werde ich wohl nicht thun, denn –«
»In Ruhe lassen?« fiel ein Anderer ein. »Diesen da? Nein, ihn nicht! Hört, Ihr Männer, was für einen guten Fang wir gemacht haben! Seht seine Gestalt, seine Länge, seine Stärke! Es giebt nur einen Einzigen, dem Allah eine solche Figur gegeben hat. Ich will in allen Höllen braten, wenn dieser Mann nicht ist Falehd, der Riese vom Stamme der Beni Sallah!«
»Allah ist groß! Ist das wahr?«
»Ja, er ist es. Ich beschwöre es.«
»So muß ich ihn doch auch kennen. Steige herab vom Rücken Deines Kameeles, Mann, damit meine Augen sich an dem Anblicke Deines Angesichtes weiden mögen!«
»Wer ich bin, kann ich Euch sagen, ohne daß ich den Sattel verlasse. Ja, ich bin Falehd.«
»Allah l'Allah! Gepriesen sei Gott, der uns den Gedanken gegeben hat, in dieser Nacht hierher zu reiten! Er hat den schlimmsten unserer Feinde in unsere Hand gegeben. Er wird mit seinem Leben den Preis bezahlen für das Blut, welches er vergossen hat!«
»Ich glaube nicht, daß dies nöthig sein wird,« meinte Falehd. »Ihr nennt mich Euren Todfeind. Welchem Stamme gehört Ihr denn an.«
»Wir sind Beni Suef.«
»Tod und Teufel! Ist das wahr?«
»Ja. Steige ab und sieh uns an!«
»Zu Euch will ich ja!«
»Zu uns? Bist Du toll? Ein Beni Sallah, welcher zu uns kommt, bringt uns sein Leben!«
»Das will ich ja auch! Ich bringe Euch mein Leben auch, zwar nicht, daß Ihr es mir nehmen sollt, sondern weil ich es Euch widmen will. Ich will an Eurer Seite oder an Eurer Spitze gegen die Beni Sallah kämpfen, bis keiner dieser Hunde mehr zu sehen ist.«
»Schweig still! Wir kennen Dich! Du kommst von der Reise und willst in Dein Lager. Dabei haben wir Dich ergriffen. Nun giebt es nur ein Mittel, Dich zu retten, indem Du einer der Unserigen zu werden versprichst. Aber wir glauben Dir nicht, wir lassen uns nicht täuschen. Wir kennen Dich. Deine Zunge hat mehrere Spitzen und vielerlei Rede.«
»Wartet! Ich werde absteigen!«
Er ließ sein Kameel niederknieen und sprang aus dem hohen Sattel herab. Die Anderen waren zu Pferde. Er zählte sechs Mann. Als er jetzt am Boden stand, sagte er:
»Habt Ihr meinen Worten und meiner Stimme nicht angehört, daß ich verwundet bin? Tretet näher und seht mich an. Man hat mir ein Auge genommen und mir die Nase zerschlagen und die Zähne zerschmettert. Das ist geschehen heute um die Mittagszeit im Lager der Beni Sallah. Ich habe das Lager verlassen, um mich zu rächen. Ich wollte zu den Beni Suef. Ich war bisher deren Todfeind, kann ihnen aber den ganzen Stamm der Beni Sallah in die Hände liefern. Allah sei Dank, daß ich Euch treffe! Thut jetzt mit mir, was Ihr wollt und denkt!«
Sie traten näher und betrachteten und befühlten ihn. Derjenige, welcher der Anführer zu sein schien, sagte:
»Ja, Du bist verwundet, aber wir müssen sicher gehen. Wenn Du aufrichtig bist, wird es Dir ganz gleichgiltig sein, wenn wir Dich gefangen nehmen.«
»Thut es!«
»Und Dich binden.«
»Hier sind meine Arme. Bindet sie!«
Es wurde ein Riemen hergenommen, mit welchem man ihm die Hände auf den Rücken band. Er mußte sich setzen. Seine Kameele wurden durch leichte Hiebe an die Vorderbeine belehrt, daß sie sich legen sollten, was sie auch sogleich thaten. Die Männer, welche auch abgestiegen waren, setzten sich um ihn herum, ihn zu verhören. Er erzählte ihnen die letzten Ereignisse nach seiner Weise, so daß sein Verhalten in ein möglichst günstiges Licht gestellt wurde. Sie hörten ihm ruhig zu. Als er geendet hatte, sagte der Anführer:
»Wir wollen Dir in der Hauptsache glauben, obgleich uns Manches noch unerklärlich und bedenklich ist.«
»Fragt mich nur! Ich werde antworten.«
»Eigentlich sollte ich Dir noch nichts sagen, denn ich weiß noch nicht gewiß, ob Du es wirklich ehrlich meinst; aber Du bist gebunden und also unschädlich. Ich will Dir mittheilen, daß wir die Kundschafter sind. Weißt Du nun, was die Krieger der Beni Suef wollen?«
»Natürlich weiß ich es nun, und ich freue mich darüber. Ihr wollt die Beni Sallah überfallen?«
»Ja. Wir haben mehrere Blutrachen gegen Euch. Wir haben die jetzige Zeit aus noch anderen Gründen gewählt. Wir wissen, daß Eure Königin baldigst wieder einem Manne gehören wird, welcher Scheik –«
»Sie gehört ihm schon!« fiel Falehd ein.
»Wie? Sie hat gewählt?«
»Das war ja der Kampf, von dem ich erzählte.«
»So habt Ihr um die Königin gekämpft?«
»Ja.«
»Aber es war doch ein Fremder!«
»Er hat die Königin an Tarik abgetreten.«
»Meinst Du den Sohn des Blitzes?«
»Ja.«
»Hört, Ihr Männer, hört! Wie gut, wie sehr gut, daß wir den Riesen gefunden haben! Sage uns einmal, Falehd, ob nicht ein Pascha bei Euch ist?«
»Er ist da.«
»Und dann noch ein Fremdling, den der Sultan der Russen gesandt hat?«
»Ja.«
»Beide sind Feinde des Vicekönigs von Egypten?«
»Sie sind es. Sie kamen, um den Stamm für sich zu gewinnen. Dieser andere Fremde aber, der mich durch seine Teufelskünste blind machte, daß ich seine Streiche nicht sehen konnte, hat den Stamm bethört, daß er nun dem Vicekönige helfen will.«
»Welch eine Dummheit! Die Krieger der Beni Suef sind niemals dem Vicekönig verbündet gewesen und werden auch niemals seine Sclaven sein!«
»Das weiß ich und darum komme ich zu Euch.«
»Wir hatten von den beiden fremden Gesandten gehört; wir wußten von der Königin, daß für sie die Zeit gekommen sei, sich einen Mann zu wählen, und wir hatten Blutrache mit Euch. Darum wurde ein Kriegszug beschlossen. Wir wollten die Gesandten in unsere Hände bekommen, um mit ihnen zu verhandeln und die Geschenke zu erhalten, welche sie wohl für Euch bestimmt haben. Wir wollten uns ferner der Königin bemächtigen, daß sie gezwungen sei, Einen unseres Stammes zu wählen. Dann wäre die Blutrache erloschen und die Beni Suef hätten sich mit den Beni Sallah vereinigt zu einem einzigen Stamme. Dieser wäre dann so mächtig gewesen, daß er die Entscheidung über Krieg und Frieden gehabt hätte in den sämmtlichen Oasen Egyptens und Nubiens. Unser Scheik hat uns ausgesandt, Alles zu erfahren und zu erkunden. Wir belauschen Euch bereits seit dreien Tagen, haben aber nichts Wichtiges gesehen und gehört.«
»Wie gut, daß Ihr da mich getroffen habt!«
»Ja, das ist gut, wenn Du uns wirklich nichts als die reine Wahrheit gesagt hast.«
»Es ist kein Wort unwahr. Ja, ich kann Euch noch viel Besseres sagen: Die beiden Gesandten, welche Ihr haben wollt, wollen zu Euch.«
»Ah! Wirklich?«
»Ja. Ihr sollt noch heute mit ihnen sprechen. Man hält sie gefangen; sie aber werden heute in der Nacht entfliehen. Suef, den ich von Euch gefangen nahm, wird sie bringen. Ich habe ihm den Ort angegeben, wo er mich treffen wird.«
»Allah l'Allah! Welch ein Wunder!«
»Die Königin könnt Ihr auch noch haben. Heute hat der Kampf stattgefunden. Erst am Tage nach dem Neumond werden Beide Mann und Frau sein dürfen. Bis dahin fällt sie in Eure Hand. Und den Abgesandten des Vicekönigs, der sich Masr-Effendi nennt, werde ich Euch auch in die Hände liefern.«
»Wenn Du das thust, so soll Dir alles Blut vergeben sein, welches Du in unserem Stamme vergossen hast!«
»O, ich werde noch mehr thun. Ich liefere Euch noch zwei Personen, zwei sehr wichtige Personen. Hiluja, die Schwester der Königin, ist bei ihr auf Besuch.«
»Gott ist groß! Die Schwester der Königin! Ist sie jung und schön?«
»Jünger und schöner als Badija.«
»Wenn sie in unsere Hand geräth, soll Dir Ehre erwiesen werden, wie selten Einem widerfährt.«
»Auch ihr Vater ist da, der Scheik der Beni Abbas.«
»O Himmel! O Muhammed! Ist's wahr?«
»Er ist heute gekommen mit einer ganzen Menge von Kriegern.«
»Wir werden sie fangen! Welches Lösegeld wird das geben! Fast kann ich Dir nicht mehr glauben, was Du erzählst!«
»Ich lüge nicht!«
»Es ist zu viel, zu viel! Wüßte ich, daß wirklich Alles wahr ist, so würde ich Dir den Riemen nehmen und Dich frei lassen. Wir würden Dich behandeln, als ob Du bereits einer der Unserigen seiest.«
»Es ist Alles, Alles wahr. Ich werde es Euch beweisen.«
»Beweise es jetzt, gleich, indem Du es beschwörest!«
»Gut! Ich schwöre bei Allah, beim Propheten, bei dem Barte meines Vaters und bei dem meinigen, daß ich Euch nicht belogen habe.«
»Und daß Du alle diese Personen in unsere Hände geben willst?«
»Ja, Alle.«
»So komm her, ich binde Dich los.«
Er that es. Der Riese streckte und dehnte die Arme aus und sagte dann:
»Ich werde Wort halten, doch könnt Ihr Euch denken, daß ich einige Bedingungen zu machen habe.«
»Sage sie!«
»Ich werde bei Euch aufgenommen als Mitglied des Stammes der Beni Suef!«
»Das sage ich Dir zu.«
»Es wird um die Königin gekämpft und ich darf mich an dem Kampfe betheiligen.«
»Das versteht sich ganz von selbst.«
»Erhalte ich die Königin nicht, so erhalte ich wenigstens Hiluja, ihre Schwester.«
»Auch das gestehe ich Dir zu.«
»Und endlich bekomme ich alles Eigenthum wieder, welches ich zurücklassen mußte!«
»Es gehört Dir. Niemand wird es Dir vorenthalten, wenn es uns gelingt, die Beni Sallah zu besiegen.«
»Es gelingt; dafür laßt nur mich sorgen. Aber wird Euer Scheik auch Alles bestätigen, was Ihr mir jetzt zugesagt habt?«
»Er wird es. Ich bin sein Eidam, der Mann seiner Tochter. Er wird mich nicht schamroth machen, indem er mir verbietet, mein Wort zu halten.«
*