
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Unter den Tiergeschichten, die die Alten uns überliefert haben, hat mir als Knaben eine immer ausnehmend gefallen: die von Androklos und dem Löwen. Androklos hatte einmal in seiner afrikanischen Heimat einem Löwen den schmerzenden Dorn aus der Pfote gezogen und das Tier gepflegt, bis es wieder gesund war. Als Sklave nach Rom gebracht, soll er eines Tages im Zirkusspiel mit einem Löwen kämpfen. Der Käfig öffnet sich, der Löwe eilt brüllend in die Arena und will sich auf den zagenden Menschen stürzen. Da stutzt er plötzlich, läßt ein zärtliches Schnurren hören und, freudig mit dem Schweife schlagend, nähert er sich dem Sklaven und schmiegt sich an ihn: der Löwe hatte seinen Wohltäter nach so langer Zeit wiedererkannt! Gewiß, eine etwas rührselige Geschichte, von jener allzu deutlich moralisierenden Kinderfibelart, wie sie der amerikanische Humorist Mark Twain einmal so köstlich verspottet hat, indem er – Fortsetzungen dazu schrieb. Und auch etwas unwahrscheinlich klingt sie: ein Löwe, der ein so gutes Gedächtnis für Menschen und vor Jahren empfangene Wohltaten haben sollte! Aber gerade über diesen Punkt hat uns Hagenbeck kürzlich aufgeklärt: die Sache könnte sich schon wirklich so abgespielt haben; denn die großen Raubtiere, Löwen und Tiger, haben tatsächlich ein erstaunliches Personengedächtnis.
»Vor reichlich vierzig Jahren«, berichtet unser Gewährsmann, »kaufte ich einmal ein Paar junger Tiger, wovon einer an einer starken Erkältung erkrankte und über beide Augen eine bläuliche Haut bekam, die das Tier blind machte. Monatelang pflegte ich den kranken Tiger und machte ihm sein Los so erträglich als möglich. Jeden Tag mußte ich zu dem Patienten in den Käfig kriechen. Auf diese Weise bildete sich ein vertrauliches Verhältnis, und schließlich wurde meine Aufopferung auch belohnt; denn das Tier wurde wieder ganz gesund. Später wurde es mit seinem Genossen an den Berliner Zoologischen Garten verkauft; hier hat es noch lange Jahre gelebt, und bis zu seinem Tode hat mir der Tiger, den ich kuriert hatte, die treuste Anhänglichkeit bewahrt. Häufig sah ich ihn lange Zeit nicht; er brauchte aber nur, und zwar ganz unvorbereitet, meine Stimme aus der Ferne zu vernehmen, um sogleich in freudige Aufregung zu geraten. Kam ich näher, so begann er nach Katzenart zu mauen und schnurren, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Nicht eher gab sich das Tier zufrieden, bis ich zu ihm herantrat und mich eine Weile mit ihm beschäftigte. Ein staunendes Publikum stand manchmal ringsumher und wußte nicht, was es aus dieser seltsamen Begegnung machen sollte … In der ganzen Welt zerstreut leben mir, wohlverwahrt hinter Schloß und Riegel, eine Anzahl alter Freunde aus der Tierwelt. Ihr Leben währt nicht so lang als das unsrige, schnell kommt das Alter und der Tod, und demgemäß gehören die meisten dieser Erinnerungen und Tierfreundschaften der Vergangenheit an. Einer der Veteranen unter meinen Bekannten ist ein Löwe, der im Zoologischen Garten zu Köln lebt« – Hagenbeck schrieb das 1908. »Er gehörte zu einem Paar, das ich im Jahre 1890 mit verschiedenen andern Tieren in einer belgischen Menagerie kaufte. Die beiden Löwen waren von nordafrikanischer Abstammung und damals fünfjährig. Die Tiere waren außergewöhnlich schön und so zahm wie Katzen; sie blieben nur zwei Monate in meinem Besitz; aber diese Zeit genügte, um – wenn ich so sagen darf – eine Freundschaft fürs Leben herzustellen. Das eine Tier blieb in Hamburg und ist vor mehreren Jahren gestorben. Das andre kam nach Köln. Der Löwe ist jetzt alt und gebrechlich, hat mich aber nicht vergessen. Aus der Reise nach Köln habe ich einmal im Scherz gewettet, daß der alte Löwe mich schon von weitem durch bloßen Zuruf erkennen würde. Und so geschah es auch: der Löwe kam sofort voller Freude an das Gitter und gab sich nicht eher zufrieden, als bis ich ihn begrüßt und gestreichelt hatte. – Im Zoologischen Garten des Bronx Park zu New York machte ich vor einigen Jahren einen ähnlichen interessanten Versuch. Dort leben zwei Löwen und ein Königstiger, die mir einst sehr zugetan waren, mich nun aber lange nicht gesehen hatten. Der Direktor Doktor Hornaday bezweifelte, daß die Tiere mich wiedererkennen würden, und, äußerst gespannt, begleitete er mich in das Raubtierhaus. Schon als ich in die Tür trat und mich den Käfigen näherte, wurden die Tiere aufmerksam und starrten mich an, wie Menschen es tun würden, die sich auf etwas besinnen. Als ich sie aber bei ihrem Namen rief, wie ich es ehedem in Hamburg zu tun pflegte, sprangen sie sofort auf und liefen mit lautem Schnurren ans Gitter, wo sie sich von mir krauen und streicheln ließen. Doktor Hornaday war ganz erstaunt. Zweifellosere Beweise des guten Gedächtnisses und der Anhänglichkeit von Raubtieren«, schließt Hagenbeck seine Mitteilung, »lassen sich wohl kaum geben.« And eine bessere Rechtfertigung, füge ich hinzu, kann auch die Geschichte von Androklos und seinem Löwen nicht erfahren.
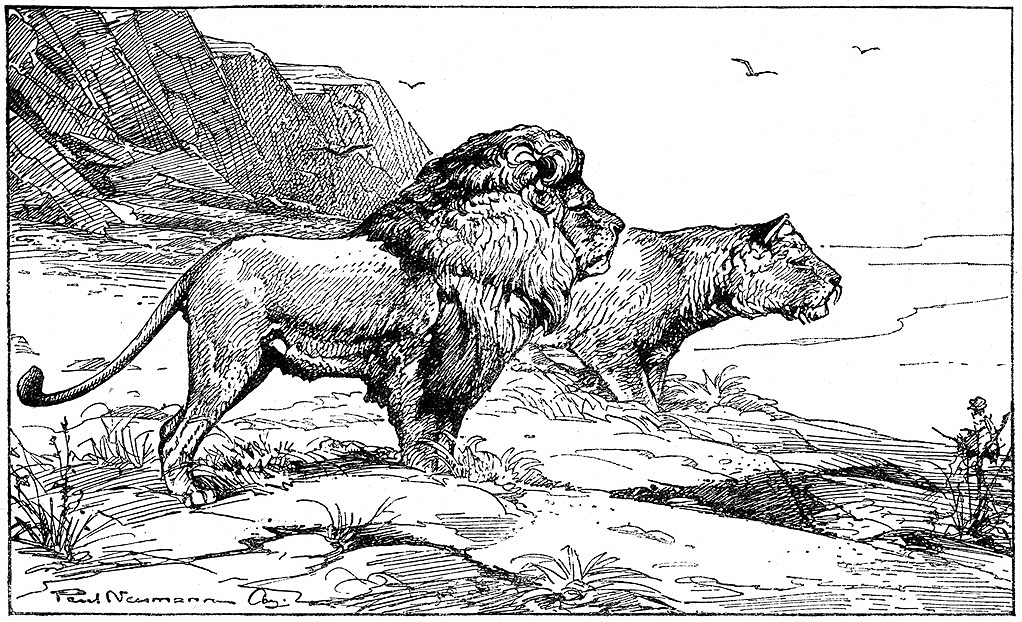
Löwenpaar
Mit Löwengeschichten, zumal mit Berichten von Löwenjagden ist es übrigens immer eine mißliche Sache gewesen: in keinem andern Falle wohl ist soviel »Jägerlatein« zutage gekommen, begeistert verbreitet und staunend geglaubt worden. Namentlich die französischen Löwenjäger, voran Jules Gérard und Chassaing haben ungezählte Löwen teils im freien Felde, teils auf dem – Papier getötet, und die Weltliteratur kennt zwei prachtvolle Löwenjägertypen dieses Schlags: des französischen Dichters Alphonse Daudet unvergleichlichen »Tartarin von Tarascon« und des Schweizers Gottfried Keller nicht minder köstlichen »Pankraz der Schmoller«.
Seit alten Zeiten schon hat man den Löwen den » König der Tiere« genannt, und diese Bezeichnung verdient er auch, weil seine ganze imposante Gestalt unverkennbar ernste Würde und Selbstbewußtsein atmet, das Ideal des Raubtiers ist. Zwar nicht der Katze in ihrer organischen Vollendung: Tiger und Leopard sind das entschieden mehr: aber sie erreichen doch das Imponierende der Löwenart nicht.
Legen wir uns zu besserem Verständnis dieser Ausführungen zuerst einmal die Frage vor: was ist ein Raubtier? Die Raubtiere ( Carnivôra) sind – nach der klaren Zusammenfassung des berühmten Münchener Zoologen Richard Hertwig – Tiere, die sich ausschließlich oder doch vornehmlich von Fleisch und Blut andrer Tiere nähren, ihre Beute mit List, durch kräftigen Sprung oder in schnellem Lauf ereilen und mit Hilfe muskelstarker, scharfkralliger Gliedmaßen und schneidender Zähne bewältigen. Der Raubtiercharakter steigert sich innerhalb der sehr großen Gruppe von den Bären bis zu den Katzenarten und verwischt sich, jenseits dieser Höhe wieder absteigend, bei den Wasserraubtieren. Die Katzen, als Raubtiere in der höchsten Vollendung, zeigen neben hoher Intelligenz und Sinnesschärfe das vorzüglichste Raubtiergebiß und die entwickeltste Raubtierpranke.
Das Gebiß ist ein ganz besonderes: der letzte Vorderbacken- (oder Lücken-) Zahn des Oberkiefers und der erste Backen- oder Mahlzahn des Unterkiefers erscheinen nämlich in sogenannte » Reißzähne« umgewandelt, in sehr große, dreizackige Zähne mit scharfen, schneidenden Kanten, die, aneinander vorbeigleitend, niemals die Kronen abschleifen, also immer scharf bleiben. Auffallend groß und derb und leicht nach hinten gebogen sind die spitzigen Eck- oder Fangzähne. Klein, fast unscheinbar, zeigen sich dagegen die Schneidezähne; verkümmert ist auch ein Backenzahn, der als einziger, stumpfgehöckert, hinter dem Reißzahn des Oberkiefers sich findet. Die Wirkung solches Raubtiergebisses ist nun folgende: mit den mächtigen, tief in das Fleisch der Beute eindringenden Fangzähnen hält das Raubtier sein Opfer fest. Mit den senkrecht aufeinander sich bewegenden Schneidezähnen werden Laut und Blutgefäße am Halse des Beutetiers durchbissen und hernach die Knochen abgenagt. Die Reißzähne werden zum Zerbeißen oder richtiger Zerschneiden großer Stücke und zum Zerbrechen der Knochen verwendet. Man kann, schildert Richard Hesse, an jedem fressenden Raubtiere sehen, wie es unter schräger Haltung des Kopfes mit den Reißzähnen die Fleischbissen abschneidet. Wie die Blätter einer Schere dicht aneinander vorbeistreichen müssen, damit sie gut schneide, genau so gleiten die scherenblattscharfen Reißzähne aneinander vorbei. Der kleine Mahlzahn im Oberkiefer dient endlich zum Zermalmen der Knochen. Die Zunge ist an ihrer Oberfläche mit zahllosen, nach hinten gerichteten, scharfen Hornstacheln bewehrt, die sie zu einer Raspel oder Feile zum Abschaben der letzten, an den Knochen haftenden Fleischteilchen machen; ihre Wirkung spüren wir im kleinen, wenn wir unsre Hand von einer Hauskatze lecken lassen. (Nebenbei bemerkt, trägt auch die Zunge der Wiederkäuer einen ähnlichen Reibeisen-Stachelbesatz, und im alten Schweden bestand deshalb eine Form der Folter darin, die Fußsohle des Verbrechers mit Salz zu bestreichen und das Salz dann durch ein Kalb ablecken zu lassen!)
Ebenso eigenartig ist die Prankenbildung der Katzenraubtiere. Die Katzen sind nur gelegentliche Kletterer (Leopard, Jaguar), für gewöhnlich bewegen sie sich auf dem Erdboden. Dabei würden nun die sichelförmig gebogenen, haarscharfen und am Ende fast nadelspitzen Krallen sehr bald stumpf geschliffen werden. Deshalb hat sich an der Katzenpranke, die mit Ballen als Schalldämpfern und elastischem Polster unter den Zehen ausgerüstet ist – die Katze hat »Sammetpfötchen«, sagt das Volk davon –, ein besonderer Schutzapparat ausgebildet. Das letzte, die Kralle tragende, stark erhöhte, oder, wenn man will, verbreiterte, abgeflachte Zehenglied ist durch ein elastisches Sehnenband mit dem vorletzten Zehenglied derart gelenkig verbunden, daß ein Muskelzug es mit der Kralle beim Schlagen oder Klettern vorstreckt, der entgegengesetzte Muskelzug aber es in der Ruhe und beim Gehen emporzieht und samt der Kralle in einer Art von Futteral oder Tasche auf der Rückenfläche des vorletzten Zehenglieds verbirgt und schützt. So kann das Katzenraubtier also ohne Beschädigung der zum »Schlagen« des Beutetiers wichtigen Prankenwaffe auf den Zehen gehen.
Der Löwe ( Fçlis lço), einst über ganz Afrika, Süd- und Westasien, ja, bis nach Europa verbreitet – zur Zeit des Perserkönigs Xerxes gab es noch in Thrakien Löwen –, wird heut in teilweise voneinander recht abweichenden (»variierenden«) geographischen Formen nur noch in beschränkten Gebieten Afrikas und Asiens angetroffen. Aus der nördlichen Sahara, folge ich der Übersicht des ausgezeichneten Tiergeographen Wilhelm Kobelt, ist er wie die großen Antilopen längst verschwunden. Ein eigentliches Steppentier ist er in Nordafrika nie gewesen, und noch weniger hat er den Titel »Wüstenkönig« (s. S. 236) verdient. Die Waldberge des Hochlands waren seine Heimat, aus denen er nur gelegentlich den Herden der Nomaden in die Steppe folgte. In den Bergwäldern haben auch die letzten Löwen ihre Zuflucht gefunden. In einer kurzen Spanne Zeit wird der Berberlöwe, die stolzeste unter den Lokalformen des Königs der Tiere, in Algerien und Tunis ganz der Vergangenheit angehören. Aus Ägypten und Vorderasien ist er ja längst verschwunden: am mittleren Euphrat und ganz an der äußersten Grenze der indischen Steppe, in den unzugänglichen Waldungen der Halbinsel Gudscharât hat sich sein schwächer bemähnter (und mit einem treffenden Ausdruck Hagenbecks: mopsgesichtiger) persischer Vetter noch in einigen Exemplaren erhalten. In den Wäldern am Südabhang der persischen Hochebene, in den Schilfdickichten am unteren Karun ist er noch recht häufig. In Südafrika ist der Löwe selten geworden, in Mittelafrika und Ostafrika aber wird er noch zahlreich angetroffen.
Bei einer Körperlänge des erwachsenen männlichen Tiers von über zwei Meter, einer Schwanzlänge dazu von etwa neunzig Zentimeter und einer Widerristhöhe endlich von rund einem Meter erhält der Löwe über die allgemeine Katzengestalt hinaus sein besonderes Gepräge durch das betont Kraftvolle aller einzelnen Verhältnisse des gedrungenen Körpers, dessen Vorderteil mit dem breitgewölbten Brustkasten sich in der wie eingezogenen Weichengegend deutlich, fast winklig gegen das viel schmälere Hinterteil absetzt, durch das massig eckige Haupt mit dem breiten Gesicht und der stumpfen Schnauze, durch die wundervolle, schlichthaarige Mähne, den »Herrschermantel«, des männlichen Tiers – dem Weibchen fehlt die Mähne –, durch die starke, mit hornigem Stachel bewehrte Schwanzquaste und durch den einfarbig sandgelben bis fahl braunroten, kurzhaarigen, glatten Pelz. Nur an einzelnen Stellen ist solcher schützenden Sandfarbe etwas Schwarz beigemischt, so oft in den Spitzen der Kopf- und Halsmähne, in deren langhaarigem Ausläufer längs des Bauches usw. Aber das ist sehr verschieden und wechselt im ganzen wie im einzelnen nicht nur nach der geographischen Form, sondern auch nach dem Individuum. Bei jungen Tieren ist das Haarkleid dick und wollig weich, an den Flanken und der ganzen Unterseite dicht mit schwarzbraunen Flecken übersät; bisweilen bleibt diese geradezu an das bunte Leopardenfell erinnernde Fleckung dauernd erhalten, namentlich auf der Unterseite und bei den Weibchen. Solch geflecktes Kleid dient sicherlich zum Schutze; denn es unterbricht, wie der englische Biologe P. Chalmers Mitchell einmal hervorhebt, die Umrißlinie und nützt besonders den Tieren, die im Walde leben und am Rande von offenen Lichtungen auf Beute lauern oder von dem Geäst der Bäume herab ihre Beute erreichen (vgl. S. 104). Die einheitliche Ausfärbung des erwachsenen Löwen kommt durch Unterdrückung der Flecke der Jungen während des Wachstums zustande. Den Zweck der Mähnenbildung scheint mir am klarsten unser trefflicher Tierbeobachter Gustav Jäger erkannt zu haben: sie ist nach ihm eine Art von Schutzschild. Wenn der Löwe sich zum Kampf rüstet, zieht er die Gesichtsmuskeln zusammen. Hierbei wird einmal die von Mähnenhaaren freie Gesichtsfläche kleiner; die schützende Haarmähne zieht sich über die Ränder des Gesichtes her. Sodann bilden sich im Gesicht dabei hohe, derbe Hautwülste, daß das Ganze wie ein gesteppter Fechthandschuh aussieht. Augen und Nasenöffnungen versinken zwischen diesen Wülsten, und die mit steifen Schnurrhaaren bedeckten Oberlippenhälften bilden, indem sie sich zu hohen Polstern zusammenziehen und das Gebiß entblößen, zwei kräftige elastische Stoßballen gegen die in Aussicht stehenden Backenstreiche. Diese merkwürdige Vorrichtung, die wir in keiner Weise bei einem andern Tiere wiederfinden, hebt Jäger treffend hervor, gibt der Gesichtsmaske in der Ruhe jene höchst charakteristische an das Menschenantlitz erinnernde Modellierung: das Charakteristische des Menschenantlitzes ist seine durch das Vorspringen der Nase, die Ausbildung des Gesichtsfleisches und die große Beweglichkeit der Lippen stark entwickelte Modellierung. Diese teilt der männliche Löwe mit uns, und darum wirken meinem Empfinden nach die wundervollen Porträte des »Königs Nobel« in Wilhelm v. Kaulbachs »Reineke Fuchs« so durchaus menschlich. Noch einen andern Vorteil erkennt Jäger der Mähne zu: der ungeheure Kopf, dessen edle Teile durch die erwähnte »Wattierung« und derbe Knochen geschützt sind, bildet im Verein mit der ungeheuren Mähne einen Schild, groß genug, daß sich der ganze Löwe hinter ihm verstecken kann, nicht so sichtbar wird. Dies geht um so leichter, als der hintere Teil des Körpers, wie wir hervorhoben, im Verhältnis zum vorderen, auffällig schmal ist. Etwas rätselhaft ist es noch immer um den hornigen Stachel in der Schwanzquaste, den schon der alte griechische Naturforscher Aristoteles kannte, und von dem die Alten behaupteten, er diene dem Löwen dazu, sich in Wut zu peitschen oder »zur Großmut anzureizen«. Weil das offenbarer Unsinn ist, wurde nachmals das Vorhandensein des Stachels überhaupt geleugnet. Aber er ist da, und die Untersuchungen Leydigs u. a. haben uns gezeigt, daß er eine Art von rundlich kegelförmiger Warze mit stark hervorgezogener Spitze darstellt, und so wird er wahrscheinlich dem Löwen Tastempfindungen vermitteln.
In einer flachen Vertiefung, unter Gebüsch, in Grasinseln, Dornenbüschen, auch wohl Felshöhlen, wo immer er genügend Deckung und Schutz findet, hat der Löwe sein Lager, das er, wenn er nicht sehr hungrig ist oder gestört wird, tagsüber nicht verläßt. Gelegentlich soll er freilich am Tage von einem erhabenen Standort Umschau halten über sein Jagdrevier. Mit Anbruch der Dunkelheit geht er auf Beute aus, alles reißend und schlagend, was sich ihm bietet, auch Aas keineswegs verschmähend. Den Beginn solches Raubzugs, zu zweien, Löwe und Löwin, aber auch in Rudeln unternommen – Schillings sah einmal siebzehn, ein zuverlässiger englischer Beobachter vollends siebenundzwanzig Löwen gemeinsam jagen –, leitet gewöhnlich jenes weithin hallende, wahrhaft majestätische Brüllen ein, das der Araber »raad«, d. h. »donnern« und nach dem er den Löwen »El ?sad«, den »Aufruhr Erregenden«, nennt. Es besteht, wie der alte schwedische Naturforscher Sparrmann einmal nicht zu Schilderndes zu beschreiben versucht, in einem »groben, völlig unartikulierten Laut, der etwas Hohles hat, wie der Schall eines Sprachrohrs. Es ist ein Mittellaut zwischen U und O und scheint aus der Erde zu kommen, so daß ich, so genau ich auch darauf horchte, doch nicht bestimmt vernehmen konnte, aus welcher Gegend und von welcher Seite es eigentlich kam«. Seine gewöhnlichen Laute sind, nebenbei bemerkt, ein tiefes, rollendes Knurren und ein gelegentlich »hustenartig hervorgestoßenes« Muss oder breiteres Wau. Die Phantasie der Araber will in diesem die nächtliche Jagd einleitenden Gebrüll des Löwen eine Handlung der Großmut sehen; es soll eine Warnung für die Tiere sein. In Wahrheit beabsichtigt er vielmehr, die Tiere seines Jagdgebiets in »panischen Schrecken« zu versetzen, sie gleichsam »kopfscheu« zu machen, daß sie auf der wilden Flucht die gewohnte Achtsamkeit vergessen und so dem Lauernden oder sich vorsichtig Anschleichenden leichter zur Beute fallen. Zell hat scharfsinnig und durchaus überzeugend damit die Tatsache in Verbindung gebracht, daß beim Jagen des Löwenpaars, wie die Eingeborenen immer behaupteten und neuere Beobachter durchaus bestätigt haben, stets die doch kleinere und schwächere Löwin, der auch das donnerähnliche Gebrüll versagt ist, der angreifende Teil ist. Das Paar verteilt auf solcher Jagd die Rollen: der Löwe scheucht die Beutetiere auf, die Löwin überfällt sie aus dem Hinterhalt. Und aus dieser sicher seit Jahrhunderten geübten Gewohnheit heraus, stammt ihr Brauch, im Gegensatz zu dem »edelmütigeren«, d. h. trägeren und sich nicht gleich entschließenden Löwen sofort den erspähten Feind, der gefährlich werden könnte, anzugreifen. Daß die Löwin namentlich angriffslustig ist, wenn sie Junge hat, versteht sich von selbst: ihr Mutterinstinkt heißt sie in diesem Falle vorbeugen. Die jungen Löwen, die bei der Geburt Kleinkatzengröße haben, sind anfänglich sehr ungeschickt. Nach etwa einem halben Jahre werden sie entwöhnt, beginnen aber schon vorher, Fleischstückchen von den Knochen abzuknabbern, die die Mutter ins Lager schleppt. Ehe sie das Lager verlassen, unterweist sie die Mutter in den Grundlagen der Pirschjagd. Sie läßt sie mit ihrem Schwanze spielen, schlenkert die Schwanzspitze umher, und die Jungen üben sich darin, diese zu ergreifen. Sobald sie stark genug sind, nimmt die Mutter sie auf einen Jagdzug mit; zuweilen erfolgen die ersten Jagdzüge auch mit beiden Eltern gemeinsam. Anfänglich warten die jungen Löwen dabei im Hinterhalt, bis ein Beutetier geschlagen ist; dann stürzen sie herzu und reißen gemeinsam mit den Alten die Beute in Stücke. Während dieser Zeit der Erziehung der Jungen wählt die Löwin meist leicht zu erlegende Beutetiere, greift kleinere Haustiere an und tötet auch mehr, als sie eigentlich zur Nahrung braucht. Nach dem ersten Jahre dürfen die jungen Löwen, die dann schon stattliche Eckzähne haben, selbständig jagen und ein Beutetier reißen und schlagen; doch bleiben die Alten in der Nähe, jeden Augenblick bereit, einzugreifen, wenn es notwendig sein sollte. Im Gebüsch, nahe der Tränke, vor allem gern an Steilufern von Bächen lauert der Löwe auf die Zebras und Antilopen der Steppe. Zusammengeduckt liegend, nimmt er seine gewaltigen Muskeln zu einer mächtigen Bewegung zusammen, und gewöhnlich ist mit einem Sprung, einem Prankenhieb, einem Biß der massigen Kiefern ins Genick das Opfer erledigt. Der Löwe soll nach Schillings bei solchen Gelegenheiten Sätze bis zu acht Meter machen können. Hat er den Sprung verfehlt, so steht er nicht selten von einem weiteren Angriff ab, und zwar, nicht »weil er sich schämt«, sondern weil er weiß, daß er im Laufe die flüchtige Antilope schwerlich einholt. Jagen Löwen, wie häufig, zu mehreren, so schneidet einer oder der andre dem Flüchtling geschickt den Weg ab. Daß der Löwe, wenn er hungrig ist, auch den Menschen angreift, ist zweifellos: die Beweggründe und Ursachen dazu sind ebenso zweifellos die gleichen wie beim Tiger, der sich zum »Menschenfresser« ausgebildet hat (s. S. 92). Sobald ein Löwe erkannt hat, daß der Mensch ein leicht zu erlangendes Beutetier ist, wird er gelegentlich immer wieder Menschen töten. Und dann kann es auch wohl geschehen, daß Löwen manche Gegenden für Menschen geradezu unbewohnbar machen, daß die Neger, wie Schweinfurth uns einmal erzählt, gezwungen sind, ihre Dörfer aufzugeben. »Wir fanden«, schildert er von dem Nilnegerstamm der Djur, »von Walddickicht umgeben, ein kleines verwahrlostes Dorf. Dornverhaue bildeten die Umzäunung; aber nirgends konnten wir einen Eingang ausfindig machen. Obgleich die Sonne schon hoch am Himmel stand, saßen die Einwohner aus Furcht vor Löwen noch immer auf der Spitze ihrer Dächer oder auf dem hohen Pfahlwerk, das ihre Kornkammern trug. Das Dorf war schon mehrmals wegen der Löwenplage verlegt worden.« Daß die Löwen an manchen Orten auch große Verwüstungen unter den Viehherden anrichten, ist ohne weiteres verständlich.
Die Eingeborenen fangen und jagen den Löwen auf die verschiedenste Weise. In Algier beziehen mehrere Jäger gemeinsam eine unterirdische, mit Schießscharten versehene Grube, Silo genannt, vor der als Köder eine Ziege oder ein Schaf angebunden wird. Naht der Löwe und bemächtigt sich des Beutetiers, so warten die Jäger so lange, bis der Räuber sich völlig in seinen Fraß vertieft hat, und eine der gleichzeitig abgeschossenen Kugeln macht dann seinem Leben ein Ende. Die Kaffern zogen früher, wie Lichtenstein berichtet, in großer Schar mit Speeren, Keulen und Schilden bewaffnet, auf die Löwenjagd aus. Nachdem das Lager aufgespürt war, wurde der Löwe umzingelt und immer enger eingeschlossen. Zuletzt reizte man ihn durch Lanzenwürfe so lange, bis er aus seinem Versteck hervorbrach und einen der Jäger annahm. Dieser warf sich im selben Augenblick zu Boden und deckte sich mit seinem Schilde. Zugleich fielen die Genossen über den Löwen her und durchstachen ihn, was häufig nicht ohne Verwundungen abging. Die außerordentlich kühnen M?saï in Ostafrika, die sich aus dem Fell oder der Mähne des Löwen einen imponierenden Kriegskopfschmuck herstellen, greifen den Löwen gelegentlich in freier Steppe nur mit ihrem Speer bewaffnet an und erlegen ihn, wie uns Weiß verbürgt hat. Auch im alten Assyrien hat man den Löwen, wie uns ein Relief zeigt, im Fußkampf gejagt. Andre Reliefs zeigen uns den König Sardanapal zu Pferde mit dem Speer und zu Wagen mit Speer, Pfeil und Bogen den Löwen jagen. Im Somalilande und in einigen Hochsteppen Britisch-Ostafrikas wird der Löwe von den Europäern zu Pferde gejagt, indem man ihn hetzt, bis er ermüdet sich stellt. In Südafrika pflegt man ihn auch mit Hunden zu jagen.