
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Kirche zu Hoy auf den Orkneyinseln liegt an einer schmalen, sandigen Bucht, die oft von Seehunden besucht wird. Wenn es windstill ist und die Glocken läuten, sieht man von weit her die Robben die Köpfe aus dem Meer erheben und aufs Land zuschwimmen, um den Klängen zu lauschen. Die Augen starr nach der Gegend gerichtet, woher die Töne kommen, verweilen sie unweit des Strandes, entzückt und verwundert der Musik hingegeben. Der Seehund ist nämlich ein ausgesprochen musikliebendes Tier, was schon Homer und die alten Naturforscher wußten. »So leicht er durch das geringste Geräusch zu verscheuchen ist, wenn er sich auf dem festen Eise befindet,« berichtet der schwedische Polarforscher Torell, »so leicht kann man ihn im offenen Wasser oder im Treibeise durch Pfeifen und andre Töne bewegen, dem Boote näher zu kommen. Solche Musik und besonders das Blasen auf der Signalpfeife vermochte einen Seehund ganz nahe an unser Boot zu locken. Er hielt dann seinen Kopf lange über dem Wasser, offenbar den angenehmen Klängen lauschend, tauchte unter und kam an einer andern Stelle wieder heraus; ein Büchsenschuß scheuchte ihn nur eine Weile fort.« So begeisterte Musikfreunde gibts unter den Tieren (von den Vögeln abgesehen) nur wenige. Nebenbei bemerkt: Versuche, die ich einst im Berliner Zoologischen Garten anstellte, erwiesen als ganz besonders musikalisch, ja, geradezu närrisch vor Freude über abgestimmten Glockenklang und Geigenmusik den – Esel; sein freudiges »I–ah, I–ah« schreiend, galoppierte er, selbst den Zucker des Wärters verschmähend, herbei, um der Musik recht nahe zu lauschen. Freude an der Musik ist eigentlich eine echt menschliche Eigenschaft; denn sie verrät ein tiefer entwickeltes Seelenleben. Wenn man nun auch solches dem Esel und dem Seehund kaum wird zusprechen können, so läßt sich doch nicht leugnen, daß gerade der Seehund mancherlei Züge aufweist, die ihn, mit Schiller zu reden, unserm »Herzen menschlich näher bringen«. Schon sein täppisch drolliges Gehaben, sein dem eines pensionierten Obersten mit kurzgeschorener, silbergrauer Tolle und martialischem Schnurrbart gleichender Kopf, die dunkelbraunen durchgeistigten Augen, die in Erregung und Schmerz Tränen vergießen, dieses behäbige Pusten und behagliche Stöhnen eines kurzhalsigen, wohlbeleibten älteren Herrn, das die Robbe hören läßt, wenn sie aus dem Wasser taucht, dieses Zittern und Seufzen, wenn sie geängstigt ist, dieses » dolce far niente«, diese »süße Faulheit«, wenn sie keine Sorgen hat, das alles hat unleugbar etwas Menschliches und läßt uns begreifen, daß die Alten nach dem Bilde des Seehundes ihre Tritonen und Nereïden schufen, wie denn auch Böcklins Meerungeheuer eine gewisse Robben-Menschen-Familienähnlichkeit zeigen. Einen rührenden, menschlichen Zug noch zu erzählen, den uns Grube bewahrt hat: Ein irischer Fischer fing einmal eine junge Robbe, die bald der liebste Spielgenoß seiner Kinder wurde. Als aber nach vier Jahren die kleine Herde des Fischers von einer Seuche befallen ward, bedeutete man dem abergläubischen Iren, das »unreine Tier«, das er beherberge, trage die Schuld daran. Grund genug, es zu beseitigen. Der Seehund wird in ein Boot geladen und jenseits der Clare-Insel ins Meer geworfen. Das Boot kehrte zurück, aber auch die Robbe; denn am andern Morgen lag sie auf ihrem gewöhnlichen Ruheplatz am Herde. Zum zweiten Male wird der mißlungene Versuch wiederholt, draußen auf hoher See, eine Tagereise von der Insel. And zum zweiten Male erscheint nach sechsunddreißig Stunden die Robbe an der Tür der Hütte. Man läßt sie ein; doch nur um sich ihrer jetzt auf eine unfehlbare Weise zu entledigen. Der Barbar stach ihr die Augen aus. So verstümmelt übergab er das Geschöpf einem Grönlandfahrer mit der Weisung, es außerhalb des Bereichs der englischen Küste über Bord zu werfen. Eine Woche war vergangen, da lag nach einer stürmischen Nacht das treue Tier wieder vor der Hütte – Hunger, Schmerz und Erschöpfung hatten es dem Tode nahegebracht; und es starb, nachdem es noch einmal die Stimmen der Kinder vernommen. Wer, fragt Grube, war hier das »unreine Tier« – der Mensch oder die Robbe?
Dieses »Menschenähnliche« des Seehundes ist aber nur die eine Seite der Medaille; die andre zeigt uns ein dem Wasserleben angepaßtes Raubtier, das, wo es mit der menschlichen Kultur in engere Berührung kommt, großen Schaden anzurichten vermag. Als der Seehund noch an den Küsten Rügens häufig war, und das ist noch nicht allzulange her, war er den Fischern ein gefürchteter Feind; er schwamm längs der Netze und biß die in den Maschen steckenden Fische ab, so daß die Fischer nur die Köpfe ernteten. Die Rügenschen Fischer stellten ihm deshalb mit allen erdenklichen Mitteln nach: sie hatten sogar eine Art von Seehund-Kriegslied (»Hol' mir den Seehund ans Land, er frißt die Fisch' auf dem Strand«, begann es in hochdeutscher Übersetzung), bei dessen Absingen sie wahre Indianertänze aufgeführt haben sollen.
Der etwa anderthalb bis zwei Meter lange Seehund oder die Robbe ( Phôca vitulîna) gehört zu den Flossenfüßern oder Wasserraubtieren. Bei dieser Unterordnung der Raubtiere sind die Gliedmaßen zu Flossen abgeplattet und Finger und Zehen durch Schwimmhäute miteinander verbunden; dem Raubtiergebiß fehlt hier der sogenannte »Reißzahn,« dafür sind sämtliche Backenzähne gleichmäßig spitzgezackt und so vortrefflich geeignet, die schlüpfrigen Fische festzuhalten und zu zerschneiden. Die ganze Gestalt des Seehundes, dem Umrisse nach weniger einem Säugetier als einem Fische ähnelnd, dem ein Scherz der Natur einen Hund- oder Otterkopf angefügt hat, verrät uns die Anpassung an ein Wasserdasein: die Torpedoform des Körpers, der eirunde, vorn zugespitzte Kopf, dem Ohrmuscheln fehlen und dessen schmalspitzige Nasenlöcher sich von selber schließen, die Flossen der Hände und Füße, das kurze, wie geschorene Haarkleid. Arme und Beine, verkürzt und verbreitert, stecken fast ganz in der Umhüllung des Rumpfes. Die Hände, mit dem Daumen als längstem Finger, stehen schräg nach außen, wie die Grabpfoten des Maulwurfs etwa, die Füße aber sind nach hinten gereckt, einander genähert und mit der Sohle zugekehrt, geradezu wie eine schwanzartige Verlängerung des Hinterleibes anzusehen, der Schwanz selbst ist nur ein Stummel. Mühsam gräbt sich der Seehund gleichsam aufs Eis oder auf den Strand; wie eine Katze buckelnd oder wie eine Spannerraupe sich zusammenkrümmend, schleudert er sich dann rutschend vorwärts, streckt sich und krümmt sich wieder wie in Krämpfen und wirft sich von neuem so ein Stück nach vorn. Ganz anders im Wasser. Einen eleganteren und geschickteren Schwimmer – den Otter vielleicht ausgenommen – kann man sich kaum denken. Die wie Schaufeln gehöhlten Füße zusammenschlagend und so das zwischen ihnen befindliche Wasser ausstoßend, treibt er die glatte, überaus biegsame Spindelwalze seines Leibes vorauf. Die Hände helfen dabei und sind zugleich die Steuerung, wie man ja auch im Boote mit den Rudern steuern kann. Die dicke Speckschicht, die den Leib umhüllt, erleichtert dieses Schwimmen; die fettgetränkten, auffallend leichten, zum Teil papierdünnen Knochen verringern des weiteren das Gewicht des Schwimmers, der bald auf dem Bauche, bald auf der Seite oder dem Rücken liegt und selbst rückwärts zu schwimmen vermag. Ein vorzüglicher Taucher, schließt der Seehund im Wasser Nasen- und Ohrenöffnung; unter Wasser vermag er etwa fünf bis sechs Minuten, ja, selbst länger zu verweilen, für gewöhnlich steigt er aber jede Minute zur Oberfläche empor, um zu atmen. Die starren, federnden, gedrehten Borsten der Schnurrhaare ermöglichen ihm, die Bewegungen der Beute im Wasser zu spüren. Die großen Nasenöffnungen sprechen für ein gutes Witterungsvermögen; die Schallwellen – und Wasser leitet den Schall ja besser als die Luft – wird das Tier dem innern Ohr wohl mit dem ganzen Körper zuleiten. Der Gesichtssinn scheint weniger gut entwickelt zu sein.
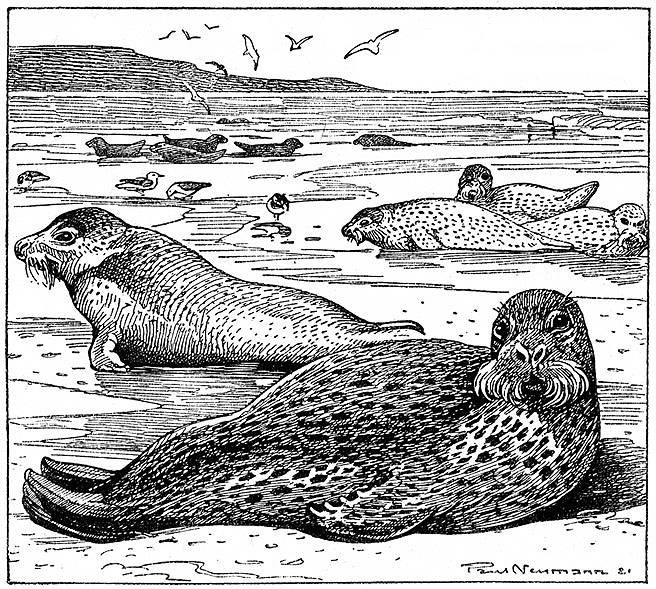
Seehunde
Die Robben sind ausgesprochen gesellige Tiere; sie tummeln und sonnen sich stets in größeren Gesellschaften, wobei sie Wachen auszustellen pflegen. Die Alten und Jungen hängen sehr aneinander, und die Mutter schützt den Sprößling oft mit Aufopferung ihres Lebens. Sehr drollig und menschlich sieht es aus, wenn sie das Junge mit der Hand an sich drückt, es gewissermaßen »unter den Arm« nimmt, wie wir es mit unsern Kleinen machen, und mit ihm ins Wasser flüchtet. Die Jungen, die an Land oder auf dem Eise geboren werden und das Schwimmen und Tauchen erst allmählich in kleineren Teichen zwischen dem Eise lernen müssen, jagen und necken sich unablässig im Wasser und spielen mit der Mutter, während der wohlbeleibte Vater vergnüglich »bellt«, brummt und knurrt und zu träg, um selber mitzuspielen, wenigstens mit den Augen dem Spiele folgt. Das Männchen hat stets mehrere Weibchen, um deren Besitz heftige Kämpfe ausgefochten werden. Die Nahrung des Seehundes bilden Fische, Krustentiere, Seesterne und dgl. Feinde hat er außer dem Menschen nur wenige: den Eisbären, den Schwertwal, größere Raubfische. Während des Winters hält sich der Seehund im Eise ein oder mehrere Atemlöcher offen, die er durch fortwährendes Aus- und Einschlüpfen am Zufrieren verhindert. Die dicke Speckschicht und der Pelz schützt das Tier genügend gegen die Kälte. Die Färbung des Pelzes, ein gelbliches Silbergrau mit schwarzbraunen rundlichen und eckigen Flecken, ist eine Art von Schutzfärbung.
Die Seehunde, von denen man mehrere Arten unterscheidet – genannt seien hier noch: der graue Seehund, die Ringelrobbe, die grönländische oder Sattelrobbe, die im Mittelmeer heimische Mönchsrobbe und die auf dem Kopfe eine aufblähbare Hautblase von Jakobinermützenform tragende und danach genannte Klappmütze –, haben eine sehr weite Verbreitung; sie kommen vom Eismeer an nach Süden bis Südamerika in den Küstengewässern vor, sind bei uns (Rügen, Nordseeküste) noch heute nicht allzu selten und gehen gelegentlich in den Flüssen stromauf bis weit ins Binnenland. Zu Zehn-, ja, Hunderttausenden alljährlich von den »Robbenschlägern« an den Küsten Kanadas, Salvadors, Neufundlands, des Beringsmeeres usf. des Pelzes und des Speckes wegen erlegt, nehmen sie an Zahl freilich beständig ab. Nicht ohne den tiefsten Abscheu zu empfinden, schreibt der deutsche Polarfahrer Bessels, kann man dieser unweidmännischen Jagd zuschauen, die den Namen Jagd kaum mehr verdient; denn sie ist niedriger, als die niedrigste Aasjägerei, in einem Maße ausgeführt, das Grauen erregt. Mit dem etwa anderthalb Meter langen, am Ende einen schweren Doppelhammer tragenden »Robbenknüttel« wird den zum Werfen der Jungen aufs Eis zu Tausenden gegangenen Robben, die unter der Sorge um die Jungen ihre Furcht gänzlich abgelegt haben und sich widerstandslos töten lassen, der Schädel zertrümmert. Jeder einzelne Schläger kann im Laufe einer Minute drei bis fünf der Tiere erlegen; lang ist der Tag unter jenen Breiten, und ehe es dunkelt, nimmt das Morden kein Ende. Das Eis ist blutgetränkt, wie ein Schlachtfeld der Schnee meilenweit gerötet von den Fußtritten der Schlächter, die erst mit Anbruch der Nacht zum Schiffe zurückkehren. So wurden beispielshalber im Jahre 1857 allein an der Küste von Salvador während eines zweimonatigen Robbenschlagens gegen 500 000 Robben erbeutet, deren Wert damals rund 2½ Millionen Mark betrug.
Die Eskimos, für deren Leben der Seehund von der größten Bedeutung ist – liefert er ihnen doch die Nahrung, Kleidung, Wohnung, Beleuchtung, Heizung und Gerät –, jagen die Robbe auf mannigfache Weise, sowohl vom Boote aus wie auf dem Eise. Als Jagdwaffe dient eine Harpune, deren Seil am Ende eine Schwimmblase trägt, und die Lanze. Die Jagd vom Boote, jenem kleinen, schmalen, einsitzigen »Kajak«, aus gilt für nicht ungefährlich, weil der harpunierte Seehund nicht selten an der sich verwickelnden Harpunenleine das Boot umwirft, auch wohl ein Loch in den Kajak beißt, so daß das Boot sinkt; der Eskimo nennt sie daher sehr bezeichnend »Kamavok«, d. h. das »Auslöschen«, nämlich des Lebens. Die Jagd auf dem Eise sei hier mit den naiven Worten des berühmten alten Herrnhuter Grönlandsmissionars David Cranz erzählt. Ein Grönländer setzt sich neben dem Loche nieder, das der Seehund zum Lustschöpfen selbst gemacht hat. Wenn nun der Seehund die Nase an das Loch hält, so stößt der Eskimo mit der Harpune drein, macht ein größeres Loch, zieht ihn heraus und schlägt ihn vollends tot. Oft muß der Jäger aber regungslos viele Stunden lang warten, ehe er das vorsichtige Tier zu harpunieren vermag; deshalb nennt der Eskimo diese Jagdart »maupok«, d. h. »er wartet«. Eine zweite Methode beschäftigt zwei Jäger. Der eine legt sich auf einen Schlitten neben dem Loch, wo der Seehund herauszukommen und sich an der Sonne zu wärmen gewohnt ist, auf dem Bauche nieder. Neben diesem großen Loch hat der zweite Jäger ein kleines gemacht und eine Harpune an einer sehr langen Stange dareingesteckt. Der auf dem Eise liegt, schaut durch das große Loch, bis ein Seehund unter der Harpune, die er mit der Hand dirigiert, hinfährt. Dann gibt er dem andern ein Zeichen, worauf dieser mit Macht den Seehund durchspießt. Diese Art des Fanges nennt der Eskimo »itsuarpok«, d. h. »er sieht durch ein Loch«. Liegt ein Seehund neben seinem Loch auf dem Eise, so rutscht der Eskimo auf dem Bauche ihm entgegen, wackelt mit dem Kopf und knurrt wie ein Seehund. Das Tier hält den Grönländer für seinesgleichen – wie denn auch nach Kanes Mitteilung die sich hochrichtende Robbe von hinten einem Eskimo ähnelt –, läßt ihn nahe an sich herankommen und wird gespießt. Wenn im Frühjahr der Strom ein großes Loch ins Eis macht, umgeben die Eskimos dieses und passen auf, bis die Seehunde in Menge unter dem Eise hervor an den Rand kommen, Luft zu schöpfen. Dann empfängt man sie mit Harpunen. Viele Robben werden auch auf dem Eise, wo sie in der Sonne schlafen und schnarchen, erschlagen. Die Erlegung der ersten Robbe durch den jugendlichen Eskimo – und erst nach Ablegung dieser Probe wird er in die Reihe der Männer ausgenommen – wird mit eigenartigen Bräuchen gefeiert. Unter besonderm Zeremoniell wird das Tier zerlegt. Ist es tischgerecht, so ruft man den fleischentblößten Kopf mit humoristischem Pathos an: »Sieh, wie wir dich behandeln. Wir haben dich gefangen, um dich gut bewirten zu können; denn von selbst kommt ihr nicht zu uns, aus törichter Furcht. Laß es dir nun hier wohlgefallen und erzähle deinen Verwandten von unsrem Betragen gegen dich, damit sie öfter zu uns kommen und sich auch also bewirten lassen.«
Wie häufig die Seehunde einst im Mittelmeer gewesen sein müssen, verraten uns die Sagen und Berichte der Alten. Ja, die Stadt Marseille hieß nach der Robbe einst »Phokäa« und führt noch heute einen Seehund im Wappen. Bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts konnte dagegen der Bischof Erich Falchendorf von Drontheim dem Papst Leo X. ein »eingesalzenes Robbenhaupt« (vermutlich übrigens ein Walroß) als seltene Kuriosität senden, und als im Revolutionsjahre 1848 Hagenbecks Vater im Krollschen Garten zu Berlin in Fischbottichen ein paar in der Nordsee gefangene Seehunde ausstellte, lief ganz Berlin dahin, die seltenen Tiere zu bewundern! Heut werden dressierte Seehunde, die ins Wasser geworfene Gegenstände apportieren, das Tamburin schlagen oder die Gitarre zupfen und derlei Kunststücke mehr vollführen, nicht selten im Zirkus gezeigt.