
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
"Wir stellten uns in den Niederungen des Waldes auf, durch die die Tapire aus den benachbarten Sumpfwiesen zu wechseln pflegten. Jeder nahm seinen Stand an einem starken Baume, um sich, wenn das Tier gerade auf ihn zulaufen sollte, dahinter verbergen zu können, und erwartete hier das Wild, das, durch einige Treiber und die Hunde aufgescheucht, die gewohnten Wege durch den Wald wählen würde. In den Stunden der Erwartung, die der europäische Jäger an solchen Plätzen zubringt, kann er sich den Eindrücken des Stillebens in einer brasilianischen Waldung überlassen. Seine Augen schweifen an den ungewohnten Formen der Bäume, des Laubes und der Früchte umher, er beobachtet die Neugier der Affen, die an die äußersten Äste herabkommen, um die fremde Erscheinung zu betrachten; er sieht den stillen Krieg der Insekten, die Geschäftigkeit großer Ameisenzüge. Bisweilen tönen die Hammerschläge der Spechte oder das Gekrächz der Araras durch die ruhige Einsamkeit. Plötzlich wird der Wald lebendig: der Tapir erscheint, von den kläffenden Hunden verfolgt, und bricht, mit vorgestrecktem Kopfe und geringeltem Schwanze in gerader Flucht durch das Dickicht, alles vor sich niederwerfend, was ihm im Wege steht. Der Lärm ist so groß, daß selbst der geübte Jäger scheu hinter den schützenden Baum tritt, um von hier aus das Wild in Hals oder Brust zu treffen. Die Brasilianer bedienen sich aus dieser Jagd sehr langer Kugelflinten. Kühne Jäger wagen wohl auch, dem vorüberrennenden Tapir ein breites Messer in die Brust zu stoßen; dies ist jedoch immer gefährlich, denn obgleich das Tier weder durch Zähne, noch durch die Klauen verwundet, kann es doch durch den gewaltigen Stoß, den es mit seinem Kopf ausübt, bedeutend verletzen. Wir waren so glücklich,« schließt der berühmte bayrische Brasilienforscher Martius seine Schilderung, »an diesem Tage zwei alte Tapire zu erlegen und einen jungen zu fangen, der gezähmt werden sollte. Das geschieht ohne Mühe, und der Tapir wird so zahm wie ein andres Haustier.«
Der Tâpir, von dem wir eine südamerikanische ( Tâ?pirus americâ?nus) und eine südasiatische Form, den Schabrackentapir ( Tâ?pirus ??ndicus), kennen, gehört zu den Huftieren ( Ungulâ?ta), und zwar zu den sogenannten Unpaarzehern ( Perissod?´ctyla), die dadurch ausgezeichnet sind, daß die mittelste Zehe sich unter dem Druck der Körperlast stärker entwickelt hat, während die andern, beim Tragen des Körpergewichts weniger beteiligten Zehen sich mehr oder weniger zurückgebildet haben. Beim Tapir ist dieser Entwicklungs- und Rückbildungsprozeß noch nicht sehr weit vorgeschritten: er hat an den Vorderfüßen noch je vier, an den Hinterfüßen je drei harthufige Zehen. Das gleichfalls in diese Unterordnung der Huftiere gehörende Rhinozeros besitzt dagegen nur drei Zehen am Vorder- wie Hinterfuß, das Pferd vollends nur eine in Tätigkeit befindliche außerordentlich verstärkte und verbreiterte Zehe. Der Tapir ist also noch mehrhufig, was für ein Sumpftier, wie er, von großer Bedeutung ist, weil dadurch sein Gewicht auf der Unterlage besser verteilt wird. Tritt ein Mensch in sumpfigen Boden, vergleicht Schmeil einmal sehr anschaulich, so kann er seinen Fuß nur schwer wieder frei machen; denn hebt er ihn, so entsteht darunter ein luftverdünnter Raum. Sinkt aber ein Mehrhufer in solchen Boden ein, so bekommt er die Füße bald wieder frei, weil durch den Zug nach oben die auseinander gespreizten Zehen sich nähern, die Bildung eines luftverdünnten Raumes also verhindert wird.
Im Äußern halb einem Pferde, halb einem Schweine ähnelnd, erscheint der bis zwei Meter lange und etwa ein Meter hohe Tapir trotz des zierlichen Gliedmaßenskelettes als ein verhältnismäßig plumpes Tier, welcher Eindruck im wesentlichen wohl durch den lang ausgezogenen, massig eckigen Kopf mit den kleinen, schiefstehenden Schweinsaugen und dem von der herabhängenden Oberlippe gebildeten Rüssel bedingt wird. Der Rüssel, an dessen Ende die Nasenlöcher sitzen, ist nur kurz, aber sehr beweglich und kann von dem schnüffelnden oder tastenden Tiere um das Doppelte seiner Länge gestreckt werden; indem der Tapir ihn um den zu erfassenden Gegenstand herumbiegt, dient er zugleich als Greiforgan. Ein kurzes, wie geschoren wirkendes, grau- bis dunkelbraunes Haarkleid bedeckt den rundlich prallen Körper, verblaßt an der Kehle und Unterseite des Halses zu einem Aschgrau und bildet auf der Mitte des Hinterkopfes und im Nacken eine kurze, starre, dunklere Mähne, ähnlich der der Pferde auf den altgriechischen Tempelfriesen. Die ziemlich großen, ovalen, steifen, weißgesäumten Ohren spielen, wenn das Tier sich beunruhigt fühlt, gleich dem witternden Rüssel, lebhaft nach allen Seiten, wie der Tapir denn auch, langsamen Schritts den Wald durchstreifend, sich vorsichtig überall umsieht. In der Erregung läßt er ein gedehntes Pfeifen hören. Stößt er auf einen Feind, so flieht er mit gesenktem Kopf ins Dickicht, mit Vorliebe aber zum Wasser, darin er, ein guter Schwimmer, sofort untertaucht. Sein gefährlichster Feind ist außer dem Menschen der Jaguar, dessen er sich auf eigene Weise gelegentlich erwehren soll. Wird er nämlich auf seinem Wechsel zum Flusse von dem Raubtier überfallen, berichten zahlreiche Beobachter, so rennt er mit seinem Reiter wie ein Sturmwind durch das Dickicht, und ehe dem Jaguar noch soviel Zeit geblieben, sich an dem fingerdicken, zähen Felle des untersetzten und kräftigen Tapirs festzukrallen, liegt er schon abgestreift in irgendeinem Dornen- oder Lianengestrüpp. Alte Tapire zeigen nicht selten auf ihrem breiten, feisten Rücken die tiefen Rißnarben von Jaguarkrallen. Der Mensch jagt den Tapir des Wildbrets wegen, das im Geschmack dem Rindfleisch ähneln soll, und schneidet aus der dicken, starken Haut Peitschen und Zügelriemen; die letzteren werden weithin verhandelt. Der Tapir ist ein Pflanzenfresser – in der Gefangenschaft übrigens gleich dem Schweine ein Allesfresser –, der besonders junge Palmenblätter, in kultivierten Gegenden aber Zuckerrohr und Melonen bevorzugt, daher in den Pflanzungen oft großen Schaden anrichtet. Eine besondere Leidenschaft hat er für salzhaltige Erde; ja, er frißt sogar Tonerde, und diese Vorliebe scheint von ihm auf die Urwaldindianer, die Otomaken am Orinoko usw., übergegangen zu sein, die solche Tonerde ihren Speisen zumischen und während der zwei Monate dauernden Hochwasserzeit fast ausschließlich Tonerde zu sich nehmen. Zum Aufenthalt wählt der Tapir dichte Waldungen, die in der Nähe von Flüssen oder sonstigen Gewässern liegen. Er badet und wälzt sich im Schlamm, sobald er nur Gelegenheit dazu hat. Die Geschlechter leben den größten Teil des Jahres für sich; nur die Mutter wird gewöhnlich von dem Jungen begleitet und verteidigt dieses mit Aufopferung ihres Lebens. Merkwürdigerweise ist der weibliche Tapir größer als der männliche, was für die Säugetiere eine sehr auffällige Erscheinung und nur noch beim Wal, den Robben und dem Igel zu beobachten, bei niederen Tieren jedoch ziemlich häufig, ja, bei den Insekten beinahe Regel ist. Das Haarkleid des Jungen ist übrigens weiß gefleckt und gestrichelt wie das der »Frischlinge« unsres Wildschweines. Das jung eingefangene Tier läßt sich leicht zähmen. Ein französischer Wundarzt zu Cayenne, erzählt Buffon, hatte einen Tapir aufgezogen, der große Anhänglichkeit zeigte und seinem Herrn wie ein Hund folgte. Er ging allein in den Wald spazieren und machte manchmal weite Wege, kehrte aber jedesmal zeitig wieder zu seinem Stalle zurück. Im übrigen verriet er jedoch wenig Intelligenz und Folgsamkeit; wollte man ihn irgendwohin haben, mußte man ihn fast wegzerren.
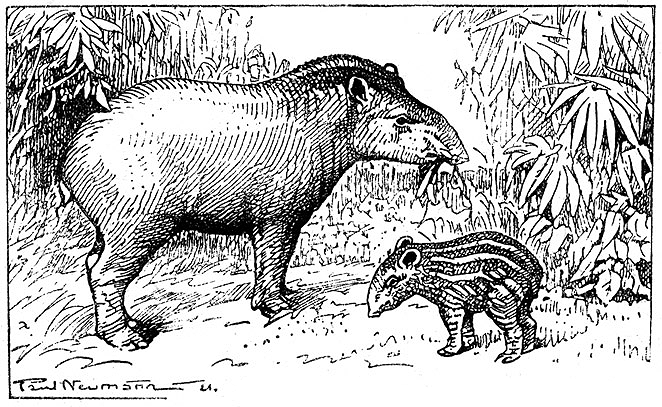
Tapir mit Jungem
Schon die ersten Entdecker des Tiers beschrieben zwei amerikanische Arten: einen Tapir der Ebene und einen im Gebirge lebenden. Von letzterem dem » Bergtapir«, der gemäß dem kälteren Klimas eine dichtere, längere Behaarung hat, dem aber andrerseits die Mähne fehlt, wußten die Indianer Kolumbiens seltsame Dinge zu fabeln. Sie nannten ihn »Pinchaque« und schilderten ihn als gespensterhaftes, großes Tier, dessen Erscheinung Unglück bedeute. In Wahrheit ist er etwas kleiner als der Tapir des Urwaldes; er soll nach dem Engländer White nie unter 3500 Meter Meereshöhe herabsteigen und ziemlich selten sein.
Der südasiatische Schabrackentapir endlich unterscheidet sich vom amerikanischen im wesentlichen durch die Färbung. Im allgemeinen schwarzbraun, trägt er auf Rücken und Hinterleib eine silberweiß glänzende, scharf abgegrenzte »Schabracke«. Eine Mähne fehlt ihm. Seine Heimat ist das südliche Birma und Siam, die Halbinsel Malakka, Sumatra und Borneo. Die Lebensweise des Schabrackentapirs gleicht der seines amerikanischen Vetters. Sehr merkwürdig ist es, daß die dunkle Farbe des Tiers abfärbt. Reibt man mit der Hand über die dunkel gefärbten Teile des Tapirs, so bekommt man davon schwarze fettige Flecke. Als eine Art von Parallelbeispiel hierzu führt Mitchell die Turakos oder Pisangfresser an, deren glänzend karminrote Feder von einem starken Regenguß sogar völlig entfärbt werden. In beiden Fällen rührt die Färbung von der Anwesenheit eines besonderen vom Körper selbsterzeugten Farbstoffes (»Pigment« s. a. S. 104) her.