
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Kaum ein andres heut lebendes Tier hat wohl soviel »Vorsintflutliches« in seinem Äußern wie das plumpgewaltige Nashorn oder »Rhinozeros« (griechisch). Mit seinem Horn auf der »Nase«, mit seinem Platten- und Schuppenpanzer, seinem breiten, eckigen, lappigen Maul, seinem schiefen, tückischen Blick ist es gleichsam das geborene Fabeltier. Und wenn auch den Alten das Rhinozeros wohlbekannt war – es gibt ja kaum ein altweltliches Tier, das sie nicht in ihren Zirkusspielen und Festzügen zur Schau stellten –, das ganze Mittelalter hindurch bis in die Neuzeit hinein spukt es als »Einhorn« in Fabeln und Wunderberichten. Funde des elfenbeinähnlichen Stoßzahnes vom Narwal ( Monodon monoceros), als kostbare Wunderarznei hochgeschätzt und noch im Jahre 1559 von den Venezianern mit 30 000 Zechinen bewertet, wurden mit ihm in Beziehung gebracht; denn auch das Horn des Rhinozeros galt von jeher für heilkräftig und giftzerstörend, und Inder, Chinesen, Malaien und Türken fertigen noch heute Becher daraus, denen Zauberkraft innewohnen soll: jedes vergiftete Getränk schäume augenblicklich darin auf. Marco Polo, der berühmte venezianische Weltreisende des 13. Jahrhunderts, sah das Nashorn auf Sumatra, hörte von ihm und schilderte es danach: »In diesem Lande gibt es viele wilde Elefanten und Nashörner, die weit kleiner sind als die Elefanten, aber ihre Füße sind sich ähnlich. Ihre Haut gleicht der eines Büffels. Vorn am Kopf haben sie ein einziges Horn, aber mit dieser Waffe stoßen und verletzen sie die nicht, welche sie angreifen, sondern brauchen hierzu nur ihre Zunge, die mit langen, scharfen Stacheln bewaffnet ist, und ihre Knie oder Füße. Wenn sie auf einen Menschen feindlich losgehen, stoßen sie ihn mit den Füßen nieder und trampeln auf ihm und zerreißen ihn mit der Zunge. Ihr Kopf ist gleich dem eines wilden Ebers, und sie tragen ihn tief am Boden. Sie wühlen mit Ergötzen in Sumpf und Schlamm und sind schmutzig in ihren Gewohnheiten. Doch lassen sich diese Tiere nicht durch Jungfrauen fangen, wie man bei uns wähnt, sondern sind im Gegenteil sehr wild und scheu.« Durch Jungfrauen sich fangen lassen … das sollte nämlich eine der Absonderlichkeiten des Einhorns sein. Der alte Gesner hat uns diese Jagdmethode in seinem famosen »Tierbuch« nach Angabe des Johannes Tzetze ausführlich beschrieben. Ein junger, starker Jäger wird in köstliche Frauenkleider gesteckt, »mit edlem geschmücktem Geruch besprengt, berieben und begossen« und muß sich dann in die Nähe der Wohnung des Untiers begeben. Das Einhorn wittert den Duft, sieht die schönen Frauenkleider und legt sich sittsam mit dem Kopf dem jungen Gesellen in den Schoß. Bald schläft es, vom Wohlgeruch betäubt, ein, und nun mögen die Jagdgenossen herbeieilen und es des Horns berauben. Dieses Einhorn sah nach Gesners Mitteilung Herr Ludwig Roman in Arabien mit eigenen Augen, und zwar »zu Mekka, da der Mahomet ein Begräbnis und Wallfahrt hat«. Die Gläubigen hielten hier zwei solcher Tiere gefangen; das ältere war in der Größe eines anderthalbjährigen Füllens und trug auf der Blesse ein »einig Horn, das fünfthalb Schuh lang« war. Im übrigen war es rauhhaarig wie ein Reh, hatte vorn gespaltene Klauen wie eine Ziege, einen Kopf wie ein Hirsch und eine dünne, auf einer Seite herabhängende Mähne. Es ist, wie Gesner schildert, ein »ganz freches, wildes, unzahmes Tier« mit einer »grausam erschrecklichen Stimme«. Demgemäß prangt es in Gesners Tierbuch in seiner »eigentlichen Kontrafaktur und Abmalung, wie es im Titel heißt – merkwürdigerweise neben dem wirklichen Nashorn, dessen Bild kein Geringerer als Albrecht Dürer nach einer ihm aus Lissabon im Jahre 1513 zugegangenen Skizze gezeichnet hat. In jenem Jahre hatte nämlich der König von Portugal ein lebendes indisches Nashorn zum Geschenk erhalten. Rund zweihundert Jahre später kam wiederum ein Nashorn nach Europa, und zwar nach England, und als um 1750 das erste Rhinozeros in Paris gezeigt wurde, erregte es dort solches Aufsehen, daß es in einer Dichtung von zehn Gesängen gefeiert wurde und einer – Mode den Namen gab.
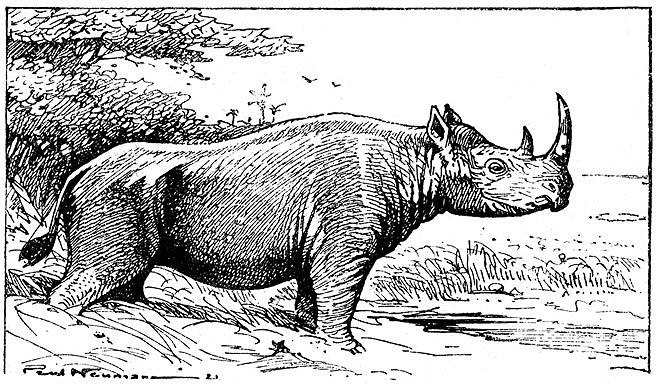
Afrikanisches Nashorn
Uns ist das Nashorn, dessen bekannteste Arten das einhörnige indische ( Rhinocros unicornis) und das zweihörnige afrikanische ( Rhionceros bicornis) sind, längst im Anblick und Wesen vertraut, so vertraut, daß sein wissenschaftlicher Name sogar ein – Kasernenhofschimpfwort geworden ist, das gar nichts von dem fabelhaften Einhorn mehr an sich hat. Über drei Meter lang, anderthalb Meter hoch, bis zu vierzig Zentner schwer, in allen Verhältnissen massig und plump, erscheint es als die Verkörperung brutalen Stumpfsinns. Der langgestreckte, seitlich zusammengedrückte Kopf sitzt auf kurzem, breitem Halse und schaut wie aus faltiger Mönchskutte daraus hervor. Die platte Stirn fällt steil ab, der Gesichtsteil wirkt wie heraus- und in die Länge gezogen, ist durch eine tiefe Einsattelung von jener getrennt und am Ende gleichsam in die Höhe gedrückt. Hoch oben am Kopfe ragen krustige, tütenförmig gedrehte Ohren, die sehr beweglich sind und so auf die Regsamkeit des Gehörsinns deuten; in der Mitte folgen, von Runzelfalten umrahmt, die ausfallend kleinen, stumpfen Schweinsaugen; ganz vorn sitzen, fast wagerecht gestellt, die länglich eirunden Nüstern, quer vor sich die faltig bewegliche, überhängende Oberlippe, die in der Mitte zu einem fingerartig geschickten Fortsatze ausgezogen ist. Hinter den Nüstern erhebt sich, in der Form eines kräftigen Rosendorns etwa, rundlich-kantig zusammengedrückt, die Spitze nach hinten zurückgekrümmt, das Horn, das dem monströsen Tiere den Namen gab. Es wird halbmeterhoch; bei dem zweihörnigen afrikanischen Rhinozeros wird das erste Horn noch länger, bis ein Meter, das dahinter stehende zweite aber bleibt an Größe und Stärke meist beträchtlich zurück. Diese Hörner, nach Beobachtungen im Berliner Zoologischen Garten vom indischen Nashorn übrigens alle fünf bis sechs Jahre abgeworfen, sind Wucherungen der derben Oberhaut, gewissermaßen – man verzeihe die etwas komische, aber doch zutreffende Vergleichung – »Leichdörner« oder »Hühneraugen«; sie finden sich als kräftige Dornen bei älteren Tieren auch auf andern Stellen der Haut – so schon von Dürer gezeichnet – und sind offenbar auf starke, dauernde, äußere Reize zurückzuführen. Ganz in diesem Sinne erklärt sich auch ein so guter Beobachter wie Heinrich Fonck ihre Entstehung. Das (afrikanische) Nashorn, schildert er, verbringt einen großen Teil seines Daseins im dichtverschlungenen Urbusch menschenleerer Steppen- und Bergländer. Der Eigenart dieser Heimat ist das Tier angepaßt. Von verhältnismäßig niedrigem Bau, streift es mit gewöhnlich tief hängendem Kopf durch die weglose Wildnis, hier allmählich seine »Wechsel« (d. h. regelmäßigen Weg) tretend und brechend. Nahe der Erdbodenbewachsung entstehen so die größten Lücken, die sich schon in geringer Höhe darüber durch die sich nach allen Seiten ausbreitenden Äste und Auswüchse schließen. Durch das Durchschieben des Kopfes und das hierbei bewirkte Hochheben und Anschlagen des Gestrüpps bei der Vorwärtsbewegung wiederholte sich dauernd ein Reiz, der zuerst eine hornartige Verdickung hervorgerufen haben mag, die im Laufe der Zeit zum starken Horn wurde, und über dieses Horn können nun mit Leichtigkeit schwere Äste, Büsche und andere Hindernisse des Urwalds nach oben bis zur Rückenhöhe hinübergestreift werden. So findet der plumpe Körper leicht, ohne Verletzungen zu erleiden und ohne mit Hilfe seines Gewichts durchbrechen zu brauchen, eine sich sofort wieder hinter ihm schließende Passage. Ein in schnellerer Gangart fliehendes Nashorn bricht freilich auch mit ungestümer Gewalt durch das krachende und berstende Gehölz, wobei es sich dann aber nicht selten tiefe, schwer heilende, bald von Insektenlarven wimmelnde Hautwunden reißt … Bei allen früher als »Dickhäuter« (Elefant, Flußpferd, Nashorn) bezeichnten Tieren ist die Haut ja in den Falten zart und außerordentlich empfindlich. Die Haut des indischen Nashorns erscheint durch die regelmäßig angeordneten Falten gerieft und wie ein in mehreren Schilden verschiebbarer Plattenpanzer, nach Art etwa der altjapanischen Rüstungen, die des afrikanischen dagegen ist nur gerunzelt und durch Quetschfalten gegliedert, sonst jedoch glatt oder warzig. Die Behaarung beschränkt sich auf eine kurzborstige Schwanzquaste und einen bürstenartigen Saum am Ohre. Junge Tiere zeigen wie beim Elefanten stärkere Behaarung, und das mit riesigem Vorderhorn (1,30 Meter) auf dem verhältnismäßig kurzen (0,75 Meter) Kopfe ausgerüstete sibirische oder wollhaarige Nashorn ( Rhinoceros tichorhînus) der Eiszeit Europas und Asiens besaß vollends wie das Mammut ein dichtes, rotbraunes Wollhaarkleid. Die Färbung der Haut ist ein schmutziges Schiefergrau bis Rotbraun, bei jungen Tieren bedeutend heller: eine in gewissen Gebieten des Kongostaates (Lado = Enklave) vorkommende, besonders breitmäulige Nashornart ( Rhinoceros sîmus) ist sogar als »weißes« Nashorn bezeichnet worden. Sehr zu Unrecht; denn es ist ebenso dunkel wie die gewöhnliche, spitzmäuligere Art – wahrscheinlich hatte sich, wie Berger vermutet, der das heute recht seltene Nashorn jüngst beobachten konnte, das erste seinerzeit erlegte Stück vorher in Asche oder Ton gewälzt. Die Beine sind verhältnismäßig weniger plump, als man bei dem wuchtigen Koloß erwarten könnte; sie sind wie beim »echten« Dackel leicht nach innen gekrümmt, als habe das Nashorn in der Jugend die »englische Krankheit« gehabt. Das polsterartig verdickte Sohleneirund trägt drei glänzende, nicht unschöne Hufe, deren mittelster der weitaus breiteste ist. Sehr eigenartig ist das Gebiß gestaltet. Dem Nashorn fehlen die Eckzähne, den afrikanischen Arten im erwachsenen Zustande auch die Schneidezähne. Sieben Mahlzähne in jeder Kieferhälfte, aus einzelnen, gehöckerten Lamellen zusammengeschmolzen und bald abgeschliffen, besorgen die Arbeit des Zerschrotens der Nahrung.
Das Nashorn ist ein Tier der sumpfigen Ebene und der grasreichen, buschigen Steppe. Es findet sich aber ebensowohl auch im dichten Urwald, wie im Hochgebirge. Ja, dieser plumpe Bergsteiger bahnt sich, nach dem Berichte Junghuhns hier (in Java) Straßen, die schier wie Menschenwerk erscheinen. Es sind Kanäle, ausgehöhlte Rinnen, die in den kühnsten Linien, man könnte sie fast »futuristisch« nennen, die Zacken der Vulkane umkreisen und, überall gleich breit und tief, nur eben Raum für die durchdrängende Masse des Tiers gewähren. Ihre Seitenwände sind hohl und glatt, wie ausgeschliffen, auch da, wo sie aus festem Gestein bestehen, ein Beweis dafür, daß diese Wechsel ungezählte Jahre lang benutzt werden. Tagsüber ruht das Nashorn meist; sobald die Sonnenglut nachläßt, kühlt es sich in schlammigem Bade und zieht dann auf Weide aus. Gräser, Wurzeln, Blätterwerk und Zweige sind seine Nahrung, die es mit dem Lippenfinger geschickt abrupft und sich auf die weiche Zunge schiebt. Stumpfsinnige Pflanzenfresser, dumm und brutal, kann man die Nashörner charakterisieren, und dazu stimmt es durchaus, daß sie gelegentlich in blinde, maßlose Wut geraten und dann jedem Feind gefährlich werden können. Das erregte Nashorn vermag auch sehr gewandt zu laufen; Schillings bezeichnet es geradezu als »ein athletenhaft gewandtes, schnelles und gefährlich behendes Tier« und nennt die »Jagd auf das Nashorn, von einem Jäger allein und weidmännisch ausgeübt, eine der gefährlichsten heute möglichen. Ein Nashorn, das wirklich einen Menschen wittert und angreift, wird seinen Gegner unter allen Umständen erreichen und auf die Hörner spießen«. Nach demselben Gewährsmann wird das Nashorn häufig von Madenhackern begleitet. In vielen Fällen verläßt sich das ruhende Tier auf seine kleinen, treuen, staarähnlichen Kameraden; sie reinigen es nicht nur von Schmarotzern, sondern warnen es auch unfehlbar vor nahender Gefahr. Letzteres geschieht durch schrilles Gezwitscher und eiliges Auffliegen. Durch die Vögel so gewarnt, stehen die Nashörner entweder blitzschnell auf oder nehmen eine sitzende Stellung ein, um nun je nach den Umständen und den bisher gemachten Erfahrungen flüchtig zu werden, langsam fortzutrollen oder – in menschenleeren Gegenden – sich bald wiederum niederzutun.
Gejagt, beziehungsweise in Gruben gefangen wird das Nashorn von den Eingeborenen um des Fleisches, der Haut und nicht zuletzt des Hornes willen. Aus der Haut werden neben Stöcken, Peitschen, Riemen und Schilden neuerdings kleine Tischplatten gefertigt. Das Horn wird zu Stöcken, Stockgriffen und dergleichen verarbeitet, zu den erwähnten Bechern gedrechselt und von den Chinesen in pulverisiertem Zustande als Saucenwürze begehrt. Lebende Tiere werden von den zoologischen Gärten mit 20-25 000 Mark bezahlt. In Indien läßt man noch heute wie Elefanten so auch Nashörner als Sportbelustigung miteinander in der Arena kämpfen.