
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Elfenbeinketten, zierlich geschnitzte Medaillons und Anhänger aus Elfenbein, elfenbeinerne Stock- und Schirmkrücken sind wieder einmal »letzter Schrei der Mode«. Zu ihnen gesellen sich Kämme, Billardkugeln, Klaviertasten, Messerhefte, Papiermesser, Schachfiguren, ein Heer von mehr oder minder künstlerischen Nippfiguren und tausend andre Dinge des täglichen Gebrauchs und des Luxus, um immer rascher, mit jener Hast, die dem modernen Menschen eigen ist, das Tier auszurotten, dessen Stoßzähnen dieses kostbare Material entstammt: den Elefanten. Freilich ist die Freude an dem warmen Glanz und der Festigkeit des Elfenbeins schon uralt. Bereits der Mensch der Urzeit schnitzte sich aus den Zähnen des Elefanten jener Eiszeittage allerlei Gerät und Schmuck, Menschen- und Tierfiguren, ritzte mit scharfem Feuersteinmesser in Mammut-Elfenbein, was sein Auge fesselte, und hat uns so verläßliche Kunde vom Leben und Treiben der Menschheit vor 100 000 Jahren gegeben. Im Ägypten der Pharaonen schnitzte man aus Elfenbein unter anderm die Steine für das Brettspiel, und nach dem Stapelplatz für das von den Negern als Tribut gelieferte Elfenbein hieß eine ganze Stadt und Insel bei den Alten Elephantine. Die hochberühmte, riesengroße, von Phidias geschaffene Statue der Athene auf der Akropolis hatte Gesicht, Hals, Arme, Hände und Füße aus Elfenbein, das sich von dem Gold der Gewandung aufs herrlichste abhob, die Schreibtafeln der reichen Griechen und Römer waren aus Elfenbein, und in den Katakomben des alten Rom hat man selbst elfenbeinerne Gelenkpuppen als Kinderspielzeug gefunden. Das Mittelalter fertigte aus »Helfantbein« allerlei kirchliches Gerät, wie Reliquienschreine, Kruzifixe und Gebetbuchdeckel; denn der Elefant galt als ein besonders frommes und » chiusche fico«, keusches Tier, wie es in Otfrieds »Evangelienbuch« heißt. Zu dieser Vorstellung hatte ein Bericht des Königs Juba von Mauretanien bei den römischen Schriftstellern geführt, wonach die Elefanten bei Sonnenaufgang die Rüssel in die Höhe recken und »so die Sonne anbeten«. Die Tatsache des Rüsselerhebens ist verbürgt, die Deutung der Alten aber selbstverständlich verkehrt. Die Elefanten, hat Th. Zell den Vorgang jüngst richtig erklärt, empfinden die Luftveränderung bei Sonnenaufgang, das Emporsteigen der erwärmten Luft, und als ausgesprochene »Nasentiere« suchen sie sich deshalb zu vergewissern, ob ihnen daher irgendwelche Gefahr drohe. Aber nicht nur der Europäer ist von jeher ein Liebhaber des Elfenbeins gewesen – auch die Negervölker schnitzen seit langem allerlei Gerät aus Elfenbein, fertigen aus den Zähnen ihre Kriegstrompeten, verzieren diese mit erstaunlichen Skulpturen und errichteten, das ist erst etwa fünfzig Jahre her, ganze Dorfumzäunungen aus Elefantenzähnen, wie die arabischen Elfenbeinhändler noch solche im heutigen Kongostaat antrafen, die Araber, die in ihrer Gier nach dem kostbaren Elfenbein Brand und Mord in die friedlichen Eingeborenendörfer trugen. Von alters her fertigt man in Indien allerlei Gerät und Schmuck aus Elfenbein, schnitzt man in Ostasien Figuren daraus, so namentlich jene grotesken japanischen »Netsukes«, die als Knöpfe oder richtiger Nesteln dienen. Man hat verschiedentlich zu berechnen versucht, wieviel Elefanten jährlich des Elfenbeinverbrauchs wegen ihr Leben lassen müssen; sichere Zahlen sind hierüber jedoch schwer zu erlangen – allein in Afrika werden schätzungsweise jährlich 55 000 Elefanten getötet! Und bei diesen Ermittlungen zeigte es sich zugleich, daß das Gewicht der Zähne auffällig abnimmt, daß also die ausgewachsenen, stark bewehrten Elefanten immer schneller ausgerottet werden. Zum Glück hat die Industrie mannigfachen Elfenbeinersatz allmählich ermittelt: Knochen in erster Linie, der schon seit Jahrhunderten das Elfenbein vertritt, von diesem freilich durch das Fehlen einer gleichmäßig parallelen Bänderung oder Streifung und durch die Anwesenheit feinster Tüpfel (Knochenkanälchen) unschwer zu unterscheiden ist; die Zähne des Flußpferds; die Nüsse und die Blattstiele der südamerikanischen Corossospalme; Gemische aus Gips, Tonerde, Kalk und dergleichen und endlich das Zelluloid, das die Bänderung des Elfenbeins täuschend nachzuahmen vermag, aber ohne weiteres an dem ihm eigentümlichen Kampfergeruch zu erkennen ist. Auch das »fossile« (lateinisch, d. h. aus der Erde gegrabene) Elfenbein ist hier zu nennen, die Stoßzähne des eiszeitlichen Mammuts, von denen merkwürdigerweise noch immer verhältnismäßig viele aus dem Boden Asiens (Sibirien) und Europas zutage kommen. Diese Zähne wurden bis zu vier Meter lang und erreichten im Mittel ein Gewicht von mehr als zwei Zentner, wie ja denn auch das Mammut an Rückenhöhe die größten heut lebenden Elefanten um reichlich ein Meter überragte. Und doch war das riesige Mammut, dessen Backenzähne und Schenkelknochen man noch vor nicht allzu langer Zeit in Spanien für die Gebeine des heiligen Christoph und Vinzenz ausgab, noch schwach in Vergleichung mit dem ihm zeitlich voraufgehenden, sogenannten Altelefanten ( ??lephas antîguus), dessen Rückenhöhe fünf Meter betrug und dessen Stoßzähne, mehr als ¼ Meter dick, die des Mammuts um gut ein Meter an Länge übertrafen: hielten doch einmal Arbeiter ein Stück eines bei Rom ergrabenen Stoßzahns dieses Elefanten für einen versteinerten Baumstamm!
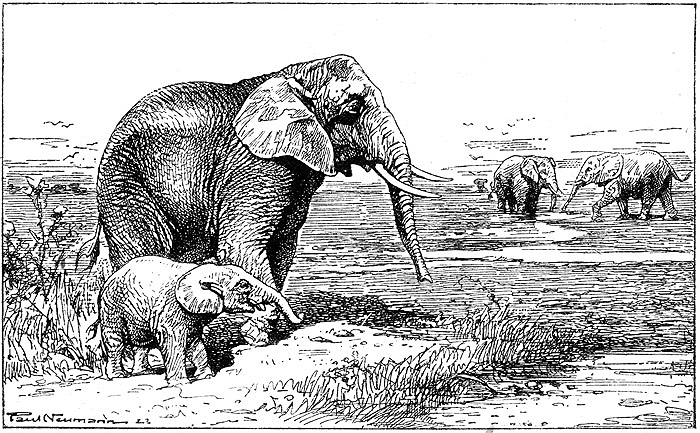
Afrikanische Elefanten
An diesen ausgestorbenen Elefantenarten gemessen, erscheint der doch selbst wie ein überlebender Urweltler in unsre Tage hineinragende Elefant Asiens und Afrikas vergleichsweise klein. Der asiatische Elefant wird höchstens 3½ Meter hoch, der afrikanische vielleicht ein wenig höher – der phantasievolle Fürst Pückler, dessen Reiseschilderungen einst viel bewundert wurden, erzählt sogar von einem 1837 zu Ouad-Medina erlegten Elefanten, es habe in dessen ausgeweidetem Leibe ein Mann zu Pferde ungebückt Platz gefunden. Der Elefant von Sumatra, Borneo und Ceylon bleibt an Größe hinter dem des Festlandes zurück – was übrigens stets bei Inselrassen der Fall ist –, und aus dem Kongo-Urwald ist jüngst vollends eine Zwergelefantenrasse bekannt geworden. Aber nicht nur hinsichtlich der Größe, auch in einigen wesentlicheren Punkten des Körperbaus sind der asiatische oder indische und der afrikanische Elefant voneinander verschieden. Am stärksten springt der Größen- und Formenunterschied der Ohren ins Auge. Der indische Elefant ( Elephas asiâticus) hat verhältnismäßig kleine, »verschoben viereckige«, lappig bewegliche Ohren, sein afrikanischer Vetter ( Elephas africânus) dagegen riesige, fünfeckige, »pappdeckelartig steife« Ohren, die bis weit auf die Schulter reichen und im Nacken sich berühren. Der Scheitel des Inders ist schön gewölbt und zweifach gebuckelt, der des Afrikaners aber flach; ersterer weist an den Vorderfüßen fünf, an den Hinterfüßen vier Hufe, letzterer deren nur vier beziehungsweise drei auf. Die Weibchen der indischen Art haben meist keine Stoßzähne, die der afrikanischen ziemlich starke, wenn auch schwächere als die Männchen. Endlich zeigen die Backenzähne des asiatischen Elefanten eine bandförmig geschlängelte Kaufläche, die des afrikanischen dagegen rautenförmige Anordnung dieser. Noch ein paar Worte über die Zähne zu sagen: der Elefant hat nur Stoßzähne, die den Schneidezähnen des Ober(Zwischen)kiefers entsprechen, und Backenzähne. Die Stoßzähne sind unbewurzelt und wachsen deshalb (wie die meißelförmigen Schneidezähne der Nagetiere, z. B. des Eichhörnchens, der Ratte) das ganze Leben hindurch gemäß der Abnützung nach. Sie erreichen eine Länge von etwa zwei Meter und ein Gewicht von fünfzig Kilogramm. Der längste bisher bekannt gewordene maß freilich über drei Meter, der schwerste wog über vier Zentner! Die Backenzähne bestehen aus zahlreichen, quergestellten, miteinander verbundenen Platten und sind immer nur in jeder Kieferhälfte je einer tätig: ist der arbeitende Zahn abgenutzt, so wird er durch den dahinter stehenden unverbrauchten ersetzt, nach vom geschoben und endlich herausgedrängt.
Der charakteristischste Besitz des Elefanten ist zweifellos der Rüssel: Nase und Hand zugleich, » nasûta mânus«, wie der ostgotische Gelehrte und Staatsmann Cassiodor ihn treffend bezeichnete. Merkwürdigerweise nennen auch die Masai in Ostafrika den Elefanten das »Handtier« ( engaina). Der Rüssel ist nicht nur ein äußerst empfindliches Geruchsorgan, er ist zugleich auch Tast- und Greifwerkzeug. Mehr als 40 000 Muskelbündel von erstaunlicher Beweglichkeit und Dehnbarkeit bilden nach Cuviers Zählung diese seltsame Nase, deren Scheidewand den Rüssel in seiner ganzen Länge durchsetzt, und die mit einem fingerartig geschickten Fortsatz endet. »Gleich einer Schlange«, schildert der viel zu schnell vergessene Hermann Masius, »windet sich der Rüffel um den jungen Palmenstamm und reißt ihn aus der Erde; er hebt mit dem kleinen Fingeranhängsel seiner Spitze das Blatt vom Boden; er schürzt und löst Knoten; ja, er faßt, wie die Alten erzählen, den Griffel und schreibt, aber er packt auch den Tiger und wirft ihn würgend unter die Füße. Mit dem Rüssel saugt der Elefant wie mit einem Trinkhorn Wasser und schüttet es sich in den Rachen (er ist ein »zweimal Trinkender«, wie die Inder sagen); durch ihn atmet er, durch ihn läßt er die schmetternde Stimme ertönen, wenn er sich selbst zum Kampfe auffordert. In dem für jedes Auge undurchdringlichen Gebüsch des Dschungels fühlt der Rüssel den Weg, und wo das Rauschen der Wasser warnend an den verborgenen Abgrund erinnert, belehrt das nie irrende, tastend zu Boden gesenkte Glied den Fuß über jeden Zollbreit, den er weiterschreitet.« Der Rüssel ist das eigentliche Lebensorgan des Elefanten. In der Natur herrscht ein strenges Sparsamkeitsgesetz: Nasentiere sind fast ganz auf den Geruchssinn gestellt, Augentiere beinahe ganz aufs Gesicht. Nur der Mensch macht hiervon eine bemerkenswerte Ausnahme; er hat seine Sinne alle gleichmäßig auszubilden getrachtet und sie dadurch sämtlich zur Mittelmäßigkeit abgestumpft. Das geschlitzte Auge des Elefanten ist demgemäß klein und nicht sonderlich gut. Das Gehör ist wohl scharf; aber die riesigen Ohrmuscheln des Afrikaners sollen, wie Zell sehr wahrscheinlich gemacht hat, weniger den Schall auffangen, als, durch ihr Fächeln die Luft bewegend, der Nase die Witterung des Feindes zuführen. Bis zu gewissem Grade stehen auch die Stoßzähne, Waffe und Werkzeug, im Dienste des Rüssels. Wie wir ein Stück Holz über dem Knie zerbrechen, vergleicht Schmeil sehr anschaulich, sind die Stoßzähne dem Elefanten der Widerstand, über den er Bäume und Äste knickt.
Ein »Durchbrecher des Urwalds« ist der Elefant; wie ein riesiger Keil treibt der massige, seitlich zusammengedrückte Körper des Tiers zähstes Pflanzengewirr auseinander. Die säulenförmigen Beine zerstampfen jedes Hindernis; mit den Füßen tötet der Riese auch den zu Boden geworfenen oder gestürmten Feind, und die grausamen indischen Marâthen ließen einst so durch den Elefanten als Henker das Haupt des Verbrechers zerschmettern. Aber diese scheinbar so plumpen Beine, dieses platte, glatte Eirund der Fußsohle sind doch andrerseits außerordentlich geschickt: der Zirkuselefant läuft auf Flaschen, ja, Plinius und Sueton berichten sogar, daß die römischen Zirkuselefanten auf dem Seil gelaufen seien und selbst die schwierigste Aufgabe des Seiltanzes, das Herabsteigen, ausgeführt hätten. So wird denn auch in der indischen Dichtung der Gang des jungen Elefanten dem Festschritt der Braut, sein Lauf vom Berg herab aber dem niederschmetternden Felsen verglichen. Der breitstirnige, hohe, massige, durch das Gewicht der Stoßzähne gleichsam niedergewuchtete Kopf sitzt auf nur kurzem Halse. Aber die Länge des Rüssels gleicht diese Kürze aus, und trotz der auffallend dicken Schädelknochen und des mächtigen Unterkiefers ist der Kopf doch nicht so schwer, wie er erscheint, weil die Stirnknochen riesige, lufthaltige Hohlräume aufweisen. Die beispiellose Wölbung der Stirnhälften verleiht dem Kopfe des indischen Elefanten den Ausdruck des Geistigen.
Der Elefant ist ein »Dickhäuter«; in den zahlreichen Falten ist diese brettstarke Laut jedoch papierdünn und äußerst empfindlich, und das Tier pflegt sich deshalb gegen die Angriffe der Insekten ständig mit Sand oder Wasser zu berieseln. Der junge Elefant hat ein dichtes, krauses, rotbraunes Haarkleid; die glasharten, spröden, brüchigen Haare werden aber bald abgescheuert, und beim erwachsenen Tier findet man nur noch spärliche Überreste davon, zumal längs des Rückens. Das eiszeitliche Mammut dagegen besaß, der Kälte völlig angepaßt, auch als ausgewachsenes Tier ein langes, dichtes, rotbraunes Wollhaarfell. Schmutzigbraun bis aschgrau gefärbt, am Bauche blaßrötliche Fleischtönung zeigend, scheint die Haut des Elefanten stark gerunzelt, gleichsam um den Körper zu schlottern, und an den Beinen, ganz besonders den Hinterbeinen sieht es so aus, als stäke das Tier in viel zu weiten Hosen. Der ewig pendelnde, drehrunde, wie ein Tau gerippte Schwanz hängt bis unter die Knie herab und trägt an dem zugespitzten Ende eine dünne, zweizeilige Haarquaste, die im Umriß an die Form einer Pfauenfeder erinnert. Diese bis zu vierzig Zentimeter langen Schwanzhaare sind bei vielen Negervölkern sehr gesuchtes Schmuckmaterial zu Arm- und Halsringen, und der alte Groeben erzählt uns in seiner »Guineischen Reisebeschreibung« vom Jahre 1694, daß mit rotem und gelbem Tuch benähte Elefantenschwänze an der Goldküste bei den Negern »in die zehen Dukaten« galten. Zumeist aber fehlt die Schwanzquaste, was daher rührt, daß die Tiere beim Marsch der Herde durch den Urwald, indem eines hinter dem andern trottet und dabei, wie Hagenbecks indischer Elefantenfänger Johannsen berichtet, mit dem Rüffel sich am Schwanz des Vorgängers hält, einander die Schwanzquaste sehr beschädigen, ja, Stücke des Schwanzes abreißen. – Das »Schwein mit dem Stoßzahn« nennt die eigenartige Zeichenschrift der Chinesen den Elefanten, und die Römer, die die riesigen Tiere zuerst im Heere des Königs Pyrrhus in Lukanien sahen, hießen sie gar »lukanische Ochsen«. Wieviel plastischer gibt nicht das Bild des Oppian und der Kirchenväter, die den fernen Anblick des Elefanten mit der aufsteigenden Gewitterwolke oder dem ragenden Bergrücken verglichen, den Eindruck dieser dunklen, formlosen Masse, dieser elementaren Stärke wieder!
Solch ein an siebzig Zentner und mehr wiegender Riese hat ein gewaltiges Nahrungsbedürfnis und kann daher nur Pflanzenfresser sein. Gräser, Laub und Körnerfrüchte bilden seine hauptsächliche Nahrung, und er nimmt davon täglich mehr als sechs Zentner zu sich, während er nach Beobachtungen im Berliner Zoologischen Garten 120 bis 200 Liter Wasser dazu säuft. Gelegentlich plündert er auch die Felder der Eingeborenen, und Heuglin erzählt vom afrikanischen Elefanten, daß er sich die riesigen Kürbisse von den Strohdächern der Neger hole, auch dann und wann eine Hütte abdecke und neugierig wie aus einem höheren Stockwerk hinab ins Innere schaue, ob sich nicht etwa Getreide darin finde. Wenn Futtermangel sie zum Verlassen ihrer Lieblingsplätze nötigt, dann gibt es für die Elefanten kein Bodenhindernis: sie durchschwimmen Ströme und Seen, arbeiten sich durch weite Sumpflandschaften, durch den dichtesten Urwald, an steilen, felsigen Höhen hinan, auf ebenem Boden förmliche Straßen stampfend. Bei solchen Wanderungen hält die Herde ziemlich geschlossen zusammen, ordnet sich aber gelegentlich, wie wir es oben schon schilderten, in langen Reihen, die dann nur schmale Wechsel machen. Meist leben die Elefanten familienweise in Rudeln von zehn bis zwanzig Stück; nicht selten ziehen aber auch Männchen und Weibchen, diese mit den Kälbern, getrennt für sich. Bei Wanderungen bilden gewöhnlich die Mütter mit den Jungen den Vortrab, die Männchen bummeln hinterher. Die Kälber, die bei der Geburt kaum ein Meter hoch sind und an dem brustständigen Euter der Kuh bei hochgehaltenem Rüssel mit den Lippen saugen, – mit dem Rüssel zu trinken, lernen sie erst später – schreiten unter dem Leibe der Mutter dahin, flüchten jedenfalls bei der geringsten Beunruhigung darunter. Kommt ein Kalb zur Welt, so verweilt (in Indien) die Herde zwei Tage lang bei der Mutter; verliert das Kalb die Mutter, so reicht ihm gewöhnlich eine andre Mutterkuh das Euter. Ganz allgemein spielen die alten Tiere mit den jungen. Von der Liebe der Elefantenmutter für ihr Junges hat uns Schweinfurth ein rührendes Beispiel berichtet. Die Niamniam in Zentralafrika pflegen Elefantentreibjagden anzustellen, indem sie die hohen Grassteppen in Brand setzen. »Kein Entweichen«, schildert der berühmte Afrikaforscher, »rettet dann das Wild; überall vermittels Feuerbränden zurückgetrieben, scharen sich schließlich die Alten um die Jungen, bedecken sie mit Gras, spritzen Wasser aus ihren Rüffeln über sie, solange es gehen will, um sie zu retten, bis sie, betäubt vom Rauch oder ohnmächtig von Hitze und Brandwunden, ihrem Schicksal erliegen, das ihnen der undankbare Mensch bereitet.« Alte Elefantenbullen scheinen bisweilen ein Einsiedlerleben zu führen und sollen dann gelegentlich sehr bösartig werden; die Engländer in Indien nennen solchen Einsiedler sehr bezeichnend »Rogue« (Schurke). Mit etwa sechzehn Jahren ist der weibliche, mit zwanzig Jahren der männliche Elefant ausgewachsen; wie schon Aristoteles, der große griechische Naturforscher, wußte, erreicht der Elefant ein Alter von höchstens 200 Jahren. So nimmt auch Schillings an, der als guter Kenner gelten darf. Einen Arbeitselefanten auf Ceylon hat man 140 Jahre lang seinen Dienst verrichten sehen; dieser Elefant war 1656 bei der Vertreibung der Portugiesen in einem Stalle, schon völlig erwachsen, von den holländischen Eroberern angetroffen worden und überdauerte die Zeit des holländischen Besitzes von Ceylon.
Über die geistigen Fähigkeiten des Elefanten gehen die Anschauungen ziemlich weit auseinander. Ein so genauer Kenner des indischen Elefanten wie der Engländer Sanderson nennt ihn ein »in vielen Beziehungen dummes Tier«. Dem widersprechen aber zahlreiche Beobachtungen andrer Forscher. Der sumatranische Elefant weiß, wie Otto berichtet, in erstaunlicher Weise die kunstvollsten Fallgruben zu vermeiden. Gerät der afrikanische dennoch in eine solche, so helfen ihm, wie Heuglin, Wissmann, Berger u. a. angeben, die Kameraden durch Einstampfen der Ränder, oder indem sie mit den Stoßzähnen die Erde um die Grube aufwühlen, wieder heraus. Für eine hohe Intelligenz spricht es ferner, daß die Elefanten sich mit den Vorderfüßen und dem Rüssel im flachen Flußbett Trichter graben und bohren, eine Art von Grundwasserbrunnen, die sie häufig, wie die Beobachtungen von Knochenhauer und Berger lehren, nachdem der Durst gestillt, wieder verschließen. Sie tun dies offenbar, um nicht mit dem Flußwasser Blutegel, Wasserkäfer, kleine Fische und dergleichen in die empfindliche Nase zu bekommen. Man vergegenwärtige sich einmal, hebt Zell mit Recht hervor, den Gedankengang des Elefanten: um seinen Rüssel vor Feinden zu bewahren, gräbt er sich einen eigenen Brunnen, und damit sich in dem Wasser nicht etwa Blutegel ansiedeln, scharrt er ihn wieder zu!
Für die hohe Intelligenz des Elefanten spricht vor allem auch die Leichtigkeit, mit der er sich zu den verschiedensten Arbeiten abrichten läßt. Wer hat nicht schon die eigenartigsten Dressurkunststücke des Elefanten gesehen? Radfahrende Elefanten, musizierende Elefanten, Elefanten, die auf Fässern und Kugeln laufen, die Treppen erklettern, auf Brettern herabrutschen usw. Von einem besonders gelehrigen Elefanten berichtet Hagenbeck: »noch nicht vier Wochen waren vergangen, da marschierte Bosco auf Flaschen, konnte auf den Hinterbeinen und auf den Vorderbeinen stehen, setzte sich an einen gedeckten Tisch, zog die Glocke und ließ sich von einem Affen bedienen, trank aus der Flasche, nahm Speisen von einem Teller, kurz, war er ein vollendeter Künstler geworden.« Nach sechswöchiger Dressur wurde das Tier nach Amerika verkauft; zwei Jahre später sah es Hagenbeck wieder. »Schon an der Tür des Stalles«, erzählt er weiter, »rief ich ein lautes ›Hallo, Bosco!‹, und aus der Ferne ertönte als Antwort ein freudiges Geschrei. Als ich näher kam, gab der Elefant jene zufriedenen, gurgelnden Töne von sich, wie man sie von diesen Tieren hört, wenn sie freudig erregt sind, und als er mich erreichen konnte, packte er mich am Arm, zog mich ganz dicht an sich heran und beleckte mir, fortwährend gurgelnd, das ganze Gesicht. Geradezu rührend war es, die Freude des Tiers zu beobachten, als es seinem alten Herrn nach zweijähriger Abwesenheit wieder gegenüberstand. Wenn man aber bedenkt, daß Bosco nur sechs Wochen in meinem Besitze war, allerdings im intimsten Verkehr mit mir, so bildet diese Wiedersehensszene ein vollkräftiges Zeugnis von dem ungeheuren Gedächtnis des Elefanten.« In Indien ist der Elefant seit undenklicher Zeit Reit-, Zug- und Lasttier. Den mit eisernem Stachel bewehrten Lenker (Mahaut, Kornak) auf dem Nacken tragend, gehorcht das Tier jedem Zuruf, jedem leisen Lenken und Stoßen der Zehen hinter die Ohrmuschel; nur selten braucht der Stachel in Tätigkeit zu treten. Als Reittier zur Jagd auf Raubwild, bei feierlichen Aufzügen usw., die einer umgitterten Plattform oder einem baldachinartig überdeckten Thronsitze gleichende »Haudah« (Sattel) tragend, weiß es sich der jedesmaligen besonderen Aufgabe aufs klügste anzupassen. Den Staatselefanten der indischen Fürsten werden kostbar gestickte, edelsteingeschmückte Decken übergehängt, die Haudah ist aus Silber, und Kopf, Rüssel und Stoßzähne des Tiers werden bemalt oder vergoldet. Einen geduldigeren, willigeren oder geschickteren Arbeiter als den indischen Lastelefanten gibt es kaum, und die Gelehrigkeit paart sich aufs glücklichste mit außergewöhnlicher Kraft. Er trägt gegen fünfzig Zentner, zieht eine Last von rund achtzig Zentner und vermag eine solche von über dreißig Zentner vorwärts zu schieben, indem er mit dem Rüsselansatz dagegen drückt. Während des Weltkrieges haben Hagenbecks Elefanten solche Arbeit ja auch auf dem Kriegsschauplatz und in den größeren deutschen Städten (z. B. Berlin) geleistet. Es ist erstaunlich, schildert ein neuerer Beobachter, wie die Tiere die schweren Bauholzstämme zu zweien mit dem Rüffel aufnehmen, wieder hinlegen und nochmals aufnehmen, bis die Last zwischen ihnen gleichmäßig verteilt ist; wie sie die Stämme transportieren und dann an Ort und Stelle ordnungsmäßig aufschichten, so daß ein Stamm genau wie der andre liegt. Den Arbeitselefanten kürzt man übrigens gewöhnlich die Stoßzähne, damit sie bei der Arbeit nicht hinderlich sind. Um den Mahaut aufsteigen zu lassen, hebt der Elefant aus Zuruf eines der Vorderbeine, indem er gleichzeitig die Hinterbeine ein wenig in Kniebeuge senkt; die Haudah erreicht man mit Hilfe einer Leiter: der Elefant kniet dabei nieder und richtet sich, wenn alles Platz genommen, mit größter Vorsicht wieder auf.
Im alten Indien und überhaupt im Altertum war der Elefant vornehmlich Kriegstier. Die ersten, gleichsam historischen Elefanten werden in den Schlachten des Perserkönigs Darius und Alexanders des Großen genannt; von seinen Zügen brachte Alexander gegen dreihundert der Tiere heim. Die letzten dieser indischen Kriegselefanten Alexanders dürften die von Pyrrhus in seinem Kampf gegen die Römer verwendeten zwanzig Tiere, die schon erwähnten »lukanischen Ochsen«, gewesen sein. Mit afrikanischen Elefanten erschienen dann später die Karthager in Spanien und Italien, und Hannibals Kriegselefanten überwanden bekanntlich sogar die Alpenpässe. Nach der Eroberung Galliens schritt Cäsar als Triumphator bei Fackelschein aufs Kapitol: vierzig Elefanten zu seiner Rechten und Linken trugen die Feuerbrände. Diese Sitte haben die römischen Kaiser beibehalten; in ihren Triumphzügen gingen vielfach Elefanten einher, und bei den Zirkusspielen mußten häufig Elefanten miteinander und mit Raubtieren kämpfen. Auch im heutigen Indien noch finden gelegentlich bei feierlichen Anlässen, wie der Thronbesteigung eines Fürsten, seiner Hochzeit und dergleichen, Elefantenkämpfe in der Arena statt. Die indischen Herrscher besaßen ehedem Kriegselefantenherden von 6000 Stück; oft genug bestimmte deren Zahl den Sieg.
Unter den vielen Jagdarten auf den Elefanten ist die der nubischen Schwertjäger oder »Agaghir« wohl die eigentümlichste. Hagenbeck berichtet darüber nach den Schilderungen von Menges etwa folgendes: Zur Jagd auf Elefanten ziehen nur die geübtesten Jäger aus, und zwar in kleinen Trupps von vier bis sechs Leuten, die vorzüglich beritten sind. Die Suche nach Elefanten beginnt damit, daß man die Wasserläufe und Tränkplätze, wohin das Wild des Nachts zur Tränke geht, genau untersucht. Finden sich die Spuren von Elefanten, dann wird die nicht zu verkennende Fährte sofort aufgenommen, und eine lange, oft sehr ermüdende Suche beginnt. Der afrikanische Elefant ist sehr beweglich und ein gewaltiger Wanderer, und oft vergehen viele Stunden, bis die Jäger Fühlung mit der Herde gewinnen. Der Angriff geschieht nun derart, daß die Jäger die Herde anreiten und den mit den besten Zähnen bewaffneten Bullen von seinen Gefährten zu trennen suchen. Durch vielhundertjährige Verfolgung gewitzigt, ist der Elefant nicht nur vorsichtig, sondern auch furchtsam geworden und flieht, wenn sich nur ein Ausweg findet. Wird er jedoch gestellt, so verwandelt er sich in den entschlossensten Gegner, der sofort zum Angriff übergeht. Unter wütendem Trompeten – das eigentlich ein »Schnauben« der Nase ist – stürzt er sich auf die Jäger und die vor Angst ganz unbändig gewordenen Pferde, die nun ihrerseits fliehen. Solch ein Angriff, schildert Schillings einmal, ist von unbeschreiblicher Furchtbarkeit, er erfolgt plötzlich, unerwartet. Die gewaltige Gestalt des erzürnten Riesen, die seine Erscheinung ins furchtbar Groteske verzerrende, eigenartige Stellung der Ohren, die den gigantischen Kopf plötzlich noch unendlich größer und gewaltiger erscheinen läßt, die unheimliche Schnelligkeit, mit der sich der Angriff vollzieht, das schrille Trompeten des Giganten – das alles wirkt in einer Weise auf den vom Jäger plötzlich zum Gejagten verwandelten Menschen ein, die er zeitlebens nicht vergessen kann. Mit Vorliebe greift der Elefant hellfarbige Pferde an, Schimmel, die ihm bei seinem nicht sonderlich guten Gesicht zuerst auffallen. Einer der Jäger reitet demgemäß einen Schimmel, und die Aufgabe dieses Reiters ist es, sich von dem Elefanten verfolgen zu lassen. Er muß es so einrichten, daß er dicht vor dem wütenden Tier bleibt und dessen ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, damit der Elefant nicht auf das achtet, was hinter ihm vorgeht. Die Kameraden des führenden Jägers jagen hinter dem Elefanten her, bis der erste ihm auf etwa zehn Schritt nahe gekommen ist. Jetzt springt er hurtig vom Pferde, eilt, das Schwert in der Hand, in langen Sätzen hinter dem Tiere drein. Ist er ihm nahe genug gekommen, so saust in dem Augenblicke, da der Elefant das linke Hinterbein auf den Boden setzt, die scharfe, mit beiden Händen geführte Klinge nieder und zerhaut die Achillessehne, so daß das Tier sofort gelähmt wird. Natürlich dreht der verwundete Bulle sich alsbald nach dem Angreifer um. Der hat sich aber bereits zur Flucht gewandt; und nun ist die Reihe an dem ersten Jäger, der von seinem Schimmel springt, sich dem halbgelähmten Tiere vorsichtig nähert und ihm mit wuchtigem Hiebe auch die Sehne des rechten Hinterbeins durchhaut. Das mächtige Tier ist jetzt völlig hilflos, die großen Schlagadern entlassen das Blut in wahren Strömen, und daran verendet der Elefant. Dann werden ihm die Stoßzähne ausgebrochen und die Haut in einzelnen Stücken abgezogen; sie wird zur Herstellung von Schilden, Schwertscheiden, Riemen und dergleichen sehr geschätzt. Auch das Fleisch wird vielfach von den Negern gegessen, gleich frisch gebraten oder indem man es in Streifen schneidet, an der Sonne röstet und als Dörrfleisch ausbewahrt. Als besondere Delikatesse gilt das Elefantenbein, das, wie Livingstone erzählt, in einem Erdloch gebraten, »ganz köstlich« schmeckt. Übrigens wurde während des Weltkriegs ein Elefant auch in Dresden geschlachtet und verzehrt. Solche Schwertjagd wird nicht selten auch von einem einzelnen beherzten Jäger unternommen, der sich geschickt anzuschleichen und zu verbergen verstehen muß. Das war schon im Altertum bekannt. Der Europäer tötet den Elefanten durch einen Schuß ins Gehirn oder aufs Blatt – die einzige Möglichkeit, den Riesen zur Strecke zu bringen. In Indien werden die wilden Elefanten mit Hilfe von zahmen in einen weiten, von mächtigen Balken umhegten Zaun (»Keddah«) getrieben, hier nach einigen Tagen des Hungerns gefesselt und so zur Zähmung gefangen. Die für solchen Fang besonders abgerichteten zahmen Elefanten (»Kunkies«) werfen, von ihren Reitern gelenkt, den Wildlingen die Schlinge um den Hals, die dann an einem Baum befestigt wird. Während die Kunkies den Gefangenen in Schach halten, befestigt der Kornak auch um die Füße des sich Sträubenden Taue und verankert diese Schlingen an den nächsten Bäumen. Vergebens kämpft der Gefesselte gegen seine Bande an, bis er ermüdet ist; nicht selten freilich gehen die Tiere dabei auch zugrunde, indem sie sich erwürgen oder sich durch das Einschneiden der Taue tiefe Fleischwunden beibringen.