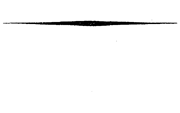|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Von nun an ließ er die Arbeit im Stich.
Nicht daß er gerade gefaulenzt hätte. Was man ein Leben lang nicht gekonnt hat, lernt man auch als Alternder nicht.
Und zu tun gab es immer genug. Bestellungen illustrierter Blätter, die er früher grundsätzlich zurückgewiesen hatte, traten jetzt, da er weniger bockbeinig schien, öfter und öfter an ihn heran. Nicht selten gab's auch einen Porträtauftrag, der infolge der sich bessernden Zeit und seines noch immer großen Namens reichlich bezahlt wurde und den Haushalt vor Kümmerlichkeit bewahrte.
Den Verwaltungsgeschäften des Künstlervereins, dessen Vorsitz nun schon seit zwei Jahrzehnten in seinen Händen lag, widmete er sich mit größerer Teilnahme denn je, und die weltumstürzenden Wichtigkeiten quollen in Masse aus den täglichen Briefeinläufen hervor.
Aber das alles bot keinen Ersatz für den verlorenen Reichtum einstiger Zeiten. Mühselig krochen die Stunden dahin, und jede war voll von nicht zu erstickendem Vorwurf. Ja, dieser Selbstvorwurf wurde recht eigentlich der Inhalt seines müde sich reckenden Lebens.
Und immer häufiger stellte die Forderung sich ein: ›Mach endlich ein Ende.‹
Was in jenem denkwürdigen Gespräch wenige Wochen vor dem Tode Brigittens als erste Ahnung in ihm aufgestiegen war, was jene Abschiedsnacht an ihrem Sarge zu krampfigem Entschluß gesteigert hatte, um freilich von der noch ungebrochenen Lebenskraft von neuem verdrängt zu werden: der Gedanke, ihr freiwillig folgen zu müssen, kroch aus den Nöten der allmählich verebbenden Energie als letztes Ergebnis zutage.
›Jawohl! Mach ein Ende!‹ Solange Brigitte lebte, hatte sich diese Welt noch immer ertragen lassen, – jetzt war sie gerade noch einen Schuß Pulver wert.
Auch Astrid hatte sich inzwischen ins Nichts verloren. Die Freundschaft, die sie sich beide als dünneren Nachguß des einstigen Rauschtranks zurechtgemacht hatten, war wenig genießbar gewesen. Lähmend lag das Bewußtsein des vernichteten Glückes auf jeder Zusammenkunft, und immer wieder geschah es, daß sie plötzlich zur Türe hinausging, um nach einer Weile mit frischgekühlten Augen wiederzukehren.
Schon zu Beginn des Frühlings verließ sie diesmal Berlin, um, bis sie ihr Landhaus beziehen konnte, in den Mittelmeerländern herumzureisen, und als er eines Tages halb zufällig an ihrer Wohnung vorüberkam, sah er Möbelwagen auf der Straße stehen, in die ein ihm sehr bekanntes Hausgerät verladen wurde.
Da wußte er genug. Und so fremd war sie ihm bereits geworden, daß kaum ein Bedauern noch in ihm hochstieg. Der kleine Stich, der ihn allzeit durchfuhr, wenn er ihrer gedachte, meldete sich ein wenig stärker als sonst.
In Worte übertragen: ›Auch die hast du auf dem Gewissen.‹
Aber das mußte verschmerzt und eingeebnet werden.
Die Lebende hatte sich mit ihr vertragen können, die Tote duldete keine Rivalin neben sich.
Und so bröckelte ein Stück des alten Lebens nach dem anderen von ihm ab.
Die Freunde waren schon längst aus seinem Gesichtskreis verschwunden, nur Reginald Naschke sprach noch hin und wieder geschäftlich bei ihm vor.
»Ick sag' schon jar nischt mehr,« erklärte er einmal. »Sie wollen es so, und so muß es denn auch richtig sein. Aber wenn Se'n Rat annehmen wollen: spielen Se nich mit sich. So wat rächt sich, und dann is es meistens zu spät.«
Isenberg schüttelte ihm bei gelegentlichem Begegnen gerade noch die Hand, und mit Maxel hatte er sich in aller Form überworfen.
Als dieser eines Tages dreist genug gewesen war, ihm wegen seiner übertriebenen Trauer Vorhaltungen zu machen, hatte er ihm kurzweg erwidert: »Du warst jahrelang beflissen, meine Ehe mit ihr auseinanderzureißen. Zum Dank dafür hat sie die deine zusammengeleimt. Es wäre Zeit, daß du sie in Ruhe ließest – und mich übrigens auch.«
Nach solchen Worten war der Bruch unvermeidlich geworden, und Steffen hatte nichts als ein Achselzucken dafür gehabt.
Weg mit ihm und weg mit allem, woran das Herz einstmals gehangen hatte!
Schließlich legte er in jähem Wechsel der Stimmung auch den Vorsitz des Künstlervereins nieder, wie tief sein Leben auch darin verwurzelt war.
Darob in Kollegenkreisen große Bestürzung, denn seiner erfahrenen Führung zu vertrauen, machte eigene Arbeit unnötig.
Beauftragte fanden sich ein, um ihn zur Zurücknahme des Entschlusses zu bewegen, doch lächelnd ließ er die verschiedenen Beredsamkeiten an sich herniederrinnen.
Und als alles nichts half, kam man überein, mit einer möglichst glanzvollen Ehrung von ihm Abschied zu nehmen.
Eine Ausstellung seines Lebenswerkes sollte es sein, wie sie sonst nur schon Gestorbenen oder höchstens Jubiläumsgreisen zuteil wird.
Die Nationalgalerie hatte sich im Hinblick auf seine Lebendigkeit ablehnend verhalten, und an die Akademie war man gar nicht erst herangetreten. Aber im Glaspalast am Lehrter Bahnhof gab es Platz in Hülle und Fülle. Dort hatten die Bonzen von der staatlichen Kunstpolizei nichts dreinzureden, und was auf der anderen Seite an offenem oder verkapptem Neid sich allenfalls vorfand, konnte durch den Hinweis auf Steffens Verdienste um den Verein rasch mattgesetzt werden.
Etliche Tage vor Weihnachtsabend war es, als die drei Würdenträger des Vorstands in seinem Hause erschienen, in der Absicht, ihm von dem Beschlusse Mitteilung zu machen und ihn gleichzeitig um seine Teilnahme an den Vorbereitungen zu ersuchen, da nur durch ihn selbst der Verbleib all seiner Bilder zu ermitteln war.
Er, ohne Ahnung von dem, was sie wollten, war wütend über die Störung und bat sie nicht einmal ins Atelier herauf, wie sich's unter Kollegen gehört, sondern empfing sie unten in Brigittens verlassenem Reich.
Als der Sprecher seine Ankündigung hergesagt hatte, die als eine Art von Weihnachtsgabe gedacht war, zuckte vorerst ein Wohlgefühl in ihm auf, das fast animalisch geartet war, rasch aber schlug es in Hohn und Bitterkeit um.
›Was soll mir das noch?‹ rief es in ihm. ›Jetzt, da alle Kraft, mich zu freuen, zum Teufel gegangen ist? Da meine ganze Lebensarbeit als Dreckhaufe hinter mir liegt?‹ Und erst als er sich dessen erinnerte, mit welcher Inbrunst Brigitte ein solches Geschehnis herbeigewünscht hatte, machte er innerlich seinen Frieden damit und fand Worte der Dankbarkeit, die dem hohen Werte des Geschenkes entsprachen und den Kollegen die Gewißheit nicht schmälerten, Spender höchster Beglückung zu sein.
Und ein Glücksgefühl, mochte er sich noch so sehr dagegen wehren, saß fortan wirklich in ihm.
Immer wieder ertappte er sich über dem Gedanken: ›Das hätte sie noch erleben müssen!‹
Und als der Weihnachtsabend da war, beschloß er, zu ihrem Grabe zu pilgern und ihr die große Neuigkeit zu erzählen.
Zu voriger Weihnacht hatte er den Friedhof wohlweislich gemieden, denn er war sich klar gewesen, daß er den Erregungen solch einer Stunde nicht gewachsen sein würde.
Jetzt war ein weiteres Jahr darüber verflossen, die zünftige Trauer hatte längst ihr Ende erreicht, und er durfte von sich verlangen, daß er imstande sein würde, die Ekstasen des Schmerzes zu meistern.
Eine Weihnachtsfeier gab es in seinem Hause nicht mehr. Ohne Brigitte wäre sie widersinnig gewesen. Doch als Loni ihn bat, ihrem Jungchen einen Baum anzünden zu dürfen – die Köchin sei eingeweiht und wolle sich gerne beteiligen –, da wagte er nicht, ihr ein Nein zu sagen, und stellte nur die eine Bedingung, daß er nichts zu sehen und zu hören brauche.
Als die Dämmerung kam, verließ er das Haus.
Hätte er geahnt, daß der schwerste Gang seines Lebens vor ihm lag, er wäre daheim geblieben.
In einer Blumenhandlung kaufte er sich ein Tannenbäumchen, mit Lichtern und Flittern geschmückt, nicht mehr als zwei Handspannen hoch, wie es Brigitte den Kindern als Vorgeschmack künftiger Freuden zur Adventszeit zu bringen pflegte, und trug es mit sich zum Friedhof.
Der war leerer als er geglaubt hatte. Nur hier und dort huschte ein Schatten die kahlen Alleen entlang.
Als er ihr Grab – sein Grab – erreicht hatte, war es beinahe finster geworden.
Der Hügel mit dem Obelisken dahinter, dessen Goldschrift gerade noch in mattem Schimmer verschwamm, lag zwischen mannshohen Zypressen in winterlicher Umkleidung da, aber auf die Tannenzweige hatte Loni einen Arm voll Rosen gelegt, und da weiches Nebelwetter herrschte, durfte man sicher sein, daß ihre Ruhestatt über das Fest hin geschmückt bleiben würde.
Nun kam noch das Weihnachtsbäumchen hinzu, das er zu Kopfenden tief in das Erdreich bettete, so daß kein Windstoß ihm etwas anhaben konnte.
Dann machte er sich daran, die Kerzen anzuzünden, aber obwohl die Luft ganz unbewegt schien, so kam doch jedesmal, wenn eines der Flämmchen aufstrahlte, ein unfühlbares Wehen daher und löschte es aus.
Und je länger er sich mühte, umso verzagter wurde er. Schließlich war ihm zumute, als hätte das Schicksal beschlossen, ihm die einzige Freude, die es für ihn auf Erden noch gab, zunichte zu machen.
Und aus der Verzagtheit wurde Verzweiflung. Da unten lag alles, was er besaß, und er konnte ihm nichts Gutes mehr antun – geradesowenig wie er ihm hier oben angetan hatte.
Nun hatte es sich gründlich verflüchtigt, – die einzige Rache, die es zu nehmen imstande gewesen.
Bald waren zwei Jahre verflossen, und noch immer wollte der Gram nicht schweigen. Er würde niemals schweigen, dessen war er heute sicherer denn je. Und niemals mehr würde er mit sich in Ordnung kommen.
Wozu noch länger mit dem Gedanken bloß spielen, den jede Lebensstunde als Ziel und als Forderung aus sich gebar?
Aber was hatte er ihr doch erzählen wollen? Etwas Freudiges gar?
Richtig! Das von der Ausstellung war's. Das sollte ja ihre Weihnachtsbescherung sein.
Oh, man kann viel erzählen hier oben, was man da unten nicht hört!
Nur eines bot Hoffnung: die Gemeinschaft des Staubes, wie wenig sie ihm sonst auch gegolten hatte.
Trotzdem – hier oben gab's noch zu tun. Ohne ihn selber war die geplante Schau verurteilt, Stückwerk zu bleiben. In alten Papieren mußte man kramen, Adressen hervorsuchen, Bittbriefe schreiben, kurzum tagtäglich dem Werk zu Gebote stehen.
Aber – wenn es vollendet war! Wenn die Wände bis zur Deckenspannung gefüllt standen und Bild an Bild in ungeahntem Reichtum Zeugnis ablegte von einem Leben, das – ob in Glück oder Unglück, gleichviel – der Arbeit gehört hatte!
Dann endlich war der Ruhetag gekommen, nach dem er bewußt und unbewußt schon lange verlangte.
Aber dann auch Ernst machen! Nicht für eine einzige Nacht die Last noch weiterschleppen, unter der er jetzt kläglich dahinschlich.
Er kniete vor dem Grabe nieder, preßte das Gesicht gegen die Tannen, und zu seiner Toten hinunter tat er den Schwur, ihr noch an demselben Tage zu folgen, an dem, als Abschluß des Daseins, sein Lebenswerk sich vor ihm ausgebreitet hatte.
Wieviel es wert war, was die Welt dazu sagte, darauf kam's nicht mehr an. Mochte die weiterrasende Zeit es tausendmal mit all ihren Schlacken hinter sich werfen, mochte es für ihn selber nichts weiter sein als ein Zeugnis unaufhaltsamen Niedergangs, der Tod sühnte auch das und brachte Glück des Vergessens.
Taumelnd erhob er sich und schaute wirren Auges umher.
Auf einem Grabmal, nicht ferne dem seinen, stand eine marmorne Frauengestalt, gegen die Schranke sich lehnend, die im Geviert das Erbbegräbnis umschloß. Auf ihrem Antlitz hatte ein verlorener Lichtschein sich niedergelassen, während alles ringsum in Dunkel verkrochen lag.
Wie eine Botin aus dem Reiche Brigittens stand sie da und grüßte lächelnd zu ihm hernieder.
Oder war sie es selber, die sich dies Steingebilde zum Körper gewählt hatte?
»Ich komme, Brigitte, ich komme!« rief er aufweinend und reckte die Arme zu ihr empor.
Da hörte er hinter den Zypressen ein Rascheln, das ihm als Zeichen des Tadels und der Verachtung ins Ohr drang. Gewiß ein Friedhofsgast gleich ihm, der ihn in seiner Unbeherrschtheit belauscht hatte. Und leise machte er sich davon wie ein ertappter Verbrecher.
Ebenso leise glitt er daheim an Attas Zimmer vorbei, in dem Loni mit ihrem Sohn ein kümmerliches Fest beging.
Doch nein, gar so kümmerlich schien es nicht, denn sie lachten und jubelten beide.
Er aber warf sich im Finstern auf sein Bett und döste umnebelt in jenes Traumland hinüber, in dem, angesichts der sorgsam verteilten Gaben Brigitte, glücklich, beglücken zu können, die Glocke schwang.
Auch die traurigsten Weihnachten gehen vorüber, und der Alltag fordert sein Recht.
Auf Steffen Tromholt wartete Arbeit genug, denn nun hieß es, den Abgang vorzubereiten.
Überall stand Angefangenes herum, das nach Fertigmachen verlangte, und wenn man erst die Kabusen durchstöberte, fand man Vergessenes in Menge, das irgend eine Laune in den Winkel gefegt hatte, wo es allmählich verkam.
Das alles zu sichten und – ob in Auswahl auch nur – für den Rahmen brauchbar zu machen, wäre ein Werk von Jahren gewesen. Während ihm, hochgerechnet, nicht mehr als vier Monate noch zu Gebote standen.
Um manches war es wahrhaftig schade. Da fand sich zum Beispiel ein Triptychon, die Herkules- und Dejanirageschichte behandelnd. Er hatte es einst begonnen, ähnlich wie die »Sintflut«, um dem aufgestauten Ingrimm über sein Eheunglück einen Abfluß zu öffnen, als er aber bei Brigittens erstem Besuche aus ihren Zügen herauslas, wie rasch sie seine Stimmung verstand, war es nicht mehr viel weitergediehen. Gerade noch das Gesicht der Heldin hatte er fertiggemacht. In holder Jugendlichkeit leuchtete seines Weibes Abbild ihm daraus entgegen. Und da ja Dejaniras unselige Tat aus lauter Liebe entsprang, so würde seiner Toten kein Unrecht geschehen, wenn er sie hierin noch einmal verkörperte.
Aber woher die Zeit dazu nehmen, zumal, wie er richtig vorausgesehen hatte, der Ausschuß an jedem Tage mit dringlichen Forderungen an ihn herantrat?
Sodann warteten in Kisten und Kasten ungezählte Papiere darauf, von ihm durchsucht und geordnet zu werden. Das meiste mochte ja für das Kaminfeuer reif sein, dazwischen aber fanden sich Schriftstücke, die wertvolle Beiträge zur zeitgenössischen Kunstgeschichte darstellten und denen allein schon um ihrer Schreiber willen ein Weiterleben gesichert sein mußte. Ebenso durften Brigittens Briefe nicht zugrunde gehen und vieles andere, das zum mindesten für Atta von Wichtigkeit war.
Hier lagen Pflichten in Menge, und je weiter der Winter voranschritt, desto wilder wurde seine Geschäftigkeit. Eine Art von Rausch hatte sich seiner bemächtigt, der wie ein Ausfluß gesteigerter Lebensfreude erschien, während er in Wahrheit dem Fieber des Abschieds entstammte. – –
Die ersten Boten des Frühlings meldeten sich. Durch die Tannenzweige auf Brigittens Grabhügel drängten sich Schneeglöckchen hindurch, und in den menschenleeren Räumen seines Heims saß die höhersteigende Sonne so vergnüglich und blank, als könne sie es nicht erwarten, daß eine neue Hausfrau den Glanz der Nachmittagstees wieder erschuf.
Mit wehem Hohn ließ Steffen die Lockungen des großen Werdens an sich herniedergleiten. Ihn ging es nichts mehr an, ihm konnte es nicht einmal das Herz schwer machen.
Und während er in verbissenem Eifer einsam herumhantierte, drang aus dem unteren Stockwerk Lonis Singen tagüber zu ihm empor und erfüllte seine Werkstatt mit widersinnigem Frohsein.
Um Loni war es ihm leid. Sie hatte sich in diesen Jahren zu einem gewandten und einsichtigen Menschenkinde herangebildet. Brigittens Schulung und die spätere Selbständigkeit waren zusammengekommen, um sie hoch über die Rangstufe eines Dienstboten emporzuheben. Zwar hatte er in seinem Testament nach Kräften für sie Sorge getragen und für ihren Knaben nicht minder, aber ins Proletariat würde sie doch wohl hinabsinken müssen, sobald der Halt dieses Hauses ihr genommen war.
Vielleicht, daß man sie Atta ans Herz legen konnte. Doch wo war Atta? Weltenweit – nicht bloß nach Meilenzahl gerechnet – lebte sie ihr eigenes Leben, das nur durch seltene Briefe mit dem seinigen verbunden war. Den alten Platz in seinem Herzen hatte sie wohl nie verloren – mit Zärtlichkeit dachte er ihrer schon um Brigittens willen –, aber allein auf dieser Erde stand er doch, und niemanden gab es, für den er noch auf ihr zu bleiben hatte. – –
Als der April herankam, war er mit seinen Vorbereitungen zu Ende. Den Nachlaß hatte er geordnet, abgeschlossen stand sein Leben vor künftigen Schnüfflern da.
Was an Zeit noch übrig war, sollte den nicht beendeten Bildern gehören. Bald holte er das eine, bald das andere aus den Kabusen hervor und bastelte daran herum, wie Licht und Stimmung es mit sich brachten. Auch Modelle bestellte er, wenn er sie gerade verwerten konnte. Nur an das Brigittengesicht Dejaniras wagte er sich nicht mehr heran.
Ein schmerzlich-seliges Ruhegefühl hatte in seiner Seele die Herrschaft gewonnen, und immer von neuem rief er sich zu: ›Fertig! Fertig mit diesem Leben!‹
Hätte das Warten nur nicht so lange gedauert! Das Schleichen der Tage wurde zur Qual. Und ab und zu entstand die Torschlußpanik daraus, die jeder Sterbenwollende kennt.
Dann brach ihm bei dem Gedanken: › Das soll das Ende sein?‹ die Angst aus sämtlichen Poren. Nicht Angst vor dem Sterben selber, die kannte er nicht. Die Angst vor dem Nicht-mehr-leben-Dürfen vielmehr, die Angst, noch nichts getan, noch nichts von seinem Eigensten der Welt gegeben zu haben.
Doch diese Anfälle gingen vorüber, und die wehe Freude am Ausruhen gewann wieder die Oberhand.
Brigittens Bild stand zu allen Stunden vor seinem Auge. Er führte lange Gespräche mit ihr, beschuldigte sich, beschuldigte sie und verteidigte sie und sich selber.
Mochte die Ehe ihm tausendmal zum Verderben geworden sein, welch mörderische Roheit hätte dazu gehört, die Frau zu opfern, die ihm ihr Alles geopfert hatte!
Hier war die Grenze menschlicher Kraft. Hier fing das Reich der Ohnmacht an, dem man den Namen »Schicksal« zu geben pflegt.
Drum war es das beste, sich in Demut zu beugen vor dem Nicht-mehr-zu-Ändernden und Frieden zu machen mit dem mißratenen Leben, indem man ihm schweigend den Rücken wandte.
Jetzt blieben nur noch zwei Wochen, und dann war alles vorüber. –
Um dieselbe Zeit geschah es, daß er von der Hängekommission gebeten wurde, die Anordnung der eingetroffenen Bilder selbst zu überwachen. Der Zustrom sei so reich, daß es unmöglich scheine, alles unterzubringen, die Auswahl aber verstehe niemand zu treffen als er.
Steffen antwortete: »Macht, was ihr wollt. Ich werde keinen Fuß hineinsetzen, bevor ihr nicht fertig seid.«
Worauf man erwiderte: Da man sich nicht getraue, Arbeiten von Wert auf den Speicher zu stellen, so habe man sich genötigt gesehen, einen weiteren Saal hinzuzunehmen. Man hoffe, er werde mit dieser Lösung zufrieden sein.
Steffen lachte und ließ sie gewähren. Wie schmeichelhaft auch, was tat es ihm noch! An dem eigenen Urteil würde auch die respektvollste Rücksicht nichts ändern.
Drei Tage vor der Eröffnung erhielt er von seinem Nachfolger im Amt einen Brief des folgenden Inhalts: Er und die Kollegen des Vorstands hätten das Bedürfnis, bevor ein profanes Auge auf seinem Lebenswerke geruht habe, es ihm in schlicht-feierlicher Weise vorzuführen, und bäten ihn darum, morgen Nachmittag um vier die Ausstellung besuchen zu wollen. Vor dem großen Portal werde er alsdann seine Freunde zum Willkomm bereit finden.
Sein Herz machte einen Sprung.
Früher, als er erwartet hatte, war der Abschluß gekommen. Ihm schien, als sei noch unendlich vieles zu tun. Aber es war ja alles getan! Die Abschiedsbriefe lagen da. Das Testament war in Ordnung. Nicht einen auf der Welt gab es, dem gegenüber er sich als Schuldner zu fühlen hatte.
Astrid ausgenommen natürlich.
Aber Astrid war allzutief verwoben in die Tragik dieses Geschehens, als daß sie ihm einen Vorwurf machen konnte. Ja, hätte er sich an ein anderes Weib herangedrängt! Oder hätte er die ihm verbliebene Zeit als eigensüchtiger Lebemann auszuschöpfen versucht! So aber hatte sie allen Grund, mit der Erinnerung an ihn in Freundschaft zu leben.
Alles das stand in dem Briefe, der inmitten des weißen Häufleins auf der linken Ecke des Schreibtisches lag. Damit durfte ihr Bild aus seinen Gedanken verschwinden, die einzig und allein Brigitte gehörten.
Die Nacht – die letzte auf Erden! – war ruhig und wohliger Träume voll.
Erst als er erwachend hochschnellte, warf sich ihm ein Druck gegen das Herz. Ähnlich wie damals, als Brigitte oben im Sarge lag.
Nun dauerte es nur noch etliche Stunden, und er weilte für immer bei ihr.
Wenn die kleine Festlichkeit beendet und das Werk seines Lebens an ihm vorübergezogen war, dann – das stand schon längst in ihm fest – würde er zum Kirchhof wandern, um an Brigittens – und der eigenen – Ruhestatt mit sich zu Ende zu kommen. – –
In vorwitziger Fülle, als hätte er bereits der Pfingstzeit gerecht zu werden, verschwendete sich der Frühling. Schon war die Welt ganz grün, und was an Blättern noch im Rückstand schien, wickelte sich in fast sichtbarer Eile aus seiner Knospenrolle. Mitten auf der Straße lärmten die Finken, und von der Wetterfahne des Hofes her machte eine Amsel Skandal.
Steffen sah und hörte das alles, aber wenn ihm das Herz wieder schwer werden wollte, dann brauchte er nur an Brigitte zu denken, die nichts mehr davon hörte und sah, und er war mit seinem Entschlusse wieder im Einklang.
Der Tag floß langsam dahin, denn er hatte ja nichts mehr zu tun.
Bevor er fortging, steckte er seinen Revolver zu sich, den er seit Wochen bereithielt. Denselben Revolver, dessen Kälte ihm einst notdürftigen Schlaf gebracht hatte.
Im hinteren Korridor kam Loni ihm geschäftig entgegen.
Ob der gnä' Herr lange ausbleiben werde und ob er ein Butterbrot mithaben wolle.
»Ich danke dir für alles, mein Kind,« sagte er, nahm ihren Kopf zwischen seine zwei Hände und küßte sie auf die Stirn.
Im Weitergehen gewahrte er noch, wie sie, blutrot geworden, in heller Bestürzung zu ihm emporsah, denn so etwas hatte sich noch niemals ereignet.
›Das Einzige, das mir geblieben ist,‹ sagte er zu sich, und einer gewissen Klausel des Testaments gedenkend: ›Lächerlich, soviel Guttat vergelten zu wollen.‹
Von der Straße her warf er noch einen Blick zu den Fenstern empor, aus denen Brigitte ihm so häufig nachgeschaut hatte, dann machte er sich auf den letzten Weg. Nein doch, noch nicht! Der letzte Weg ging zu Brigitte. –
Das schwärzliche Häuflein dort – von der Farbigkeit etlicher Blumen und Frühlingskleider durchsprenkelt – das waren sie, Männlein und Weiblein, die ihn erwarteten.
Und als er vor ihnen stand und die Hüte sich lüfteten, trat der, der sein Nachfolger war, rasch auf ihn zu und flüsterte: »Kommen Sie! Wir möchten Sie lieber drinnen begrüßen.«
An seiner Seite schritt er von Raum zu Raum, an hämmernden, klebenden, pinselnden Handwerksleuten vorbei, – einige verbeugten sich artig, andere glotzten ihn an, aber alle schienen darum zu wissen – und die kleine Gruppe zottelte hinter ihm drein.
Vor einem rotbraunen Plüschvorhang machte man halt und winkte nach rückwärts, da ein paar aus dem Gefolge sich unterwegs verloren hatten, wahrscheinlich, weil dieses oder jenes ihnen nicht ganz unbekannte Bild sie zum Schauen verlockte.
Ein plötzliches Gefühl der Angst und des Grauens stieg in Steffen empor. –
Bisher hatte er sich treiben lassen, halb wohlgefällig und halb erbittert, von Todessehnsucht gebannt; jetzt packte ihn zum ersten Male das Bewußtsein des Ungeheuerlichen, dem er sich ausgeliefert hatte.
Warum war er nicht daheim geblieben und hatte sich aus der Entfernung feiern lassen, soviel sie nur wollten? Wie die Qual ertragen, wenn das, was er jetzt erblicken sollte, den Stachel des Unwerts noch tiefer in seine Seele trieb?
Und vor allem: falls es ihm mit dem Sterben ernst war – und das war es, weiß Gott! –, was ging ihn dann das alles noch an?
›Kehr um!‹ schrie es in ihm.
Aber das wäre eine Posse geworden. Und da kamen auch die Nachzügler schon.
Der Vorhang rollte zurück und schloß sich hinter den Eintretenden wieder.
Nun erst sah Steffen sich von ausgestreckten Händen umringt, die alle gedrückt und geschüttelt sein wollten. Ein rasch gebildeter Halbkreis schob sich zwischen ihn und die Bilderfluchten, die jenseits der nächsten Türöffnung im Endlosen verschwammen.
Sein Nachfolger räusperte sich, und während Worte der Lobhudlung, wie sie sonst nur bei Leichenfeiern dem Munde eines Kollegen entquellen, gleich schmerzhaften Fanfarenklängen sein Ohr belagerten, irrten die Augen über die Köpfe der Umstehenden hinweg in fiebriger Suche die Wände entlang.
Aber da war nichts als ein Schillern und Flimmern und mißtönige Flecke, von dem Gold der Rahmen umprunkt. Nirgends ein Ausruhen, nirgends ein Wiedersehen.
Blödsichtig stierte er in die Weite.
Doch wie er, um all dem Gespenstischen zu entrinnen, den Blick zur Seite wandte, sah er plötzlich etwas Liebes, von alters her Vertrautes und doch längst Fremdgewordenes ganz nahe vor sich.
Die »Winterschlacht« war's, die er seit seiner Jugend nicht mehr erblickt hatte.
Und zugleich hörte er die Stimme Brigittens, wie sie ihm das Bild geschildert hatte, als sie beide – noch unverlobt – durch den Strandwald gewandert waren.
Wie seltsam, unglaubhaft fast! Jedes ihrer Worte wurde lebendig über Jahrzehnte hinweg: »Freund und Feind zusammengekrochen, um einander zu wärmen, – wie sie ein Feuerchen anmachen wollten, das der Sturm stets wieder verlöschte – und wie ein zerschossener Preuße einen sterbenden Österreicher auf seinem Schoße hielt, dem er, da er nichts weiter für ihn tun konnte, seinen warmen Atem gegen die erstarrenden Hände blies.«
Ja, da war's! Gerade so! Genau so! Wie tief hatte sie sich davon erschüttern lassen, lange bevor er selbst in ihr Leben getreten war, und hatte doch nichts weiter als einen armen Holzschnitt gekannt.
Um die Tränen nicht zu zeigen, die er emporschießen fühlte, sah er sich nach einer Möglichkeit um, die Flucht zu ergreifen. Vergebens. Nirgends bot sich ein Ausweg.
Der Redner aber glaubte, die Ergriffenheit des Gefeierten sei durch die Schönheit seiner Worte erzeugt, und da Rührung bekanntlich ansteckt, so holte er sein Taschentuch vor und schneuzte sich schamhaft hinein.
Auch andere Taschentücher zeigten sich in der Runde, und ein Duft von »Chypre« und »Quelques Fleurs« wehte wie ein Opfergerüchlein gen Himmel.
Der Redner schloß mit einem kräftigen Seitensprung gegen die revolutionierende Jugend und einem nicht minder kräftigen Händeschütteln, das sich reihum zehn- bis fünfzehnmal wiederholte. Gleichzeitig streckten die Frauen dem Gefeierten die bereitgehaltenen Blumen entgegen, und da deren zu viele waren, als daß er sie hätte auf den Arm nehmen können, so wurden sie einem Saaldiener anvertraut, der sie bis auf weiteres treulich bewachte.
Steffen sprach rasch ein paar Worte üblichen Dankes, und hierauf begann der Rundgang.
Bild reihte sich an Bild. Saal reihte sich an Saal. Jeder gefüllt bis zur Decke. Kaum eines Fingers Breite zwischen den Rahmen.
›Das soll ich alles gemacht haben?' fragte sich Steffen.
Und wieder zeigte sich das Flirren und Flimmern, nur stärker als vorhin, so daß er fürchten mußte, sein Bewußtsein beginne sich damit zu trüben. Schließlich sah er nur noch Sonnen und Monde.
»Wenn ich mich – einen Augenblick – setzen darf,« stammelte er.
Sie fühlten ihm nach: Das Glück, das ihm heute von ihnen bereitet wurde, war viel zu groß, um von einem Sterblichen mit Fassung ertragen zu werden.
Und während sie ihn sorglich zu einem Stuhle geleiteten, sprachen sie bunt durcheinander: »Ruhen Sie sich hübsch aus, Kollege! … Uns würd' es genau so gehen! … Wir wollen nur dies und das noch den Damen zeigen … Und dann verschwinden wir ganz geräuschlos.«
Noch einmal gab's ein Dutzend Hände zu schütteln, und dann war er allein.
Allein mit Brigitte.
Denn ihr Geist schwebte über dem allem.
Je mehr er sich wieder zu sammeln vermochte, je schärfer sich dieses oder jenes Bild ins Auge fassen ließ, desto klarer in ihrer Körperlichkeit, desto leuchtender in ihrem Seelenleben stand sie vor ihm.
Das war kein bloßes Trugbild mehr. Leibhaftig stand sie da und lächelte und sprach, und jedes ihrer Worte fand Widerhall und hatte Bedeutung.
Zu loben verstand sie immer. Denn Lob brauchte er, das wußte sie. Lob war ihm, was Herbstregen der aufgehenden Saat ist. Und was sie zu tadeln hatte, das war so klüglich verborgen in zögernden Fragen und stutzigen Blicken, daß es ihn niemals kränken oder entmutigen konnte, daß es ihm nur Stoff zum Nachdenken gab, woraus dann von selber die Erkenntnis erwuchs, daß hier ein Fehler steckte, der sich beseitigen ließ.
Und wie er nun aufstand und in langsamem Forschen die Wände entlangschritt, da ging sie immer mit ihm.
Zu diesem Bilde hatte sie das gesagt, zu jenem das. Ein jedes war so und nicht anders entstanden, weil ihr Auge darauf geruht, ihr Wort es gesegnet hatte.
O Gott! Da hing ja das »Frühlingsopfer«! Auch das »Frühlingsopfer« war da!
Und vor seinen Sinnen erstand jener Abend in Venedig, als ihm durch sie erst klar werden mußte, was er recht eigentlich damit gewollt und dargetan hatte.
Und dort die Herbstlandschaften, die er gleich nach der Hochzeit aus Trotz und Verzagtheit heraus auf die Leinwand gekleckst hatte. Wie ihm da zum erstenmal durch ihren fragenden Blick kund wurde, daß es ein Ludern nicht gab, solange sie als Warnerin an seiner Seite daherschritt.
Und dann, als die Jahre weiterrückten! Das dort und das!
O nein doch! Ein Rückschritt war das nicht! Im Gegenteil! Wenn Kunst nun einmal von Können herkommt, das war gekonnt. Und das auch. Und jenes erst recht!
Heute, da er diesem fernen Schaffen ganz sachgemäß, ganz unparteiisch gegenüberstand, durfte er sich ein Urteil anmaßen, geradeso, wie wenn er als Fremder hereingeschneit wäre.
Und dieses Urteil – ohne Selbsttäuschung und Größenwahn – konnte nur günstig ausfallen. Wenn dies ein Kollege ausgestellt hätte, er würde nichts anderes vermocht haben, als ihm voll Anerkennung die Hand zu drücken.
Doch nun weiter, immer weiter – dem Heute entgegen!
Hier war der »Badestrand« und dort die Blumenstücke. Alles kurz vor dem Kriege entstanden.
Blumen waren ja gar nicht sein Fach. ›Aber sieh mal an! So konnte ich Blumen malen!‹ Ganz ordentlich. Gar nicht so schlecht. Eine Nummer zu lebhaft vielleicht, aber das lag ja wohl in der Zeit.
Und jenes Strandbild gar mit den in der Brandung sich wälzenden Leibern! Mit der kalten Lamain war es gemacht, nur um eine Zufallsimpression sich nicht verflüchtigen zu lassen.
Aber wenn man das konnte, dann hätte man die »Sintflut« vielleicht gar nicht zu zerschneiden gebraucht! Mit dem neuen gewachsenen Können wäre sicher noch was draus geworden.
Ja, wenn dies Können wirklich gewachsen war – um Gottes willen, was als Folge ergab sich dann?
Dann war ja all sein Kleinmut ein Unsinn gewesen, dann hatte das widrige Schicksal ihm kein Verderben gebracht. Aus allen Nöten, allem Jammer war er vielleicht nur noch stärker hervorgegangen. Und Brigitte, Brigitte hatte ihm nicht bloß ein Segen sein wollen, sie war ihm auch wirklich ein Segen gewesen.
Sein Segen, sein Stern, seine Muse!
Ach so oft hatte er »Muse« zu ihr gesagt, aber immer nur spottend, ja höhnisch vielleicht gar! Und nun ergab sich's, daß sie den Namen genau so verdiente, als wäre sie eine himmelentstiegene, ewig strahlende Schönheit und nicht bloß sein in Mitleid geliebter alter Hausgeist gewesen. –
Um Gottes willen! Nicht losschluchzen! Nicht in die Kniee brechen!
Dort am Eingang, die Blumensträuße bewachend, stand ja der Diener.
Richtig, die Blumensträuße! Die gehörten zu ihr! Die gehörten aufs Grab!
Und auf ihr Grab gehörte auch er.
Aber nicht zum Sterben! Nein, sich darüber hinzuwerfen und, das Gesicht in der Erde verborgen, zu weinen, zu weinen, die Seele sich aus dem Leibe zu weinen in Glück und in Dank und in Liebe.
Und hatte er tausendmal geschworen, ihr heute zu folgen, wenn sie es wüßte, ach, wie würde sie ihn ausgelacht haben!
»Mein dummes Steffichen!« würde sie gesagt haben. Ach, und das würde sehr gut tun!
Zugleich schoß blitzschnell der Plan für ein künftiges Leben ihm durch das Hirn: Lonis Sohn – Brigittens Enkel – würde er zu sich ins Haus nehmen und erziehen als sein eigen. Damit würde auch Loni wie eine Tochter zu ihm gehören und er würde nicht mehr allein sein.
Vielleicht kam auch Atta einmal zurück.
Auf alle Fälle: Die Arbeit war da. Dejanira trug ihre Züge; dies sollte das erste sein, das zur Vollendung gedieh.
Und vieles konnte noch folgen.
Über allem aber wachte sie, wie sie im Leben gewacht hatte.
Lächelnd in jeder Bedrängnis, geduckt, geduldet, betrogen, – immer war sie die Siegerin geblieben.
Und so siegte sie jetzt noch vom Grabe aus über den Tod.